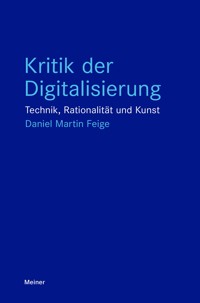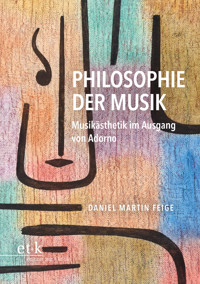13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Spätestens mit Beginn des neuen Jahrtausends hat sich das Computerspiel gesellschaftlich als relevantes ästhetisches Medium durchgesetzt. Mit seiner zunehmenden Anerkennung als ästhetisches und künstlerisches Phänomen stellt sich auch die Frage nach seinen diesbezüglichen Eigenarten. Das vorliegende Buch klärt in philosophischer Perspektive Begriff, Ästhetik und Kunstcharakter des Computerspiels. Dabei lässt es sich von der Annahme leiten, dass die Konturen ästhetischer Medien beständig neuverhandelt werden. Die Lektion des Buches lautet somit, dass derjenige, der sich mit der Ästhetik des Computerspiels befasst, auch über die Ästhetik anderer Medien und Künste nachdenken muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Spätestens mit Beginn des neuen Jahrtausends hat sich das Computerspiel gesellschaftlich als relevantes ästhetisches Medium durchgesetzt. Mit dieser Anerkennung als ästhetisches und künstlerisches Phänomen stellt sich allerdings auch die Frage nach seinen diesbezüglichen Eigenarten. Daniel Martin Feiges neues Buch klärt in philosophischer Perspektive Begriff, Ästhetik und Kunstcharakter des Computerspiels. Dabei lässt es sich von der Annahme leiten, dass die Konturen ästhetischer Medien beständig neu verhandelt werden. Wer sich mit der Ästhetik des Computerspiels befasst, muss zugleich auch über die Ästhetik anderer Medien und Künste nachdenken.
Daniel Martin Feige ist Juniorprofessor für Philosophie und Ästhetik unter besonderer Berücksichtigung des Designs an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Letzte Veröffentlichung im Suhrkamp Verlag: Philosophie des Jazz (stw 2096).
Daniel Martin Feige
Computerspiele
Eine Ästhetik
Suhrkamp
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2160
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
eISBN 978-3-518-74215-0
www.suhrkamp.de
Inhalt
Danksagung
Kapitel 1 Einleitung
Das Computerspiel als Gegenstand der Ästhetik und Kunstphilosophie
Eine kurze Geschichte des Computerspiels
Kapitel 2 Zur Bestimmung des Wesens des Computerspiels
Falsche Alternativen
Jenseits der Definition?
Das Wesen als Entwicklung bestimmter Unbestimmtheit
Kapitel 3 Das Computerspiel als ästhetisches Medium
Die Irreduzibilität des Ästhetischen
Zur Praxeologie des Medialen
Ästhetische Valenzen des Computerspiels
Kapitel 4 Das Computerspiel als Kunst
Kunst als Reflexionsgeschehen
Der Streit um die Kunst
Computerspielen als Durchspielen des Selbst
Kapitel 5 Schluss
Dialektik oder: Zur philosophischen Geste dieses Buchs
Literaturverzeichnis
Gameography
Namenregister
Für Helene
Danksagung
Dieses Buch zur Ästhetik des Computerspiels wäre ohne intensiven Austausch mit einer Vielzahl von Freunden und Kollegen nicht entstanden. Einigen, die in besonderer Weise explizit oder implizit zu seiner Fertigstellung und finalen Gestalt beigetragen haben, möchte ich an dieser Stelle danken. Dank gilt zunächst meinen philosophischen Lehrern Martin Seel und Georg W. Bertram, die in jeweils unterschiedlicher Weise meine Interessen in der Ästhetik und Kunstphilosophie nachhaltig geprägt haben. Ihnen verdankt sich unendlich vieles in diesem Buch auch dann, wenn die Thesen und der Stil nicht die ihren sind. Markus Rautzenberg danke ich nicht allein für zahlreiche hilfreiche Diskussionen zu Fragen einer Philosophie des Computerspiels, sondern auch für seine Kommentare zum Manuskript sowohl aus philosophischer Perspektive als auch aus der Perspektive der Game Studies, wovon es sehr profitiert hat. Dank gilt außerdem Thomas Hensel, der den dritten Abschnitt des zweiten Kapitels sehr hilfreich kommentiert hat. Weiterhin danke ich dem Suhrkamp Verlag und vor allem Philipp Hölzing für das Vertrauen in das Projekt, die freundliche Betreuung und nicht zuletzt für zahlreiche Anmerkungen zum Manuskript. Das vorliegende Buch ist im Rahmen meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich 626 »Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste« an der Freien Universität Berlin entstanden. Dank gilt nicht nur der DFG für die Ermöglichung eines derartigen Forschungsprojekts, sondern auch den Mitgliedern des Sonderforschungsbereichs und hier vor allem der Sprecherin Gertrud Koch und dem Geschäftsführer Michael Lüthy, die in den fünf Jahren, die ich am Sonderforschungsbereich beschäftigt war, maßgeblich an der Konstitution eines Umfeldes beteiligt waren, wie man es sich in wissenschaftlicher Hinsicht nicht produktiver und in persönlicher Hinsicht nicht freundlicher wünschen könnte. Aus dem Kreis meiner direkten Kollegen an der Freien Universität Berlin möchte ich vor allem Fabian Börchers und Frank Ruda danken: die langjährigen Diskussionen, die mich mit beiden verbinden, haben unübersehbar ihre Spuren in diesem Buch hinterlassen.
Kapitel 1Einleitung
Das Computerspiel als Gegenstand der Ästhetik und Kunstphilosophie
Computerspiele sind zu einem weltweit verbreiteten Phänomen geworden. Beim Erscheinen einer neuen Spielkonsole stehen Menschen in vielen Ländern vor den Geschäften Schlange, lange bevor diese öffnen; in Südkorea füllen Virtuosen des Computerspiels ganze Stadien mit Zuschauern wie hierzulande nur beim Fußball; und die Ankündigungen von Fortsetzungen etablierter Spieleserien geraten heute zu Großereignissen auf Messen und im Internet. Nicht zuletzt dringt die Computerspieleindustrie mittlerweile in Umsatzregionen vor, die ehedem nur der Musik- und Filmindustrie vorbehalten waren. Computerspiele sind im Mainstream angekommen und bilden einen integralen Bestandteil der Alltagskultur. Wurde bis vor einigen Jahren von konservativen Mahnern und Vertretern des kulturellen Establishments noch vor der Schädlichkeit von Computerspielen gewarnt, sind solche Stimmen heute weitestgehend verstummt.[1] Man macht es sich aber zu einfach, wenn man darin nur einen Ausdruck der Macht des Faktischen sieht. Mit Computerspielen ist ein neues ästhetisches Medium entstanden – und die Geburt ästhetischer Medien ist seit jeher von kritischen Stimmen begleitet worden, denen der kulturelle Wandel, der mit diesen Medien einhergeht, nicht geheuer war. Schon bei der Erfindung der Fotografie und des Films wurde der Untergang des Abendlandes ausgerufen.[2] Natürlich lässt sich aus dieser Beobachtung nicht schon eine Apologie des Computerspiels stricken. Damit würde man einer Gleichsetzung des Ungleichen das Wort reden, insofern historische Genesen unterschiedlicher ästhetischer Medien keineswegs bloße Variationen eines letztlich identischen Vorgangs sind. Eine Analogisierung kann aber zumindest den Blick dafür schärfen, kritische Reaktionen gegenüber Computerspielen vorgängig ins rechte Licht zu rücken und sich von pauschalen Verurteilungen dieses Mediums freizumachen, wie sie etwa für die unsägliche, weil von jeglicher Kenntnis des Gegenstands freie Diskussion um so genannte »Killerspiele« charakteristisch sind. Es kann, kurz gesagt, nicht darum gehen, das Computerspiel als solches und das heißt alle Computerspiele entweder als Ausdruck einer defekten Lebensform oder als wertvoll anzusehen. Denn offensichtlich sind Computerspiele sehr unterschiedlich und können zudem in ausgesprochen unterschiedlichen Hinsichten als misslungen oder gelungen, als förderlich oder schädlich angesehen werden.
Im Lichte ihrer steigenden gesellschaftlichen Relevanz sind Computerspiele seit geraumer Zeit auch zum Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzungen geworden. Unter dem Etikett der Game Studies gibt es eine ebenso junge wie heterogene Disziplin, die sich der Erforschung des Computerspiels verschrieben hat.[3] Obwohl sich in den Game Studies mittlerweile eine Reihe umfassender Diskussionskontexte etabliert haben, sind sie nach wie vor eher ein Sammelbecken unterschiedlicher theoretischer wie empirischer Perspektiven, die scheinbar nur durch den Gegenstand, den sie in den Blick nehmen, verbunden sind; soziologische Studien finden sich neben mediengeschichtlichen Rekonstruktionen, pädagogische Untersuchungen neben ästhetischen Erwägungen. Letztlich steht mit diesen unterschiedlichen Perspektiven aber der scheinbar geteilte Gegenstand selbst auf dem Spiel. Man kann sagen, dass der Gegenstand in den Game Studies von unterschiedlichen theoretischen wie empirischen Beschreibungen aus erschlossen wird und dass das Feld der Game Studies von einem Pluralismus solcher Beschreibungen geprägt ist. Das Vorliegen eines solchen Beschreibungspluralismus ist sicherlich auch Ausdruck der Tatsache, dass es sich bei der entsprechenden Disziplin wie auch ihrem Gegenstand um ein recht junges Phänomen handelt. Es ist jedoch wichtig, festzuhalten, dass ein derartiger Pluralismus der Beschreibungen nicht schon per se etwas Wünschenswertes ist – auch wenn er das zumindest insofern ist, als Computerspiele sehr unterschiedlich und beständig in Veränderung begriffen sind. Aus zwei Gründen lässt sich gleichwohl einsehen, dass der Gedanke, dass man einen Gegenstand umso besser beschrieben hat, je mehr unterschiedliche Beschreibungen man von ihm generiert, unzutreffend ist. Erstens ist nicht jede mögliche Beschreibungsperspektive eine Bereicherung des Verständnisses des entsprechenden Gegenstands. Auch dann, wenn in einer Wissenschaft zuallererst um eine Bestimmung ihres Gegenstands gerungen wird, ist es nicht so, dass tatsächlich alle Beschreibungen solche des entsprechenden Gegenstands selbst sind. Wer etwa durch eine physikalische Beschreibung des Spielers im Akt des Spielens herauszufinden meint, was Computerspiele in Wirklichkeit sind, macht sich eines Kategorienfehlers schuldig. In jedem Fall verwechselt man, wenn man jede vorgelegte Beschreibung eines Gegenstandes begrüßt, die Qualität von Beschreibungen mit ihrer Quantität. Zweitens kann ein derartiger Beschreibungspluralismus keineswegs so harmonisch verstanden werden, wie er sich im Rahmen eines solch quantitativen Verständnisses geriert. Mag auch eine unter Rückgriff auf soziologische Methoden vorgenommene empirische Erkundung des Sozialverhaltens bei Lan-Partys, das heißt beim gemeinsamen Spielen in einem Raum mit untereinander verbundenen Computern, sich nicht mit einer filmwissenschaftlichen Beschreibung der audiovisuellen Eigenarten bestimmter Spiele beißen – die Beschreibung des Computerspiels in Begriffen der Tätigkeit des Spielens und die Beschreibung des Computerspiels in Begriffen der interaktiven Erzählung sind Beschreibungen, die sich in bestimmten Hinsichten durchaus widersprechen und keineswegs derart additiv nebeneinanderstehen können.[4] Die Game Studies sollten somit im Sinne eines Streits um eine angemessene Beschreibung des Computerspiels verstanden werden.
Dass das vorliegende Buch keineswegs zu allen oder auch nur den meisten der mittlerweile durchaus verzweigten Diskussionen der Game Studies Stellung bezieht und sich ihnen, wenn überhaupt, eher von der Seite nähert, liegt an dem Ziel, das es verfolgt. Dieses Ziel besteht in einer philosophischen Analyse der ästhetischen Eigenarten des Computerspiels. Das Buch unternimmt somit den Versuch, aus der Perspektive der philosophischen Ästhetik zu explizieren, was für Computerspiele wesentlich ist. In diesem Sinne konkurriert oder konvergiert es in seinen Thesen nur dort mit Beiträgen der Game Studies, wo diese explizit oder implizit als philosophische Thesen zu Fragen der Ästhetik oder Kunstphilosophie gelesen werden können. Das wirft die Frage auf, was eine philosophische Beschäftigung mit Computerspielen von anderen Arten der Beschäftigung mit Computerspielen und damit auch von denjenigen Beiträgen der Game Studies, die keine philosophischen Thesen entwickeln, unterscheidet. Die Antwort darauf lautet kurz und bündig: Einer philosophischen Analyse des Computerspiels in seiner ästhetischen Eigenart geht es um eine reflexive Klärung der für unser Verständnis dieser ästhetischen Eigenart unverzichtbaren Grundbegriffe. In diesem Sinne ist die bereits erwähnte Kontroverse zwischen Deutungen, die Computerspiele primär in Begriffen der Tätigkeit des Spielens erläutern, und Deutungen, die Computerspiele primär in Begriffen interaktiver Erzählungen verstehen, durchaus eine philosophisch relevante Kontroverse. Denn es scheint bei ihr darum zu gehen, was Computerspiele im Kern sind. Die Frage hingegen, was für die sozialen Interaktionen bei Multiplayerspielen übers Internet oder im Fall der leiblichen Ko-Präsenz bei Lan-Partys relevant ist, ist dort richtig aufgehoben, wo sie ohnehin in weiten Teilen bereits diskutiert wird: in der Soziologie. Die Frage, ob der exzessive tägliche Konsum von Computerspielen einen schädlichen Einfluss auf die kognitive und soziale Entwicklung von Kindern hat, ist ebenfalls dort am besten aufgehoben, wo sie ohnehin diskutiert wird: in der Pädagogik und Psychologie. Auch wenn die Grenzen keineswegs bei allen Fragen so deutlich liegen mögen – bei der Frage der Schädlichkeit des exzessiven Konsums von Computerspielen könnte man zum Beispiel die Rückfrage stellen, warum so etwas nicht auch beim exzessiven Konsum von Romanen oder von Musik untersucht wird und ob eine Vorentscheidung in dieser Frage nicht subkutan eine bestimmte problematische medien- und kulturpolitische Agenda kolportiert: Die Tatsache, dass das vorliegende Buch zu vielen derartigen Fragen schweigt, ist keineswegs Ausdruck einer Borniertheit oder Ignoranz, sondern vielmehr der Tatsache geschuldet, dass die Philosophie zu solchen Fragen schlichtweg gar keine Auskunft geben kann, weil sie nicht in der Reichweite ihrer theoretischen Mittel liegen. Kurz gesagt: Bei solchen Fragen ist die Philosophie letztlich gar kein kompetenter Diskussionspartner und lässt sich bereitwillig von anderen Disziplinen belehren. Ebenso steht es um Fragen der technologischen Entwicklung des Computerspiels oder Fragen einer Kulturgeschichte des Computerspiels – solche Fragen können und sollen nicht von Philosophen beantwortet werden, sondern vielmehr von Medienhistorikern und Medientheoretikern, und sie werden bereits im Rahmen der Game Studies in produktiver Weise behandelt. Selbst noch die Frage, ob ein bestimmtes Computerspiel ästhetisch gelungen oder misslungen ist, ist keine Frage, die die Philosophie beantworten kann, auch wenn sie sich mit ästhetischem Gelingen beschäftigt: Die Philosophie klärt auf, was wir mit dem Begriff ästhetischen Gelingens überhaupt meinen, nicht aber, ob ein spezifisches Spiel ästhetisch gelungen ist oder nicht. Denn letztere Frage ist eine Frage, bei der der Philosoph in prinzipiell keiner anderen Lage ist als jeder andere ästhetisch aufmerksame Teilnehmer der Praxis des Computerspielens. Wenn in diesem Buch dennoch Urteile über die ästhetische Gelungenheit oder Misslungenheit gefällt werden, so sind diese Urteile prinzipiell verhandelbar, und mit ihnen steht und fällt nicht schon die zugrundeliegende philosophische Theorie – auch wenn das, wie wir noch sehen werden, keineswegs für eine subjektivistische Auffassung solcher Urteile spricht. Mit Blick auf die These, dass eine philosophische Aufklärung ästhetischen Gelingens eine Aufklärung dessen ist, was wir mit dem Begriff des ästhetischen Gelingens meinen, lässt sich ein Vergleich zur philosophischen Ethik ziehen: Die Moralphilosophie ist keine Instanz zur Besserung der Menschen, sondern vielmehr ein Bereich der praktischen Philosophie, der sich mit der Frage beschäftigt, was genau es heißt, dass wir Lebewesen sind, die für moralische Ansprüche prinzipiell ansprechbar sind und sein sollten. Wer meint, alltägliche moralische Probleme durch eine Lektüre von Kants Texten zur praktischen Philosophie lösen zu können, verwechselt dessen Texte mit einer bestimmten Form erbaulicher Literatur.
Mit der Erläuterung, dass im Folgenden die ästhetischen Eigenarten des Computerspiels in den Blick genommen werden, ist bereits eine Spezifizierung der philosophischen Perspektive angegeben, die hier verfolgt wird. Computerspiele werden in diesem Buch aus der Sicht der philosophischen Ästhetik und Kunsttheorie betrachtet. Um die Sache zu verkomplizieren, muss man festhalten, dass die Analyse dessen, was ästhetische Phänomene sind, und die Analyse dessen, was Kunstwerke sind, letztlich zwei verschiedene Projekte sind: Die Kunst ist kein Sonderfall des Ästhetischen; durch eine Analyse ästhetischer Phänomene hat man nicht schon etwas zur Analyse der Kunst beigetragen.[5] In anderer Weise kann man, wenn man den Begriff der Ästhetik für die Kunst beibehalten wollte, auch sagen: Die Ästhetik der Kunst ist nicht die Ästhetik außerkünstlerischer Objekte und Ereignisse. Wenn im Titel dieses Buchs nur von einer Ästhetik des Computerspiels die Rede ist, so ist das nicht bloß ästhetischen Gründen geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass unser eingespielter Sprachgebrauch keine terminologische Vorentscheidung nahelegt; die Unterscheidung zwischen ästhetischen Phänomenen und künstlerischen Gegenständen ist eine Unterscheidung innerhalb einer philosophischen Debatte und keine, die allein unter Rekurs auf die mannigfaltigen Verwendungsweisen der Begriffe Ästhetik und Kunst im Alltag zu beantworten wäre. Es scheint mir deshalb sinnvoll, in gebotener Kürze einleitend etwas dazu zu sagen, worum es in der philosophischen Ästhetik und Kunsttheorie jeweils geht – Erläuterungen, die im Verlauf des Buchs noch deutlicher Kontur gewinnen werden. Beschäftigt sich die philosophische Ästhetik anhand des Leitbegriffs der ästhetischen Erfahrung mit der Art und Weise,[6] wie sich beliebige Objekte und Ereignisse der Welt unserem sinnlichen Vernehmen im Sinne einer gesteigerten Aufmerksamkeit vor allem für ihre phänomenalen Aspekte präsentieren, so beschäftigt sich die philosophische Kunsttheorie allein mit der Eigenart solcher Gegenstände, die Kunstwerke sind. Die Ästhetik als Theorie der ästhetischen Erfahrung macht keinen Unterschied zwischen Naturgegenständen und Artefakten, denn es geht ihr um ästhetische Erfahrung überhaupt. Die Kunst ist jedoch, anders als man denken könnte, nicht einfach ein besonderer Gegenstand einer am Leitfaden der ästhetischen Erfahrung explizierten philosophischen Ästhetik. Versucht man, Kunst anhand des Leitbegriffs der ästhetischen Erfahrung im eben spezifizierten Sinne zu analysieren, so gerät man in eher unerquickliche Meditationen darüber, was ein Waldspaziergang und eine verzierte Kommode von einer Improvisation John Coltranes und einem Spielfilm Jean-Luc Godards unterscheidet; die philosophische Fachliteratur ist voll von subtilen Diskussionen dieser Art.[7] Das zeigt meines Erachtens aber weniger die Schwierigkeit des Problems als vielmehr, dass hier bereits vorgängig die falsche Frage gestellt worden ist. Denn eine solche Frage missversteht Kunsterfahrungen als Sonderfall ästhetischer Erfahrungen und übersieht den kategorialen Unterschied, der eigentlich zwischen ihnen besteht. Anders gesagt: Zwar kann man sich vielen Kunstwerken mit Blick auf ihre phänomenale Fülle hingeben – aber wenn man sich bloß dieser Fülle hingibt, behandelt man sie nicht länger als Kunstwerke. Und selbst in dem Fall, in dem die für ein Kunstwerk relevanten Aspekte keine anderen sind als die sinnlich vernehmbaren Aspekte des entsprechenden Gegenstandes, gewinnen sie in der Kunst eine andere Form als im Ästhetischen. Geht es in der Ästhetik um ästhetische Erfahrungen, verstanden als Erfahrung der Art und Weise, wie sich uns Objekte und Ereignisse vor allem in ihrer phänomenalen Fülle präsentieren, und damit in irgendeiner Weise immer auch um eine spezifisch sinnliche Erfahrung,[8] geht es in der Kunst um eine kategorial andere Art von Erfahrung, nämlich eine spezifische Erfahrung von Sinn. Spezifisch ist diese Erfahrung von Sinn, weil sie eine Erfahrung eines irreduzibel verkörperten Sinns im Sinne der Form des künstlerischen Gegenstands ist. Und eine solche Form ist niemals nur die Sache eines sinnlichen Vernehmens, sondern immer eine Sache eines kunstspezifischen Verstehens. An einem Sonnenaufgang kann man demgegenüber nichts in der hier relevanten Hinsicht verstehen;[9] man kann ihn nur in seiner phänomenalen Fülle vernehmen. Und auch dann, wenn man ein ästhetisch gestaltetes Artefakt, das kein Kunstwerk ist, in bestimmter Weise verstehen muss – etwa in dem Sinne, dass es sich hier um einen Gegenstand handelt, dessen Witz es ist, sich in seiner phänomenalen Fülle darzubieten –, ist es nicht so, dass es sich bei einem solchen Verstehen schon um ein Verstehen eines Kunstwerks handeln würde. Ist dieser Gegenstand ein ästhetisches Artefakt, aber kein Kunstwerk, sind seine ästhetischen Valenzen solche eines ästhetischen Vernehmens und keine eines kunstspezifischen Verstehens. Zweifelsohne sind ästhetische Phänomene genauso wie Kunstwerke etwas, das ausgehend von Möglichkeiten seiner Erfahrbarkeit erläutert werden muss. Eine Kunsterfahrung ist aber eine gänzlich andere Art von Erfahrung als eine ästhetische Erfahrung, bei der wir uns der phänomenalen Fülle der entsprechenden Phänomene hingeben. Eine Erfahrung mit einem Kunstwerk zu machen heißt, dass wir uns im Nachvollzug der Form des Kunstwerks von diesem bestimmen lassen. Es gibt hier somit zwei unterschiedliche Formen der Erfahrung. Diese Formen artikulieren sich auch in der unterschiedlichen Rolle, die das Begriffliche in solchen Erfahrungen spielt. Den Unterschied zwischen einer ästhetischen Erfahrung und einer Kunsterfahrung darf man jedoch nicht so beschreiben, dass die ästhetische Erfahrung sich im Gegensatz zur Kunsterfahrung auf etwas Nichtbegriffliches, bloß Gegebenes beziehen würde, denn auch in der ästhetischen Erfahrung sind Begriffe im Spiel. Noch unser scheinbar unbelecktes Sehen ist ein Sehen von etwas als etwas und so zu erläutern, dass in der sinnlichen Anschauung unsere begrifflichen Vermögen passiv affiziert werden.[10] Für die ästhetische Erfahrung ist gleichwohl charakteristisch, dass es ihr nicht um eine Fixierung und Bestimmung dieses Etwas geht, sondern sie bei der Mannigfaltigkeit verweilt, in der sich uns die Objekte und Ereignisse der Welt phänomenal präsentieren – und damit auch bei der Möglichkeit ihrer potenziell unendlichen Bestimmbarkeit.[11] In der Erfahrung von Kunstwerken hingegen sind nicht bloß unsere begrifflichen Vermögen im Spiel, sondern was hier erfahren wird, ist selbst etwas, was sich als verkörperter Begriff bestimmen lässt.[12] Nicht allein hinsichtlich des Erfahrungsbegriffs und der Rolle des Begrifflichen muss zwischen Kunsterfahrungen und ästhetischen Erfahrungen unterschieden werden. Auch das, was an diesen Erfahrungen für uns lohnend ist oder, wie man anders auch sagen könnte, was der Witz oder die Pointe dieser Erfahrungen ist, ist jeweils zu unterscheiden: Geht es in der ästhetischen Erfahrung um eine Aufmerksamkeit für die Art und Weise, wie sich die Welt uns sinnlich darbietet, und damit um die Lust an einer sich selbst reproduzierenden Wahrnehmung, besteht eine Kunsterfahrung wesentlich darin, dem Ereignis ästhetischen Gelingens in unserem Selbst- und Weltverhältnis gerecht zu werden. Kurz gesagt: Ästhetik und Kunst kennzeichnen kategorial getrennte Formen und gehören logisch in verschiedene Register von Praktiken.[13]
Der Begriff des Computerspiels ist ebenso wie Begriffe wie Film, Fotografie, Musik, Malerei, Tanz und Theater zunächst einmal neutral gegenüber der eben markierten Unterscheidung zwischen Ästhetik und Kunsttheorie, auch wenn wir etwa Musik und Malerei häufig »Künste« nennen. Es ist nämlich offensichtlich so, dass keineswegs alle Fotografien, Filme, Musikstücke, Gemälde und Tänze und selbst Theateraufführungen künstlerische Gegenstände sind, auch wenn es sich hier durchweg um Phänomene handelt, die man als ästhetische Phänomene würdigen kann. Man kann deshalb davon sprechen, dass Computerspiel, Film, Fotografie, Musik, Malerei, Tanz usw. als ästhetische Medien charakterisiert werden können. Computerspiele sind wie Film, Fotografie und Tanz zumindest in dem Sinne wohl unstrittig ein ästhetisches Medium, dass es einer Aufmerksamkeit für ihre visuellen, auditiven und – etwa im Sinne der Interfaces, das heißt der Eingabe- und Steuerungsgeräte der Spiele – haptischen Dimensionen bedarf, wenn man sie nicht schon im Vorhinein verzeichnet beschreiben möchte. Was darüber hinaus der Begriff des Mediums anderes als der Begriff des ästhetischen Phänomens meint, möchte ich an dieser Stelle zunächst einmal offenlassen. Mehr noch: Im Verlauf des Buches werde ich bestimmte herkömmliche Verständnisse des Medienbegriffs sogar explizit oder implizit zurückweisen. Weil sein Gebrauch nicht allein ausgesprochen polyvalent ist,[14] sondern in bestimmten Spielarten auch problematische theoretische Kontexte evoziert, die ich vermeiden möchte, habe ich mich entschlossen, in diesem Buch von Computerspielen und nicht von digitalen Spielen zu sprechen. Denn der Begriff des digitalen Spiels lässt entsprechende Kontexte eher anklingen, da er den Begriff des analogen Spiels zum Gegensatz hat. Bei dem Begriff des Computerspiels, wie er hier verwendet wird, handelt es sich dagegen um einen generischen Begriff: Er dient keiner Abgrenzung zwischen Spielen auf Konsolen und Spielen auf Computern – im deutschsprachigen Raum werden Konsolenspiele terminologisch häufig als Videospiele bezeichnet –, sondern meint die gesamte Klasse von Computerspielen, ganz gleich, ob es sich um Spiele auf Computern, Konsolen oder Handys handelt. Der Begriff des Videospiels bildet demgegenüber deshalb nicht den Titel dieses Buchs, weil der Begriff nicht nur zumeist die Praxis des Spielens mit Konsolen vor dem Fernseher meint – was für sich ein sinnvolles Unterscheidungskriterium sein mag, das für das Interesse des vorliegenden Buchs aber nicht zentral ist –, sondern weil er Formen medialisierten Sehens in den Vordergrund der Definition rückt. Dabei handelt es sich um einen Gedanken, dem eine Medientheorie zugrunde liegt, die in diesem Buch letztlich zurückgewiesenen wird.
Mit den bisherigen Erläuterungen ist eine erste Beschreibung des Ziels des vorliegenden Buchs benannt: Es geht um eine Bestimmung der ästhetischen Eigenarten des Computerspiels aus der Perspektive der philosophischen Ästhetik und Kunsttheorie. Diese Beschreibung ist gleichwohl nur eine erste und dabei recht allgemeine Angabe, unter welchem Gesichtspunkt das Computerspiel im Folgenden betrachtet werden soll. Deshalb gilt es nun, eine spezifischere Beschreibung dieses Ziels zu geben. Sie lautet: Die ästhetischen Eigenarten des Computerspiels sollen in der Weise aus der Perspektive der philosophischen Ästhetik und Kunsttheorie in den Blick genommen werden, dass das Computerspiel als ästhetisches Medium im Spannungsfeld anderer ästhetischer Medien verständlich wird. Das Computerspiel wird somit im Reigen von Film, Fotografie, Musik, Literatur, Malerei usw. verortet werden. Gegen eine solche Perspektive drängt sich natürlich sogleich ein naheliegender Einwand auf. Dieser besagt, dass gerade die Eigenart des Computerspiels von vornherein verfehlt wird, wenn man das Computerspiel im Spannungsfeld anderer ästhetischer Medien verortet. Das vorliegende Buch als Ganzes ist genau der gegenteiligen These verpflichtet: Man kann über ein ästhetisches Medium nur im Lichte seiner vielfältigen Beziehungen zu anderen ästhetischen Medien nachdenken. Das ist selbstverständlich nicht so gemeint, dass man, wenn man eine ästhetische Theorie des Computerspiels formuliert, auch eine der Literatur und eine des Films formulieren muss. Es ist auch nicht so gemeint, dass man in dem Sinne ästhetische Medien relational bestimmen müsste, dass man bloß die Unterschiedlichkeit ästhetischer Medien herausarbeitet. Es ist vielmehr derart gemeint – und das ist die zentrale medienästhetische Pointe des gesamten Buchs –, dass ästhetische Medien im Lichte von Austausch- und Abgrenzungsprozessen mit anderen ästhetischen Medien beständig neu verhandelt werden. Anders als man vielleicht zunächst denken könnte, haben ästhetische Medien wie der Film, die Musik, die Literatur und der Tanz keine inhärent festgelegten Spielräume von Ausdrucksmöglichkeiten, deren Überschreitung durch einzelne ästhetische Gegenstände dazu führen würde, dass diese Gegenstände eben kein Film, keine Musik, keine Literatur, kein Tanz usw. mehr wären – oder zumindest kein guter Film, kein gelungenes musikalisches Werk, kein überzeugender Roman und kein gelungener Tanz. Natürlich bestreitet die These, dass ästhetische Medien beständig neu verhandelt werden, nicht, dass es Unterschiede zwischen ästhetischen Medien gibt. Im Gegenteil: Ein derart veränderter Blick lässt, so der leitende Gedanke, diese Unterschiede erst in angemessener Weise hervortreten, insofern sie nicht als statische und ungeschichtliche vorausgesetzt werden. Noch einmal anders formuliert: Natürlich ist eine Fuge von Johann Sebastian Bach etwas ganz anderes als ein Film von Michael Haneke und ein Computerspiel von Warren Spector etwas ganz anderes als eine Choreographie von Pina Bausch. Zu sagen, dass ästhetische Medien allein im Spannungsfeld anderer ästhetischer Medien verständlich gemacht werden können, heißt nicht, diese Unterschiede zu nivellieren. Es heißt vielmehr, dass sich die Konturen ästhetischer Medien durch Prozesse des Austausches und der Abgrenzung untereinander beständig verschieben – Prozesse, die letztlich von den einzelnen Gegenständen her, nämlich konkreten Filmen, Fotografien, Gemälden, musikalischen Werken, Tänzen, Computerspielen usw., zu verstehen sind. Eine Fuge von Bach, ein Film von Haneke, ein Computerspiel von Spector und eine Choreographie von Bausch bestimmen, wenn sie gelungen sind, jeweils neu, was die entsprechenden ästhetischen Medien sind, denen sie angehören. Man kann nicht vor der Fuge, dem Film, der Choreographie und dem Computerspiel schon wissen, was Musik, Film, Tanz und Computerspiel als ästhetische Medien sind, insofern im Lichte jedes ästhetisch gelungenen Gegenstands ihre Konturen neu verhandelt werden. Das Buch möchte die logische Struktur einer entsprechenden Dynamik mit Blick auf das Computerspiel herausarbeiten. Man könnte denken, dass sich eine entsprechende Dynamik dabei besonders markant am Computerspiel herausarbeiten lässt, weil es sich hier um ein relativ junges ästhetisches Medium handelt, dessen Ort im Reigen ästhetischer Medien noch nicht abgesteckt ist.[15] Die leitende These lautet aber anders: Kein ästhetisches Medium gewinnt jemals einen festen Ort gegenüber anderen ästhetischen Medien in dem Sinne, dass es nicht im Lichte jedes neuen ästhetisch gelungenen Gegenstands neu verhandelt würde. Aus diesem Grundgedanken, der im Verlauf des Buchs genauer entwickelt werden wird, folgt eben zugleich, dass eine Ästhetik des Computerspiels sich nicht allein auf eine Beschreibung von Computerspielen stützen kann, sondern ihren Austausch mit anderen ästhetischen Medien in den Blick nehmen muss. Es stellt daher keinen Fehler oder kein Versehen dar, wenn im Folgenden nicht jedes Argument aus einer Phänomenologie der Ästhetik von Computerspielen gewonnen wird. Wenn es so ist, dass man, um angemessen über die Ästhetik von Computerspielen nachzudenken, auch immer schon über andere ästhetische Medien nachdenken muss, so stellt dieses Buch nicht allein einen Beitrag zur Ästhetik des Computerspiels dar, sondern auch einen Beitrag zur Philosophie ästhetischer Medien – und zur Philosophie der Kunst.
Das vorliegende Buch möchte somit einen philosophischen Beitrag zum Verständnis der Ästhetik des Computerspiels erbringen, indem es dieses im Lichte seiner vielfältigen Beziehungen zu anderen ästhetischen Medien als das, was es ist, verständlich macht. Diese Perspektive auf die Ästhetik des Computerspiels wird in drei Kapiteln entfaltet. Das folgende zweite Kapitel gilt der Frage: Was sind Computerspiele? Dabei geht es um nicht weniger als das Wesen des Computerspiels. In einer einschlägigen Kontroverse in den Game Studies ist das Wesen des Computerspiels entweder in Begriffen des digitalen Spiels oder in Begriffen der interaktiven Erzählung erläutert worden. Es wird sich zeigen, dass es sich hier um eine falsche Alternative handelt. Das ist nicht so, weil es noch eine dritte Alternative gäbe, die demgegenüber richtig wäre, sondern weil bereits ein Versuch, in diesem logischen Register das Wesen des Computerspiels zu bestimmen, grundsätzlich zum Scheitern verurteilt ist. Es wird sich aber auch erweisen, dass Spielarten einer naheliegenden Alternative, nämlich dass Computerspiele so unterschiedlich sind, dass der Begriff überhaupt nicht definiert werden kann, ebenfalls nicht überzeugen können. Positiv wird demgegenüber der Gedanke formuliert, dass das Wesen des Computerspiels nichts anderes ist als die Form seiner Entwicklung in und durch seine einzelnen Gegenstände. Damit zeichnet sich ein anderes Verständnis dessen ab, was das Wesen einer Sache ist. Es zeichnet sich kurz gesagt eine Spielart eines Essentialismus ab, die nicht länger der Pluralität und Dynamik der Phänomene widerstreitet. Es geht im zweiten Kapitel damit um nicht weniger als die Formulierung eines Begriffs des Wesens, der zufolge das Wesen einer Sache nicht ihrer geschichtlichen Entwicklung entgegensteht.
Eine solche Bestimmung konkretisiert das dritte Kapitel dann mit Blick auf die Ästhetik des Computerspiels. Dieses Kapitel gilt im Sinne der vorangehenden Bemerkungen einer Explikation der Ästhetik des Computerspiels im Lichte anderer ästhetischer Medien. Es löst damit sozusagen das Versprechen ein, eine Antwort auf die Frage, was Computerspiele sind, nicht allein der Form nach zu geben, sondern mit Blick auf das Ästhetische auch inhaltlich. Zunächst gilt es, dabei zu klären, was ein ästhetisches Medium überhaupt ist – und damit auch zu zeigen, dass eine ästhetische Beschreibung irreduzibel ist. Sie ist in dem Sinne irreduzibel, dass ästhetische Valenzen eines Gegenstands nicht auf physikalische Eigenschaften reduziert werden können. Hinsichtlich des Computerspiels ist die Frage dabei besonders drängend, ob solche Valenzen nicht auf technische Eigenschaften oder etwa auf einen zugrundeliegenden Programmcode oder Ähnliches reduzierbar sind. Es gilt gegenüber derartigen Thesen zu zeigen, dass die ästhetische Seinsweise des Computerspiels eine seiner wesentlichen Seinsweisen ist und dass sie irreduzibel ist. Positiv kann der Begriff des ästhetischen Mediums im Register einer Praxeologie des Medialen konturiert werden. Von einer Praxeologie des Medialen zu sprechen meint, dass im Rahmen von Medien hergestellte Artefakte ausgehend von deren dynamischen Gebrauchsweisen zu erläutern sind beziehungsweise dass das entsprechende Medium in bestimmter Weise gar nichts anderes ist als die hergestellten Artefakte, produktionsästhetisch verstanden als bestimmte Gebrauchsweisen konkreter Materialien, Apparate usw.[16] Auf der Grundlage dieser Analyse werden daraufhin einige ästhetische Eigenarten des Computerspiels in den Blick genommen. Im Lichte von Film, Literatur, Theater, Musik und Architektur geht es nicht nur darum, ästhetische Momente bestimmter Arten von Computerspielen nachzuvollziehen, sondern auch darum, das Computerspiel als ästhetisches Medium von seinen vielfältigen Austauschprozessen mit anderen ästhetischen Medien her verständlich zu machen. Diese Analyse beansprucht natürlich in dem Sinne keine Vollständigkeit, dass mit ihr Austauschprozesse im Detail analysiert würden; eine solche Vollständigkeit ist angesichts der entwickelten Thesen sogar aus prinzipiellen Gründen unmöglich. Wohl aber beansprucht das dritte Kapitel, die zugrundeliegende Logik des Nachdenkens über Computerspiele unter ästhetischen Gesichtspunkten offenzulegen.
Das vierte Kapitel gilt schließlich einer Bestimmung von Computerspielen als Ereignisse der Kunst. Die im zweiten Kapitel entwickelte offene Logik wird im vierten Kapitel also anders als im dritten Kapitel nicht unter ästhetischer, sondern unter kunsttheoretischer Perspektive durchgespielt. Im Lichte der im Verlauf des Buches noch deutlicher werdenden Unterscheidung zwischen philosophischer Ästhetik und Kunsttheorie umfasst der Begriff des künstlerischen Ereignisses weder alle Computerspiele noch die meisten. Diskussionen über das Computerspiel als Kunstwerk sind aus dieser Perspektive immer nutzlos. Wie nicht jeder Film und nicht jedes Musikstück und nicht jedes Bild ein Kunstwerk ist, so ist auch nicht jedes Computerspiel ein Kunstwerk. In einem ersten Schritt soll dabei der Begriff der Kunst genauer geklärt und geltend gemacht werden, dass er trotz seiner Entgrenzung oder gar Verabschiedung in den Avantgarden des 20.Jahrhunderts keineswegs obsolet geworden ist. Daraufhin wird weitergehend gezeigt, dass der Begriff der Kunst sich auf Gegenstände bezieht, die als Teil der Welt verstanden werden müssen und sich keineswegs als subjektive oder intersubjektive Projektionen in die Welt verstehen lassen. Es geht darum, zu zeigen, dass die Wandelbarkeit dessen, was Kunst ist, und die Wandelbarkeit dessen, was es heißt, ein Kunstwerk angemessen zu interpretieren, nicht der These widersprechen, dass Kunstwerke letztlich derart objektiv zu verstehen sind, dass sie Teil der Welt sind. Die verbreitete Auffassung, dass etwas dann ein Kunstwerk ist, wenn wir es als solches behandeln, erweist sich zumindest dann als falsch, wenn sie meint, dass unsere Wahrnehmungen und Interpretationen Projektionen auf eine Welt sind, nicht aber Entdeckungen von etwas, das selbst Teil der Welt ist. Abschließend wird es im vierten Kapitel darum gehen, diese Gedanken mit Blick auf spezifische Computerspiele zu konkretisieren. Im Rahmen einiger Hinweise zu solchen Computerspielen, von denen gezeigt werden wird, dass ihnen sinnvoll ein Kunstanspruch zugeschrieben werden kann, soll erläutert werden, was spezifisch für diese Computerspiele ist, insofern es sich bei ihnen um Kunstwerke handelt. Dass das Kapitel keineswegs der lächerlichen Versuchung erliegt, einen Kanon der Computerspiele, die Kunstwerke sind, zu formulieren noch so etwas wie Kriterien der Kunstfähigkeit von Computerspielen anzugeben unternimmt – Versuche, gegen deren Möglichkeit das gesamte vierte Kapitel sogar explizit gerichtet ist –, ist keiner Unsicherheit der Theoriebildung geschuldet. Es liegt vielmehr darin begründet, dass aus der Tatsache, dass es einen kategorialen Unterschied gibt zwischen solchen Computerspielen, die Kunstwerke sind, und solchen, die keine Kunstwerke sind, nicht schon folgt, welche das eine und welche das andere sind.
Ein abschließendes fünftes Kapitel blickt danach noch einmal auf den gesamten Gang der Überlegungen unter dem Gesichtspunkt der Art von philosophischer Bewegung, die dieser exemplifiziert, zurück. Der Aufbau des Buches lässt sich dabei folgendermaßen charakterisieren: Behandelt das zweite Kapitel die Form des Begrifflichen, behandelt das dritte Kapitel die Form des Ästhetischen und das vierte Kapitel schließlich die Form der Kunst. Diese Formen sind irreduzibel, aber auch Kapitel drei und vier exemplifizieren in unterschiedlicher Weise die Logik des Begriffs, die im zweiten Kapitel entwickelt worden ist.
Eine kurze Geschichte des Computerspiels
Um auch für solche Leser, die mit Computerspielen bislang noch nicht in größerem Maße vertraut sind, eine sinnvolle Lektüre dieses Buches zu ermöglichen, habe ich mich entschlossen, dem Gang der Überlegungen eine ebenso kurze wie rabiate Geschichte des Computerspiels voranzustellen. Diese knappe Darstellung behandelt, anders als das folgende zweite Kapitel, noch nicht die Frage, was es heißt, die Geschichte des Computerspiels als Geschichte des Computerspiels angemessen zu erzählen. Es sollen vielmehr einige Hintergrundinformationen für die Überlegungen dieses Buches bereitgestellt werden. Die Darstellung orientiert sich an unserem in der Praxis eingespielten Sprechen über Computerspiele, ohne diese Praxis bereits theoretisch zu erörtern, und möchte an erster Stelle an einige wichtige Spiele und Genres von Spielen ebenso wie an einige Computer- und Videospielsysteme erinnern.[17]
Was heute einer der weltweit wichtigsten Zweige der Unterhaltungsindustrie ist, begann als Freizeitspaß an amerikanischen Hochtechnologie-Instituten. Obwohl es wohl nicht das erste Computerspiel war – 1958 hatte William Higinbotham schon Tennis for Two auf einem Oszillographen programmiert –, kann Steve Russells Spacewar! als exemplarisches frühes Computerspiel gelten. Er hatte es Anfang der 1960er Jahre am Massachusetts Institute of Technology entwickelt. Bei Spacewar! handelt es sich um ein schlichtes Spiel, bei dem zwei menschliche Kontrahenten jeweils ein Raumschiff auf einem statischen Bildschirm steuern. Dennoch verbreitete sich das Spiel an Forschungsinstituten in ganz Amerika. Die Grundlagen für das Computerspiel als Massenmedium legte aber wohl Nolan Bushnell mit der Firma Atari, die er zusammen mit Ted Dabney im Jahr 1972 gründete. Im selben Jahr programmierte er auch Pong – eine Art digitales Tennis, bei dem jeder Spieler mit einem Paddle, das heißt einem kontinuierlich regelbaren Drehknopf, einen Schläger nach oben und unten bewegen konnte – und stellte es als Automat in Spielhallen und Kneipen auf. Per Münzeinwurf konnte man dann eine Partie spielen. Spätestens jetzt war eine der von den 1970er bis zu den 1990er Jahren wichtigsten Formen des Computerspiels geboren: der Arcade-Automat. In ihrer technischen Überlegenheit gegenüber frühen Videospielkonsolen und Heimcomputern – schließlich beherbergten sie teure und spezialisierte Platinen, auf denen nur eines oder nur sehr wenige Computerspiele gespeichert waren, wohingegen Videospielkonsolen und Heimcomputer auf beliebig viele Spiele ausgelegt waren – waren sie lange Zeit ein Motor der gesamten Computerspielentwicklung. Damit sind bereits die weiteren, bis heute wichtigen Formen des Computerspiels genannt: Haben Arcade-Automaten mittlerweile ihre Relevanz eingebüßt, sind es Heimcomputer und Videospielkonsolen – und heute vermehrt auch Smartphones, Tablets und Handhelds als Fortschreibungen der beiden Formate –, auf denen heute Computerspiele gespielt werden.
Die historisch wohl einflussreichste und kommerziell erfolgreichste frühe Videospielkonsole stammte wie Pong ebenfalls von Atari: das 1977 erschienene Atari Video Computer System (kurz: Atari VCS). Es wurde an den Fernseher angeschlossen, und über die Jahre erschienen Unmengen von Spielen dafür, die separat gekauft und in die Konsole eingesteckt wurden. Neben Automatenumsetzungen gab es in den frühen 1980er Jahren auch viele Eigenentwicklungen Ataris, die neue Spielprinzipien erprobten. Allerdings hatte Atari keine Kontrolle über die Dritthersteller von Spielen, so dass der Markt dementsprechend mit qualitativ minderwertigen Spielen überschwemmt wurde. Da es zudem bei Time Warner, die Atari übernommen hatten, zu vielen Fehlentscheidungen kam – so wurden etwa 12 Millionen Module des Spielhallenerfolgs Pac-Man(1982) bei nur 10 Millionen verkauften Konsolen produziert –, hatte die junge Industrie schon 1983 einen veritablen Crash zu verkraften. Legendär schlecht war das VCS-Spiel E.T. the Extra-Terrestrial (1982) zum gleichnamigen Film – der Programmierer hatte es in nur fünf Wochen programmieren müssen, damit es rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft fertig wurde. Die überschüssigen Module ließ Atari in der Wüste von New Mexico vergraben.[18] Die Videospieleindustrie erholte sich erst Mitte der 1980er Jahre mit Nintendos Videospielkonsole Nintendo Entertainment System (kurz: Nes) von diesem Crash, dafür aber nachhaltig. Ehedem wichtige Konsolenhersteller sind heute gleichwohl entweder nicht länger am Markt oder beschränken sich – wie etwa Sega, lange Zeit der Hauptkonkurrent von Nintendo auf dem Sektor der Videospielkonsolen – nur noch auf das Programmieren und Veröffentlichen von Spielen. Neben Nintendo sind Sony und Microsoft heute die einflussreichsten Firmen – Sonys erste Playstation erschien dabei erst Ende 1994 und Microsofts erste Xbox sogar erst 2001. Anhand der Entwicklung der Videospielkonsolen ließe sich auch eine besonders prägnante Geschichte der Interfaces und Steuerungsgeräte erzählen: Vom Paddle über verschiedene Arten von Joysticks bis hin zu der gegenwärtig auf allen aktuellen Konsolen anzutreffenden Bewegungssteuerung ist die Geschichte der Computerspiele auch immer eine Geschichte der Interfaces von Computerspielen.[19]
Aber nicht allein Videospielkonsolen begannen Ende der 1970er Jahre ihren Siegeszug, sondern auch Heimcomputer. Wie im Bereich der Videospielkonsolen konkurrierten auch im Sektor der Heimcomputer verschiedene Modelle, für die mit ihrer jeweils unterschiedlichen technischen Ausstattung (Hardware) unterschiedliche Spiele und Anwendungsprogramme (Software) programmiert wurden. Fast immer waren dabei solche Spiele, die auf mehreren Videospielsystemen und Heimcomputern erschienen, von unterschiedlicher technischer Qualität, die sich aus den Fähigkeiten der entsprechenden Programmierer ebenso wie aus den technischen Spezifikationen des jeweiligen Videospielsystems oder der Art des Heimcomputers herleitete. Der vielleicht für Computerspiele einflussreichste frühe Heimcomputer war der Ende der 1970er Jahre von Steve Jobs und Steve Wozniak erdachte Apple II, auf dem zahlreiche wirkmächtige Computerspiele erschienen. Seine Systemarchitektur selbst war bereits von der Programmierung von Spielen beeinflusst, denn Jobs und Wozniak hatten 1976 das einflussreiche Automatenspiel Breakout entwickelt – in gewissem Sinne eine Einzelspielervariante von Pong, bei der der Spieler mit Hilfe eines Schlägers und eines Balls Blöcke auf dem Bildschirm abräumen musste. Der zumindest in Deutschland wohl wichtigste Heimcomputer der 1980er Jahre kam aber erst 1982 auf den Markt: Commodore bot seinen damals leistungsstarken 8-Bit-Rechner Commodore 64 (kurz: C64) zu einem erschwinglichen Preis an, so dass er Mitte der 1980er Jahre in vielen Jugendzimmern stand. Der Nachfolger, der Commodore Amiga (kurz: Amiga), rang ab Ende der 1980er Jahre dann mit dem Atari ST (kurz: ST) um die Vorherrschaft der leistungsstärkeren 16-Bit-Rechner auf dem Heimcomputermarkt. Hatte sich der Amiga kurzfristig als Sieger herauskristallisiert,[20] so begannen sich spätestens seit den frühen 1990er Jahren die PCs mit ihrer flexiblen Systemarchitektur durchzusetzen, die heute den Computermarkt im Spielesektor dominieren.
Erscheint die Differenzierung zwischen Arcade-Automaten auf der einen und Videospielkonsolen und Heimcomputern auf der anderen Seite noch trennscharf, lässt sich Gleiches nicht für die Unterscheidung zwischen Videospielkonsolen und Heimcomputern sagen. Mag auf den ersten Blick bei Videospielkonsolen die Hardwarebasis stabiler anmuten als bei Heimcomputern, ist doch zugleich anzumerken, dass auch Heimcomputer wie der C64 und Amiga eine letztlich stabile und nur minimal modulare Hardwarebasis aufwiesen. So wie man für die 1996 erschienene Videospielkonsole Nintendo 64 eine Speichererweiterung kaufen konnte und man bei den aktuellen Videospielkonsolen Modelle mit unterschiedlichen Festplattengrößen kaufen kann, so konnte man für den Amiga eine Speichererweiterung erwerben und später eine externe Festplatte. Auch ein zweites naheliegendes Differenzierungskriterium, dem zufolge Videospielkonsolen am Fernseher gespielt