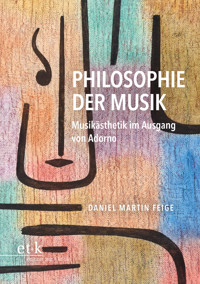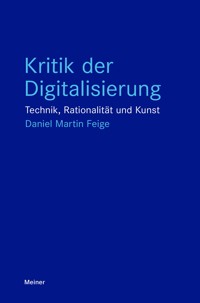
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Felix Meiner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Blaue Reihe
- Sprache: Deutsch
›Digitalisierung‹ ist in aller Munde: Ihre mangelhafte Umsetzung wird ebenso angemahnt, wie vor ihren Folgen gewarnt wird. Das neue Buch von Daniel Martin Feige zeigt, dass die mit der Digitalisierung verbundenen Technologien weder neutrale noch unschuldige Mittel zu beliebigen Zwecken sind und soziale Medien keine Orte des Diskurses. Es weist nach, dass wir Begriffe wie Geist, Denken und Handeln KI-Systemen nicht sinnvoll zuschreiben können und entsprechende Diskurse einer Umarbeitung von Begriffen dienen, die wir eigentlich nur auf Menschen anwenden können. Feige entwickelt seine Kritik an der Datifizierung unseres gesellschaftlichen Lebens in drei Schritten: aus technikphilosophischer, anthropologischer und kunstphilosophischer Perspektive. Dabei macht er plausibel, dass Kunst unter den Bedingungen der Digitalisierung eine kritische Rolle erfüllen kann und dass wir auf umstrittene Begriffe wie Autonomie und selbst Genie nicht verzichten können. Sein Buch bietet zum ersten Mal den systematischen Entwurf einer kritischen Theorie der Digitalisierung. Dass sich vor dem Hintergrund seiner Diagnose sowohl Analysen, die die Digitalisierung bis in die Vor- und Frühgeschichte verlängern, als auch Diskurse, die der Künstlichen Intelligenz die Fähigkeit zu handeln und zu denken zusprechen, als höchst problematisch erweisen, zeigt Feige in seinem differenziert argumentierenden Essay.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Martin Feige
Kritik der Digitalisierung
Technik, Rationalität und Kunst
Meiner
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über ‹http://portal.dnb.de› abrufbar.
eISBN (PDF) 978-3-7873-4721-6
eISBN (ePub) 978-3-7873-4722-3
© Felix Meiner Verlag Hamburg 2025. Alle Rechte vorbehalten. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übertragungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, soweit es nicht §§ 53, 54 UrhG ausdrücklich gestatten. Konvertierung: Bookwire GmbH
Inhalt
Einleitung
Kritik der Digitalisierung als kritische Theorie der Digitalisierung
Kapitel 1
Technik und Gesellschaft
1.1 Praxis und Wissen
1.2 Instrumentelle Vernunft und Gesellschaft
Kapitel 2
Geist und Künstliche Intelligenz
2.1 Denken und Vernunft
2.2 Handeln und Leben
Kapitel 3
Kunst und Digitalisierung
3.1 Autonomie und Heteronomie
3.2 Genie und Künstliche Intelligenz
Schluss
Kunst und Philosophie als Formen der Kritik
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Personenregister
Einleitung
Kritik der Digitalisierung als kritische Theorie der Digitalisierung
›Digitalisierung‹ ist in aller Munde: Ihre mangelhafte Umsetzung wird ebenso angemahnt, wie vor ihren Folgen gewarnt wird. Sie lässt sich als eine gesamtgesellschaftliche Transformation definieren, die Arbeit, Zusammenleben und Gegenständlichkeit in eine neue und einheitliche Form überführt. Diese Form kommt durch die Übersetzung dieser Bereiche in Daten im Rahmen der zunehmenden Durchdringung unserer Praxis durch neuartige Technologien zustande. Im Anschluss an Luciano Floridi lassen sich diese Technologien als Informations- und Kommunikationstechnologien bezeichnen (kurz: IKTs).1 Die mit ihnen einhergehenden Formen, Logiken und Strukturen der Vermessung und Berechnung schreiben sich auch unabhängig von diesen technologischen Grundlagen fort.
Die These des vorliegenden Buches lautet, dass es sich bei diesen Technologien weder um neutrale noch unschuldige Hilfsmittel unserer Praxis handelt. Vielmehr führen sie in unsere Praxis etwas ein, was nicht länger aus der Perspektive ihres verständigen Vollzugs thematisch werden kann. Aus diesem Grund ist die Tatsache, dass sie neue Herrschaftsformen in unserem Zusammenleben installieren, kein Unfall, der ihnen von außen zustößt. Vor dem Hintergrund einer solchen Diagnose erweisen sich sowohl technikphilosophische Analysen, die die Digitalisierung bis in die Früh- und Vorgeschichte verlängern, als auch Diskurse, die der Künstlichen Intelligenz (kurz: KI) die Fähigkeit, zu handeln und zu denken, zusprechen, als problematisch. Dasselbe gilt für den Gedanken, dass Kunst unter den Bedingungen der Digitalisierung partizipativer im Sinne einer leichteren Zugänglichkeit wird. Ich möchte vielmehr vorschlagen, diese Thesen als Verlängerung der Logik der Digitalisierung auf der Ebene des philosophischen Denkens zu begreifen. Um ein Schlagwort aus aktuellen Diskussionen in unserem Fach aufzugreifen: Solche Positionen betreiben ein ›Conceptual Engineerings‹,2 ohne es entsprechend auszuweisen. Sie bauen unsere Begriffe der Praxis, des Geistes und der Kunst nach einer Logik um, die ihnen eigentlich fremd ist.
Was immer wir in sozialen Medien, beim Gebrauch von Chatbots oder bei der Nutzung digitaler Werkzeuge zur Erstellung von Designgegenständen tun, wir produzieren ›Daten‹. Daten sind, darauf hat Sybille Krämer zutreffend hingewiesen,3 nicht Teil einer unseren alltäglichen Umgang mit der Welt übersteigenden Wirklichkeit, sondern sie werden gemacht, und zwar durch IKTs: Sie bestehen in Zeichen, die so gebaut sind, dass sie von Apparaten verarbeitet werden können, die aber von uns gerade nicht länger wie sprachliche Zeichen gelesen werden können. Digitalisierung ist die Datifizierung der Wirklichkeit. Im Geiste der frühen kritischen Theorie Max Horkheimers und Theodor W. Adornos lässt sich zur Datifizierung sagen:4 Sie ist nicht neutral oder interesselos, sondern Ausdruck einer Radikalisierung instrumenteller Vernunft, die nur danach fragen kann, wie effizient etwas ist, nicht aber danach, ob das, was angestrebt wird, wünschenswert ist. Die Datifizierung der Wirklichkeit geht damit mit einer Verselbstständigung der Mittel einher, die nicht länger intrinsisch auf Zwecke bezogen sind. Die Daten-Profile, die durch unseren Gebrauch der IKTs entstehen, bewirken einen Verlust an Selbstbestimmung; unser Handeln wird als Verhalten gelesen, das prognostizierbar und kontrollierbar wird.
Wenn ich in dieser Weise vorschlage, eine Kritik der Digitalisierung aus dem Geiste der kritischen Theorie zu formulieren, so ist nicht allein daran zu erinnern, dass die Frage der ökonomischen, diskursiven und sozialen Macht intrinsisch mit der Frage der Digitalisierung verbunden ist. Es ist auch daran zu erinnern, dass eine solche Kritik nicht unter Berufung auf eine vordigitale Welt formuliert werden kann. Dass wir hier noch, so könnte man denken, einen körperlicheren Umgang mit der Welt hatten oder einen unverstellten Zugang zur Natur, übersieht, dass auch die vor-digitale Welt von falschen Verhältnissen durchzogen war. Vor dem Prozess der Digitalisierung war keineswegs alles besser. Ihr imaginierter Ort einer vordigitalen Welt ist genauso Versprechen wie Schrecken. Es gibt kein Zurück vor die Digitalisierung. Das zu sehen heißt aber nicht, die problematischen Züge der Digitalisierung zu übersehen. Vielmehr gilt es sie im Sinne der immanenten Dialektik der Digitalisierung zu denken.
Das vorliegende Buch entwickelt seine Grundthese, dass IKTs keine neutralen Technologien sind, sondern Arbeit, Zusammenleben und Gegenständlichkeit aus einer datifizierten Logik neu fassen, in drei Schritten: aus der Perspektive technikphilosophischer, anthropologischer und kunstphilosophischer Überlegungen.
Das erste Kapitel entfaltet aus technikphilosophischer Perspektive die These, dass die andersartige Logik, die IKTs in unsere Praxis einführen, nicht von außen bedroht ist, falschen Verhältnissen zuzuspielen. Im ersten Teil des Kapitels werde ich die Relation von Praxis und Technik beleuchten, im zweiten Teil Beiträge der kritischen Theorie für eine weitergehende Analyse dieser Relation fruchtbar machen.
Ich beginne mit einer Gegenüberstellung zweier Diskurse, die gegenwärtig unser Nachdenken über die Digitalisierung prägen: revisionistische und deflationistische Diskurse. Erstere sehen in der Digitalisierung eine Vollendung einer Entwicklung, die schon mit der Entstehung des Alphabets begonnen hat, letztere behaupten, dass sich mit der Digitalisierung nichts Grundsätzliches ändert. Beide, so werde ich zeigen, spielen den Bruch, den die Digitalisierung darstellt, herunter. Aus geschichtsphilosophischer Perspektive widerspricht die These, dass es Vorläufer gab, nicht der These, dass die Digitalisierung einen Einschnitt darstellt. Der Bruch lässt sich aus der Perspektive des Verhältnisses von Technik und Praxis verständlich machen. Technik und Praxis sind immer interdependent, Technik bestimmt unser Tun, wie umgekehrt Tun unsere Techniken bestimmt. Aber für durch IKTs geprägte Praktiken gilt, dass es hier hinter unserer Praxis noch eine weitere Ebene zu entdecken gibt: die Daten, in die alles übersetzt werden muss, um im Rahmen der IKTs verarbeitet werden zu können. Zwar ist all unser Tun immer auch mit Unverfügbarkeiten konfrontiert, da der Lauf der Dinge nicht durchweg unserem Willen gehorcht. Paradoxerweise aber werden diese Unverfügbarkeiten im Rahmen der Digitalisierung einerseits an die Seitenlinie der Praxis verschoben, andererseits wird die Welt nun das, was in Form der IKTs an ihr berechenbar ist.
Im zweiten Teil des Kapitels werde ich diese technikphilosophischen Überlegungen mit Horkheimer und Adorno in ihrer sozialen Logik weiterverfolgen. Zwar liegt es nicht im Begriff des ›Handys‹, Bewegungsprofile von Nutzerinnen und Nutzern zu erstellen, aber es ist kein Zufall, dass heute alle Handys mit einer solchen Software ausgestattet sind, die Bewegungsprofile erstellt und unser Verhalten prognostizierbar macht. Diese werden mit Informationen zu unserem Konsumverhalten, unseren Partnerwahlpräferenzen und unseren kulinarischen Vorlieben zu Profilen verbunden. Als solche werden sie eine handelbare Ware. Adorno und Horkheimer haben gezeigt, dass die Moderne sich durch eine Verselbständigung instrumenteller Rationalität auszeichnet. Diese wird im Zuge der Digitalisierung radikalisiert: Während im Zuge der Industrialisierung materielle Objekte zergliedert wurden, dringt dieses Verfahren nun in die Materie selbst ein: Objekte werden nicht länger zergliedert, sondern aus einer vorgängigen Zergliederung in Daten neugeschaffen.
Das zweite Kapitel argumentiert aus anthropologischer Perspektive dafür, dass wir geistige Fähigkeiten nur Lebewesen zuschreiben können, nicht aber einer KI. So wie unsere Praxis durch die Digitalisierung einer Logik der Datifizierung unterzogen wird, so wird der Begriff des Geistes mit der These, dass KIs denken können, aus einer Computerlogik neu bestimmt. Ein solches Vorgehen werde ich im ersten Teil des Kapitels mit Blick auf den Begriff des Denkens, im zweiten Teil dann mit Blick auf den Begriff des Handelns einer Kritik unterziehen.
In jüngster Zeit hat sich vor allem durch die breite Nutzung sogenannter Large Language Models (kurz: LLMs) die Frage nach dem Unterschied zwischen menschlichem Geist und Künstlicher Intelligenz verschärft. LLMs sind Programme, die mit großen Datensätzen natürlicher Sprachen gefüttert werden und mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsrechnung Antworten auf Fragen von Nutzerinnen und Nutzern geben. Vorschläge, KIs minimale oder weitreichende kognitive Fähigkeiten zuzuschreiben, übersehen aber nicht allein, dass LLMs nicht wissen, wovon sie sprechen. Vielmehr geht der Gedanke, dass KIs kognitive Fähigkeiten haben, mittelbar auf einen Vorschlag Alan Turings zurück. Er hat die Frage, ob Maschinen denken können, durch die Frage ersetzt, ob wir den Unterschied zwischen den Textausgaben eines Menschen und einer Maschine erkennen können. Im Rückgriff auf Argumente von Donald Davidson, Hubert Dreyfus und Brian Cantwell Smith werde ich geltend machen, dass Turings Test kein geeigneter Kandidat ist, um diese Frage zu beantworten: Ob ein Wesen ein geistiges Wesen ist, zeigt sich nicht in der Frage, ob es grammatikalisch korrekte und von uns als sinnvoll identifizierbare Sätze ausgeben kann, sondern ob wir verstehen können, dass es diese Sätze in einer Weise gebraucht, die sich in kommunikativen Situationen auf Zustände und Ereignisse der Wirklichkeit beziehen.
Wie wir das, was eine Künstliche Intelligenz uns auf eine Frage in einem ›prompt‹ ausgibt, nicht sinnvoll als Ausdruck des Denkens beschreiben können, so können wir das, was eine Künstliche Intelligenz zu tun in der Lage ist, nicht sinnvoll anhand des Begriffs des Handelns fassen. Im zweiten Teil des Kapitels werde ich im Anschluss an Anscombe geltend machen, dass zu handeln heißt, etwas als ein ›Gutes‹ zu sehen und es durch sein Tun zu verwirklichen. Es hilft mithin nicht, KI mit Robotik zu verbinden: Eine Maschine, die mittels Sensoren Abgleiche zwischen Ist- und Soll-Zuständen (oder Ähnlichem) vornimmt, ist kein Akteur, der handelt. Weitergehend werde ich dafür argumentieren, dass ein handelnder Akteur Träger einer Lebensform sein muss. Die Tatsache, dass eine Künstliche Intelligenz nicht lebendig ist, könnte sich so als Merkmal erweisen, das eine unüberwindbare Hürde für die Entwicklung einer Künstlichen allgemeinen Intelligenz (kurz: AGI) im Rahmen gegenwärtiger KI-Paradigmen darstellt.
Das dritte Kapitel argumentiert aus kunsttheoretischer Perspektive dafür, Kunst als eine Form einer immanenten Kritik der Digitalisierung zu sehen. Angesichts der Diagnose dieses Buches drängt sich die Frage nach Möglichkeiten der Kritik auf und dieser Frage gehe ich mit Blick auf die Kunstpraxis nach. Im ersten Teil werde ich dabei den Gedanken der Autonomie der Kunst verteidigen, im zweiten die Transformation der Kunstpraxis unter den Bedingungen der Digitalisierung nachzeichnen.
In jüngsten Diskursen wird zunehmend die Abschaffung der Autonomie der Kunst bzw. ihre herrschaftskritische Demaskierung gefordert. Nicht selten gehen diese Diskurse mit emanzipatorischen Erzählungen zum Internet als herrschaftsfreiem Raum und den sozialen Medien als Abbau von ›Gatekeeping‹ einher. Die berechtigte Kritik an rassistischen, sexistischen und klassistischen Ausschlüssen der Gegenwart trifft aber das falsche Ziel, wenn sie von der Kunst fordert, die Ärmel hochzukrempeln und praktisch zu werden. In Wahrheit sind entsprechende unumwundene Politisierungen der Kunst selbst auch Effekte der Verwertungslogik der Digitalisierung. Ich werde in einer Gegenüberstellung des Handelns als Ausdruck unserer praktischen Vernunft und des ästhetischen Hervorbringens als Ausdruck unserer ästhetischen Vernunft zeigen, dass die Verabschiedung der Autonomie der Kunst, selbst wenn sie diskursiv gefordert wird, einem Selbstmissverständnis der künstlerischen Praxis geschuldet ist.
Der zweite Teil des Kapitels diskutiert paradigmatische Arbeiten einer unter den Bedingungen der Digitalisierung entstandenen Kunst: Sie lassen sich als Verwirklichung einer Form der Gegen-Digitalisierung im Sinne eines gegenwendigen, disruptiven wie reflexiven Gebrauchs der IKTs begreifen. Hier werde ich abschließend zugleich die Kritik der KI ins Positive wenden: Im Kontext der Kunst erweist sie sich als fruchtbar, gerade weil die partielle Fremdheit dessen, was sie generiert, anschlussfähig ist an die konstitutive Fremdheit künstlerischer Gebilde. In einem auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnlich anmutenden Manöver werde ich dabei versuchen, diese Praktiken im Kontext eines Begriffs zu erläutern, den Kant zur Bestimmung der Spezifik künstlerischen Hervorbringens in besonderer Weise geprägt hat: dem Begriff des Genies. Wie ich im ersten Teil den Begriff der ›Autonomie‹ vor ihren problematischen Lektüren in Schutz nehmen möchte, so werde ich dasselbe hier auch mit dem Begriff des ›Genies‹ tun. Ein kurzes Schlusskapitel wird reflexiv die Frage stellen, wie sich die Form der philosophischen Kritik zur Form der künstlerischen Kritik verhält.
Für hilfreiche Kommentare zu einer früheren Fassung des Manuskripts danke ich ganz herzlich Thomas Alkemeyer, Florian Arnold, Hannes Bajohr, Johannes Bernhardt, Fabian Börchers, Christian Grüny, Martin Lenz, Michael Lüthy (sowie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseres gemeinsamen Kolloquiums), Sabine Müller-Mall, Katharina Neuburger, Arnd Pollmann, Ulrike Ramming, Christian Schröter, Jens Schröter, Jörg Volbers und Gesa zur Nieden. Danken möchte ich zudem Sophie Kraft und Martin Höhler für die Unterstützung bei der Redaktion sowie Marcel Simon-Gadhof für die freundliche Betreuung des Buches.
Kapitel1Technik und Gesellschaft
1.1 Praxis und Wissen
Ich beginne mit einer vorläufigen Arbeitsdefinition des Begriffs der Digitalisierung, die ich Nelson Goodmans Symbolphilosophie entnehme. In seinem Hauptwerk Sprachen der Kunst hat er analoge von digitalen Systemen wie folgt unterschieden:5 Analog ist ein System, wenn »es syntaktisch und semantisch dicht ist«,6 digital ist es hingegen, wenn es »nicht nur diskontinuierlich, sondern auch syntaktisch und semantisch durchgängig differenziert [ist]«.7 Diese Sätze sind schon in ihrer Wahl der Begriffe sehr technisch und bedürfen einer Erläuterung. Sie sind im Kontext von Goodmans Theorie der Notation zu sehen. Von ›Dichte‹ spricht Goodman, wenn es zwischen jeden zwei Elementen eines Zeichensystems noch ein drittes gibt.8 Ein Beispiel wäre ein skalenloses Quecksilberthermometer. Von ›Disjunktivität‹ als Gegenbegriff der ›Dichte‹ spricht Goodman hingegen dort, wo wir es mit einer endlichen Anzahl von Elementen zu tun haben. Ein Beispiel hierfür ist das Alphabet. Diese Unterscheidung lässt sich sowohl auf der Seite der Zeichen wie auf der Seite dessen, wofür sie jeweils stehen, durchspielen. Beim Quecksilberthermometer etwa ist Dichte auf beiden Seiten zu finden: Jede minimale Differenz der Gradzahl drückt sich auch in minimalen Unterschieden der Höhe der Quecksilbersäule aus.
Wenn wir diese Unterscheidung in weniger technischen Begriffen, als Goodman sie fasst, erläutern, lässt sie sich wie folgt auf den Punkt bringen: Analog sind solche Symbolsysteme, bei denen jede Nuance in der Symbolisation wie in dem, wofür die Symbole jeweils stehen, einen Unterschied macht. Digital hingegen sind solche Symbolsysteme, die aus einer endlichen Anzahl von Elementen bestehen und bei denen das, wofür sie jeweils stehen, klar unterschieden und wiederum endlich ist. Ein digitales Quecksilberthermometer ist aus dieser Perspektive deshalb digital, weil es eine endliche Anzahl von Nachkommastellen hat, die für eine endliche Anzahl von Temperaturunterschieden stehen.
Goodmans Vorschlag ermöglicht zwei Einsichten. Erstens wird in digitalen Symbolsystemen etwas in eine endliche Anzahl von Elementen zerlegt. Diese Elemente können addiert oder subtrahiert werden, ohne dass diese Operationen die Identität der Elemente selbst verändern würden. Das ist in einem analogen Symbolsystem nicht möglich: Es gibt hinter den spezifischen Amplituden der Kritzeleien von Cy Twombly oder dem besonderen Klang des Selmer Mark VI Tenorsaxofons in Michael Breckers Händen keine solchen Elemente zu entdecken. Auch wenn daraus nicht folgt, dass man nicht mit Hilfe digitaler Technologien den Stil von Twombly oder Brecker nachahmen kann, so basiert ein solches Vorgehen dennoch auf einer anderen symbolischen Logik als im Fall des analogen Nachspielens oder Nachzeichnens. Zweitens bestreitet Goodman im Rahmen seiner Unterscheidung von analogen und digitalen Symbolsystemen nicht, dass Elemente analoger Symbolsysteme im Rahmen einer digitalen Verarbeitung neugefasst werden können. So kann ich selbst bei einem Gemälde von van Gogh nicht auf Farbverläufe achten, sondern das Gemälde anhand eines vorher festgelegten Schemas einer bestimmten Anzahl von Farben beschreiben. Digitalität ist also nicht allein eine Eigenschaft eines Symbolsystems im Sinne der Seinsweise von Elementen. Sie ist vielmehr etwas, was wir im Rahmen des Prozesses der Digitalisierung herstellen; eine Art und Weise, auf die wir Dinge, die in vielen Fällen zunächst einmal in analoger Weise existiert haben, behandeln und womit wir ihre Existenzweise modifizieren.
Ich habe mit Goodmans Vorschlag einer Definition von ›Digitalität‹ nicht deshalb begonnen, weil ich sie im Folgenden zur Grundlage für meine Überlegungen nehmen werde. Ich habe vielmehr mit ihr begonnen, weil sich in dieser Art der Definition ein verbreitetes und, wie ich denke, in Teilen verkürztes Verständnis dessen ausdrückt, was die Digitalisierung auszeichnet. Idealtypisch lassen sich hier zwei Arten von Diskursen unterscheiden, im Rahmen derer die Digitalisierung begrifflich gefasst wird.9 Ich möchte sie revisionistische Diskurse einerseits und deflationistische Diskurse andererseits nennen. Goodmans Position ist, wie ich im Folgenden noch zeigen werde, Ausdruck eines revisionistischen Diskurses.
Revisionistische Diskurse behaupten, dass die Digitalisierung einen grundsätzlichen Bruch mit allen vorangehenden gesellschaftlichen Praktiken darstellt und diese zugleich auf den Begriff bringt. Im Zuge der Digitalisierung ändern sich der Sinn von Arbeit, Zusammenleben und Gegenständlichkeit, wie diese Veränderung den Sinn vorangehender Begriffe derselben erst eigentlich verständlich macht. Dabei rechne ich sowohl solche Positionen revisionistischen Diskursen zu, die die Digitalisierung als historischen Einschnitt im 20. Jahrhundert begreifen, als auch solche Positionen, die einen entsprechenden Einschnitt ein paar Jahrhunderte früher ansetzen. Revisionistisch sind solche Diskurse, weil sie den Charakter des Bruchs in der Weise betonen, dass durch den Bruch das eigentliche Wesen dessen, was wir immer schon waren, zum Vorschein kommt. Sie bieten Beschreibungen an, die weitreichende Neufassungen der Grundbegriffe notwendig machen, anhand derer wir uns üblicherweise verstehen.
Ihnen sollen Diskurse gegenübergestellt werden, die ich als ›deflationistische‹ Diskurse bezeichnen möchte. Der Begriff des Deflationismus entstammt der Wahrheitstheorie und meint hier eine Position, die den Begriff der Wahrheit für philosophisch nicht relevant hält.10 Ihr Grundgedanke besagt, dass einen Satz als ›wahr‹ zu bezeichnen nicht viel mehr meint als seinen Inhalt noch einmal zu unterstreichen. Man kann dem Deflationismus zufolge auf den Begriff der Wahrheit verzichten, ohne dass etwas Wesentliches verloren ginge. Ich wende diesen Begriff wie folgt zur Einordnung von Diskursen der Digitalisierung an: Deflationistische Diskurse behaupten, dass im Rahmen der Digitalisierung nichts in einem philosophisch relevanten Sinne Neues entsteht. Den aufgeheizten Debatten um die Digitalisierung gegenüber gilt es entsprechend entspannt zu bleiben. Es handelt sich bei Informations- und Kommunikationstechnologien um zwar besonders leistungsfähige Technologien, aber durch sie wandeln sich Arbeit, Kommunikation und Gegenständlichkeit gar nicht grundsätzlich.
Ich möchte im Folgenden in drei Schritten zeigen, dass es sich bei dieser Alternative um eine falsche Alternative handelt. In den ersten beiden Schritten werde ich die Seiten dieser Alternative etwas genauer ausfalten. Zugleich werde ich Positionen aufgreifen, denen es nicht im engeren Sinne um Digitalisierung geht. Mir geht es hier nämlich um zwei Formen des Denkens, die von strukturellen Problemen affiziert sind, die nicht allein aufgrund einer empirischen Unterinformiertheit mit Blick auf Phänomene der Digitalisierung oder ihre Geschichte zustande kommen. Gilt der erste Schritt revisionistischen, so der zweite deflationistischen Diskursen. Im dritten Schritt werde ich den Gedanken deflationistischer Diskurse aufgreifen, dass Informations- und Kommunikationstechnologien nur graduell von bestehenden Techniken unterschieden sind. Im Rahmen einer Kritik dieses Gedankens werde ich aus technikphilosophischer und praxistheoretischer Perspektive Überlegungen vorbereiten, die im Folgenden dann anhand von Argumenten von Horkheimer und Adorno konkretisiert werden.
Revisionistische Diskurse
Die Entstehung der Informations- und Kommunikationstechnologien bedeutet revisionistischen Diskursen zufolge nicht lediglich eine graduelle Veränderung gegenüber vorangehenden Technologien oder Praktiken. Vielmehr läuten sie ein gänzlich neues Zeitalter ein. Aber was dabei eingeläutet wird, ist in bestimmter Weise redundant: Charakteristisch für die anhand mit dem Schlagwort ›revisionistisch‹ belegten Diskurse ist, dass diese Entwicklung nach ihnen ein gänzlich neues Selbst- und Weltverständnis derart notwendig macht, dass die Digitalisierung vorangehende Selbst- und Weltverständnisse und Technologien auf den Begriff bringt. Terminologisch verstehe ich unter revisionistischen Diskursen damit solche Positionen, die den Einschnitt der Digitalisierung mit einer bestimmten praktischen, epistemischen oder ontologischen positiven Entwicklung verbinden.
Revisionistische Diskurse sind nicht allein Diskurse im Umfeld des Silicon Valleys und viele Positionen, die dem Transhumanismus zuzuschlagen sind (es gibt hier eine wenig überraschende Schnittmenge).11 Vielmehr sind auch eine Reihe medienhistorischer und philosophischer Positionen hierunter zu subsumieren.12 Ihnen zufolge muss man den Einschnitt, den die Digitalisierung darstellt, gar nicht mit dem Bau und der Verbreitung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien in Verbindung bringen. Vielmehr kann man ihn schon mit Leibniz’ binärem Zahlensystem oder noch radikaler mit der Erfindung des Alphabets ansetzen. Denn schon hier ist, um es mit Goodman zu sagen, die syntaktische Disjunktivität mustergültig verwirklicht.
Jürgen Habermas hat in seinem Buch Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik festgehalten: Bei den neuen Medien handelt es sich »nicht bloß um eine Erweiterung des bisherigen Medienangebots, sondern um eine mit der Einführung des Buchdrucks vergleichbare Zäsur in der menschheitsgeschichtlichen Entwicklung der Medien«.13 Damit hat er meines Erachtens recht. Und seine These fällt deshalb nicht unter den Begriff des revisionistischen Diskurses, weil er eben nicht sagt, dass die Digitalisierung derart die Wahrheit des Buchdrucks sei, dass der Buchdruck sich selbst nur unter den Bedingungen der Digitalisierung angemessen verstehen könne. Ich verstehe entsprechende Diskurse also so, dass sie offen oder verkappt mit einer Geschichtsteleologie (und wie wir noch sehen werden: einer bestimmten Spielart derselben) einhergehen.
Das Problem revisionistischer Diskurse ist, dass sie offen oder verkappt eine Gestalt technikoptimistischen und letztlich ideologischen Denkens sind. Es trifft zu, dass der Prozess der Digitalisierung einen grundsätzlichen Wandel unseres Selbst- und Weltverhältnisses mit sich bringt. Dieser besteht unter anderem darin, dass wir Maschinen gebaut haben, die in ›forensischer‹ Manier Strukturen in unserer Praxis identifizieren können, die uns aus der Teilnehmerperspektive unzugänglich sind. Big-Data-Techniken können etwa im Feld der Verbrechensbekämpfung Wahrscheinlichkeiten des Eintretens einer Gesetzesübertretung prognostizieren, zu der kein Mensch in der Lage wäre. Und bestimmte Muster und Strukturen etwa der Wirkung von Medikamenten lassen sich ohne den Gebrauch Künstlicher Intelligenz schlicht nicht ausfindig machen. Meines Erachtens wäre es aber unzutreffend, diese Entwicklungen bloß als Aufdeckung vorher unzugänglicher Tatsachen oder Strukturen zu begreifen. Sie bestehen vielmehr in einer Umarbeitung unserer Praxis. Es ist damit das verkappte teleologische Geschichtsmodell und genauer seine spezifische Spielart, das revisionistische Diskurse aus meiner Perspektive theoretisch disqualifiziert.
Dass man Leibniz und seine Nachfolger retrospektiv so beschreibt, dass sie an einem Computer gearbeitet hätten, bevor er gebaut werden konnte, geschieht nämlich um den Preis, dass die Dynamik historischer Ideen und Vorläufer heruntergespielt wird. Das Problem ist, dass sich unter einer solchen Beschreibung die Situation so darstellt, als hätten wir es in der frühen Neuzeit und der Gegenwart prinzipiell mit demselben Projekt in derselben Weise zu tun. Aus diesem Bild wird in bestimmter Weise die Geschichtlichkeit dieser Kulturtechniken getilgt, wie ihre Konkretion in Praktiken.
Der Bruch, den die Digitalisierung in unsere Praxis einführt, wird damit ironischerweise rigoros depotenziert. Aus der Tatsache, dass wir im Lichte der gegenwärtigen Entwicklungen eine retrospektive Geschichte zu Vorläufern der gegenwärtigen Entwicklungen erzählen können, darf nicht der Schluss gezogen werden, dass das Vergangene eine noch unvollkommene Variante des Gegenwärtigen wäre. Mehr noch: Es ist erst unter den Bedingungen der Gegenwart und aus der Perspektive der Existenz der Informations- und Kommunikationstechnologien verständlich, Leibniz avant la lettre als einen der Vordenker der Computertechnologie zu begreifen. In diesem Sinne setzt ein solcher Blick logisch das historische Ereignis voraus, durch das wir die vorangehende Geschichte neu und anders denken.14
Um diesen Gedanken zur Struktur des Verhältnisses von Entwicklung und Ereignis in der Geschichte zu konkretisieren, lässt sich eine Überlegung Slavoj Žižeks fruchtbar machen. Er behauptet,15 dass Kafka seine eigenen Vorgänger hervorbracht habe. Das klingt wie eine logische Unmöglichkeit: Wie kann etwas historisch Späteres etwas historisch Früheres ›hervorbringen‹? Žižek meint damit natürlich nicht, dass durch Kafka Autorinnen und Autoren, die vor ihm geschrieben haben, als Personen plötzlich zu existieren begonnen hätten. Vielmehr ist gemeint, dass Kafkas Werk ein derartiges literarisches Ereignis darstellt, dass das gesamte literarische Feld in Bewegung geraten ist. Durch das Ereignis seines Werks werden neue Linien in der Geschichte der Literatur erkennbar, Nachfolger ebenso wie Vorgänger. Ereignis als Bruch schließt sich hier mit Kontinuität zusammen. In Kafkas Vorgängern war nicht Kafka in kausaler Weise schon angelegt, aber aus der Perspektive von Kafkas Werk können wir rückblickend wie rückwirkend eine Geschichte auch der Vorgänger erzählen. Die Analogie, um die es mir hier geht, sollte klar sein: Die Digitalisierung stellt einen Einschnitt dar, aber dieser Einschnitt ist depotenziert, wenn er entweder als bloß konsequente Vollendung vorher unzureichender Praktiken verstanden wird oder in die Vorgeschichte der Digitalisierung verlegt wird. Die Kategorien der Beschreibung dieser Vorgeschichte werden überhaupt erst unter den Bedingungen der Digitalisierung verständlich. In diesem Sinne möchte ich vorschlagen, dass wir den kategorialen Wandel, der sich in der Gegenwart unter dem Schlagwort der ›Digitalisierung‹ vollzieht, so begreifen, dass er eine retrospektive Vorgeschichte hat, aber durchaus etwas qualitativ Neues meint. Dieses Neue depotenzieren revisionistische Diskurse.
Ich möchte dieses geschichtsphilosophische Argument, das im Hintergrund meiner Kritik an revisionistischen Diskursen steht, noch etwas weiter konkretisieren. Revisionistische Diskurse weiten die technologische Revolution der Digitalisierung anachronistisch aus. Sie begreifen sie so, dass sie alle anderen Technologien und sämtliche Formen der Praxis derart ›schluckt‹, dass erst Beschreibungen aus dem Geiste der Digitalisierung jene überhaupt verständlich machen. Das Argument gegen diese Diskurse lautet, dass sie die Geschichtlichkeit der Digitalisierung insofern leugnen, als sie über keinen tragfähigen Begriff von Geschichte verfügen. Das liegt an der sich selbst nicht in angemessener Weise historisch durchsichtig werdenden teleologischen Natur dieser Diskurse. Anders kann man auch sagen: Selbst wenn eine bestimmte Spielart der Teleologie geschichtsphilosophisch unverzichtbar ist, bringen revisionistische Diskurse nicht die richtige Art dieser Teleologie mit.
Teleologie meint die Zielgerichtetheit eines Prozesses. Die einzelnen zeitlichen Teile des Prozesses, seine Phasen, werden hier durch ihre Rolle für die Verwirklichung des entsprechenden Ziels individuiert. Von einer solchen teleologischen Prozesslogik muss ein leeres Fortschreiten unterschieden werden. Etwas wird in diesem Fall zwar immer anders, aber bleibt dadurch doch gleich, weil es keine entsprechende logische Gliederung aufweist.16 Man kann hier an Abläufe in der unbelebten Natur denken, die zwar durch Naturgesetze beschreibbar sind, aber nur beständige Veränderungen kennen, die durch diese Gesetze erklärbar sind. Das Reich der Geschichte betreten wir dann, wenn wir es einerseits mit einer Zielgerichtetheit zu tun haben, bei der aber andererseits die einzelnen Elemente der Verwirklichung des Ziels in den Sinn des Ziels selbst eingehen und sich dieser Prozess darin selbst durchsichtig werden kann. In diesem Sinne ist die Geschichte weder sinnvoll anhand des Vorbilds von Prozessen im Reich des Lebendigen zu deuten (die ebenfalls teleologisch verfasst sind) noch eine bloße Reihe unverbundener Ereignisse, auf die wir ›unsere‹ Begriffe projizieren, um sie mit Sinn zu versehen (wer das sagt, behandelt Geschichte nach dem Vorbild von Abläufen der unbelebten Natur).17
Mit geschichtlichen Prozessen haben wir es dann zu tun, wenn ein Ereignis einen Beitrag zur Verwirklichung eines bestimmten Begriffs (etwa den des Staates18) leistet, ohne dass der Sinn dessen, woran dieses Ereignis mitarbeitet, schon vor dem Ereignis festgestanden hat.19 Geschichte kann nicht unter Absehung teleologischer Kategorien als Geschichte verstanden werden – aber der Sinn dieser Kategorien steht nicht schon vor dem Gang der Dinge fest. Das Problem revisionistischer Diskurse ist, dass sie das Ereignis tilgen und gerade darin mustergültig eine Verlängerung der Praxis der Digitalisierung darstellen, anstatt eine Theorie der Digitalisierung zu bieten.
Diese Probleme geschichtsphilosophischer Art, die sich als Probleme hinsichtlich der Frage ausweisen lassen, welche Form zeitlicher Logik die Entstehung und Durchsetzung der Digitalisierung exemplifiziert, gehen auf Entscheidungen unter anderem in den symbolphilosophischen Grundlagen zurück. Ich hatte mit Goodman begonnen, um mit einer in dieser Hinsicht plausiblen, aber dennoch auch problematischen Position zu beginnen. Goodman unterbreitet nicht allein einen produktiven Vorschlag, wie sich analoge von digitalen Symbolsystemen unterscheiden lassen. Vielmehr kann er das nur um den Preis, dass er ein Werden von Begriffen von Symbolsystemen nicht denken kann. Goodmans Kategorien bieten ein Raster von Unterscheidungen, das gänzlich insensitiv ist im Hinblick auf Fragen der Geschichtlichkeit und der Praxis.
Natürlich bestreitet Goodman nicht, dass Symbolsysteme historisch entstanden sind und sich entwickelt haben und es hier viel Wissenswertes zu erfahren gibt. Er bestreitet allerdings, dass eine solche Entwicklung selbst Teil der symbolphilosophischen Position sein kann. Trotz aller Betonung der Veränderbarkeit und des konstruktiven Charakters dessen, was Symbolsysteme bezeichnen, sind die Logiken und Formen der Symbolsysteme bei Goodman gegebene, nicht gewordene Logiken und Formen. Dass ein Nachdenken über Digitalisierung als Eigenart von Symbolsystemen auf den Spuren Goodmans mitunter dazu führt, die Digitalisierung selbst historisch vor ihre Implementierung in Form von Praktiken zu verlegen, ist daher nicht verwunderlich. Eine Theorie der Digitalisierung müsste demgegenüber den Versuch unternehmen, sie als Transformation in das Denken selbst einzutragen. Und das muss gar nicht in apologetischer Weise geschehen, sondern kann auch, wie ich im Folgenden versuchen werde, in kritischer Weise geschehen.
Der Begriff des revisionistischen Diskurses kann damit auf zwei unterschiedliche Weisen verwendet werden. Er kann so verwendet werden, dass er besagt, dass sein Bezugsgegenstand eine Revision etablierter Unterscheidungen notwendig macht. Die Digitalisierung ändert grundsätzlich unser Selbst- und Weltverhältnis. Der Begriff kann aber auch so verwendet werden, dass der Diskurs, den diese Positionen entwickeln, selbst eine Revision etablierter Weisen unseres Selbst- und Weltverständnisses darstellt. Es ist charakteristisch für revisionistische Diskurse, dass sie faktisch beides tun: Sie beanspruchen, der Transformation unserer Selbst- und Weltverhältnisse durch die Digitalisierung im Denken Rechnung zu tragen. Faktisch tun sie das dadurch, dass sie die Begriffe zur Explikation unseres Selbst- und Weltverhältnisses selbst einer Revision unterziehen. Sie betreiben eine Form des ›Conceptual Engineering‹, ohne das deutlich zu sagen. Unter dem Stichwort ›Conceptual Engineering‹ werden in der aktuellen Philosophie Diskussionen zur Frage geführt, wie Begriffe geklärt werden sollen. Der Grundgedanke besagt, dass eine philosophische Explikation eines Begriffs dezidiert die Zielstellung dieser Explikation adressieren muss: Wozu und mit welchem Ziel wollen wir die Grenzen eines entsprechenden Begriffs ziehen? Ich finde diese Debatten vor allem hilfreich zur Beschreibung des Vorgehens bestimmter Texte. Angesichts der hier ausgewiesenen Probleme liegt es nahe, eine Alternative zu solchen Diskursen zu suchen. Ich fasse diese Alternative unter dem Begriff der deflationistischen Diskurse.
Deflationistische Diskurse
Deflationistische Diskurse bestreiten, dass die Digitalisierung eine Neufassung des Sinns unserer Grundbegriffe notwendig macht. Diese These kann normativ oder deskriptiv verstanden werden. Die normative Spielart würde besagen, dass es einen vor-digitalen positiven Bezugspunkt unseres Selbst- und Weltverhältnisses gibt, von dem aus die technologischen Entwicklungen zu beurteilen sind. Dieser Bezugspunkt wäre eine Art archimedischer Punkt für die Kritik. Im Sinne dieser These könnte man etwa Folgendes sagen: Das eigentliche Paradigma der Kommunikation ist der mündliche Austausch, digitale Plattformen wie Twitter, Bluesky oder Facebook sind demgegenüber privative und uneigentliche Kommunikationsformen. Das läge aber, so der Gedanke, nicht an ihren problematischen politischen Grammatiken, sondern weil sie gültige Kommunikationsmaßstäbe unterschreiten würden. Man kann hier aber auch an Positionen denken, die die Fülle sinnlicher Erfahrung und körperlicher Aktivität gegen die Verarmung im Reich der binären Codes ausspielen, oder an solche,20 die um die Destabilisierung unseres Zusammenlebens durch die Digitalisierung besorgt sind. Selbst wenn die Implementierung von Informations- und Kommunikationstechnologien disruptiven Charakter haben sollte,21 so ist die Antwort darauf nicht, dass man vorschlägt, dass wir wieder einen ursprünglichen Umgang mit unserem Körper und der ›Natur‹ gewinnen sollten.
Normative Spielarten deflationistischer Diskurse sind zum Scheitern verurteilt. Das liegt weniger daran, dass man sie als Ausdruck einer scheinbar konservativen und fortschrittsfeindlichen Haltung sehen kann. Was hier ›Fortschritt‹ heißt, ist nämlich nicht ohne weiteres im Vorhinein zu entscheiden. Sie scheitern vielmehr daran, dass sie in Wahrheit etwas anderes tun, als sie behaupten. Zur Erinnerung: Damit es sich hier um einen deflationistischen Diskurs normativer Spielart handelt, muss er nicht allein behaupten, dass es einen Bezugspunkt für die Kritik der Digitalisierung gibt, sondern zugleich behaupten, dass die Digitalisierung nichts Relevantes ändert. Aber das geht in Wahrheit nicht zusammen: Um etwas zu kritisieren, muss man es für kritikwürdig halten und zumindest in dieser Hinsicht anerkennen. Man kann nicht zugleich sagen, die Digitalisierung sei irrelevant für unser Selbst- und Weltverhältnis, und dann im Namen eines vor-digitalen Selbst- und Weltverhältnisses gegen sie zu Felde ziehen. Denn indem man das tut, fällt man sich selbst ins Wort und zeigt, dass sie hier eben doch eine Relevanz hat. Normativ-deflationistische Diskurse spielen ein anderes Spiel, als sie auszuweisen in der Lage sind.
Deskriptive Spielarten deflationistischer Diskurse verweisen darauf, dass die Warnungen vor oder die euphorischen Begrüßungen der Digitalisierung diese in ihrer Relevanz überschätzen. Es handelt sich bei Informations- und Kommunikationstechnologien vielmehr um zwar neuartige Technologen, aber um Technologien, die in einer Kontinuität zu vorangehenden Technologien stehen. Sie empfehlen also, begrifflich abzurüsten: Sowohl ein alarmistisches Warnen vor den (vermeintlichen) Gefahren der Digitalisierung ist überzogen als auch die Versprechungen des transhumanistischen Diskurses, wenn diese unter Rekurs auf die fortschreitende Digitalisierung begründet werden. In Wahrheit handelt es sich hier um neue und besonders effiziente Technologien, die uns viel Arbeit abnehmen, aber sich kategorial nicht grundsätzlich von anderen Technologien unterscheiden. In diesem Sinne raten deskriptive Spielarten deflationistischer Diskurse zur Besonnenheit und Mäßigung in der Wortwahl.
Anders als die Geschichtsklitterungen, die revisionistische Diskurse betreiben, anerkennen deflationistische Diskurse deskriptiver Spielart, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien Vorläufer haben. So ist eine E-Mail zwar etwas anderes als ein Brief, aber am Ende des Tages könnte sie funktional verwandt sein mit einem Brief. Und die sozialen Medien beerben vielleicht die Stammtische von ehedem. Deskriptive deflationistische Diskurse bestreiten dabei, dass wir gegenüber dem vor-digitalen Zeitalter einen neuen Begriff unseres Selbst- und Weltverständnisses brauchen. Damit aber unterschätzen sie ebenso wie normative Spielarten deflationistischer Diskurse die Veränderungen in den Bereichen Arbeit, Gegenständlichkeit und Zusammenleben, die sich durch die zunehmende Durchdringung aller Aspekte unserer Lebensform mit den Informations- und Kommunikationstechnologien ergeben.
Das liegt daran, dass es ihnen an einem angemessenen Begriff des Verhältnisses unterschiedlicher Medien wie auch einem angemessenen Begriff des Mediums (und eines solchen von Technologien als Medien22) ermangelt. Man kann E-Mails funktional wie Briefe beschreiben, aber das ist schlichtweg nicht zutreffend. Nicht allein haben sie gegenüber dem Brief ein größeres und auch ein anderes Funktionsspektrum. Vielmehr wandelt sich das, was ein Brief ist, just durch die Entstehung der E-Mail. Was vormals aufgrund medialer Bedingungen eine notwendige Form der Kommunikation war, wird nun eine mögliche Form der Kommunikation. Briefe nach der Entstehung der E-Mail zu schreiben, kann ebenso Ausdruck einer besonderen Wertschätzung sein wie anachronistisch. In einer Zeit, in der Briefe oder der mündliche Austausch Paradigmen waren, ergeben solche Urteile wie das letzte keinen Sinn. Zugleich ändert sich auch der Sinn von Urteilen wie dem ersteren.
Die Entstehung von Medien ist somit nicht additiv zu begreifen; es ist nicht so, dass mit der Entstehung des Fernsehens neben der Zeitung und dem Buch ein weiteres Medium zu den existierenden Medien hinzukommt und sie dieselben bleiben, die sie ehedem waren. Die Veränderung betrifft hier nicht Fragen wie diejenige, ob ein neues Medium ein altes Medium verdrängt.23 So kann man sich sicherlich um das Fortbestehen der Tages- und Wochenzeitungen nach der Erfindung sozialer Medien Sorgen machen und sie müssen in der einen oder anderen Weise auf den Rückgang ihrer Auflagen reagieren. Zentral ist für mich an dieser Stelle ein anderer Gedanke: Die Zeitung ist durch die Entstehung zirkulierender Nachrichten in sozialen Medien etwas anderes geworden, ebenso wie der Brief durch die Entstehung der E-Mail etwas anderes geworden ist. Medien stapeln sich historisch nicht additiv aufeinander, sondern durch die Entstehung und Durchsetzung eines neuen Mediums wird das Feld bestehender Medien derart in Schwingungen versetzt, dass es zu Verschiebungen, Neubestimmungen und mitunter sogar Auslöschungen oder Aufhebungen kommt.24 Deskriptive Spielarten deflationistischer Diskurse operieren mit einem unzureichenden Begriff des Mediums, wenn sie das Verhältnis der Medien zueinander als redundant begreifen.
Ich habe in der Kritik deflationistischer und revisionistischer Diskurse dafür argumentiert, dass sie nicht zuletzt deshalb keinen angemessenen Begriff der Digitalisierung haben, weil sie nicht über einen angemessenen Begriff des Mediums verfügen. Grundsätzlicher