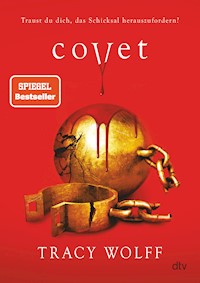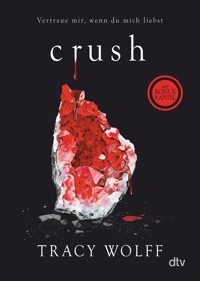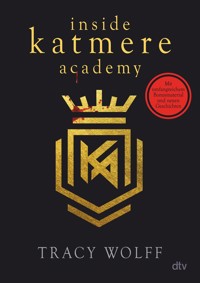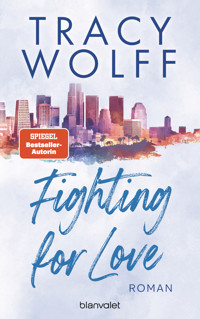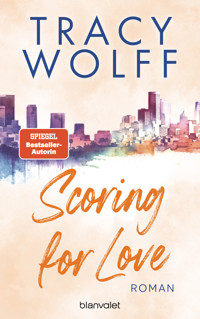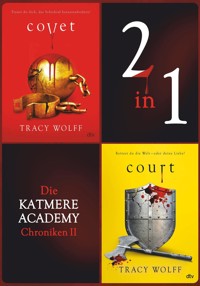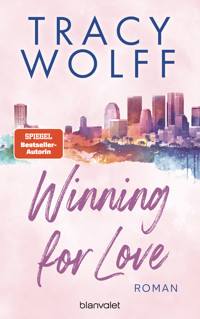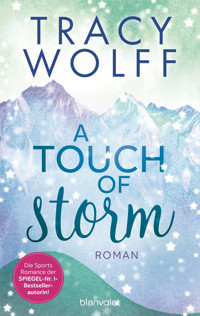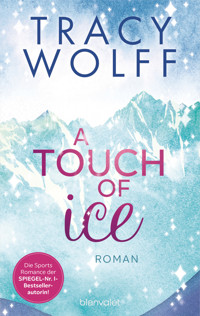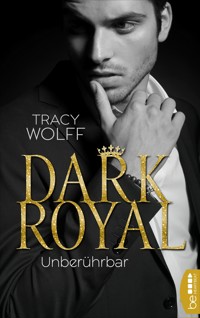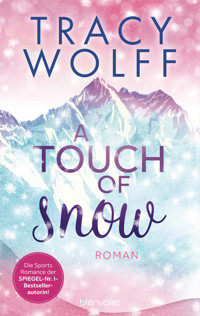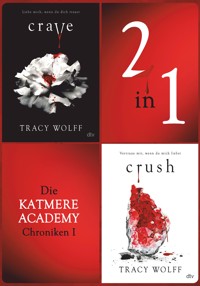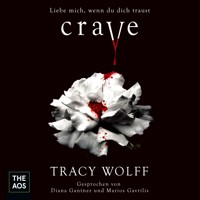
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: The AOS
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Katmere Academy Chroniken
- Sprache: Deutsch
Liebe mich, wenn du dich traust Der Auftakt der beliebten Bestseller-Reihe, die einen die Nächte durchlesen lässt! Nach dem Unfalltod ihrer Eltern verschlägt es Grace buchstäblich ins kalte Exil: die Wildnis von Alaska, wo ihr Onkel ein Internat leitet, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht. Und die Schüler sind nicht weniger mysteriös, allen voran Jaxon Vega, zu dem Grace sich auf unerklärliche Weise hingezogen fühlt – trotz aller Warnungen, dass sie in seiner Nähe nicht sicher ist. Doch Jaxon hat seinen Ruf nicht umsonst: Je näher sie und der unwiderstehliche Bad Boy einander kommen, desto größer wird die Gefahr für Grace. Offensichtlich hat jemand es auf sie abgesehen … Alle Bände der Katmere-Academy-Chroniken: Band 1: Crave Band 2: Crush Band 3: Covet Band 4: Court Band 5: Charm Band 6: Cherish Die Spin-off-Reihe: Die Calder-Academy-Chroniken von Tracy Wolff bei dtv: Band 1: Sweet Nightmare Band 2: Sweet Chaos (erscheint im Herbst 2026) Band 3: Sweet Vengeance (erscheint 2027) Die Bände sind nicht unabhängig voneinander lesbar.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»Er bringt mich mit einem einzigen Blick aus dem Gleichgewicht, zerstört mich mit einem Kuss.«
Vom ersten Moment an weiß Grace, dass sie an der Katmere Academy, dem Internat ihres Onkels in der Wildnis von Alaska, fehl am Platz ist. Zwischen den einzelnen Schülergruppen schwelt ein unausgesprochener Konflikt, doch allen gemeinsam scheint die Ablehnung gegenüber Grace. Aber Grace hat nach dem Tod ihrer Eltern keine Wahl, als in Alaska zu bleiben. Und dann ist da noch Jaxon Vega – düster, unergründlich und unnahbar. Irgendwas an ihm zieht Grace unaufhaltsam in seinen Bann und auch Jaxon scheint ihr nicht widerstehen zu können. Je näher sie einander kommen, desto mehr scheint Graces Leben in Gefahr zu sein. Denn irgendwer hat es auf Grace abgesehen. Und die Bedrohung ist viel größer, als Jaxon und Grace ahnen …
Von Tracy Wolff ist bei dtv außerdem lieferbar:
Crave
Crush
Covet
Court
Charm
Cherish
Star Bringer (zusammen mit Nina Croft)
TRACY WOLFF
crave
Roman
Aus dem amerikanischen Englischvon Katarina Ganslandt
Für meine Jungs die immer an mich geglaubt haben,undfür Stephanie,die mir geholfen hat,selbst wieder an mich zu glauben
0
Wer sein Leben nicht am Abgrund führt, macht sich zu breit
ICH STEHE AM RAND DES ROLLFELDS, starre auf das Flugzeug, in das ich gleich einsteigen soll, und versuche krampfhaft, nicht komplett auszurasten.
Leichter gesagt als getan.
Nicht, weil ich im Begriff bin, mein gesamtes bisheriges Leben hinter mir zu lassen – wobei das bis vor zwei Minuten tatsächlich mein größtes Problem gewesen ist –, sondern weil mich beim Anblick dieses Flugzeugs, von dem ich mir nicht sicher bin, ob es diese Bezeichnung überhaupt verdient, nackte Panik erfasst.
»Alles klar, Grace?« Der Mann, der im Auftrag von meinem Onkel Finn hier ist, um mich abzuholen, sieht mit mildem Lächeln auf mich hinab. Er heißt Philip. Glaube ich jedenfalls. Als er sich mir vorgestellt hat, war das Wummern meines Herzschlags in meinen Ohren so laut, dass ich Schwierigkeiten hatte, ihn zu verstehen. »Bereit, dich ins Abenteuer zu stürzen?«
Scheiße, nein. Bin ich nicht. Weder in ein Abenteuer noch in sonst irgendwas.
Wenn mir vor einem Monat jemand prophezeit hätte, dass ich heute auf einem Flugfeld in Fairbanks, Alaska, stehen würde, hätte ich ihn ausgelacht. Und wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich von Fairbanks aus in dieser winzigen Klapperkiste an den gefühlt äußersten Rand der Welt – oder in meinem Fall an einen Ort am Fuße des Mount Denali, des höchsten Bergs Nordamerikas – fliegen würde, hätte ich ihn für vollkommen durchgeknallt erklärt.
Aber in einem Monat kann sich viel verändern oder – schlimmer noch – für immer ausgelöscht werden.
Es gibt nur eins, worauf ich mich in den letzten Wochen mit absoluter Sicherheit verlassen konnte: Ganz egal, wie schlimm alles ist, es kann immer noch schlimmer werden …
1
Landen ist auch nur abstürzen und hoffen, dass man irgendwie überlebt
»DA VORNE LIEGT HEALY«, verkündet Philip, nachdem wir eine Reihe von Berggipfeln überflogen haben. Er nimmt eine Hand vom Steuerknüppel und deutet auf eine Ansammlung von Gebäuden vor uns in der Ferne. »Home sweet home.«
»Oh, wow. Sieht echt …« Winzig aus? Superwinzig. Viel kleiner als das Stadtviertel, in dem ich bisher gewohnt habe, und natürlich noch viel, viel kleiner als ganz San Diego.
Andererseits kann ich das von hier oben aus nicht wirklich beurteilen. Nicht wegen der dunklen Berge, die wie seit Jahrhunderten schlafende Ungeheuer rings um den Ort aufragen, sondern weil ein merkwürdiges Zwielicht herrscht, das Philip als bürgerlicheAbenddämmerung bezeichnet, obwohl es noch nicht mal siebzehn Uhr ist. Immerhin kann ich erkennen, dass Healy aus lauter wie zufällig zusammengewürfelten Häuschen besteht – mehr Siedlung als Stadt.
»… interessant aus«, beende ich meinen Satz. »Sieht sehr interessant aus.«
In Wirklichkeit sieht es für mich zwar eher nach dem neunten Kreis der Hölle aus, aber ich will Philip, der gerade zum Sinkflug ansetzt, nicht beleidigen. Lieber bereite ich mich innerlich auf den nächsten in einer Reihe von erschütternden Momenten vor, die mich ereilt haben, seit ich vor zehn Stunden in Kalifornien das erste Flugzeug bestiegen habe.
Meine Vorahnung trügt mich nicht. Gerade habe ich eine asphaltierte Fläche unter uns entdeckt, die in diesem Kaff mit seinen knapp tausend Einwohnern (danke, Google) vermutlich als Flugplatz durchgeht, da sagt Philip: »Halt dich fest, Grace. Die Landebahn ist ziemlich kurz, weil eine längere Piste hier draußen kaum schneefrei zu halten ist. Das wird eine Blitzlandung.«
Ich weiß zwar nicht, was ich mir darunter genau vorzustellen habe, aber gut klingt es nicht. Also umklammere ich sicherheitshalber den Griff in der Flugzeugtür, der bestimmt genau dafür erfunden wurde, während wir auf den Boden zurasen.
»Wird schon schiefgehen!«, ruft Philip. Definitiv einer der Top-Five-Sprüche, die man während des Landeanflugs nicht von seinem Piloten hören möchte.
Praktisch im Sturzflug kommen wir dem weißen harten Boden immer näher und ich kneife die Augen zusammen. Sekunden später schrammen die Reifen der Maschine über Asphalt, und Philip bremst so stark ab, dass ich nach vorn geschleudert werde und mich nur der Sicherheitsgurt davor bewahrt, mir den Schädel am Instrumentenbrett einzuschlagen. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Keine Ahnung, welcher Teil des Flugzeugs dieses Dröhnen erzeugt. Lieber nicht darüber nachdenken. Im nächsten Moment setzt ein schrilles Quietschen ein, das lauter wird, als wir nach links wegrutschen.
Mein Herz hämmert so wild, dass ich Angst habe, es könnte jede Sekunde aus meiner Brust katapultiert werden. Die Zähne schmerzhaft in die Unterlippe vergraben, kneife ich weiter fest die Augen zu. Wenn das jetzt mein Ende ist, muss ich es nicht auch noch kommen sehen.
Mir schießt durch den Kopf, ob Mom und Dad ihr Ende wohl haben kommen sehen, und ich habe den Gedanken noch nicht ganz abgewürgt, da bringt Philip das Flugzeug auch schon schlitternd, ruckelnd und bebend zum Stehen.
Mein Körper reagiert ähnlich. Selbst meine Zehen vibrieren.
Vorsichtig schlage ich die Augen auf und widerstehe dem Bedürfnis, mich nach eventuell gebrochenen Knochen abzutasten. Aber Philip lacht nur und behauptet: »Perfekt. Die reinste Bilderbuchlandung.«
Klar. Aus einem Bilderbuch mit Horrorgeschichten vielleicht. Kopfüber von hinten nach vorn gelesen.
Ich sage nichts, sondern ringe mir tapfer ein Lächeln ab, hole meine Handschuhe aus dem Rucksack, der zwischen meinen Beinen steht, und ziehe sie an. Dann öffne ich die Flugzeugtür, springe hinaus und bete, dass meine zittrigen Knie mich tragen.
Tun sie – gerade so.
Eisige Kälte umfängt mich. Hier draußen sind es sicher minus zehn Grad. Ich klappe den Kragen meines frisch angeschafften Daunenmantels hoch und laufe zum Heck des Flugzeugs, um die drei Koffer rauszuholen, die alles sind, was mir von meinem bisherigen Leben geblieben ist.
Ihr Anblick versetzt mir einen schmerzhaften Stich, aber ich darf nicht daran denken, was ich alles zurückgelassen habe, oder dass jetzt fremde Menschen in dem Haus leben, das mal mein Zuhause war.
Was zählen schon ein Haus oder meine zurückgelassenen Zeichensachen oder mein Schlagzeug, wenn ich etwas so viel Kostbareres verloren habe? Ich verdränge jeden Gedanken daran, ziehe den ersten Koffer aus dem engen Gepäckfach des Flugzeugs und wuchte ihn zu Boden. Als ich gerade nach dem nächsten greifen will, erscheint Philip neben mir und hebt die beiden anderen so mühelos heraus, als wären sie mit Federn gefüllt und nicht mit allem, was mir auf dieser Welt noch geblieben ist.
»Auf geht’s, Grace. Wir legen lieber einen Zahn zu, bevor du vor Kälte blau anläufst.« Er nickt in Richtung eines etwa zweihundert Meter entfernten Parkplatzes und ich verkneife mir ein Stöhnen. Im Ernst jetzt? Hier gibt es noch nicht mal ein Flughafengebäude? Mittlerweile zittere ich nicht mehr nur wegen der holperigen Landung. Die Kälte ist echt barbarisch. Wie kann man an so einem Ort bloß leben? Das erscheint mir alles wie ein schlechter Traum, vor allem, wenn man bedenkt, dass ich heute Morgen bei angenehmen zweiundzwanzig Grad aufgewacht bin.
Weil ich aber keine andere Wahl habe, nicke ich ergeben und ziehe meinen Koffer über den Asphalt auf den kleinen Platz zu, der in Healy als Flughafen durchgeht. Das krasse Gegenteil von den hektischen, heillos mit Menschen überlaufenen Terminals in San Diego.
Philip überholt mich mit großen Schritten, in jeder Hand einen schweren Koffer. Ich will ihn gerade darauf hinweisen, dass er sie auch ziehen kann, als ich auf die verschneite Fläche trete. Okay, verstehe. Im Schnee blockieren die Rollen sofort.
Wir haben erst die Hälfte der Strecke zum (immerhin geräumten) Parkplatz zurückgelegt und ich bin trotz meines dicken Mantels und der mit Kunstpelz gefütterten Handschuhe schon halb erfroren. Keine Ahnung, wie ich von hier aus zu dem Internat kommen soll, an dem mein Onkel Schulleiter ist. Ob es in Healy so was wie Uber oder ein anderes Taxiunternehmen gibt? Ich will Philip gerade fragen, da kommt zwischen den geparkten Pick-ups jemand mit ausgebreiteten Armen auf uns zugestürmt.
Der Größe nach zu urteilen, könnte es meine Cousine Macy sein, aber ob sie es tatsächlich ist, lässt sich unter den dicken Klamottenschichten unmöglich erkennen.
»Du bist hier !«, ertönt eine helle Stimme aus den Tiefen des wandelnden Bergs aus regenbogenbuntem, gefüttertem Kapuzenparka, Mütze und mehrfach gewickeltem Schal. Okay, das ist eindeutig Macy.
»Bin ich«, bestätige ich düster, weil ich viel lieber woanders wäre. Ob es wohl zu spät ist, mir noch Pflegeeltern zu suchen? Oder bei Gericht einen Antrag auf vorzeitige Volljährigkeit zu stellen? Ich würde lieber in San Diego auf der Straße leben als an einem Ort, dessen Flughafen aus einer einzigen Landebahn und einem winzigen Parkplatz besteht. Heather wird mich so was von bemitleiden, wenn ich ihr das schreibe.
»Endlich!« Meine Cousine schlingt die Arme um mich. Die Umarmung gerät etwas unbeholfen, was zum einen daran liegt, dass Macy so dick eingepackt ist, und zum anderen daran, dass sie zwar erst sechzehn und damit ein Jahr jünger ist als ich, mich aber trotzdem um mindestens zwanzig Zentimeter überragt. »Ich warte schon seit einer Stunde auf euch.«
»Tut mir leid.« Ich löse mich aus ihrer Umklammerung. »Der Flug aus Seattle nach Fairbanks hatte Verspätung, weil es so gestürmt hat, dass wir erst nicht starten konnten.«
»Ja, das mit den Stürmen hört man öfter.« Sie schüttelt den Kopf. »Echt krasse Wetterverhältnisse dort.«
Eigentlich würde ich jetzt gern sagen, dass die Wetterverhältnisse in dieser Eiswüste, wo sich die Leute astronautenmäßig vermummen müssen, ja wohl um einiges krasser sind, verkneife es mir aber. Macy ist zwar meine Cousine, aber wir haben uns seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen und ich will sie nicht vor den Kopf stoßen. Zusammen mit meinem Onkel Finn und Philip gehört sie zu den einzigen Menschen, die ich hier in Alaska kenne. Und außerdem zu dem kleinen Rest von Familie, der mir noch geblieben ist.
Also zucke ich nur unverbindlich mit den Schultern.
Das scheint eine angemessene Reaktion zu sein, denn Macy lächelt und wendet sich dann an meinen Piloten. »Danke, dass du Grace abgeholt hast, Onkel Philip. Ich soll dir von Dad ausrichten, dass er dir eine Kiste Bier schuldet.«
»Kein Problem, Mace. Ich hatte sowieso was in Fairbanks zu erledigen«, winkt er ab, als wäre ein Rundflug von zweihundert Kilometern kein großes Ding. Andererseits ist es das in dieser Einöde, in der es in jede Richtung nur Massen von Schnee und Bergen gibt, vielleicht tatsächlich nicht. Bei Wikipedia habe ich gelesen, dass Healy mit der Außenwelt nur durch eine einzige Straße verbunden ist, die im Winter wegen des Schnees oft gesperrt ist.
Während der letzten Wochen habe ich immer wieder versucht, mir vorzustellen, wie es in dieser entlegenen Gegend wohl aussehen wird. Wie es sein wird.
Tja, schätze, ich werde es bald herausfinden.
»Dad lässt dir ausrichten, dass er Freitag mit dem Bier zu dir kommt, damit ihr euch das Spiel zusammen anschauen und mal wieder einen richtigen Kumpel-Abend machen könnt.« Macy sieht wieder mich an. »Es tut ihm total leid, dass er dich nicht selbst abholen konnte, in der Schule hat es einen Notfall gegeben, um den er sich kümmern musste. Aber ich soll ihm sofort Bescheid sagen, wenn wir ankommen.«
»Das macht doch nichts«, sage ich. Was soll ich auch sonst sagen? Außerdem habe ich in dem Monat, seit meine Eltern gestorben sind, gelernt, dass im Grunde fast alles egal ist.
Was spielt es für eine Rolle, wer mich abholt, solange ich irgendwie zum Internat komme?
Was spielt es für eine Rolle, wo ich lebe, wenn es nicht zu Hause bei Mom und Dad ist?
Philip begleitet uns zum Rand des Parkplatzes, wo er meine Koffer abstellt. Macy umarmt ihn zum Abschied, ich schüttle ihm die Hand und murmle: »Danke fürs Herbringen.«
»War mir ein Vergnügen. Ruf mich an, falls du mal wieder einen Flug brauchst.« Er zwinkert mir zu, dann dreht er sich um und stapft durch den Schnee zurück zum Rollfeld.
Wir sehen ihm einen Moment lang hinterher. »Kommst du?« Macy greift nach den beiden Koffern. Ich folge ihr, obwohl ich am liebsten hinter Philip herrennen, in das kleine, klapprige Flugzeug klettern und ihn anflehen würde, mich wieder zurück nach Fairbanks zu fliegen. Oder besser, gleich nach San Diego.
Dieser Wunsch wird sogar noch drängender, als Macy sagt: »Falls du mal pinkeln musst, solltest du das jetzt hier erledigen. Bis zur Schule sind wir noch ungefähr anderthalb Stunden bergauf unterwegs.«
Anderthalb Stunden? Das kann unmöglich sein. Diese angebliche Stadt sieht aus, als könnte man in einer Viertelstunde oder maximal zwanzig Minuten von einem Ende zum anderen fahren. Wobei mir jetzt auffällt, dass ich vom Flugzeug aus kein Gebäude gesehen habe, das auch nur annähernd groß genug gewesen wäre, um ein Internat für etwa vierhundert Schüler zu beherbergen, also befindet sich die Katmere Academy vielleicht gar nicht direkt in Healy.
Schaudernd denke ich an all die Berge und Flüsse, von denen der Ort umschlossen ist, und frage mich, wo dieser lange Tag wohl enden wird. Und was stellt sich Macy eigentlich vor, wo ich hier pinkeln soll?
»Schon okay«, sage ich, obwohl mich der Gedanke an die lange Fahrt extrem nervös macht. Ich fand die Reise bis hierher schon anstrengend genug, habe sie aber irgendwie in einer Art Dämmerzustand durchgestanden. Als ich jetzt meinen Koffer durch das Halbdunkel über den Parkplatz ziehe und die beißende Kälte mit jedem Schritt unerträglicher wird, werde ich in rasendem Tempo von der Realität eingeholt. Spätestens als Macy zielstrebig auf einen am Straßenrand parkenden Motorschlitten zusteuert.
Im ersten Moment halte ich es für einen Scherz, aber als sie sich daranmacht, meine Koffer auf den Anhänger zu hieven, ahne ich, dass sie es ernst meint. Sieht aus, als würde ich gleich bei Temperaturen von (laut meiner Handy-App) mehr als zehn Grad unter dem Gefrierpunkt in einem Schneemobil neunzig Minuten in fast kompletter Dunkelheit quer durch Alaska fahren.
Fehlt nur noch das Lachen der bösen Hexe aus dem Zauberer von Oz, die verkündet, dass sie es nicht erwarten kann, sich mich und meinen kleinen süßen Hund Toto zu schnappen. Wobei es eigentlich auch ohne Hexenbeteiligung schon gruselig genug ist.
Fasziniert beobachte ich, wie Macy mein Gepäck mit Riemen routiniert auf dem Schlitten festschnallt. Wahrscheinlich sollte ich ihr irgendwie helfen, aber ich wüsste gar nicht, wie. Und weil ich auf gar keinen Fall möchte, dass die wenigen Besitztümer, die mir noch geblieben sind, irgendwo verstreut in den Weiten Alaskas enden, halte ich es für das Vernünftigste, die Befestigungsarbeit der Expertin zu überlassen.
»Moment noch.« Macy öffnet eine mitgebrachte Sporttasche, wühlt darin und zieht eine dick gefütterte Skihose und einen langen Wollschal heraus – beides in Knallpink. »Hier. Die wirst du brauchen.« Pink war als kleines Mädchen meine absolute Lieblingsfarbe, jetzt nicht mehr so. Trotzdem bin ich irgendwie gerührt, dass Macy sich das seit unserer letzten Begegnung gemerkt hat.
»Danke.« Ich ringe mir ein Lächeln ab und zerre die Skihose über meine mit Emojis bedruckte Jogginghose, unter der ich lange Thermounterwäsche trage, die ich auf dringendes Anraten meines Onkels hin vor dem Abflug in Seattle angezogen habe. Danach versuche ich mir den Wollschal so um Hals und Gesicht zu wickeln, wie Macy es mit ihrem regenbogenfarbenen Schal gemacht hat.
Das ist gar nicht so einfach, weil er mir immer wieder von der Nase rutscht, sobald ich den Kopf drehe.
Irgendwann habe ich den Trick raus und Macy reicht mir einen der Helme, die über dem Lenker des Schneemobils hängen.
»Hier. Der ist isoliert und bewahrt dich nicht nur vor einem Schädelbruch, falls wir einen Unfall haben, sondern hält dich auch warm«, sagt sie. »Außerdem schützt das Visier deine Augen vor der kalten Luft.«
»Weil mir sonst die Augäpfel einfrieren?«, frage ich erschrocken. Es ist schon schwer, unter dem dicken Schal ausreichend Luft zum Atmen zu bekommen. Mit Helm ersticke ich wahrscheinlich.
»Augäpfel können nicht einfrieren«, sagt Macy mit einem nachsichtigen Lachen. »Aber es ist angenehmer, weil die Augen nicht so vom Fahrtwind tränen.«
»Ach so, ja, klar, Fahrtwind«, sage ich verlegen. »Was für eine bescheuerte Frage.«
»Nein, überhaupt nicht.« Macy legt mir einen Arm um die Schultern. »Es gibt eine Menge Dinge zu lernen, wenn man das erste Mal in Alaska ist. Das geht am Anfang allen so. Aber du wirst dich schnell zurechtfinden, versprochen.«
Da bin ich mir nicht so sicher. Im Moment kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich mich in dieser kalten, fremden Welt jemals heimisch fühlen werde – aber das behalte ich für mich, um meine Cousine nicht zu verletzen. Sie gibt sich solche Mühe, alles dafür zu tun, dass ich mich wohlfühle.
»Es tut mir so leid, dass du herkommen musstest, Grace«, sagt sie und schiebt schnell hinterher: »Also, ich meine … Ich freue mich natürlich mega, dass du da bist. Ich wünschte mir nur, es wäre nicht deswegen, weil …« Ihre Stimme wird leiser und sie beendet den Satz nicht.
Das kenne ich schon. Nachdem mich meine Freunde und Lehrer wochenlang wie ein rohes Ei behandelt haben, habe ich begriffen, dass niemand es aussprechen möchte. Aber ich bin zu erschöpft, um irgendwas zu sagen, was es ihr leichter machen würde. Stattdessen schiebe ich mir meine widerspenstigen Locken aus dem Gesicht, um den Helm überzustülpen, und befestige den Riemen so unter dem Kinn, wie Macy es mir zeigt.
»Bist du bereit?«, fragt sie, nachdem ich meine Schutzausrüstung angelegt habe.
Die Antwort auf diese Frage wäre zwar ehrlicherweise immer noch dieselbe wie bei Philip in Fairbanks, aber ich nicke erneut und sage: »Ja, klar. Absolut.«
Ich warte, bis Macy auf das Schneemobil gestiegen ist, und klettere dann hinter sie.
»Schling einfach die Arme um mich und halt dich fest«, ruft sie über das Röhren des Motors hinweg, und in der nächsten Sekunde rasen wir auch schon durch die fahle Dunkelheit, die sich ringsherum erstreckt.
Ich habe noch nie solche Angst gehabt.
2
Nur weil du in einem Turm lebst, bist du noch lange kein Prinz
DIE FAHRT IST DANN DOCH nicht so schlimm wie befürchtet.
Angenehm zwar auch nicht, aber das hat mehr damit zu tun, dass ich schon den ganzen Tag unterwegs bin und endlich irgendwo – egal wo – ankommen will, von wo ich nicht nach kurzem Zwischenaufenthalt schon wieder in das nächste Flugzeug steigen muss. Oder auf ein Schneemobil.
Wenn dieser Ort beheizt wäre und frei von Vertretern der hier ansässigen Tierwelt, die ich unterwegs in der Ferne heulen höre, wäre ich voll dabei. Mittlerweile fühlt sich alles unterhalb der Hüfte komplett taub an. Ich frage mich gerade, wie ich es jemals schaffen soll, meine eingeschlafenen Pobacken wieder aufzuwecken, als Macy scharf abbiegt, den Weg verlässt, dem wir bis jetzt gefolgt sind (wobei »Weg« in diesem Fall eher großzügig eine ungefähre Richtung beschreibt), und einen Hang hinauffährt. Wir schlängeln uns in Serpentinen durch den Nadelwald bergauf und kurz darauf sehe ich in der Dunkelheit Lichter funkeln. »Ist das die Katmere Academy?«, rufe ich.
»Genau.« Macy schaltet einen Gang runter und steuert den Motorschlitten im Slalomkurs zwischen den Bäumen hindurch. »Nur noch ein paar Minuten, dann sind wir da.«
Dem Himmel sei Dank. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir trotz der dicken Socken mindestens ein bis drei Zehen abgefroren wären, wenn die Fahrt noch länger gedauert hätte. Natürlich wusste ich, dass Alaska kalt ist, aber dass es so kalt sein würde … darauf war ich nicht vorbereitet.
Wieder dringt irgendwo aus der Tiefe der Wälder das Heulen eines wilden Tiers an mein Ohr, aber ich achte nicht darauf, weil wir in diesem Moment den Wald verlassen und uns dem Internatsgebäude nähern, dessen Anblick sofort meine gesamte Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Wobei Gebäude viel zu modern klingt. Es sieht aus wie ein Schloss. In den vergangenen Wochen habe ich im Netz immer mal wieder nach der Katmere Academy gesucht, weil ich mir ein Bild meiner zukünftigen Schule machen wollte, konnte aber nirgends auch nur den kleinsten Hinweis darauf entdecken. Anscheinend ist die Schule so elitär, dass noch nicht mal Google sie kennt.
Die Anlage ist gigantisch. Wirklich gigantisch. Von hier aus sieht es aus, als würde sich die Backsteinmauer, die das Gelände umgibt, über den halben Berg erstrecken.
Solche Prachtbauten kannte ich bisher nur von Abbildungen europäischer Schlösser oder Kirchen aus dem Kunstunterricht, in echt habe ich so etwas noch nie gesehen. Spitzbögen, Strebepfeiler und hohe Fenster mit filigraner Steinmetzarbeit dominieren die Fassade.
Als wir näher kommen, entdecke ich auf den Dächern und Zinnen steinerne Dämonen – Wasserspeier, wie man sie von gotischen Kathedralen kennt. Ich weiß, dass meine Fantasie mit mir durchgeht, aber ich wäre nicht überrascht, wenn wir drinnen von Quasimodo persönlich empfangen werden würden.
Macy bremst vor dem großen schmiedeeisernen Tor ab und tippt einen Code ein, worauf die Flügel aufschwingen und die Fahrt weitergeht.
Ich komme mir vor, als wäre ich in einem Horrorfilm gelandet oder in einem Gemälde von Salvador Dalí – das ist alles total surreal. Über Macys Schulter spähend stelle ich fest, dass die Katmere Academy zwar in einem Schloss untergebracht, aber immerhin nicht von einem Wassergraben umgeben ist. Da ist auch kein Feuer speiender Drache, der den Eingang bewacht. Die lange, gewundene Zufahrt sieht aus wie die von anderen Nobelinternaten, die ich aus Filmen kenne. Der einzige Unterschied ist, dass sie – Überraschung! – tief verschneit ist. Wir fahren direkt auf das riesige Eingangsportal mit seinen gewaltigen, uralten Flügeltüren zu.
Ich schüttle den Kopf, weil ich das alles einfach nicht glauben kann. Wo bin ich hier nur gelandet?
»War doch gar nicht so schlimm, oder?«, ruft Macy, als sie so abrupt zum Stehen kommt, dass der Schnee unter den Kufen nach allen Seiten stiebt. »Und wir haben nicht mal ein Karibu gesehen, geschweige denn einen Wolf.«
Weil das stimmt, nicke ich und lasse mir nicht anmerken, dass ich völlig eingeschüchtert bin. Und dass sich mein Magen vor Nervosität zu einem festen Knoten zusammengezogen hat, weil meine Welt zum zweiten Mal innerhalb von einem Monat komplett auf den Kopf gestellt worden ist.
Ich tue so, als wäre alles okay.
»Am besten bringen wir erst mal dein Gepäck ins Zimmer, damit du dich ein bisschen ausruhen kannst.«
Macy steigt vom Schlitten und zieht sich den Helm mitsamt der Mütze vom Kopf. Ich lächle, als ich zum ersten Mal ihre kurzen, fedrig geschnittenen Haare sehe, die in allen Regenbogenfarben leuchten. Normalerweise müssten sie ihr platt am Kopf kleben, nachdem sie stundenlang Helm und Mütze aufhatte, aber Macy wirkt, als käme sie frisch vom Friseur.
Was perfekt zu ihrer übrigen Erscheinung passt. In der farblich aufeinander abgestimmten Kombi aus Daunenjacke, Schneehose und Stiefeln könnte sie auch Cover-Model eines Modemagazins zum Thema »Wildes Alaska« sein.
Ich sehe dagegen wahrscheinlich aus, als hätte ich mir einen Kampf mit einem mies gelaunten Karibu geliefert. Den ich verloren habe. Haushoch. Und genauso fühle ich mich auch.
Meine Cousine löst die Riemen von den Koffern und hebt sie vom Anhänger. Ich nehme in jede Hand einen und gehe zu der großen Freitreppe, die zum Eingangsportal hinaufführt, bleibe aber schon nach ein paar Stufen stehen und ringe nach Luft.
»Das ist der Höhenunterschied«, erklärt Macy und nimmt mir einen Koffer aus der Hand. »San Diego liegt direkt an der Pazifikküste und hier sind wir fast zweitausend Meter über dem Meeresspiegel. Es wird ein paar Tage dauern, bis du dich daran gewöhnt hast, dass die Luft hier oben viel dünner ist.«
Die Vorstellung, nicht genug Sauerstoff zu bekommen, reicht aus, um die Panikattacke zu triggern, die ich den ganzen Tag mit Mühe unterdrückt habe. Ich schließe die Augen und hole tief Luft – oder jedenfalls so tief, wie das hier möglich ist.
Einatmen, fünf Sekunden halten, ausatmen. Einatmen, zehn Sekunden halten, ausatmen. Einatmen, fünf Sekunden halten, ausatmen. Genau wie Heathers Mutter, Dr. Blake, es mir vorgemacht hat. Sie ist Psychotherapeutin und hat mir ein paar Methoden gezeigt, um mit den Angstattacken umzugehen, die mich immer wieder überfallen, seit meine Eltern verunglückt sind. Allerdings weiß ich nicht, ob ihre Tipps mir in dieser Situation wirklich helfen können.
Aber ich kann auch nicht ewig so reglos wie die steinernen Wasserspeier, die auf mich herabstarren, auf der Treppe stehen bleiben. Vor allem, weil ich selbst durch die geschlossenen Lider Macys besorgten Blick auf mir spüre.
Also hole ich noch mal tief Luft, öffne die Augen und schenke meiner Cousine ein Lächeln, das eine Zuversicht ausstrahlt, die ich nicht empfinde. »Geht gleich wieder«, sage ich.
»Ganz bestimmt.« Sie nickt mitfühlend. »Lass dir Zeit. Ich bringe schon mal die Koffer hoch.«
»Nein, nein. Das schaffe ich schon.«
»Es ist echt okay, Grace. Ruh dich kurz aus.« Macy hebt die Hand zur universellen »Bleib wo du bist«-Geste. »Wir haben es nicht eilig.«
Widerspruch ist zwecklos, das spüre ich. Zumal die Panikattacke, gegen die ich ankämpfe, es noch schwieriger macht, genügend Luft zu bekommen. Also nicke ich gehorsam und sehe zu, wie sie meine Koffer – einen nach dem anderen – zum Eingang hochschleppt.
Im Augenwinkel nehme ich eine flüchtige Bewegung über meinem Kopf wahr. Etwas, das, kaum habe ich es bemerkt, schon wieder verschwunden ist. Habe ich es mir nur eingebildet? Nein, da ist es wieder. In einem erleuchteten Fenster des höchsten Turms blitzt kurz etwas Rotes auf.
Eigentlich kann es mir egal sein, aber aus irgendeinem Grund lege ich den Kopf in den Nacken, schaue nach oben und warte darauf, dass es – was immer es ist – sich noch einmal zeigt.
Ich muss nicht lange warten.
Da schaut jemand aus dem Fenster. Ich kann ihn nicht deutlich sehen, dazu steht er zu weit oben und ist durch die Scheibe nur verzerrt zu erkennen, aber es scheint ein Typ zu sein. Ein Typ in einem roten Hoodie. Markantes Gesicht, dunkler Haarschopf.
Es gibt keinen Grund, das irgendwie bedeutungsvoll zu finden – erst recht keinen, ihn so anzustarren –, und doch halte ich den Blick wie hypnotisiert nach oben gerichtet, bis Macy alle drei Koffer die Treppe hochgetragen hat.
»Meinst du, du schaffst den Aufstieg jetzt?«, ruft sie zu mir herunter.
»Ach so, äh, ja. Klar.« Ich mache mich daran, die letzten etwa dreißig Stufen zu erklimmen, und ignoriere das Schwindelgefühl. Höhenkrankheit – noch so was, mit dem ich mich in San Diego nie herumschlagen musste.
Toll.
Als ich noch ein letztes Mal zu dem Fenster hochschaue, bin ich nicht überrascht, dass niemand mehr dort steht. Trotzdem versetzt es mir einen unerklärlichen Stich der Enttäuschung, über den ich aber nicht weiter nachdenke. Ich habe gerade weiß Gott größere Sorgen.
»Echt irre, dass das Internat in einem Schloss ist ! Total unglaublich«, sage ich zu meiner Cousine, als sie einen der hohen Türflügel aufstößt.
Und dann bleibt mir gleich noch mal die Luft weg. So beeindruckend das Gebäude mit den Bögen und Steinmetzarbeiten von außen aussah – beim Anblick der prächtigen Eingangshalle verschlägt es mir die Sprache. Ich bin fast versucht, einen tiefen Knicks zu machen. Oder wenigstens eine Verbeugung mit Kratzfuß. Einfach … unglaublich.
Ich weiß nicht, was ich zuerst bestaunen soll, den kunstvoll gearbeiteten schwarzen Kristalllüster, der von der hohen Decke hängt, oder den mächtigen Kamin mit dem prasselnden Feuer, der die gesamte rechte Seite der Halle einnimmt.
Letztlich ist es aber der Kamin, der mich magnetisch anzieht, weil: Wärme ! Außerdem ist er ein absolutes Schmuckstück mit seiner aus Stein gehauenen Umrandung und dem geschmiedeten, in buntem Bleiglas gefassten Kamingitter, das das Licht der Flammen im ganzen Raum funkeln lässt.
»Ziemlich cool, was?« Macy grinst.
»Total cool«, raune ich ehrfürchtig. »Es ist …«
»… magisch. Ich weiß.« Sie schaut mich an und wackelt mit den Brauen. »Willst du noch mehr sehen?«
Will ich! Damit Macy nicht wieder die Schwerarbeit leisten muss, greife ich diesmal nach den beiden größeren Koffern und überlasse ihr den kleinsten, bevor wir losgehen. Zwar bin ich längst noch nicht davon überzeugt, dass ich tatsächlich in Alaska bleiben will, aber das heißt ja nicht, dass ich mich hier nicht ein bisschen umschauen kann. Ich meine, hey, es ist immerhin ein Schloss. Ein Schloss mit dicken Steinmauern und farbenprächtigen Wandteppichen, an denen ich nicht vorbeikomme, ohne immer wieder kurz staunend stehen zu bleiben, während ich Macy in eine Art Gemeinschaftssaal folge.
Was dann kommt, ist der nicht so tolle Teil dieser Schlossführung. Eigentlich hatte ich ja gehofft, erst mal keinen anderen Menschen begegnen zu müssen. Aber hier sind lauter kleine Grüppchen von Schülern, die zusammenstehen und sich lachend unterhalten oder über Bücher, Laptops oder Handys gebeugt an alten Holztischen sitzen. Im hinteren Bereich des Raums hängt ein gigantischer Fernseher, davor stehen ein paar antik wirkende, mit goldenem und rotem Brokatstoff bezogene Sessel und kleine Sofas, auf denen sechs Jungs hocken und von Mitschülern umringt auf einer Xbox zocken.
Als wir mit den Koffern an ihnen vorbeimarschieren, fällt mir auf, dass sie nur so tun, als wären sie ins Spiel vertieft, genau wie die anderen sich nicht wirklich auf ihre Gespräche, Bücher oder Handys konzentrieren. Stattdessen beobachten alle verstohlen, wie Macy mich quer durch den Saal führt. Oder sollte ich besser sagen: wie sie mich vorführt?
Mein Magen zieht sich zusammen. Ich husche geduckt hinter meiner Cousine her und versuche mir mein Unbehagen nicht anmerken zu lassen. Natürlich verstehe ich, dass sie neugierig auf »die Neue« sind – die noch dazu die Nichte des Internatsleiters ist –, aber es zu verstehen, macht es nicht leichter, die Blicke so vieler fremder Leute zu ertragen. Vor allem, weil meine Locken durch den Helm mit Sicherheit total platt gedrückt sind.
Ich bin zu sehr damit beschäftigt, jeglichen Augenkontakt zu vermeiden und vor Panik nicht in Schnappatmung zu verfallen, als dass ich irgendwas sagen könnte. Erst als wir am anderen Ende in einen Gang treten, platze ich heraus: »Ich fasse es nicht, dass du echt hier zur Schule gehst.«
»Du jetzt auch«, erinnert Macy mich mit leisem Lachen.
»Ja, schon, aber …« Ich bin neu hier und habe mich noch nie in meinem ganzen Leben irgendwo so fehl am Platz gefühlt.
»Aber …?«, wiederholt sie mit hochgezogenen Brauen.
»Das ist alles ein bisschen viel.« Ich bleibe kurz stehen, um die farbenprächtigen Glasfenster zum Hof und die in den Stein gemeißelten Verzierungen im Deckengewölbe zu bewundern.
»Ich weiß.« Macy wartet, bis ich wieder zu ihr aufgeholt habe. »Aber es ist auch Zuhause.«
»Dein Zuhause«, flüstere ich und versuche, nicht an das Haus zu denken, von dem ich mich vor Kurzem für immer verabschieden musste. Das einzig annähernd Exzentrische dort waren die vielen Windspiele und Windräder, mit denen Mom die vordere Veranda dekoriert hatte.
»Unser Zuhause. Warte es nur ab.« Sie zieht ihr Handy aus der Jacke und tippt eine Nachricht ein. »Ich schreibe Dad schnell, dass du da bist. Er hat mich gebeten, schon mal die Zimmersituation mit dir zu besprechen.«
»Die Zimmersituation?« Hier spukt es bestimmt und nachts huschen Geister oder scheppernde leere Ritterrüstungen durch die Zimmer.
»Ja, weil die Einzelzimmer in diesem Halbjahr eigentlich alle schon vergeben sind. Dad hat vorgeschlagen, dass wir zwei Leute zusammenlegen könnten, damit du eins für dich bekommen kannst, aber ich wollte dich fragen, ob du vielleicht Lust hast, bei mir einzuziehen.« Sie lächelt zaghaft. »Ich könnte es natürlich total verstehen, wenn du lieber allein wohnen willst, so kurz nach …«
Wieder ein Satz, der nicht zu Ende gesprochen wird. Normalerweise gehe ich nicht darauf ein, aber diesmal kann ich mir nicht verkneifen zu fragen: »Nach was?«
Ich will einfach, dass jemand es endlich laut ausspricht. Vielleicht fühlt es sich dann realer an und weniger nach einem schrecklichen Albtraum.
Aber als Macy blass wird, begreife ich, dass sie sicher nicht diejenige sein wird. Und dass es unfair von mir ist, das von ihr zu erwarten.
»Tut mir leid«, flüstert sie und ihre Augen glitzern verdächtig, als würde sie gleich anfangen zu weinen. Hinter meinen Lidern beginnt es auch sofort zu prickeln, aber das tue ich ihr – und mir – nicht an. Das Einzige, was mich bisher vor einem Zusammenbruch bewahrt hat, ist mein emotionaler Stachelpanzer und mein Talent zur Verdrängung.
Ich werde ganz bestimmt nicht riskieren, beides zu verlieren. Nicht hier vor meiner Cousine und allen anderen, die möglicherweise an uns vorbeikommen. Nicht, nachdem ich – den Blicken von eben nach zu urteilen – gerade zur neuesten Attraktion in diesem Zirkus erklärt worden bin.
Statt mir also bei Macy die Umarmung abzuholen, die ich so dringend bräuchte, und mir einzugestehen, wie sehr ich mein Zuhause vermisse und meine Eltern und mein Leben, straffe ich die Schultern und ringe mir das überzeugendste Lächeln ab, zu dem ich imstande bin. »Okay. Dann zeig mir doch mal unser Zimmer.«
Macys Blick ist zwar immer noch besorgt, aber ihre Augen strahlen wieder. »Unser Zimmer? Bist du sicher?«
Ich seufze innerlich und gebe meinem schönen Traum von einem kleinen bisschen Ruhe und Ungestörtheit den Abschiedskuss. Wobei, so ein Drama ist es dann auch wieder nicht. Ich habe in den letzten Wochen weitaus mehr verloren als meine Privatsphäre. »Ganz sicher. Deine Mitbewohnerin zu werden klingt absolut perfekt.«
Ich habe meine Cousine eben vor den Kopf gestoßen, was absolut nicht meine Art ist. Genauso wenig, wie es meine Art wäre, jemand anderen aus seinem Zimmer zu vertreiben. Das wäre nicht nur total egoistisch und würde nach Bevorzugung von Familienmitgliedern aussehen, sondern wäre garantiert auch eine todsichere Methode, mich hier bei allen unbeliebt zu machen – was definitiv nicht auf meiner To-do-Liste steht.
»Cool.« Macy breitet strahlend die Arme aus und drückt mich kurz, aber fest an sich. Dann holt sie wieder ihr Handy raus und verdreht die Augen. »Dad hat noch nicht geantwortet. Er schaut nie nach, ob er Nachrichten hat. Was hältst du davon, wenn du kurz hier wartest, während ich ihn schnell holen gehe? Er wollte dich unbedingt sofort sehen, sobald wir angekommen sind.«
»Ich kann doch mit…«
»Nicht nötig.« Sie deutet auf eine Nische neben einem prächtigen Treppenaufgang, in der zwei zierliche Barocksessel an einem Tischchen stehen, auf dem ein Schachbrett aufgebaut ist. »Setz dich solange hin und ruh dich ein bisschen aus, Grace. Du bist total erschöpft, kein Wunder nach der anstrengenden Reise.«
Weil sie recht hat – und mir außerdem der Kopf wehtut und meine Lunge sich weiterhin wie eingeschnürt anfühlt –, nicke ich und lasse mich in einen der Sessel fallen. Ich bin wirklich unfassbar müde. Am liebsten würde ich den Kopf ins Polster lehnen und ein paar Minuten einfach nur die Augen schließen. Aber ich habe Angst, dass ich dann sofort einschlafen würde, und möchte auf gar keinen Fall das Mädchen sein, das an ihrem ersten Tag an der neuen Schule (… oder an irgendeinem anderen Tag) komatös im Gang entdeckt wird. Am besten noch mit übers Kinn rinnendem Sabberfaden.
Mehr, um mich irgendwie zu beschäftigen, als aus echtem Interesse greife ich nach einer der steinernen Schachfiguren auf dem Brett, um sie mir genauer anzusehen. Mir stockt kurz der Atem, als ich erkenne, dass die Figur einen Vampir darstellt, komplett mit wehendem Umhang und gebleckten Fangzähnen. Das ist ein bisschen unheimlich, aber auch witzig, weil es perfekt zur Atmosphäre in diesem Gruselschloss passt.
Neugierig geworden, beuge ich mich vor, nehme eine der Figuren von der anderen Seite und lache beinahe laut auf, als ich sehe, dass es ein Drache ist – majestätisch und zugleich bedrohlich mit weit ausgebreiteten Schwingen. Er ist unglaublich filigran gearbeitet. Wunderschön.
Wie überhaupt das gesamte Schachspiel.
Ich stelle ihn wieder zurück und greife nach der danebenstehenden Figur. Einem Drachen, der mit seinem schläfrigen Blick und den gefalteten Flügeln etwas weniger gefährlich aussieht. Behutsam drehe ich ihn zwischen den Fingern, fasziniert von der Sorgfalt, mit der der Künstler auch die feinsten Einzelheiten – von den Flügelspitzen bis hin zu den gekrümmten Klauen – aus dem Stein geschnitten hat. Bisher habe ich mich nie sonderlich für Schach begeistert, aber dieses Set könnte das ändern.
Ich stelle den Drachen wieder zurück und suche unter den Vampiren nach der Dame. Sie ist als Königin dargestellt, überirdisch schön, mit langen glatten Haaren, auf denen eine Krone sitzt, und einem reich verzierten Umhang.
»Vorsicht. Sie ist ziemlich bissig.« Die leise, leicht grollende Stimme erklingt so dicht an meinem Ohr, dass ich erschrocken aufspringe und die Schachfigur auf das Brett klappert. Ich wirble herum und stehe dem einschüchterndsten Typen aller Zeiten gegenüber. Und zwar nicht, weil er so umwerfend gut aussieht – obwohl er das zweifellos tut …
Aber das allein ist es nicht. Da ist noch etwas anderes an ihm. Etwas, das fremdartig ist und intensiv und überwältigend. Unmöglich in Worte zu fassen. Sein Gesicht wäre im neunzehnten Jahrhundert schwärmerisch in Gedichten besungen worden. Eine Spur zu markant, um schön zu sein, und gleichzeitig zu einzigartig, um es nicht zu sein.
Hohe Wangenknochen wie gemeißelt.
Volle rote Lippen.
Scharf geschnittenes Kinn.
Schimmernde Alabasterhaut.
Und seine Augen … undurchdringliche Obsidiane. Augen, die alles sehen und nichts preisgeben, umkränzt von unverschämt langen Wimpern.
Und das Schrecklichste ist: Diese allwissenden Augen sind laserstrahlartig auf meine gerichtet. In mir steigt die Angst auf, sie könnten all die Dinge sehen, die ich so angestrengt zu verstecken versuche. Ich senke die Lider, will wegschauen, schaffe es aber nicht. Sein Blick hält mich gefangen und ich bin wie hypnotisiert von den magnetischen Schwingungen, die er aussendet.
Ich schlucke trocken und versuche, durchzuatmen.
Was mir nicht gelingt.
Jetzt grinst er auch noch. Hebt einen Mundwinkel zu einem Lächeln, das jede einzelne meiner Fasern durchdringt. Dieses schiefe Lächeln macht alles noch schlimmer, denn es sagt mir, dass er genau weiß, welche Wirkung er auf mich hat. Schlimmer noch, dass er es genießt.
Mit einem Mal steigt solche Wut in mir auf, dass die betäubende Eisschicht, in der ich seit dem Tod meiner Eltern eingeschlossen war, zu schmelzen beginnt. Sie reißt mich aus meiner inneren Starre, die das Einzige war, das mich davon abgehalten hat, jede Sekunde jedes einzelnen langen Tags, der seitdem vergangen ist, laut in die Welt hinauszubrüllen, wie verflucht ungerecht und gemein es ist, dass mein Leben aus nichts anderem mehr besteht als aus Schmerz und Entsetzen und Hilflosigkeit.
Das ist kein gutes Gefühl. Und dass es dieser Typ ist, der es in mir auslöst – dieser Typ mit seinem Grinsen und seinem schönen Gesicht und den kalten Augen, die nicht bereit sind, mich loszulassen, mir aber gleichzeitig nicht das Geringste über ihn preisgeben –, macht mich noch zorniger.
Die Wut verleiht mir aber auch die Kraft, mich zu befreien. Ich reiße den Blick von seinem los und suche verzweifelt nach etwas anderem, auf das ich ihn heften kann.
Das Problem ist, dass er direkt vor mir steht und die Sicht auf alles andere versperrt.
Um ihm nicht in die Augen schauen zu müssen, senke ich den Blick auf seinen Körper – seinen hochgewachsenen, schlanken Körper. Ja, genau: großer Fehler. Er hat eine enge schwarze Jeans an und ein schwarzes T-Shirt, das seinen flachen Bauch und seine muskulösen Arme perfekt in Szene setzt. Ganz zu schweigen von seinen Schultern, die so breit sind, dass ich beim besten Willen nicht daran vorbeischauen kann. Dazu die dichten, schwarzen Haare, die eine Spur zu lang sind, sodass sie ihm ins Gesicht fallen und den Blick der Betrachterin – also meinen – auf seine absurd hohen Wangenknochen lenken, worauf mir nichts anderes übrig bleibt, als zu kapitulieren und zuzugeben, dass dieser Typ, arrogantes Grinsen hin oder her, verflucht sexy ist.
Er hat etwas Abgründiges und Ungezähmtes an sich und strahlt mit jeder Pore Gefahr aus.
Die wenigen Sauerstoffpartikel, die ich trotz der ungewohnten Höhenluft erfolgreich in meine Lungen gepumpt hatte, lösen sich in nichts auf. Was mich nur noch mehr aufregt. Weil … Was soll das? Jetzt mal im Ernst. Wann habe ich mich bitte in die Protagonistin eines dämlichen Young-Adult-Romans verwandelt? In das Klischee des Mädchens, das neu an eine Schule kommt und sich von der ersten Sekunde an in den heißesten, unerreichbarsten Bad Boy verliebt?
Kotz, würg und nein. Die Rolle werde ich in dieser Geschichte hier garantiert nicht übernehmen.
Fest entschlossen, meine seltsame Gefühlsanwandlung im Keim zu ersticken, zwinge ich mich dazu, ihm noch mal ins Gesicht zu schauen. Und als sich unsere Blicke diesmal treffen, erkenne ich, dass es scheißegal ist, ob ich hier irgendein dämliches und überstrapaziertes Klischee erfülle oder nicht.
Er erfüllt es nämlich nicht.
Ich muss ihm nur noch mal in die Augen sehen, um mit absoluter Sicherheit zu wissen, dass dieser Typ mit dem verschlossenen Blick und der düsteren Ausstrahlung ganz bestimmt nicht der Held einer Geschichte ist. Am allerwenigsten meiner Geschichte.
3
Vampirköniginnen sind nicht die einzig bissigen Geschöpfe
WEIL UNSER BLICKDUELL FÜR MEINEN GESCHMACK ein bisschen zu sehr in eine Machtdemonstration abgleitet, suche ich nach einer Möglichkeit, mich wieder auf sicheres Terrain zu begeben, und reagiere – mit Verspätung – auf das Einzige, was er bis jetzt zu mir gesagt hat. »Entschuldige. Von wem hast du gerade gesprochen? Wer ist bissig?«
Er greift nach der Dame und hält sie mir hin. »Die hier ist nicht besonders freundlich.«
Ich sehe ihn an. »Äh. Das ist eine Schachfigur.«
Er erwidert meinen Blick mit seinen Obsidianaugen. »Und was willst du damit sagen?«
»Damit will ich sagen, dass das eine Schachfigur ist. Aus Marmor. Die kann niemanden beißen.«
Er wiegt den Kopf. »›Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Hölle, Horatio, als Eure Schulweisheit sich träumen lässt.‹«
»Erde«, korrigiere ich ihn.
Er zieht fragend eine nachtschwarze Augenbraue hoch, weshalb ich erkläre: »Es heißt ›Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, Horatio …‹.«
»Ach ja?« Seine Miene bleibt unverändert, aber der Ton ist spöttisch, als wäre ich diejenige, die einen Fehler gemacht hat, und nicht er. Dabei weiß ich genau, dass ich recht habe. Ich war an meiner bisherigen Schule in Englisch in einem AP-Kurs auf Collegeniveau. Wir haben Hamlet erst letzten Monat zu Ende gelesen und unsere Lehrerin hat uns ewig über diesen Satz diskutieren lassen.
»Meine Version gefällt mir aber besser.«
»Obwohl sie falsch ist?«
»Gerade, weil sie falsch ist.«
Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll, und schüttle nur den Kopf. Wie hoch wohl die Gefahr ist, mich zu verirren, wenn ich mich jetzt sofort auf die Suche nach Macy und Onkel Finn mache? In Anbetracht der schieren Größe dieses Gemäuers vermutlich sehr hoch, trotzdem bin ich versucht, es zu riskieren, weil mit jeder Sekunde, die ich hier stehe, immer klarer wird, dass dieser Typ nicht nur unglaublich faszinierend, sondern auch extrem Furcht einflößend ist.
Keine Ahnung, was gefährlicher ist, aber das will ich lieber gar nicht erst herausfinden.
»Ich muss gehen«, stoße ich zwischen den Zähnen hervor, von denen ich bis dahin nicht wusste, dass ich sie aufeinanderpresse.
»Sehr gut erkannt.« Er tritt ein Stück zurück und nickt in Richtung des Gemeinschaftsraums, durch den Macy mich gerade geführt hat. »Zum Ausgang geht es da entlang.«
Damit hat er mich kalt erwischt. »Ach? Und was soll mir das sagen? Dass ich die Tür schnellstmöglich von außen schließen soll, oder was?«
»Das kannst du machen, wie du willst«, antwortet er achselzuckend. »Hauptsache, du bleibst nicht hier. Ich habe deinen Onkel gewarnt, dass du an unserer Schule nicht sicher bist, aber wie es scheint, liegt ihm nicht besonders viel an dir.«
Wieder lodert Wut in mir auf, deren Hitze den letzten Rest der Taubheit der vergangenen Wochen wegsengt. »Sag mal, für wen hältst du dich eigentlich? Du führst dich auf, als wärst du der Rausschmeißer von irgend so einem exklusiven Club!«
»Rausschmeißer?« Sein Tonfall ist so verächtlich wie der Ausdruck auf seinem Gesicht. »Ich gebe dir nur einen guten Rat. Glaub mir, das ist der herzlichste Empfang, den du hier zu erwarten hast.«
»Ist das so?« Ich ziehe die Brauen hoch. »Willkommen in Alaska, oder was?«
»Willkommen in der Hölle trifft es eher. Und jetzt verschwinde endlich.«
Den letzten Satz spuckt er so giftig aus, dass mir das Herz in die Kehle springt.
Gleichzeitig schießt mein Wutpegel bis in die Stratosphäre. »Sitzt dir dein aufgeblasenes Ego quer«, frage ich, »oder bist du einfach von Natur aus so ein unwiderstehlicher Charmebolzen?«
Der Satz ist draußen, bevor ich darüber nachgedacht habe, was ich sage. Aber ich bereue nichts. Es ist zu schön zu sehen, wie ihm der Schock das unerträgliche Grinsen aus dem Gesicht wischt.
Jedenfalls einen Moment lang. Dann schlägt er zurück. »Wenn dämliche Sprüche das Einzige sind, was du zu bieten hast, gebe ich dir hier an der Academy ungefähr eine Stunde.«
Ich weiß, dass ich darauf nicht eingehen sollte, aber er sieht so selbstzufrieden aus, dass ich nicht anders kann. »Bis was passiert?«
»Bis du gefressen wirst.«
Ihm ist deutlich anzusehen, dass er meine Frage für dumm hält, was mich noch mehr aufbringt. »Ernsthaft? Damit willst du mir Angst machen?« Ich verdrehe die Augen. »Beiß mich doch.«
»Ich verzichte lieber.« Er mustert mich abschätzig. »Du taugst nicht mal als Vorspeise.« Im nächsten Moment tritt er blitzschnell auf mich zu, beugt sich zu meinem Ohr herunter und raunt: »Höchstens vielleicht als kleine Zwischenmahlzeit.« Sein Kiefer schließt sich mit einem scharfen Schnappgeräusch, das mich zusammenzucken lässt und mir einen Schauder über den Rücken jagt.
Und zwar einen … unangenehmen Schauder. Ja. Doch. Ehrlich.
Ich sehe mich verstohlen um. Hat irgendjemand mitgekriegt, was hier gerade läuft? Aber von den Leuten, die mich vorhin noch neugierig angestarrt haben, scheint sich demonstrativ niemand mehr für mich zu interessieren. Ein schlaksiger Rothaariger dreht seinen Kopf im Vorbeigehen sogar in einem so unnatürlichen Winkel von uns weg, dass er fast mit einem entgegenkommenden Mitschüler zusammenstößt.
Okay, das sagt mir alles, was ich über diesen Typen wissen muss. Anscheinend haben alle hier Angst vor ihm.
Entschlossen, die Kontrolle über die Situation – und über mich selbst – zurückzugewinnen, trete ich einen großen Schritt zurück, ignoriere mein hämmerndes Herz und die flatternden Flugsaurier in meinem Magen und frage: »Was ist eigentlich dein Problem?«
»Wie viel Zeit hast du? Könnte ein bis drei Jahrhunderte dauern, es zu erklären.« Das selbstherrliche Grinsen ist wieder zurück. Offensichtlich verschafft es ihm Genugtuung, mich zu verunsichern, und ich gebe mich einen winzigen Moment lang dem Gedanken hin, wie viel Genugtuung es mir verschaffen würde, ihm eine zu knallen.
»Sei nicht so verdammt …«
»Sag du mir nicht, wie ich sein oder nicht sein soll, okay?«, unterbricht er mich hart. »Nicht, solange du keine Ahnung hast, wo du hier reingeraten bist.«
»Oh nein!« Ich reiße gespielt verängstigt die Augen auf. »Kommt jetzt etwa der Teil der Geschichte, wo du mir von den wilden Bestien erzählst, die mir in der Wildnis Alaskas auflauern?«
»Nein, das ist der Teil der Geschichte, in der ich dir die wilden Bestien zeige, die hier im Schloss auf dich lauern.« Er tritt einen Schritt auf mich zu und macht damit den Abstand wieder zunichte, den ich gerade erfolgreich zwischen uns gebracht hatte.
Mein Herz verhält sich sofort wieder wie ein gefangener Vogel im Käfig, der sich verzweifelt gegen die Gitterstäbe wirft.
Das ärgert mich maßlos.
Mich ärgert, dass er es schafft, mir Angst einzujagen und gleichzeitig durch seine Nähe Gefühle in mir auszulösen, die ich einem solchen Arsch gegenüber auf keinen Fall empfinden sollte. Aber am allermeisten ärgert mich sein Blick, mit dem er mir zu verstehen gibt, dass er ganz genau weiß, was in mir vorgeht.
Ich empfinde es als extrem demütigend, solche Gefühle für jemanden zu haben, der umgekehrt ganz offensichtlich nur Verachtung für mich übrighat, weshalb ich mit zittrigen Knien einen Schritt zurückweiche. Und noch einen. Und noch einen.
Das Problem ist: Mit jedem Schritt, den ich mich von ihm wegbewege, macht er einen Schritt auf mich zu, bis ich schließlich zwischen ihm und dem Schachtisch eingeklemmt bin und keine Fluchtmöglichkeiten mehr habe. Nachdem ich nicht weiter zurückkann, beugt er sich noch näher zu mir vor, bis ich seinen warmen Atem auf der Wange spüre und seine seidigen schwarzen Haare meine Haut streifen.
»Hey! Was …« Ich ringe nach Luft, weil praktisch keine mehr in meiner Lunge übrig ist. »Was machst du?«, krächze ich, als er den Arm ausstreckt und an mir vorbeigreift.
Er antwortet nicht. Aber als er sich wieder aufrichtet, sehe ich, dass er eine der Drachenfiguren vom Spielbrett genommen hat. Er hält sie mir hin und zieht eine Augenbraue hoch. »Ich hatte versprochen, dir die Bestien zu zeigen.«
Mit seinen zu wütenden Schlitzen verengten Augen, der erhobenen klauenbewehrten Pranke und den gebleckten scharf gezackten Zähnen sieht der Drache tatsächlich ziemlich bedrohlich aus. Trotzdem ist er nichts weiter als eine Schachfigur. »Sorry, aber vor einem sechs Zentimeter großen Drachen habe ich keine Angst.«
»Tja, solltest du aber.«
»Tja, Pech.« Meine Stimme klingt gepresst, weil er viel zu dicht vor mir steht. So dicht, dass ich die Wärme seines Körpers spüre, so dicht, dass ich nur einmal tief Luft holen müsste und meine Brust würde an seine gepresst.
Diese Vorstellung lässt tief in mir wieder ein Kaleidoskop von Flugtieren aufstieben. Noch mehr zurückweichen kann ich zwar nicht, aber dafür lehne ich mich so weit wie möglich nach hinten und versuche, dem Blick seiner dunklen, unergründlichen Augen standzuhalten.
Wir schweigen beide. Die Stille dehnt sich eine … dann zehn … zuletzt fünfundzwanzig Sekunden lang, bis er schließlich sagt: »Ach? Wenn du keine Angst vor wilden Bestien hast, wovor hast du dann Angst?«
Bilder vom völlig zerstörten Wagen meiner Eltern tauchen vor meinem inneren Auge auf, Bilder ihrer zerschmetterten Leichen. Da ich außer Onkel Finn und Macy keine anderen Angehörigen habe, bin ich in San Diego die Einzige aus der Familie gewesen, die sie identifizieren konnte.
Die ihre blutverschmierten, zerfetzten Körper ansehen musste, bevor sie für die Beerdigung hergerichtet werden konnten.
Schlagartig wallt der mittlerweile vertraute Schmerz in mir auf, aber ich reagiere darauf, wie ich es seit Wochen tue. Ich verdränge ihn. Leugne seine Existenz. »Ach, weißt du …«, sage ich so lässig wie möglich, »wenn man erst mal alles verloren hat, was einem etwas bedeutet hat, gibt es nicht mehr besonders viel, was einem Angst einjagt.«
Er erstarrt. Alle Selbstsicherheit fällt von ihm ab. Selbst sein Blick verändert sich. Er blinzelt. Das wilde Lodern in seinen Augen erlischt und stattdessen kann ich plötzlich etwas darin lesen, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Eine tief liegende Verletztheit, um die er so viele Schutzwälle errichtet hat, dass sie kaum zu erkennen ist. Trotzdem nehme ich sie wahr. Vielleicht ist es ja mein eigener Schmerz, der seinen Schmerz spürt.
Es ist ein wundersam grausames Gefühl, das in seiner Intensität kaum zu ertragen ist und gegen das ich gleichzeitig nichts tun kann.
Also tue ich nichts. Genau wie er.
Vollkommen reglos stehen wir voreinander und schauen uns an. Das Grauen, das jeder von uns unabhängig vom anderen durchlebt hat, scheint uns auf unerklärliche Weise zu verbinden. Nehmen wir den Schmerz im anderen vielleicht gerade deshalb umso deutlicher wahr, weil wir ihn in uns selbst verleugnen?
Ich kann nicht sagen, wie lange wir uns so gegenüberstehen. In meinem Fall jedenfalls lange genug, um überrascht wahrzunehmen, dass meine Abneigung gegen ihn verflogen ist.
Lange genug, um die silbernen Sprenkel im Mitternachtsschwarz seiner Augen zu bemerken – weit entfernte Sterne, deren Leuchten das Dunkel durchdringt und die er jetzt nicht mehr zu verstecken versucht.
Lange genug, um das wilde Klopfen meines Herzens wieder unter Kontrolle zu bringen.
Zumindest, bis er die Hand hebt und sanft an einer meiner Locken zieht.
Ich vergesse, wie man atmet.
Hitze durchströmt mich und zum ersten Mal, seit ich in Healy die Tür von Philips Flugzeug geöffnet habe, ist mir nicht mehr kalt.
Hey, was passiert hier? Vor fünf Minuten habe ich diesen Kerl noch für ein Riesenarschloch gehalten.
Und jetzt … weiß ich gar nichts mehr. Nur, dass ich dringend Ruhe brauche. Und Schlaf. Und Sauerstoff.
Ich stemme beide Hände gegen seine Schultern, um ihn wegzustoßen, aber genauso gut könnte ich versuchen, eine Felswand zu verschieben. Er rührt sich nicht.
Jedenfalls nicht, bis ich flüstere: »Bitte …«
Selbst dann wartet er noch eine Sekunde oder zwei oder drei, bevor er meine Locke freigibt. In meinem Kopf dreht sich alles und meine Hände zittern.
Als er einen Schritt zurücktritt und sich durch seine eigenen dunklen Haare fährt, entblößt er dabei für einen kurzen Moment eine gezackte Narbe, die von der Mitte seiner linken Augenbraue zu seinem linken Mundwinkel verläuft. Die dünne, weiße Linie ist auf seiner hellen Haut kaum auszumachen, aber sie ist definitiv da und besonders an der Stelle auffällig, wo sie eine v-förmige Scharte in seine dunkle Braue geschlagen hat.
Man sollte meinen, die Narbe würde ihn weniger attraktiv machen oder zumindest den Zauber seiner Anziehungskraft etwas brechen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Der Makel verstärkt seine Ausstrahlung nur noch und verwandelt ihn von einem x-beliebigen gut aussehenden Typen in einen tragischen Helden, dem man nicht widerstehen kann. In einen gefallenen Engel, der aus jeder Pore Gefahr verströmt. Die Narbe ist der Beweis. Zusammen mit seinem Schmerz, den ich eben gespürt habe, macht sie ihn … menschlicher. Macht ihn trotz seiner düsteren Aura zugänglicher. Eine solche Narbe kann nur von einer entsetzlichen Verletzung herrühren. Sie erzählt von Dutzenden Nadelstichen, unzähligen Operationen und einem qualvoll langen Heilungsprozess. Von unendlichem Leid. Niemand sollte so leiden müssen, auch nicht dieser arrogante Junge, der mir zwar etwas Angst macht und mich mit seiner Art bis aufs Blut reizt, mich zugleich aber auch in seinen Bann zieht.
Daran, wie er die Augen kurz verengt, die Schultern strafft und die Hände ballt, erkenne ich, dass er weiß, dass ich die Narbe bemerkt habe. Er neigt den Kopf etwas, sodass ihm die Haare wieder über die Wange fallen, und es versetzt mir einen Stich, dass er offenbar glaubt, etwas verstecken zu müssen, das er wie einen Orden tragen sollte. Etwas, das von einer Stärke zeugt, auf die er stolz sein sollte, statt sich für die Spuren zu schämen, die diese Verletzung hinterlassen hat.
Ohne nachzudenken, lege ich ihm eine Hand ans Gesicht und zucke zusammen, als seine dunklen Augen aufblitzen. Aber statt mich wegzustoßen, wie ich es erwartet habe, steht er unbeweglich da und lässt zu, dass ich ihm mit dem Daumen über die Wange – über die Narbe – streiche.
»Das war sicher schlimm«, flüstere ich, als ich in der Lage bin, den schmerzhaften Klumpen aus Mitgefühl herunterzuschlucken und wieder zu sprechen. »Es muss wahnsinnig wehgetan haben.«
Er sagt darauf nichts, sondern schließt die Augen, schmiegt sich in die Berührung meiner Hand und atmet tief ein.
Doch gleich darauf hebt er ruckartig den Kopf und weicht einen großen Schritt zurück. Zum ersten Mal ist er derjenige, der den Abstand zwischen uns vergrößert, seit er sich hier angeschlichen hat – was mir jetzt fast vorkommt, als wäre es in einem anderen Leben passiert.
»Ich verstehe dich nicht«, sagt er mit seiner tiefen, rauen Stimme, die jetzt so leise ist, dass ich Mühe habe, ihn zu hören.
»›Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Hölle, Horatio, als Eure Schulweisheit sich träumen lässt.‹« Ich zitiere den Satz absichtlich so falsch wie er vorhin.
Er schüttelt benommen den Kopf und seufzt. »Wenn du nicht von hier verschwindest …«
»Ich kann nicht verschwinden«, unterbreche ich ihn. »Ich habe niemanden, zu dem ich gehen könnte. Meine Eltern …«
»Sind tot. Ich weiß.« Er lächelt freudlos. »Wenn du tatsächlich keine andere Wahl hast, als hierzubleiben, dann hör mir jetzt ganz genau zu, okay?«
»Wa…?«
»Mach dich so unsichtbar wie möglich. Schau hier nichts und niemanden länger als nötig an.« Er beugt sich zu mir und senkt die Stimme zu einem bedrohlichen Raunen: »Und vor allem: Bleib immer und zu jeder Zeit wachsam.«
4
Schimmernde Rüstungen sind so was von letztes Jahrhundert
»GRACE !«, HALLT DIE STIMME von Onkel Finn von Weitem durch den Gang. Ich fahre herum und winke lächelnd, obwohl mir eigentlich nicht danach ist, weil das, was mir gerade gesagt wurde, ziemlich unangenehm nach einer Warnung klang.
Als ich mich Mr Groß-Dunkel-und-Unheimlich wieder zuwende, um ihn zu fragen, wovor ich mich seiner Meinung nach so in Acht nehmen soll, ist er verschwunden.
Während ich mich noch suchend nach allen Seiten umschaue, ist Onkel Finn auch schon bei mir und schließt mich so fest in die Arme, dass es mich kurz in die Luft hebt. Ich erwidere die Umarmung genauso fest und lasse mich von seinem tröstlichen Geruch einhüllen – dem gleichen waldigen Duft, den auch mein Vater immer an sich gehabt hat.
»Entschuldige bitte, dass ich dich nicht selbst abgeholt habe. Ein paar Schüler hatten sich verletzt und ich musste mich darum kümmern.«
»Das macht doch überhaupt nichts. Hoffentlich nichts Ernstes?«
»Nein, nein, alles in Ordnung.« Er schüttelt den Kopf. »Nur ein paar Dummköpfe, die sich wie Dummköpfe aufgeführt haben. Na, du weißt ja, wie Jungs sind.«
Mir liegt auf der Zunge zu antworten, dass ich offensichtlich keine Ahnung von Jungs habe, wie meine letzte Begegnung mit einem Exemplar dieser Art eindeutig bewiesen hat, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich die seltsame Begegnung besser nicht erwähnen sollte, weshalb ich nur verständnisvoll lache.
»Aber lass uns nicht über meine Arbeit reden.« Onkel Finn drückt mich noch einmal kurz an sich, bevor er sich ein Stück zurücklehnt, um mich zu mustern. »Wie war die Reise? Und noch viel wichtiger: Wie geht es dir?«
»Die Reise war lang«, sage ich, »aber okay. Und mir geht’s auch ganz okay.« Die inflationär benutzte Lüge des Tags.
»Das ist vermutlich stark beschönigt.« Er seufzt. »Die letzten Wochen müssen unglaublich hart für dich gewesen sein. Ich wäre nach der Beerdigung gern noch etwas länger in San Diego geblieben, um dir bei all den Dingen, die du regeln musstest, zur Seite zu stehen.«
»Schon gut. Ehrlich. Die Makleragentur, die du mit dem Verkauf des Hauses beauftragt hattest, hat sich um alles gekümmert. Und Heather und ihre Mutter waren die ganze Zeit für mich da.«
Er öffnet den Mund, als wollte er noch etwas hinzufügen, aber vielleicht nicht unbedingt mitten im Flur, denn er sagt nur: »Das ist gut. Ich schlage vor, dass du erst mal in Ruhe ankommst und deine Sachen zu Macy ins Zimmer bringst. Morgen besprechen wir deinen Stundenplan und danach stelle ich dir unsere Vertrauenslehrerin Dr. Wainwright vor. Ich glaube, du wirst sie mögen.«
Ach ja, stimmt: Dr. Wainwright. Die Vertrauenslehrerin des Internats, die außerdem ausgebildete Psychotherapeutin ist. Und zwar nicht irgendeine, sondern meine ganz persönliche, weil Heathers Mutter und mein Onkel der Meinung sind, ich bräuchte psychotherapeutische Unterstützung. Normalerweise wäre ich von der Idee nicht so begeistert, aber dass ich seit Wochen jeden Morgen unter der Dusche mit den Tränen kämpfe, ist möglicherweise ein Zeichen dafür, dass sie mit dieser Einschätzung doch nicht so ganz falschliegen.
Ich nicke. »Geht klar.«
»Hast du Hunger?«, fragt er. »Das Abendessen hast du leider verpasst, aber ich lasse dir etwas aufs Zimmer schicken. Und es gibt da noch eine Sache, über die wir sprechen sollten, aber …« Er sieht mich einen Moment prüfend an. »Wie verträgst du die Höhenluft?«
»Geht so. Mir ist ein bisschen schwindelig, aber das wird schon.«
»Ganz bestimmt.« Er mustert mich noch einmal forschend, dann räuspert er sich und wendet sich an seine Tochter, die sich während unserer Begrüßung ein paar Schritte im Hintergrund gehalten hat. »Gib ihr am besten gleich Ibuprofen, Macy, und sorg bitte dafür, dass sie genügend trinkt. Ich lasse euch Suppe und Gingerale hochbringen. Erst mal was Leichtes, morgen sehen wir dann weiter.«
»Leicht« klingt perfekt, weil ich schon allein beim Gedanken an Essen sofort einen Würgereiz bekomme. »Hört sich gut an«, sage ich.
»Ich bin froh, dass du jetzt hier bist, Grace. Von nun an wird alles einfacher, das verspreche ich dir.«
Ich nicke nur. Was bleibt mir auch anderes übrig? Ich bin nicht froh, hier zu sein – Alaska kommt mir so unwirtlich vor wie der Mond –, aber ich wäre sehr dafür, dass alles einfacher wird. Ich sehne mich danach, endlich mal wieder einen Tag zu erleben, an dem ich mich nicht beschissen fühle.
Eigentlich hatte ich ja gehofft, dieser Tag könnte schon morgen kommen, aber der Blick, mit dem mich Mr Groß-Dunkel-und-Unheimlich vorhin angeschaut hat, als ich ihm gesagt habe, dass ich ganz sicher nicht von hier verschwinden werde, lässt mich daran zweifeln.