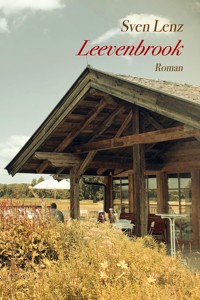4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: edition tiefblau
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als junge Studenten haben Daniel und Gabriel einen blutigen Eid geschworen, ihr Leben und Sterben ausschließlich der Kunst zu widmen. Viele Jahre später kommt der todkranke Gabriel zu Daniel, um den Selbstmordpakt einzufordern und als Performance im Internet zu posten. Er droht, Daniels Freundin Juli zu verstümmeln, wenn er sich nicht an die Vereinbarung hält. Kann und will Daniel sich für eine Frau opfern, von der er sich im Geiste schon getrennt hat? Aber beide haben die Rechnung ohne Juli gemacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sven Lenz
Creepman
Roman
Für den unbekannten KünstlerInhaltsverzeichnis
Impressum
Vorspiel
Hildegard Vogelsang
steht am Fenster und sieht zu, wie ein Auto vor ihrem Tor einparkt. Ein Mann steigt aus und geht zu Vatis Haus. Nein, nicht Vatis Haus. Schon lange nicht mehr. Da wohnen jetzt diese jungen Leute. Der bärtige Mann mit dem komischen Namen. Und seine blonde Freundin. Unverheiratet. Die haben sich nicht mal vorgestellt bei ihr. Haben keinen Antrittsbesuch gemacht. So wie es früher üblich war, wenn man neu in eine Nachbarschaft zog.
Sie bleibt am Fenster stehen und wartet, ob der Mann wieder herauskommt und wegfährt. Sie wartet eine ganze Zeit, aber nichts passiert. Sie überlegt, ob sie die Polizei rufen soll. Unschlüssig geht sie auf und ab. Dann nimmt sie den Hörer von der Gabel und legt einen Finger in die Wählscheibe. Aber was soll sie der Polizei sagen? Das Auto stört ja nicht. Niemand wird dadurch behindert. Und dann würde sie die Polizei möglicherweise von irgendetwas Wichtigem abhalten. Sie legt wieder auf.
Aber es ist doch ihre Einfahrt! Da kann nicht einfach jeder parken, wie er will. Was nun, wenn sie Gäste hätte? Die einen Parkplatz vor dem Tor brauchten.
Sie hat keine Gäste. Aber sie wäre darauf vorbereitet. Das Haus ist tipptopp in Schuss. Das kann sie alles noch selber machen. Man darf nicht nachlassen. Sich nicht gehen lassen. Zum Beispiel der Fernseher. Gleich kommen die Nachrichten. Dann macht sie ihn an. Vorher nicht. Sonst sitzt man am Ende den ganzen Tag davor. So eine ist sie nicht.
Sie sieht noch einmal aus dem Fenster. Das Auto vor dem Tor. Es macht sie nervös. Sie greift zum Telefon. Aber dann stellt sie sich vor, wie böse der Schutzmann mit ihr sein würde. Weil sie ihn von seiner Arbeit abhielte. Von seiner richtigen Arbeit. Von richtigen Verbrechen. Sie lässt den Hörer auf der Gabel liegen.
Nach den Nachrichten kommt ein Krimi. Die Schauspieler sagen komische Sätze auf. Es klingt sehr künstlich. Niemand in der wirklichen Welt spricht so. Und die Handlung ist auch sehr unglaubwürdig. Komische Zufälle reihen sich aneinander. Hildegard hat zunehmend Schwierigkeiten zu folgen. Nach einer halben Stunde schläft sie in ihrem Fernsehsessel ein.
Als sie aufwacht, ist es viel später. Sie schaltet den Fernseher aus und sieht aus dem Fenster. Das Auto ist noch da. Aber da steht tatsächlich auch ein Polizeiwagen auf der Straße. Einer der anderen Nachbarn hat wohl angerufen. Jetzt schleppen sie das Auto bestimmt ab. Oder geht es doch um etwas anderes?
Da ist auch ein Krankenwagen.
Hildegard steht am Fenster und guckt.
1. Ein halb vergrabener Hund
Daniel
steht vor dem Bett und starrt in den offenen Koffer. Auf Julis Schuhe. Während er noch mit sich ringt, ob er eine Frage oder gleich Protest formulieren soll, kommt Juli aus dem Bad. Sie hat so ein Zeug im Gesicht. Eine bröckelige Masse mit der Konsistenz von getrocknetem Quark. Ein fahles Grün, wie Leuchtstreifen auf dem Boden von Flugzeugkabinen. Mund und Augen hat sie ausgespart, wie dunkle Höhlen liegen sie in diesem Brei. Wenn Daniel die Augen ein bisschen zusammenkneift, sieht er einen Totenkopf vor sich.
Über dieser Maske hat sie ein Handtuch zu einem Turban gewickelt. Ein blasses Rosa, wie von vor hundert Jahren. Die Farben wirken komplementär aufeinander. Der grünlich schimmernde Totenschädel und das blassrosa Ding darüber, vielleicht das offen liegende Gehirn eines radioaktiv verseuchten Mutanten. Gamma Girl. Nein: Omega Girl. Noch besser: Omega Thing. Er sieht den Schriftzug vor sich.
Beware of the Vicious Omega Thing!
Die Buchstaben in denselben Farben, von fahlgrün unten nach blassrosa oben verlaufend, mit einem leichten Strahlen versehen, gleichzeitig an den Rändern bröckelnd, so wie die Maske in Julis Gesicht. Wenn sie die Mundwinkel bewegt, zerstören Miniaturerdbeben die Oberfläche, hinterlassen verwüstetes Land.
So etwas in der Art als Hintergrund. Postapokalypse. Von trockenen Rissen durchzogenes, von Bomben verkratertes Land. Davor dieses groteske Wesen mit dem zerfallenden Gesicht und dem offenen Gehirn. Im aufwirbelnden Staub darunter eine Zeile in denselben Farben wie oben, aber kleiner:
Once a Princess, Now a Monster.
Fetzen ihres Gesichts fallen auf den grauen Umhang, der eine schwer definierbare Gestalt verbirgt.
Das ist mein Bademantel. Warum nimmt sie nicht ihren eigenen?
Juli hält eine Flasche Crémant in der Hand, knickt in der Hüfte ein und zeigt sie vor. Dazu machte sie einen fragenden Laut, ein „Mmh?“, das sich am Ende mit Schwung nach oben biegt. Daniel übersetzt es in ein knallgelbes SCREEEEEEETCH!!!, mit fetten schwarzen Schatten, hinter dem Omega Thing herziehend.
Er bewegt seinen Kopf nach links, nach rechts. Nein, er will nichts trinken. Er will noch laufen gehen. Und überhaupt. Dann bleibt es ja nicht bei einem Glas, und er will morgen früh nicht verkatert im Flieger sitzen.
Juli zieht die Mundwinkel herunter, ein paar trockene Krümel fallen herab und verfangen sich in Daniels Bademantel. Sie wirft die Flasche auf das Bett, wo sie weich landet, dann aber in die Kuhle rollt, die der Koffer in das Bett drückt. Mit einer haben Drehung und einem „Klick“ schmiegt sie sich an das Metall.
„Was soll das?“
Juli folgt mit den Augen seinen Händen, die in den aufgeklappten Metallkoffer greifen und wahllos Schuhe herausheben, nur um sie wieder fallen zu lassen. Ihr Turban wippt hin und her, sie legt den Kopf schief und lächelt, wobei sich wieder winzige Bröckchen der Maske lösen und herunter rieseln.
„Das verstehst du nicht.“
Und das soll wohl neckisch sein, oder kokett. Wieder dreht er den Kopf von links nach rechts und zurück. Nein, das versteht er wirklich nicht. Er glotzt auf die Schuhe, die sich im Koffer drängeln. Sofort verwandelt er sie in insektoide Monstren, die unter und neben dem Omega Thing hervor kriechen. Die Landschaft ähnelt vielleicht mehr einer Müllkippe. Verrottete Schränke, Koffer, Gerümpel. Dazwischen Spinnen mit schleimigen, dünnen Riemchenbeinen, Skorpione mit Stacheln aus Pfennig-absätzen. Sie begleiten das Omega Thing mit grimmigen Mienen, hungrigen Klauen und bösen Äuglein, glitzernd wie Steinchen aus Strass.
„Madrid hat die beste Clubszene von ganz Spanien.“
Daniel beisst die Kiefer zusammen. Geflügeltes Horrorgetier umflattert das Omega Thing mit spitzen Schnäbeln. Ein halbes Dutzend Stöckelschühchen zählt er. Und einmal Sneakers. Strahlend weiß. Für vier Tage Studienreise nach Madrid.
„Wenn wir schon den ganzen Tag durchs Prada laufen müssen, will ich mich abends wenigstens ein bisschen amüsieren.“
„Pra-do! Das Museum, nicht der Schuhladen.“
Seine Hand langt unwillkürlich an den Mund. Er verflucht sich kurz und wünscht, er hätte das nicht gesagt. Gleichzeitig spürt er den kleinen Kick von Triumph.
„Hab ich gesagt, Pra-do!“
Daniel sieht Julis Ohrläppchen zwischen Feuchtigkeits-maske und Turbanhandtuch knallrot leuchten.
Hast du nicht. Daniel wischt sich mit der Hand imaginäre Krümel aus dem Vollbart. Hast du eben nicht.
Was für eine miese Pointe. Und im echten Leben überhaupt nicht zum Lachen. Zum Heulen ist das, so bescheuert. Darum will er eigentlich alleine fahren. Weil er seine Nächte eben nicht in irgendwelchen Clubs verbringen und Juli beim Tanzen zusehen will. Mit ihr zusammen auf der Tanzfläche, das ist wie mit Paco de Lucia auf der Bühne, eine Blockflöte in der Hand, auf der man nicht mehr spielen kann als „Ihr Kinderlein kommet.“ Und das schlecht.
Er steht auf, geht zum Schrank und nimmt die Joggingsachen heraus. Er schlüpft in die Hose, zieht ein T-Shirt über und die leichte Jacke. Dann setzt er sich aufs Bett und steigt in die Schuhe.
„Was?“
„Nichts.“
Er zerrt an den Schnürsenkeln. Neben dem Bett steht seine Reisetasche. Ein Paar Schuhe, eine Hose, drei T-Shirts, ein Pulli, Unterwäsche, Waschzeug. Skizzenblock, Stifte. Buch für den Flug. Fertig. Klein, leicht, praktisch. Handgepäck.
„Was bist du denn jetzt so sauer?“
„Ich lauf ’ne Runde.“
„Jetzt warte doch mal. Sagst du mir vielleicht mal, was los ist? Können wir miteinander reden, bitte?“
Er geht zügig die Galerie entlang. Worüber reden. Über das Offensichtliche? Darüber, dass sie sehr verschiedene Vorstellungen davon haben, was eine tolle Zeit in Madrid ist?
Daniel verlagert sein Gewicht nach vorn und lässt sich die Treppe hinabfallen. Mit einer Hand am Handlauf und den Blick auf die Stufen unter ihm gerichtet, sieht er seinen Füßen zu, wie sie seinen Fall in winzig kurze Augenblicke teilen. Jede einzelne Stufe knackt kurz und scharf. In dem Tempo, in dem Daniel hinabläuft, klingt es wie ein brechender Baumstamm.
„Jetzt hau doch nicht einfach ab, Daniel! Können wir nicht drüber reden? Würdest du bitte mit mir reden?“
Stell erst mal die Flasche wieder in den Kühlschrank, denkt er und ärgert sich gleichzeitig darüber, sich auch über diese Kleinigkeit noch zu ärgern. Er zwingt seine Gedanken zurück nach Madrid. Es war ein Fehler, Juli überhaupt zu dieser Reise einzuladen. Das sollte er vielleicht jetzt zum Thema machen. Er könnte sie daran erinnern, dass sie es war, die sich aufgedrängt hat. Die unbedingt mit wollte.
Er hatte sich gefreut. Hat das kleine zweifelnde Gefühl weggedrückt. Hat wirklich geglaubt, sie würden das hinkriegen. Vielleicht einen neuen Schritt machen in ihrer Beziehung. Aufeinander zu.
Aber das ist offensichtlich ein Irrtum. Die Frage ist nur, ob man das wieder rückgängig machen kann. Oder wie. Sie gibt ihm ja gerade eine Steilvorlage. Sie will reden. Er könnte ihr Vorhaltungen machen. Er könnte einen richtigen Streit provozieren. Er weiß, wie er bei ihr die Knöpfe drücken muss, um sie in Rage zu versetzen. Bis sie laut werden und wahrscheinlich so etwas sagen würde wie: Dann fahr doch alleine! Und dann würde er sich darauf berufen und genau das tun.
Allein die Vorstellung hat schon etwas ungemein Befreiendes.
Er nimmt einen Schlüssel vom Haken und öffnet die Tür.
„Daniel!“
Er sieht sich nicht mehr nach ihr um. Er geht nach draußen und zieht die Tür hinter sich zu.
Für eine gute Sekunde hält die Welt die Pausentaste gedrückt. Dann weht ihm eine Bö einen feuchten Lappen von Nieselregen ins Gesicht. Die Tropfen sammeln sich in seinem Bart. Der Abend wickelt sich kalt um ihn. Der Frühling lässt auf sich warten. In Madrid scheint mittags die Sonne bei 20 Grad.
Er fummelt den Reißverschluss in den Schlitz und zieht die dünne Jacke zu. Er hüpft dreimal auf und ab und geht dann zur schmiedeeisernen Pforte. Sie quietscht als er sie öffnet, und sie quietscht noch einmal als er sie schließt.
The Hounted Castle. Ein Titel in Geisterweiß. Mit Anmutung von Knochen und Totenkopf in den Buchstaben. Zinnen und Türmchen, ein Festungswall, Burggraben, Zugbrücke. Eine Bastei auf einer Anhöhe. Aus den schmalen hohen Fenstern ein hellgrünes Licht, ein schwacher roter Schimmer darüber. Im Hintergrund ein Gewitter, ein mehrfach gespaltener Blitz taucht die Burg in Gegenlicht. Dunkle Wolkentürme. Regen wie Bindfäden. Und davor eine schwarze Gestalt. In Rüstung. Mit Schwert. Herausfordernd gehoben. Ein Extra-Panel rechts unten. Das Gesicht des Ritters. Halb verdeckt vom Visier. Die Augen im Schatten, die Zähne gebleckt. Eine Sprechblase: Vanish now, unholy ghost! For I have come to reclaim what’s mine!
So was in der Art. Tales of the Warrior, Nummer 42. Tatsächlich Nummer 42? Ja. Nur ein Zufall.
Es geht gar nicht um Madrid. Der ursprüngliche Fehler ist gewesen, mit ihr in das Haus einzuziehen. Seitdem geht es bergab. Vorher war alles gut. Als sie noch zwei getrennte Wohnungen hatten. Jetzt ist kein Anlass mehr gering genug für Streit. Banale Dinge. Lächerliche Dinge. Ausgerechnet Schuhe. Ein so mieses Klischee.
Er möchte jetzt gern eine rauchen.
Daniel holt tief Luft und zwingt sich in einen lockeren Trab die Straße hinab. Durch die noch kahlen Baumkronen leuchtet weiter unten das blaue Schild der Tankstelle. Er könnte ein Bier trinken, eine rauchen, ein bisschen über den Fluss gucken und sich überlegen, wie er mit der Situation umgehen soll. Die Vorstellung breitet sich warm in ihm aus, das blaue Licht der Tankstelle zieht ihn magnetisch an.
Er läuft das Gefälle der Straße abwärts und alles scheint leichter zu werden. Bis diese andere Stimme sich meldet und ihn daran erinnert, dass er nur noch wenige Wochen Trainingszeit hat. Heute ist eine Ausnahme, giert etwas in ihm. Jeder Tag ist eine Ausnahme, antwortet kühl die Stimme.
Und mit einem gepressten „Fuck!“ reißt er sich herum, biegt links in den kleinen Weg, der zum Fluss hinab führt und platscht in flachen Pfützen vorwärts.
Schon wieder die Zahl 42. Zweiundvierzig Komma eins neun fünf, um genau zu sein. Da muss man sich heranarbeiten. Jeden Tag ein bisschen. Zweimal die Woche ein bisschen mehr. Aber heute nur die kleine Runde.
Er schüttelt den Kopf wie ein Hund sein Fell. Zu seiner Rechten umstehen kahle Bäume und Büsche die Villen, die über den Fluss blicken. Auf der anderen Seite strömt das Wasser ruhig vorüber. Dahinter funkeln Lichter in der Dämmerung. Fenster.
Daniel sucht den Rhythmus von Laufen und Atmen. Will den Beat spüren. In die Routine fallen. Aber die Luft piekst in seinen Lungen, als er tiefer einatmet. Der Wind weht in kurzen Schüben feinen Regen in sein Gesicht. Er tritt in eine tiefere Pfütze und spürt Feuchtigkeit in seinem Schuh. Vor allem aber wird er das Bild nicht los.
Tales of the Warrior # 42. The Hounted Castle.
Juli in seinem Haus. Ein Poltergeist in seiner Schutzburg. The Omega Thing. Was für eine verdammte Schnapsidee hat ihn bloß dazu verleitet, Juli zu fragen, ob sie mit ihm in dieses Haus ziehen will? In dieses Haus, in das er sich verliebt hat. Das er schließlich gekauft hat.
Hier hat es seinen Anfang genommen. Genau hier. Eine warme Sonne im Nacken, eine feine Brise im Gesicht, ein leichter Wellengang auf dem Fluss. Er hat Juli die Treppen hochgeführt, ist mit ihr die Straße entlang spaziert. Unter dicht belaubten Bäumen standen sie vor dem Haus.
„Wie findest du es?“
„Besonders.“
Ja, das war es. Besonders.
„Ich werde es kaufen“, hat er behauptet und damit die eigenen Zweifel, ob er sich das dauerhaft würde leisten können, aus dem Weg geräumt.
„Es passt zu dir.“
Das findet er auch. Nach wie vor.
Und dann fuhren sie zurück in die Stadt. Zu ihr. Und die Behauptung „Ich werde es kaufen.“ fachte auf eigentümliche Art und Weise seine Leidenschaft an. Sie machten eine Flasche Crémant auf. Auf die Entscheidung schon mal. Und so nahm es seinen Lauf.
Betrunken. Hormongesteuert noch dazu. Eine dieser Liebesnächte mit Schampus und Schokolade. Endorphin ohne Ende. „Willst du da mit mir wohnen?“ Sie sagte „Ja“, und das war aufregend. Sexy. Ein Kribbeln im Bauch. Ein Gefühl von großer Lebendigkeit. Erkenntnisschock, so nannte er es damals für sich.
Der Nieselregen bildet Tropfen auf der Stirn, die ihm über das Gesicht laufen. Fahrig wischt er mit dem Ärmel darüber und verscheucht so auch die Zärtlichkeit der Erinnerung. Er überspringt auch die Gespräche mit der Bank, den Termin mit dem Notar, das ganze Hin und Her der Verkaufsabwicklung. Sein Gedächtnis hakt sich an den Tag des Einzugs. Erste Unstimmigkeit schon dabei. Mein Bett oder dein Bett? Mein Sofa oder dein Sofa? Praktisch oder schön? Das erste Mal der Gedanke, dass es doch sein Haus ist, dass sie nur Miete zahlt.
Schlimmes Gefühl. Zieht Scham nach sich und die Bereitschaft, einen Kompromiss zu finden. Oben schön, das Schlafzimmer, das Bad, das kleine Zimmerchen, aus dem dann ein begehbarer Kleiderschrank wird. Unten praktisch. Seine Schreibtische, sein Arbeitsplatz. Dafür ihr Sofa, ihr Sessel, ihr Tisch. Unser kleines Haus.
Als alles stand, als alle Kartons ausgepackt waren, noch am selben Abend, schloss Daniel die Tür, setzte sich an seinen Schreibtisch und atmete aus. Da kam mehr Luft aus seinen Lungen, als er je eingeatmet hatte, so schien es. Nie hat er sich mehr zuhause gefühlt als in diesem Moment. Er umarmte Juli, wollte das mit ihr teilen.
Aber etwas war unrund. Und es dauerte nicht lange, bis er verstand, was das war. Sie will hier eigentlich gar nicht sein. Hier draußen. Sie findet es öde. Sie will viel lieber in der Stadt leben. Mittendrin. Sie nörgelt über die ewige Fahrerei. Die Totenstille nachts.
Dicht am Wasser haben die Schritte der Spaziergänger einen Trampelpfad gebildet, auf dem es sich besser laufen lässt. Der Fluss steht höher als gewöhnlich am Ufer, schmale Wellen schwappen über die Steine. Daniel schüttelt noch einmal den Kopf und sucht in der Dämmerung und durch den Regen nach der Silhouette der Brücke, die da irgendwo vor ihm liegt.
Oder ist es bloß wegen des Geldes? Habe ich sie deswegen gefragt? Weil ich Angst habe, ich kann das alleine nicht stemmen? Den Kredit. Alles, was da noch zu machen ist. Die Treppe mal als erstes. Eine anständige Küche vielleicht. Konfliktpotential. Sie haben so unterschiedliche Vorstellungen von solchen Sachen. Und nicht nur in Sachen Wohnungseinrichtung. Nein, das ging sehr viel weiter. Gegensätze ziehen sich an, sagt man. Das mag ja stimmen. Aber sie gehen sich auch wahnsinnig auf die Nerven. Das sagt man nicht so sprichwörtlich. Er denkt an die Flasche Crémant, die Juli aus dem Kühlschrank geholt hat. Aufs Bett geworfen. Da bleibt sie jetzt liegen, bis Daniel sie wegräumt. Er denkt an die Schuhe im Koffer. An Madrid. An den Prado. Die Kostbarkeiten darinnen. Velázquez natürlich, Las Meniñas. Aber vielmehr noch die Schatzkammer mit Goyas pinturas negras. Diese unglaublichen Bilder einmal im Original sehen. Die Aura des Künstlers spüren. Die Aura des Museums. Den eigenen Blick darauf werfen. Auf diese grotesken Figuren aus dem Gruselkabinett des Francisco de Goya y Lucientes. Obwohl er sich unter all den virtuosen und voluminösen Gemälden auf das eine besonders freut. Das in seiner Einfachheit hervorsticht. Das beinahe abstrakt daherkommt. Perro Semihundido, der halb versunkene Hund.
Ein Hundekopf, der aus einer schmutzigbraunen Fläche hervorragt, scheinbar nach Luft japsend, als trotze er einer sich aufbäumenden Welle. Um sein Leben ringend. Darüber gelbe Flächen, Schraffuren, undefinierbare Formen, ungreifbare Räume. Ein Sandsturm vielleicht. Der Hund in einer Düne vergraben. Vielleicht ist es ein halb vergrabener Hund. Vielleicht hat ihn sogar jemand dort eingegraben. Mutwillig. Goyas Welt war grausam genug, sich das vorstellen zu dürfen. Da lag der Hund begraben.
Wie gern möchte Daniel sich vor das Bild setzen, es ausgiebig betrachten und es dann nachzeichnen. Nachfühlen vielleicht, was Goya gefühlt hat, als er es malte. Wenigsten eine Ahnung davon erhaschen.
Hundido heißt aber auch deprimiert. Ist es am Ende ein halb deprimierter Hund? Vielleicht Goya selber? Der hat es auch nicht leicht gehabt im Leben. Mit der Inquisition und all dem. Und dann spielt ihm seine Fantasie vor, wie Juli neben ihm im Museum steht. Mit den Füßen scharrend. In hochhackigen Pumps.
„Können wir jetzt weiter?“
Sein wieder aufflammender Zorn beschleunigt den Beat, und bald kann er die Brücke vor sich ausmachen.
Im Rhythmus der Schritte ordnen sich seine Gedanken. Die nahe Zukunft ist ein Weg in die weiter entfernte. Juli nimmt seine Hand und zieht ihn voran. Hinter der nächsten Biegung warten Kinderaugen auf ihn. Große, helle, vor Erwartung leuchtende Kinderaugen. Julis Augen bei diesem Thema. Von dem sie nicht lassen will. Das ist doch der einzig vernünftige Grund, nicht mehr in der Stadt zu wohnen. Eine Familie zu gründen. Sie würde den begehbaren Kleiderschrank in ein Kinderzimmer verwandeln.
Und nicht zum ersten Mal führt dieser Gedanke an einen Punkt, zu einer Schlussfolgerung, die sich folgerichtig ergibt, deren Konsequenz er sich aber bisher verweigert hat. Denn die Wahrheit ist doch, dass sie nicht zusammenpassen. Das Kinderthema. Aber auch Julis Unordnung und ihre aufbrausende Art. Und dieser Modefimmel. Alles so. Sein Zorn kennt ein paar Adjektive, die seine Scham aber sofort wegdrückt.
Es gibt bei allem Ärger keinen Grund, arrogant zu werden, ermahnt er sich. Und sucht nach einer neutralen Formulierung, um seinen Gedanken zu beschreiben. Sie haben verschiedene kulturelle Hintergründe.
Das klingt nicht abwertend, oder? Ihre Welt und meine Welt sind einfach nicht kompatibel. Ganz wertfrei. Nein, natürlich nicht. Geht gar nicht. Wertfrei. Werte waren Werte, die lassen sich eben nicht relativieren.
Und an dieser Stelle schmilzt sein Zorn unvermittelt in sich zusammen, löst sich auf, bildet Pfützen, die sich ausbreiten und zusammenfließen bis sie einen tiefen See voll Traurigkeit bilden. Ein kurzer heißer Schub drückt auf seine Tränendrüsen und lässt die Nase laufen. Die Kontaktlinsen schwimmen und mit ihnen die Aussicht. Er zieht den Rotz hoch, spuckt aus und kneift die Augen ein paar Mal kurz und heftig zusammen, bis die Tränen sich mit dem Nieselregen auf seinen Wangen vereinigen und sich im Gestrüpp der Barthaare verlieren. Der Blick wird wieder klar und scharf.
Wir müssen uns trennen. Das ist die einzige schlüssige Konsequenz. Wir passen nicht zueinander. Wir haben sehr verschiedene Vorstellungen von der Zukunft. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Ein kalter Schauer löscht die warme Traurigkeit ab. Erkenntnisschock. Er darf sich nicht in der schönen Melancholie baden. Nicht noch einmal. Nicht schon wieder. Nicht aufschieben, was nicht zu verhindern ist. Die Dinge regeln sich nicht von selbst. Schon gar nicht zum Besseren. Er wird eine Entscheidung treffen und dann konsequent handeln. Keine Ausflüchte mehr. Kein Beschönigen der Situation, weil es doch auch all die anderen Momente mit ihr gibt. Sommerfrische am Meer, Schlittschuhlaufen im Park, lauschige Restaurants und hippe Bars. Und das Bett nicht zu vergessen. Ja, man kann das Leben mit ihr feiern. Keine Frage. Aber das Leben findet nicht im Bett statt. Nicht das wahre Leben. In das er früher zurückgekehrte, nachdem er bei ihr war, erschöpft, beseelt, aber auch froh, wieder zu Hause zu sein.
Jetzt gibt es diesen Rückzugsort nicht mehr. Jetzt leben sie beide im selben Haus. In diesem Haus, das er gekauft hat.
Es wird schwer werden mit dem Kredit, wenn ihre Miete wegfällt. Aber das wird er schon hinkriegen. Mehr arbeiten. Weniger ausgeben. Was auch immer.
Dass er allein sein wird. Ja, aber das wäre nicht das erste Mal. Und lieber allein, als ständig zu kämpfen.
Er ist sich vollkommen klar darüber, dass sie ebenso genervt ist von der Situation wie er. Dass er nicht der Mann ist, den sie sich wünscht. Der Vater ihrer Kinder. Der Partner auf der Tanzfläche. Warum also sollen sie sich weiter miteinander quälen.
Und dann erreicht Daniel die Brücke. Mächtige Betonpfeiler links und rechts des Ufers heben eine Straße über das Wasser. Oben hört er Autos den Fluss überqueren. Ohne Verschnaufpause wendet er sich nach rechts und setzt seine Füße im gleichen Beat auf die Treppenstufen, die aufwärts führen. Er zählt nicht mit, er weiß, wie viele es sind.
Und als er oben an der Straße angekommen ist, brennen und zittern seine Muskeln. Seine Lungen stoßen heißen Dampf in das Licht der Straßenlaternen. Sein Rücken ist klitschnass von Schweiß und Regen. Er stützt sich mit den Händen auf den Knien ab und spürt dem Pochen in seinem glühenden Schädel nach. Aber in seinem Inneren herrscht eine schwebende Ruhe.
Ich werd’s ihr sagen. Dass ich alleine nach Madrid fahre. Es wird Streit geben. Heulerei und alles. Ich werde auf dem Sofa schlafen. Morgen früh dann raus. Oder schon heute Nacht zum Flughafen fahren.
Der Wind kühlt ihn schneller aus, als er sich von der Anstrengung erholen kann. Er hebt den Kopf, sieht über den Fluss hinweg, ignoriert die wenigen Autos, die an ihm vorbei über die Brücke fahren und findet einen Rest von diesem gleichermaßen erhabenen wie erschreckenden Gefühl in sich, das er Erkenntnisschock nannte.
Irgendwo hinter dem Horizont fließt der Fluss ins Meer. Die Weite eines Ozeans breitet sich in seinen Gedanken aus. Sein überforderter Kreislauf steuert einen leichten Schwindel bei und erhöht so die Wirkung des Moments. Er sucht einen Anker in der Endlosigkeit und findet ihn in seinem Willen.
Tabula Rasa. Keine Spielereien mehr, kein Hinhalten, kein Aufschieben. Klare Ansage. Ich fahre alleine nach Madrid. Wir trennen uns. Du suchst dir eine eigene Wohnung, schließlich ist das hier mein Haus.
Und wenn ich Glück habe, ist sie schon ausgezogen, wenn ich aus Madrid zurückkomme. Würde mich nicht wundern. Alle möglichen Leute werden ihr helfen. Darin ist sie gut.
Seine Hände und Füße erstarren, die Nase läuft, die Trainingsjacke klebt unangenehm kalt am Rücken. Er ballt die Hände mehrfach zu Fäusten, hüpft ein paar Mal auf und ab und setzt sich dann langsam wieder in Bewegung.
Wohl besser, gleich nach der Ansage zum Flughafen zu fahren. Sonst gibt’s Diskussion die ganze Nacht. Und wer weiß, wo das endet.
Er läuft in lockerem Trab die Straße entlang. Und als er in sein Viertel einbiegt, muss er vom Fußweg auf die Straße wechseln, denn zwischen den hohen alten Bäumen in den schmalen Straßen parken dicht an dicht Autos der gehobenen Klassen. Hinter den Bäumen und Vorgärten strahlen die Fenster der Jugendstilvillen und der Herrenhäuser aus Backstein warmes Licht in den nasskalten Abend. Der letzte Kilometer geht leicht bergauf, die finale Hürde vor dem Zieleinlauf.
Daniel verlangsamt das Tempo, bis er mehr geht als läuft. Verblüfft stellt er fest, dass es nicht mehr regnet und auch kein Wind mehr weht. Vor sich sieht er sein Haus. Das kleine zwischen den beiden großen.
The Hounted Castle. The Omega Thing.
Er bleibt stehen und lauscht in die Dämmerung. Doch da ist nur sein Atem und das Rauschen des Blutes in seinen Ohren. Dann das feuchte Rascheln seiner Trainingsjacke, als er seinen Arm bewegt, um auf die Uhr zu schauen. Diese Ruhe. Die Ruhe vor dem Sturm.
Etwas in seinem Inneren ballt sich. Ein Grummeln, begleitet von gluckernden Geräuschen. Der Magen vielleicht.
Es macht ein Unterschied, einen Plan zu entwerfen oder ihn durchzuführen. Fantasie und Realität leben nicht im selben Haus. Jetzt wird es ernst. Eine Versuchung kriecht aus seinem Innersten und schlägt vor, noch abzuwarten, zu sehen, wie es in Madrid wird. Vielleicht ist alles gar nicht so schlimm. Vielleicht erledigen sich manche Sachen doch noch von selbst. Vielleicht muss er nur mehr Geduld haben. Wenigstens kann er auf eine bessere Gelegenheit warten. Warum jetzt in diesem Moment?
Scharf saugt er Luft zwischen den Zähnen ein, bis diese vor Kälte schmerzen. Dann setzt er sich wieder in Bewegung.
Bring’s hinter dich, Mann. Morgen in Madrid scheint die Sonne.
Vor der Einfahrt der benachbarten Villa parkt ein Porsche 911 gegen die Fahrtrichtung der Einbahnstraße. Ein Verwandter der alten Dame? Außen schwarz lackiert und innen auffällig gelbes Leder. Was für eine Kombination. Warnzeichen der Insekten. Achtung, Gefahr! Bei Boulevardzeitungen die Farbkombination für Katastrophenmeldungen. Super Gau im Atomkraftwerk. Das SCREEEEETCH!!! von The Omega Thing.
Und die Pforte seines Hauses steht offen. Daniel ist sicher, dass er sie geschlossen hat, als er losgelaufen ist. Ob Juli? Aber ihr Auto steht vor dem Haus und drinnen brennt Licht. Er nimmt seinen Schlüssel und öffnet die Haustür. Ein feiner Duft von Zigarettenqualm kriecht in seine Nasenlöcher.
Juli
steht auf der Galerie und ruft ihm hinterher:
„Jetzt hau doch nicht einfach ab, Daniel! Können wir nicht drüber reden? Würdest du bitte mit mir reden?“
Ihre Hände wissen nicht, ob sie empört nach oben fliegen oder wütend runter auf das Geländer schlagen wollen. So zucken ihre Arme auf halber Höhe, bis die Beine den Impuls aufnehmen und Daniel folgen. Als Juli die Treppe erreicht, hört sie die Tür ins Schloss fallen.
Er hat sich nicht einmal umgedreht, sie weder angesehen noch tschüs gesagt. Auf der ersten Stufe stolpert sie beinahe über ihre Füße. Sie hält sich mit einer Hand am Geländer fest, schlüpft aus den weichen Pantoffeln und steigt die Treppe barfuß hinunter. Mit der anderen Hand hebt sie den viel zu großen Bademantel an, um die Stufen unter sich sehen zu können. Jede einzelne Stufe ächzt und knarzt.
Die Konzentration, die sie für den Abstieg aufbringen muss, frisst einen großen Teil ihrer Wut auf. Und als sie unten ankommt, rennt sie nicht zur Tür, reisst sie nicht auf, schreit ihm nicht irgendetwas hinterher.
Stattdessen steht sie mit nackten Füßen auf den kalten Fliesen und sieht durch das schmale hohe Fenster hinaus.
Dünne Regentropfen laufen an der Scheibe entlang. Von Daniel keine Spur mehr. Das ist eine miese Angewohnheit, die er sich da in letzter Zeit zugelegt hat. Grantig sein, schweigen und dann abhauen. Und nicht drüber reden wollen. Allenfalls noch: Muss trainieren. Als sei damit alles gesagt.
Sie spürt den Ärger in ihrem Bauch herumkriechen. Und ausgerechnet heute. Welche Laus ist ihm denn jetzt schon wieder über die Leber gelaufen?
Sie öffnet die kleine Schublade neben der Spüle. Ihre Hand kramt darin herum. Vier Einwegfeuerzeuge, eine Schachtel Streichhölzer, zwei kleine Aschenbecher. Keine Zigaretten.
Vielleicht auf der Terrasse hinterm Haus. Sie durchquert den Raum und öffnet die Terrassentür. Kalter Wind schlägt ihr ins Gesicht. Feiner Nieselregen hängt in der Luft. Auf dem Gartentisch steht ein großer runder Aschenbecher aus Ton. Darin schwimmen aufgequollene Kippen im von Asche gesättigten Regenwasser. Auf der Fensterbank eine Schachtel ihrer Marke. Aber leer. Sie lässt sie liegen.
Vielleicht in der Handtasche. Aber wo ist die? Nicht an der Garderobe. Nicht auf dem Tisch. Nicht auf dem Sofa. Hat sie die Tasche mit nach oben genommen?
Sie rafft den Bademantel und steigt die Treppen wieder hoch. Unter ihren Füßen knarrt das Holz. Die Handtasche ist weder im Bad noch im Schlafzimmer zu finden. Juli betritt den begehbaren Kleiderschrank gegenüber vom Bett und wühlt hinter den Pullovern im untersten Regal links. Notversteck, Geheimlager. Nichts.
Sie müsste zur Tanke gehen. Und dann draußen auf der Terrasse unterm Regenschirm rauchen. Wie früher auf dem Schulhof. Keine schöne Vorstellung. Zu viel Aufwand. Dann eben nicht.
Im Aufstehen sieht sie sich im großen Spiegel, der die Stirnwand des kleinen Ankleidezimmers ausmacht. Sieht das Handtuch auf ihrem Kopf. Den alten Bademantel. Und die bröckelnde Gesichtsmaske.
Das sieht ja fürchterlich aus. Ich dummes Huhn, ich hab’s verdorben. Ich hätte mich erst zurechtmachen sollen und dann mit der Flasche kommen. Verdammte Ungeduld.
Sie geht ins Bad, nimmt das Handtuch vom Kopf, schlüpft aus dem Bademantel und wäscht sie sich die Maske vom Gesicht. Sie tupft sich die Wangen trocken, öffnet die Augen und erlebt sofort den nächsten Schock.
Eingerahmt von den feuchten, verstrubbelten Haaren, strahlt ihr ein knallrotes Gesicht aus dem Spiegel entgegen. Die Maske zu lange drauf gelassen. Mit fahrigen Händen sucht sie nach etwas, mit dem sie ihre Haut beruhigen kann. Sie verreibt die Lotion hektisch im Gesicht und betet inständig, dass die Rötung verschwindet bevor Daniel zurück ist.
Ich bin so blöd, ich bin so blöd, ich bin so blöd. Und zu der Rötung, die die Maske verursacht hat, pumpt Blut durch die Adern des Gesichts und lässt es heiß glühen.
Lässt sich alles wieder gut machen. Wenn Daniel die übliche Runde läuft, hat sie ungefähr eine Stunde Zeit. Und die wird sie auch brauchen.
Sie badet, rasiert sich die Beine und tupft sich dann mit einem weichen Frottierhandtuch trocken. Sie cremt sich mit einer Bodylotion ein. Im begehbaren Kleiderschrank besieht sie sich im Spiegel. Ein frisches rosiges Leuchten nur noch. Gut. Sie hebt ihre Brüste leicht an. Okay, hängen ein klein bisschen. Aber noch ganz gut für 38. Noch zwei Jahre, dann ist vierzig. Gruselig. Dreißig zu werden ist schon komisch gewesen. Aber vierzig. Das klingt nach alt. Zu alt für ein Kind.
Dabei ist der Gedanke an ein Kind ganz neu. Sie hat nie ernsthaft Mutter sein wollen. Im Gegenteil. Ein Kind zu haben heisst, keine Zeit zu haben für’s Training, keine Zeit für das nächste Turnier, keine Zeit für die Shows, wo man das gute Geld verdient.
Mal ganz abgesehen von der Gefahr, aus dem Leim zu gehen. Die hart erarbeitete Silhouette aufzuweichen. Sie erinnert sich an Kathis erste Schwangerschaft. Wie sie rund und weich geworden war. Die war so glücklich gewesen. Juli hat sich für ihre Schwester gefreut, wie sie sich auch für die Freundinnen und Kolleginnen gefreut hat. Aber die dicken Bäuche. Die Kinderwagen. Die Spielplätze. Juli ist immer erleichtert gewesen, dass der Kelch an ihr vorbei gegangen war. Als wären die anderen vom Blitz getroffen worden.
Was hat sich verändert? Warum überfällt sie jetzt manchmal so eine Traurigkeit, eine merkwürdige Sehnsucht, wenn sie Kathi mit den Kindern sieht? Ist doch etwas dran an der biologischen Uhr? Die lauter tickt kurz vor vierzig?
Daniel ist echt toll mit den Mädchen von Kathi. Die lieben ihn auch total. Der kann gut mit Kindern. Der wäre ein super Papa. Sagt doch auch immer, wie sehr er die Mädchen mag.
Juli setzt sich an den Schminktisch und föhnt ihre Haare. Sie bürstet sie durch, legt sie in gewundenen Bögen hoch und steckt sie mit einer großen Silberspange fest.
Jetzt ist eine gute Zeit, jetzt ist sie fruchtbar. Sie fühlt, wie die Hormone im Körper herum hüpfen. Sie legt ihre Hände auf die Brüste und dann auf ihren flachen Bauch. Vom Mädchen zur Frau. Von der Frau zur Mutter. Ist das nicht der natürliche Gang der Dinge?
Ja, es ist ein neuer Lebensabschnitt. Ein festes Zuhause statt ewiger Rumfahrerei von Stadt zu Stadt. Ein fester Job statt von einer Veranstaltung zur nächsten. Ein fester Mann statt ständig wechselnder Bekanntschaften. Das passt jetzt. Eine Familie.
Die Röte der Gesichtsmaske hat sich inzwischen ganz aufgelöst. Ihr Gesicht strahlt ihr gesund und rosig aus dem Spiegel entgegen. Sie inspiziert die Fältchen in den Augenwinkeln. Am Mund. Am Ohransatz. Am Hals. Glück gehabt. Gute Gene. Und gute Pflege natürlich. Sie schminkt die Wimpern ein bisschen und findet, dass das reicht.
Auf der Ablage neben der elektrischen Zahnbürste liegt die Packung mit der Pille. Ein so vertrautes Bild. Seit zwanzig Jahren. Sie drückt eine heraus und hält sie in der Hand. Betrachtet sie von allen Seiten.
Und wirft sie in die Toilette. Und drückt alle anderen auch heraus und wirft sie hinterher. Sie zieht die Spülung, und mit dem Geräusch des abfließenden Wassers kribbelt es einmal kalt die Wirbelsäule hinunter.
Was hab ich getan, was hab ich getan, was hab ich getan? Und dann verwandelt sich die schlotternde Unsicherheit in ihr komplettes Gegenteil: Jawohl, ich will ein Kind. Von Daniel. Heute Nacht. Tropi. Trotz Pille. So was passiert. Immer wieder mal. Schon oft gehört. Ein Schicksalskind. Das kann man nicht wegmachen lassen. Sie wird es auf jeden Fall bekommen. Egal, wie Daniel reagiert.
Mit hektischen Schritten geht sie ins Schlafzimmer, zieht das Kleid an, das Daniel so gern mag und durchwühlt fahrig den Koffer auf der Suche nach passenden Schuhen. Unterm Koffer findet sie ihre Handtasche. Keine Zigaretten.
Sie sieht ihn vor sich, so wie er vorhin das Haus verlassen hat. Grantig und schweigend. Und sie sieht ihn vor sich, wie er mit Kathis Kindern spielt. Fröhlich und liebevoll. Ein Kind ist das beste, was ihnen beiden passieren kann. Keine Frage. Alles, was in letzter Zeit so anstrengend ist, wird sich in Freude auflösen. Ganz klar.
Manchmal muss man Daniel eben zu seinem Glück zwingen. So ist das doch von Anfang an gewesen. So ist er nun mal. Wenn das Kind erst da ist, wird er sich freuen. Auf jeden Fall. Das ist genau, was er braucht im Leben. Was sie beide brauchen.
Ein leichter Schwindel lässt sie für eine Sekunde innehalten. Die Lust auf eine Zigarette wird geradezu übermächtig. Dann fällt ihr ein, dass sie sowieso aufhören muss, wenn sie schwanger wird. Und trinken auch. Sie nimmt die Flasche Crémant vom Bett, legte sie sanft in die Armbeuge und wiegt sie wie ein Baby an der Brust.
Nee, peinlich.
Die Glockentöne der Haustürklingel. Hat Daniel etwa den Schlüssel vergessen? Sie packt die Flasche in eine Faust, ihre Handtasche in die andere und trippelt die Galerie entlang. Auch wenn sie sich vollkommen sicher auf den hohen Absätzen bewegen kann, muss sie kleine Schritte machen. Durch das Quietschen der Stufen hört sie die Klingel ein zweites Mal.
„Ich komme! Komme schon!“
Sie stellt die Flasche auf der Treppe ab und gleitet geradezu über die Fliesen bis zur Eingangstür. Dort lässt sie die Handtasche stehen, drückt das Kreuz durch und kontrolliert mit fliegenden Handflächen kurz den Sitz ihrer Hochsteckfrisur. Sie zaubert sich ein Lächeln ins Gesicht, greift an die Klinke und öffnet die Tür.
Da steht nicht Daniel vor ihr.
Da steht einer in Daniels Alter, vielleicht ein bisschen drüber. Dafür kleiner. Nicht größer als sie selbst. Jetzt, auf ihren sehr hohen Absätzen, sieht sie sogar ein bisschen von oben auf ihn herab. Auf seine Glatze. Schlank, fast dünn steht er vor der Tür, sein schwarzer Anzug eine halbe Nummer zu groß. Ein weißes Hemd glänzt unter dem Jackett.
Er hat ein bisschen was von einem Totengräber.
Aber dann sieht sie, dass sein Hemd aus Seide und der Anzug mit kleinen gelben Applikationen versehen ist. Hier eine Naht, da ein Abnäher. Das ist Design. Mit so einem Anzug geht man auf eine Party, nicht zu einer Beerdigung.
Der Mann sieht sie kurz an, scheint verwirrt, seine Augen suchen an ihr vorbei einen Weg in das Haus. Sein Kopf zuckt einmal kurz, dann räuspert er sich.
„Wohnt hier nicht Daniel Loisan?“
Wie nebenbei registriert sie, dass er Lo-i-san sagt, wie es richtig ist, nicht etwa Leu-sahn, wie die meisten Menschen. Also scheint er Daniel zu kennen.
„Ja, der wohnt hier. Ist aber grad nicht da.“
Der Mann ruckelt den Gurt seiner Laptoptasche auf der Schulter zurecht. Die schwarze Tasche ist ähnlich wie der Anzug mit gelben Applikationen versehen. Designer-stück, eindeutig.
„Kommt er wieder?“
„Das hoffe ich doch!“
„Kann ich auf ihn warten?“
Wieder sieht Juli, wie seine Augen an ihr vorbei ins Haus drängen. Sie hält ihr Lächeln im Gesicht, während sie überlegt, ob sie den fremden Mann herein lassen soll. Und wie wohl Daniel das findet, wenn er zurückkommt. Und was der Mann will und wer er überhaupt ist. Und als hätte der Mann ihre Gedanken gelesen, sagt er: „Oh, Entschuldigung. Ich bin Gabriel. Gabriel Hollinderbäumer. Ein alter Freund von Dani. Ich bin zufällig in der Gegend sozusagen. Wollte ihm nur kurz zum Geburtstag gratulieren.“
Er hält ihr die rechte Hand hin. Hat er tatsächlich Dani gesagt? Automatisch nimmt Juli die Hand. Er weiß, dass Daniel Geburtstag hat. Okay.
„Juliane Wohlers. Juli.“
„Gabriel. Gabi.“
Juli lacht, der Mann lacht auch, aber sein Händedruck ist zart, beinahe schwächlich.
„Hallo Juli.“
„Hallo Gabriel.“
„Nein, wirklich. Alle nennen mich Gabi.“
Was jetzt? Na gut. Der ist harmlos.
„Okay. Hallo Gabi. Komm rein.“
Sie tritt einen Schritt zurück und lässt ihn an sich vorbei das Haus betreten. Er macht einige Schritte hinein, bleibt dann stehen und sieht sich um.
„Daniel ist laufen. Aber ich schätze, er ist jeden Augenblick zurück.
„Dani geht joggen?“
Also hat sie sich eben nicht verhört.
„Und du sagst Dani zu ihm?“
„Ja, warum?“
„Er mag das gar nicht.“
Er kann sogar richtig grantig werden, wenn sie ihm in einem Anfall zärtlicher Rührung irgendwelche Kosenamen gibt. Dani geht schon mal gar nicht. Mein Liebster sagt sie manchmal, das lässt er durchgehen.
„Setz dich doch.“
Gabi sieht sich um, geht zum Sofa und setzt sich.
„Tolles Kleid. Steht dir ausgezeichnet.“
„Danke.“
„Cooler Anzug.“
„Danke. Hat ein Freund für mich gemacht.“
„Solche Freunde hätte ich auch gern. Kann ich dir was anbieten? Kaffee? Wasser? Bier?“
„Wasser, gern.“
Juli schenkt zwei Gläser mit Mineralwasser ein und setzt sich zu ihm.
„Keine Geburtstagsparty heute?“
Gabi nimmt das Glas mit beiden Händen hoch. Zittern seine Hände etwa?
„Nein. Daniel will keine Feier. Keine Feier, kein Geschenk, kein Garnichts. Ist ja sein Geburtstag.“
Jetzt ist ihr aus Versehen doch die eigene Enttäuschung rausgerutscht. Sie lacht und wedelt mit einer Hand die imaginäre kleine dunkle Wolke vor ihrem Gesicht weg.
„Nein, wir fliegen morgen früh nach Madrid. Sehen uns die Museen an. Prado und so. Das ist sozusagen die Feier und das Geschenk und alles.“
„Madrid ist toll. Superschöne Clubs. Fantastisches Nachtleben. Mindestens so gut wie Barcelona. Wenn nicht besser.“
Gabi legt Daumen und Zeigefinger zusammen und führt sie an den Mund. Mit einem winzigen Schmatzer schickte er sie in die Luft zurück.
„Vielleicht sollten wir beide hinfahren“, lacht Juli und hebt ihr Glas.
Gabi sieht sie fragend an, aber Juli schüttelt nur den Kopf.
„Prosit!“
„Zum Wohl!“
Sie nimmt einen kleinen Schluck, stellt das Glas auf den Tisch und legt die Hände in den Schoß.
„So, jetzt aber mal. Ich würde ja gerne sagen: Ach, du bist Gabriel. Gabi. Schon so viel von dir gehört. Aber um die Wahrheit zu sagen, ich glaube, Daniel hat dich überhaupt noch nie erwähnt.“
Gabi verzieht den Mund, als habe er auf etwas Bitteres gebissen.
„Ja, wir haben uns lang nicht mehr gesprochen, geschweige denn gesehen. Müssen jetzt bald zwölf Jahre sein.“
„Woher kennt ihr euch denn überhaupt?“
„Wir haben zusammen Kunst studiert.“
„Kunst? Ich dachte, er hat Psychologie studiert. Ein paar Semester wenigstens.“
„Das war nachher.“
„Ach so, ja. Hab ich wohl nicht richtig abgespeichert.“
Sie nimmt das Glas in die Hand und führt es unschlüssig zum Mund, trinkt dann nur, um die Bewegung nicht ins Leere laufen zu lassen.
Klar, Daniel interessiert sich für Kunst. kann auch total gut zeichnen. Aber dass er das studiert hat, hat er nie erzählt. Das hätte sie sich gemerkt.
Das ist ja so typisch. Er redet überhaupt nicht gern über früher. Jede Geschichte muss man ihm einzeln aus der Nase ziehen. Und dann kommen auch nur vage Andeutungen von irgendwas. Einmal hat sie ihn nach seiner Schulzeit gefragt. „Ist vorbei.“ hat er gesagt. Mehr nicht.
„Und ihr? Wie kommt Dani zu so einer bezaubernden Frau? Hätte ich ihm nicht zugetraut, wenn ich ehrlich bin.“
Juli winkt ab und lächelt. Sie ist sich nicht sicher, ob das ein Kompliment ist. Da schwingt etwas Merkwürdiges mit, etwas, das sie nicht ganz einordnen kann.
„Verheiratet?“
„Nein.“
„Kinder?“
„Nein... noch nicht.“
Gabi hebt die Augenbrauen.
„Aber ihr plant welche?“
„Mal sehen.“
Ein kleines Männchen boxt ihr kurz in den Magen.
„Und wie habt ihr euch kennengelernt?“
Es ist schon ein bisschen forsch. Wie er mich ausfragt.
„Auf einer Weihnachtsfeier.“, sagt sie wahrheitsgemäß und muss lachen. „Voll peinlich, oder?“
Gabi lacht mit.
„Nein, warum denn?“
„Bei meiner Schwester in der Firma. Also nicht ihre Firma, sie arbeitet da bloß. Steuerberater, Anwälte, Anlageheinis und so. Große Kanzlei. Daniel hat die Homepage für die gebastelt. Saß da noch wegen irgendwas am Computer. Und alle anderen schon Party-Party-Party. Der tat mir so leid.“
„Hast du da auch gearbeitet? Bei deiner Schwester?“
„Nee, ich habs nicht so mit Zahlen. Kathi, meine Schwester, die ist die Kluge bei uns in der Familie. Ich war bloß mitgenommen.“
Ein winziges Glucksen und ein kaum sichtbares Kopfschütteln.
„Aber so was von mitgenommen. Glaubst du nicht. Hatte mich gerade ein paar Tage vorher von so einem Typen getrennt. Der hat mir ungelogen zwei Jahre lang heile Welt vorgespielt. Und dann hab ich – zufällig! – rausbekommen, dass der Frau und Kinder hat. Kleine Kinder. Familie. In einer anderen Stadt. Mitgenommen ist gar kein Ausdruck. Am Boden zerstört eher. Kathi wollte mich aufheitern, glaub ich. Oder an einen Kollegen verkuppeln. Anwalt oder Steuerdingsbums. Was Seriöses auf jeden Fall. Die waren aber alle bescheuert. Daniel war nett. Nee, nett ist blöd gesagt. Weißt schon, was ich meine.“
Sie sieht die Situation vor sich. Die Büroetage mit den grauen Teppichfliesen. Den Konferenzraum, der auch mit Weihnachtsdeko nichts von seiner Sachlichkeit, sprich Langeweile verlor.
Es roch nach Papier, nach Toner und irgendwie auch nach Computern. Ein Mitarbeiter vorne am Empfang. Dicker Bauch und lose Krawatte unter gerötetem Gesicht. Mixte Cocktails und schäkerte mit zwei aufgedonnerten Sekretärinnen. Im Konferenzraum hatte ein hagerer Jungspund ein paar Boxen an einen Computer gehängt und versuchte sich als DJ. Inklusive der Posen. Ein ebenso junger Kollege griff ihm gelegentlich in die Tastatur, was abrupte Wechsel in der Musik nach sich zog. Männer und Frauen in Anzügen, und alle schienen sich zu bemühen, eine schlechte Sitcom nachzuspielen. Peinlich, das Ganze.
In der Teeküche plauderte Kathi mit Kollegen, als sei ein ganz normaler Arbeitstag. Juli trank unschlüssig einen zu süßen und viel zu alkoholischen Cocktail und entdeckte dann den Mann im Serverraum, in seine Arbeit versunken, als sei er blind und taub für den Trubel um ihn herum. Sie schnappte sich eine Flasche Champagner und stellte sich an die Wand neben ihn. Irgendwie aus Mitleid. Weil er arbeiten musste, während alle anderen feierten.
„Bin gleich fertig.“
Er beachtete sie gar nicht richtig. So blieb sie einfach stehen, schaute ihm zu. Trank aus der Flasche.
„Was wird denn das?“
„Die neue Homepage.“, antwortete er, ohne den Blick vom Bildschirm zu nehmen. „Muss nur noch ein paar Sachen checken.“
„Ich arbeite hier nicht.“
„Ach so?“
Jetzt sah er sie das erste Mal an.
Blicke konnten sich tatsächlich berühren. Er sah sie an und schwieg. Wie bei einem Wettkampf. Sie knickte ein. Deine blauen Augen machen mich so.
„Schluck?“
„Gleich.“
War er bloß unsicher? So ein Computerfreak, der Angst vor Frauen hatte? Nein, dafür war er zu gelassen. Kein Anzeichen von Nervosität. Sollte sie das als unhöflich abtun, dass er sie so mit der Flasche in der Hand stehen ließ? Sollte sie einfach gehen?
Einer von den Anzugträgern kam dazu, ein Elchgeweih auf dem Kopf und einen Cocktail in der Hand.
„Was geht denn hier ab?“
Schwere Zunge und Glanz in den Augen.
„Arbeit.“, sagte der Mann am Rechner und tippte.
„Arbeit!“, wiederholte das Elchgeweih und versuchte es wie eine Zote klingen zu lassen. Der Computermann ignorierte ihn. Juli schloss sich an, stellte sich hinter ihn und starrte auf den Bildschirm als habe sie auch nur die Spur einer Ahnung, was die Zeichen dort bedeuteten.
„Na dann.“
Das Elchgeweih zögerte einen Moment und zog dann ab.
Er hatte „gleich“ gesagt. Wie lange dauerte ein „gleich“?
Und weil er nichts sagte, redete sie. Dass ihre Schwester sie mitgebracht hatte. Die arbeitete hier. Steuerberatung. Dass sie aber auch schon mal einen Bürojob gehabt hatte. Bei einer Spedition, nach ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau. Aber das hatte sie nur ihren Eltern zuliebe gemacht. Die meinten, dass sie was Sicheres in der Hinterhand brauchte. Weil sie ja eigentlich tanzen wollte. Also nicht Ballett und auch nicht Musical oder so. Sondern richtig. Paar und Formation. Tango, Salsa, Chachacha.
Und dann hatte sie ihr Hobby zum Beruf gemacht. Wart Profi geworden. Turniere getanzt. Und natürlich Shows. Viel rumgekommen. Hatte Spaß gemacht. Aber das ging halt nicht ewig.
Er sah kurz zu ihr rüber und sie verstand es als Aufforderung, weiter zu erzählen.
Dass sie jetzt eben fest in einer Tanzschule arbeitete. Auch ein bisschen Geschäftsführung mitmachte, weil sie das ja mal gelernt hatte. Doch, war ein guter Job. Hin und wieder gab es auch mal einen Auftritt. Sie war zufrieden.
Und wenn sie eigentlich doch gekommen war, um sich zu amüsieren, sich ein paar Drinks zu genehmigen und abzutanzen, so war es doch so viel schöner. Mit dem Mann da im Serverraum zu stehen und zu quatschen.
„Fertig.“
Er nahm ihr die Flasche aus der Hand und trank.
„Juli.“, stellte sie sich vor, weil sie plötzlich bemerkte, dass sie dem Typen zwar ihr halbes Leben erzählt, aber nicht ihren Namen genannt hatte. Er hatte auch nicht gefragt.
„Daniel.“
„Und du so?“
„Siehst ja. Webdesign.“
Sie tranken abwechselnd aus der Flasche und als es gegenüber im Konferenzraum richtig laut wurde, weil alle einen Karnevalsknaller mitbrüllten, wollte er nach Hause gehen. Einfach so. Sagte tschüs und zog seine Jacke an. Ohne nach ihrer Telefonnummer zu fragen. Also holte sie ihren Mantel, verabschiedete sich schnell von Kathi und lief ihm hinterher. Lotste ihn in die nächstbeste Bar.
Er taute auf. War witzig. Schlagfertig. Und er konnte gut zuhören. Sie erzählte ihm, dass sie gerade frisch getrennt war. Von so einem Vollspasti, der ihr zwei Jahre lang seine Familie in einer anderen Stadt verheimlicht hatte. Sie wartete auf seinen Versuch. Als der nicht kam, ergriff sie die Initiative. Küsste ihn. Es war schön. Also nahm sie ihn mit nach Hause. Schleppte ihn ab.
Wie vertraut sie mit ihm sein konnte. So verschlossen er nach außen war, so nah war er ihr, wenn sie allein waren. Das Wort Intimität bekam eine komplett neue Bedeutung.
„Also, wenn du nicht die Zahlenfrau in der Familie bist, was machst du denn stattdessen?“
„Tanzlehrerin.“
Gabi macht große Augen.
„Echt wahr?“
„Echt wahr. Wer’s nicht im Kopf hat, muss es eben in den Beinen haben. Sagt man doch so, oder?“
Sie lachen.
„Ich war Profi. Turniertanz. Formation. Aber da kommt nicht viel bei rum. Das Geld wird bei den Shows verdient. Firmenveranstaltungen und so. Tja, und am Ende landet man dann in einer Tanzschule. Augen auf bei der Berufswahl.“
Sie lacht einmal gegen den resignierten Tonfall an, der ihr da rausgerutscht ist und denkt gleichzeitig, dass es an der Zeit ist, den Spieß umzudrehen.
„Und du so? Machst du noch Kunst?“
„Ich mache nicht Kunst. Ich bin Kunst.“
Juli lässt ihr kleines Glockenlachen heraus, sie denkt, dass Gabi einen Scherz macht. Aber der lächelt nicht einmal. Sie nimmt ihr Wasserglas und nippt daran. Für einen Moment ist es merkwürdig still und sie überlegt, ob sie Musik auflegen soll. Oder welche. Komische Antwort. Ich bin Kunst. Was sollte das bedeuten?
„Ich betreibe einen kleinen Club. Das Bee-Hive.“
„Bee-Hive? Wie die Frisur?“
Juli tastet vorsichtig mit beiden Händen an ihren hochgesteckten Haaren herum und lächelt Gabi an.
„Nie von gehört, glaub ich. Wo ist der denn?“
„Oh, nicht in dieser Stadt.“
„Ach so. Was für Musik?“
„House, Elektro, Schlager. Je nach DJ.“
„Schlager?“
„Was die jungen Leute heute so hören wollen.“
„Legst du auch auf?“
„Manchmal.“
„Und was ist so deins?“
„Ich mag die alten Sachen. Funk, Soul, Disco.“
„Ich auch!“
Juli steht auf, stöckelt zur Hi-Fi-Anlage und schaltet sie ein. Die Boxen melden mit einem weichen Plopp ihre Bereitschaft. Sie geht in die Knie, nimmt kleine Päckchen von einem kippeligen Turm aus CDs, blättert sie durch, und dann findet sie, was sie gesucht hat, schiebt die CD in den Schlitz der Anlage und dreht den Lautstärkeregler hoch.
Eine Bassdrum markiert den Anfang, eine funkige Gitarre spielt eine kleine Melodie. Juli nickt im Takt. Streicher flirren aus den schlanken Boxen links und rechts des Flachbildfernsehers. Die Gitarre wieder und dann der Falsettgesang von Robin Gibb. Juli murmelt die Melodie mit und ihr Körper überlässt sich sofort der Musik.
„Awright, it’s okay, you may look the other way.“
Sie dreht sich einmal um sich selbst und ruft über die Musik: „Das beste an einem freistehenden Haus ist, dass man’s mal so richtig krachen lassen kann, ohne dass die Nachbarn gleich die Polizei holen.“
Sie sieht Gabi lächeln und nicken. Er schiebt die Schultern abwechselnd im Takt vor und zurück. Die Gibbs singen: „Staying alive, staying alive.“
Schade nur, dass wir’s nie machen. Party. Aber an meinem Geburtstag geht’s hier mal richtig ab, beschließt sie und dreht die Lautstärke wieder herunter.
„Sag mal Gabi, rauchst du?“
„Ja. Aber ich muss nicht unbedingt.“
„Doch! Jetzt gleich und unbedingt! Bitte, bitte, bitte!“
Sie geht zur Küchenzeile, holt einen der kleinen Aschenbecher und ein Feuerzeug aus der Schublade. Gabi zieht eine Schachtel Zigaretten aus seinem Jackett. Nicht ihre Marke, aber akzeptabel.
Er öffnet die Schachtel, hält sie ihr hin und schnippt sie von hinten an, so dass zwei Zigaretten nach vorne rutschen. Juli nimmt mit spitzen Fingern eine und strahlt.
„Danke.“
Sie lässt sich Feuer geben. Sie zieht. Sie inhaliert.
„Oh, tut das gut.“
Sie zieht gleich noch einmal.
„Normal rauchen wir praktisch gar nicht mehr. Wenn überhaupt, dann draußen. Aber ich finde, wenn Gäste da sind, ist drinnen erlaubt. Wollen ja keine totalen Spießer werden.“
Und so, wie man sicher sein kann, dass der Bus in dem Moment kommt, in dem man sich eine Zigarette anzündet, so geht auch just in diesem Moment das Türschloss. Juli zieht noch einmal hastig, pustet den Rauch in kurzen Stößen aus sich heraus und drückt dann die Kippe fahrig in den Aschenbecher, während sie gleichzeitig den Rauch vor ihrem Gesicht wegwedelt.
Die Tür geht auf. Daniel starrt erst sie an, dann Gabi.
„Ü-ber-rasch-schung!“, ruft sie und hebt die Hände auf Schulterhöhe.
Daniel lässt die Tür hinter sich zufallen.
„Gabi?“
Juli sucht eine Andeutung von Freude in seinem Gesicht. Vergeblich. Sie schluckt und zwingt sich ein tapferes Lächeln auf.
„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.“, hört sie Gabi hinter sich sagen.
„Danke gleichfalls.“, entgegnet Daniel kühl.
Gabi
bremst den Wagen an einer Kreuzung. Der Motor röchelt und Gabi muss ein bisschen Gas geben, um ihn am Laufen zu halten.
Er beugt den Kopf und sieht nach oben. Die Scheibenwischer schieben die feinen Tropfen des Nieselregens mit einem sanften Schaben zur Seite. Sie hinterlassen Schlieren.
Auf einem hellblauen und selbstreflektierenden Schild liest er den Namen der Straße, die er sucht. Die Navi-Uschi aber will ihn noch einmal um den Block schicken. Er schaltet sie ab, tritt aufs Gaspedal und fährt verkehrt herum in die Einbahnstraße.
Zwischen alten Bäumen parken neue Autos. Dahinter liegen von großzügigen Gärten umgeben die Häuser. Die Hausnummern sind kaum zu erkennen. Aber die Straße ist nicht sehr lang. Er wird irgendwo halten und zu Fuß weitersuchen.
Vor einer Villa, an deren Tor ein großes Schild darum bittet, die Einfahrt freizuhalten, parkt er den Wagen gegen die Fahrtrichtung ein und dreht den Schlüssel. Die Scheibenwischer legen sich stotternd zur Ruhe. Der Motor erstirbt und schweigt.
Gabi sinkt in den Sitz zurück und reibt sich die Augen. Abends kann er kaum noch etwas erkennen. Da hilft auch eine Brille nichts. Er drückt die Handflächen gegen das Gesicht, schiebt die Brille mit den Fingerspitzen nach oben und klopft sich die Wangen ab. Die Müdigkeit, die latente Erschöpfung, die ihn seit geraumer Zeit begleitet, lässt sich davon nicht beeindrucken. Seine Daumen massieren den angespannten Nacken.
Er setzt die Brille wieder auf und nimmt die Tasche vom Beifahrersitz. Ist das Ganze eine dumme Idee? Eine Kurzschlusshandlung? Gibt es denn keine Alternativen? Etwas mit gewisser Planungssicherheit?
Ich hätte mir wenigstens eine Waffe besorgen können. Oder die ganze Aktion ein bisschen besser vorbereiten, planen, durchdenken.
Aber die Idee ist erst vor kurzer Zeit entstanden. Beim Aufräumen. Diesen Zettel gefunden. Das Manifest. Ein bisschen Recherche, wo Daniel jetzt wohnt. Christine wusste es. Dann ist er losgefahren.
Und erst jetzt kommen die Fragen. Was wird er machen, wenn Daniel nicht da ist. Wenn er nicht alleine ist. Wenn alles den Bach runtergeht.
Es gibt Alternativen. Die gibt es immer. Er kann wieder nach Hause fahren und sich etwas anderes ausdenken. Etwas Glamouröses.
Aber ich will es wenigstens versucht haben.
Er steigt aus und sieht einen Schatten im Licht des Fensters der Villa. Ob die wohl den Wagen abschleppen lassen?
Egal.
Er lässt die Tür zufallen ohne abzuschließen.
Die Luft ist feucht und kalt. Der Regen legt Tropfen auf die Brillengläser. Er nimmt die Brille ab.
Das Haus, das er sucht, ist gleich nebenan. Es steht zwischen zwei beinahe baugleichen Villen. Kahle, aber hoch gewachsene Hecken begrenzen zu beiden Seiten ein schmales Grundstück, auf das sich ein Kubus von nicht mal zehn Metern Kantenlänge quetscht.
Die ehemals wohl weiße Farbe blättert an mehreren Stellen ab. Hohe schmale Fenster sind in die Wände geschnitten wie Schießscharten. Das Haus sieht aus wie ein Stück eines quadratischen Wehrturms, eine Art Legostein ohne Knöpfe, den man zwischen die beiden Villen in den Garten gestellt hat. Ein kantiger Fremdkörper, der die ornamentalen Formen links und rechts provoziert. Ein architektonischer Alptraum. Mehr Bunker als Haus. Dass irgendwer dafür jemals eine Baugenehmigung bekommen hat, ist erstaunlich genug. Aber Gabi findet den ästhetischen Widerspruch anregend.
Vor dem Haus sichert ein schmiedeeisernes Gitter das Gelände, ähnlich wie bei den Villen nebenan. Das Tor quietscht, als Gabi hindurchgeht.
Als er die Klingel drückt, hört er die Glocken von Big Ben im Inneren des Hauses widerhallen. Das war mal modern. Vor dreißig Jahren oder so. Nichts passiert. Aber er sieht Licht in den Fenstern und klingelt noch einmal. Er hört jemanden rufen. Dann öffnet sich die Tür.
Das ist nicht Dani, der da vor ihm steht. Es ist eine Frau mit einem hübschen Gesicht und strahlend blauen Augen unter hochgestecktem Blondhaar. Sie trägt ein Seidenkleid im Asia-Style. Hellblau wie ihre Augen. Kleine rosa Blüten, die in einer unregelmäßigen Linie an der Seiten entlang laufen, betonen ihre Figur. Als blicke man zwischen zwei blühenden Kirschbäumen in den Frühlings-himmel.
Hat er sich in der Adresse geirrt? Aber da ist das Schild mit der Hausnummer, die Christine ihm genannt hat. Er versucht, an der Frau vorbei einen Blick ins Innere des Hauses zu werfen. Mit wie vielen Menschen muss er rechnen? Feiert er etwa eine Party?
Dann bemerkt er sein eigenes Schweigen und die befremdliche Atmosphäre, die er damit erzeugt. Er zwingt sich ein Lächeln ins Gesicht und stellt sich vor.
Sie lächelt. Sie lässt ihn hinein.
Alles offen. Ein großer Raum. Quadratisch, innen wie außen. Weiße Fliesen auf dem Fußboden. Nicht mehr ganz taufrisch. Stumpf. Viele Risse und Sprünge darin. Es erinnert an ein altes Badehaus. Die schmalen Fenster, die Schießscharten, schließen den Raum nach außen eher ab, als dass sie ihn öffnen.
Vielleicht eher ein Schlachthaus. Auf halber Länge und halber Höhe ist eine zweite Ebene eingebaut. Sie wird von vier schmalen Säulen abgestützt. Holz, weiß angemalt. Eine Treppe links an der Wand führt hinauf. Oben zieht sich eine Galerie über die Breite des Raumes, zwei Türen. Schlafzimmer und Bad?.
Unter der Treppe ein Verschlag, vielleicht ein Gästeklo oder eine Abstellkammer. Daneben zwei weiße Arbeits-platten auf Alubeinen über Eck, mehrere Bildschirme darauf. Rechts von der Säule ein fliederfarbenes Sofa mit passendem Sessel. Ein gläserner Couchtisch. Blumen in einer Aalto-Vase. Ein großer Flachbildfernseher und eine Hi-Fi-Anlage. Neben der Eingangstür eine verrockte Küchenzeile. Ein Campingtisch. Eine Studentenbude.
Juli sagt, dass Dani laufen geht. Da scheint sich ja einiges in seinem Leben verändert zu haben. Und Juli ist womöglich tatsächlich seine Freundin. Jetzt geht es darum, Vertrauen aufzubauen. Eine Basis. Das wichtigste ist: Mit wie vielen Leuten muss er heute Abend rechnen? Gibt es eine Party? Nein. Juli scheint enttäuscht zu sein. Gabi ist erleichtert. Zwei Personen, das ist überschaubar. Wenn er es geschickt anstellt, kann er beide unter Kontrolle behalten. Auch ohne Waffe.
Juli redet von Madrid. Gabi erinnert sich an Madrid. Geile Partys mit José und den anderen Transen. Alle hatten schon mal in einem Film von Almodóvar mitgespielt. Behaupteten sie jedenfalls. Und er erinnert sich an eine Flamenco-Bar, in der José gesungen hatte. Herzzerreißend. Ehrlich. Schmerzhaft. Einmal weit weg von dem ganzen Glitter-Flitter-Disco-Scheiß. Ohne Fummel. Ohne Make-Up. Ein echter authentischer Moment. Selbst Josés Beerdigung war dagegen Showtime.
José. Joselito.
Juli holt ihn in die Gegenwart zurück. Woher er Dani kennt. Gabi fragt die Basics bei ihr ab. Und sieht dann, dass sie nicht so jung ist, wie er anfangs dachte. Ihre gute Figur und ihr hübsches Gesicht lenken von den kleinen Erscheinungen des Alterns ab. Hier und da die Fältchen. Sie hat die Mitte dreißig wohl doch schon überschritten.
Es ist die Rede von einer Weihnachtsfeier und dass sie Tanzlehrerin ist. Deshalb also läuft sie so sicher auf diesen Schuhen. Wie José es nie gelernt hat. Immer ein bisschen wackelig. Oder sind das die Drogen gewesen?
Ob er immer noch Kunst mache.
„Ich mache nicht Kunst, ich bin Kunst.“
Er zwingt seine Aufmerksamkeit auf diesen Moment in Raum und Zeit. Dafür bin ich doch hier. Reiß dich zusammen. Konzentrier dich!
Er erzählt vom Bee-Hive, sie legt Musik auf. Das unsägliche, zu oft gehörte Staying Alive. Soundtrack seines Lebens. Und eine Ironie, von der Juli nichts ahnen kann. Gute Miene zum bösen Spiel machen. Sie fragt nach Zigaretten. Sie rauchen. Und dann steht plötzlich Dani im Raum.
Ein Adrenalinkick mobilisiert Gabis Körper, als sei ein Vorhang aufgezogen, ein Scheinwerfer auf ihn gerichtet worden. Showtime.
„Ü-ber-rasch-ung!“
Ja, das ist Dani, der dort steht. Aber es ist nicht der Dani, den er in Erinnerung hat. Dieser hier trägt keine Brille. Dafür einen Vollbart. Die Haare ziemlich kurz. Und er ist schlank. Der Trainingsanzug hängt locker um seinen Körper. Gabi ist sich nicht sicher, ob er ihn im Vorbeigehen auf der Straße überhaupt erkennen würde.
Unglaublich. Er sieht echt gut aus.
„Gabi?“
Mit Schwung steht Gabi auf, greift nach dem Wasserglas, erhebt es in Richtung Dani und knallt dabei beinahe die Hacken zusammen.
„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!“
Danis Gesichtsausdruck wechselt von Verwirrung zu Unmut. Tropfen fallen von seinem nassen Trainingsanzug auf die Fliesen.
„Danke, gleichfalls.“
Erfreut ist er offensichtlich nicht. Aber, nun ja, das ist vielleicht auch nicht zu erwarten gewesen.
„Heißt das.“ Juli sieht abwechselnd zu Dani und Gabi.„Du auch?“
Gabi nickt, ohne den Blick von Dani zu nehmen.
„Gleicher Tag, gleiches Jahr.“
„Warum hast du nichts gesagt? Mensch, Gabi. Herzlichen Glückwunsch!“
Juli reicht ihm die Hand, überlegt es sich dann anders, drückt sich an ihn und umarmt ihn, Bussi links und rechts. Sie riecht nach etwas Süßem. Vanille vielleicht. Gabi denkt an Weihnachtsplätzchen und aromatisierten Tee.
„Das muss jetzt aber echt gefeiert werden.“
Juli trippelt zur Küchenzeile. Sie drückt Dani einen Schmatzer auf die Wange.
„Wie war’s?“
„Gut.“
Dani starrt Gabi an.