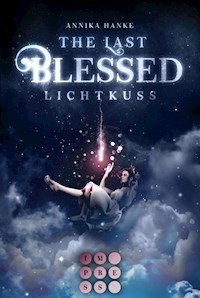Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mayas Bruder ist tot. Gebissen von einem Werwolf, dahingerafft vom Fieber. Jetzt ist es ihre Pflicht, in seine Fußstapfen zu treten und ihren Vater stolz zu machen: als beste Jägerin der Stadt! Doch sind die Werwölfe wirklich so abgrundtief böse, wie alle behaupten? Auf der Suche nach Antworten trifft Maya auf Ezra. Er ist ein Alpha ohne Rudel. Eine der Bestien, die sie bekämpfen muss. Je näher sie ihm kommt, desto mehr stellt sie infrage, was sie über die Welt, in der sie aufgewachsen ist, zu wissen glaubt. Bis sie vor eine folgenschwere Wahl gestellt wird: Leben oder Tod? Liebe oder Verrat? Doch was, wenn das schlimmste Monster in den eigenen Reihen haust? Vergiss Romeo und Julia und sag Hallo zu Maya und Ezra!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Crescent Hill
Im Schatten des Mondes
Annika Hanke
Copyright © 2023 by
Drachenmond Verlag GmbH
Auf der Weide 6
50354 Hürth
https://www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Julia Adrian
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout Ebook: Stephan Bellem
Umschlagdesign: Giessel Design – Christin Thomas
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-584-7
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Prolog
1. Maya
2. Maya
3. Maya
4. Ezra
5. Maya
6. Maya
7. Maya
8. Ezra
9. Maya
10. Maya
11. Maya
12. Ezra
13. Maya
14. Maya
15. Maya
16. Ezra
17. Maya
18. Maya
19. Maya
20. Ezra
21. Maya
22. Maya
23. Maya
24. Ezra
25. Maya
26. Maya
27. Ezra
28. Maya
29. Maya
30. Maya
Epilog
Danksagung
Drachenpost
Für die einsamen Wölfe,
die trotz allem stark genug sind,
aufzustehen und weiterzumachen.
Prolog
Blut klebte an seinen Händen, doch es war nicht sein eigenes. Er wusste, dass es Werwölfe gab, das hatte sein Vater ihm nie verheimlicht. Schließlich war er in eine Jägerfamilie hineingeboren worden, und es war seine Pflicht, eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.
Doch am heutigen Abend war sein ganzes Leben binnen Sekunden in Hunderte Scherben zersprungen.
Kaum öffnete er die Türen zum Anwesen, konnte er bereits die Spuren wahrnehmen. Nicht nur der schwere Geruch von nassem Hund und Wald hing in der Eingangshalle, auch modrige Pfotenabdrücke zeichneten sich auf dem hellen Marmorboden ab, und Robert wusste auf einen Schlag, was geschehen war: Wölfe hatten sich Zutritt zur Villa der Familie Cavanaugh verschafft.
Eiskalte Angst erfasste ihn, raubte ihm die Luft zum Atmen, weil er nicht wusste, was ihn erwartete, wenn er den blutigen Spuren an den Wänden bis zum Wohnzimmer folgte. Einen Herzschlag lang war er wie betäubt, ehe er einen Fuß vor den anderen setzte. Vielleicht hätte sein Verstand direkt auf den Jäger, der er sein sollte, umschalten müssen, doch er tat es nicht. Stattdessen blieb er der vierzehnjährige Junge, der er war und unter normalen Umständen sein sollte.
Als er ins Wohnzimmer trat und seine zwei Brüder zerfetzt vorfand, blieb er stehen, kämpfte gegen die Machtlosigkeit und das Würgen an, das automatisch hervorbrach. Vor dem Sofa fand er seine kleine Schwester und seine Mutter. Der Teller mit der Geburtstagstorte lag zersprungen auf dem Boden, eine einzelne Kerze brannte noch auf dem Tisch, daneben standen die Geschenke für Lia, fein säuberlich eingepackt. Ob seine Familie gedacht hatte, er komme zur Tür herein?
»Mom?«, brach es aus ihm hervor. Er strauchelte auf seine Mutter zu. Tränen nahmen ihm die Sicht, er stolperte über eine umgeschlagene Teppichecke und stürzte auf die Knie. Mit steifen Fingern griff er in die flauschigen Fasern, hoffte, betete, dass das hier nur ein Albtraum war, aus dem er gleich erwachte.
Da hörte Robert Kampfgeräusche aus dem Garten. Er riss den Blick von seiner Familie los und sah in die finstere Nacht hinaus. Als er den Schrei seines Vaters hörte, schaltete sein Verstand endlich, wenn auch langsam und wie durch dicke Wolken, auf den des Jägers um.
Er näherte sich auf allen vieren seiner Mutter und streckte die Hand nach dem Schwert aus, das von ihr umklammert wurde, als hinge ihr Leben davon ab. Und so war es ja auch gewesen, nicht wahr? Nur hatte sie den Kampf verloren.
Zitternd bog er die Fingerglieder seiner Mutter auf, um den Griff des Schwerts zu befreien und die Waffe selbst aufzunehmen. Sie war geschmiedet aus purem Silber, dem einzigen Material, das für Werwölfe bei einem Treffer ins Herz absolut tödlich war und auf der Haut für Verbrennungen und Verätzungen sorgte. Ausdruckslos starrte ihn seine Mutter an, keinerlei Wärme mehr in ihren Augen. Er hatte Mühe, den Kloß in seinem Hals hinunterzuschlucken.
Tapfer kratzte Robert seinen kläglichen Rest Mut zusammen und rannte nach draußen, genau dorthin, wo die Kampfgeräusche herkamen. Er fand seinen Vater im Garten, den linken Arm an den Körper gepresst, in der rechten Hand ein Silberschwert. In bedrohlich geduckter Haltung umkreiste ihn ein halb verwandelter Wolf, ließ ihn keine Sekunde aus den Augen. Die Bestie sprang vor, schleuderte seinen Vater zu Boden. Robert wusste sofort, dass sie keine Chance hatten.
»Lass ihn in Ruhe!«, rief er und hob das Schwert. Der Wolfsmann drehte sich zu ihm. Obwohl kein Vollmond am Himmel stand, glühten seine Augen gelb und die Fangzähne ragten zwischen den Lippen hervor. Er war nicht gänzlich verwandelt, aber auch definitiv nicht mehr menschlich.
»Robert, nicht! Das ist ein Alpha!« Sein Vater zwang sich hoch, der Wolf knurrte. Robert klopfte das Herz bis zum Hals. Wie sollte er gegen einen Alpha, den Kopf eines ganzen Rudels, kämpfen? Er hatte noch nicht einmal mit der Ausbildung an der Akademie begonnen. Er wusste nur das, was sein Vater ihm eingetrichtert hatte: Werwölfe waren das Böse. Sie mussten ausgerottet werden.
Mit einem Schrei stürzte er vor und hieb nach der Kreatur des Mondes. Ein Knurren drang aus ihrer Kehle, und sie sprang in unmenschlicher Geschwindigkeit zur Seite, sodass Robert sie verfehlte. Er hatte keine Chance. Der Wolf holte aus und traf ihn im Gesicht. Seine Wange brannte lichterloh und er stürzte, schaffte es nicht, sich wieder aufzuraffen. Die Ohnmacht nagte an ihm. Sein Vater schrie, ehe es gespenstisch ruhig wurde.
Er wusste nicht, wie lange er auf den Tod wartete, doch er kam nicht. Stattdessen kehrte mit jedem Herzschlag die Kraft in seinen Körper zurück. Er stützte sich auf die Ellbogen, blinzelte das Blut aus den Augen und sah sich verzweifelt um. Der Wolf schien fort zu sein, Hoffnung keimte in ihm auf. Hoffnung, die sofort schwand, als er die Silhouette seines Vaters am Boden entdeckte. Robert kroch auf ihn zu.
»Vater«, wimmerte er und starrte in dessen fahles Gesicht, das tiefe Kratzer über Stirn, Wange und Auge aufwies.
»Du musst unser Vermächtnis fortführen«, brachte sein Vater röchelnd hervor. Er legte eine blutverschmierte Hand an Roberts Wange und sah ihm in die Augen. »Werde ein Jäger. Beschütze Crescent Hill und vernichte die Werwölfe.«
»Vater, nein!« Tränen nahmen ihm die Sicht. Er wollte nicht wahrhaben, dass sein Vater starb. Dass seine ganze Familie tot war.
»Mein Junge, versprich es mir.«
Robert wusste nicht, woher er die Kraft nahm, doch er nickte. Es war der letzte Wunsch seines Vaters, er konnte ihm diesen niemals ausschlagen.
»Ich verspreche es«, flüsterte er.
Und die Trauer in seinem Blick wich loderndem Zorn, als sein Vater, der größte Werwolfjäger seiner Generation, den letzten Atemzug nahm.
Maya
Der Song im Radio dröhnte viel zu laut aus den Lautsprechern. Ich saß bereits seit einer halben Stunde auf dem Fahrersitz meines Wagens, hielt das Lenkrad fest umklammert und starrte auf das Gebäude, das sich hell und protzig in den Himmel erstreckte. Der prunkvolle Turm aus weißem Stein trug auf seinem Spitzdach eine Mondsichel. Die Schrift über dem Haupteingang hatte ich schon Tausende Male gelesen: Moonlight Academy.
Die Akademie, an der Jäger ausgebildet wurden, eines von Hunderten Instituten auf der Welt, die sich um das allgegenwärtige Werwolfproblem kümmerten. Seit die Wölfe vor ungefähr achtzig Jahren aus den Schatten getreten waren und wir um ihre Existenz wussten, gab es die Akademien. Sie waren quasi über Nacht gegründet worden und nicht mehr wegzudenken. Solange es Werwölfe gab, würden Jäger sie jagen.
Ich schloss die Augen und lehnte die Stirn gegen das Lenkrad, spürte den Bass des Songs in meinem Körper vibrieren. Die Akademie war zwangsläufig mein zweites Zuhause, doch noch nie war es mir so schwergefallen, durch diese Türen zu treten.
Aaron sollte an meiner Seite sein. Mein großer Bruder sollte mich aufziehen, weil ich beim Training gegen ihn verlor, sollte sich über mich lustig machen, weil ich seiner Meinung nach wie ein waschechtes Mädchen zuschlug. Doch Aaron war tot. Zwei Wochen schon, und seitdem war nichts mehr wie zuvor.
Ich hatte mir eine Auszeit genommen, auf den Pausenknopf gedrückt. Doch jetzt musste ich zurück, dem Druck und der Erwartungshaltung meiner Eltern standhalten.
»Wir unterbrechen für eine Eilmeldung«, gab der Radiosprecher bekannt. »In Denver hat es einen weiteren Werwolfsangriff gegeben. Dabei sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Moonlight Academy in Denver verhängt daher eine abendliche Ausgangssperre ab neun Uhr.«
Ein Klopfen an der Scheibe riss mich hoch. Neben meinem Auto stand niemand anderes als Jamie. Er lächelte und ich seufzte, ehe ich die sichere, abgeschirmte Blase meines Wagens verließ. Kühle, feuchte Herbstluft wehte mir entgegen, und ich wünschte, heute Morgen nicht aus dem Bett gestiegen zu sein. Hätte ich nicht einfach liegen bleiben können? Dann wäre mir die Akademie mit all ihren Idioten erspart geblieben.
»Hey«, grüßte Jamie und zog mich in eine Umarmung, kurz nachdem ich die Wagentür zugeknallt hatte. Ich atmete seinen vertrauten Duft nach Minze und frisch gewaschener Wäsche ein, drückte ihn jedoch von mir, als ich das dumpfe Gefühl aufkommender Tränen verspürte.
»Sorry, ich kann nicht …« Ich schüttelte den Kopf.
»Ich stehe diesen Tag mit dir durch, okay? Wir machen alles in deinem Tempo.« Trotz der herbstlichen Temperaturen trug er ein weißes Poloshirt, das im krassen Kontrast zu seiner dunklen Haut stand. Auf der linken Brust war die Mondsichel aufgestickt, die von einem Schwert durchstoßen wurde. Rosen rankten sich um die Silberwaffe, darunter stand der Schriftzug, der auch auf dem Akademiegebäude prangte.
Er fuhr sich durch das Haar, das an den Seiten kurz rasiert war und sich auf dem Kopf in winzigen Kringeln lockte, was seinen nigerianischen Wurzeln zu verdanken war.
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich hier sein möchte«, gab ich zu. Sein Nasenpiercing blitzte in der Sonne, als er den Arm um meine Schultern legte. Er zwang mich sanft, aber bestimmt fort vom Parkplatz in den Schatten der Akademie, die mir Bauchschmerzen bereitete.
»Ich bin mir sicher, dass es gar nicht so schlimm sein wird, wenn du erst das Gebäude betreten hast. Jeder hier weiß, was passiert ist. Sie werden sich dir gegenüber schon benehmen.«
Und genau das war meine Sorge. Ich wollte nicht von Blicken verfolgt oder in Watte gepackt werden, erst recht nicht vor meinen Eltern. Ich würde es nicht ertragen, sie würden es nicht ertragen, wenn die arme kleine Maya wegen des Verlustes ihres Bruders bemitleidet wurde. Ich musste stark sein, klarkommen mit dem Loch, das in meiner Brust klaffte, abschließen. Auch wenn es mir die Luft zum Atmen raubte und die Leere in mir mich zerfraß. Bislang hatte ich nichts gefunden, was diese Leere füllen konnte.
»Zieh dich um und komm in die Halle, ja? Ich werde deinem Vater sagen, dass wir gemeinsam trainieren.«
Jamie blieb vor den Umkleiden stehen. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass wir bereits die mit weißem Marmor ausgelegte Eingangshalle hinter uns gelassen hatten. Ich nickte nur zur Antwort, befreite mich aus Jamies Griff und stieß die Tür zur Umkleide auf. Die Deckenlampe schaltete sich flackernd ein, und ich fand mich in einem rechteckigen, rot gefliesten Raum wieder, in dem mehrere Bänke und Garderoben standen. Dieser Raum erinnerte an eine normale Highschool-Umkleide, auch wenn es dort sehr viel kleiner und enger war.
Ich suchte mir einen freien Platz und zog die Trainingsklamotten aus meiner Tasche. Das Logo der Moonlight Academy blitzte mir silbern entgegen, und ich strich kurz über den eingestickten Faden.
War ich tatsächlich schon wieder bereit, mich in den Ring zu begeben? Konnte ich einfach dort weitermachen, wo ich vor zwei Wochen aufgehört hatte?
Meine Eltern waren direkt nach Aarons Tod zur Normalität übergangen, als hätten sie nicht gerade ihren Sohn verloren. Als hätten sie nicht ihr Kind begraben müssen. Ich wusste, dass sie dasselbe auch von mir erwarteten, schließlich war ich eine Cavanaugh.
»Reiß dich einfach zusammen«, murmelte ich mir selbst zu und zog mich um. Ich band mir die hellblonden Locken zu einem Zopf zusammen und atmete noch einmal tief durch, ehe ich in die Halle trat.
Und natürlich passierte genau das, was ich befürchtet hatte: alle starrten mich an. Ich biss mir auf die Zunge, reckte das Kinn und ging zielstrebig auf Jamie zu.
Das Flüstern schwoll an. Es traf mich eiskalt.
»Wusstest du, dass sie schon wiederkommt?«
»Wie lange ist ihr Bruder jetzt tot?«
»Sieh sie dir an, als wäre nichts gewesen!«
»Typisch Cavanaughs.«
»Tja, kein Herz, kein Schmerz!«
Ich ballte die Fäuste und spürte den feinen Schmerz in den Handflächen, als sich meine Fingernägel in das Fleisch gruben. Normalerweise würde Aaron jetzt neben mir stehen und meine Finger entspannen, die verkrampfte Faust wieder öffnen. Aber er war nicht da, um mir zu sagen, dass alles gut werden würde.
»Maya, du gehst mit Jamie auf die Matte«, rief mir mein Vater entgegen, das dunkelblonde Haar wie immer perfekt gestylt, keine einzige Strähne lag in irgendeiner Weise falsch. Er hatte die muskulösen Arme vor der Brust verschränkt und blickte mich mit Aarons stahlgrauen Augen finster an. Natürlich ignorierte er das Flüstern, ignorierte meinen Schmerz, mein Unwohlsein.
Es lag nicht an mir, das wusste ich. Beziehungsweise versuchte ich mir das einzureden. Denn es lag irgendwie doch an mir, schließlich war ich nicht Aaron. Ich war nicht der Musterschüler, nicht der perfekte Sohn. Ich war nur die zwei Jahre jüngere Schwester, die jetzt zusehen musste, dass sie die Lücke füllte, die Aaron hinterlassen hatte.
Jamie zog mich auf die Matte. Die Halle der Akademie war riesig, uns gegenüber befand sich eine Fensterfront, die einen Blick auf die angrenzende Arena bot, in der die Prüfungen der Absolventen abgehalten wurden.
Rechts und links standen Waffenwände und jeweils ein Schrank, in dem die Matten nach dem Training verstaut wurden. Auch sie zierte die durchstoßene Mondsichel, das Symbol der Akademie und Werwolfjäger. Es verfolgte mich bereits mein Leben lang, und ich wünschte mir sehnlichst, es nicht mehr auf der Brust tragen zu müssen.
Doch das würde ich. Heute, morgen, selbst nächstes Jahr. Und bald sogar als Tattoo auf dem Unterarm, sollte ich die Ausbildung zur Jägerin abschließen. Was ich tun würde.
Tun musste.
»Fangt an!«, donnerte mein Vater durch die Halle, und ich hob die Fäuste, sicherte meinen Stand. In Jamies Gesicht konnte ich lesen, dass er mich verschonen wollte, dass er, so gut es ging, sanft zu mir sein würde. Ich schüttelte den Kopf. Ich wollte nicht verschont werden.
Mit einem tiefen Atemzug sprang ich vor und täuschte mit der linken Faust einen Kinnhaken an, traf Jamie dann aber mit der rechten gegen die Rippen. Er stöhnte auf, krümmte sich kurz, richtete sich aber blitzschnell wieder auf und schlug mit halber Kraft zu. Normalerweise spürte ich die Vibration bis in die Zähne, den Schmerz, der durch den ganzen Körper schoss, wenn Knochen auf Knochen traf. Doch dieser Schlag würde mir nicht einmal einen blauen Fleck bescheren.
»Johnson! Zu mir!«
Jamie ließ seine Kampfhaltung fallen, ehe er dem Befehl augenblicklich nachkam. Mein Vater, Robert Cavanaugh, war nicht nur Gründer und Trainer der Akademie, er war auch der Favorit der diesjährigen Bürgermeisterwahl von Crescent Hill und Oberster Werwolfjäger. Meine Mutter, Lucia Cavanaugh, war für die Verwaltung zuständig, den »bürokratischen Kram«, wie Vater es abfällig nannte.
Auch wenn sie nicht ganz so kalt und herablassend wie er war, ergänzten sich die beiden perfekt. Sie stärkte ihm in allen Dingen den Rücken und war die Vorzeigefrau an der Seite des wohl wichtigsten Mannes in Crescent Hill. Außerdem betreute sie die neuen Jäger und organisierte die entsprechenden Werbemaßnahmen sowie sämtliche Aufträge. Alles, was zu einem gut laufenden Geschäft nun mal dazugehörte.
»Wir sind nicht hier, um irgendjemanden zu schonen, hast du verstanden?«, tönte mein Vater, ganz in der Rolle der Akademieleitung. Er stand so, dass ich die Narbe, die sein Gesicht teilte, nicht sehen konnte. Doch ich wusste, sie war da. Ein brandrotes Mahnmal, das wie sein alles zerfressender Hass auf die Wölfe loderte. Ich teilte diesen Hass nicht, obwohl ich durch sie Aaron verloren hatte, so wie Vater seine ganze Familie. Anders als er wollte ich aber keine Rache, sondern ein Leben frei von Gewalt und Tod und Verlust; eines, in dem ich nicht die Tochter des besten Jägers von Crescent Hill samt blutrünstigem Erbe war.
Was der Hass und das Töten mit einem anstellen konnten, sah ich tagtäglich in meiner Familie. Es hatte uns Aaron gekostet – und ein Teil von mir fürchtete, dass ich genauso enden würde. Trotzdem wollte ich keine Mörderin sein.
Nicht einmal eine Wolfsmörderin.
»Ihr denkt vielleicht noch, das sei nur Spaß. Das ist es aber nicht!« Vater hob die Stimme und sprach nun zu allen Anwärtern. »Ihr werdet hier ausgebildet, um unsere Stadt vor den wilden Kreaturen zu schützen, die nicht zögern würden, euch oder andere Menschen zu töten. Es ist mir also egal, ob ihr untereinander befreundet seid oder nicht. Jeder trainiert mit voller Kraft! Ansonsten ist er oder sie nicht würdig, ein Jäger der Moonlight Academy zu sein.« Bei den letzten durchdringenden Worten sah Vater Jamie an. Ein Wunder, dass er nicht direkt mich ansprach; das war auch gar nicht nötig. Er hatte das Talent, mich auch so zu treffen.
Jamie trat mit gesenktem Kopf zurück auf die Matte. Ich schüttelte meine Arme aus, ehe ich sie in Verteidigungshaltung hob. Mir war klar, dass Jamie jetzt härter zuschlagen musste, weil er sonst Probleme bekam. Ich verstand das, niemand hier wollte sich mit der Akademieleitung anlegen.
Wir hatten schon oft zusammen gekämpft, ich kannte Jamies Taktik in- und auswendig. Vielleicht konnte ich ihm standhalten. Doch er war viel schneller, als ich in Erinnerung hatte. Er stürzte nach vorn, im nächsten Moment spürte ich bereits, wie sein Unterarm gegen meinen prallte. Das vertraute Vibrieren schoss durch meinen Körper, der Schmerz breitete sich aus und ließ mich keuchen. Adrenalin pumpte durch meine Adern und spülte den Schmerz fort.
Bevor Jamie ein weiteres Mal zuschlagen konnte, duckte ich mich und riss ihm die Beine unter dem Körper weg. Er landete auf dem Rücken, doch den Bruchteil einer Sekunde später war er schon wieder auf den Füßen und schlug zu. Er traf mich in die Rippen. Ich taumelte, blockte den nächsten Schlag ab, doch Jamie war zu schnell. Sein Kinnhaken traf mich mit voller Wucht und ich ging zu Boden. Das Blut, das auf die Rose des Wappens tropfte, war kaum zu sehen. Beides war rot und verlief ineinander.
Ich fuhr mir mit dem Handrücken über die aufgeplatzte Lippe und richtete mich auf. Jamie neigte kurz den Kopf, als wollte er sich entschuldigen. Doch nun war ich diejenige, die sich auf ihn stürzte. Ein Sturm aus Emotionen wütete in meinem Inneren, das Adrenalin rauschte durch meine Blutbahn. Ich dachte an Aaron, dachte an meinen Vater, dem ich nie genug sein würde, und schlug zu. Drängte Jamie zurück, der in meiner schnellen Schlagabfolge nur die Arme überkreuzt vor sein Gesicht halten konnte. Ich schlug ihm in die Rippen, er keuchte, hielt meine herannahende Faust jedoch auf und drehte mir den Arm auf den Rücken, sodass ich schmerzerfüllt aufschrie. Er stieß mich zu Boden, und dieses Mal wollte ich einfach nur liegen bleiben.
»Für heute reicht es.«
Die Schritte der Anwärter entfernten sich und ich schloss die Augen. Mein Kopf brummte, mein Arm schmerzte und ich rollte die Schulter, um zu überprüfen, ob sie noch im Gelenk saß. Jamie würde mich zwar niemals ernsthaft verletzen, aber Unfälle geschahen, erst recht, wenn Druck von meinem Vater ausgeübt wurde.
»Du hast gut gekämpft«, lobte Jamie und reichte mir die Hand. Ich ließ mich hochziehen und seufzte erschöpft.
»Nicht gut genug«, erwiderte ich mit Blick auf meinen Vater, der sich nur kopfschüttelnd abwandte und selbst die Halle verließ. Ich war kein Vergleich zu Aaron, und die Enttäuschung meiner Eltern darüber spürte ich jeden verdammten Tag.
»Daran arbeiten wir, versprochen.«
Ich schenkte Jamie ein halbherziges Lächeln, das keine Hoffnung in sich trug, ehe auch wir die Halle verließen.
* * *
Als ich aus der Dusche kam, war die Umkleide zum Glück leer. Alle wollten nach Hause, alle außer mir. Ich würde mir bloß am Esstisch anhören müssen, dass ich versagt hatte, generell nicht stark genug sei, zu wenig Motivation zeige und überhaupt eine bodenlose Enttäuschung sei, weshalb ich Zeit schindete. Ich wischte über den beschlagenen Spiegel und betrachtete mein Ebenbild. Den kleinen Leberfleck auf der Nase hatte Aaron an genau derselben Stelle gehabt. Die Ähnlichkeit zu ihm fraß sich heute schmerzhaft in mein Herz, und in meinen sowieso schon geröteten Augen standen neue Tränen, die ich kaum noch aufhalten konnte. Äußerlich glichen wir einander so sehr, dass ich bei jeder reflektierenden Scheibe zusammenzuckte. Beinahe dankbar betastete ich die aufgeplatzte Lippe, die bereits zu schwellen begann und mein Gesicht – Aarons Gesicht – verfremdete. Es würde sicher ein paar Tage dauern, ehe der feine Schnitt verheilte.
Ich reckte das Kinn und schluckte die Tränen. Zumindest in diesem Punkt unterschied ich mich von Aaron und glich mehr meinem Vater: Ich konnte meine Gefühle genauso gut verbergen wie er, auch wenn das die einzige Gemeinsamkeit war, die wir teilten.
* * *
Es war spät geworden, draußen war die Sonne fast untergegangen, was mir die Ruhe gab, nach der ich mich sehnte. Ich hasste es, eine Maske zu tragen, nicht ich sein zu dürfen. Selbst zu Hause musste ich die Starke mimen, weil es sich für eine Cavanaugh einfach so gehörte. Ich durfte keine Schwäche zeigen, das hatten mir meine Eltern eingetrichtert – und ich gehorchte.
Als ich in meinem Wagen saß, stieß ich die Luft aus. Am liebsten würde ich hierbleiben, nicht heimfahren.
Mein Handy vibrierte und zeigte eine Nachricht von Jamie.
J: Sorry, dass ich einfach gegangen bin. Meine Eltern haben mich abgeholt – sind bei Tante Trudy …
Ich musste über das augenverdrehende Emoji hinter seiner Nachricht schmunzeln. Tante Trudy war eine recht gewöhnungsbedürftige, schrullige ältere Dame, die allein außerhalb von Crescent Hill lebte. Seit dem Tod ihres Ehemanns pflegten Jamies Eltern engen Kontakt zu ihr und fuhren alle zwei Wochen hinaus. Es war zu einer Tradition geworden, dass Jamie mitmusste. Sie freute sich immer so sehr, ihren einzigen Neffen mit selbst gebackenen Törtchen zu verwöhnen, wohingegen er froh war, wenn er wieder verschwinden konnte.
M: Oh, grüß Tante Trudy herzlich von mir! Und ihre fünf Katzen, oder waren es schon sechs? Wie auch immer, wir sehen uns morgen!
Zwar konnte Jamie das schwache Lächeln auf meinem Gesicht nicht sehen, aber ich fühlte mich ein bisschen ausgeglichener, als ich die Nachricht getippt hatte. Jamie war eine der wenigen Konstanten in meinem Leben, die mir Halt und Geborgenheit gaben.
Anstatt einer richtigen Textnachricht sendete er nur noch mehr augenrollende Emojis, was mich zum Lachen brachte. Ich warf das Handy in meine Tasche und trat den Heimweg an.
* * *
Natürlich stand der Range Rover meines Vaters bereits im Carport. Ich hielt vor dem gusseisernen Tor, tippte den Code ins Zahlenfeld und lenkte meinen Ford neben die Luxuskarosse. Erneut fühlte ich mich unfähig, auszusteigen und in das Gebäude zu gehen. Irgendwie häuften sich diese Momente derzeit bei mir. Nichtsdestotrotz zwang ich mich hinaus und hinein in die Höhle des Löwen.
»Ich bin wieder da«, rief ich, hängte meine Jacke auf und betrat das ausladende Wohnzimmer unserer Villa. Die bodentiefe Fensterfront zeigte den letzten Lichtstreifen am Horizont, bevor die Sonne gänzlich unterging. Zugegeben, wir hatten einen fantastischen Ausblick.
Crescent Hill lag in Colorado, am Rande der Rocky Mountains. Die Berge boten ein märchenhaftes Panorama, waren jedoch auch die Heimat zahlloser Werwölfe. Deshalb pochte Vater so sehr darauf, dass die Stadt genügend Jäger ausbildete, um diese auf kontrollierte Streifzüge zu schicken. Die Jäger beschützten die Stadt und verteidigten sie gegen Angriffe, dämmten die Wölfe aber auch aktiv ein, sollten sie zu zahlreich werden oder Crescent Hill zu nahe kommen. Da die Handlungsbefugnis darüber allein beim amtierenden Bürgermeister, Shawn McIntyre, lag, war mein Vater scharf auf den Posten. Würde er die kommende Wahl gewinnen, stand ihm nichts und niemand mehr im Weg. Dann konnte er frei über sämtliche Eindämmungsaktionen und Streifzüge entscheiden.
»Du hast lange gebraucht«, merkte meine Mutter an, die gerade eine Schüssel Salat auf den Esstisch stellte. Ich zwang mich zu einem falschen Lächeln.
»Ja, tut mir leid, ich wurde aufgehalten.«
»Von wem? Deinem Wagen?« Die Stimme meines Vaters war verächtlich. Mein Lächeln verrutschte, ich räusperte mich und setzte mich an den gedeckten Tisch. »Du hättest heute fokussierter sein müssen, Maya. Dein Auftritt war alles andere als würdig.«
»Ich weiß, tut mir leid. Wird nicht mehr vorkommen«, sagte ich leise und starrte auf den Teller vor mir. Auf den Rand war ein verschnörkeltes goldenes C gemalt worden – Cavanaugh. Nicht einfach nur ein Nachname, sondern der Inbegriff der besten Jägerfamilie ganz Amerikas. Ich konnte mir dank dieses Namens, der ein Gewicht hatte, das ich nicht tragen konnte, innerhalb von Crescent Hill keine eigene Zukunft aufbauen. Ich war verflucht, denn ich war eine Cavanaugh – eine Jägerin. Ganz egal, ob ich es wollte oder nicht.
»Richtig, das wird es nicht. Du wirst dich konzentrieren und zusammenreißen, hast du verstanden? Es liegt nun an dir, die Beste der Akademie zu sein. Dein Bruder wäre nie so schnell zu Boden gegangen. Keine fünfzehn Sekunden – kannst du dir das vorstellen, Lucia? Da kommt unsere Tochter zu spät zum Training und lässt sich auch noch wie ein blutiger Anfänger übertölpeln! Eine Schande.«
Ich presste die Lippen aufeinander. Es war immer dasselbe. Seit Aaron tot war, musste ich mir genau diese Worte anhören.
Deinem Bruder wäre dieser Fehler niemals passiert.
Aaron war ein besserer Kämpfer.
Aaron wäre ein exzellenter Jäger geworden.
Aaron, Aaron, Aaron.
Wo blieb ich dabei?
»Ich habe keinen Hunger«, sagte ich und stand auf.
»Iss wenigstens etwas Salat.« Meine Mutter klang weitaus friedlicher, als ich mich wegen meines Vaters fühlte.
»Ich sagte, ich habe keinen Hunger.«
»Lass sie gehen, Lucia«, befahl mein Vater knapp, und ich sah zu, dass ich die Treppen hochkam. In meinem Zimmer schmiss ich die Tür zu und warf mich aufs Bett. Ich presste mir ein Kissen vors Gesicht, damit es meinen Schrei erstickte. Wie sehr ich mir wünschte, endlich volljährig zu sein und diesem Haus, dieser Stadt einfach nur den Rücken zu kehren.
Maya
Zu meinem großen Glück waren meine Eltern am Morgen schon aus dem Haus, als ich die Treppe nach unten zur Küche nahm. Ich kannte es nicht anders, Aaron und ich waren in unserer Kindheit stets allein gewesen. Wir hatten ein gutes Dutzend Babysitter durch, ehe meine Eltern entschieden, Aaron sei alt genug, um von nun an selbst auf mich zu achten. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir nur noch uns selbst. Und jetzt war ich ganz allein.
Ich schmiss die Kaffeemaschine an und suchte mir meinen Lieblingsthermobecher aus dem Schrank, den Aaron mir zum letzten Geburtstag geschenkt hatte. Er war knallbunt, ganz im Gegensatz zur beigefarbenen Küche, die direkt an das offene Wohn- und Esszimmer mit der Fensterfront grenzte. Ich sah auf die Kochinsel in der Mitte, auf den neuesten Induktionsherd, die marmorne Arbeitsplatte und die teuren Möbel, die sich fein säuberlich aneinanderreihten.
Unser Haus war schön, keine Frage. Schön, wenn man auf klassische Eleganz, Reichtum und Luxus stand. Ich hingegen hatte mir immer einen Hund gewünscht. Dann wäre Leben in dieses Haus eingekehrt, dann hätte man es nicht für ein Ausstellungsstück gehalten, in dem kein einziges Körnchen Staub zu finden war. Aber meine Eltern hatten es nicht erlaubt, ein Hund hätte meinem Fokus geschadet – und der sollte stets auf der glorreichen Zukunft als Jägerin liegen.
Ich riss mich von der Einrichtung los und kochte mir einen Kaffee. Aaron hatte seinen immer schwarz getrunken, was ich überhaupt nicht verstehen konnte – wie bekam man dieses bittere Zeug bitte ohne Milch und Zucker runter?
Nachdem ich meinen To-go-Becher verschlossen hatte, verließ ich das Haus der Akademieleitung – denn nach Familie fühlte es sich hier schon lange nicht mehr an.
* * *
Bevor ich mich in die Schule stürzte, blieb ich noch einen Moment im Wagen sitzen. Es wurde zu einer neuen Gewohnheit, die mir Kraft gab, den Alltag ohne Aaron durchzustehen. Ich hörte einen Song zu Ende, den er gemocht hätte, schaltete das Radio aus, als die Werbung prompt mit der Ausbildung zum Jäger startete, und versuchte die Trauer beiseitezuschieben. Anders als die Akademie hatte ich die Highschool nicht pausiert, sondern war zwei Tage nach Aarons Beerdigung mit versteinertem Gesicht zum Unterricht erschienen, weil meine Eltern darauf bestanden hatten.
Trotz – oder gerade wegen des Verlustes eines Jägers gab es in der Schule nur ein Thema: den Tag der offenen Tür bei der Moonlight Academy und die darauffolgende Woche voller Infoabende und Veranstaltungen.
Die Beerdigung des eigenen Sohnes hin oder her – Priorität meiner Eltern war es, neue Jäger auszubilden, deshalb gaben sie sich die größte Mühe, möglichst viele Highschool-Abgänger anzuwerben. Das Gesetz schrieb ein Mindestalter von achtzehn Jahren vor – nur galt das nicht für uns, die glücklichen Kinder der Akademieleitung.
Wir waren die große Ausnahme.
Gewesen … denn jetzt war das nur noch ich.
Wäre es nach mir gegangen, hätte mich nichts auf der Welt dazu bringen können, mich zur Werwolfjägerin ausbilden zu lassen. Doch meine Stimme hatte nie gezählt, und jetzt war ich das Aushängeschild der Akademie. An jedem Schwarzen Brett, das es hier gab, hingen Plakate und Flyer mit meinem Gesicht. Die Jäger waren mit jedem Schritt, den man hier tat, überpräsent.
Sophie wartete am Spind auf mich, ein breites Lächeln im Gesicht, die Augen funkelnd. Alles an ihr schrie nach guten Neuigkeiten.
»Du glaubst gar nicht, wer mich gefragt hat, ob ich mit ihm auf Trevors Party gehe!« Ihre Stimme war gedämpft, dennoch schoss sie zum Satzende ein, zwei Oktaven höher. Wie dankbar ich ihr war, dass sie mich nicht schonte oder mit Samthandschuhen anfasste. Stattdessen hakte sie sich bei mir unter und strahlte mich an. Sie wusste, wie sehr ich diese Normalität brauchte, wie dringend ich weitermachen musste, was auch immer weitermachen hieß. Ich hielt inne, ließ mir mit der Antwort Zeit, um sie ein bisschen zappeln zu lassen, und tippte mir nachdenklich gegen das Kinn.
»Vielleicht Daniel aus dem Footballteam?«
Sie verdrehte die Augen.
»Oder John aus der Elften?«
»Man, stell dich nicht dumm! Brian hat mich gefragt.«
Ich setzte ein Lächeln auf, das sich sogar ein bisschen echter anfühlte als die unzähligen davor. Brian war in unserem Jahrgang, und Sophie hatte schon ewig ein Auge auf ihn geworfen. Sie war bisher bloß zu schüchtern gewesen, um ihn anzusprechen, weshalb ich mich umso mehr freute, dass er es nun endlich geschafft hatte, sie zu einer Party einzuladen.
»Wenn du willst, machen wir uns gemeinsam fertig«, bot ich an.
Ihre Augen funkelten. »Wirklich?«
»Ja, natürlich.« Es war der erste Schritt aus meinem Schneckenhaus. Wieder aktiv am Leben teilnehmen, etwas erleben. Vielleicht war es die richtige Entscheidung.
»Ich würde mich wirklich freuen. Aber nur, wenn es für dich nicht zu viel wird, ja?«
Ich gab mich selbstsicherer, als ich mich fühlte. »Ich kann dich doch unmöglich ohne meine Unterstützung mit Brian ausgehen lassen, nicht bei deinen Haaren!«
Ich streckte die Hand aus und berührte ihre wirre Mähne, die wir unbedingt bändigen mussten. Sophie hatte kein Händchen dafür, ich dafür umso mehr.
Sie sah aus wie eine Irin, bestand aber darauf, ausschließlich amerikanische Vorfahren zu haben. Woher sie also den Rotton ihres Haars hatte, der so typisch für die Inseln war, blieb ungeklärt. Vielleicht waren vor Hunderten von Jahren auch Wikinger nach Amerika gekommen und hatten das wilde Rot an sie vererbt. Das Temperament dazu hatte sie jedenfalls, auch wenn es sich selten zeigte. Sophie war eher der ruhige, unauffällige Typ. Und genauso war auch ihre Kleiderwahl – der ich ein bisschen Glamour verleihen würde.
»Du wirst ihn umhauen, da bin ich mir sicher.«
Sophie lächelte, ihre Wangen glühten. Sie war bis über beide Ohren in diesen Kerl verliebt.
»Oh, oh!« Ich deutete mit dem Kinn hinter sie. »Objekt der Begierde auf sechs Uhr.«
Sophie riss die Augen auf. »Kommt er hierher?«
»Er ist gleich da. In drei, zwei, eins …«
»Hey«, sagte Brian.
Sophie drehte sich in Zeitlupe zu ihm um. »Hi.«
»Also ich dachte, dass wir zwei uns vielleicht heute nach der Schule im Bex BBQ treffen könnten?«
Ich konnte förmlich sehen, wie das Herz von Sophie einige Etagen tiefer sank, bevor es doppelt so schnell zu schlagen einsetzte. Sie nickte eifrig.
»Ehm, ja, das wäre toll!«
»Cool. Also sehen wir uns nach der Schule.« Er schenkte ihr ein Lächeln, bei dem seine Grübchen zum Vorschein kamen, ehe er mit seinen Freunden verschwand.
Sophie atmete tief durch. »Ist das gerade wirklich passiert?«
»Ist es. Ich habe es mitbekommen.« Ich versuchte gar nicht erst, das Grinsen zu verstecken.
Als es klingelte, hakte sie sich bei mir unter und begann darüber zu philosophieren, ob sie sich vorher noch umziehen müsse oder nicht. Ich bestärkte sie darin, so zu bleiben, wie sie war, wenngleich ich ihr versprach, einen Lidstrich für sie zu zaubern. Make-up gehört zu meiner Standardausrüstung. Augenringe von durchweinten Nächten? Kein Problem. Blasse Haut von zu viel Kummer? Auch dafür kannte ich die perfekte Lösung. Beautyprodukte waren mein Schild, sie verbargen mein wahres Ich zuverlässig vor den Blicken der Öffentlichkeit, vor ihrem Urteil und Spott. Auch Sophie, da war ich sicher, würde der feine Schwung eines Lidstriches den nötigen Stupser Selbstvertrauen geben.
Mit ihr an meiner Seite verging der Unterricht wie im Flug, und schon hatte ich sie verabschiedet. Unsicher stand ich auf dem Parkplatz der Crescent High, der sich allmählich leerte, und suchte nach einem Grund, nicht zur Akademie zu müssen. Es fiel mir so unfassbar schwer, dort hinzugehen. Vielleicht, weil alles dort mit Aaron zusammenhing und zu viele Erinnerungen an diesen Ort geknüpft waren.
Also steuerte ich einen der Tische auf dem Hof an, kramte meine Hausaufgaben hervor und begann mit einem Aufsatz, den wir zwar erst Ende der nächsten Woche fertig haben mussten, der mir aber gerade recht kam. Ich holte mein Handy und meine Kopfhörer raus und hörte nebenbei Musik, was den Nachmittag erträglich gestaltete.
Erst als ein Schatten auf meinen Text fiel, tauchte ich aus meiner Arbeit auf und hob den Kopf. Jamie saß mir gegenüber und schmunzelte. Ich zog die Kopfhörer raus und beendete den Song von TheFray, bevor er richtig beginnen konnte.
»Hast du kein Training?«, fragte ich ihn.
»Ich habe dich gesucht. Du warst nicht in der Akademie, deswegen habe ich mir Sorgen gemacht.«
Ich winkte ab, rollte die Kopfhörer auf und steckte sie in das Seitenfach meiner Tasche. Seit fast einem Jahr war das mein strikter Tagesablauf: vormittags besuchte ich die Highschool, danach ging es zum Training in die Akademie. Viel Zeit für Hausaufgaben, Freizeitaktivitäten oder gar einen Sportverein blieb da nicht.
»Mein Vater tobt, richtig?«
Jamie zuckte mit den Schultern. »Er war gar nicht da. Wie sieht’s aus? Hast du Hunger? Ich könnte einen Burger vertragen.« Er lehnte sich auf der Bank zurück und fasste sich mit beiden Händen an den Bauch.
Ich lachte. »Wie kann ich dazu bloß Nein sagen?«
* * *
Der Parkplatz vorm Bex BBQ war wie immer proppenvoll, und ich war erleichtert, als ich etwas abseits noch einen Stellplatz im Schatten zweier Rhododendren fand. Im Inneren des Bex BBQ herrschte reges Treiben, die vielen verschiedenen Gespräche erschlugen uns, kaum dass wir eintraten. Der vertraute Geruch nach Pommes und Fett stieg mir in die Nase, und prompt musste ich an meinen letzten Besuch hier denken. Es war der Abend gewesen, in dessen Verlauf Aaron von einem Werwolf gebissen worden war. Ein Kloß setzte sich in meinem Hals fest, und ich kämpfte gegen die aufkommenden Tränen. Erst vor drei Wochen hatte ich hier mit ihm gesessen; er hatte eine Ketchupflasche zum Explodieren gebracht, sein ganzes Gesicht, sein Haar, alles war rot gewesen. Sein Lachen schien noch im Raum zu hängen.
Blinzelnd folgte ich Jamie zur Bar. Als ich unseren Stammplatz passierte, spielte mir mein Verstand einen Streich: der Typ, der seinen Burger dort aß, ähnelte meinem Bruder so sehr, dass ich ins Stocken geriet.
Doch er war es nicht.
Natürlich nicht. Denn Aaron war tot.
Der Kloß schwoll an, drückte auf meine Brust und schnürte mir die Luft zum Atmen ab. Eine Welle der Trauer überrollte mich.
»Geh schon mal zu Bex, ja?«
Jamie zog die Brauen zusammen, doch er nickte nur. Vermutlich sah er mir an, dass etwas nicht stimmte. Ich flüchtete zu den Toiletten, schloss die Tür und stützte mich auf das Waschbecken, um tief durchzuatmen.
»Atme, Maya. Reiß dich zusammen«, flüsterte ich mir selbst zu und fing die erste Träne mit dem Zeigefinger auf. Ich presste die Zähne aufeinander und zwang die Trauer nieder. Gäbe ich jetzt nach, würde ich zusammenbrechen. Ich kannte diese Momente zu gut, wenn die Erinnerungen an meinen großen Bruder, meinen Helden aufbrachen, und mit ihnen das klaffende Loch in meiner Brust. Wenn ich allein war, konnte der Schmerz die Oberhand gewinnen. Nicht aber hier. Nicht vor allen Leuten – ich war schließlich eine Cavanaugh.
Ich brauchte einige Atemzüge, ehe ich mich so weit unter Kontrolle hatte, dass ich mich zurücktraute.
»Hey, Bex«, grüßte ich die rothaarige Bardame und setzte mich auf den Hocker neben Jamie, der mich besorgt musterte, aber zu meinem Glück nichts sagte. Er wusste vermutlich, dass jeglicher Kommentar meine hauchdünne Selbstbeherrschung zum Einstürzen bringen konnte.
»Hi, ihr Süßen. Was darf ich euch bringen?«
»Zweimal den Bacon Burger mit Pommes und Tequila.«
Bex legte die Unterarme auf den polierten Tresen und beugte sich zu Jamie. Ihre Augen funkelten. Sie war Anfang zwanzig, hatte ein kleines Vermögen von ihrer Großmutter geerbt und sich mit diesem Restaurant einen Lebenstraum erfüllt. Sie wusste natürlich, dass Jamie und ich keinen Alkohol trinken durften – ich noch weniger als er, da ich erst siebzehn war. Jamie war im Alter meines Bruders. Neunzehn.
Aaron war bloß neunzehn geworden.
»Netter Versuch, Kleiner.« Bex’ seidenweiche Stimme ließ keine Widerrede zu, doch Jamie wusste, dass sie eine Schwäche für ihn hatte. Er fuhr mit dem Zeigefinger federleicht über ihren Unterarm.
»Vielleicht hast du aus Versehen eine Flasche stehen gelassen, und wir waren so frei und haben sie mitgenommen? Komm schon, Bex, das wäre nicht das erste Mal.«
Jamie sprach leise und Bex verdrehte die Augen.
»Verdammt, du bist für so einen jungen Kerl einfach viel zu scharf!« Sie stieß ein Lachen aus und füllte zwei Shotgläser mit der hellen Flüssigkeit. »Aber glaubt ja nicht, dass ihr die ganze Flasche bekommt. Maximal zwei Drinks, kapiert?«
»Du bist die Beste«, jubelte Jamie. Bex erwiderte nichts und ging nach hinten in die Küche.
Ich hob eine Braue. »Was bitte war denn das? Seit wann flirtest du mit ihr?«
Er zuckte mit den Schultern. »Ach, das ist doch harmlos.«
»Sie ist süß.«
»Ist sie.« Er grinste. »Und nur fünf Jahre älter. Eine Kleinigkeit!«
Ich stieg in sein Lachen ein. Das hier tat gut. Bei ihm zu sein, mit ihm zu scherzen. Ich brauchte das hier nicht nur, ich wollte es auch. Einen Burger essen, Zeit mit meinem besten Freund verbringen. Auf andere Gedanken kommen.
Ich schnappte mir über den Tresen hinweg ein hohes Glas und eine Cola.
Während wir auf unser Essen warteten, lauschte ich Jamies Geplauder und ließ den Blick durchs Lokal schweifen. Brian und Sophie saßen in einer Fensternische. Sie waren in ein Gespräch vertieft, leere Teller standen vor ihnen und unangerührte Getränke. Es lief offensichtlich gut.
Wenig später kam Bex mit zwei gut gefüllten Tellern zu uns. Mir lief das Wasser im Mund zusammen, als ich den fetttriefenden Speck sah, der auf dem Burger lag. Immerhin war mein Hunger zurück, in den ersten Tagen nach Aarons Tod hatte ich kaum einen Bissen runterbekommen.
»Danke, Bex.«
Sie zwinkerte mir zu, ehe sie sich den anderen Gästen widmete. Jamie und ich aßen schweigend, mein Magen knurrte vorwurfsvoll, das hier war praktisch mein Frühstück. Nicht nur Aarons Verlust, auch der ständige Vergleich mit ihm schlug mir auf den Magen.
»Gehst du eigentlich zu Trevors Party?«, fragte Jamie zwischen zwei Bissen.
»Sieht wohl so aus.« Ob ich tatsächlich gehen würde, wusste ich noch nicht. »Wenn ich hingehe, muss ich nicht zu Hause sein, und außerdem will ich Sophie bei ihrem Outfit helfen. Brian geht mit ihr hin.«
»Wenn du willst, begleite ich dich.« Jamie blickte mich mit so viel Wärme und Gutherzigkeit an. Wir kannten uns seit der Unterstufe und waren ebenso lange unzertrennlich. Er war immer für mich da, auch dann, wenn es mit meinen Eltern kompliziert wurde. Schließlich war ich schon immer das schwarze Schaf der Familie gewesen.
Als Aaron mit sechzehn zur Akademie gegangen war, hatte ich gedacht, aus dem Schneider zu sein. Ich hatte gehofft, dass es meinen Eltern reichte, wenn eines ihrer Kinder ein Jäger wurde.
Doch da hatte ich mich verrechnet – pünktlich zu meinem sechzehnten Geburtstag hatte Vater mich zum ersten Training in der Akademie mitgenommen. Aaron und ich hatten nur eine Woche später einen Pakt geschlossen: Ich würde die Ausbildung durchziehen, mit Aarons Hilfe. Er versprach mir, mich zu unterstützen und zu beschützen, und ich ihm im Gegenzug, es zumindest auszuprobieren, das Jägerdasein, als könnte man es wie eine modische Jacke an- und wieder ausziehen, sollte es doch nicht passen. Wir hatten uns für die Zeit nach dem Abschluss sogar jeweils einen Brief geschrieben und diese zusammen in einer Dose hinterm Haus zwischen den Hortensien meiner Mutter vergraben. Würde sie jemals herausfinden, dass wir in ihrem Blumenbeet gebuddelt hatten, wären wir … wäre ich einen Kopf kürzer.
Jetzt war ich allerdings das einzige verbliebene Kind und sollte auch nach der Ausbildung in Aarons Fußstapfen treten, ganz gleich, ob ich wollte oder nicht. Und scheiße, sein Tod hatte meine Abneigung gegenüber der Akademie nur verstärkt.
Zwar war ich nicht sicher, was ich nach der Highschool machen wollte, doch alles war besser als die Pläne, die Vater für mich hegte. Wenn ich erst achtzehn war, würde ich endlich eigene Entscheidungen treffen können. Dann konnte er mich nicht mehr zwingen, nicht mehr über mich verfügen, wie er es nun tat. Sein Plan sah vor, dass ich nach der Schule meinen Teil zum Kampf gegen die Werwölfe beitrug, dass ich meine Pflicht und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft erfüllte. Dabei war es egal, ob an der Front oder als Ausbilderin an einer der anderen Akademien. Doch diese Macht würde und konnte ich ihm nicht gewähren. Nicht mehr.
Ich hatte einen anderen Plan: das letzte Schuljahr beenden und dann weg. Es gab genug Jäger, die Akademie hatte Absolventen und Bewerber satt, niemanden außer meinen Vater interessierte es, ob ausgerechnet ich als Jägerin fungierte oder nicht.
»Erde an Maya!« Jamie tippte mir gegen die Schulter. Er grinste und schob mir einen weiteren Shot zu. »An was auch immer du gedacht hast: ertränke es!«
Meine Eltern würden mich umbringen, wenn sie erfuhren, dass ich Alkohol trank. Trotzdem nahm ich das Glas und stürzte die brennende Flüssigkeit in einem Zug hinunter.
* * *
Es war spät, als ich mir ein Taxi rief. Der Tequila vernebelte mir die Sinne, und ich entschied, draußen zu warten, um frische Luft zu tanken. Jamie wollte noch bei Bex bleiben – so viel zum »harmlos«. Während ich auf das Taxi wartete, holte ich meine Sporttasche aus dem Wagen. Das Poloshirt hätte ich gestern schon waschen müssen, es allerdings vergessen.
Etwas schepperte, ich erstarrte und der Dusel war mit einem Schlag fort. Der Parkplatz hatte sich bereits geleert, nur vereinzelte Fahrzeuge standen noch da. Sogar die angrenzende Straße war unbefahren. Die umliegenden Häuser lagen ruhig vor mir, hier und da brannte in einem der Fenster fahles Licht.
»Hallo?«, rief ich in die Stille hinein. »Ist da jemand?«
Anstatt einer Antwort blitzte ein Paar gelber Augen in der Dunkelheit auf. Die Blätter der Rhododendronbüsche raschelten, als nur wenige Schritte entfernt ein tiefschwarzer Wolf auf den Parkplatz trat. Er setzte eine wuchtige Vorderpfote auf den Asphalt. Ich stolperte zurück. Der Wolf, nein, der Werwolf blieb stehen. Es musste einer sein, die zu langen Vorderläufe, der leichte Buckel in seinem Rücken … die Größe, die Augen – all das waren Zeichen, dass es sich um einen Werwolf handelte!
In der Theorie hatte ich mich bis zur Erschöpfung mit der gänzlich verwandelten Gestalt eines Werwolfs befasst, in Wahrheit hatte ich jedoch noch nie einen zu Gesicht bekommen. Ich war absolut nicht darauf vorbereitet, was es mit mir machte. Eiskalte Panik schoss durch meinen Körper und lähmte mich. Bilder meines Bruders flammten vor meinem inneren Auge auf. Wie das Wolfsfieber ihn nach dem Biss zerfressen hatte und er den Kampf schließlich verlor …
Ob Aaron dieselbe Angst verspürt hatte wie ich gerade? Oder hatte er selbstbewusst bis zum letzten Atemzug gekämpft?
Würden meine Eltern nun ihr zweites Kind verlieren?
Würden sie dann endlich trauern?
Oder weitermachen wie bisher?
Gelächter drang zu mir, als zwei Männer aus der Bar kamen. Der Wolf richtete sich auf, stieß ein Schnauben aus und sprang auf mich zu. Ich stolperte zurück und fiel. Ich landete auf der Hüfte und hob instinktiv die Arme zum Schutz. Als ob mir das helfen würde! Doch der Schmerz des Angriffs blieb aus.
Mit wild klopfendem Herzen ließ ich die Arme sinken. Der Werwolf war fort. Was zur Hölle war das gewesen? Werwölfe töteten wahllos – das wurde uns in der Akademie eingetrichtert. Sie verschonten niemanden, hatten sich niemals unter Kontrolle, erst recht nicht verwandelt. Selbst halb verwandelt waren sie blutrünstig und kaum zu stoppen.
Wieso also lebte ich noch?
Das Gelächter der Männer riss mich aus der Schockstarre. »Hey!«, rief ich und zwang mich vom kalten Asphalt hoch. Schon von Weitem roch ich ihre Alkoholfahne … und erkannte in einem der beiden ausgerechnet Dax, den Erzfeind meines Bruders. Dennoch, im Restaurant waren Menschen. Bex, Jamie, Sophie. Meine Freunde. Und Dax war ein Jäger, ob betrunken oder nicht, er würde handeln.
»Hier war ein Werwolf«, stieß ich aus. »Er war verwandelt, wir müssen die Akademie informieren!«
»Ein verwandelter Werwolf? So ein richtig großer, ja?« Dax lachte abfällig, als würde er mit einem kleinen Mädchen sprechen, das gerade die Zahnfee gesehen hatte.
»Wenn ich es doch sage«, beharrte ich.
»O Mann, Cavanaugh, du tust echt alles für Aufmerksamkeit, was?« Dax packte mich am Oberarm und drehte mich herum. Er deutete in den Himmel, und ich folgte seinem Fingerzeig. In der schwarzen Nacht brach der Mond durch die Wolkendecke. Doch es war kein Vollmond, sondern bloß eine schmale Sichel. »Wir haben nich’ mal Vollmond. Du kannst keinem verwandelten Wolf begegnet sein. Wohl nicht aufgepasst im Unterricht, was?«
Ich schluckte schwer, rang den Kloß in meinem Hals nieder. Dax hatte recht. Werwölfe konnten sich nur mithilfe des Vollmonds in ihre Wolfsgestalt verwandeln. Außer es war ein geborener Wolf … aber die waren ausgerottet. Mein Vater selbst hatte eines der letzten Rudel hier in Colorado vernichtet.
Aber … Was hatte ich dann gesehen?
»Es war sicher nur ’n Hund, Kleines«, lallte der Jäger neben Dax. »Wärst du wirklich ’nem Werwolf begegnet, wärst du jetzt tot. Was machst du überhaupt hier? Siehst nicht aus, als dürftest du trinken. Sollen wir Daddy anrufen und sagen, wo du dich rumtreibst?«
Just in diesem Moment erhellten Scheinwerfer den Parkplatz und das Taxi hielt nicht weit von uns entfernt. Meine Gedanken fuhren Achterbahn. Was sollte ich jetzt tun? Sollte ich hierbleiben, allein nach dem Werwolf suchen – falls es einer gewesen war? Es war doch einer, oder? Ich konnte zur Akademie fahren. Oder die Polizei rufen. Oder Vater.
»Ich weiß, was ich gesehen habe …«
»Du solltest heimfahren, Kleine. Ist doch dein Taxi, oder? Falls da wirklich ein Wolf war, ist er längst weg.«
Dax stieß dem anderen gegen die Schulter. Er lallte überdeutlich. »Wir werden uns um das Problem kümmern. Joshua hier is’ mein Kumpel, wir werden uns umsehen. Du kanns’ beruhigt nach Hause fahren.« Um seine Worte zu unterstreichen, wankte er zum Taxi und zog die hintere Tür auf. Er musste wirklich betrunken sein, sonst würde Dax sich nicht so benehmen.
Verunsichert trat ich zum Wagen. »Versprecht ihr, dass ihr die Leute bei Bex warnt?«
»Klaar«, zog er das Wort in die Länge und salutierte.
Ich stieg ins Taxi. Das erste Mal seit geraumer Zeit verspürte ich den Drang, meinen Vater um Hilfe zu bitten. Auf ihn würden die Jäger hören. Ich nickte, wie um mir selbst zu bestätigen, dass der Plan gut war, ehe ich dem Taxifahrer die Adresse nannte. Während der Fahrt schrieb ich Jamie, dass er aufpassen und heimfahren sollte. Sophie schickte ich ebenfalls eine Nachricht, von ihr kam prompt die Antwort, dass sie gerade überglücklich in ihr Bett gefallen sei. Eine Sorge weniger.
Mein Herzschlag blieb die Fahrt über konstant und schnell, auch dann noch, als der Wagen vor unserer Haustür hielt. Ich schmiss dem Fahrer das Geld entgegen und rannte die Auffahrt hinauf. Das Tor stand offen und in der Villa brannte Licht. Mein Vater erwartete mich bereits. In seiner Hand hielt er einen Stapel Papiere, den er zu einer Rolle gewickelt hatte. Wenn er um Beherrschung rang – vor allem dann, wenn sein Zorn ihn überkam –, tat er stets etwas mit den Händen. Hier war es nun das Papier, das er quälend fest mit den Fingern umschloss. Die Adern und Sehnen an seinen Armen traten deutlich hervor, als er eine Faust ballte.
Scheiße.
»Ihr glaubt gar nicht, was gerade passiert ist –«
»Du bist zu spät«, unterbrach er mich. Ich verstummte, als er sich vom Tisch abstieß und zu mir herüberkam. Seine Kiefer mahlten. Die Faust öffnete sich. Er drehte das Papier. Schloss die Finger um die Rolle, zerdrückte sie. Direkt vor mir baute er sich auf und rümpfte die Nase.
»Hast du getrunken?«
»Nein, du musst …«
»Du hast keinerlei Disziplin!« Seine Stimme polterte wie ein Donnergrollen durch den Raum, und ich zuckte vor der Heftigkeit zusammen. »Was haben wir bei dir nur falsch gemacht? Aaron hätte sich nie erlaubt, Alkohol zu trinken. Vor allem nicht mit siebzehn Jahren!«
Ich presste die Lippen zusammen. Natürlich. Es ging wieder einmal darum, was Aaron getan hätte und was nicht. Ich war es so leid.
»Ich bin einem Werwolf begegnet«, sagte ich mit erzwungener Ruhe. »Einem Werwolf, Vater, direkt vor Bex BBQ!«
»Du warst im Bex BBQ?«
»Ja, ich …«
»So viel dazu, dass du nicht getrunken hast!«
»Aber auf dem Parkplatz war wirklich …«
»Ich rieche den Alkohol bis hierher! Sei wenigstens ehrlich, Maya. Wenigstens das.«
»Aber …«
»Es reicht jetzt.«
»Aber …«
»Ich sagte, es reicht! Auf dein Zimmer, und zwar sofort!«
Das vierte »aber« blieb mir im Hals stecken, weil auch ich meinen Stolz hatte. Und weil der Kloß in meiner Kehle dank der aufkommenden Tränen ohnehin so groß war, dass ich keinen weiteren Widerstand hervorbrachte.
»Okay, wenn das so ist. Gute Nacht, Vater.« Ich zischte das letzte Wort so voller Zorn und Verachtung, dass ich von mir selbst entsetzt war. Diese Familie holte tatsächlich das Schlechteste aus mir heraus.
Nachdem ich die Tür meines Zimmers geschlossen hatte, lehnte ich mich dagegen. Hielt mein Vater wirklich so wenig von mir, dass er es nicht einmal für nötig hielt, mich ausreden zu lassen? Dass ich Alkohol getrunken hatte, war ein Schnitt ins eigene Fleisch gewesen, doch er hätte mir wenigstens zuhören müssen! Ich war seine Tochter!
Entschlossen zog ich mein Handy hervor und fragte Jamie, ob ich vorbeikommen könnte. Er antwortete sofort.
J: Bin gerade heimgekommen und hab Zeit. Komm her!
Ich biss mir auf die Unterlippe und tippte die Antwort.
M: Muss schauen, wie ich ungesehen rauskomme.
J: Soll ich dich abholen?
M: Nein, du hast getrunken, alles gut.
Eilig packte ich das Nötigste zusammen und schulterte meine Schultasche. Wie lange ich bei Jamie bleiben konnte, wusste ich nicht. Eine Nacht musste vorerst reichen. Hauptsache, ich kam hier raus.
Ich öffnete die Tür einen Spaltbreit und horchte in den Flur hinein. Das Licht im Erdgeschoss wurde gelöscht und ich hörte die Schritte meines Vaters nahen. Sacht schloss ich die Tür und wartete, bis seine Schritte verklangen, dann schlüpfte ich hinaus und auf Zehenspitzen hinunter. Ich zog meine Jacke über, bewaffnete mich mit einem Pfefferspray aus der obersten Kommodenschublade und verließ das Haus.
Erst als ich auf dem leeren Parkplatz stand, fiel mir ein, dass mein Auto ja noch vor der Bar stand. Mist. Wobei es vermutlich besser war, dass es nicht hier war, denn durch das Gefühlschaos in meinem Inneren wüsste ich nicht, ob ich mich nicht trotz des Alkohols ans Steuer gesetzt hätte. Und das war ein absolutes Tabu.
Kurz überlegte ich, ein Taxi zu rufen, verwarf den Gedanken jedoch. Es könnte meinen Eltern auffallen und würde zudem zu lange dauern. Also musste ich laufen.
Ich drückte mich an der Hauswand entlang, als die Überwachungskamera von der Tür zur Auffahrt schwenkte, und hinüber in den Schutz der Hortensien meiner Mutter. Geduckt schlich ich bis zur Ostseite des Zauns, der unser Grundstück umschloss. Ich warf meine Taschen hinüber, kletterte auf die Gartenbox, in der die Polsterauflagen steckten, und schwang mich selbst auf die andere Seite.
Ich überquerte die leere Straße und blickte mich mehrfach um, das Pfefferspray hatte ich fest in der Hand. Gedanklich rief ich mir in Erinnerung, was wir in der Akademie lernten: Keine Angst vor der Dunkelheit haben, Jäger wissen sich zu verteidigen, immer. Mit oder ohne Waffe.
Ich musste ich es nur oft genug wiederholen, um es selbst zu glauben. Denn in Wahrheit scheute ich den Kampf, mehr noch: Ich hatte eine Scheißangst davor, angegriffen zu werden, denn ich wusste nicht, ob mich der Verlust von Aaron erneut gefangen nehmen würde und meine Jägerinstinkte sich deswegen nicht so schnell und routiniert einschalteten, wie sie es sollten. Falls ich überhaupt Jägerinstinkte besaß. Immerhin war ich heute das erste Mal einem Werwolf begegnet, und es hatte sich angefühlt, als wäre eine Sperre in mir aufgeklappt, die mich lähmte. Wie sollte ich so gegen einen Wolf kämpfen?
Ich atmete erleichtert auf, als Jamies Haus in Sichtweite kam. Unter seinem Fenster befand sich ein Rankgitter, an dem ich hochkletterte. Er hatte mich bereits gehört, öffnete das Fenster und nahm mir die Taschen ab.
»Was ist passiert?«, fragte er.
»Auf dem Parkplatz bin ich einem Werwolf begegnet«, platzte es aus mir heraus.
Jamie riss die Augen auf. »Was? Geht es dir gut?«
Ich nickte, konnte ihn aber kaum ansehen. »Bis auf eine Schürfwunde bin ich glimpflich davongekommen. Er hat mich nicht angegriffen.« Ein Teil von mir wollte ihm erzählen, dass es sich um einen verwandelten Werwolf gehandelt hatte. Doch der andere, größere Teil fürchtete, dass er mir keinen Glauben schenken würde. Jamie war mein bester Freund, doch die Zweifel, die Vaters Ablehnung und der Spott von Dax gesät hatten, saßen zu tief. Ich wollte nicht auch noch von ihm hören, dass es unmöglich sei, ich mich geirrt haben müsse oder Schlimmeres. Also beließ ich es dabei. »Mein Vater hat mich als Lügnerin abgestempelt. Ich werde noch wahnsinnig, wenn ich dortbleibe.«
»Verdammt.« Jamie zog mich in eine Umarmung. Ich schlang die Arme um seine Mitte und verbarg das Gesicht an seiner Brust. Es tat gut, nicht auf Ablehnung zu treffen.
»Du kannst so lange bleiben, wie du möchtest, okay?« Jamie nahm mein Gesicht in die Hände und strich sanft mit den Daumen über meine Wangen, um die Tränen fortzuwischen. Sein Angebot war alles, was ich brauchte. Am liebsten wäre ich nie wieder nach Hause zurückgekehrt. Doch natürlich konnte ich meinen Eltern nicht ewig entkommen. Früher oder später musste ich mich ihnen stellen, auch wenn ich Bauchschmerzen bekam, wenn ich nur an den kläglichen Versuch dachte, mit ihnen zu reden. Ob sie sich überhaupt sorgen würden, wenn sie bemerkten, dass ich nicht zu Hause war? Wohl kaum. Trotzdem konnte ich Jamies Angebot nicht annehmen, denn meine Eltern waren nichts, was sich irgendwann von selbst erledigen würde – sie waren meine Familie, ob ich es wollte oder nicht.
Also schüttelte ich den Kopf, schob Jamies Hände von meinen Wangen. »Ich weiß, danke. Aber ich werde morgen nach der Schule zurückfahren.«
Jamie stieß die Luft hörbar aus. »Wenn du willst, komme ich mit dir.«
»Nein. Da muss ich allein durch. Aber danke. Du bist immer für mich da, ich weiß das wirklich zu schätzen.«
»Dafür gibt es doch Freunde, Maya.« Er schenkte mir ein Lächeln.
»Danke«, flüsterte ich, nahm meine Tasche und floh ins angrenzende Bad, ehe ich sein Angebot doch noch annahm. Ein Blick in den Spiegel zeigte mir, dass meine Mascara dunkle Spuren auf den Wangen hinterlassen hatte. Ich zog ein Abschminktuch hervor und beseitigte das Panda-Make-up. Mein Spiegelbild sah ziemlich fertig aus. Meine Augen waren gerötet und geschwollen von den Tränen, meine Handballen blutverkrustet. Vielleicht sollte ich Vater die Schürfwunden zeigen. Ihm beweisen, dass ich die Wahrheit gesagt hatte.
Doch würde er mir glauben?
Ich verließ das Bad und kroch zu Jamie ins Bett.
»Glaubst du, dass sie irgendwann aufhören, mich mit Aaron zu vergleichen?«, fragte ich nach einer ganzen Weile in die Stille hinein.
»Ich weiß es nicht«, murmelte Jamie schlaftrunken. »Aber ich wünsche es dir.« Er tätschelte meine Hand und drehte mir den Rücken zu, doch allein seine Anwesenheit beruhigte meine Nerven ungemein.
Für diesen kurzen, bittersüßen Moment erlaubte ich mir, meine Sorgen zu vergessen und Jamies Nähe einfach zu genießen. Er gab mir die Sicherheit und die Gewissheit, gemocht zu werden. Und das war alles, was ich gerade brauchte.
Maya
Er hat mich nach Hause gebracht und auf die Wange geküsst. Ich weiß, das ist kaum erwähnenswert, aber ich dachte, mir würde das Herz aus der Brust springen!«
Sophie hatte mich auf dem Parkplatz abgefangen und erzählte von ihrem Date mit Brian. Ich hörte nur mit halbem Ohr zu. Die Nacht bei Jamie war erholsamer gewesen als die gesamten letzten zwei Wochen. Ich hatte wie ein Stein geschlafen. Dennoch war mein Gedankenkarussell direkt nach dem Aufwachen angesprungen und drehte sich seither um meine Eltern. Dabei hatten sie vermutlich nicht mal mitbekommen, dass ich gestern Abend geflohen war. Morgens sahen wir einander sowieso nicht.
»Und dann hatten wir in seinem Auto heißen Sex.«
Ich blinzelte ein paarmal. »Sex?«
Sie lachte. »O Mann, hörst du mir eigentlich zu?«
Ich strich mir eine Strähne hinters Ohr, die meinen Zopf verlassen hatte. »Entschuldige. Ich hatte gestern Streit mit meinem Vater und hab heimlich bei Jamie übernachtet.«
Sophie zog die Brauen besorgt zusammen und legte mir eine Hand auf den Arm. »Verdammt, so schlimm? Das tut mir leid … und ich erzähle bloß von Brian.« Sie schüttelte über sich selbst den Kopf.
»Nein, mir tut es leid. Ich bin eine schlechte Freundin, weil ich dir nicht zuhöre. Es freut mich, dass ihr euch nähergekommen seid.«