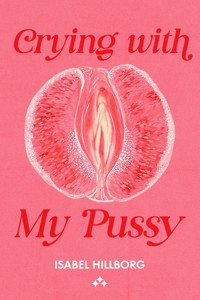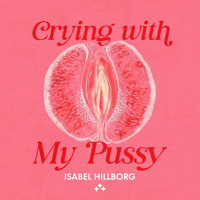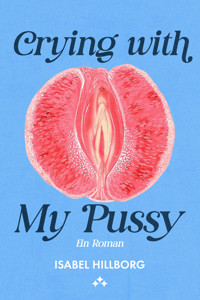
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aniara
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Crying with My Pussy, der aufrüttelnde Debütroman der schwedischen Autorin Isabel Hillborg, ist eine kompromisslose Erkundung von Trauma, Begehren und Widerstandskraft. Brutal ehrlich, gewaltig komisch und hinreißend subversiv durchschneidet Hillborgs Stimme kulturelle Tabus mit einem emotionalen Skalpell. Protagonistin Jennie navigiert durch die Nachwirkungen eines Kindheitstraumas mittels intensiver Beziehungen. Während sie durch Komplexität, psychische Erkrankungen und erotische Zwänge taumelt, wird ihre Reise zu einer kraftvollen Meditation darüber, wie wir von unseren tiefsten Wunden heilen. Hillborg chronikiert meisterhaft die Suche einer Frau, ihre Identität zurückzuerobern. Mit Anklängen an Virginie Despentes und Chris Kraus ist dieser Roman literarisch und politisch zugleich – für alle, die sich jemals zerbrochen fühlten und versuchten, sich wieder zusammenzusetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Crying with my pussy
Isabel Hillborg
Crying With My Pussy
Isabel Hillborg
Isabel Hillborg © 2025
Aniara Press AB, Stockholm 2025
Cover: Anze Ban Virant
Übersetzung: Aniara
www.aniara.one
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags oder der Autorin reproduziert werden, außer im Rahmen des EU-Urheberrechts.
Inhalt
Vorwort
1. Martin
2. Christian
3. Charlie
4. Peter
5. Jensen
6. Joe
7. Ollie
8. Tom
9. Sam
10. Alex
Vorwort
Die Weinende Frau
Custardcakes, leckere Schokolade, glasierte Cupcakes, Käsesandwichs mit zu viel Butter, eine Vintage Birkin Tasche, Louboutins mit roten Sohlen, Hochglanz-Interior-Magazine … all diese Dinge, mit denen man sich angeblich tröstet und verwöhnt, wenn es nötig ist.
Aber für uns, die wir uns nicht stumpf in den Glücksmythos der Konsumgesellschaft eingekauft haben, taugt keines dieser heißbegehrten Attribute.
Nein, gegen Liebeskummer, Lebensangst oder die gute alte Alltagsödnis, oder PMS übrigens auch, hilft nur eines — Sex.
Nichts lässt mich so lebendig fühlen, so präsent, so frei und so neugierig auf das, was das Leben zu bieten hat, wie wenn ich einen wirklich guten Fick hinkriege. Als würde mit jedem Stoß, jedem Stöhnen, jedem Orgasmus — egal ob vorgetäuscht oder nicht — jeder Zweifel am Sinn des Lebens einfach verschwinden. Dieses lähmende Gefühl der Sinnleere ist fort. Ich bin glücklich. Ich bin schön. Ich bin begehrt. Ich bin jemand.
Descartes — »Ich denke, also bin ich.«
Ich ficke, also bin ich.
Ich wünschte wirklich, es gäbe etwas anderes, das mir diesen Adrenalinkick geben könnte wie das Ficken — ich habe alle möglichen Drogen probiert, Alkohol und was man Abenteuer nennt, aber nichts verschafft mir dieses intensive Gefühl der Euphorie wie der Moment, wenn ein Schwanz in mich eindringt.
Deshalb ficke ich weiter und lasse mich ficken.
Deshalb weine ich weiter, mit meiner Muschi.
Martin
Eine große, wuchtige Leere hat sich in meiner Brust eingenistet. Das Wort suggeriert, sie sei leer, bar jeden Inhalts, aber wie irreführend diese Beschreibung doch ist. Die Leere ist überhaupt nicht leer, im Gegenteil, sie ist vollgestopft mit Dingen, die drücken und stoßen und mit allen Mitteln gehört werden wollen. Manchmal wünschte ich, ich könnte bestimmte Dinge nicht denken, es gäbe in meinem Gehirn eine Sperre, zu der nicht einmal ich Zugang hätte. So müsste es sein. Diese Räume, in denen der Schrecken und das Grübeln haust, sollten verschlossen bleiben. Dieses Wissen macht alles noch schlimmer, die Erkenntnis, dass ich die Einzige bin, die diesen Gedanken denkt, und ich will ihn gar nicht denken können, will diesem Gefühl entkommen, das seine Finger immer im Spiel hat. Ich will nicht zwanghaft ein Blatt in tausend Stücke zerreißen und dabei vor mich hinflüstern »jetzt habe ich das Blatt einmal, zweimal ..., siebenmal ... zerrissen«, oder mich zu Box Breathing in der U-Bahn zwingen müssen, damit meine verdammten Gedanken mich nicht zum hunderttausendsten Mal vor ahnungslosen Zuschauern überfallen.
Ich erinnere mich, wie sie mich zum ersten Mal heimsuchten, sie schlichen sich an wie Rauch über einem Feuer, und als ich sie bemerkte, war es bereits zu spät – ich war unwiederbringlich rauchgeschädigt.
Der Sommer hatte gerade erst begonnen, und ich sollte das Wochenende bei meinen Großeltern verbringen, wie schon so oft zuvor. Großmutter und Großvater – eine Einheit, die irgendwie selbstverständlich war, immer zusammen genannt, nie getrennt, nicht einmal als Großvater starb, als ich zehn war, was eigentlich seltsam war, denn Großvater war ja ohnehin nie wirklich da. Ich kann mich eigentlich nur an drei Mal erinnern, als Großvater tatsächlich da war; andere Erinnerungen erfinde ich, übertreibe sie gern und romantisiere sie, weil es sich so gemütlich anhört zu sagen, man sei »bei Großmutter und Großvater« gewesen. Das gehört sich ja auch so als Kind, das ist Teil einer glücklichen Kindheit: Großmutter und Großvater, frisch gebackene Kekse und flauschige Decken über klebrigen kleinen Kinderfüßen. »Glückliche Kindheit« übrigens – lass dir diese Phrase mal auf der Zunge zergehen, schmeckt sie nicht bitter? Klingt das nicht eher nach Strafe als nach Belohnung? Wer kann bei klarem Verstand ehrlich behaupten, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben? Regt es dich nicht auch unglaublich auf, wenn Leute das sagen und es auch noch ernst meinen? Oder sind es nur Menschen wie ich, bei denen angesichts solch utopischer Behauptungen sofort die Warnleuchten angehen: »Verdrängung« ...? Nachträgliche Konstruktion, Verdrängung oder einfach nur Naivität oder niedrige Ansprüche – irgendetwas stimmt definitiv nicht, wenn jemand behauptet, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Trotzdem ist es etwas, wonach wir streben und es beneidenswert finden.
Als ich etwa fünf Jahre alt war, saß Großvater an dem runden Küchentisch in der kleinen Küche, seine abgetragenen braunen Lederpantoffeln scharrten über den zerschlissenen Teppich, während er mit zitternden Händen geräuschvoll seinen hellbraunen Kaffee schlürfte.
»Jennie, komm, setz dich zu Großvater, ich mache dir ein Sandwich.«
Ich überlegte nicht lange, ging einfach zu ihm und ließ mich auf seinen anzugbedeckten Schoß sinken – er arbeitete als Manager in einem Technologieunternehmen, Anzughosen gehörten zu seiner täglichen Kleidung. Er bestrich eine Brotscheibe für mich mit Butter, eine dicke Schicht Butter, genau wie ich es mochte, und teilte sie in zwei Hälften – nicht quer, wie üblich, sondern der Länge nach, damit ich sie leicht in die Kaffeetasse tunken konnte, denn ich liebte es, meine Sandwichs in Kaffee zu tauchen. Großvater lachte, er fand es amüsant und ein bisschen merkwürdig, dass ich mit gerade mal fünf Jahren einen so erwachsenen Geschmack wie Kaffee schätzen konnte. Ein leichtes Stechen in meiner Nase, nicht vom Kaffeeduft, sondern vom scharfen, leicht abgestandenen Biergeruch. Großvater roch nach abgestandenem Bier, es schien aus seinem ganzen Körper zu verdampfen, wie aus Vulkankratern, seine Poren spuckten abgestandenes Bier aus und mir wurde ein bisschen übel. Aber ich blieb trotzdem sitzen, das war schließlich Großvaters Geruch, so roch er nun mal, sonst wäre er nicht mein Großvater. Die andere Erinnerung an Großvater stammt von einem weiteren Übernachtungsbesuch bei ihnen. Großmutter hatte die Matratze für mich hergerichtet, in der Ecke zwischen Sofa und Fernseher, sorgfältig bezogen mit den üblichen Laken, die ich immer hatte – die rosafarbenen mit den kleinen weißen Blumen und dem Spitzenrand – meine Lieblingsbettwäsche. Ich saß auf den Knien auf meiner Matratze und wartete darauf, dass Großmutter in der Küche fertig wurde, damit wir anfangen konnten, Annie zu schauen, wie wir es immer taten, wenn ich da war. Annie war Großmutters und mein Lieblingsfilm, wir konnten ihn uns nicht oft genug ansehen. Wenn die Musikszenen begannen, drehte Großmutter die Lautstärke auf, und ich sang mit dieser ungeniert lauten Kinderstimme mit, die kleine Mädchen haben, bevor sie anfangen, sich zu fragen, ob sie genug Gesangstalent besitzen, um so mutig und laut zu singen. Dann zeigte mir Großmutter, wie man die Tanzschritte von Annie und ihren Waisenhausfreundinnen nachmacht – Großmutter wusste das, sie konnte gut tanzen und arbeitete als Kindertanzlehrerin in Teilzeit. Mit kindlicher Vorfreude fieberte ich unserer Filmzeit entgegen und summte das Lied über das Morgen vor mich hin, während Großvater im abgewetzten beige-braunen Stoffsessel in der Ecke gegenüber meinem Bett döste. Ab und zu schnarchte er.
»Großvater, Großvater«, flüsterte ich versuchsweise, um zu sehen, ob er mich hören konnte. Keine Antwort, nur ein plötzliches Schnarchen.
Ich kümmerte mich wieder um meine Angelegenheiten und summte leise vor mich hin, während ich kleine Purzelbäume auf der weichen Matratze schlug.
»Willst du einen von diesen süßen kleinen Gummibärchen, bevor ich sie alle aufesse?« Großvater war aufgewacht.
Er hielt mir die dunkelgrüne Keramikschale hin, in der er immer seine Süßigkeiten aufbewahrte. Ich schüttelte den Kopf, immer noch mitten in meinen Purzelbäumen. Ich wollte mir den Appetit für die Kartoffelchips und den Dip aufheben, von denen ich wusste, dass Großmutter sie in der Küche anrichtete. Das dritte Mal, als die Gedanken in mich eindrangen, sich einnisteten und häuslich niederließen, war an einem Tag, als der Herbst jeden Moment drohte, die Sommerstimmung kippen zu lassen. Ich tue mich noch immer schwer mit dem Herbst, dieser Zeit, wenn die Helligkeit vertrieben wird, als würde ein riesiger Tyrann sie in die Flucht jagen, der das Sommerlachen ersticken, die Unbeschwertheit auf eine ernsthafte Ebene zwingen und die kindlich-naiven Spiele mit düsterer Feierlichkeit durchtränken will. Es fühlt sich an, als würde der Sommer, die Helligkeit, für immer verschwinden. Die Hoffnung stirbt. Es war so ein Tag. Ich lag auf dem Bett in Großmutters und Großvaters Schlafzimmer, die Tür stand einen Spalt offen und ich hörte Großmutters helle, leicht zittrige Stimme aus der Küche und Großvaters summende Antwort. Ich dachte an nichts Besonderes und spürte auch nichts Bestimmtes in meinem Körper. Plötzlich, ohne Vorwarnung, war es, als würde ein dunkler Schatten durch den Raum huschen. Doch anstatt schnell weiterzuziehen, verhakte er sich, blieb, nur um dann in meinen zehnjährigen Mädchenkörper einzusickern. Reglos lag ich da und fühlte, wie er von mir Besitz ergriff, mich Dinge spüren ließ, die kein Kind spüren sollte, Gedanken denken ließ, für die Kinder noch keine Worte kannten. Der Schatten machte mich binnen Sekunden schwerer, eine Schwermut, die noch viel Ärger bereiten würde. Doch selbst als ich Angst hatte und mich schrecklich fühlte, war da auch eine Neugier, eine Faszination, dass so etwas geschehen konnte – und so sank ich tiefer hinein, drang weiter vor in den pechschwarzen Raum, der sich in meiner flatternden Brust aufgetan hatte. Die Sinnlosigkeit und die Leere hätten sich vielleicht noch ein paar Jahre Zeit gelassen, sich vorzustellen. Das werde ich nie erfahren. Stattdessen lag ich da, verstrickt in einem Spinnennetz aus philosophischen Lebensgrübeleien, die unbeantwortet blieben und sich immer verworrener verknoteten, völlig unlösbar für ein zehnjähriges Kind. Ich machte Knoten in die Fäden, und mein Herz schlug härter und härter, die Fäden vermehrten sich, wanden sich um meinen dünnen Hals und erstickten mich. Alles drehte sich in meinem berstenden Kopf und ich schrie, reglos liegend schrie ich so laut ich konnte:
»Großmutter, hilf mir, Großmutter!« Tränen liefen mir über die Wangen und ich fand mich in einer Glasblase wieder, für alle Ewigkeit mit der Sinnlosigkeit und der Leere eingesperrt, Amen.
Die Tür flog auf und Großmutter stürzte herein und warf sich neben mich aufs Bett. Die Sorge und Angst in ihren Augen machten mir fast noch mehr Angst, aber als Großmutter ihre Arme um mich schlang, durchbrach sie die Glasblase, zumindest für kurze Zeit – jetzt könnte es für einen Moment ohne mich darin schweben, aber es würde immer einen Faden um meinen Hals behalten, und wenn ich mich zu weit entfernte oder zu fliehen versuchte, würde es sich bemerkbar machen: »Denk bloß nicht, du könntest mir entkommen, ich bin dein Zuhause, hierher gehörst du.«
Großvater schaute ins Zimmer, sagte, er hätte mir ein Bad eingelassen — ein warmes Bad sei genau das, was ich bräuchte — aber Großmutter winkte ab. Ich versuchte es Großmutter zu erklären, fand aber keine passenden Worte, wusste nur, dass die Gedanken, die sich zu formen versuchten, nicht hineinpassten, es waren zu viele, sie formten sich und türmten sich übereinander, ließen meinen Kopf fast platzen vor Unbehagen. Ich glaube, genau das sagte ich zu Großmutter, dass viele ungewollte Gedanken sich einfach immer weiter und weiter drehten, und sie verstummte völlig. Sie sah mich mit diesem Blick an, dem ich etwa zehn Jahre später bei so vielen Psychologen wieder begegnen würde. Mir wurde in diesem Moment klar, dass es keinen Sinn hatte zu offenbaren, was in meinem Kopf vorging; es würde mein Geheimnis bleiben.
Der Sommer zwischen der sechsten und siebten Klasse neigte sich dem Ende zu. Johanna, meine beste Freundin, und ich fuhren unsere übliche Fahrradroute zwischen meinem Haus in dem Stadtteil, wo niemand leben wollte, und Johannas Haus in dem Viertel, wo alle hinwollten, die nicht schon dort wohnten.
»Du hast nur noch etwas mehr als eine Woche, Jennie«, sagte Johanna und sah mich mit scheinbar echter Besorgnis an.
Ich fand es eigentlich ziemlich albern, sagte aber natürlich nichts und antwortete mit einem Gesichtsausdruck, der noch mehr Sorge vermittelte:
»Ich weiß, es muss passieren, bevor die siebte Klasse anfängt, sonst sterbe ich.«
Johanna schwieg einen Moment, begann dann aber gleich wieder, von ihrem Plan zu plappern – wie wir es schaffen würden, dass ich meine Jungfräulichkeit verlor, bevor die siebte Klasse begann. Eine lebenswichtige Mission.
Ich war eifersüchtig auf Johanna, sie hatte alles, was ich auch wollte: Sie lebte in einem schönen zweistöckigen Haus im superschicken Majåker, sie hatte eine Mutter und einen Vater, einen kleinen Bruder, eine kleine Schwester und einen großen Bruder. Ihren eigenen großen Bruder, über den sie die Augen rollte und den sie anschreien konnte: »Du bist so verfickt dumm, ich hasse dich.« Ich hatte schon immer einen großen Bruder gewollt. Ich stelle mir vor, dass es mir dann so viel besser gegangen wäre. Dass ein großer Bruder mich hätte beschützen können, nicht nur vor den ätzenden älteren Jungs, sondern auch vor der hinterhältigen, bösartigen Leere und der Sinnlosigkeit. Johanna tat so, als wünschte sie sich, keinen älteren Bruder zu haben, aber ich wusste, dass sie in Wahrheit froh darüber war, dass sie es liebte, wie überfürsorglich er wurde, wenn er herausfand, dass irgendein Junge für seine kleine Schwester schwärmte, dass er »Den bring ich verdammt noch mal um« sagte, wann immer Johanna petzte, dass jemand gemein zu ihr gewesen war, und dass er so gutaussehende Freunde hatte, von denen sie bemerkt hatte, wie sie ihr verstohlene Blicke zuwarfen, wenn sie die Treppe zu seinem Zimmer hochschlichen. Aber worauf ich wahrscheinlich am meisten eifersüchtig war: Johanna hatte einen Vater.