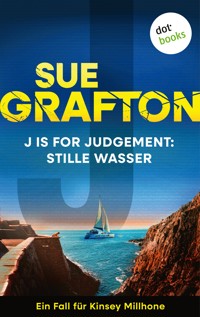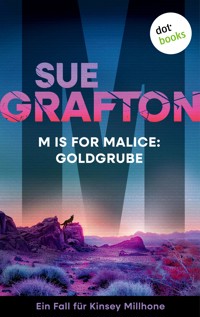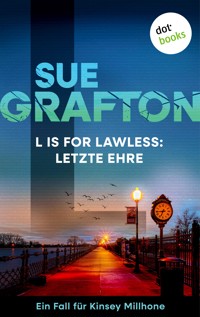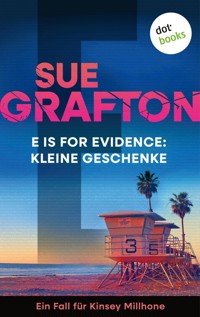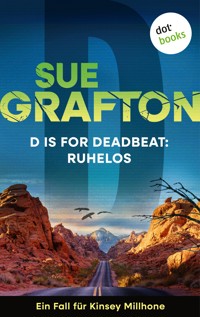
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kinsey Millhone
- Sprache: Deutsch
Der vierte Fall für die einfallsreichste Privatdetektivin Kaliforniens. "Mein Name ist Kinsey Millhone. Ich bin Privatdetektiv. Ich zahle meine Rechnungen pünktlich, befolge die meisten Gesetze und finde, dass andere Leute das ebenfalls tun sollten. Wenn es um Gerechtigkeit geht, bin ich pedantisch …" "Man verschenkt nicht mal eben 25.000 Dollar. Doch der Mann, der bei Kinsey Millhone, Privatdetektivin aus Kalifornien, am Tag vor Halloween auftaucht und sich als Alvin Limardo vorstellt, hat genau das im Sinn. Kinsey soll einen Jungen ausfindig machen, dem Limardo viel zu verdanken hat, und diesem das Geld überbringen. Hin- und hergerissen zwischen professionellem Interesse und Argwohn nimmt die Ermittlerin den ungewöhnlichen Auftrag schließlich an. Doch schon bald muss sie erkennen, dass nichts an diesem Fall so ist, wie es scheint: Der Scheck – geplatzt. Alvin Limardos guter Ruf – gefälscht. Ihr Auftraggeber – tot. Doch Kinsey Millhone wäre nicht die geschickteste Detektivin an der Westküste, wenn sie so schnell aufgeben würde … "Irrsinnig unterhaltsam und mit einem unvergleichlichen Sinn für Humor!" San Francisco Chronicle Der vierte Band einer der erfolgreichsten Krimiserien überhaupt, der unabhängig genossen werden kann – ein packender Ermittlerkrimi für Fans der Bestsellerserien von James Patterson und Val McDermid. Als Hörbuch bei Saga Egmont erhältlich sowie als eBook bei dotbooks.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Man verschenkt nicht mal eben 25.000 Dollar. Doch der Mann, der bei Kinsey Millhone, Privatdetektivin aus Kalifornien, am Tag vor Halloween auftaucht und sich als Alvin Limardo vorstellt, hat genau das im Sinn. Kinsey soll einen Jungen ausfindig machen, dem Limardo viel zu verdanken hat, und diesem das Geld überbringen. Hin- und hergerissen zwischen professionellem Interesse und Argwohn nimmt die Ermittlerin den ungewöhnlichen Auftrag schließlich an. Doch schon bald muss sie erkennen, dass nichts an diesem Fall so ist, wie es scheint: Der Scheck – geplatzt. Alvin Limardos guter Ruf – gefälscht. Ihr Auftraggeber – tot. Doch Kinsey Millhone wäre nicht die geschickteste Detektivin an der Westküste, wenn sie so schnell aufgeben würde …
eBook-Neuausgabe Oktober 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1987 unter dem Originaltitel »D is for Deadbeat« bei Henry Holt, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1988 unter dem Titel »D wie Drohung« bei Ullstein sowie 1999 in einer Neuausgabe unter dem Titel »Ruhelos« bei Goldmann.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1987 by Sue Grafton
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1988 by Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt am Main – Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/smutan, Zachary Wanger 925 und AdobeStock/Earth Pixel LLC.
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (fb)
ISBN 978-3-69076-781-1
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sue Grafton
D is for Deadbeat: Ruhelos
Kriminalroman – Ein Fall für Kinsey Millhone 4
Aus dem Amerikanischen von Dagmar Hartmann
dotbooks.
Für meine Schwester Ann und in Erinnerung an Maple Hill
Kapitel 1
Später fand ich heraus, daß sein Name John Daggett war, aber so stellte er sich nicht vor an dem Tag, als er in mein Büro kam. Schon damals spürte ich, daß etwas nicht stimmte, aber ich konnte mir nicht denken, was es war. Der Job, für den er mich anheuerte, schien einfach genug, aber dann versuchte der Gauner, mich um mein Geld zu bringen. Wenn man freiberuflich arbeitet, kann man es sich nicht leisten, solche Dinge schleifen zu lassen. Das Wort macht die Runde, und ehe man sich’s versieht, glauben alle, man ist leicht übers Ohr zu hauen. Ich spürte ihm nach, meines Geldes wegen, und das Nächste, was ich weiß, ist, daß ich in einen Strudel von Ereignissen hineingerissen wurde, von denen ich mich bis heute noch nicht ganz erholt habe.
Mein Name ist Kinsey Millhone. Ich bin Privatdetektiv, habe eine Lizenz vom Staat Kalifornien und ein kleines Büro in Santa Teresa, wo ich die ganzen zweiunddreißig Jahre meines Lebens verbracht habe. Ich bin weiblich, selbstversorgend, und jetzt Single, nachdem ich zweimal geschieden bin. Ich gebe zu, daß ich manchmal mürrisch bin, aber meistens bin ich umgänglich und freundlich, hege allerdings (vielleicht) einen übertriebenen Wunsch nach Unabhängigkeit. Außerdem plagt mich genau die Art von Verbissenheit, die die Arbeit als Privatdetektiv für jemanden mit Hochschulausbildung, einem Abschluß der Polizeiakademie und der Unfähigkeit, für jemand anderen zu arbeiten, zu einem ausbaufähigen Vorschlag werden läßt. Ich zahle meine Rechnungen pünktlich, befolge die meisten Gesetze und finde, daß andere Leute das ebenfalls tun sollten ... schon allein aus Höflichkeit. Wenn es um Gerechtigkeit geht, bin ich pedantisch, aber ich lüge auch, wenn es nötig ist. Unbeständigkeit hat mich noch nie beunruhigt.
Es war Ende Oktober, am Tag vor Halloween, und das Wetter im Mittelwesten spielte Herbst – klar und sonnig und kühl. Als ich in die Stadt fuhr, hätte ich schwören können, daß Holzrauch in der Luft lag, und ich erwartete fast, daß die Blätter sich gelb und rot verfärbten. Stattdessen sah ich nur dieselben alten Palmen, dasselbe gnadenlose Grün überall. Die Brände des Sommers waren unter Kontrolle, die Regenfälle hatten noch nicht eingesetzt. Es war eine typische kalifornische Nichtjahreszeit, aber sie kam mir vor wie Herbst, und ich reagierte mit übermäßig guter Laune, dachte daran, am Nachmittag zum Schießplatz hinauszufahren, was ich immer tue, wenn ich etwas zum Lachen haben will.
An diesem Samstagmorgen war ich ins Büro gekommen, um ein paar buchhalterische Aufgaben zu erledigen – Rechnungen zu bezahlen, meine Monatserklärungen fertigzumachen. Ich hatte meine Rechenmaschine aufgestellt, ein Formular in die Schreibmaschine eingespannt, und vier ausgefüllte Erklärungen lagen links von mir auf dem Schreibtisch, adressiert und gestempelt. Ich war so in meine Aufgabe vertieft, daß ich gar nicht merkte, daß jemand in der Tür stand, bis der Mann sich räusperte. Ich reagierte mit einem dieser kleinen Sätze, wie man sie macht, wenn man die Abendzeitung aufschlägt und eine Spinne rausläuft. Der Mann fand das offenbar amüsant, aber ich mußte mich auf die Brust schlagen, um meinen Herzschlag wieder zu verlangsamen.
»Ich bin Alvin Limardo«, erklärte er. »Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe.«
»Schon gut. Ich hatte bloß keine Ahnung, daß Sie da standen. Suchen Sie mich?«
»Wenn Sie Kinsey Millhone sind, ja.«
Ich stand auf und schüttelte ihm über den Schreibtisch hinweg die Hand. Dann forderte ich ihn auf, Platz zu nehmen. Mein erster flüchtiger Eindruck war, daß er ziemlich heruntergekommen war, aber auf den zweiten Blick fand ich nichts, was diesen Eindruck untermauert hätte.
Er war um die Fünfzig, zu hager, um bei guter Gesundheit zu sein. Sein Gesicht war lang und schmal, das Kinn ausgeprägt. Sein Haar war aschgrau, kurz geschnitten, und er roch nach Zitrus-Cologne. Die Augen waren haselnußbraun, sein Blick distanziert. Der Anzug, den er trug, war von einem sonderbaren Grünton, seine Hände waren riesig mit langen, knochigen Fingern und deutlich vergrößerten Knöcheln. Die fünf Zentimeter schmalen Handgelenke, die ohne Manschetten aus den Jackettärmeln ragten, deuteten auf Schäbigkeit hin, obwohl seine Kleidung nicht wirklich abgenutzt aussah. Er hielt ein Stück Papier in der Hand, das er zweimal gefaltet hatte, und damit spielte er jetzt verlegen herum.
»Was kann ich für Sie tun?« erkundigte ich mich.
»Ich hätte gern, daß Sie das zustellen.« Er strich das Stück Papier glatt und legte es auf meinen Tisch. Es war eine Bankanweisung auf eine Bank in Los Angeles, mit Datum vom 29. Oktober, und ausgestellt auf eine Person namens Tony Gahan über eine Summe von fünfundzwanzigtausend Dollar.
Ich versuchte, nicht so überrascht auszusehen, wie ich mich fühlte. Er sah nicht aus wie ein Mann, der Geld übrighatte. Vielleicht hatte er die Summe von Gahan geliehen und zahlte sie jetzt zurück. »Erzählen Sie mir, worum es da geht?«
»Er hat mir einen Gefallen getan. Ich möchte mich bedanken. Das ist alles.«
»Das muß aber ein großer Gefallen gewesen sein. Sind Sie böse, wenn ich frage, was er getan hat?«
»Er war freundlich zu mir, als ich ganz unten war.«
»Und deshalb brauchen Sie jetzt mich?«
Er lächelte kurz. »Ein Anwalt würde einhundertzwanzig Dollar die Stunde verlangen, wenn er es erledigen sollte. Ich vermute, Sie berechnen weit weniger.«
»Eine Botenagentur ebenfalls«, sagte ich. »Und noch billiger wäre es, wenn Sie es selbst überbringen.« Ich wollte nicht neunmalklug sein, aber ich verstand wirklich nicht, wozu er einen Privatdetektiv brauchte.
Er räusperte sich. »Das habe ich versucht, aber ich weiß Mr. Gahans derzeitige Adresse nicht genau. Er hat einmal am Stanley Place gewohnt, aber da ist er jetzt nicht. Ich bin heute morgen dort gewesen, das Haus steht leer. Es sieht aus, als hätte schon eine ganze Weile niemand mehr dort gewohnt. Ich möchte, daß ihn jemand ausfindig macht und dafür sorgt, daß er das Geld bekommt. Wenn Sie abschätzen können, was das kosten wird, bezahle ich im Voraus.«
»Das kommt darauf an, wie gut sich Mr. Gahan versteckt. Möglicherweise liegt seine derzeitige Adresse im Kreditbüro vor oder bei der Kfz-Zulassungsstelle. Eine Menge Fragen lassen sich per Telefon klären, aber das kostet immer noch Zeit. Bei dreißig Dollar die Stunde kommt da einiges zusammen.«
Er holte sein Scheckheft hervor und fing an, einen Scheck auszuschreiben. »Zweihundert Dollar?«
»Sagen wir lieber vier. Ich kann das Geld immer noch zurückgeben, wenn die Rechnung drunter bleibt«, sagte ich. »Im Übrigen habe ich eine Lizenz zu verlieren, es ist also besser, wenn die Sache in Ordnung ist. Ich würde mich wohler fühlen, wenn Sie mir erzählen, um was es hier geht.«
Und an dieser Stelle legte er mich herein, weil das, was er mir erzählte, nämlich gerade ausgefallen genug war, um überzeugend zu sein. Lügnerin, die ich bin, kam es mir doch nicht in den Sinn, daß sich soviel Falschheit mit der Wahrheit vermischen könnte.
»Ich bin vor einer Weile mit dem Gesetz in Konflikt geraten und habe einige Zeit im Gefängnis verbracht. Tony Gahan hat mir geholfen, kurz ehe ich eingesperrt wurde. Er hatte keine Ahnung von den Umständen, in denen ich mich befand, war also kein Mittäter bei irgendetwas, und Sie wären es genausowenig. Ich fühle mich in seiner Schuld.«
»Warum kümmern Sie sich nicht selbst darum?«
Er zögerte, fast schüchtern, dachte ich. »Das ist ein bißchen so wie in dem Buch von Charles Dickens, Große Erwartungen. Es würde ihm vielleicht nicht gefallen, wenn ein Vorbestrafter zu seinem Wohltäter wird. Die Leute haben da manchmal komische Vorstellungen.«
»Und wenn er eine anonyme Spende nicht annehmen will?«
»In dem Fall können Sie den Scheck zurückgeben und die Gebühr behalten.«
Ich rutschte unruhig auf meinem Stuhl herum. Was stimmt an diesem Bild bloß nicht, fragte ich mich. »Woher haben Sie das Geld, wenn Sie im Gefängnis gewesen sind?«
»Santa Anita. Ich bin noch auf Bewährung und dürfte überhaupt nicht bei Pferderennen wetten, aber es fällt mir schwer zu widerstehen. Deshalb möchte ich das Geld an Sie weitergeben. Ich bin ein Spieler. Ich kann nicht soviel Geld um mich haben, ohne es zum Fenster rauszuschmeißen.« Er machte den Mund zu und sah mich an, wartete ab, was ich noch fragen würde. Ganz offensichtlich wollte er freiwillig nicht mehr erzählen, als unbedingt nötig war, um meine Bedenken zu zerstreuen, aber er schien überraschend geduldig dabei. Später begriff ich natürlich, daß seine Gelassenheit wahrscheinlich das Ergebnis davon war, daß er mir soviel Unsinn erzählt hatte. Das Spiel, das er spielte, muß ihm Spaß gemacht haben. Lügen macht Spaß. Ich kann damit auch den ganzen Tag zubringen.
»Weshalb waren Sie angeklagt?« erkundigte ich mich.
Er schlug die Augen nieder, richtete seine Antwort an die übergroßen Hände, die gefaltet in seinem Schoß lagen. »Ich glaube nicht, daß das wichtig ist. Das Geld hier ist jedenfalls sauber, und ich habe es ehrlich erworben. An der ganzen Transaktion ist nichts illegal, wenn es das ist, was Ihnen Sorgen bereitet.«
Natürlich machte es mir Sorgen, aber ich fragte mich langsam, ob ich zu anspruchsvoll war. Nach außen hin war an seiner Bitte nichts Ungewöhnliches. Ich ließ mir seinen Vorschlag noch einmal vorsichtig durch den Kopf gehen, fragte mich, was Tony Gahan für Limardo getan hatte, um diese Art von Bezahlung zu verdienen. Es ging mich wahrscheinlich nichts an, solange dabei kein Gesetz gebrochen worden war. Meine Intuition sagte mir, ich sollte den Auftrag ablehnen, aber zufällig war am nächsten Tag die Miete für mein Apartment fällig. Ich hatte das Geld auf meinem Girokonto, aber es kam mir vor wie ein Wink des Schicksals, daß mir so unerwartet Geld in den Schoß fallen sollte. Auf jeden Fall sah ich keinen Grund, abzulehnen. »Also gut«, willigte ich ein.
Er nickte einmal, erfreut. »Gut.«
Ich saß da und beobachtete, wie er seinen Namen unter den Scheck setzte. Er riß ihn heraus und schob ihn mir zu, steckte das Scheckheft dabei in die Innentasche seines Jacketts. »Meine Adresse und Telefonnummer stehen drauf, für den Fall, daß Sie sich mit mir in Verbindung setzen müssen.«
Ich zog einen Standardvertrag aus meiner Schreibtischschublade und brauchte ein paar Minuten, um ihn auszufüllen. Ich bekam seine Unterschrift und notierte mir dann Tony Gahans letzte bekannte Adresse, ein Haus in Colgate, dem Wohnviertel gleich nördlich von Santa Teresa. Ich spürte schon so etwas wie unterschwellige Angst, wünschte, ich hätte nicht eingewilligt, irgendetwas zu tun. Aber nun hatte ich mich verpflichtet, der Vertrag war unterschrieben, und ich sagte mir, ich würde das Beste daraus machen. Wieviel Ärger wird das wohl geben, dachte ich.
Er stand auf, ich tat dasselbe und ging mit ihm zur Tür. Als wir jetzt beide standen, konnte ich sehen, wieviel größer als ich er war – vielleicht eins dreiundneunzig gegenüber meinen eins fünfundsechzig. Er blieb stehen, eine Hand auf dem Türgriff, schaute mit demselben entrückten Starren auf mich herab.
»Eines sollten Sie über Tony Gahan vielleicht noch wissen«, sagte er.
»Und das wäre?«
»Er ist fünfzehn.«
Ich stand da und sah Alvin Limardo nach, als er den Gang entlangging. Ich hätte ihn zurückrufen sollen, Leute.
Ich hätte da schon wissen müssen, daß es nicht gutgehen würde. Stattdessen schloß ich die Bürotür und kehrte an meinen Schreibtisch zurück. Aus einem Impuls heraus öffnete ich die Fenstertüren und ging auf den Balkon. Ich beobachtete die Straße, aber von ihm war nichts zu sehen. Unzufrieden schüttelte ich den Kopf.
Ich schloß den Scheck in meinen Aktenschrank. Am Montag wollte ich ihn in mein Schließfach bei der Bank bringen, bis ich Tony Gahan ausfindig gemacht hatte, und ihn ihm dann übergeben. Fünfzehn?
Um zwölf Uhr machte ich das Büro dicht und ging über die Hintertreppe nach unten zu dem Parkplatz, wo ich meinen VW abholte, eine uralte Limousine mit mehr Rost als Farbe. Das ist nicht gerade die Art von Auto, die man für eine Verfolgungsjagd aussuchen würde, aber das meiste, was ein Privatdetektiv tut, ist ohnehin nicht so aufregend. Meistens besorge ich Informationen über die früheren Arbeitsstellen eines künftigen Angestellten oder bereite für ein paar Anwälte hier in der Stadt die nächsten Verhandlungen vor, untersuche die Fälle. Mein Büro wird mir von der California Fidelity Insurance gestellt, einem früheren Arbeitgeber von mir. Der Hauptsitz der Gesellschaft befindet sich gleich nebenan, und ich arbeite immer noch sporadisch für sie, im Austausch gegen ein bescheidenes Zweizimmerbüro (ein Innen-, ein Außenraum) mit separatem Eingang und einem Balkon, von dem aus man die State Street überblicken kann.
Ich ging bei der Post vorbei und ließ die Briefe in den Kasten fallen, dann hielt ich bei der Bank und deponierte Alvin Limardos vierhundert Dollar auf meinem Konto.
Vier Arbeitstage später, an einem Donnerstag, erhielt ich einen Brief von der Bank, der mich informierte, daß der Scheck geplatzt war. Ihren Unterlagen zufolge hatte Alvin Limardo sein Konto aufgelöst. Als Beweis wurde mir der Scheck selbst mitgeschickt, auf dessen Vorderseite ein Stempel in der speziellen purpurroten Tinte prangte, die ganz klar zum Ausdruck bringt, daß das Mißfallen der Bank erregt wurde.
Das meine auch.
Auf meinem Konto waren die vierhundert Dollar wieder abgebucht worden, und man berechnete mir noch drei Kröten zusätzlich, scheinbar um mich zu ermahnen, in Zukunft keine Geschäfte mit Nieten mehr zu machen. Ich griff nach dem Telefon und wählte Alvin Limardos Nummer in Los Angeles. Falsch verbunden. Ich war schlau genug gewesen, die Suche nach Tony Gahan aufzuschieben, bis der Scheck eingelöst war, hatte also noch keine Arbeit geleistet. Aber wie sollte ich den Scheck ersetzt bekommen? Und was sollte ich in der Zwischenzeit mit den fünfundzwanzig Riesen machen? Inzwischen befand sich die Bankanweisung sicher in meinem Schließfach, aber sie war völlig nutzlos für mich, und ich wollte nicht an dem Fall Weiterarbeiten, solange ich nicht wußte, daß ich bezahlt wurde. Theoretisch hätte ich Alvin Limardo einfach nur eine Nachricht schreiben müssen, aber die hätte genauso wie dieser dumme Scheck zu mir zurückkommen können – und dann? Mist. Ich würde nach L. A. fahren müssen. Eines habe ich jedenfalls gelernt, wenn es ums Eintreiben von Schulden geht – je schneller man ist, desto größer sind die Chancen.
Ich suchte seine Adresse aus meinem Thomas Guide to Los Angeles Streets heraus. Sogar auf der Karte sah es nicht so aus, als handelte es sich um eine gute Gegend. Ich schaute auf die Uhr. Es war 10 Uhr 15. Ich würde neunzig Minuten bis nach L. A. brauchen, wahrscheinlich noch einmal eine Stunde, bis ich Limardo ausfindig gemacht, ihn mir vorgeknöpft, den Scheck ersetzt gekriegt und einen Happen gegessen hatte. Die Fahrt zurück würde neunzig Minuten dauern, ich wär also gegen 3 Uhr 30 oder 4 Uhr wieder im Büro. Nun, das war nicht allzu schlimm. Es war öde, aber notwendig, also beschloß ich, mich nicht weiter herumzuquälen, sondern es hinter mich zu bringen.
Um 10 Uhr 30 hatte ich meinen Wagen aufgetankt und war unterwegs.
Kapitel 2
Bei Sherman Oaks verließ ich den Ventura Freeway und fuhr auf dem San Diego Freeway Richtung Süden bis zum Venice Boulevard. Ich bog ab und hielt mich rechts. Nach meinen Berechnungen mußte die Adresse, die ich suchte, irgendwo in der Nähe sein. Ich fuhr ein Stück parallel zurück Richtung Sawtelle.
Als ich das Haus sah, wurde mir klar, daß ich die Rückseite schon beim Vorbeifahren auf dem Freeway gesehen hatte. Auf dem Dach hing eine schlaffe, orangefarbene Fahne mit der Aufschrift ZU VERMIETEN. Eine Regenrinne aus Beton trennte das Gebäude von der Straße, und eine drei Meter hohe Wand aus Holzziegeln, die mit Nachrichten für vorbeikommende Autofahrer besprüht war, schützte es vor heranrasenden Autos. Dornige Gräser waren am Fuß der Mauer gewachsen, und Abfall hatte sich in den wenigen größeren Büschen gesammelt, die es geschafft hatten, die Autoabgase zu überleben. Mir war das Gebäude aufgefallen, weil es so typisch für L. A. zu sein schien: kahl, billig gebaut, schlecht gestaltet. Von seiner Rückseite ging etwas Boshaftes aus, und der Eingang erwies sich als noch schlimmer.
Die Straße bestand zum größten Teil aus kalifornischen »Bungalows«, kleinen Zweizimmerhäusern aus Holz und Putz mit vernachlässigten Höfen ohne Bäume. Die meisten von ihnen waren in Pastellfarben gestrichen, merkwürdigen Tönen von Türkis bis Lila, die den Eindruck von Billigfarben machten, die die Farbe darunter nicht ganz überdeckt hatten.
Ich fand einen Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite, schloß meinen Wagen ab und ging zu dem Apartmenthaus rüber.
Das Gebäude fing an, sich in seine Bestandteile aufzulösen. Der Putz wirkte mehlig und trocken, die Fensterrahmen aus Aluminium verbeult. Das schmiedeeiserne Tor vor dem Haus war einfach aus der Stützwand gerissen worden, zurückgeblieben waren faustgroße Löcher. Zwei Wohnungen zu ebener Erde waren mit Brettern vernagelt. Die Hausverwaltung hatte großzügig eine Reihe von Abfalltonnen nahe der Treppe zur Verfügung gestellt, aber (scheinbar) kein Geld, um den Abfall beseitigen zu lassen. Ein großer, gelber Köter scharrte begeistert in diesem Abfallhaufen herum, schien aber für seine Bemühungen nichts weiter als ein Viertelchen Pizza zu ernten. Er trabte davon, die Pizzakante wie einen Knochen zwischen den Zähnen.
Ich wagte mich in den Schutz der Treppe. Die Briefkästen waren größtenteils herausgefetzt worden, und die Post lag in der Eingangshalle verstreut wie Abfall. Der Adresse auf dem Scheck nach lebte Limardo in Apartment 26. Ich vermutete, daß es sich irgendwo oben befand. Es gab offensichtlich vierzig Wohneinheiten, nur wenige mit den Namen der Bewohner versehen. Das erschien mir merkwürdig. In Santa Teresa wird Post überhaupt nicht zugestellt, wenn es keinen Briefkasten gibt, der deutlich gekennzeichnet und in Ordnung ist. Ich stellte mir den Postboten vor, wie er seine Tasche wie einen Papierkorb ausleerte und dann zu Fuß entfloh, ehe die Bewohner des Hauses wie Käfer ausschwärmten.
Die Apartments waren in Reihen um einen Innenhof angeordnet, einen »Garten« aus losem Kies, rosa Pflastersteinen und Zyperngras. Ich suchte mir vorsichtig meinen Weg über rissige Betonstufen.
Auf dem zweiten Treppenabsatz saß ein Schwarzer in einem alten Klappstuhl aus Metall und ritzte mit einem Messer an einem Stock Kernseife herum. Eine Zeitschrift lag aufgeschlagen auf seinem Schoß, um die Abfälle aufzufangen. Er war vielleicht fünfzig Jahre alt, untersetzt und formlos, mit kurzgeschnittenem, krausem Haar, das an den Ohren Grau aufwies. Seine Augen waren von einem schmuddeligen Braun, das eine Lid verzerrt von einer Naht, die sich über seine Wange hinabzog.
Mit einem Blick nahm er meine Erscheinung in sich auf, ehe er sich wieder der Skulptur zuwandte, die unter seinen Händen Gestalt annahm. »Sie müssen Alvin Limardo suchen«, bemerkte er.
»Richtig«, antwortete ich überrascht. »Woher wissen Sie das?«
Er schenkte mir ein kurzes Lächeln, zeigte dabei perfekte Zähne, so weiß wie die Seife, an der er schnitzte. Er wandte mir sein Gesicht zu, und das verletzte Auge erweckte die Illusion eines Zwinkerns. »Baby, Sie sind nich von hier. Ich kenn alle, die hier wohnen. Und so, wie Sie aussehn, woll’n Sie hier auch nix mieten. Wenn Sie wüßten, wo Sie hinmüßten, dann würden Sie direkt dahin gehn. Statt dess’n schau’n Sie sich um, als würde sich gleich irgendwas auf Sie stürz’n, mich eingeschlossen«, erklärte er und machte eine Pause, um mich zu mustern. »Ich würde sagen, Sie machen Sozialarbeit. Bewährungshilfe oder so was. Vielleicht Sozialhelferin.«
»Nicht schlecht«, lobte ich. »Aber warum Limardo? Wieso glauben Sie, daß ich ihn suche?«
Jetzt lächelte er, sein Zahnfleisch schimmerte rosig. »Wir hier sind alle Alvin Limardo. Das is’ ’n Scherz von uns. Bloß so ’n Name, den wir den Leuten geben, wenn wir sie an der Nase rumführen wollen. Ich war erst letzte Woche selbst Alvin Limardo, als ich mir Essensmarken geholt hab. Er bekommt Sozialhilfe, Invalidenrente, AFDC. Letzte Woche kam jemand, der ihn verhaften wollte. Hab erzählt, Alvin Limardo wär weg. Gibt jetzt niemanden mehr hier, der so heißt. Dieser Alvin Limardo, den Sie suchen ... is’ der weiß oder schwarz?«
»Weiß«, antwortete ich und beschrieb dann den Mann, der Samstag in mein Büro gekommen war. Der Schwarze nickte, als ich mit der Beschreibung erst halb durch war, sein Messer glättete noch immer die Seife. Es sah aus, als hätte er eine Sau geschnitzt, die auf der Seite lag, umgeben von einem Knäuel Ferkelchen, die an ihr herumkletterten, um gesäugt zu werden. Das Ganze konnte nicht länger als zehn Zentimeter sein.
»Das ist John Daggett. Oje. Er is’ ’n schlechter Kerl. Den müssen Sie suchen, aber der is’ weg.«
»Haben Sie eine Ahnung, wohin er gegangen ist?«
»Santa Teresa, hab ich gehört.«
»Schön, ich weiß, daß er letzten Samstag da war. Da hab ich ihn getroffen. Ist er seitdem noch mal hier gewesen?«
Der Mann verzog skeptisch den Mund. »Ich hab ihn Montag gesehn, und dann is’ er wieder weg. Aber andere Leute suchen den wohl auch. Der benimmt sich wie ’n Mann, der rennt und nich erwischt werden will. Was woll’n Sie denn von ihm?«
»Hat mir ’nen ungedeckten Scheck ausgestellt.«
Er warf mir einen erstaunten Blick zu. »Sie nehmen ’nen Scheck von so ’nem Kerl? Mein Gott, Mädchen! Was is’ denn mit Ihnen los?«
Ich mußte lachen. »Ich weiß. Ist meine eigene Schuld, verdammt. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht erwischen, ehe er ganz verschwindet.«
Er schüttelte den Kopf, unfähig, Mitleid mit mir zu haben. »Von solchen dürfen Se nix nehmen. Das is’ der erste Fehler, den Sie gemacht hab’n. Und daß Sie jetzt hierhergekommen sind, könnte der nächste sein.«
»Gibt es hier irgendjemanden, der wissen könnte, wo ich ihn erreichen kann?«
Mit dem Messer wies er auf ein Apartment zwei Türen weiter. »Fragen Sie Lovella. Sie könnte es wissen. Aber vielleicht auch nich’.«
»Ist sie eine Freundin von ihm?«
»Kann man nich’ sagen. Sie is’ seine Frau.«
Ich hatte ein bißchen mehr Hoffnung, als ich an die Tür von Apartment 26 klopfte. Ich hatte schon befürchtet, er wäre ausgezogen. Die Tür hatte ungefähr auf Schienbeinhöhe ein großes Loch. Das Schiebefenster stand fünfzehn Zentimeter weit offen, ein Stück Vorhang hing heraus. Ein Sprung lief diagonal über die Scheibe, wurde von einem breiten Streifen Isolierband zusammengehalten. Ich konnte riechen, daß drinnen etwas kochte, Gemüsesuppe oder Grünkohl, mit einem Hauch von Essig und Schinkenspeck.
Die Tür wurde geöffnet, und eine Frau blinzelte mich an. Ihre Oberlippe war geschwollen wie bei Kindern, wenn sie vom Fahrrad fallen, während sie das Fahren damit lernen. Ihr linkes Auge war vor nicht allzu langer Zeit blau geschlagen worden und verblaßte erst allmählich, und die umgebende Haut wies alle Farben des Regenbogens auf von Gelb bis Grau. Ihr Haar hatte die Farbe von Heu, war in der Mitte gescheitelt und wurde über jedem Ohr von einer Klemme gehalten. Ich konnte auch nicht annähernd erraten, wie alt sie sein konnte. Jünger jedenfalls, als ich erwartet hatte, nachdem ich John Daggetts Alter auf über fünfzig schätzte.
»Lovella Daggett?«
»Richtig.« Sie schien zu zögern, soviel zugegeben.
»Ich bin Kinsey Millhone. Ich suche John.«
Sie fuhr sich mit der Zunge über die Oberlippe, als hätte sie sich noch nicht an die neue Form und Größe gewöhnt. Auf der aufgeschürften Fläche hatte sich Schorf gebildet, der jetzt aussah wie ein Bart. »Der ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo er ist. Warum suchen Sie ihn?«
»Er hat mich angestellt, um etwas für ihn zu erledigen, aber er hat mir einen ungedeckten Scheck als Bezahlung gegeben. Ich hatte gehofft, wir könnten das in Ordnung bringen.«
Sie musterte mich, während sie mehr Informationen verlangte. »Was sollten Sie tun?«
»Ich sollte etwas zustellen.«
Sie glaubte kein bißchen davon. »Sind Sie von der Polizei?«
»Nein.«
»Was dann?«
Zur Antwort zeigte ich ihr die Fotokopie meiner Lizenz.
Sie drehte sich um und ging von der Tür fort, ließ sie hinter sich offen. Ich schätzte, daß das ihre Art war, mich hereinzubitten.
Ich trat ins Wohnzimmer und schloß die Tür hinter mir. Der Teppichboden zeigte das Grün, das Wohnungsinhaber überall so lieben. Die einzigen Möbel im Zimmer waren ein kleiner Tisch und zwei einfache Holzstühle. Ein Rechteck an einer Wand, wo der Teppich heller war, verriet, daß hier einmal eine Couch gestanden hatte, und Abdrücke im Teppich zeigten die Stellen, wo zwei schwere Sessel und ein Couchtisch gestanden hatten, angeordnet in dem, was Innenarchitekten als »Konversationsgruppierung« bezeichnen. Statt Konversation zu betreiben, schien Daggett jetzt direkt zur Sache zu kommen. Die einzige Lampe, die ich sah, war aus der Fassung gerissen worden, und die Drähte gingen heraus wie Eingeweide.
»Wo sind die Möbel?«
»Hat er letzte Woche alle verpfändet. Hat das Geld gebraucht, um seine Barrechnungen zu bezahlen. Das Auto ist schon vorher abgestoßen worden. War sowieso nur ein Stück Dreck, aber ich hab dafür bezahlt. Sie müßten mal sehn, was ich jetzt als Bett hab. ’ne alte, vollgepißte Matratze, die er irgendwo auf der Straße gefunden hat.«
An der Anrichte standen zwei Barhocker, und ich kletterte auf einen und sah zu, wie Lovella in dem kleinen Raum hantierte, der als Küche diente. Ein Aluminiumtopf stand auf dem Gasherd. Das Wasser darin kochte wütend vor sich hin. Auf einer der hinteren Flammen stand ein mitgenommener Aluminiumtopf, in dem Grünzeug siedete.
Lovella trug Jeans und ein schlichtes, weißes T-Shirt mit der Innenseite nach außen. Das Fruit-of-the-Loom-Schild hing sichtbar am Nacken heraus. Sie hatte das Hemd hochgeschoben und unter der Brust geknotet, so daß es als Oberteil diente und ihr Bauch frei blieb. »Wollen Sie Kaffee? Ich wollte gerade welchen machen.«
»Ja, bitte.«
Sie spülte mit fließendem warmem Wasser eine Tasse aus und trocknete sie flüchtig mit einem Papierhandtuch ab. Dann stellte sie sie auf die Anrichte und löffelte Instant-Kaffee hinein, ehe sie dasselbe Papierhandtuch als Topflappen benutzte und damit nach dem Topf griff. Das Wasser sprudelte an der Seitenwand des Topfes, als sie goß. Sie gab noch Wasser in eine zweite Tasse, rührte den Inhalt schnell um und schob sie mir zu, noch mit dem Löffel darin.
»Daggett is ein Schwein. Die sollten ihn lebenslang einlochen«, bemerkte sie, fast müßig, dachte ich.
»Hat er Ihnen das angetan?« fragte ich, und mein Blick wanderte kurz über ihr zerschundenes Gesicht.
Sie starrte mich aus stumpfen, grauen Augen an, ohne sich die Mühe zu machen, zu antworten. Aus der Nähe konnte ich sehen, daß sie kaum älter als fünfundzwanzig war. Sie beugte sich vor, stützte die Ellbogen auf die Anrichte, den Kaffeebecher mit beiden Händen haltend. Sie trug keinen BH, und ihre Brust war groß, so weich und schwer wie mit Wasser gefüllte Ballons; die Warzen zeichneten sich wie Knoten unter dem T-Shirt-Stoff ab. Ich fragte mich, ob sie eine Nutte war. Ich hatte ein paar kennengelernt, die dieselbe sorglose Art im Umgang mit Sexualität hatten – alles an der Oberfläche, keine Gefühle dahinter.
»Wie lange waren Sie verheiratet?«
»Stört es Sie, wenn ich rauche?«
»Ist Ihre Wohnung. Sie können tun, was Sie wollen«, antwortete ich.
Das brachte mir ein schwaches Lächeln ein, das erste, das ich bei ihr gesehen hatte. Sie langte nach einer Packung Pall Mall 100, machte den Gasofen an und zündete die Zigarette an der Flamme an, hielt den Kopf dabei schräg, damit ihr Haar nicht Feuer fing. Sie sog tief und atmete aus, blies mir eine Rauchwolke ins Gesicht. »Sechs Wochen«, sagte sie dann, eine verspätete Antwort auf meine Frage. »Wir waren Brieffreunde, nachdem er nach San Louis kam. Haben uns ein Jahr lang geschrieben, und dann hab ich ihn geheiratet, in der Minute, als er entlassen wurde. Dumm? Himmel! Können Sie glauben, daß ich das getan habe?«
Ich zuckte kommentarlos die Achseln. Es war ihr ohnehin egal, ob ich das glaubte oder nicht. »Wie haben Sie sich überhaupt kennen gelernt?«
»Durch ’nen Kumpel von ihm. Billy Polo, mit dem ich gegangen bin. Die haben da gesessen und über Frauen geredet, und mein Name is gefallen. Ich schätze, Billy hat so von mir gesprochen, daß Daggett mich für ’ne heiße Nummer hielt. Auf jeden Fall hat er sich dann mit mir in Verbindung gesetzt.«
Ich nippte an meinem Kaffee. Er hatte den schalen, fast säuerlichen Geschmack von Instant, und am Rand schwammen winzige Klümpchen Kaffeepulver herum. »Haben Sie Milch dafür?«
»Oh, klar, tut mir leid.« Sie ging zum Kühlschrank und holte eine kleine Dose Kondensmilch heraus.
Das war nicht ganz das, was ich im Sinn gehabt hatte, aber ich tröpfelte trotzdem etwas davon in meinen Kaffee und beobachtete fasziniert, wie die Milch in einer Reihe kleiner, weißer Tupfen an die Oberfläche stieg. Ich fragte mich, ob ein Wahrsager aus dem Muster lesen konnte wie aus Teeblättern. Ich dachte, ich würde Verdauungsschwierigkeiten in meiner näheren Zukunft sehen, war mir aber nicht sicher.
»Daggett kann sehr charmant sein, wenn er will«, erzählte sie. »Aber geben Sie ihm ein paar Drinks und er ist der gemeinste Kerl der Welt.«
Diese Geschichte kam mir bekannt vor. »Warum haben Sie ihn nicht verlassen?«
»Weil er mir nachgegangen wäre, darum«, sagte sie heftig. »Sie kennen ihn nicht. Der hätte mich umgebracht, ohne auch nur einen zweiten Gedanken daran zu verschwenden. Wäre dasselbe gewesen, wenn ich die Bullen gerufen hätte. Geben Sie diesem Kerl Widerworte und der haut Ihnen ins Maul. Der haßt Frauen, das is mit ihm los. Klar, wenn er nüchtern wird, haut er mit seinem Charme alle um. Jedenfalls hoffe ich, daß der für immer weg is’. Hat Montagmorgen ’nen Anruf gekriegt und is wie der Blitz verschwunden. Seitdem hab ich nich mehr von ihm gehört. Aber das Telefon is’ gestern auch abgestellt worden. Wüßte also nich, wie er sich mit mir in Verbindung setzen sollte, wenn er das wollte.«
»Warum reden Sie nicht mit seinem Bewährungshelfer?«
»Schätze, das könnte ich tun«, meinte sie zögernd. »Aber der stellt doch was an, sobald sich der andere umdreht. Hatte zwei Tage lang ’nen Job, aber den hat er hingeschmissen. Klar dürfte er nich’ trinken. Ich glaub, er hatte zuerst vor, sich an die Vorschriften zu halten, aber das war zuviel.«
»Warum verschwinden Sie nicht, solange Sie die Chance haben?«
»Und wohin? Ich hab keinen Pfennig.«
»Es gibt Häuser für mißhandelte Frauen. Rufen Sie im Frauenzentrum an, dort wird man es wissen.«
Sie machte eine abweisende Geste. »Herrje, so Leute wie Sie gefallen mir. Sind Sie schon mal von ’nem Kerl verprügelt worden?«
»Nicht von einem, mit dem ich verheiratet war. Das würde ich mir nicht gefallen lassen.«
»Hab ich auch immer gedacht, Schwester, aber ich will Ihnen mal was sagen. So einfach kommt man da nich’ raus. Nich’ bei ’nem Kerl wie Daggett. Der hat geschworen, er würde mir bis ans Ende der Welt folgen, und das würde er.«
»Warum war er im Gefängnis?«
»Hat er nie gesagt, und ich hab nie gefragt. War auch doof. Aber zuerst war mir das egal. Ein paar Wochen lang war alles prima. Er war wie ’n Kind, verstehn Sie? Und so süß! Herrje, der is hinter mir hergelaufen wie ’n junger Hund. Wir konnten einfach nich’ genug voneinander kriegen. War alles genau wie in den Briefen, die wir uns geschrieben haben. Und dann hat er eines Abends zu tief in die Flasche geguckt und die Scheiße ging los.«
»Hat er je den Namen Tony Gahan erwähnt?«
»Nee. Wer soll das sein?«
»Ich bin mir nicht sicher. Ein Kind, das ich für ihn finden sollte.«
»Womit hat er Sie bezahlt? Kann ich den Scheck mal sehen?«
Ich zog ihn aus der Handtasche und legte ihn auf die Anrichte. Ich hielt es für besser, den Bankscheck nicht zu erwähnen. Ich glaubte nicht, daß sie es gut aufnehmen würde, daß er sein Geld verschenken wollte. »Soviel ich weiß, ist Limardo ein künstlicher Name.«
Sie musterte den Scheck. »Ja, aber Daggett hatte wirklich ein bißchen Geld auf diesem Konto. Ich glaube, er hat es abgehoben, bevor er ging.« Sie sog erneut an ihrer Zigarette, als sie mir den Scheck zurückgab. Es gelang mir, den Kopf zu drehen, ehe sie mir wieder den Rauch ins Gesicht blasen konnte.
»Dieser Anruf, den er am Montag erhielt. Worum ging es da? Wissen Sie das?«
»Keine Ahnung. Ich war im Waschsalon. Kam heim, und er war noch am Telefon, sein Gesicht so grau wie der Putzlappen da. Er hat schnell aufgelegt und dann Zeug in seinen Reisesack gestopft. Hat die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, als er nach seinem Bankbuch suchte. Ich hatte schon Angst, er würde auf mich losgehen, weil er glaubte, ich hätte es genommen, aber wahrscheinlich war er so durcheinander, daß er überhaupt nicht an mich gedacht hat.«
»Hat er Ihnen das so gesagt?«
»Nein, aber er war eiskalt und nüchtern, und seine Hände haben übel gezittert.«
»Haben Sie eine Ahnung, wohin er gefahren sein könnte?«
Etwas blitzte in ihren Augen auf, ein Gefühl, das sie verbarg, indem sie die Augen niederschlug. »Er hatte nur einen einzigen Freund, und das war Billy Polo in Santa Teresa. Wenn er Hilfe brauchte, ist er immer zu ihm. Ich glaub, er hatte früher auch Familie dort, aber was aus denen geworden ist, weiß ich nicht. Darüber hat er nie viel gesprochen.«
»Dann ist Polo auch entlassen?«
»Ich hab gehört, er wär erst vor kurzem rausgekommen.«
»Na ja, vielleicht kann ich den aufspüren, da er die einzige Spur ist, die ich habe. Aber würden Sie mich anrufen, wenn Sie von einem der beiden hören?« Ich zog eine Karte raus und schrieb meine Privatadresse und Telefonnummer auf die Rückseite. »Machen Sie’s als R-Gespräch.«
Sie betrachtete beide Seiten der Karte. »Was glauben Sie, was da los ist?«
»Ich weiß es nicht, und es ist mir auch ziemlich egal. Sobald ich ihn finde, bring ich diese Sache in Ordnung und steige aus.«
Kapitel 3
Da ich schon mal in der Gegend war, ging ich gleich noch bei der Bank vorbei. Die Frau am Beratungsschalter hätte kaum weniger hilfsbereit sein können. Sie hatte dunkles Haar, war Anfang Zwanzig und wohl neu dort. Das entnahm ich der Tatsache, daß sie auf jede einzelne meiner Fragen mit dem gequälten Blick eines Menschen reagierte, der sich über die Bestimmungen nicht sicher ist und deshalb zu allem nein sagt. Sie wollte »Alvin Limardos« Kontonummer nicht bestätigen, ebensowenig wie die Tatsache, daß das Konto gelöscht worden war. Sie wollte mir auch nicht sagen, ob es vielleicht ein anderes Konto unter John Daggetts Namen gab. Ich wußte, daß es eine Kopie der Kassenanweisung selbst geben mußte, aber sie weigerte sich, die Information zu bestätigen, die er selbst mir gegeben hatte. Ich glaubte immer noch, daß ich einen anderen Weg einschlagen konnte, vor allem, wo es um so viel Geld ging. Es konnte der Bank doch gewiß nicht gleichgültig sein, was mit fünfundzwanzigtausend Dollar geschah. Ich stand am Schalter und starrte die Frau an, und sie starrte zurück. Vielleicht hatte sie nicht begriffen.
Ich zog die Fotokopie meiner Lizenz hervor und zeigte darauf. »Schauen Sie her, sehen Sie das? Ich bin Privatdetektiv. Ich habe wirklich ein Problem. Ich wurde beauftragt, eine Kassenanweisung zuzustellen, aber jetzt kann ich den Mann nicht finden, der mir die Anweisung gegeben hat, und ich weiß nicht, wo sich die Person aufhält, die das Geld erhalten soll. Ich versuche doch nur, eine Spur ausfindig zu machen, damit ich tun kann, was man mir aufgetragen hat.«
»Das verstehe ich.«
»Aber Sie wollen mir keine der nötigen Informationen geben, richtig?«
»Das verstößt gegen die Bankvorschriften.«
»Verstößt es denn nicht gegen die Bankvorschriften, wenn Alvin Limardo mir einen ungedeckten Scheck ausstellt?«
»Doch.«
»Was soll ich dann damit tun?« Ich kannte die Antwort bereits ... vergessen Sie ihn .. . aber ich fühlte mich stur und pervers.
»Bringen Sie ihn vor Gericht«, schlug sie vor.
»Aber ich kann den Mann nicht finden. Er kann nicht vor Gericht gestellt werden, wenn niemand weiß, wo er ist.«
Sie starrte mich nur stumm an.
»Was ist mit den fünfundzwanzigtausend Dollar?« wollte ich wissen. »Was soll ich damit tun?«
»Keine Ahnung.«
Ich starrte auf den Tisch. Als ich im Kindergarten war, war ich bissig, und ich kämpfe noch heute mit diesem Trieb. Es gibt einem einfach ein gutes Gefühl, verstehen Sie? »Ich möchte mit Ihrem Vorgesetzten sprechen.«
»Mr. Stallings? Der hat schon Feierabend.«
»Also schön, gibt es hier sonst irgendjemanden, der mir dabei helfen könnte?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin für den Kundendienst zuständig.«
»Aber Sie tun doch nichts. Wie können Sie das Kundendienst nennen, wenn Sie überhaupt nichts tun?«
Sie preßte die Lippen zusammen. »Bitte reden Sie nicht so mit mir. Das ist sehr beleidigend.«
»Was muß ich also tun, damit mir hier jemand hilft?« »Haben Sie ein Konto bei uns?«
»Wenn ich es hätte, würde das helfen?«
»Nicht in diesem Fall. Es ist uns nicht gestattet, Informationen über unsere Kunden weiterzugeben.«
Das war nun wirklich albern. Ich entfernte mich von ihrem Schalter. Ich wollte eine beißende Bemerkung machen, aber mir fiel keine ein. Ich weiß, daß ich einfach wütend auf mich selbst war, weil ich diesen Job überhaupt angenommen hatte, aber ich hoffte, ein wenig Zorn an ihr auszulassen ... ein sinnloses Unterfangen. Ich kehrte zu meinem Wagen zurück und steuerte den Freeway an. Als ich Santa Teresa erreichte, war es 4 Uhr 3 5. Ich fuhr einfach am Büro vorbei und direkt nach Hause. Meine Laune besserte sich im selben Augenblick, als ich eintrat. Meine Wohnung war früher eine Einzelgarage und besteht jetzt aus einem Zimmer, sechs Meter jede Wand, mit einer schmalen Ausbuchtung zur Rechten, die als Kochnische dient und durch eine Anrichte vom Wohnbereich abgetrennt ist. Der Raum ist hervorragend genutzt: eine kombinierte Wasch-Trocken-Maschine neben dem Herd, Bücherregale, Schubladen und Vorratskammern in die Wand eingebaut. Alles ist sauber und ordentlich und genau das Richtige für mich. Ich besitze ein ausziehbares Sofa, auf dem ich zur Zeit meistens nur schlafe, einen Schreibtisch, einen Stuhl, einen Beistelltisch und dicke Kissen, die als zusätzliche Sitzplätze dienen, wenn Besuch kommt.
Mein Badezimmer ist eine dieser vorgeformten Naßzellen, in die alles eingelassen ist, einschließlich Handtuchhalter, Seifenschale und ein Ausschnitt für das Fenster, das auf die Straße hinausgeht. Manchmal stehe ich in der Badewanne, die Ellbogen auf das Fensterbrett gestützt, und schaue den vorbeifahrenden Autos zu, denke, wie glücklich ich doch bin. Ich bin gern allein. Das ist fast so, als wäre man reich.
Ich ließ meine Handtasche auf den Schreibtisch fallen und hängte die Jacke an einen Haken. Dann setzte ich mich auf die Couch und zog die Stiefel aus, ehe ich zum Kühlschrank hinübertappte und eine Flasche Weißwein und einen Korkenzieher holte. Hin und wieder versuchte ich, mich zu benehmen, als hätte ich Stil, mit anderen Worten, ich trinke Wein aus einer Flasche und nicht aus einem Pappbehälter. Ich zog den Korken heraus und goß mir etwas in ein Glas. Dann ging ich zum Schreibtisch hinüber, holte das Telefonbuch aus der obersten Schublade und schleppte Telefon, Buch und Weinglas zum Sofa. Ich stellte das Weinglas auf den Beistelltisch und blätterte das Buch durch, um zu sehen, ob Billy Polo geführt wurde. Natürlich wurde er nicht. Ich schlug den Namen Gahan nach. Nichts. Ich trank etwas Wein und überlegte, was ich als nächstes tun könnte.
Aus einem Impuls heraus suchte ich nach Daggett. Lovella hatte erwähnt, daß er früher hier gelebt hatte. Vielleicht hatte er noch Verwandte in der Stadt.
Es waren vier Daggetts aufgeführt. Ich wählte sie der Reihe nach an und sagte jedes Mal dasselbe. »Hallo. Ich versuche, einen John Daggett zu erreichen, der früher hier in der Gegend gewohnt hat. Können Sie mir sagen, ob das die richtige Nummer ist?«
Die beiden ersten Anrufe brachten mich nicht weiter, aber bei dem dritten reagierte der Mann, der meine Frage entgegennahm, mit diesem sonderbaren Schweigen, das verrät, daß eine Information zu erwarten ist.
»Was wollen Sie von ihm?« fragte er. Er hörte sich an, als wäre er um die Sechzig, wählte seine Worte vorsichtig, achtete sorgsam auf meine Antwort, war aber unentschieden, wieviel er verraten sollte.
Er kam tatsächlich direkt auf den kitzligsten Teil der Sache zu sprechen. Nach allem, was ich über Daggett gehört hatte, war er ein Schurke. Also wagte ich nicht, mich als seine Freundin zu bezeichnen. Wenn ich zugab, daß er mir Geld schuldete, würde man am anderen Ende nur den Hörer auf die Gabel knallen. Für gewöhnlich erklärte ich in einer solchen Situation, daß ich Geld für ihn hätte, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das würde in diesem Fall nicht klappen. Die Leute kommen allmählich hinter diesen Mist.
Ich band ihm die erste Lüge auf, die mir einfiel. »Also, um die Wahrheit zu sagen, ich habe John nur einmal gesehen, aber ich versuche, einen gemeinsamen Bekannten zu finden, und ich glaube, John hat seine Adresse und Telefonnummer.«
»Wen wollten Sie denn sprechen?«
Das überraschte mich total, da ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht hatte. »Wen? Äh ... Alvin Limardo. Hat John Alvin je erwähnt?«
»Nein, ich glaube nicht. Aber vielleicht sind Sie hier doch nicht richtig. Der John Daggett, der hier gewohnt hat, ist derzeit im Gefängnis, und zwar seit, ich würde sagen, zwei Jahren.« Seine Art ließ einen Mann ahnen, der selbst noch aus einer falschen Verbindung interessante Möglichkeiten zieht. Trotzdem war es klar, daß ich ins Schwarze getroffen hatte.
»Das ist genau der, von dem ich rede. Er war in San Luis Obispo.«
»Ist er noch.«
»O nein. Er ist draußen. Er ist vor sechs Wochen entlassen worden.«