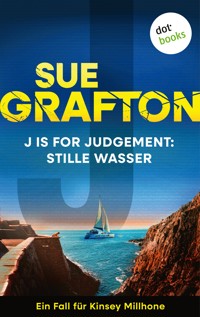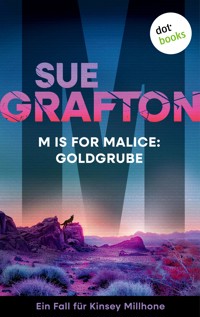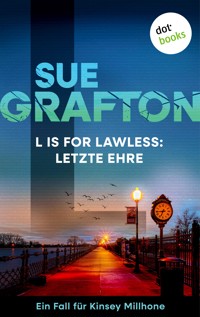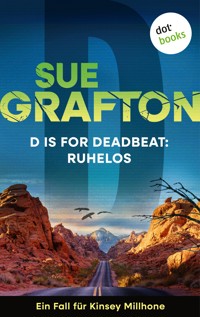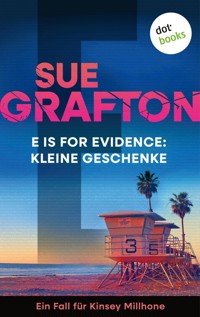
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kinsey Millhone
- Sprache: Deutsch
Der fünfte Fall für die kompetenteste Privatdetektivin der Westküste Herausforderungen ist die eigenwillige Ex-Polizistin und Privatdetektivin Kinsey Millhone gewöhnt. Doch ihr aktueller Fall wird für sie zur Belastungsprobe: Unerwartet landen 5.000 Dollar auf ihrem Bankkonto. Statt sich zu freuen, reagiert die Detektivin misstrauisch – zurecht, wie sich bald herausstellt. Denn ehe sie es sich versieht, wird sie beschuldigt, bestechlich zu sein. Als zu allem Überfluss noch zwei Morde in ihrem Umfeld geschehen, steht für Kinsey plötzlich alles auf dem Spiel – ihr Ruf, ihre Existenz, ihr Leben. Die Detektivin ist gezwungen in eigener Sache zu ermitteln, und erfährt schon bald, dass die Wurzeln des Komplotts über zwanzig Jahre in die Vergangenheit zurückreichen … »Klug, hart und gründlich … Kinsey Millhone ist ein Vergnügen.« The Bloomsbury Review Der fünfte Band einer der erfolgreichsten Krimiserien überhaupt, der unabhängig gelesen werden kann – ein packender Ermittlerkrimi für Fans der Bestsellerserien von Michael Connelly und Sara Paretsky. Im sechsten Band rollt Kinsey Millhone einen 17 Jahre alten Mordfall neu auf – und stößt auf frische Leichen … »Einer der besten Krimis.« – Amazon-Leser »Ein Pageturner.« – Amazon-Leser
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Herausforderungen ist die eigenwillige Ex-Polizistin und Privatdetektivin Kinsey Millhone gewöhnt. Doch ihr aktueller Fall wird für sie zur Belastungsprobe: Unerwartet landen 5.000 Dollar auf ihrem Bankkonto. Statt sich zu freuen, reagiert die Detektivin misstrauisch – zurecht, wie sich bald herausstellt. Denn ehe sie es sich versieht, wird sie beschuldigt, bestechlich zu sein. Als zu allem Überfluss noch zwei Morde in ihrem Umfeld geschehen, steht für Kinsey plötzlich alles auf dem Spiel – ihr Ruf, ihre Existenz, ihr Leben. Die Detektivin ist gezwungen in eigener Sache zu ermitteln, und erfährt schon bald, dass die Wurzeln des Komplotts über zwanzig Jahre in die Vergangenheit zurückreichen …
eBook-Neuausgabe Juli 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1988 unter dem Originaltitel »E is for Evidence« bei Henry Holt, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1989 unter dem Titel »E wie Eigennutz« bei Ullstein sowie 1996 in einer Neuausgabe unter dem Titel »Kleine Geschenke« bei Goldmann.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1988 by Sue Grafton
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1989 by Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt am Main – Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/dcorneli
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (fb)
ISBN 978-3-98952-977-9
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sue Grafton
E is for Evidence: Kleine Geschenke
Kriminalroman – Ein Fall für Kinsey Millhone 5
Aus dem Amerikanischen von Dagmar Hartmann
dotbooks.
Für meine beiden Mütter, die einstige und die gegenwärtige: Viv und Lillian
Die Autorin möchte sich bei folgenden Personen für ihre unschätzbare Hilfe bedanken: Steven Humphrey; Jim Hetherington, President, und Dorcas Lube, Office Manager, Hetherington, Inc.; Bruce Boller, First Vice President, Robert W Baird, Inc.; Joyce Mackewich und Kim Nelson von Montgomery, Fansler & Carlson Insurance; Dennis W. Leski; William Pasich; Robert Snowball; Caroline Ware, Santa Barbara Travel; Elisa Moran, Santa Barbara County Registrar of Voters; Kathleen Hotchkiss, Culinary Alliance and Bartenders Local 498; Anne Reid; Frank und Florence Clark; Lynn Herold, Ph. D., Senior Criminalist, Department of Chief Medical Examiner-Coroner, Los Angeles County; George Donner, A-I Tri-Counties Investigations; Detective Robert J. Lowry, Investigative Division, Santa Barbara Police Department, und Deputy Juan Tejeda, Santa Barbara County Sheriffs Department.
Kapitel 1
Es war Montag, der 27. Dezember. Ich saß in meinem Büro und versuchte, meine Stimmung loszuwerden, die schlecht war, ausgesprochen schlecht. Sie bestand zu gleichen Teilen aus Ärger und Unbehagen. Den Ärger hatte ein Brief von meiner Bank hervorgerufen. Sie wissen schon, einer von diesen Fensterumschlägen, durch die man das gelbe Papier sehen kann. Zuerst dachte ich, ich hätte mal wieder überzogen, aber was dann zum Vorschein kam, war ein Auszug von Freitag, dem 24. Dezember, über eine Einzahlung von 5000 Dollar auf mein Konto.
»Was zum Teufel ist das denn?«
Die Kontonummer stimmte, aber ich hatte kein Geld eingezahlt. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß Banken die am wenigsten hilfreichen Institutionen der Welt sind, und die Erkenntnis, daß ich unterbrechen mußte, was ich gerade tat, nur um deren Fehler auszubügeln, war fast mehr, als ich ertragen konnte. Ich schob den Brief beiseite und versuchte, mich wieder zu konzentrieren. Ich schickte mich an, den vorläufigen Bericht über einen Versicherungsfall zu schreiben, den ich hatte überprüfen sollen. Darcy, die Sekretärin der California Fidelity, hatte mir gerade am Telefon erklärt, Mac wolle die Akte umgehend vorgelegt haben. Im Geiste hatte ich schon einen bösen Vorschlag auf der Zunge, was sie meiner Meinung nach tun könnte, aber ich hielt den Mund und legte eine (wie ich fand) bewunderungswürdige Zurückhaltung an den Tag.
Ich wandte mich also wieder meiner tragbaren Smith-Corona zu, spannte das richtige Formular ein. Meine flinken Finger schwebten über den Tasten, während ich meine Notizen überflog. Und genau da blieb ich hängen. Irgendetwas stimmte nicht, aber ich kam nicht dahinter, was es war. Ich warf noch einen Blick auf den Kontoauszug.
Dann rief ich in der Bank an, hoffte, daß die Ablenkung mir helfen würde zu erkennen, was mich an der Situation bei Wood/Warren störte, einer Gesellschaft, die Hydrieröfen zur industriellen Verwendung herstellte. Da draußen hatte es am 19. Dezember gebrannt. Ein Lagerhaus war zerstört worden.
»Mrs. Brunswick, Kundenbetreuung. Kann ich Ihnen helfen?«
»Äh, ja, ich hoffe«, antwortete ich. »Ich habe gerade eine Nachricht Ihrer Bank erhalten. Danach habe ich letzten Freitag fünftausend Dollar auf mein Girokonto eingezahlt. Aber das habe ich nicht. Können Sie das klären?«
»Darf ich bitte Ihren Namen und Ihre Kontonummer haben?«
»Kinsey Millhone«, sagte ich und nannte ihr dann langsam und deutlich meine Kontonummer.
Sie bat mich zu warten, während sie ihre Daten im Computer abfragte. In der Zwischenzeit lauschte ich der Musik von »Good King Wenceslaus«. Ich persönlich habe das nie verstanden. Um welches Fest geht es dabei?
Mrs. Brunswick schaltete sich wieder ein. »Miss Millhone, ich begreife nicht ganz, wo das Problem ist, aber unsere Unterlagen weisen eine Bareinzahlung auf dieses Konto auf. Wie es scheint, wurde das Geld im Nachttresor eingeworfen.«
»Sie haben immer noch so etwas?« staunte ich.
»In unserer Filiale in der Innenstadt, ja.«
»Aber da muß ein Fehler vorliegen. Ich habe diesen Nachttresor nie auch nur gesehen. Ich benutze immer meine Scheckkarte, wenn ich nach Bankenschluß noch etwas brauche. Was machen wir jetzt?«
»Ich kann eine Kopie des Einzahlungsbeleges suchen«, schlug sie zögernd vor.
»Würden Sie das bitte tun? Weil ich nämlich letzten Freitag überhaupt nichts eingezahlt habe, und schon gar nicht fünftausend Dollar. Vielleicht hat jemand ein paar Ziffern auf dem Einzahlungsschein vertauscht, aber das Geld gehört bestimmt nicht mir.«
Sie notierte meine Telefonnummer und versprach, sich wieder mit mir in Verbindung zu setzen. Ich ahnte schon, daß mir noch unzählige Telefonate bevorstanden, ehe die Korrektur vorgenommen werden würde. Wenn nun jemand frisch-fröhlich Schecks auf diese fünftausend Dollar ausstellte?
Ich wandte mich wieder meiner Aufgabe zu und wünschte, mir wäre die Erleuchtung gekommen. Meine Gedanken sprangen herum. Die Akte betreffend den Brand bei Wood/Warren war vier Tage zuvor, am Donnerstag, dem 23., in meine Hände gelangt. Ich war mit meinem Vermieter, Henry Pitts, um vier Uhr verabredet, zu einem Abschiedsdrink. Danach sollte ich ihn zum Flughafen bringen. Er flog nach Michigan, um die Feiertage mit seiner Familie zu verbringen. Einige von denen nähern sich schon den Neunzig, sind aber immer noch frisch und munter und gut gelaunt. Henry ist zweiundachtzig, noch ein Kind, und er war wahnsinnig aufgeregt bei der Aussicht auf diese Reise.
Ich war an jenem Nachmittag also noch im Büro, hatte meinen Papierkram aufgearbeitet und mußte noch einige Zeit totschlagen. Ich ging auf meinen Balkon im ersten Stock hinaus und schaute nach rechts, auf das V des Pazifischen Ozeans, der am Fuß der State Street zu sehen war, zehn Blocks weiter abwärts. Wir sind hier in Santa Teresa, Kalifornien, fünfundneunzig Meilen nördlich von Los Angeles. Der Winter hier ist wunderschön, voller Sonnenschein und mit milden Temperaturen, leuchtenden Bougainvilleen, sanften Winden und Palmen, die mit ihren Wedeln den Möwen zuwinken, die über ihnen dahinsegeln.
Das Einzige, was auf Weihnachten hindeutete, das nur noch zwei Tage entfernt war, waren die Girlanden entlang den Hauptstraßen. Und natürlich waren die Geschäfte gestopft voll mit Käufern, und ein Trio der Heilsarmee tutete auf Trompeten »Deck the Halls«. Um fröhlicher zu werden, beschloß ich, meine Strategie für die beiden nächsten Tage auszuarbeiten.
Jeder, der mich kennt, wird Ihnen erklären, daß ich froh bin, nicht verheiratet zu sein. Ich bin weiblich, zweimal geschieden, keine Kinder und keine engen Familienbande. Von Beruf bin ich Privatdetektiv. Normalerweise bin ich vollkommen zufrieden mit dem, was ich tue. Es gibt Zeiten, da mache ich ewig Überstunden wegen eines Falles, dann wieder bin ich unterwegs, und dann wieder igele ich mich in meinem winzigen Apartment ein und lese tagelang. Wenn jedoch Feiertage vor der Tür stehen, habe ich festgestellt, daß ich mich selbst überlisten muß, damit das Fehlen von geliebten Personen keine Depression erzeugt. Thanksgiving war toll gewesen. Ich hatte den Tag mit Henry und ein paar von seinen Kumpeln verbracht. Sie hatten gekocht und Champagner getrunken und gelacht und Geschichten aus lang vergangenen Tagen erzählt, bis ich mir wünschte, ich wäre so alt wie sie und nicht so jung, wie ich bin, nämlich zweiunddreißig.
Jetzt verließ Henry die Stadt, und sogar Rosie, die die schmuddelige kleine Kneipe hat, in der ich oft esse, hatte bis zum 2. Januar geschlossen und weigerte sich, irgendjemandem zu verraten, was sie vorhatte. Rosie ist sechsundsechzig, Ungarin, klein, vollbusig und manchmal grob. Es war also nicht so, daß ich befürchtete, liebevollen Klatsch und Tratsch zu verpassen. Die Tatsache, daß sie ihre Kneipe schloß, war bloß eine weitere Erinnerung daran, daß ich ganz allein auf dieser Welt war und mich besser darum kümmerte, was ich nun tun wollte.
Auf jeden Fall beschloß ich nach einem Blick auf meine Armbanduhr, daß ich ebensogut heimfahren konnte. Ich schaltete den Anrufbeantworter ein, schnappte mir meine Jacke und meine Handtasche und sperrte gerade ab, als Darcy Pascoe, die Empfangsdame der Versicherungsgesellschaft nebenan, ihren Kopf durch die Tür steckte. Ich hatte früher ausschließlich für die California Fidelity gearbeitet, ganztags, hatte Brände untersucht und Betrugsfälle bei Lebensversicherungen. Jetzt haben wir ein inoffizielles Abkommen. Ich bin mehr oder weniger abrufbereit, erledige eine Anzahl von Untersuchungen für sie, und dafür habe ich meine Büroräume in der Innenstadt, die ich mir sonst nie leisten könnte.
»Mann, bin ich froh, daß ich dich noch erwischt hab’«, meinte Darcy. »Mac hat mir aufgetragen, dir das hier zu geben.«
Sie reichte mir eine Akte, auf die ich automatisch einen Blick warf. Das Blankoformular darin deutete darauf hin, daß ich einen Brand untersuchen sollte, den ersten seit Monaten.
»Mac hat das getan?« Mac ist der Vizepräsident von California Fidelity. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß er sich persönlich mit Routineunterlagen befaßte.
»Nun ja, eigentlich hat Mac sie Andy gegeben, und Andy hat mir gesagt, ich sollte sie dir geben.«
Am Deckel der Akte hing ein Notizzettel mit dem Datum von vor drei Tagen und dem Vermerk EILT. Darcy fing meinen Blick auf, und ihre Wangen röteten sich leicht.
»Die war unter einen Haufen Zeug auf meinem Schreibtisch gerutscht, sonst hätte ich sie dir schon früher gebracht«, entschuldigte sie sich. Darcy ist Ende Zwanzig und nimmt alles ein bißchen locker. Ich ging zu meinem Schreibtisch hinüber, warf die Akte auf ein paar andere, an denen ich arbeitete. Ich würde mich gleich am nächsten Morgen daranmachen. Darcy blieb an der Tür stehen. Sie erriet meine Absicht.
»Kannst du nicht heute schon damit anfangen? Ich weiß, daß er es eilig hat, daß jemand da rausfährt. Jewel sollte sich eigentlich darum kümmern, aber sie hat zwei Wochen Urlaub. Deshalb hat Mac gemeint, du könntest es übernehmen.«
»Worum geht es?«
»Ein großer Lagerbrand draußen in Colgate. Wahrscheinlich hast du in den Nachrichten davon gehört.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich war in L. A.«
»Na ja, die Zeitungsausschnitte sind auch da drin. Schätze, die wollen baldmöglichst jemanden da draußen.«
Ich war wütend über den Druck, aber ich öffnete den Aktendeckel noch einmal und überflog die Verlustanzeige, die zuoberst lag. »Wood/Warren?« sagte ich.
»Kennst du die Gesellschaft?«
»Ich kenne die Woods. Bin mit der jüngsten Tochter zur High-School gegangen. Wir waren in derselben Klasse.«
Sie sah erleichtert aus, als hätte ich gerade ein Problem für sie gelöst. »Toll. Ich erzähle Mac, daß du vielleicht heute nachmittag noch rausfährst.«
»Darcy, würdest du das bitte sein lassen? Ich muß jemanden zum Flughafen bringen. Aber vertrau mir. Ich mache eine Verabredung für den frühestmöglichen Zeitpunkt aus.«
»Oh. Na gut, dann schreibe ich eine Notiz, damit sie wissen, daß du dich drum kümmerst. Ich muß zurück ans Telefon. Sag mir Bescheid, wenn du den Bericht fertig hast, dann hole ich ihn ab.«
»Prima«, murmelte ich. Sie mußte zu dem Entschluß gekommen sein, sie hätte mich weit genug getrieben, denn sie entschuldigte sich und verschwand eiligst.
Kaum war sie gegangen, als ich bei Wood/Warren anrief, nur um die Sache hinter mich zu bringen. Ich verabredete ein Treffen mit dem Präsidenten der Gesellschaft, Lance Wood, für 9 Uhr am folgenden Morgen, dem Heiligabend.
Inzwischen war es 15 Uhr 45, und ich stopfte die Akte in meine Handtasche, sperrte ab und eilte über die Hintertreppe zum Parkplatz, wo ich meinen VW abgestellt hatte. Zehn Minuten später war ich daheim.
Bei unserer kleinen Vorweihnachtsfeier schenkte Henry mir einen neuen Roman von Len Deighton, und er bekam von mir einen blauen Mohairschal, den ich selbst gehäkelt hatte – kaum jemand weiß, daß ich über dieses Talent verfüge. Wir hockten in der Küche und aßen eine halbe Platte seiner selbstgemachten Zimtrollen, und dazu tranken wir Champagner aus den Kristallflöten, die ich ihm ein Jahr zuvor geschenkt hatte.
Er holte sein Flugticket heraus und überprüfte noch einmal die Abflugzeit. Seine Wangen waren vor Erwartung gerötet. »Ich wünschte, du würdest mitkommen«, sagte er. Er hatte den Schal um den Hals gewickelt; die Farbe betonte seine Augen. Sein weißes Haar war weich und zu einer Seite gebürstet, sein schmales Gesicht war von der kalifornischen Sonne gebräunt.
»Ich wünschte, das könnte ich; nur habe ich gerade einen Auftrag übernommen, um meine Miete zahlen zu können«, erklärte ich. »Aber du kannst eine Unmenge Fotos machen und sie mir zeigen, wenn du wiederkommst.«
»Was ist mit dem Weihnachtsabend? Du bist doch hoffentlich nicht allein.«
»Henry, würdest du bitte aufhören, dir Sorgen zu machen? Ich habe eine Menge Freunde.« Wahrscheinlich würde ich den Tag allein verbringen, aber ich wollte nicht, daß er sich Gedanken machte.
Er hielt einen Finger hoch. »Moment mal. Das hätte ich fast vergessen. Ich habe ja noch ein kleines Geschenk für dich.« Er ging zu dem Tisch neben der Spüle hinüber und holte etwas Grünzeug in einem kleinen Topf. Den stellte er vor mich hin und lachte, als er den Ausdruck auf meinem Gesicht sah. Es sah aus wie ein Farn und roch wie alte Socken.
»Das ist ein Farn«, erklärte er. »Diese Art lebt allein von der Luft. Du mußt ihn nicht einmal gießen.«
Ich starrte auf die feinziselierten Blätter, die von einem fast durchscheinenden Grün waren und aussahen, als stammten sie aus einem Raumschiff. »Kein Dünger?«
Er schüttelte den Kopf. »Stell ihn einfach nur hin.«
»Ich muß mir keine Gedanken machen, daß er zuwenig Licht bekommt oder daß ich ihn zurückschneiden muß?« Ich warf mit diesen Ausdrücken um mich, als wüßte ich, was sie zu bedeuten hätten. Ich habe eine äußerst ungeschickte Hand mit Pflanzen und habe seit Jahren jeden Drang unterdrückt, mir eine anzuschaffen.
»Nichts. Der Farn soll dir Gesellschaft leisten. Stell ihn dir auf den Schreibtisch. Dadurch wird alles ein bißchen freundlicher.«
Ich hielt den kleinen Topf hoch und inspizierte die Pflanze von allen Seiten, wobei der erste beunruhigende Funken von Besitzerstolz in mir erwachte. Ich mußte in noch schlechterer Verfassung sein, als ich dachte.
Henry fischte seinen Schlüsselbund aus der Hosentasche und schob ihn mir zu. »Falls du in meine Wohnung mußt«, meinte er.
»Prima. Ich bringe die Post und die Zeitungen hinein. Soll ich sonst noch irgendetwas erledigen, während du fort bist? Ich könnte den Rasen mähen.«
»Nicht nötig. Ich habe dir die Nummer dagelassen, unter der ich zu erreichen bin, sollte ›Das Große‹ wieder zuschlagen. Einen anderen Grund könnte ich mir nicht denken.«»Das Große« – damit meinte er das Erdbeben, das wir alle fast täglich erwarten, seit dem letzten von 1925.
Wieder ein Blick auf die Uhr. »Wir machen uns wohl besser auf den Weg. In diesen Tagen ist der Flughafen immer voll.« Sein Flugzeug ging zwar erst um 19 Uhr, wir hatten also noch anderthalb Stunden Zeit für den Zwanzig-Minuten-Weg zum Flughafen, aber es hatte keinen Sinn zu streiten. Der Süße. Wenn er warten mußte, dann konnte er es ebensogut am Flughafen tun und sich glücklich mit den Mitreisenden unterhalten.
Ich zog meine Jacke an, während Henry noch einmal durchs Haus ging. Er brauchte ein paar Minuten, um die Heizung herunterzuschalten und sich zu vergewissern, daß alle Fenster und Türen gesichert waren. Dann nahm er seinen Mantel und seinen Koffer, und wir brachen auf.
Um 17 Uhr 15 war ich wieder daheim. Ich hatte noch immer einen Kloß im Hals. Ich hasse es, mich von Leuten zu verabschieden, und ich hasse es, zurückgelassen zu werden. Es wurde inzwischen dunkel, und die Luft war kalt geworden. Ich schloß auf und betrat meine Wohnung. Mein Apartment war früher Henrys Einzelgarage gewesen. Es mißt etwa fünf Meter im Quadrat, mit einem kleinen Anbau auf der rechten Seite, der mir als Küche dient. Ich habe die Möglichkeit, meine Wäsche zu waschen, und habe auch eine Naßzelle. Der Raum ist geschickt so aufgeteilt, daß der Eindruck entsteht, ich hätte Wohnzimmer, Eßzimmer und Schlafzimmer, wenn ich erst einmal mein Schlafsofa ausklappe. Und ich habe mehr als genug Platz für die paar Sachen, die ich besitze.
Wenn ich mein winziges Königreich betrachte, erfüllt mich das für gewöhnlich mit Befriedigung, aber heute kämpfte ich noch mit einem Hauch vorweihnachtlicher Depression, und meine Wohnung erschien mir düster und eng. Ich schaltete ein paar Lampen an. Dann stellte ich den Farn auf meinen Schreibtisch. Hoffnungsvoll wie immer hörte ich meinen Anrufbeantworter ab, aber niemand hatte eine Nachricht hinterlassen. Die Stille machte mich unruhig. Ich drehte das Radio an – Bing Crosby sang von einer weißen Weihnacht, wie er sie von früher kannte. Ehrlich gesagt habe ich noch nie weiße Weihnachten erlebt, aber ich begriff das Wesentliche und stellte das Radio wieder ab.
Ich hockte mich auf einen Küchenstuhl und konzentrierte mich auf die Signale aus meinem Innern. Hunger! Das ist einer der Pluspunkte, wenn man allein ist: Man kann essen, wann immer man will. Zum Abendessen bereitete ich mir an diesem Abend ein Sandwich aus Oliven-Pfeffer-Käse auf Weizenvollkornbrot. Es ist mir immer wieder ein Trost zu wissen, daß die Käsemarke, die ich kaufe, noch immer genauso schmeckt wie damals, als ich sie im Alter von dreieinhalb Jahren zum ersten Mal gegessen habe. Resolut drängte ich dieses Thema beiseite, denn es hing mit meinen Eltern zusammen, die ums Leben kamen, als ich fünf war. Ich schnitt das Sandwich in vier Teile, wie ich es immer tat, schenkte mir ein Glas Weißwein ein und trug meinen Teller zum Sofa hinüber, wo ich das Buch aufschlug, das Henry mir zu Weihnachten geschenkt hatte. Ich warf einen Blick auf die Uhr.
Es war 18 Uhr. Das würden zwei sehr lange Wochen werden.
Kapitel 2
Am nächsten Morgen, dem 24. Dezember, joggte ich drei Meilen, duschte, aß eine Schüssel Cornflakes, packte alles, was ich brauchte, in eine Stofftasche und machte mich um 8.45 Uhr auf den Weg nach Colgate, das eine schnelle Zehn-Meilen-Fahrt entfernt lag. Beim Frühstück hatte ich noch einmal die Akte durchgesehen und fragte mich bereits, warum es so eilig war. In dem Zeitungsartikel hieß es, daß das Lagerhaus ausgebrannt war, aber es gab keine vielsagende Schlußzeile über Brandstiftung und Untersuchungen, die noch im Gange wären, und auch keine Spekulationen dahingehend, daß der Brand verdächtig gewesen sei. Der Bericht der Feuerwehr war ebenfalls dabei, und den las ich zweimal. Es sah alles nach Routine aus. Offenbar lag der Ursprung des Feuers in einem Fehler der elektrischen Anlage, der gleichzeitig auch die Sprinkleranlage außer Betrieb gesetzt hatte. Da es sich bei den Materialien, die in dem zweistöckigen Gebäude untergebracht waren, hauptsächlich um Papierwaren handelte, hatte sich das Feuer um 2.00 Uhr nachts schnell ausgebreitet. Der Einsatzleiter der Feuerwehr erklärte, daß es keine Spuren von Benzin oder anderen Brennstoffen gab und auch keine Hindernisse, die die Arbeit der Feuerwehr erschwert hätten. Nichts wies darauf hin, daß Türen oder Fenster offengelassen worden wären, um günstigen Zug zu erzeugen, und auch sonst gab es keinen Hinweis auf einen Vorsatz. Ich hatte Dutzende von Berichten wie diesen gelesen. Was war also hier so wichtig? überlegte ich. Vielleicht war mir ein wesentliches Detail entgangen, aber soweit ich sehen konnte, handelte es sich um einen Standardfall. Ich schätzte, daß jemand bei Wood/Warren Druck auf die California Fidelity ausübte, damit sie die Angelegenheit schnell regelte, und das erklärte vielleicht Andys Panik. Er ist immer auf Lob aus, hat Angst vor Kritik und steckt nach allem, was ich so höre, mitten in einer schlimmen Krise mit seiner Frau. Wahrscheinlich war er die Quelle des leichten Anflugs von Hysterie, der diesen Fall begleitete. Vielleicht verließ sich Mac auch auf ihn.
Colgate ist die Schlafstadt, die sich an Santa Teresa anschließt. Hier gibt es Wohnungen, die sich die durchschnittliche, arbeitende Bevölkerung leisten kann. Während neue Bauwerke in Santa Teresa den strengen Vorschriften der Baubehörde unterliegen, folgt man in Colgate keinem bekannten Plan, und so lassen sich die Häuser kaum beschreiben. Es gibt eine Hauptstraße, gesäumt von Donut-Läden, Fast-Food-Restaurants, Schönheitssalons und Möbelgeschäften, die sich auf Furnier und Plastik, Velours und Kunstleder spezialisiert haben. Von dieser Durchgangsstraße erstrecken sich Wohntrakte in alle Richtungen. Die Häuser erinnern an die konzentrischen Ringe auf einem Baumstumpf, ziehen sich spiralförmig Dekade um Dekade immer weiter bis nach außen, wo die neuesten Häuser aufs offene Land vordringen oder das, was noch davon übrig ist. Hier und da kann man an verlassenen Fleckchen noch Zeichen der alten Zitrushaine sehen, die dort einmal blühten.
Das Firmengelände von Wood/Warren lag in einer Seitenstraße, die zu einem verlassenen Autokino führt, das jetzt am Wochenende als Flohmarkt dient. Die Rasenflächen vor den benachbarten Fabrikgebäuden waren kurz geschnitten, und die Büsche waren zu perfekten Würfeln gestutzt. Ich fand einen Parkplatz vor dem Haus und stieg aus. Das Gebäude war ein gedrungenes Haus, anderthalb Stockwerke hoch, aus weißem Putz und Feldsteinen. Das Lagerhaus selbst lag zwei Blöcke entfernt. Ich würde die Brandstätte besichtigen, wenn ich mit Lance Wood gesprochen hatte.
Die Eingangshalle war klein und einfach, ausgestattet mit einem Schreibtisch, einem Bücherregal und einer vergrößerten Fotografie des FlFA-5000-Ofens, dem das Unternehmen sein Vermögen verdankte. Er sah aus wie ein übergroßer Küchenherd mitsamt Edelstahltresen und eingebauter Mikrowelle. Aus der säuberlich gerahmten Liste daneben gingen die technischen Daten des FIFA 5000 hervor.
Hinter mir kehrte die Empfangsdame mit einer frischen Tasse Kaffee und einer Styroporpackung an ihren Platz zurück, die nach Würstchen und Eiern roch. Das Plastikschild auf ihrem Tisch verriet mir, daß ihr Name Heather war. Sie war Mitte Zwanzig und hatte anscheinend noch nichts über die Gefahren von Cholesterin und Fett gehört. Letzteres würde sie schon bald an sich entdecken.
»Kann ich Ihnen helfen?« Ihr Lächeln enthüllte die Spangen an ihren Zähnen. Ihr Gesicht war noch gerötet, weil sie am Vorabend eine Aknemaske aufgetragen hatte, die aber bislang noch nicht viel Wirkung zeigte.
»Ich bin für neun Uhr mit Lance Wood verabredet«, erklärte ich. »Ich arbeite für die California-Fidelity-Versicherung.«
Ihr Lächeln verblaßte ein wenig. »Sie untersuchen die Brandstiftung?«
»Nun, ich bin hier wegen des Anspruchs auf Feuerversicherung«, verbesserte ich sie und überlegte, ob sie der irrigen Ansicht war, »Brandstiftung« und »Brand« seien gleichbedeutend.
»Oh. Mr. Wood ist noch nicht da, aber er muß jeden Augenblick kommen.« Die Spangen verliehen ihrer Aussprache ein Lispeln, das sie amüsierte, wenn sie sich selbst hörte. »Kann ich Ihnen einen Kaffee bringen, während Sie warten?«
Ich schüttelte den Kopf. Es gab einen Stuhl, und auf den setzte ich mich und vergnügte mich damit, eine Broschüre über einen anderen Schmelzofen durchzublättern. Diese Leute hier hatten etwa genausoviel zu lachen wie ich daheim, wo meine Hauptunterhaltungsquelle ein Buch über die praktischen Aspekte der Ballistik, über Feuerwaffen und kriminalistische Techniken ist.
Durch eine Tür zu meiner Linken konnte ich ein paar Büroangestellte sehen, lässig gekleidet und geschäftig, aber irgendwie düster. Ich spürte nichts von Kameradschaft zwischen ihnen, aber vielleicht läßt die Herstellung von Industrieöfen nicht die Art gutmütiger Neckerei aufkommen, wie ich sie von der California Fidelity her kannte. Zwei Schreibtische waren leer.
Man hatte den Versuch gemacht, alles weihnachtlich zu dekorieren. Ein künstlicher Baum stand auf der anderen Seite der Halle, groß und skelettähnlich und mit bunten Ornamenten behängt. Wie es schien, waren keinerlei Lichter an dem Baum befestigt, was ihm ein lebloses Aussehen verlieh und die Einheitlichkeit der Äste, die in vorgebohrte Löcher im Aluminiumstamm gesteckt worden waren, noch hervorhob. Die Wirkung war deprimierend. Nach der Information, die ich erhalten hatte, betrug der Umsatz von Wood/Warren jährlich über fünfzehn Millionen Dollar. Warum hatten sie sich nur keine echte Tanne geleistet?
Heather schenkte mir ein verlegenes Lächeln und fing an zu essen. Das Anschlagbrett hinter ihr war mit Girlanden aus Lametta geschmückt und mit Schnappschüssen der Besitzerfamilie und der Belegschaft bedeckt. F-R-Ö-H-L-I-C-H-E W-E-I-H- N-A-C-H-T-E-N stand in glänzenden, gekauften Silberbuchstaben darunter.
»Darf ich mir das mal ansehen?« fragte ich und deutete auf die Collage.
Sie hatte inzwischen den Mund voll Croissant, brachte aber dennoch eine Zustimmung zustande, indem sie eine Hand vor den Mund hielt, um mir den Anblick des gekauten Essens zu ersparen. »Nur zu.«
Die meisten Fotos zeigten Angestellte der Firma, von denen ich einige schon gesehen hatte. Auch Heather war auf einem der Fotos, ihr blondes Haar war viel kürzer, ihr Gesicht wies noch den Babyspeck auf. Die Spangen an ihren Zähnen repräsentierten wohl das letzte Überbleibsel ihrer Teenager-Zeit. Wood/Warren mußte sie gleich nach der High-School angestellt haben.
Auf einem Foto standen vier Knaben in den Overalls der Fabrik als lockere Gruppe auf der Treppe. Einige Fotos wirkten steif und gestellt, aber größtenteils drückten sie so etwas wie guten Willen aus, den ich im Augenblick allerdings nicht feststellen konnte. Linden »Woody« Wood, der Gründer, war zwei Jahre zuvor gestorben, und ich fragte mich, ob ein Teil des Frohsinns diese Firma mit seinem Hinscheiden wohl verlassen hatte.
Die Woods selber bildeten das Mittelstück. Es handelte sich um ein Porträt, das im Heim der Familie aufgenommen zu sein schien. Linden stand da, eine Hand auf der Schulter seiner Gemahlin. Die fünf erwachsenen Kinder waren um ihre Eltern gruppiert. Lance hatte ich nie zuvor gesehen, aber ich kannte Ash, weil ich mit ihr auf der High-School gewesen war. Olive, die ein Jahr älter war, hatte die Santa Teresa High-School kurz besucht, war dann in ihrem letzten Schuljahr aber in ein Internat geschickt worden. Wahrscheinlich hatte das mit einem kleinen Skandal zu tun, aber ich war mir nicht sicher, worum es damals gegangen war. Die älteste der fünf war Ebony, die inzwischen fast vierzig sein mußte. Ich erinnerte mich, gehört zu haben, daß sie irgendeinen reichen Playboy geheiratet hatte und jetzt in Frankreich lebte. Der Jüngste war ein Sohn namens Bass, nicht ganz dreißig, verantwortungslos, rücksichtslos, als Schauspieler ein Versager und als Musiker ohne Talent. Das letzte, was ich gehört hatte, war, daß er jetzt in New York lebte. Acht Jahre zuvor hatte ich ihn durch meinen Exmann Daniel, einen Jazzpianisten, flüchtig kennengelernt. Bass war das schwarze Schaf der Familie. Welche Geschichte Lance hatte, wußte ich nicht.
Als ich ihm sechsundsechzig Minuten später an seinem Schreibtisch gegenübersaß, begriff ich allmählich. Lance war um 9.30 Uhr eingetroffen. Die Empfangsdame sagte ihm, wer ich war. Er stellte sich vor, und wir schüttelten uns die Hände. Er erklärte, er hätte noch einen kurzen Anruf zu erledigen und käme dann sofort zu mir. Ich sagte »Schön«, und dann sah ich nichts mehr von ihm bis 10.16 Uhr. Da hatte er inzwischen sein Jackett abgelegt, den Schlips gelockert und den obersten Knopf an seinem Hemd geöffnet. Er saß, die Füße auf dem Schreibtisch, und sein Gesicht glänzte ölig im fluoreszierenden Neonlicht. Er mußte Ende Dreißig sein, wirkte aber älter. Die Kombination aus Jähzorn und Unzufriedenheit hatte Falten um seinen Mund eingegraben, hatte das klare Braun seiner Augen verdorben und den Eindruck eines Mannes hinterlassen, der vom Schicksal hart gefordert wird. Sein Haar war hellbraun, am Scheitel dünner, und er hatte es streng nach hinten gekämmt. Ich hielt die Sache mit dem Telefonat für Quatsch. Mir kam er wie ein Mann vor, der sich damit wichtig machen muß, daß er andere Leute warten läßt. Sein Lächeln war selbstzufrieden, und die Energie, die er ausstrahlte, war unterlegt mit Spannung.
»Entschuldigen Sie die Verspätung«, begann er. »Was kann ich für Sie tun?« Er hatte sich in seinem Drehsessel zurückgelehnt und die Schenkel gespreizt.
»Soviel ich weiß, haben Sie einen Anspruch auf Verlust durch Brand angemeldet.«
»Das ist richtig. Und glauben Sie mir, ich verlange nichts, was mir nicht zusteht.«
Ich murmelte etwas Nichtssagendes vor mich hin und hoffte, daß ich die Tatsache verbarg, daß ich mißtrauisch geworden war. Jeder Versicherungsbetrüger, dem ich je gegenübergesessen habe, hatte genau dasselbe gesagt, bis hin zu dem frommen kleinen Kopfnicken. Ich zog meinen Kassettenrecorder heraus, schaltete ihn an und stellte ihn auf den Tisch. »Die Gesellschaft verlangt, daß ich dieses Interview mitschneide«, erklärte ich.
»Das ist schon in Ordnung.«
Meine nächsten Bemerkungen richtete ich an den Recorder, nannte meinen Namen, die Tatsache, daß ich für die California Fidelity arbeitete, Datum und Uhrzeit des Interviews und erklärte, daß ich mit Lance Wood in seiner Eigenschaft als Präsident von Wood/Warren sprach, nannte die Anschrift der Gesellschaft und erklärte die Art des Verlustes.
»Mr. Wood, es ist Ihnen bekannt, daß dieses Gespräch aufgezeichnet wird«, sagte ich zu dem Recorder.
»Ja.«
»Und ich habe Ihre Erlaubnis, die Unterhaltung mitzuschneiden, die wir jetzt führen werden?«
»Ja, ja«, sagte er und vollführte dabei diese kleine Drehbewegung mit der Hand, die sagen will: »Lassen Sie uns endlich anfangen.«
Ich warf einen Blick auf die Akte. »Können Sie mir etwas über die Umstände berichten, unter denen der Brand im Lagerhaus von Wood/Warren in 606 Fairweather am 19. Dezember dieses Jahres stattfand?«
Er rutschte ungeduldig hin und her. »Offen gesagt, ich war nicht in der Stadt, aber nach allem, was man mir erzählt hat ...«
Das Telefon summte, und er packte den Hörer und bellte wie ein Hund hinein: »Ja?«
Es gab eine Pause. »Ja, verdammt, stellen Sie sie durch.« Er warf mir einen kurzen Blick zu. »Nein, warten Sie. Ich nehme es draußen an.« Er legte auf, entschuldigte sich brüsk und verließ das Zimmer. Ich schaltete den Recorder aus und berichtigte im Geiste den ersten Eindruck, den ich von ihm gehabt hatte. Er wurde um die Taille herum schwer, und seine Gabardinehose war ungünstig hochgerutscht. Sein Hemd klebte mitten auf dem Rücken. Er stank nach Schweiß – nicht nach dem sauberen, animalischen Schweiß, wie ihn harte körperliche Arbeit hervorruft, sondern nach dem stechenden, etwas abstoßenden Geruch von Streß. Seine Haut war bleich, und irgendwie sah er ungesund aus.
Ich wartete fünfzehn Minuten und schlich dann auf Zehenspitzen zur Tür. Die Empfangshalle war verlassen. Von Lance Wood war weit und breit nichts zu sehen. Ebensowenig von Heather. Ich ging weiter zu der Tür, die ins innere Büro führte. Aus dem Augenwinkel erhaschte ich einen Blick auf jemanden, der sich auf der Rückseite des Gebäudes bewegte und sehr nach Ebony aussah, aber ich war mir nicht sicher. Eine Frau blickte zu mir auf. Der Name auf ihrem Schreibtisch wies sie als Ava Daugherty aus, die Bürovorsteherin. Sie war Ende Vierzig, mit einem kleinen Gesicht und einer Nase, die aussah, als hätte ein Chirurg sie gemacht. Ihr Haar war kurz und schwarz, mit dem Glanz von Haarspray. Sie war über irgendetwas traurig, möglicherweise über die Tatsache, daß sie gerade einen ihrer leuchtendroten Acrylfingernägel abgebrochen hatte.
»Ich sollte mich mit Lance Wood treffen, aber er ist verschwunden. Wissen Sie, wohin er gegangen ist?«
»Er hat das Werk verlassen.« Sie leckte versuchsweise über den gesplitterten Nagel, als könnte ihre Spucke ihn wieder kleben.
»Er ist gegangen?«
»Das sagte ich doch.«
»Hat er gesagt, wann er zurück sein würde?«
»Mr. Wood berät sich nicht mit mir«, erwiderte sie schnippisch. »Wenn Sie Ihren Namen hinterlassen, nimmt er bestimmt Kontakt mit Ihnen auf.«
Eine Stimme unterbrach sie. »Stimmt was nicht?«
Wir sahen beide auf. Ein dunkelhaariger Mann stand in der Tür hinter mir. Ava Daughertys Verhalten wurde etwas weniger feindselig. »Das ist der Vizepräsident der Gesellschaft«, erklärte sie mir, und dann, zu ihm gewandt: »Sie sollte sich mit Lance treffen, aber er hat die Fabrik verlassen.«
»Terry Kohler«, stellte er sich mir vor und hielt mir die Hand hin. »Ich bin Lance Woods Schwager.«
»Kinsey Millhone, von der California Fidelity«, sagte ich und schüttelte ihm die Hand. »Freut mich, Sie kennenzulernen.« Sein Händedruck war fest und heiß. Er war drahtig, mit dunklem Schnurrbart und großen, dunklen Augen, aus denen Intelligenz sprach. Er mußte Anfang Vierzig sein. Ich fragte mich, mit welcher Schwester er verheiratet war.
»Um welches Problem geht es? Kann ich helfen?«
Ich erzählte ihm kurz, warum ich hier war, und berichtete auch, daß Lance Wood mich ohne ein Wort der Erklärung verlassen hatte.
»Warum zeige ich Ihnen nicht einfach das Lagerhaus?« schlug er vor. »Dann können Sie sich wenigstens den Ort des Brandes ansehen. Ich nehme an, das gehört auch zu Ihren Aufgaben.«
»Das wäre nett. Ist sonst irgendjemand hier draußen berechtigt, mir die Information zu geben, die ich benötige?«
Terry Kohler und Ava Daugherty wechselten einen Blick, den ich nicht deuten konnte.
»Da warten Sie besser auf Lance«, meinte er. »Moment, vielleicht kann ich herausbekommen, wohin er gegangen ist.« Er ging ins andere Büro hinüber.
Ava und ich mieden Small Talk. Sie öffnete die obere rechte Schreibtischschublade und holte eine Tube Crazy Glue hervor. Sie ignorierte mich betont auffällig, als sie die Spitze abknipste und einen durchsichtigen Tropfen auf ihren gesprungenen Nagel drückte. Sie runzelte die Stirn. Ein langes, dunkles Haar hatte sich im Klebstoff verfangen, und ich beobachtete ihren Kampf, als sie es herausziehen wollte.
Ich schaltete mich in die Unterhaltung ein, die drei Ingenieure hinter mir führten. Es handelte sich um eine Diskussion über das Problem, das vor ihnen lag. Da ich davon ohnehin nichts verstand, schaltete ich mich wieder aus.
Noch weitere zehn Minuten vergingen, ehe Terry Kohler wieder auftauchte. Er schüttelte in offensichtlicher Verzweiflung den Kopf.
»Ich weiß nicht, was hier vorgeht«, sagte er. »Lance mußte wegen eines Notfalls fort, und Heather ist immer noch nicht wieder an ihrem Platz.« Er hielt ein Schlüsselbund hoch. »Ich bringe Sie zum Lagerhaus hinüber. Sagen Sie Heather, daß ich die Schlüssel hab’, wenn sie wieder auftaucht.«
»Ich muß meinen Fotoapparat holen«, meinte ich. »Er ist in meiner Handtasche.«
Er trabte geduldig neben mir her in Lance Woods Büro, wo ich meine Kamera holte, meine Brieftasche in meinen Beutel steckte und die Handtasche ließ, wo sie war.
Zusammen gingen wir dann wieder durch das Vorzimmer und die anderen Büros. Niemand sah auch nur auf, als wir vorbeigingen, aber neugierige Blicke folgten uns stumm. Ich mußte an diese Porträts denken, bei denen man auch immer den Eindruck hat, die Augen würden sich bewegen.
Die Montagearbeit wurde in einem großen, gut belüfteten Bereich der hinteren Hälfte des Gebäudes geleistet. Die Wände bestanden hier aus Wellblech, der Boden aus Beton.
Wir blieben nur einmal stehen, als Terry mich einem Mann namens John Salkowitz vorstellte. »John ist Chemieingenieur und Berater«, erkärte er mir. »Er ist seit sechsundsechzig bei uns. Wenn Sie irgendwelche Fragen bezüglich hoher Temperaturen haben, dann ist er Ihr Mann.«
Aus dem Stegreif fiel mir keine ein – aber Terry ging auch schon weiter auf die rückwärtige Tür zu, und ich trottete hinter ihm her.
Rechts von uns lag eine doppelbreite Schiebetür aus Stahl. Sie ließ sich nach oben schieben, um eintreffende Ladungen zuzulassen oder um die Teile zu verladen, die versandfertig waren.
Wir traten auf die Straße hinaus und liefen auf die andere Seite hinüber.
»Mit welcher der Wood-Schwestern sind Sie verheiratet?« erkundigte ich mich. »Ich bin mit Ash zur Schule gegangen.«
»Mit Olive«, antwortete er lächelnd. »Wie war doch Ihr Name?«
Ich sagte es ihm, und für den Rest des kurzen Weges unterhielten wir uns, verstummten erst, als die verkohlten Überreste des Lagerhauses in Sichtweite kamen.
Kapitel 3
Ich brauchte drei Stunden, um die Stätte des Brandes zu untersuchen. Terry machte sich die Mühe, die Vordertür aufzusperren, obwohl das angesichts der Zerstörung, die das Feuer angerichtet hatte, lächerlich schien. Der größte Teil der äußeren Hülle des Gebäudes stand noch, aber der erste Stock war eingestürzt, lag jetzt im Erdgeschoß, und das Ergebnis war eine nahezu undurchdringliche Masse aus geschwärztem Müll. Die Scheiben der Fenster im ersten Stock waren durch die Hitze gesprungen. Metallrohre lagen frei, viele von ihnen verbogen durch das Gewicht der nach innen einstürzenden Mauern. Was an erkennbaren Gegenständen blieb, war auf abstrakte Umrisse reduziert worden. Farben oder sonstige Details waren nicht mehr zu erkennen.
Als er merkte, daß ich eine ganze Weile dort zu tun haben würde, entschuldigte sich Terry. Wood/Warren hörte an diesem Tag früher auf, weil es Heiligabend war. Er erklärte, wenn ich früh genug fertig würde, wäre ich eingeladen, etwas Punsch mit ihnen zu trinken und Weihnachtskekse zu essen Ich hatte bereits mein Maßband herausgeholt, außerdem Notizbuch, Zeichenblock und Bleistifte und entwarf im Geiste eine Liste, in welcher Reihenfolge ich vorgehen wollte. Ich bedankte mich bei ihm und bemerkte kaum, daß er ging.
Ich umkreiste das Gebäude, entdeckte die Bereiche, wo es am stärksten gebrannt hatte, überprüfte die Fensterrahmen im ersten Stock auf Spuren eines gewaltsamen Eindringens. Ich war mir nicht sicher, wann die Aufräumungsmannschaft eintreffen würde, aber da es keine offensichtlichen Hinweise auf Brandstiftung gab, konnte ich mir nicht vorstellen, daß California Fidelity eine Verzögerung erwirken könnte. Montag morgen wollte ich Lance Woods finanzielle Lage überprüfen, nur um sicherzugehen, daß nicht Profitgier als Motiv hinter dem Brand selbst steckte ... in diesem Fall war das eine reine Formsache, da der Einsatzleiter der Feuerwehr in seinem Bericht Brandstiftung bereits ausgeschlossen hatte. Da dies wahrscheinlich die einzige Gelegenheit war, die wir bekommen würden, um alles zu untersuchen, fotografierte ich alles und verschoß dabei zwei Filme mit jeweils vierundzwanzig Aufnahmen.
Soweit ich erkennen konnte, lag der Ursprung des Feuers irgendwo in der Nordwand, was im Einklang mit der Theorie eines Kurzschlusses zu stehen schien. Ich würde das Diagramm der Leitung auf den Bauplänen einsehen müssen, aber ich vermutete, daß der Einsatzleiter genau das getan hatte und so zu seiner Analyse gekommen war. Die Oberfläche des verkohlten Holzes wies das typische Muster von Rissen auf, wobei die am stärksten verkohlte Stelle und der kleinste Riß im Muster sich in diesem hinteren Teil des Gebäudes befanden. Da heiße Luft aufstieg und Flammen normalerweise nach oben schlagen, ist es für gewöhnlich möglich, den Verlauf eines Brandes nachzuvollziehen. Die Flammen neigen dazu, nach oben zu züngeln, bis sie an ein Hindernis stoßen, und sich dann horizontal auszubreiten, auf der Suche nach anderen, vertikalen Ausgängen.
Ein Großteil der Inneneinrichtung war zu Asche geworden. Die tragenden Wände standen noch, schwarz und spröde wie Schlacke. Vorsichtig suchte ich mir einen Weg durch das verkohlte Zeug, fertigte eine detaillierte Zeichnung der Ruinen an, notierte den Grad der Verbrennung, das Aussehen im Allgemeinen, wie stark die verbrannten Gegenstände jeweils verkohlt waren. Jede Oberfläche, der ich mich gegenübersah, war von der schwarzen und aschenen Fahlheit extremer Hitze überzogen. Der Geruch war mir vertraut: verbranntes Holz, Ruß, der Gestank durchweichten Isoliermaterials, und über allem hing der chemische Duft von ganz gewöhnlichen Stoffen, die auf ihre Grundelemente reduziert worden sind. Da war auch noch ein anderer Geruch, den ich zwar bemerkte, aber nicht identifizieren konnte. Wahrscheinlich hing er mit den Materialien zusammen, die hier gelagert worden waren. Als ich Lance Wood am Vortag angerufen hatte, hatte ich um eine Kopie der Inventarliste gebeten. Ich wollte sie noch einmal überprüfen. Vielleicht konnte ich die Quelle dieses Geruches herausfinden. Es gefiel mir zwar nicht sonderlich, daß ich die Brandstätte überprüfen mußte, ehe ich Gelegenheit hatte, mit ihm zu sprechen, aber mir schien keine Wahl zu bleiben, nachdem er jetzt verschwunden war. Vielleicht würde er zur Weihnachtsfeier im Büro wiederkommen, und ich könnte ihn dann auf ein Gespräch gleich Montag früh festnageln.
Um 14 Uhr klappte ich meinen Skizzenblock zu und bürstete meine Jeans ab. Meine Tennisschuhe waren fast weiß von der Asche, und ich vermutete, daß mein Gesicht schmutzig war. Trotzdem war ich recht zufrieden mit dem, was ich geschafft hatte. Wood/Warren würde die Schätzungen von verschiedenen Lieferanten beibringen müssen, und diese würden der California Fidelity zusammen mit meiner Empfehlung bezüglich der Zahlung der Versicherungssumme vorgelegt werden. Ich griff auf die Standardregel zurück und kam zu einer Schätzung von fünfhunderttausend Dollar Erstattungskosten und einer zusätzlichen Zahlung für den Verlust des Inventars.