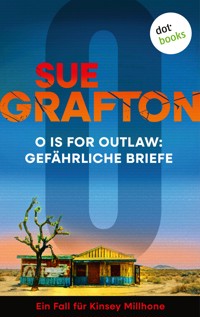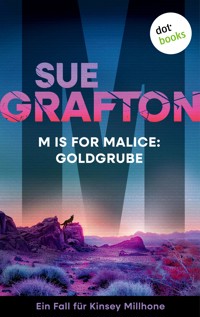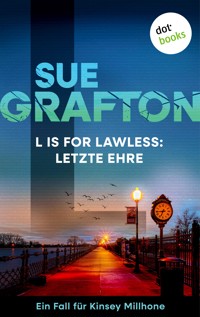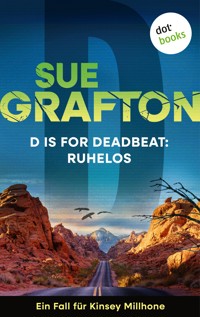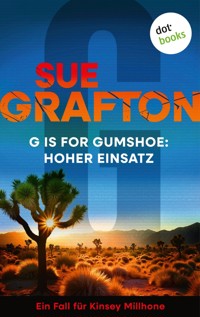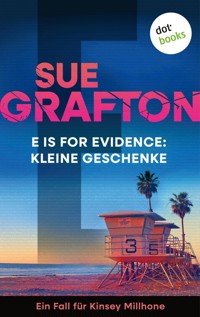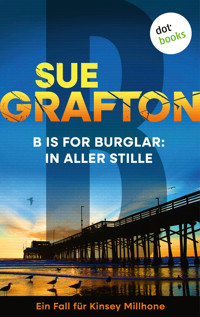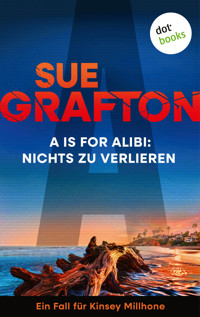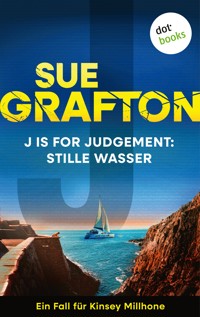
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kinsey Millhone
- Sprache: Deutsch
In ihrem zehnten Fall verfolgt Kaliforniens berühmteste Privatdetektivin die Spur eines Todgeglaubten … Eine Versicherungsgesellschaft setzt Privatermittlerin Kinsey Millhone auf einen Toten an: Fünf Jahre nach seinem angeblichen Selbstmord taucht der Immobilienbetrüger Wendell Jaffe plötzlich wieder auf – quicklebendig und unter falschem Namen in einem mexikanischen Küstenort. Für die Detektivin beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Der abgebrannte Hochstapler ist nicht nur mit einer neuen Partnerin unterwegs, sondern scheint auch in einen Plan verstrickt zu sein, der weit über Versicherungsbetrug hinausgeht. Während Kinsey seine Spur verfolgt, geraten nicht nur Jaffes Familie und alte Geschäftspartner ins Visier – auch Kinsey selbst wird zum Ziel. Und hinter allem lauert ein dunkles Geheimnis, das sie stärker betrifft, als sie ahnt … »Das ist vielleicht die befriedigendste Krimireihe, die es gibt.« The Wall Street Journal Der zehnte Band einer der erfolgreichsten Krimiserien überhaupt, der unabhängig gelesen werden kann – ein fesselnder Ermittlerkrimi für Fans von James Patterson und Patricia Cornwell. In ihrem elften Fall macht sich Kinsey auf der Suche nach einem verschollenen Vermögen – mit einem Killer im Nacken … »Sue Grafton macht Kinsey so real, dass man das Buch nicht mehr aus der Hand legen kann. Man muss einfach wissen, was als nächstes passiert.« – Amazon-Leserin »Schön, witzig, spannend ... Kinsey vom Feinsten.«– Amazon-Leser
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine Versicherungsgesellschaft setzt Privatermittlerin Kinsey Millhone auf einen Toten an: Fünf Jahre nach seinem angeblichen Selbstmord taucht der Immobilienbetrüger Wendell Jaffe plötzlich wieder auf – quicklebendig und unter falschem Namen in einem mexikanischen Küstenort. Für die Detektivin beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Der abgebrannte Hochstapler ist nicht nur mit einer neuen Partnerin unterwegs, sondern scheint auch in einen Plan verstrickt zu sein, der weit über Versicherungsbetrug hinausgeht. Während Kinsey seine Spur verfolgt, geraten nicht nur Jaffes Familie und alte Geschäftspartner ins Visier – auch Kinsey selbst wird zum Ziel. Und hinter allem lauert ein dunkles Geheimnis, das sie stärker betrifft, als sie ahnt …
eBook-Neuausgabe Oktober 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »J is for Judgement« bei Henry Holt, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien unter dem Titel »Stille Wasser« im Wilhelm Goldmann Verlag, München.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1993 by Sue Grafton
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2000 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Svetolk, Constantin Seltea und AdobeStock/Dary Maltseva
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (ma)
ISBN 978-3-69076-792-7
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sue Grafton
J is for Judgement: Stille Wasser
Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen von Mechtild Sandberg-Ciletti
dotbooks.
Kapitel 1
Bei flüchtigem Hinsehen würde man nicht glauben, daß es zwischen dem Mord an einem für tot erklärten Mann und den Ereignissen, die meine Ansichten über mein Leben veränderten, einen Zusammenhang gab. Die Fakten über Wendell Jaffe hatten mit meiner Biographie auch tatsächlich nicht das Geringste zu tun, aber Mord ist selten eine eindeutige Angelegenheit, und keiner hat je behauptet, daß Offenbarungen den Gesetzen der Logik folgen. Meine Nachforschungen über die Vergangenheit des Toten lösten Fragen nach meiner Vergangenheit aus, und am Ende wurde es schwierig, die beiden Geschichten auseinanderzuhalten. Das Schlimme am Tod ist, daß keine Veränderungen mehr stattfinden. Das Schlimme am Leben ist, daß nichts je gleichbleibt. Das Ganze begann mit einem Anruf, nicht bei mir, sondern bei Mac Voorhies, einem der Vizepräsidenten der California Fidelity Versicherungsgesellschaft, bei der ich früher einmal gearbeitet habe.
Mein Name ist Kinsey Millhone. Ich bin Privatdetektivin in Kalifornien und habe mein Büro in Santa Teresa, fünfundneunzig Meilen nördlich von Los Angeles. Meine Zusammenarbeit mit der CF Versicherungsgesellschaft hatte im vergangenen Dezember ein jähes Ende gefunden, und ich konnte nicht in das Haus 903 State Street zurückkehren. So habe ich nun seit sieben Monaten in der Kanzlei Kingman und Ives einen gemieteten Büroraum. Lonnie Kingman hat in erster Linie mit Strafsachen zu tun, genießt aber durchaus auch die Kniffligkeiten von Prozessen, bei denen es um Unglücksfälle oder widerrechtliche Tötung geht. Er ist seit Jahren mein Anwalt und immer da, wenn ich ihn brauche. Lonnie ist klein und bullig, ein Bodybuilder und Raufbold. John Ives ist mehr der ruhige Typ, der die intellektuelle Herausforderung des Berufungsprozesses vorzieht. Ich bin der einzige Mensch, den ich kenne, der nicht automatisch sämtliche Rechtsanwälte der Welt in Grund und Boden verdammt. Nur zur Kenntnisnahme, ich mag auch Bullen. Ich mag jeden, der zwischen mir und der Anarchie steht.
Die Kanzlei Kingman und Ives nimmt das ganze obere Stockwerk eines kleinen Gebäudes im Zentrum ein. Die Belegschaft besteht aus Lonnie, seinem Partner, John Ives, und einem Anwalt namens Martin Cheltenham, Lonnies bestem Freund, der bei ihm Büroräume gemietet hat. Der größte Teil der täglich anfallenden Arbeit wird von den beiden Sekretärinnen, Ida Ruth und Jill, erledigt. Wir haben außerdem eine Empfangsdame namens Alison und einen juristischen Mitarbeiter, Jim Thicket.
Der Raum, den ich übernommen habe, war früher ein Konferenzzimmer mit Kochnische. Nachdem Lonnie das letzte freie Büro in der zweiten Etage annektiert hatte, ließ er eine neue Küche einbauen und einen Raum für die Kopiergeräte. Mein Büro ist groß genug für einen Schreibtisch, meinen Drehsessel, mehrere Aktenschränke, einen Minikühlschrank und eine Kaffeemaschine und schließlich einen großen Schrank, in dem Stapel von Umzugskartons stehen, die ich seit dem Einzug nicht angerührt habe. Ich besitze meinen eigenen Telefonanschluß, kann aber auch die beiden Anschlüsse der Kanzlei benutzen. Ich habe auch noch meinen Anrufbeantworter, aber im Notfall nimmt Ida Ruth Anrufe für mich entgegen. Eine Zeitlang habe ich versucht, ein anderes Büro zu finden. Ich hatte genug Geld, um mir den Umzug leisten zu können, da ich vor Weihnachten für einen Auftrag einen Fünfundzwanzigtausend-Dollar-Scheck kassiert hatte. Das Geld war in diversen Papieren angelegt, die mir nette Zinsen brachten. Aber nach einer Weile wurde mir klar, wie angenehm mein neuer Arbeitsplatz war. Die Lage war gut, und es war wohltuend, bei der Arbeit Leute um sich zu haben. Einer der wenigen Nachteile des Alleinlebens ist es, daß man nie jemanden hat, dem man erzählen kann, was man gerade vorhat. Nun hatte ich wenigstens am Arbeitsplatz Menschen in meiner Nähe, die immer wußten, wo ich war, und bei denen ich mich jederzeit melden konnte, wenn ich ein paar Streicheleinheiten brauchte.
An diesem besonderen Montagmorgen Mitte Juli saß ich seit etwa anderthalb Stunden an meinem Schreibtisch und telefonierte pausenlos herum. Ein Kollege aus Nashville hatte mir geschrieben und mich gebeten, ich möge mich in meiner Gegend nach dem Exehemann einer seiner Klientinnen umschauen, der mit seinen Unterhaltszahlungen mit sechstausend Dollar im Rückstand war. Gerüchteweise hieß es, der Mann habe sich aus Tennessee nach Kalifornien abgesetzt, um sich irgendwo in der Gegend von Perdido oder Santa Teresa niederzulassen. Man hatte mir neben dem Namen des Mannes seine letzte Adresse, sein Geburtsdatum und seine Sozialversicherungsnummer mitgeteilt und mich beauftragt, die Suche nach ihm aufzunehmen. Ich kannte außerdem Modell und Marke des Wagens, den er zuletzt gefahren hatte, sowie das Kennzeichen, das das Fahrzeug in Tennessee zuletzt gehabt hatte. Ich hatte bereits zwei Briefe nach Sacramento geschrieben: einen an die örtliche Führerscheinstelle mit der Bitte um Auskünfte über den Gesuchten; den anderen an die Fahrzeugmeldestelle, um zu prüfen, ob er seinen 83er Ford Lieferwagen angemeldet hatte. Im Augenblick war ich dabei, die öffentlichen Versorgungswerke in der Gegend anzurufen, um herauszubekommen, ob es einen Neuanschluß auf den Namen des Mannes gab. Bisher hatte ich kein Glück gehabt, aber es machte trotzdem Spaß. Für fünfzig Dollar die Stunde bin ich bereit, fast alles zu tun.
Als die Sprechanlage summte, beugte ich mich automatisch vor und drückte auf den Knopf. »Ja?«
»Sie haben Besuch«, sagte Alison. Sie ist vierundzwanzig, temperamentvoll und tatkräftig. Sie hat blondes Haar, das ihr bis zur Taille reicht, trägt Größe 34 und krönt das i in ihrem Namen entweder mit einem Gänseblümchen oder einem Herz, je nach Laune, die aber immer gut ist. »Ein Mr. Voorhies von der California Fidelity Versicherung.«
Ich spürte förmlich, daß über meinem Kopf wie bei einer Comicfigur ein Fragezeichen Gestalt annahm. Mit zusammengekniffenen Augen beugte ich mich tiefer über die Sprechanlage. »Mac Voorhies ist bei Ihnen draußen?«
»Soll ich ihn zu Ihnen schicken?«
»Ich komme vor«, sagte ich.
Ich konnte es nicht glauben. Mac war bei der California Fidelity mein direkter Vorgesetzter gewesen. Und sein Boß, Gordon Titus, war der Mann, der mich an die Luft gesetzt hatte. Zwar hatte ich mich inzwischen mit der beruflichen Veränderung ausgesöhnt, aber wenn ich an diesen Kerl dachte, kam mir immer noch die Galle hoch. Flüchtig schwelgte ich in Phantasien, Gordon Titus hätte Mac geschickt, um mich um Verzeihung zu bitten. Ha, ha, das glaubst du doch wohl selbst nicht, dachte ich sofort. In aller Eile sah ich mich in meinem Büro um; keinesfalls sollte es aussehen, als pfiffe ich auf dem letzten Loch. Das Zimmer war nicht groß, aber es hatte ein eigenes Fenster, eine Menge saubere weiße Wand und einen flauschigen Wollteppich in gebranntem Orange. Mit den drei gerahmten Aquarellen an den Wänden und dem eineinviertel Meter hohen Ficus sah es sehr geschmackvoll aus. Fand ich jedenfalls. Gut, okay, der Ficus war aus Plastik, aber das merkte man echt nur, wenn man ganz nahe ran ging.
Ich hätte einen Blick in den Spiegel geworfen (ja, so prompt wirkte Macs Erscheinen), aber ich besitze keine Puderdose, und außerdem wußte ich bereits, was ich sehen würde – dunkles Haar, hellbraune Augen, keine Spur Make-up. Wie immer trug ich Jeans, Stiefel und Rolli. Ich befeuchtete meine Finger und strich mir über mein widerspenstiges Haar, um eventuell abstehende Strähnen zu glätten. In der Woche zuvor hatte ich in einem Anfall totaler Frustration eine Nagelschere gepackt und mir ritscheratsche das Haar geschnitten. Das Resultat war erwartungsgemäß ausgefallen.
Im Korridor wandte ich mich nach links. Mein Weg führte an mehreren Büros vorbei. Mac stand in der Empfangshalle vor Alisons Schreibtisch. Er ist Anfang Sechzig, groß und brummig, mit flaumigem weißen Haar, das seinen Kopf wie ein Heiligenschein umgibt. Die nachdenklichen dunklen Augen liegen ein wenig schräg in seinem langen, knochigen Gesicht. Anstelle der gewohnten Zigarre rauchte er eine Zigarette, von der Asche auf seinen korrekten Anzug gefallen war. Mac war nie einer, der sich angestrengt hat, um körperlich fit zu bleiben, und seine Figur ähnelt nun einer Zeichnung aus der Kinderperspektive: lange Arme und Beine, ein verkürzter Rumpf, auf dem ein kleiner Kopf sitzt.
»Mac?« sagte ich.
»Hallo, Kinsey«, sagte er in einem wunderbar ironisch wehmütigen Ton.
Ich freute mich so sehr, ihn zu sehen, daß ich laut herauslachte. Wie ein tolpatschiger, etwas zu groß geratener junger Hund sauste ich zu ihm und warf mich in seine Arme. Mac reagierte auf soviel Ungebärdigkeit mit einem seiner seltenen Lächeln, bei dem er Zähne zeigte, die von den vielen Zigarren und Zigaretten stark verfärbt waren. »Lange nicht gesehen«, sagte er.
»Ich kann nicht glauben, daß du hier bist. Komm mit in mein Büro, machen wir’s uns gemütlich«, sagte ich. »Möchtest du einen Kaffee?«
»Nein, danke. Ich habe gerade welchen getrunken.«
Mac drehte sich herum, um seine Zigarette auszudrücken, und merkte zu spät, daß es nirgends einen Aschenbecher gab. Er sah sich verwirrt um, und einen Moment lang blieb sein Blick auf der Pflanze auf Alisons Schreibtisch haften. Sie beugte sich vor.
»Geben Sie ruhig her.« Sie nahm ihm die Zigarette ab und ging mit dem brennenden Stummel zum offenen Fenster. Erst nachdem sie ihn hinausgeworfen hatte, sah sie hinaus, um sich zu vergewissern, daß er nicht in irgendjemandes Kabrio auf dem Parkplatz landete.
Auf dem Weg nach hinten brachte ich Mac über meine derzeitigen Lebensumstände aufs laufende. Als wir in mein Büro kamen, zeigte er sich angemessen beeindruckt. Wir tauschten den neuesten Klatsch und die letzten Neuigkeiten über gemeinsame Freunde. Ich nutzte die Gelegenheit, um den Mann genauer zu betrachten. Die Zeit war eindeutig nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Er hatte weniger Farbe als früher. Und er hatte, nach seinem Aussehen zu urteilen, ungefähr fünf Kilo Gewicht verloren. Er wirkte müde und unsicher, völlig uncharakteristisch bei ihm. Der Mac Voorhies von damals war brüsk und ungeduldig gewesen, gerecht, entschlußkräftig, humorlos und konservativ. Ein Mann, für den sich gut arbeiten ließ. Ich hatte immer seine Reizbarkeit bewundert, die der Leidenschaft entsprang, jede Aufgabe nach besten Kräften zu lösen. Jetzt war der Funke erloschen, und das beunruhigte mich.
»Alles in Ordnung? Irgendwie wirkst du gar nicht wie der alte.«
Er antwortete mit einer ungeduldigen Handbewegung – ein unerwarteter Energieausbruch. »Die schaffen es, einem die Arbeit völlig zu verleiden, das kannst du mir glauben. Diese verdammten Kerle da oben in der Chefetage mit ihrem ständigen Gerede von ›unterm Strich‹. Ich kenne das Versicherungsgeschäft – Mensch, ich arbeite schließlich lang genug in der Branche. Die CF war mal eine große Familie. Wir mußten eine Firma leiten, aber wir haben es mit Menschlichkeit getan, und jeder hat das Revier des anderen geachtet. Keiner von uns ist dem anderen in den Rücken gefallen, und niemand hat die Kunden für dumm verkauft. Aber jetzt – ich weiß nicht, Kinsey. Der Umsatz ist lächerlich. Die Vertreter werden so schnell verschlissen, daß sie kaum Zeit haben, ihre Aktenköfferchen auszupacken. Und immer wird nur von Gewinnspannen und Kostendämpfung geredet. In letzter Zeit merke ich immer wieder, daß ich überhaupt keine Lust mehr habe, zur Arbeit zu gehen.« Er hielt inne und lächelte verlegen. »Lieber Gott, hör sich das einer an! Ich rede wie ein alter Nörgler – was ich ja auch bin. Sie haben mir die ›Frühverrentung‹ angeboten, was auch immer das heißt. Verstehst du, sie machen alle möglichen Verrenkungen, um uns alte Hasen so bald wie möglich von der Gehaltsliste zu streichen. Wir verdienen viel zuviel und sind zu unflexibel.«
»Und – hast du vor anzunehmen?«
»Ich weiß noch nicht, aber ja, vielleicht. Vielleicht nehme ich an. Ich bin einundsechzig und müde. Ich würde gern noch ein bißchen Zeit mit meinen Enkelkindern verbringen, ehe ich ins Gras beiße. Marie und ich könnten unser Haus verkaufen und uns dafür einen Wohnwagen kaufen, ein bißchen was vom Land sehen und die Kinder besuchen. Immer reihum, damit wir keinem auf die Nerven gehen.« Mac und seine Frau hatten acht erwachsene Kinder, alle verheiratet, mit zahllosen eigenen Kindern. Er legte das Thema mit einer abschließenden Geste ad acta, schien in Gedanken schon bei etwas anderem zu sein. »Schluß damit. Ich habe noch einen ganzen Monat Zeit, um es mir zu überlegen. Aber jetzt ist erst mal was anderes dran. Es ist was passiert, und da habe ich sofort an dich gedacht.«
Ich wartete schweigend, um ihn auf seine Weise erzählen zu lassen. Da ging es immer am flüssigsten. Er zog eine Packung Marlboro heraus und schüttelte eine Zigarette heraus. Erst wischte er sich den Mund mit dem Handrücken ab, dann steckte er die Zigarette zwischen die Lippen. Er nahm ein Heftchen Streichhölzer heraus und zündete die Zigarette an, löschte das Flämm- chen des Streichholzes dann in einer Rauchwolke. Er schlug die Beine übereinander und benutzte seine Hosenaufschläge als Aschenbecher. Ich hatte Angst, daß er seine Nylonsocken in Brand setzte.
»Erinnerst du dich an Wendell Jaffe, der vor ungefähr fünf Jahren verschwunden ist?«
»Vage«, antwortete ich. Nach dem, was ich im Kopf hatte, war Jaffes Segelboot verlassen vor der Küste treibend aufgefunden worden. »Rekapituliere doch mal kurz. Das ist der Mann, der auf See verschwunden ist, nicht wahr?«
»So sah es aus, ja.« Mac wackelte nachdenklich mit dem Kopf, während er sich sammelte, um mir eine kurze Zusammenfassung zu geben. »Wendell Jaffe und sein Partner, Carl Eckert, gründeten mehrere Gesellschaften mit beschränkter Haftung, um Immobiliengeschäfte zu machen. Es ging dabei um die Erschließung von Grundstücken und den Bau von Eigentumswohnungen, Geschäftsgebäuden, Einkaufszentren und dergleichen. Sie versprachen ihren Anlegern eine Rendite von fünfzehn Prozent und dazu die Rückzahlung ihrer Einlage innerhalb von vier Jahren. Sie selbst wollten vorerst auf Gewinne verzichten. Dafür kassierten sie aber immense Honorare, wiesen ungeheuer hohe Geschäftsunkosten aus, kurz, sie sahnten richtig ab. Als die Gewinne ausblieben, bezahlten sie die alten Anleger mit dem Geld der neuen Anleger, verschoben das Geld von einer Mantelfirma zur anderen und warben immer neue Anleger an, um das Spiel in Gang zu halten.«
»Ein Schneeballgeschäft also«, sagte ich.
»Richtig. Ich glaube, sie haben mit guten Absichten angefangen, aber so hat es schließlich geendet. Wie dem auch sei. Jaffe merkte, daß das nicht ewig so weitergehen konnte, und da ist er von seinem Boot aus ins Wasser gegangen. Seine Leiche wurde nie gefunden.«
»Er hinterließ einen Abschiedsbrief, wenn ich mich recht erinnere«, warf ich ein.
»Stimmt. Nach allem, was man hörte, litt der Mann an den klassischen Symptomen einer Depression: Niedergeschlagenheit, Appetitlosigkeit, Angst, Schlaflosigkeit. Schließlich fährt er auf seinem Segelboot hinaus und springt über Bord. In dem Brief, den er seiner Frau hinterlassen hat, hieß es, er habe sich in Schulden gestürzt, um das Geschäft am Laufen zu halten, was, wie er jetzt einsähe, völlig hoffnungslos sei. Er ist total verschuldet. Er weiß, daß er alle enttäuscht hat, und kann den Konsequenzen nicht ins Gesicht sehen. Seine Frau und seine beiden Söhne brachte er damit in eine schreckliche Situation.«
»Wie alt waren die Kinder?«
»Ich glaube, Michael, der ältere, war siebzehn, und Brian muß zwölf gewesen sein. Es war wirklich eine üble Geschichte. Er machte seine Familie kaputt, trieb mehrere seiner Anleger in den Bankrott, und sein Geschäftspartner, Carl Eckert, landete im Kittchen. So wie’s aussah, ist Jaffe gerade noch rechtzeitig abgesprungen, ehe das ganze Kartenhaus einstürzte. Aber das Problem war, daß es keinen konkreten Beweis für seinen Tod gab. Seine Frau beantragte bei Gericht die Ernennung eines Nachlaßtreuhänders, obwohl er ja praktisch nichts hinterlassen hatte. Die Bankkonten waren abgeräumt, und das Haus war bis unters Dach verschuldet. Sie mußte es schließlich aufgeben. Die Frau tat mir damals wirklich leid. Sie hatte seit Jahren nicht mehr gearbeitet, seit dem Tag ihrer Heirat nicht mehr. Und nun sollte sie plötzlich sich und die Kinder ganz allein durchbringen, hatte nicht einen Cent auf der Bank und keinerlei Ausbildung. Sie war eine nette Frau, und es war schlimm für sie. Fünf Jahre lang blieb alles still. Nicht die leiseste Spur von dem Mann.«
»Aber er ist gar nicht tot?« sagte ich und nahm damit die Pointe vorweg.
»Darauf komme ich gleich«, versetzte Mac mit einem Anflug von Irritation. Ich verkniff mir also meine Fragen, um ihn in Ruhe und auf seine Art berichten zu lassen.
»Das war tatsächlich eine Frage, die uns beschäftigte. Die Versicherungsgesellschaft war nicht scharf darauf, ohne offiziellen Totenschein zu zahlen. Schon gar nicht, nachdem Wendells Partner wegen Betrugs und Unterschlagung unter Anklage gestellt worden war. Es war schließlich gut möglich, daß Jaffe sich mit der Kohle aus dem Staub gemacht hatte, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Wir haben zwar nie direkt so argumentiert, aber wir haben die Zahlung verschleppt. Dana Jaffe engagierte einen Privatdetektiv, der sich auf die Suche machte, aber niemals auch nur den Schatten eines Beweises zutage förderte, sei es pro oder contra«, fuhr Mac fort. »Es war nicht zu beweisen, daß er tot war, aber das Gegenteil auch nicht. Ein Jahr nach dem Unfall beantragte sie bei Gericht unter Berufung auf den Abschiedsbrief und den seelischen Zustand ihres Mannes, die Toterklärung. Sie legte eidesstattliche Versicherungen seines Partners und diverser Freunde vor. Gleichzeitig informierte sie unsere Gesellschaft davon, daß sie als alleinige Begünstigte Forderung auf Auszahlung der Lebensversicherungssumme erhebe. Wir leiteten daraufhin unsere eigene Untersuchung ein, die ziemlich intensiv war. Bill Bargerman war damit befaßt. Du erinnerst dich an ihn?«
»Den Namen kenne ich, aber ich glaube, wir sind uns nie begegnet.«
»Er saß damals wahrscheinlich in der Zweigstelle in Pasadena. Guter Mann. Ist jetzt im Ruhestand. Kurz und gut, er tat, was er konnte, aber es gelang ihm nicht zu beweisen, daß Wendell Jaffe noch am Leben sein könnte. Immerhin haben wir es geschafft, die Todesvermutung zu verhindern – vorläufig jedenfalls. Angesichts seiner finanziellen Probleme, argumentierten wir, sei es unwahrscheinlich, daß Jaffe sich, wenn er am Leben sein sollte, freiwillig stellen würde. Der Richter entschied für uns, aber wir wußten, daß es nur eine Frage der Zeit war, ehe das Urteil aufgehoben werden würde. Mrs. Jaffe war natürlich wütend, aber sie brauchte nur ein bißchen Geduld. Sie bezahlte weiterhin die Prämie, und als die fünf Jahre um waren, ging sie erneut vor Gericht.«
»Ich dachte, so was dauert sieben Jahre.«
»Das Gesetz ist vor ungefähr einem Jahr geändert worden. Vor zwei Monaten hat sie endlich ein gerichtliches Urteil erwirkt und ließ Jaffe für tot erklären. Da blieb der Gesellschaft natürlich keine Wahl. Wir zahlten.«
»Ah, jetzt wird’s spannend«, sagte ich. »Um was für einen Betrag geht es?«
»Fünfhunderttausend Dollar.«
»Nicht schlecht«, meinte ich. »Aber vielleicht hat sie es verdient. Sie mußte ja lange genug warten, ehe sie kassieren konnte.«
Mac lächelte flüchtig. »Sie hätte ein wenig länger warten sollen. Dick Mills hat mich angerufen – auch ein ehemaliger CF- Mitarbeiter. Er behauptet, er hätte Jaffe in Mexiko gesehen. In einem Ort namens Viento Negro.«
»Tatsächlich? Wann denn?«
»Gestern«, antwortete Mac. »Dick war der Vertreter, der Jaffe damals die Lebensversicherung verkauft hat. Er hat auch danach immer wieder mit ihm zu tun gehabt. Im Zusammenhang mit Jaffes Firma. Na ja, und er war jetzt in Mexiko, in irgendeinem Nest zwischen Cabo und La Paz am Golf von Kalifornien, und behauptet, Jaffe in der Hotelbar gesehen zu haben. Er hätte da mit irgendeiner Frau gesessen.«
»Einfach so?«
»Einfach so«, wiederholte Mac. »Dick mußte auf den Zubringerbus zum Flughafen warten und hatte sich in die Bar gesetzt, um schnell noch einen zu kippen, ehe der Fahrer kam. Jaffe saß auf der Terrasse, vielleicht einen Meter entfernt, durch einen überwachsenen Zaun getrennt. Dick sagte, zuerst habe er die Stimme erkannt. Ein bißchen rauh und ziemlich tief mit texanischem Akzent. Zuerst sprach der Mann englisch, aber als der Kellner kam, stieg er auf Spanisch um.«
»Hat Jaffe Dick gesehen?«
»Anscheinend nicht. Dick meinte, er sei nie in seinem Leben so baff gewesen. Er sagt, er habe dagesessen wie festgenagelt und darüber beinahe den Bus zum Flughafen verpaßt. Kaum war er zu Hause, hat er mich angerufen.«
Mein Herz begann schneller zu schlagen. Man braucht mir nur einen interessanten Auftrag vorzusetzen, und schon fängt mein Puls zu galoppieren an. »Und wie soll’s jetzt weitergehen?«
Mac schnippte Asche in seinen Hosenaufschlag. »Ich möchte, daß du so schnell wie möglich da runterfliegst. Ich nehme doch an, du besitzt einen gültigen Reisepaß?«
»Ja, sicher, aber was ist mit Gordon Titus? Weiß er von diesem Plan?«
»Titus laß mal meine Sorge sein. Diese Geschichte mit Wendell wurmt mich seit Ewigkeiten. Die würde ich gern noch geklärt sehen, ehe ich bei CF aufhöre. Eine halbe Million Dollar ist kein Pappenstiel. Wäre doch ein schöner Abschluß meiner beruflichen Laufbahn.«
»Wenn es stimmt«, sagte ich.
»Ich glaube nicht, daß sich Dick Mills geirrt hat. Also, übernimmst du die Sache?«
»Ich müßte erst sehen, ob ich meine Termine hier verschieben kann. Kann ich dich in ungefähr einer Stunde anrufen und dir Bescheid geben?«
»Natürlich. Kein Problem.« Mac sah auf seine Uhr und stand auf. Er legte einen Packen Papiere auf die Ecke meines Schreibtischs. »Ich würde mir nur an deiner Stelle nicht zuviel Zeit lassen. Du bist auf der Maschine gebucht, die um eins nach Los Angeles startet. Dein Anschlußflug geht um fünf. Die Tickets und der Flugplan sind da drinnen«, sagte er.
Ich lachte. California Fidelity und ich waren wieder im Geschäft.
Kapitel 2
Bis zum Start der Mexicana-Maschine nach Cabo San Lucas hatte ich drei Stunden Aufenthalt in Los Angeles. Mac hatte mir eine Mappe mit Zeitungsartikeln über Jaffes Verschwinden und seine Nachwehen mitgegeben. Ich machte es mir in einer der Flughafenbars bequem und sah die Ausschnitte durch. Dazu schlürfte ich eine Margarita. Zum Einstimmen. Zu meinen Füßen stand die in aller Eile gepackte Reisetasche, in der neben anderen Dingen meine 35-Millimeter-Kamera, mein Feldstecher und der Videorecorder, den ich mir selbst zum vierunddreißigsten Geburtstag geschenkt hatte, verstaut waren. Mir gefiel das Spontane dieser Reise, und ich verspürte schon jetzt dieses Gefühl geschärfter Selbstwahrnehmung, das mit dem Reisen kommt. Meine Freundin Vera und ich besuchten zur Zeit einen Spanischkurs für Anfänger bei der Volkshochschule in Santa Teresa. Allerdings waren wir in unserem sprachlichen Ausdruck fürs erste noch auf das Präsens und kurze Aussagen von zweifelhaftem Nutzen beschränkt – es sei denn, da hockten irgendwo ein paar schwarze Katzen in den Bäumen; dann konnten Vera und ich mit dem Finger auf sie zeigen und sagen: Muchos gatos negros están en los árboles, sí? Sí, muchos gatos. Mindestens bot mir diese Reise Gelegenheit, meine Sprachkenntnisse zu erproben und zu vertiefen.
Zu den Zeitungsausschnitten hatte Mac mehrere Schwarzweißfotos gelegt, die Jaffe bei verschiedenen öffentlichen Anlässen zeigten – Ausstellungseröffnungen, politischen Veranstaltungen, Wohltätigkeitsfesten. Er hatte offensichtlich zur Elite gehört: gutaussehend, elegant gekleidet, stets im Mittelpunkt. Häufig jedoch war sein Gesicht das eine, das unscharf war, so als wäre er genau in dem Moment, als der Fotograf auf den Auslöser drückte, einen Schritt zurückgewichen oder hätte sich abgewandt. Ich überlegte, ob er vielleicht damals schon ganz bewußt vermieden hatte, fotografiert zu werden. Er war Mitte Fünfzig, ein kräftiger Mann mit grauem Haar über einem Gesicht mit hohen Wangenknochen, vorspringendem Kinn und großer Nase. Er wirkte ruhig und selbstbewußt, ein Mann, dem es ziemlich gleichgültig war, was andere von ihm dachten.
Einen Moment lang fühlte ich mich ihm irgendwie verbunden, als ich mir vorstellte, wie es wäre, einfach die Identität zu wechseln. Für mich, die geborene Lügnerin, hatte die Vorstellung immer schon etwas Verlockendes gehabt. Der Gedanke, einfach aus dem eigenen Leben auszusteigen und sich in ein neues, ganz anderes hineinzubegeben wie ein Schauspieler, der die Rolle wechselt, entbehrte nicht einer gewissen Romantik. Vor nicht allzulanger Zeit hatte ich mit einem entsprechenden Fall zu tun gehabt: Ein Mann, der wegen Mordes verurteilt war, war bei einem Arbeitseinsatz geflohen und hatte es geschafft, sich eine ganz neue Persönlichkeit zu kreieren. Er hatte nicht nur seine ganze Vergangenheit abgelegt, sondern sich auch des Makels seiner Verurteilung wegen Mordes entledigt. Er hatte sich eine neue Familie und eine gute Stellung zugelegt und war in seiner neuen Gemeinde ein geachteter Mann. Es wäre ihm vielleicht gelungen, die Täuschung bis ans Ende seines Lebens aufrechtzuerhalten, hätte sich nicht siebzehn Jahre später bei der Ausstellung eines richterlichen Haftbefehls ein Irrtum eingeschlichen, der, Laune des Schicksals, zu seiner Verhaftung führte. Wir können eben unserer Vergangenheit nicht entkommen.
Ein Blick auf meine Uhr sagte mir, daß es Zeit war zu gehen. Ich packte die Zeitungsausschnitte wieder ein und nahm meine Reisetasche. Ich ging durch die Halle, passierte die Sicherheitskontrolle und trat den langen Marsch zu meinem Flugsteig an. Es gehört zu den unabänderlichen Gesetzen des Reisens mit dem Flugzeug, daß sich der Flugsteig, an dem man ankommt oder abfliegt, stets am äußersten Ende des Terminals befindet, besonders wenn man schweres Gepäck schleppen muß oder zu enge Schuhe anhat. Ich setzte mich in den Warteraum und rieb meinen schmerzenden Fuß, während langsam meine Mitreisenden eintrudelten.
Sobald ich in der Maschine auf meinem Platz saß, nahm ich den Hochglanzprospekt des Hotels zur Hand, den Mac zu den Tickets gelegt hatte. Er hatte mir nicht nur den Flug gebucht, sondern auch gleich in dem Ferienhotel, in dem Wendell Jaffe gesichtet worden war, ein Zimmer bestellt. Ich war zwar nicht überzeugt davon, daß der Mann dort noch anzutreffen sein würde, aber weshalb hätte ich einen kostenlosen Urlaub ausschlagen sollen?
Das Bild der Hacienda Grande de Viento Negro zeigte ein zweistöckiges Gebäude mit einem Streifen dunklen Strandes im Vordergrund. Im Untertitel wurden ein Restaurant, zwei Bars und ein beheizter Pool angepriesen sowie Freizeitangebote von der Stadtrundfahrt mit freien Drinks bis zum Tennis, Schnorcheln und Tiefseetauchen.
Meine Nachbarin las mit. Beinahe hätte ich den Prospekt mit der Hand abgeschirmt wie in der Schule, wenn jemand abzuschreiben versuchte. Die Frau war in den Vierzigern, sehr dünn, sehr braungebrannt, sehr schick im schwarzen Hosenanzug mit beigefarbenem Top darunter.
»Sie wollen nach Viento Negro?« fragte sie.
»Ja. Kennen Sie die Gegend?«
»O ja. Und ich kann nur hoffen, Sie haben nicht die Absicht, da zu wohnen.« Sie deutete auf den Prospekt und verzog geringschätzig den Mund dabei.
»Wieso nicht? Ich finde, das Hotel sieht sehr ordentlich aus.«
Sie zog leicht die Brauen hoch. »Na ja, es ist Ihr Geld.«
»Nein, ist es nicht. Ich bin geschäftlich unterwegs«, entgegnete ich.
Sie nickte nur, offensichtlich nicht überzeugt. Sie tat so, als vertiefte sie sich in ihre Zeitschrift, gab mir aber durch ihre Miene klar zu verstehen, daß sie sich nur mit Mühe zurückhielt. Einen Augenblick später sah ich, wie sie ihrem Nachbarn zur Rechten etwas zumurmelte. Dem Mann hing ein Bausch Kleenex aus einem Nasenloch; vermutlich um das Nasenbluten zu stillen, das durch den steigenden Druck in der Kabine des Flugzeugs hervorgerufen worden war. Der Zellstoffstreifen sah aus wie eine dicke selbstgedrehte Zigarette. Der Mann beugte sich ein wenig vor, um mich besser sehen zu können.
Ich richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf die Frau. »Mal ehrlich. Ist da etwas nicht in Ordnung?«
»Ach, es ist sicher okay«, antwortete sie gedämpft.
»Kommt nur drauf an, was man von Staub, Feuchtigkeit und Ungeziefer hält«, warf der Mann ein.
Ich lachte – hahaha –, da ich annahm, er scherze. Keiner von beiden verzog eine Miene.
Verspätet lernte ich, daß viento negro »schwarzer Wind« heißt, eine passende Beschreibung für die Wolken dunklen Lavastaubs, die jeden Tag gegen Ende des Nachmittags vom Strand heraufgewirbelt wurden. Das Hotel war bescheiden, ein Bau in Form eines auf dem Kopf stehenden Us, aprikosenfarben gestrichen, mit kleinen Balkonen. Aus Blumenkästen fiel Bougainvillea in kardinalroten Kaskaden herab. Das Zimmer war sauber, aber ziemlich schäbig, mit Blick auf den Golf von Kalifornien im Osten.
Zwei Tage strich ich auf der Suche nach einem Opfer, das auch nur annähernde Ähnlichkeit mit den fünf Jahre alten Fotografien von Wendell Jaffe hatte, im Hacienda Grande und im Ort, Viento Negro, umher. Wenn alles schiefgeht, sagte ich mir, kannst du immer noch versuchen, in deinem verbesserungsbedürftigen Spanisch das Personal auszuquetschen; wobei ich allerdings Angst hatte, einer der Leute würde Jaffe dann vielleicht einen Tip geben. Vorausgesetzt natürlich, er war überhaupt hier. Ich setzte mich an den Pool, hing im Hotelfoyer herum, nahm den Zubringerbus in den Ort. Ich führte mir sämtliche Touristenattraktionen zu Gemüte: die Sonnenuntergangskreuzfahrt, einen Schnorchelausflug, eine Höllenfahrt über staubige Gebirgsstraßen in einem gemieteten Geländewagen. Ich versuchte mein Glück in den beiden anderen Hotels in der Gegend, in den Restaurants und Kneipen der Umgebung. Ich testete den Nachtclub in meinem Hotel, klapperte sämtliche Discos und Geschäfte ab. Nirgends fand ich eine Spur von ihm.
Schließlich rief ich Mac an, um ihm von meinen bis dato vergeblichen Bemühungen zu berichten. »Das wird hier allmählich ganz schön teuer. Vielleicht ist er ja längst weg – wenn dein Kollege ihn überhaupt gesehen hat.«
»Dick schwört Stein und Bein, daß er’s war.«
»Nach fünf Jahren?«
»Hör mal, bleib einfach noch zwei, drei Tage dran. Wenn er bis Ende der Woche nicht aufgetaucht ist, kannst du dich in die nächste Maschine Richtung Heimat setzen.«
»Mir soll’s recht sein. Ich wollte dich nur vorwarnen, falls ich mit leeren Händen kommen sollte.«
»Das verstehe ich. Versuch’s weiter.«
»Du bist der Boß«, sagte ich.
Ich fand Gefallen an dem Städtchen, das man vom Hotel aus mit dem Taxi auf einer staubigen zweispurigen Straße in zehn Minuten erreichte. Die meisten Bauten, an denen ich vorüberkam, waren unfertig, roher Löschbeton, den man dem wuchernden Unkraut überlassen hatte. Der einst herrliche Blick auf den Hafen war jetzt durch Hochhäuser verstellt, und in den Straßen wimmelte es von Kindern, die Chichlets verkauft, das Stück für hundert Pesos. Hunde dösten auf den Bürgersteigen in der Sonne. Die Fassaden der Geschäfte an der Hauptstraße leuchteten in kräftigen Blau- und Gelbtönen, in knalligem Rot und Papageiengrün, bunt wie Urwaldblumen. Plakatwände kündeten von weitreichenden kommerziellen Interessen von Fujifilm bis Immobilien 2000. Die meisten geparkten Autos standen mit zwei Rädern auf dem Bürgersteig, und den Kennzeichen war zu entnehmen, daß Touristen bis aus Oklahoma hierherkamen. Die Geschäftsleute waren höflich und zeigten sich meinem stockenden Spanisch gegenüber geduldig. Es gab keine Anzeichen von Kriminalität oder Rowdytum. Alle waren viel zu abhängig von den amerikanischen Touristen, um es zu riskieren, sie vor den Kopf zu stoßen. Dennoch waren die auf dem Markt angebotenen Waren minderwertig und überteuert, und das Essen in den Restaurants war ausgesprochen zweitklassig. Unermüdlich wanderte ich von einem Ort zum anderen und suchte in den Menschenmengen nach Wendell Jaffe oder seinem Ebenbild.
Am Mittwochnachmittag – ich war inzwischen zweieinhalb Tage hier – gab ich die Suche schließlich auf und legte mich eingecremt, daß ich wie eine frisch gebackene Kokosmakrone roch, an den Pool. Kühn zeigte ich in einem ausgebleichten schwarzen Bikini meinen Körper, der gesprenkelt war von alten Schußwunden und gestreift von den bleichen Narben diverser anderer Verletzungen, die man mir im Lauf der Jahre beigebracht hatte. Ja, mein körperliches Befinden scheint viele Leute zu kümmern. Im Moment hatte meine Haut einen schwachen Orangeton, da ich, um die winterliche Blässe zu kaschieren, eine Grundierung in Form von Selbstbräunungscreme aufgetragen hatte. Natürlich hatte ich das Zeug unregelmäßig aufgetragen, und an den Fußknöcheln war ich scheußlich fleckig. Es sah aus, als hätte ich eine besondere Form der Gelbsucht. Ich kippte mir den Strohhut ins Gesicht und versuchte, die Schweißbäche zu ignorieren, die sich in meinen Kniekehlen sammelten. Sonnenbaden ist so ziemlich der langweiligste Zeitvertreib auf Erden. Aber positiv war immerhin, daß ich hier von Telefon und Fernsehen abgeschnitten war. Ich hatte keinen Schimmer, was in der Welt passierte.
Ich mußte wohl eingenickt sein; plötzlich jedenfalls hörte ich das Rascheln einer Zeitung, dann die Stimmen zweier Leute in den Liegestühlen rechts von mir. Sie unterhielten sich auf Spanisch, und in meinen Ohren klang das ungefähr so: Bla-bla-bla ... aber ... bla-bla-bla-bla ... weil ... bla-bla-bla ... hier. Eine Frau mit eindeutig amerikanischem Akzent sagte etwas von Perdido, Kalifornien, dem kleinen Ort dreißig Meilen südlich von Santa Teresa. Ich horchte auf. Ich war gerade dabei, meinen Hut etwas hochzuschieben, um mir die Frau ansehen zu können, als ihr Begleiter ihr auf Spanisch erwiderte. Ich rückte meinen Hut zurecht und drehte ganz langsam den Kopf, bis ich ihn im Blickfeld hatte. Verdammt, das mußte Jaffe sein. Wenn man das Alter und mögliche kosmetische Korrekturen berücksichtigte, war dieser Mann zumindest ein heißer Kandidat. Ich kann nicht behaupten, daß er dem Wendell Jaffe auf den Fotos glich wie ein Ei dem anderen, aber er hatte eine gewisse Ähnlichkeit: das Alter, die Figur, seine Haltung, die Art, wie er seinen Kopf neigte, für ihn typische Merkmale, derer er sich wahrscheinlich gar nicht bewußt war.
Er war in eine Zeitung vertieft. Flink huschten seine Augen von einer Spalte zur nächsten. Dann schien er meine Aufmerksamkeit zu spüren und sandte einen vorsichtigen Blick in meine Richtung. Wir sahen uns flüchtig an, während die Frau an seiner Seite weiterbabbelte. Wechselnde Emotionen spiegelten sich in seinem Gesicht, und er berührte mit einem warnenden Blick zu mir den Arm der Frau. Vorübergehend versiegte der Wortschwall. Mir gefiel die Paranoia. Sie sagte einiges über seine geistige Verfassung aus.
Ich griff mir meine Strohtasche und kramte in ihren Tiefen, bis er das Interesse an mir verlor. Und ich Idiotin hatte meinen Fotoapparat nicht mit! Ich hätte mich ohrfeigen können. Ich holte mein Buch heraus und schlug es irgendwo in der Mitte auf, dann scheuchte ich einen imaginären Käfer von meinem Bein und sah mich um, wobei ich – wie ich hoffte – einen Eindruck absoluten Desinteresses vermittelte. In leiserem Ton nahmen die beiden ihr Gespräch wieder auf. Inzwischen verglich ich die Gesichtszüge des Mannes im Geist mit denen des Typen, dessen Foto ich in meiner Mappe hatte. Die Augen verrieten ihn: dunkel und tiefliegend unter sehr hellen silberweißen Augenbrauen. Dann sah ich mir die Frau an seiner Seite an; ich war ziemlich sicher, daß ich sie nie zuvor gesehen hatte. Sie war in den Vierzigern, sehr klein und dunkel und tief gebräunt. Der BH aus Hanfgarn verhüllte Brüste wie Briefbeschwerer, und die eingezogene Krümmung unter der Bikinihose zeigte, daß sie geprügelt worden war, wo es weh tat.
Den Hut über dem Gesicht, ließ ich mich tiefer in meinen Liegestuhl sinken und lauschte unverfroren dem sich steigernden Streitgespräch. Immer noch sprachen die beiden spanisch miteinander, und das Wesen des Dialogs schien mir von schlichter Meinungsverschiedenheit in hitzige Auseinandersetzung überzugehen. Sie brach das Gespräch plötzlich ab, indem sie sich in dieses gekränkte Schweigen hüllte, dem Männer immer ratlos gegenüberstehen. Fast den ganzen Nachmittag lagen sie nebeneinander auf ihren Liegestühlen, sprachen kaum ein Wort und beschränkten sich in ihren Interaktionen auf ein Minimum. Liebend gern hätte ich ein paar Fotos geschossen. Zweimal dachte ich daran, in mein Zimmer hinaufzulaufen, aber ich meinte, es könnte merkwürdig aussehen, wenn ich wenige Minuten später mit voller Fotoausrüstung zurückkehren würde. Ich hielt es für besser, mich in Geduld zu fassen und auf den geeigneten Moment zu warten. Die beiden waren eindeutig Hotelgäste, und ich konnte mir nicht vorstellen, daß sie so spät am Tag noch abreisen wollten. Morgen konnte ich ein paar Bilder machen. Heute sollten sie sich erst einmal an meinen Anblick gewöhnen.
Um fünf begann der Wind in den Palmen zu rascheln, und vom Strand stiegen Spiralen schwarzen Staubs in die Höhe. Sandkörner knallten auf meine Haut, legten sich auf meine Zunge, und meine Augen fingen an zu tränen. Die wenigen Hotelgäste in meiner Nähe packten eilig ihre Sachen zusammen. Ich wußte inzwischen aus Erfahrung, daß die Staubböen sich bei Sonnenuntergang legten. Jetzt jedoch schloß sogar der Mann im Kiosk seine Bude und suchte schleunigst Deckung.
Der Mann, den ich beobachtet hatte, stand auf. Seine Begleiterin wedelte sich mit der Hand vor dem Gesicht herum, als wollte sie einen Mückenschwarm vertreiben. Mit gesenktem Kopf, um den Staub nicht in die Augen zu bekommen, sammelte sie ihre und seine Sachen ein. Sie sagte etwas auf Spanisch zu ihm und rannte dann zum Hotel. Er ließ sich Zeit, völlig unbeeindruckt, wie es schien, von dem plötzlichen Wetterumschwung. Er faltete die Badetücher zusammen, schraubte den Deckel auf eine Tube Sonnenschutzcreme, verstaute dies und jenes in einer Strandtasche und trottete dann ganz gemächlich zum Hotel zurück. Es schien ihm nichts daran zu liegen, seine Freundin einzuholen. Vielleicht war er ein Mann, der Konfrontationen gern aus dem Weg ging. Ich ließ ihm etwas Vorsprung, packte dann meine Sachen und machte mich auch auf.
Ich trat ins untere Foyer, das im Allgemeinen den Elementen offenstand. Bunte Leinensofas standen so, daß man den Fernsehapparat sehen konnte. Sessel waren zu kleinen Plauderecken für die wenigen Gäste gruppiert. Der Raum erhob sich über zwei Stockwerke zu einer Galerie, die das obere Foyer mit dem Empfang abschloß. Das Paar war nirgends zu sehen. Der Barkeeper war damit beschäftigt, die hohen Holzläden zu schließen, um den Raum vor dem Eindringen des heißen, beißenden Windes zu schützen. Augenblicklich war die Bar in künstliches Dämmerlicht getaucht. Ich ging die breite, glänzende Treppe zur Linken hinauf, um im Hauptfoyer, das im Obergeschoß war, nach den beiden zu sehen. Dann wandte ich mich zum Portal, denn es konnte ja sein, daß sie doch in einem anderen Hotel wohnten und nun ihren Wagen vom Parkplatz holten. Alles war leer und verlassen. Der immer heftiger tobende Wind hatte die Menschen in die Häuser getrieben. Ich kehrte zu den Aufzügen zurück und fuhr zu meinem Zimmer hinauf.
Als ich die Schiebetür zum Balkon geschlossen hatte, war der Wind so stark geworden, daß der Sand wie ein plötzlicher sommerlicher Regenschauer gegen das Glas prasselte. Der Tag versank in geisterhaftem Zwielicht. Wendell und die Frau waren irgendwo im Hotel, hatten sich vermutlich genau wie ich in ihrem Zimmer verkrochen. Ich holte mein Buch heraus, legte mich aufs Bett unter die verblichene Baumwolldecke und las, bis mir die Augen zufielen.
Um sechs Uhr fuhr ich mit einem Ruck in die Höhe. Der Wind hatte sich wieder gelegt; und dank der wie wild arbeitenden Klimaanlage war es im Zimmer ungemütlich kalt geworden. Das Sonnenlicht war zum milden Gold des schwindenden Tages verblichen und badete die Wände meines Zimmers in sanftem maisgelbem Glanz. Draußen begann das Hotelpersonal wie jeden Tag zu fegen. Alle Gehwege mußten gekehrt und die Haufen schwarzen Sandes zum Strand hinuntergefegt werden.
Ich duschte und kleidete mich an, fuhr ins Foyer hinunter und machte, in der Hoffnung, das Paar wieder zu sichten, eine Runde durchs Hotel. Ich sah mich im Restaurant, in den beiden Bars, auf der Terrasse und im Innenhof um. Vielleicht machten sie ein Nickerchen oder aßen in ihrem Zimmer zu Abend. Vielleicht waren sie auch zum Essen in den Ort gefahren. Ich schnappte mir selbst ein Taxi und ließ mich nach Viento Negro bringen. Um diese Zeit erwachte das Städtchen gerade wieder zum Leben. Die Strahlen der untergehenden Sonne vergoldeten für kurze Zeit die Telefondrähte. Die Luft war schwer von der Hitze und durchdrungen vom Geruch des Buschlands.
In einem Selbstbedienungsrestaurant im Freien fand ich einen unbesetzten Tisch für zwei – mit Blick auf eine verlassene Baustelle. Der viele von Unkraut überwachsene Beton und die rostigen Stangen und Gitter konnten meinen Appetit nicht im geringsten dämpfen. Mit einem Pappteller voll gedünsteter Shrimps, die ich schälte und in Salsa tauchte, saß ich auf einem wackligen Klappstuhl und ließ es mir schmecken. Blecherne Musik vom Band dröhnte aus den Lautsprechern über mir. Das Bier war eiskalt und das Essen, wenn auch mittelmäßig, so doch wenigstens billig und sättigend.
Um halb neun kam ich ins Hotel zurück. Wieder sah ich mich im Foyer um und machte dann noch einmal einen Abstecher zum Restaurant und den beiden Bars des Hotels. Nirgends fand ich eine Spur von Wendell oder der Frau in seiner Begleitung. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß er unter dem Namen Jaffe reiste, es hatte also wenig Sinn, am Empfang nach ihm zu fragen. Ich hoffte, daß die beiden nicht ausgezogen waren. Eine Stunde streifte ich im Hotel herum und ließ mich endlich auf einem Sofa im Foyer in der Nähe des Eingangs nieder. Ich kramte mein Buch aus meiner Handtasche und las zerstreut bis weit nach Mitternacht.
Erst da gab ich auf und ging in mein Zimmer. Sicherlich würden die beiden am folgenden Morgen wieder auftauchen. Vielleicht konnte ich den Namen herausbekommen, unter dem Jaffe derzeit reiste. Ich wußte nicht recht, was ich mit der Information anfangen würde, aber ich war sicher, daß es Mac interessieren würde.
Kapitel 3
Am nächsten Morgen stand ich um sechs auf, weil ich am Strand ein Stück laufen wollte. Am Morgen nach meiner Ankunft war ich nach beiden Seiten je anderthalb Meilen weit gejoggt. Jetzt reduzierte ich die Strecke auf Viertelmeilenabschnitte, um das Hotel im Auge behalten zu können. Ich hoffte immer noch, ich würde sie entdecken – auf der Terrasse am Pool, beim Morgenspaziergang am Strand. Ich fürchtete immer noch, sie könnten am Abend zuvor abgereist sein, so unwahrscheinlich das auch war.
Nach der morgendlichen Ertüchtigung nahm ich in meinem Zimmer eine rasche Dusche und zog mich an. Ich legte einen Film in die Kamera ein, hängte mir sie um den Hals und ging in den Frühstücksraum, der sich an das obere Foyer anschloß. Ich wählte einen Platz in der Nähe der offenen Tür und legte den Fotoapparat auf den Stuhl neben mir. Beinahe unablässig behielt ich den Aufzug im Auge, während ich Kaffee, Saft und Flocken bestellte. Ich zog das Frühstück in die Länge, so gut es ging, aber weder Wendell noch die Frau ließen sich sehen. Nachdem ich die Rechnung unterschrieben hatte, ging ich mit meinem Fotoapparat zum Pool hinunter, wo sich bereits andere Gäste eingefunden hatten. Im Wasser tobte eine Meute präpubertärer Knaben herum, und im Innenhof spielte ein frisch verheiratetes Pärchen Tischtennis. Ich wanderte einmal um das Hotel herum und ging wieder hinein – durch die Bar im unteren Foyer zur Treppe. Meine Unruhe wuchs.
Und da sah ich sie plötzlich.
Sie stand mit verschiedenen Zeitungen in der Hand vor dem Aufzug. Anscheinend hatte ihr noch keiner gesagt, wie selten die Aufzüge funktionierten. Sie war noch ungeschminkt, und ihr Haar war wirr und zerzaust vom Schlaf. Sie hatte Badesandalen an den Füßen und trug einen Frotteebademantel, der um die Taille lose gegürtet war. Unter dem klaffenden Revers konnte ich einen dunkelblauen Badeanzug sehen. Wenn die beiden vorgehabt hätten, an diesem Tag abzureisen, dachte ich mir, hätte sie sich sicher nicht zum Baden angezogen. Sie sah flüchtig auf meinen Fotoapparat, mied jedoch meinen Blick.
Ich stellte mich neben sie und starrte fasziniert die Leuchtanzeige an. Die Aufzugtür öffnete sich, und zwei Leute traten heraus. Ich hielt mich diskret im Hintergrund und ließ sie zuerst einsteigen. Sie drückte auf den Knopf mit der Zwei und sah mich fragend an.
»Da will ich auch hin«, murmelte ich.
Sie lächelte vage, ohne echte Absicht, Kontakt aufzunehmen. Ihr schmales Gesicht wirkte eingefallen, dunkle Schatten unter ihren Augen ließen darauf schließen, daß sie nicht gut geschlafen hatte. Der schwüle Duft ihres Parfums hing zwischen uns in der Luft. Schweigend fuhren wir ins zweite Stockwerk hinauf, und als die Tür sich öffnete, ließ ich ihr mit einer höflichen Geste den Vortritt.
Sie wandte sich nach rechts und steuerte auf ein Zimmer am hinteren Ende des Korridors zu. Ihre Gummisandalen schlugen klatschend auf den gefliesten Boden. Ich blieb stehen und tat so, als suchte ich in den Taschen nach meinem Schlüssel. Mein Zimmer war eine Etage tiefer, aber das brauchte sie nicht zu wissen. Ich hätte mir gar nicht solche Mühe zu geben brauchen, sie zu täuschen. Sie schloß die Tür zu Nummer 312 auf und ging hinein, ohne noch einmal zurückzublicken. Es war fast zehn, und der Wagen des Zimmermädchens stand zwei Türen entfernt von dem Zimmer, in dem die Frau verschwunden war. Die Tür zu Zimmer 316 stand offen, das Zimmer war offenbar gerade freigeworden und leer.
Ich eilte zum Aufzug zurück und ging, unten angekommen, direkt zum Empfang, da ich um ein anderes Zimmer bitten wollte. Der Hotelangestellte war sehr entgegenkommend, vielleicht weil das Haus fast leer war. Das Zimmer, sagte er, würde allerdings frühestens in einer Stunde fertig sein, aber ich nahm diese Wartezeit huldvoll in Kauf. Ich ging zum Kiosk und kaufte mir ein Exemplar der Zeitung von San Diego.
Mit der Zeitung unter dem Arm fuhr ich zu meinem alten Zimmer hinauf, packte Kleider und Fotoapparat in meine Reisetasche, sammelte meine Toilettensachen und schmutzige Unterwäsche ein. Ich nahm die Tasche mit ins Foyer und wartete dort darauf, das andere Zimmer beziehen zu können. Keinesfalls wollte ich Wendell eine Gelegenheit geben, sich aus dem Staub zu machen. Als ich mich endlich im Zimmer 316 einrichten konnte, war es fast elf. Vor 312 stand ein Frühstückstablett mit schmutzigem Geschirr. Ich warf einen Blick auf die Toastkrümel und die Kaffeetassen. Diese Leute aßen entschieden zu wenig Obst.
Ich ließ meine Zimmertür angelehnt, während ich auspackte. Ich hatte mich nun zwischen Wendell Jaffe und den Hotelausgang platziert; sowohl die Treppe als auch die Aufzüge befanden sich mehrere Türen rechts von mir. Ich hielt es für ziemlich ausgeschlossen, daß er verschwinden konnte, ohne von mir gesehen zu werden. Und siehe da, um halb eins sah ich ihn und seine Freundin auf dem Weg nach unten, beide in Schwimmkleidung. Ich ging mit meinem Fotoapparat auf den Balkon und wartete, bis sie zwei Stockwerke tiefer auf den Fußweg kamen.
Ich hob meinen Fotoapparat und verfolgte den Weg der beiden durch den Sucher. Ich hoffte, sie würden sich irgendwo in Reichweite des Zooms niederlassen. Sie verschwanden hinter üppigen gelben Hibiskusbüschen. Ich bekam sie kurz ins Blickfeld, während sie ihre Sachen auf einem Tisch ablegten und es sich in ihren Liegestühlen bequem machten. Doch als sie endlich die richtige Stellung gefunden und sich ausgestreckt hatten, um die Sonne zu genießen, waren sie bis auf Wendell Jaffes Füße von den blühenden Sträuchern abgeschirmt.
Ich ließ ein wenig Zeit verstreichen, dann folgte ich ihnen an den Pool und verbrachte den Tag in ihrer nächsten Nähe. Diverse bleiche Neuankömmlinge waren damit beschäftigt, ihr Revier zwischen Bar und Pool abzustecken. Mir ist aufgefallen, daß Urlauber in solchen Ferienhotels dazu neigen, auf Hoheitsrechte zu pochen, indem sie Tag für Tag dieselben Liegestühle, dieselben Barhocker, dieselben Tische im Restaurant beanspruchen, damit nur ja alles genauso langweilig und vorhersehbar ist wie zu Hause. Ich würde wahrscheinlich bereits nach einem Tag der Observation vorhersagen können, wie die meisten von ihnen ihren Urlaub gestalten wollen. Und wenn sie wieder nach Hause fahren, wundern sie sich vermutlich, daß ihnen die Reise doch nicht die Erholung gebracht hat, die sie sich erhofft hatten.
Jaffe und seine Freundin lagen nicht an ihrem gestrigen Platz. Ein anderes Pärchen hatte ihn ihnen offenbar weggeschnappt. Wieder beschäftigte sich Jaffe mit den neuesten Zeitungsnachrichten in englischer und in spanischer Sprache. Meine Gegenwart wurde kaum zur Kenntnis genommen, und ich achtete sorgfältig darauf, weder mit Jaffe noch der Frau Blickkontakt aufzunehmen. Ich fotografierte ab und zu und täuschte dabei brennendes Interesse an architektonischen Details, künstlerischen Perspektiven und Meeresansichten vor. Wenn ich das Objektiv auf irgendetwas in ihrer Nähe richtete, schienen sie es zu spüren und zogen sich zurück wie hochempfindliche Meerestiere.
Sie bestellten sich den Lunch ans Becken. Ich verdrückte an der Bar ein paar gesunde Chips mit Salsa, ohne sie aus den Augen zu lassen. Ich sonnte mich und las. Ab und zu ging ich zum seichten Ende des Pools und machte meine Füße ein bißchen naß. Selbst bei den drückenden Julitemperaturen erschien mir das Wasser eiskalt. Schon wenn ich bis zu den Waden hineinging, bekam ich Atemnot und verspürte ein dringendes Bedürfnis laut loszukreischen. Ich ließ in meiner Wachsamkeit erst ein wenig nach, als ich hörte, wie Jaffe für den folgenden Nachmittag einen Ausflug zum Hochseefischen verabredete. Wäre ich wahrhaft paranoid gewesen, hätte ich hinter diesem Ausflug vielleicht ein neuerliches Fluchtmanöver vermutet. Aber wovor mußte er jetzt noch fliehen? Mich kannte er nicht, und ich hatte ihm keinen Anlaß gegeben, gegen mich Verdacht zu schöpfen.
Zum Zeitvertreib schrieb ich eine Ansichtskarte an Henry Pitts, meinen Hauswirt in Santa Teresa. Henry ist vierundachtzig Jahre alt und hinreißend: groß und schlank mit tollen Beinen. Er ist gescheit und gutmütig, wacher als ein Haufen Leute meiner Bekanntschaft, die halb so alt sind wie er. In letzter Zeit hatte es ihm ziemlich die Petersilie verhagelt, weil sein älterer Bruder William, der mittlerweile sechsundachtzig war, mit Rosie, der Ungarin, der die Kneipe um die Ecke gehörte, angebändelt hatte. William war Anfang Dezember aus Michigan eingetrudelt, um die Depressionen loszuwerden, die sich nach einem Herzinfarkt bei ihm eingestellt hatten. William war unter den besten Umständen eine Nervensäge, aber sein »Scharmützel mit dem Tod« – wie er es nannte – hatte seine unangenehmsten Eigenschaften verstärkt. Wie ich hörte, hatten Henrys andere Geschwister – Lewis mit siebenundachtzig, Charlie mit einundneunzig und Nell, die im Dezember vierundneunzig wurde – demokratisch abgestimmt und Henry in seiner Abwesenheit das Sorgerecht für William zuerkannt.
Williams Besuch, ursprünglich für zwei Wochen geplant, hatte sich nunmehr auf sieben Monate ausgedehnt, und das hautnahe Zusammenleben begann seinen Tribut zu fordern. William, egozentrisch, hypochondrisch, zimperlich, launisch und bigott, hatte sich in meine Freundin Rosie vergafft, die ihrerseits autoritär, neurotisch, kokett, halsstarrig und knauserig war und nie ein Blatt vor den Mund nahm. Die beiden waren glückselig miteinander.
Die Liebe hatte sie reichlich kindisch gemacht, und das war mehr, als Henry ertragen konnte. Ich fand es eigentlich ganz süß, aber was wußte ich schon!
Ich unterschrieb die Karte an Henry und schrieb gleich noch ein paar sorgfältig überlegte spanische Zeilen an Vera. Der Tag erschien mir endlos; nichts als Hitze und Insekten und kreischende Kinder im Pool. Jaffe und seine Frau schienen es von Herzen zu genießen, in der Sonne zu liegen und sich braten zu lassen. Hatte sie denn noch nie jemand vor Falten, Hautkrebs und Sonnenstich gewarnt? Ich zog mich immer wieder in den Schatten zurück, viel zu ruhelos, um mich auf mein Buch zu konzentrieren. Jaffe benahm sich überhaupt nicht wie ein Mann auf der Flucht, sondern vielmehr wie jemand, der Zeit hatte wie Sand am Meer. Vielleicht empfand er sich nach fünf langen Jahren nicht mehr als Flüchtiger. Daß er amtlich tot war, davon wußte er nichts.
Gegen fünf erhob sich wie gewohnt der viento negro. Auf dem Tisch knisterten Jaffes Zeitungen, einzelne Blätter schnellten in die Höhe wie hastig aufgezogene Segel. Die Frau grapschte gereizt nach ihnen und packte sie mit ihrem Badetuch und ihrem Sonnenhut zusammen. Sie schob ihre Füße in die Gummisandalen und wartete ungeduldig auf Jaffe. Der tauchte noch einmal ins Becken, vermutlich um sich die Sonnencreme vom Körper zu spülen, ehe er mit ihr hineinging. Ich sammelte meine Siebensachen zusammen und ging vor ihnen. Soviel mir daran lag, die Verbindung zu ihnen zu halten, hielt ich es doch für unklug, aggressiver zu sein, als ich es bisher gewesen war. Ich hätte mich mit ihnen bekanntmachen und versuchen können, ein Gespräch anzufangen, um sie vorsichtig über ihre derzeitigen Lebensumstände auszufragen. Aber ich hatte bemerkt, wie geflissentlich sie jede Demonstration von Kontaktsuche vermieden, und ich konnte daraus nur schließen, daß sie Annäherungsversuche von mir abgewehrt hätten. Da war es besser, ähnliches Desinteresse vorzutäuschen.
Ich ging in mein Zimmer und schloß die Tür hinter mir, schaute durch den Spion, bis ich sie durch den Flur kommen sah. Ich nahm an, sie würden sich genau wie wir anderen in ihrem Zimmer verkriechen, bis der Wind sich wieder legte. Ich duschte und zog mich um. Dann streckte ich mich auf dem Bett aus und versuchte zu lesen, nickte vorübergehend ein, bis es auf den Korridoren still geworden war und vom Pool nicht das kleinste Geräusch heraufdrang. Immer noch trieben Windböen schwarze Sandkörner an meine Balkontür. Die Klimaanlage des Hotels, die gelinde gesagt äußerst launisch war, brummte hin und wieder in fruchtlosem Bemühen, der Hitze Herr zu werden. Manchmal war es im Zimmer so kalt wie in einem Kühlschrank, meistens jedoch stickig und abgestanden. Kein Wunder, daß in Hotels dieser Sorte Ängste vor neuen exotischen Variationen der Legionärskrankheit erwachen.
Als ich aufwachte, war es dunkel. Im ersten Moment wußte ich nicht, wo ich war. Ich knipste das Licht an und sah auf meine Uhr. Zwölf nach sieben. Ach ja. Mir fiel wieder ein, daß ich auf Verfolgungsjagd und Wendell Jaffe mein Opfer war. Waren die beiden vielleicht inzwischen weggegangen? Ich stand auf und lief barfuß zur Tür, um hinauszusehen. Der Korridor war hell erleuchtet und in beiden Richtungen leer. Ich ging bis zu Zimmer 312 und ein Stück weiter, in der Hoffnung, ein Lichtschimmer unter der Tür würde mir verraten, daß jemand im Zimmer war. Aber ich sah gar nichts, und ich wagte es nicht, mein Ohr an die Tür zu legen und zu lauschen.
Zurück in meinem Zimmer, schlüpfte ich in meine Schuhe. Dann putzte ich mir im Badezimmer die Zähne und kämmte mich. Ich nahm eines der schäbigen Hotelhandtücher mit auf den Balkon und hängte es über das Geländer auf der rechten Seite. Als ich ging, ließ ich das Licht brennen, sperrte die Zimmertür ab und fuhr mit meinem Feldstecher in der Hand nach unten. Ich schaute mich in der Cafeteria um, beim Zeitungskiosk und in der Bar. Jaffe und seine Freundin waren nirgends zu sehen. Als ich draußen auf dem Fußweg stand, drehte ich mich herum, hob meinen Feldstecher und ließ meinen Blick über die Fassade des Hotels schweifen. Im zweiten Stock entdeckte ich das Handtuch auf meinem Balkon. Ich rückte mit meinem Blick zwei Balkone weiter. Dort rührte sich nichts, aber in Jaffes Zimmer war schwacher Lichtschimmer erkennbar, und die Balkontür schien halb aufgeschoben zu sein. Waren sie ausgegangen, oder schliefen sie? Im Foyer ging ich ans Haustelefon und wählte 312. Es meldete sich niemand. Ich ging wieder in mein Zimmer und steckte den Zimmerschlüssel, Stift und Papier und die kleine Taschenlampe ein. Dann löschte ich das Licht.
Ich trat auf den Balkon hinaus und starrte, die Ellbogen aufs Geländer gestützt, in die Nacht hinaus. Dabei machte ich ein versonnenes Gesicht, als kommunizierte ich mit der Natur, während ich in Wirklichkeit überlegte, wie ich in das übernächste Zimmer kommen konnte. Aber es beobachtete mich gar niemand. Nicht einmal die Hälfte der Fenster in der Hotelfassade waren erleuchtet, Bougainvillea wucherte dunkel und dicht. Hier und dort konnte ich jemanden auf einem Balkon sitzen sehen, und manchmal glomm eine Zigarette auf. Es war mittlerweile ganz dunkel geworden. Die äußeren Fußwege waren mit kleinen Lampen gesäumt, der Swimmingpool schimmerte wie ein Edelstein. Drüben, auf der anderen Seite des Beckens kam gerade eine Fete in Gang – Musik, Stimmengewirr, Gelächter, der rauchige Geruch nach gegrilltem Fleisch wehten zu mir herauf. Ich war ziemlich sicher, daß kein Mensch etwas merken würde, wenn ich mich flink wie ein Schimpanse von einem Balkon zum nächsten schwang.