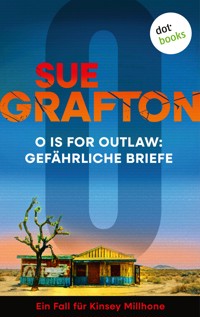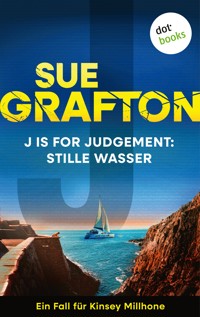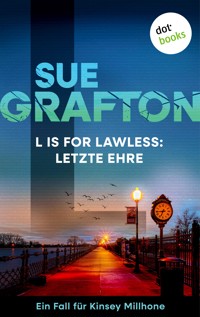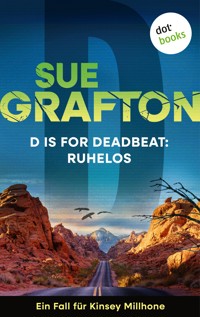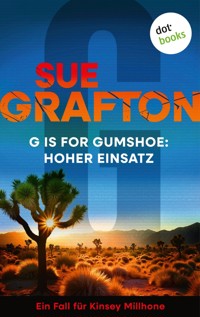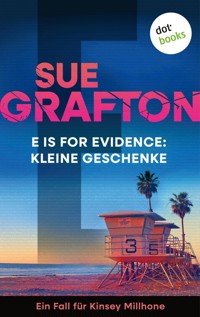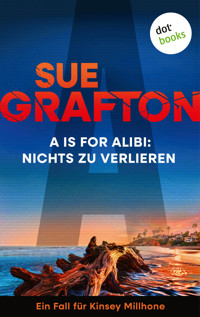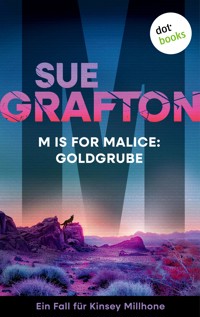
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kinsey Millhone
- Sprache: Deutsch
In ihrem dreizehnten Fall wird die Kultermittlerin in ein tödliches Familiendrama um Erbe, Schuld und Vergeltung gezogen … Als Privatermittlerin Kinsey Millhone von ihrer Cousine beauftragt wird, den lange verschollenen Guy Malek – Erbe eines kalifornischen Bauimperiums – aufzuspüren, führt die Spur zu einem kleinen Ort nahe Santa Teresa. Dort lebt Guy unter neuem Namen ein ruhiges Leben – geläutert, fromm und weit entfernt von seiner zerrütteten Familie. Als Millhone ihn zur Rückkehr überzeugt, ist Guy kurz darauf tot – brutal erschlagen im Haus seiner Kindheit. Entsetzt über den Mord nimmt Kinsey die Ermittlungen auf und stößt auf ein düsteres Netz aus Schuld, gestohlenem Erbe und einer lange geplanten Rache. Doch der Täter lauert näher, als sie je geahnt hätte … »Wenn ein Fan einmal einen von Graftons Alphabet-Romanen gelesen hat, wird er oder sie nicht ruhen, bis alle anderen gefunden sind.« Los Angeles Herald Examiner Der dreizehnte Band einer der erfolgreichsten Krimiserien überhaupt, der unabhängig gelesen werden kann – ein fesselnder Ermittlerkrimi für Fans von James Patterson und Sara Paretsky. In ihrem vierzehnten Fall bringt Kinsey Millhone ein dunkles Geheimnis ans Licht – und macht sich selbst zur Zielscheibe … »Kinsey ist zurück und besser denn je. Sue Grafton hat ein weiteres Buch herausgebracht, das man bis zum letzten Wort nicht aus der Hand legen kann.« – Amazon-Leser »Totale Spannung und ein schockierendes Ende. Dieses Buch ist ein absolutes Muss.«– Amazon-Leserin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als Privatermittlerin Kinsey Millhone von ihrer Cousine beauftragt wird, den lange verschollenen Guy Malek – Erbe eines kalifornischen Bauimperiums – aufzuspüren, führt die Spur zu einem kleinen Ort nahe Santa Teresa. Dort lebt Guy unter neuem Namen ein ruhiges Leben – geläutert, fromm und weit entfernt von seiner zerrütteten Familie. Als Millhone ihn zur Rückkehr überzeugt, ist Guy kurz darauf tot – brutal erschlagen im Haus seiner Kindheit. Entsetzt über den Mord nimmt Kinsey die Ermittlungen auf und stößt auf ein düsteres Netz aus Schuld, gestohlenem Erbe und einer lange geplanten Rache. Doch der Täter lauert näher, als sie je geahnt hätte …
eBook-Neuausgabe Oktober 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »M is for Malice« bei Henry Holt, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Goldgrube« im C. Bertelsmann Verlag, München.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1996 by Sue Grafton
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Svetolk, Constantin Seltea, frank 60 und AdobeStock/Pathiphan Phadungrat
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (fb)
ISBN 978-3-69076-371-4
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected] .
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sue Grafton
M is for Malice: Goldgrube
Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen von Ariane Böckler
dotbooks.
Für meine guten Freunde ... Barbara Brightman Jones und Joe Jones und Joanna Barnes und Jack Warner
Kapitel 1
Robert Dietz trat am Mittwoch, dem achten Januar, wieder in mein Leben. Ich erinnere mich an das Datum, weil es Elvis Presleys Geburtstag war und einer der lokalen Radiosender angekündigt hatte, sie würden die nächsten vierundzwanzig Stunden damit verbringen, jeden Song zu spielen, den er je gesungen hatte. Um sechs Uhr morgens plärrte mein Radiowecker mit »Heartbreak Hotel« in voller Lautstärke los. Ich schlug mit der flachen Hand auf den Ausschaltknopf und rollte mich wie gewohnt aus dem Bett. Dann schlüpfte ich zur Vorbereitung auf meinen morgendlichen Dauerlauf in den Jogginganzug, putzte mir die Zähne, spritzte mir Wasser ins Gesicht und trottete die Wendeltreppe hinab. Ich schloß die Haustür hinter mir ab und ging hinaus, wo ich, an den Türpfosten vor meiner Wohnung gelehnt, ein paar obligatorische Stretching-Übungen machte. Der Tag konnte nur seltsam werden, da mir ein gefürchtetes Mittagessen mit Tasha Howard bevorstand, einer meiner kürzlich entdeckten Cousinen ersten Grades. Joggen war das einzige, was mir einfiel, um mein Unbehagen zu dämpfen. Mein Ziel war der Fahrradweg, der am Strand entlangführt.
Ach, der Januar. Die Feiertage hatten mich unruhig gemacht, und der Anbruch des neuen Jahres löste eine dieser endlosen inneren Diskussionen über den Sinn des Lebens aus. Normalerweise achte ich nicht besonders auf den Lauf der Zeit, aber dieses Jahr nahm ich mich aus irgendeinem Grund selbst unter die Lupe. Wer war ich wirklich innerhalb des Gesamtsystems, und worauf lief das alles hinaus? Fürs Protokoll: Ich heiße Kinsey Millhone, bin weiblich, alleinstehend, fünfunddreißig Jahre alt und alleinige Inhaberin von Kinsey Millhone Investigations in der südkalifornischen Stadt Santa Teresa. Ich habe eine Ausbildung zur Polizistin durchlaufen und zwei Jahre bei der Polizei von Santa Teresa gearbeitet, bevor mir das Leben in die Quere kam, was eine ganz andere Geschichte ist, und zwar eine, die ich (noch) nicht zu erzählen beabsichtige. Seit mittlerweile zehn Jahren verdiene ich mein Geld als Privatdetektivin. An manchen Tagen sehe ich mich selbst (edel, ich geb’s zu) als Kämpferin gegen das Böse im Ringen um Recht und Ordnung. An anderen Tagen gestehe ich ein, daß die dunklen Mächte an Boden gewinnen.
Nicht alles davon war mir bewußt. Ein Teil meiner diffusen Grübelei vollzog sich auf einer Ebene, die ich kaum wahrnahm. Es ist ja nicht so, daß ich meine Tage in einem Zustand unablässiger Angst verbringe, die Hände ringe und mir die Kleider zerreiße. Ich vermute, daß das, was ich durchmachte, eine leichte Form von Depression war, ausgelöst (vielleicht) durch die schlichte Tatsache, daß es Winter war und die kalifornische Sonne sich rar machte.
Ich habe meine Laufbahn mit der Untersuchung von Brandstiftungen und Ansprüchen aufgrund fahrlässiger Tötung für die California Fidelity Insurance begonnen. Vor einem Jahr kam meine Verbindung zur CFI zu einem abrupten und schimpflichen Ende, und derzeit teile ich Büroräume mit der Anwaltskanzlei Kingman und Ives und nehme nahezu alles an, um über die Runden zu kommen. Ich bin lizenziert, vereidigt und komplett versichert. Ich habe fünfundzwanzigtausend Dollar auf einem Sparbuch, wodurch ich mir den Luxus erlauben kann, jeden Kunden wegzuschicken, der mir nicht paßt. Bis jetzt habe ich zwar noch keinen Fall abgelehnt, aber ich habe es schon ernsthaft in Erwägung gezogen.
Tasha Howard, die bereits erwähnte Cousine, hatte mich angerufen und mir einen Auftrag angeboten, wobei jedoch der Fall in seinen Einzelheiten noch nicht zur Sprache gekommen war. Tasha ist Anwältin und hat sich auf Testamente und Nachlässe spezialisiert. Sie arbeitet für eine Kanzlei, die Büros unterhält in San Francisco und in Lompoc, etwa eine Stunde nördlich von Santa Teresa. Soweit ich es verstanden habe, teilt sie ihre Zeit in etwa gleichmäßig zwischen den beiden auf. Normalerweise bin ich an Arbeit interessiert, aber Tasha und ich stehen uns nicht direkt nahe, und ich vermutete, daß sie den Köder eines Auftrags benutzte, um sich in mein Leben einzuschleichen.
Wie es der Zufall wollte, kam ihr erster Anruf am Tag nach Neujahr, und so konnte ich ihr ausweichen, indem ich behauptete, ich machte noch Urlaub. Als sie am siebten Januar erneut anrief, gab es kein Entrinnen mehr. Ich saß im Büro und steckte gerade mitten in einer anstrengenden Patience, als das Telefon klingelte.
»Hi, Kinsey. Hier ist Tasha. Ich dachte, ich versuche es noch mal bei dir. Habe ich dich in einem ungünstigen Moment erwischt?«
»Es paßt schon«, sagte ich. Ich begann zu schielen und tat so, als brächte ich mich mit einem den Schlund hinabgerichteten Finger selbst zum Würgen. Natürlich konnte sie das nicht sehen. Ich legte eine rote Acht auf eine schwarze Neun und deckte die letzten drei Karten auf. Soweit ich sah, würde die Patience nicht aufgehen. »Wie geht’s?« fragte ich, vielleicht eine Millisekunde zu spät.
»Ganz gut, danke. Und dir?«
»Mir geht’s gut«, sagte ich. »Mensch, ist das ein Zufall, daß du ausgerechnet jetzt anrufst. Gerade wollte ich den Hörer abnehmen. Ich habe den ganzen Vormittag Anrufe erledigt, und du warst die nächste auf meiner Liste.« Ich benutze oft das Wort Mensch, wenn ich das Blaue vom Himmel herunterlüge.
»Freut mich, das zu hören«, sagte sie. »Ich dachte, du gingst mir aus dem Weg.«
Ich lachte. Ha. Ha. Ha. »Überhaupt nicht«, sagte ich. Ich wollte meinen Protest schon weiter ausführen, doch sie redete unverdrossen weiter. Da ich ohnehin keine Karte mehr ablegen konnte, schob ich sie allesamt beiseite und begann, meine Schreibtischauflage mit ein paar Arbeitsplatz-Graffiti zu verzieren. Ich schrieb das Wort KOTZ in Blockbuchstaben und versah jeden einzelnen davon mit einer dreidimensionalen Schattierung.
Sie fragte: »Wie sieht dein Terminplan für morgen aus? Können wir uns eine Stunde zusammensetzen? Ich muß sowieso nach Santa Teresa, und wir könnten uns zum Mittagessen treffen.«
»Das ginge wahrscheinlich«, sagte ich vorsichtig. In dieser Welt kommt man mit Lügen nur so lange weiter, bis einen die Wahrheit einholt. »Worum geht es denn?«
»Das würde ich lieber unter vier Augen besprechen. Paßt dir zwölf Uhr?«
»Klingt gut«, sagte ich.
»Wunderbar. Ich reserviere uns einen Tisch. Bei Emile’s-at-the-Beach. Wir treffen uns dort«, sagte sie, und mit einem Klicken war sie weg.
Ich legte den Hörer auf, schob den Kugelschreiber beiseite und bettete meinen Kopf auf den Tisch. Was war ich doch für eine Idiotin! Tasha mußte gewußt haben, daß ich sie nicht sprechen wollte, ich hatte mich aber nicht getraut, ihr das zu sagen. Vor zwei Monaten hatte sie mir aus der Klemme geholfen, und obwohl ich ihr das Geld zurückgezahlt hatte, hatte ich immer noch das Gefühl, ihr etwas schuldig zu sein. Vielleicht würde ich ihr höflich zuhören, bevor ich ablehnte. Ich hatte noch einen anderen kleinen Auftrag auf Lager. Von einem Anwalt im ersten Stock unseres Gebäudes war ich engagiert worden, zwei Vorladungen zu eidlichen Zeugenaussagen in einem Zivilprozeß zuzustellen.
Am Nachmittag zog ich los und gab fünfunddreißig Dollar (plus Trinkgeld) für einen regulären Haarschnitt im Friseursalon aus. Sonst gehe ich immer alle sechs Wochen selbst mit einer Nagelschere auf meinen widerspenstigen Schopf los, wobei meine Technik darin besteht, daß ich jedes Haarbüschel abschneide, das hervorsteht. Ich muß mich wohl wirklich verunsichert gefühlt haben, da es mir normalerweise nicht einfiele, bares Geld für etwas hinzublättern, das ich so leicht selbst machen kann. Natürlich habe ich schon öfter zu hören bekommen, daß meine Frisur wie das Hinterteil eines jungen Hundes aussieht, aber was gibt es dagegen einzuwenden?
Der Morgen des achten Januar brach unvermeidlich an, und ich jagte wie von Furien gehetzt den Fahrradweg entlang. Meistens nutze ich meinen Dauerlauf als Möglichkeit, zu mir selbst zu kommen und den Tag und die Natur am Strand zu genießen. An diesem Morgen war ich ganz auf Arbeit konzentriert und strafte mich schon fast selbst durch die Energie, die ich in mein Training investierte. Als ich meinen Lauf und meine allmorgendlichen Verrichtungen beendet hatte, ging ich gar nicht erst ins Büro, sondern werkelte zu Hause herum. Ich bezahlte ein paar Rechnungen, räumte meinen Schreibtisch auf, wusch eine Maschine Wäsche und plauderte kurz mit meinem Vermieter Henry Pitts, während ich drei seiner frisch gebackenen Zimtschnecken verspeiste. Nervös war ich selbstverständlich nicht.
Wie üblich, wenn man auf etwas Unangenehmes wartet, schien die Uhr in Zehnminutensätzen vorwärtszuspringen. Ehe ich mich’s versah, stand ich vor meinem Badezimmerspiegel und trug – in Gottes Namen – preisreduzierte Kosmetika auf, während ich mich zusammen mit Elvis, der »It’s Now Or Never« sang, einem Gefühlsausbruch hingab. Die Mitsingerei versetzte mich in meine Schulzeit zurück – keine umwerfende Assoziation, aber trotzdem lustig. Damals verstand ich nicht mehr von Make-up als heute.
Ich überlegte, ob ich mich besonders schick machen sollte, aber das wäre in meinen Augen wirklich zu weit gegangen, also schlüpfte ich in meine gewohnten Blue jeans, einen Rollkragenpullover, meinen Tweed-Blazer und Stiefel. Ich besitze genau ein Kleid, und das wollte ich nicht für einen solchen Anlaß verschwenden. Ich sah auf die Uhr: elf Uhr fünfundfünfzig. Emile’s war nicht weit, gerade fünf Minuten zu Fuß. Wenn ich Glück hatte, würde mich beim Überqueren der Straße ein Lastwagen anfahren.
Als ich eintraf, waren fast alle Tische besetzt. In Santa Teresa machen die Strandrestaurants den Löwenanteil ihres Geschäfts in der Touristensaison im Sommer, wenn die Motels und Pensionen in Meeresnähe allesamt ausgebucht sind. Nach dem Labor Day Anfang September werden die Menschenströme dünner, bis die Stadt wieder ihren Bewohnern gehört. Aber Emile’s-at-the-Beach ist auch unter den Einheimischen sehr beliebt und scheint unter dem turnusmäßigen Kommen und Gehen der auswärtigen Gäste nicht zu leiden.
Tasha mußte mit dem Wagen von Lompoc heruntergefahren sein, da ein schnittiger roter Trans Am mit einem persönlichen Kennzeichen, auf dem TASHA H stand, am Bordstein parkte. Unter Detektiven nennt man so etwas einen Anhaltspunkt. Außerdem macht der Flug von Lompoc hier herunter mehr Ärger, als er wert ist. Ich betrat das Restaurant und suchte die Tische ab. Ich verspürte nur wenig Lust auf die Begegnung, aber ich wollte für alle Möglichkeiten offenbleiben. Welche das waren, wußte ich nicht zu sagen.
Ich entdeckte Tasha hinter einem der bogenförmigen Durchgänge, bevor sie mich sah. Sie saß in einem kleinen Nebenzimmer abseits des Hauptspeisesaals. Emile hatte sie an einen Zweiertisch direkt am Fenster plaziert. Sie blickte hinaus auf den Kinderspielplatz, der auf der anderen Straßenseite in dem kleinen Park am Strand lag. Das Planschbecken war geschlossen und den Winter über abgelassen worden, ein Kreis aus blaulackiertem Gips, der jetzt wie ein Landeplatz für ein UFO wirkte. Zwei Kinder im Vorschulalter kletterten mühsam rückwärts auf eine daneben stehende Rutsche, die im Sand verankert war. Ihre Mutter saß mit einer Zigarette in der Hand auf der niedrigen Einfassungsmauer aus Beton. Hinter ihr sah man die nackten Masten der Boote, die im Hafen lagen. Der Tag war sonnig und kühl, und am blauen Himmel jagten die Wolken dahin, die ein Unwetter zurückgelassen hatte, das nun nach Süden abzog.
Ein Kellner kam an Tashas Tisch, und sie sprachen kurz miteinander. Sie nahm eine Speisekarte von ihm entgegen. Ich konnte sehen, wie sie ihn darauf hinwies, daß sie noch auf jemanden wartete. Er zog sich zurück, und sie begann die Auswahl an Gerichten zu studieren. Ich hatte Tasha bisher nie zu Gesicht bekommen, aber im vorletzten Sommer war ich ihrer Schwester Liza begegnet. Ich war verblüfft gewesen, weil Liza und ich uns so ähnlich sahen. Tasha war drei Jahre älter und präsentierte sich solider. Sie trug ein graues Wollkostüm mit einer weißen, kragenlosen Seidenbluse, die aus dem tiefen V-Ausschnitt der Jacke hervorsah. Ihr dunkles Haar war von blonden Strähnen durchzogen und wurde von einer eleganten schwarzen Chiffonschleife an ihrem Nackenansatz hinten zusammengehalten. Der einzige Schmuck, den sie trug, war ein Paar überdimensionale Goldohrringe, die glitzerten, wenn sie sich bewegte. Da sie sich mit der Verwaltung von Nachlässen beschäftigte, hatte sie vermutlich nicht viel Gelegenheit zu flammenden Plädoyers im Gerichtssaal, aber trotzdem würde sie bei einem verbalen Geplänkel ziemlich einschüchternd wirken. Auf der Stelle beschloß ich, meine Angelegenheiten zu ordnen.
Sie erblickte mich, und ich sah, wie sich ihre Miene belebte, als sie die erstaunliche Ähnlichkeit auch zwischen uns beiden registrierte. Womöglich besaßen alle Kinsey-Cousinen die gleichen Gesichtszüge. Ich hob eine Hand zum Gruß und bahnte mir durch die zahlreichen Mittagsgäste den Weg zu ihrem Tisch. Ich setzte mich auf den Platz ihr gegenüber und schob meine Tasche unter den Stuhl. »Hallo, Tasha.«
Einen Moment lang musterten wir uns gegenseitig. Auf der High School hatte ich mich in Biologie mit Mendels roten und weißen Erbsenblüten beschäftigt; mit dem Kreuzen von Farben und dem sich daraus ergebenden Muster der »Nachkommenschaft«. Genau dieses Prinzip war auch hier am Werk. Von nahem konnte ich sehen, daß sie dunkle Augen hatte, während meine haselnußbraun waren, und daß ihre Nase so aussah wie meine, bevor sie mir zweimal gebrochen wurde. Sie zu sehen war, als sähe ich mich selbst unvermittelt in einem Spiegel, ein zugleich fremder und vertrauter Anblick. Ich und nicht ich.
Tasha brach das Schweigen. »Das ist ja unheimlich. Liza hat mir zwar gesagt, daß wir uns ähnlich sehen, aber damit habe ich wirklich nicht gerechnet.«
»Es steht offenbar außer Zweifel, daß wir verwandt sind. Was ist mit den anderen Cousinen? Sehen sie auch aus wie wir?«
»Variationen zu einem Thema. Als Pam und ich Teenager waren, wurden wir oft miteinander verwechselt.« Pam war die Schwester zwischen Tasha und Liza.
»Hat Pam ihr Baby inzwischen bekommen?«
»Schon vor Monaten. Ein Mädchen. Große Überraschung«, sagte sie trocken. Ihr Tonfall war ironisch, aber ich begriff den Witz nicht. Sie spürte die unausgesprochene Frage und lächelte daraufhin flüchtig. »Alle Kinsey-Frauen bekommen Mädchen. Ich dachte, du wüßtest das.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Pam hat sie Cornelia getauft, um sich bei Grand einzuschmeicheln. Leider versuchen wohl die meisten von uns hin und wieder, bei ihr Punkte zu sammeln.«
Cornelia LaGrand war der Mädchenname meiner Großmutter, Burton Kinsey. »Grand« war seit dem Säuglingsalter ihr Spitzname gewesen. Soweit ich gehört hatte, regierte sie die Familie mit eiserner Hand. Sie war großzügig mit Geld, aber nur, wenn man nach ihrer Pfeife tanzte – genau der Grund, aus dem die Familie mich und meine Tante Gin neunundzwanzig Jahre lang so gezielt ignoriert hatte. Ich war in einfachen Verhältnissen groß geworden, eindeutig untere Mittelschicht. Tante Gin, die mich aufgezogen hat, hatte als Bürokraft für California Fidelity Insurance gearbeitet, die Firma, die mich schließlich auch eingestellt (und wieder gefeuert) hatte. Sie war mit einem bescheidenen Gehalt ausgekommen, und wir hatten nie viel besessen. Wir hatten stets in mobilen Behausungen gelebt – Wohnwagen mit wenig Platz –, die ich immer noch bevorzuge. Zugleich war mir aber selbst damals klar, daß andere Leute Wohnwagen für schäbig hielten. Warum, weiß ich nicht.
Tante Gin hatte mir beigebracht, mich niemals bei jemandem einzuschmeicheln. Was sie mir allerdings verschwiegen hatte, war, daß es einige Verwandte gab, bei denen sich das Einschmeicheln durchaus lohnte.
Tasha war sich des Dickichts, in das ihre Bemerkungen führten, vermutlich bewußt, und ging zum Nächstliegenden über. »Laß uns erst einmal zu Mittag essen, dann kann ich dich über den Fall informieren.«
Wir erledigten den angenehmen Teil, unser Essen zu bestellen und zu verspeisen, und plauderten dabei nur über äußerst belanglose Themen. Sowie unsere Teller abgetragen waren, wurde sie allerdings mit einem wirkungsvollen Wechsel ihres Tonfalls ganz geschäftsmäßig. »Klienten von uns hier in Santa Teresa sind in einer verzwickten Lage, die dich vielleicht interessieren könnte. Kennst du die Maleks? Ihnen gehört Malek Construction.«
»Ich kenne sie nicht persönlich, aber der Name ist mir geläufig.« Ich hatte das Firmenlogo schon auf Baustellen in der Stadt gesehen, ein weißes Achteck wie ein Stopschild, auf dem in der Mitte die Umrisse eines roten Zementmischers prangten. Alle Firmenlastwagen und Baustellentoiletten waren rot wie die Feuerwehr, und die Wirkung war bestechend.
Tasha fuhr fort: »Es ist eine Sand- und Kiesfirma. Mr. Malek ist vor kurzem verstorben, und unsere Kanzlei verwaltet den Nachlaß.« Der Kellner kam und füllte unsere Kaffeetassen nach. Tasha nahm ein Zuckerpäckchen und faltete erst auf allen Seiten die Kanten des papierenen Randes um, bevor sie die Ecke abriß. »Bader Malek hat 1943 eine Kiesgrube gekauft. Ich weiß nicht, was er damals dafür bezahlt hat, aber heute ist sie ein Vermögen wert. Kennst du dich mit Kies aus?«
»Nicht die Bohne«, antwortete ich.
»Ich auch nicht, bis diese Sache aktuell wurde. Eine Kiesgrube wirft auf die Schnelle nicht sonderlich viel Gewinn ab, aber interessanterweise wurde es im Lauf der letzten dreißig Jahre durch Umweltgesetze und Landnutzungsregelungen immer schwieriger, eine neue Kiesgrube aufzumachen. In diesem Teil Kaliforniens gibt es einfach nicht besonders viele. Wenn man nun die Kiesgrube für seine Region besitzt und die Baubranche boomt – was sie zur Zeit tut –, dann wird die Grube von einem Flop in den Vierzigern zu einem richtigen Schatz in den Achtzigern, natürlich immer abhängig davon, wie tief und von welcher Qualität die Kiesreserven sind. Inzwischen steht fest, daß diese hier in einer idealen Kieszone liegt und sich vermutlich weitere hundert oder hundertfünfzig Jahre ausbeuten läßt. Da heutzutage niemand mehr eine Genehmigung bekommt... tja, du hast sicher begriffen, was ich damit sagen will.«
»Wer hätt’s gedacht?«
»Eben«, sagte sie und fuhr fort. »Bei Kies empfiehlt es sich, in der Nähe von Ortschaften zu sein, wo gebaut wird, da der größte Kostenfaktor der Transport ist. Auf jeden Fall war Bader Malek ein kleines Kraftwerk, und er hat es geschafft, seine Profite zu maximieren, indem er in andere Bereiche expandierte, die aber allesamt mit der Baubranche zu tun hatten. Malek Construction ist heute die drittgrößte Baufirma im Bundesstaat. Und sie ist nach wie vor in Familienbesitz; eine von wenigen, könnte ich hinzufügen.«
»Und wo liegt das Problem?«
»Dazu komme ich gleich, aber ich muß erst noch ein bißchen weiter ausholen. Bader und seine Frau Rona hatten vier Söhne – wie Orgelpfeifen, alle genau zwei Jahre auseinander. Donovan, Guy, Bennet und Jack. Donovan ist inzwischen Mitte Vierzig, und Jack vermutlich neununddreißig. Donovan ist der beste von ihnen: ein typischer Erstgeborener, zuverlässig, verantwortungsvoll und der große Leistungsträger unter den Geschwistern. Seine Frau Christie und ich waren im College zusammen auf einem Zimmer, und dadurch bin ich überhaupt erst in diese Sache verwickelt worden. Der zweite Sohn, Guy, hat sich als Nichtsnutz entpuppt. Die anderen beiden sind in Ordnung. Allerdings nichts Großartiges, zumindest danach zu urteilen, was Christie gesagt hat.«
»Arbeiten sie für die Firma?«
»Nein, aber Donovan bezahlt trotzdem alle ihre Rechnungen. Bennet bildet sich ein, ›Unternehmer‹ zu sein, was heißt, daß er Jahr für Jahr bei schlechten Geschäften Riesensummen in den Sand setzt. Momentan versucht er sich in der Restaurantbranche. Er will mit zwei Teilhabern ein Lokal unten auf dem Granita eröffnen. Hinausgeworfenes Geld ist gar kein Ausdruck. Der Mann muß verrückt sein. Jack vertreibt sich die Zeit mit Golfspielen. Soweit ich weiß, ist er begabt genug, um bei den Profis mitzumischen, aber wahrscheinlich nicht so gut, daß er davon leben kann.
Auf jeden Fall war damals in den Sechzigern Guy derjenige, der Marihuana geraucht und sich wüst aufgeführt hat. Sein Vater war für ihn ein materialistischer, kapitalistischer Drecksack, und das hat er ihm auch bei jeder Gelegenheit gesagt. Guy geriet offenbar mehrmals ziemlich böse in die Klemme – wurde mit anderen Worten straffällig –, und Bader hat ihn schließlich enterbt. Donovan zufolge hat sein Vater Guy eine Pauschalsumme gegeben, und zwar zehntausend in bar, sein Anteil am damals noch bescheidenen Familienvermögen. Bader sagte dem Jungen, er solle die Fliege machen und nicht wiederkommen. Guy Malek verschwand und ward seitdem nicht mehr gesehen. Das war im März 1968. Damals war er sechsundzwanzig, also muß er heute dreiundvierzig sein. Ich glaube, es hat niemandem wirklich etwas ausgemacht, als er ging. Vermutlich war es eine Erleichterung, nach allem, was er der Familie zugemutet hatte. Rona war zwei Monate zuvor gestorben, im Januar desselben Jahres, und Bader hat mit dem Vorhaben, sein Testament zu ändern, seinen Anwalt aufgesucht. Du weißt ja, wie das vor sich geht: ›Daß ich in diesem Testament keine Verfügung zugunsten meines Sohnes Guy getroffen habe, geht nicht auf einen Mangel an Liebe oder Zuneigung meinerseits zurück, sondern liegt darin begründet, daß ich zu meinen Lebzeiten für ihn gesorgt habe und der Ansicht bin, daß diese Zuwendungen mehr als ausreichend waren‹ – bla bla bla. In Wirklichkeit hatte Guy ihn einen Haufen Geld gekostet, und er hatte die Nase voll.
So. Ausblende, Einblende. 1981 ist Baders Anwalt an einem Herzinfarkt gestorben, und Bader bekam seine gesamten juristischen Unterlagen zurück.«
Ich unterbrach sie. »Entschuldige. Ist das so üblich? Ich hätte angenommen, daß sämtliche Dokumente im Nachlaß des Anwalts aufbewahrt würden.«
»Kommt auf den Anwalt an. Vielleicht hat Bader darauf bestanden. Ich weiß es nicht genau. Ich vermute, er hatte einen ziemlichen Dickschädel. Damals hatte ihn der Krebs bereits in den Klauen, an dem er schließlich gestorben ist. Außerdem hatte er durch die massive Chemotherapie einen Schlaganfall erlitten, der ihn zusätzlich schwächte. So krank, wie er war, wollte er wahrscheinlich die Strapazen bei der Suche nach einem neuen Anwalt nicht auf sich nehmen. Seiner Ansicht nach waren seine Angelegenheiten ja auch geordnet, und was er mit seinem Geld anstellte, ging niemanden etwas an.«
Ich sagte: »O weh.« Ich wußte zwar nicht, was kommen würde, aber es klang nicht gut.
»›O weh‹ trifft es ganz genau. Als Bader vor zwei Wochen starb, ist Donovan seine Papiere durchgegangen. Das einzige Testament, das er gefunden hat, war jenes, das Bader und Rona 1965 unterzeichnet hatten.«
»Was ist mit dem späteren Testament geschehen?«
»Das weiß niemand. Vielleicht hat es der Anwalt aufgesetzt, und Bader hat es zur Durchsicht mit nach Hause genommen. Womöglich hat er es sich wieder anders überlegt. Oder vielleicht hat er das Testament so unterschrieben, wie es war, und erst später beschlossen, es zu vernichten. Tatsache ist jedenfalls, daß es weg ist.«
»Also ist er ohne letzten Willen verstorben?«
»Nein, nein. Wir haben ja noch das frühere Testament – das 1965 aufgesetzt wurde, bevor Guy ins schwarze Nichts geschleudert wurde. Es ist korrekt unterzeichnet und vollständig besiegelt, was bedeutet, daß Guy Malek, falls kein Einspruch erfolgt, zu den Erben gehört und ein Viertel des Nachlasses seines Vaters verlangen kann.«
»Wird Donovan dagegen Einspruch erheben?«
»Es ist nicht Donovan, der mir Sorgen macht. Das Testament von 1965 überträgt ihm die Verfügungsgewalt über den Familienbesitz, also sitzt er sowieso am längeren Hebel. Bennet ist derjenige, der davon redet, daß er Einspruch erheben will, aber er hat im Grunde keinerlei Beweise dafür, daß das spätere Testament existiert. Allerdings könnte das ohnehin alles für die Katz sein. Wenn Guy Malek vor Jahren von einem Lastwagen überfahren wurde oder an einer Überdosis gestorben ist, gibt es keine Probleme – solange er selbst keine Kinder hat.«
»Wird langsam kompliziert«, sagte ich. »Um wieviel Geld geht es eigentlich?«
»Daran arbeiten wir noch. Der Nachlaß wird momentan auf etwa vierzig Millionen Dollar geschätzt. Natürlich hat die Regierung Anspruch auf einen hübschen Batzen. Die Erbschaftssteuer liegt zwischen fünfzig und fünfundfünfzig Prozent. Dank Bader hat die Firma glücklicherweise kaum Schulden, also ist Donovan bis zu einem gewissen Betrag in der Lage, Kredite aufzunehmen. Außerdem können die Erben die Entrichtung der Erbschaftssteuer nach Steuergesetzbuch Abschnitt 6166 aufschieben, da Malek Construction als privat geführte Firma mehr als fünfunddreißig Prozent des geschätzten Gesamtnachlasses ausmacht. Wir werden vermutlich Gutachter suchen, die auf einen niedrigen Wert kommen, und dann hoffen, daß das Finanzamt bei der Wirtschaftsprüfung nicht allzu nachdrücklich auf einem höheren Wert besteht. Um deine Frage zu beantworten, die Jungs werden vermutlich jeder mit fünf Millionen Dollar nach Hause gehen. Guy kann sich glücklich schätzen.«
»Nur daß kein Mensch weiß, wo er ist«, sagte ich.
Tasha zeigte mit dem Finger auf mich. »Stimmt.«
Ich überlegte kurz. »Es muß ein Schock für die Brüder gewesen sein, als sie erfuhren, daß Guy einen genauso großen Anteil des Nachlasses erben würde.«
Tasha zuckte die Achseln. »Ich hatte bisher nur einmal Gelegenheit, mit Donovan zu sprechen, und er macht in diesem Punkt einen zuversichtlichen Eindruck. Er agiert als Nachlaßverwalter. Am Freitag reiche ich das Testament beim Nachlaßgericht ein. Im Grunde ist das einzige, was sie dort machen, das Testament zu Protokoll zu nehmen. Donovan hat mich gebeten, Bennet zuliebe den Antrag erst in einer Woche einzureichen, weil Bennet davon überzeugt ist, daß das spätere Testament noch auftaucht. In der Zwischenzeit erschiene es mir sinnvoll, wenn wir herausfinden könnten, wo sich Guy Malek aufhält. Ich dachte, wir könnten dich für die Suche engagieren, falls du interessiert bist.«
»Klar«, sagte ich sofort. Da zierte ich mich nicht lange! Ehrlich gesagt liebe ich Fälle mit Vermißten, und die Umstände machten mich neugierig. Wenn ich hinter einem Verschollenen her bin, winke ich oft mit der Aussicht auf plötzlichen Reichtum von einem jüngst verstorbenen Verwandten. In Anbetracht der Gier des Menschen ist das häufig von Erfolg gekrönt. In diesem Fall würde mir die Realität von fünf Millionen Dollar die Arbeit erleichtern. »Was hast du denn für Informationen über Guy?« fragte ich.
»Da müßtest du mit den Maleks sprechen. Die klären dich auf.« Sie kritzelte etwas auf die Rückseite einer Visitenkarte, die sie mir dann hinhielt. »Das ist Donovans Nummer im Geschäft. Hinten habe ich seine Privatadresse und -telefonnummer notiert. Abgesehen natürlich von Guy leben die Jungs noch alle zusammen auf dem Anwesen der Maleks.«
Ich studierte die Rückseite der Visitenkarte. Die Adresse sagte mir nichts. »Ist das im Ort oder irgendwo außerhalb? Das habe ich noch nie gehört.«
»Es gehört zum Stadtgebiet. In den Hügeln über der Stadt.«
»Ich rufe heute nachmittag dort an.«
Kapitel 2
Ich ging auf dem Cabana Boulevard nach Hause. Der Himmel hatte aufgeklart, und die Lufttemperatur lag bei etwa dreizehn Grad. Eigentlich befanden wir uns im tiefsten Winter, und die messingfarbene kalifornische Sonne war nicht so warm, wie sie aussah. Sonnenhungrige lagen verstreut im Sand wie Strandgut, das die Flut zurückgelassen hatte. Ihre gestreiften Schirme erzählten vom Sommer, und doch war das neue Jahr erst eine Woche alt. Das Sonnenlicht brach sich in den Wellen, die gegen die Pfähle unter dem Kai schlugen. Die Brandung mußte eiskalt sein und das Salzwasser in den Augen brennen, aber dennoch plätscherten Kinder in den Wellen umher und tauchten mit Begeisterung in die wirbelnden Tiefen hinab. Ich konnte ihre dünnen Schreie über dem Donnern der Brandung hören wie die von Sensationshungrigen auf einer Achterbahn, während sie sich in den eisigen Schrecken stürzten. Am Strand bellte ihnen ein nasser Hund entgegen und schüttelte sich das Wasser aus dem Fell. Selbst aus der Entfernung konnte ich erkennen, wo sich seine borstigen Haare in Schichten aufgeteilt hatten.
Ich bog nach links in die Bay Street ein. Vor dem Hintergrund aus Immergrün konkurrierten üppig wuchernde hellrosa und orangefarbene Geranien mit magentaroten Bougainvilleen, die über die Zäune in meinem Viertel wallten. Beiläufig fragte ich mich, wo ich mit der Suche nach Guy Malek anfangen sollte. Er war seit siebzehn Jahren verschwunden, und die Aussichten, ihn aufzuspüren, waren nicht gerade rosig. Ein solcher Auftrag erfordert Einfallsreichtum, Geduld und systematisches Vorgehen, aber der Erfolg hängt manchmal von reinem Glück und einer Spur Zauberei ab. Versuchen Sie mal, einem Kunden auf dieser Grundlage eine Rechnung zu stellen.
Sobald ich wieder zu Hause war, wusch ich mir das Make-up vom Gesicht, schlüpfte in meine Reeboks und tauschte meinen Blazer gegen ein rotes Sweatshirt ein. Unten in der Kochnische schaltete ich das Radio an und stellte den Sender mit dem Elvis-Marathon ein, der immer noch im Gange war. Mit lautlosen Lippenbewegungen sang ich den Text von »Jailhouse Rock« mit und tanzte hüftschwenkend im Wohnzimmer umher. Dann holte ich einen Stadtplan heraus und breitete ihn auf meinem Küchentresen aus. Ich stützte mich mit immer noch tanzendem Hinterteil auf die Ellbogen und suchte die Straße, in der die Maleks wohnten. Die Verdugo war ein schmales Sträßchen zwischen zwei parallel verlaufenden Straßen, die aus den Bergen herabführten. In dieser Gegend kannte ich mich nicht gut aus. Ich legte Donovans Visitenkarte auf den Tresen neben den Stadtplan, griff nach dem Wandtelefon und wählte die vorne abgedruckte Nummer.
Von der Empfangsdame der Firma wurde ich zu einer Sekretärin durchgestellt, die mir mitteilte, daß Malek draußen im Gelände sei, aber jeden Moment im Büro zurückerwartet werde. Ich nannte ihr meinen Namen und meine Telefonnummer und erklärte, was ich von ihm wollte. Sie sagte, sie werde ihn bitten, mich zurückzurufen. Ich hatte gerade aufgelegt, als ich ein Klopfen an der Tür hörte. Ich öffnete das Bullauge und sah mich Robert Dietz gegenüber.
Ich machte die Haustür auf. »Ja, wen haben wir denn da?« sagte ich. »Wo es doch erst zwei Jahre, vier Monate und zehn Tage her ist.«
»Wirklich schon so lang?« fragte er milde. »Ich bin gerade aus Los Angeles hochgefahren. Darf ich reinkommen?«
Ich trat einen Schritt zurück, und er ging an mir vorbei. Elvis hatte soeben zu »Always On My Mind« angesetzt, das ich offen gestanden in diesem Moment nicht vertragen konnte. Ich griff hinüber und machte das Radio aus. Dietz trug immer noch die gleichen Blue jeans, die gleichen Cowboy-Stiefel und das gleiche Sportsakko aus Tweed. Als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, hatte er dieselbe Kluft getragen, während er an der Wand eines Krankenhauszimmers lehnte, wo ich bewacht wurde, nachdem mich ein bezahlter Killer von der Straße abgedrängt hatte. Jetzt war er zwei Jahre älter, womit er ungefähr fünfzig sein mußte, kein schlechtes Alter für einen Mann. Er hatte im November Geburtstag, ein dreifacher Skorpion, für diejenigen, die darauf etwas geben. Die letzten drei Monate unserer Beziehung hatten wir zusammen im Bett verbracht, wenn wir nicht draußen am Schießstand waren und Schießübungen mit mosambikanischen Pistolen machten. Eine Liebesaffäre unter Privatdetektiven ist eine merkwürdige und wundersame Angelegenheit. Er wirkte ein bißchen massiger, aber das lag daran, daß er mit dem Rauchen aufgehört hatte – vorausgesetzt, er hatte nicht doch wieder angefangen ...
»Möchtest du einen Kaffee?« fragte ich.
»Gern. Wie geht’s dir? Du siehst gut aus. Der Haarschnitt gefällt mir.«
»Vierzig Dollar. So eine Verschwendung! Ich hätte es selbst machen sollen.« Ich suchte alles Nötige für eine Kanne Kaffee zusammen und nutzte die häusliche Beschäftigung, um meine Gefühlslage zu ergründen. Eigentlich empfand ich nicht viel. Ich freute mich, ihn zu sehen, genauso wie ich mich über die Begegnung mit jedem alten Freund gefreut hätte, doch über eine gewisse Neugier hinaus blieb mir ein Aufwallen der sexuellen Chemie erspart. Ich verspürte weder heftige Freude angesichts seines Auftauchens noch Ärger darüber, daß er unangemeldet gekommen war. Er war ein impulsiver Mann: ungeduldig, ruhelos, sprunghaft. Er sah müde aus, und sein Haar wirkte wesentlich grauer, fast aschgrau um die Ohren. Er setzte sich auf einen meiner Küchenhocker und lehnte die Unterarme auf den Tresen.
Ich schaltete die Kaffeemaschine ein und stellte die Tüte mit dem gemahlenen Kaffee wieder in den Kühlschrank. »Wie war’s in Deutschland?«
Dietz war ein Privatdetektiv aus Carson City, Nevada, der sich auf Personenschutz spezialisiert hatte. Er hatte das Land verlassen, um nach Deutschland zu gehen, wo er antiterroristische Trainingsprogramme für Militärstützpunkte in Übersee leitete. Er antwortete: »Gut, solange es lief. Irgendwann blieben die Gelder aus. Heutzutage will Uncle Sam keine Mäuse mehr für so was rauswerfen. Aber es hat mich sowieso angeödet: als Mann mittleren Alters durchs Unterholz zu kriechen. Ich mußte zwar nicht unbedingt mit ihnen rausgehen, aber ich konnte es nicht lassen.«
»Und was bringt dich wieder her? Arbeitest du an einem Fall?«
»Ich will die Küste hochfahren, um die Jungs in Santa Cruz zu besuchen.« Dietz hatte zwei Söhne mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin, einer Frau namens Naomi, die sich standhaft geweigert hatte, ihn zu heiraten. Sein älterer Sohn Nick war inzwischen vermutlich zwanzig. Ich wußte nicht genau, wie alt der jüngere Sohn war.
»Ah. Und wie geht es ihnen?«
»Phantastisch. Sie müssen diese Woche irgendwelche Hausarbeiten abgeben, also habe ich gesagt, ich würde noch bis Samstag warten und dann erst hochkommen. Wenn sie ein paar Tage frei kriegen, würde ich gern ein bißchen mit ihnen wegfahren.«
»Mir ist aufgefallen, daß du hinkst. Woher kommt das?«
Er tätschelte seinen linken Oberschenkel. »Ein kaputtes Knie«, antwortete er. »Hab mir bei Nachtmanövern den Meniskus gerissen, als ich über ein Schlagloch gestolpert bin. Das ist jetzt schon die zweite Meniskusverletzung, und die Docs sagen, ich müßte mir eine Knieplastik machen lassen. An einer Operation bin ich nicht interessiert, aber ich habe mich bereit erklärt, dem Knie etwas Ruhe zu gönnen. Außerdem bin ich ausgelaugt. Ich brauchte einen Tapetenwechsel.«
»Du warst auch ausgelaugt, bevor du weggegangen bist.«
»Nicht ausgelaugt. Ich habe mich gelangweilt. Aber ich glaube, weder das eine noch das andere läßt sich dadurch heilen, daß man immer weiter das gleiche macht.« Dietz’ graue Augen waren sehr klar. Er war auf seine ungewöhnliche Weise ein gutaussehender Mann. »Ich dachte, ich könnte vielleicht ein paar Tage auf deiner Couch kampieren, wenn du nichts dagegen hast. Ich soll möglichst wenig auf den Beinen sein und mir Eis aufs Knie legen.«
»Also wirklich! Das ist ja reizend. Du verschwindest für zwei Jahre aus meinem Leben, und dann tauchst du wieder auf, weil du eine Krankenschwester brauchst? Vergiß es.«
»Ich verlange nicht von dir, daß du dir Umstände machst«, sagte er. »Ich nehme an, du hast zu tun, also bist du doch ohnehin den ganzen Tag unterwegs. Ich sitze einfach hier und lese oder sehe fern und kümmere mich um meinen eigenen Kram. Ich habe sogar meine eigenen Eisbeutel dabei, die man ins Kühlfach legt. Ich will nicht, daß irgendwer um mich herumschwirrt. Du wirst keinen Finger krumm machen müssen.«
»Findest du es nicht ein klein wenig aufdringlich, mich auf diese Art damit zu überfallen?«
»Es ist nicht aufdringlich, solange du die Möglichkeit hast, nein zu sagen.«
»Oh, klar. Und Schuldgefühle entwickle? Das sehe ich anders«, sagte ich.
»Warum solltest du Schuldgefühle entwickeln? Schmeiß mich raus, wenn es dir nicht paßt. Was ist denn los mit dir? Wenn wir einander nicht die Wahrheit sagen können, wozu soll dann eine Beziehung gut sein? Tu, was du willst. Ich kann mir ein Motel suchen oder heute abend noch die Küste hinauffahren. Ich dachte nur, es wäre nett, ein bißchen zusammenzusein.«
Ich beäugte ihn mißtrauisch. »Ich werd’s mir überlegen.« Es hatte keinen Sinn, ihm zu sagen – nachdem ich schon kaum bereit war, es mir selbst gegenüber zuzugeben –, wie stumpf mir das Licht in den Tagen nach seiner Abreise vorgekommen war, wie sich jedesmal Beklemmung in mir geregt hatte, wenn ich nach Hause in die leere Wohnung kam, wie Musik mir ständig geheime Botschaften zuzuflüstern schien. Friß oder stirb. Es schien keinen Unterschied zu machen. Hundertmal hatte ich mir seine Rückkehr ausgemalt, aber nie auf diese Art. Nun war die Stumpfheit eine innerliche geworden, und all meine früheren Gefühle für ihn hatten sich von leidenschaftlichem Engagement zu gelindem Interesse – bestenfalls – gewandelt.
Dietz hatte mich beobachtet, und sein Blinzeln zeigte mir, daß er verblüfft war. »Bist du wegen irgend etwas sauer?«
»Überhaupt nicht«, sagte ich.
»Doch, bist du.«
»Nein, bin ich nicht.«
»Weswegen bist du denn so sauer?«
»Würdest du das bitte lassen. Ich bin nicht sauer.«
Er musterte mich einen Augenblick lang, dann hellte sich seine Miene auf. Er sagte: »Ohhh, jetzt hab ich’s kapiert. Du bist sauer, weil ich gegangen bin.«
Ich spürte, wie meine Wangen Farbe bekamen, und brach den Blickkontakt ab. Ich stellte den Salz- und den Pfefferstreuer so nebeneinander, daß sich ihre Standflächen gerade berührten. »Ich bin nicht sauer, weil du gegangen bist. Ich bin sauer, weil du zurückgekommen bist. Endlich habe ich mich ans Alleinsein gewöhnt, und jetzt bist du wieder da. Wo bleibe ich dabei?«
»Du hast gesagt, du seist gern allein.«
»Stimmt. Ich kann es aber nicht leiden, zuerst aufgenommen und dann wieder fallengelassen zu werden. Ich bin kein Haustier, das du nach Belieben ins Tierheim stecken und wieder abholen kannst.«
Sein Lächeln erstarb. »›Fallengelassen‹? Du bist nicht fallengelassen worden. Was soll denn das heißen?«
In diesem Moment klingelte das Telefon und ersparte uns weitere Diskussionen. Donovan Maleks Sekretärin sagte: »Miss Millhone? Ich habe Mr. Malek für Sie am Apparat. Können Sie einen Moment dranbleiben?«
»Ja, ich warte.«
Dietz sagte mit lautlosen Lippenbewegungen: Bist du nicht.
Ich streckte ihm die Zunge heraus. Manchmal wirke ich sehr reif.
Donovan Malek kam ans Telefon und meldete sich. »Guten Tag, Miss Millhone ...«
»Nennen Sie mich doch Kinsey.«
»Danke. Hier ist Donovan Malek. Ich habe gerade mit Tasha Howard gesprochen, und sie hat mir erzählt, daß sie heute mittag mit Ihnen geredet hat. Ich nehme an, sie hat Sie über die Lage unterrichtet.«
»Weitgehend«, sagte ich. »Können wir uns irgendwie treffen? Tasha möchte alles so schnell wie möglich vom Tisch haben.«
»Ganz meine Meinung. Hören Sie, ich habe ungefähr eine Stunde Zeit, bevor ich woandershin muß. Ich kann Ihnen ein paar grundlegende Informationen geben – Guys Geburtsdatum, seine Sozialversicherungsnummer und ein Foto, wenn Ihnen das etwas nützt«, sagte er. »Möchten Sie kurz hier rauskommen?«
»Klar, das kann ich machen«, sagte ich. »Was ist mit Ihren Brüdern? Besteht die Möglichkeit, daß ich auch mit ihnen sprechen kann?«
»Natürlich. Bennet hat gesagt, er käme heute nachmittag gegen vier nach Hause. Ich rufe Myrna an – das ist die Haushälterin – und lasse ausrichten, daß Sie ihn sprechen möchten. Bei Jack bin ich mir nicht so sicher. Er ist ein bißchen schwerer zu erwischen, aber das kriegen wir schon hin. Was Sie von mir nicht erfahren, können Sie sich von den beiden sagen lassen. Wissen Sie, wo ich bin? Auf der Dolores draußen in Colgate. Sie fahren an der Ausfahrt nach Peterson ab, dann über den Freeway und ein Stück zurück. Von da aus ist es die zweite Straße rechts.«
»Klingt gut. Bis gleich.«
Als ich den Hörer auflegte, sah Dietz auf seine Uhr. »Du bist also unterwegs. Ich muß mich bei einem alten Freund melden und werde ein Weilchen weg sein. Hast du später Zeit?«
»Erst ab sechs oder so. Kommt auf meinen Termin an. Ich versuche, einen Mann aufzuspüren, der seit siebzehn Jahren verschwunden ist, und ich möchte mir gern ein paar Hintergrundinformationen von seiner Familie besorgen.«
»Ich lade dich zum Essen ein, wenn du noch nichts gegessen hast, oder wir können ausgehen und etwas trinken. Ich möchte dir wirklich nicht zur Last fallen.«
»Das können wir später besprechen. In der Zwischenzeit brauchst du aber einen Schlüssel.«
»Das wäre gut. Dann kann ich noch duschen, bevor ich mich auf die Socken mache, und abschließen, wenn ich gehe.«
Ich zog die Krimskrams-Schublade in der Küche auf, nahm den Ersatzschlüssel, der an seinem eigenen Ring hin, heraus und schob ihn über den Tresen.
»Ist dir das auch recht? Ich weiß, daß du nicht gern belagert wirst. Ich kann mir auch ein kleines Zimmer auf dem Cabana nehmen, wenn du lieber Ruhe und Frieden möchtest.«
»Momentan ist es mir recht. Wenn es mir zuviel wird, sage ich es. Laß uns einfach improvisieren«, sagte ich. »Ich hoffe, du magst den Kaffee schwarz. Es gibt weder Milch noch Zucker. Tassen sind da oben.«
Er steckte den Schlüssel in die Tasche. »Ich weiß, wo die Tassen sind. Bis später.«
Malek Construction bestand aus einer Reihe miteinander verbundener Wohnwagen, die wie Dominosteine angeordnet waren und in einer Sackgasse in einem Industriepark standen. Hinter den Büros befand sich eine asphaltierte Fläche voller roter Fahrzeuge: Lieferwagen, Zementmischer, Kipper und Straßenbaumaschinen, alle mit dem weiß-roten Firmenlogo. Eine zweistöckige Werkstatt aus Wellblech erstreckte sich entlang der Rückseite des Grundstücks, offenbar angefüllt mit Wartungs- und Reparaturwerkzeug für den immensen Fuhrpark der Firma. Auch Zapfsäulen standen bereit. Auf der einen Seite sah ich vor einem Gewirr von Büschen sechs leuchtendgelbe Kettenschlepper und zwei John-Deere-Planierraupen stehen. Männer mit Helmen und roten Overalls gingen ihrer Arbeit nach. Die Ruhe wurde vom Rumpeln näher kommender Schwerfahrzeuge, einem gelegentlichen schrillen Pfeifton und dem ständigen Piep-piep-piep, wenn ein Fahrzeug rückwärts fuhr, durchbrochen.
Ich parkte auf der anderen Seite auf einem Besucher-Parkplatz neben Jeeps, Cherokee Rangers und zerbeulten Pickups. Auf dem kurzen Weg zum Eingang konnte ich den Verkehr vom nahen Freeway sowie das Brummen eines Kleinflugzeugs hören, das auf den im Westen gelegenen Flughafen zuflog. Die Inneneinrichtung des Büros zeugte von einer vernünftigen Mischung aus gutem Geschmack und Sinn fürs Praktische: glänzende Walnußpaneele, stahlblauer Teppichboden, dunkelblaue Aktenschränke und dazu passende dunkelrote Tweed-Polstermöbel. Bei den männlichen Angestellten bestand die Standardkluft offenbar aus Krawatte, Hemd und Hose ohne Anzugjacke. Die Schuhe sahen aus, als könnte man mit ihnen gut über Sand und Kies gehen. Die Kleiderordnung für Frauen schien weniger strikt zu sein. Es herrschte eine angeregte Atmosphäre. Polizeireviere haben die gleiche Ausstrahlung; jeder ist in die Arbeit vertieft.
Im Vorraum, wo ich wartete, lagen nur branchentypische Zeitschriften, Exemplare von Pit & Quarry, Rock Products, Concrete Journal und Asphalt Contractor. Ein kurzer Blick genügte, um mich davon zu überzeugen, daß es hier um Themen ging, die mir nicht mal im Traum eingefallen wären. Ich las kurz über Ovalloch-Hohlformen und Mehrzweck-Beimischungen, motorgetriebene ausziehbare Betonrutschen und fahrbare Betonrecyclinganlagen. Mannomannomann! Manchmal mußte ich über die Abgründe meiner Unwissenheit staunen.
»Kinsey? Ich bin Donovan Malek«, sagte jemand.
Ich sah auf, legte die Zeitschrift beiseite und stand auf, um ihm die ausgestreckte Hand zu schütteln. »Nennt man Sie Don oder Donovan?«
»Donovan ist mir lieber, wenn es Ihnen recht ist. Meine Frau kürzt es zwar manchmal zu Don ab, aber ich lasse es nur ihr ab und zu durchgehen. Danke, daß Sie so pünktlich sind. Kommen Sie mit nach hinten in mein Büro, dann können wir uns unterhalten.« Malek hatte helles Haar und war frisch rasiert. Sein Gesicht war breit und von Falten durchzogen, er trug eine Hornbrille und hatte dunkelbraune Augen. Ich schätzte ihn auf einsachtzig und vielleicht hundert Kilo. Er trug Chinos und ein kurzärmliges, milchkaffeefarbenes Hemd. Er hatte seine Krawatte gelockert und den obersten Hemdknopf geöffnet wie ein Mann, der keine Einschränkungen mag und an chronischer Überhitzung leidet. Ich folgte ihm durch eine Hintertür und über eine Veranda aus Holzbohlen, die mehrere Wohnwagen von doppelter Breite verband. Die Klimaanlage in seinem Büro summte gleichmäßig, als wir hereinkamen.
Der Wohnwagen, in dem er residierte, war in drei gleich große Büros unterteilt, die sich eines hinter dem anderen vom Vorderteil des Wagens bis zu seiner Rückseite erstreckten. Lange Leuchtstoffröhren warfen ein kaltes Licht über die weißen Resopalplatten der Schreib- und Zeichentische. Breite Ablageflächen waren übersät mit technischen Handbüchern, Projektberichten, Baubeschreibungen und Entwürfen. Stabile Bücherregale aus Metall, die mit Aktendeckeln vollgestopft waren, säumten fast überall die Wände. Donovan schien in seiner Umgebung keine Privatsekretärin zu haben, und ich mußte vermuten, daß eine der Frauen in den vorderen Räumen seine Anrufe beantwortete und ihm die Schreibarbeit abnahm.
Er bot mir einen Stuhl an und setzte sich selbst auf einen hochlehnigen Ledersessel hinter seinen Schreibtisch. Dann beugte er sich zur Seite und zog aus einem Bücherregal ein Jahrbuch von einer High School in Santa Teresa, das er auf einer mit einer Büroklammer markierten Seite aufschlug. Er streckte den Arm aus und reichte es mir herüber. »Guy mit sechzehn. Wer weiß, wie er heute aussieht.« Er lehnte sich zurück und wartete meine Reaktion ab.
Der Junge, der mir aus dem Foto entgegenblickte, hätte einer meiner Klassenkameraden sein können, obwohl er einige Jahre älter war als ich. Das Schwarzweißfoto im Format fünf mal fünf Zentimeter zeigte ihn mit relativ langem, hellem und lockigem Haar. Auf seinen Zähnen saß eine Zahnspange, die durch die leicht geöffneten Lippen glitzerte. Er hatte einen unreinen Teint, störrische Augenbrauen und lange blonde Koteletten. Sein Hemd war aus einem Stoff mit wildem Blumenmuster. Ich hätte auf ausgestellte Hosen und einen breiten Ledergürtel gewettet, obwohl nichts davon auf dem Bild zu sehen war. Meiner Meinung nach sollten sämtliche High-School-Jahrbücher eingesammelt und verbrannt werden. Kein Wunder, daß wir alle unter mangelndem Selbstwertgefühl litten. Was waren wir doch für ein Haufen von Spinnern! Ich sagte: »Er sieht genauso aus wie ich in seinem Alter. In welchem Jahr hat er seinen Abschluß gemacht?«
»Er hat keinen gemacht. Er wurde sechsmal vom Unterricht ausgeschlossen und ist schließlich abgegangen. Soweit ich weiß, hat er nicht einmal sein letztes Zeugnis abgeholt. Er hat mehr Zeit in der Besserungsanstalt als zu Hause verbracht.«
»Tasha hat von strafbaren Handlungen gesprochen. Können Sie mir davon erzählen?«
»Sicher, wenn mir einfällt, wo ich anfangen soll. Erinnern Sie sich noch an das Gerücht, man könne von Aspirin und Coca-Cola high werden? Er ist sofort losgezogen und hat es ausprobiert. Der Junge war schwer enttäuscht, als es keinerlei Wirkung zeigte. Damals war er in der achten Klasse. Wenn ich all die sogenannten ›harmlosen Streiche‹, die er sich damals geleistet hat, außer acht lasse, würde ich sagen, daß seine ersten gravierenden Gesetzesverstöße noch in seiner Schulzeit lagen, als er zweimal wegen Marihuanabesitz festgenommen wurde. Er hing dick in der Drogenszene drin: Gras, Speed, Uppers, Downers. Wie hieß das Zeug damals noch? Reds und Yellow Jackets und irgend etwas namens Soapers. LSD und Halluzinogene kamen ungefähr zur selben Zeit auf. Damals nahmen Teenager weder Heroin noch Kokain, und von Crack hatte noch kein Mensch was gehört. Das ist wohl eine neuere Entwicklung. Eine Zeitlang hat er Klebstoff geschnüffelt, aber er sagte, daß ihm die Wirkung nicht behagte. Der Junge war ein Connaisseur, wenn es darum ging, high zu sein«, sagte er verächtlich. »Um für den Stoff zu bezahlen, hat er praktisch alles geklaut, was nicht niet- und nagelfest war. Autos hat er gestohlen und schwere Maschinen von Daddys Baustellen. Sie können sich bestimmt ein Bild davon machen.«
»Die Frage mag Ihnen seltsam erscheinen, aber war er beliebt?«
»Das war er in der Tat. Das Foto macht nicht viel her, aber er war ein gutaussehender Junge. Er war zwar unverbesserlich, aber er besaß eine Art von trotteliger Freundlichkeit, die andere Leute offenbar anziehend fanden, vor allem die Mädchen.«
»Warum? Weil er gefährlich war?«
»Ich kann es wirklich nicht erklären. Er gab sich als schüchterne, tragische Figur, so als könnte er gar nicht anders. Er hatte nur einen Freund, einen Jungen namens Paul Trasatti.«
»Wohnt der noch hier in der Gegend?«
»Klar. Er und Jack spielen zusammen Golf. Bennet ist auch mit ihm befreundet. Sie können ihn fragen, wenn Sie mit ihm sprechen. An andere Freunde kann ich mich jetzt aus dem Stegreif nicht erinnern.«
»Sie selbst sind damals nicht mit Guy herumgezogen?«
»Nicht, wenn es sich vermeiden ließ«, sagte er. »Ich bemühte mich, soviel Distanz wie möglich zwischen uns zu schaffen. Es wurde so schlimm, daß ich die Tür zu meinem Zimmer abschließen mußte, damit er nicht alles davontrug. Er hat geklaut, was ihm zwischen die Finger kam. Stereoanlagen und Schmuck. Manches des Geldes wegen und manches nur, um Ärger zu machen. Nachdem er achtzehn geworden war, ließ er sich ein bißchen mehr einfallen, da das Risiko höher war. Dad sagte ihm schließlich klipp und klar, daß er ihn gnadenlos zur Sau machen werde, wenn er noch einmal Scheiße baute. Entschuldigen Sie meine krasse Ausdrucksweise, aber ich rege mich immer noch auf, wenn ich an diese Geschichte denke.«
»Hat er daraufhin das Haus verlassen?«
»Daraufhin hat er sich eine andere Taktik zugelegt. Oberflächlich betrachtet machte er reinen Tisch und fing an, hier draußen zu arbeiten, in der Wartungswerkstatt. Er war schlau, das muß ich ihm lassen. Wußte mit seinen Händen umzugehen und hatte was auf dem Kasten. Er muß diese Firma als Erfüllung seiner Wünsche gesehen haben. Er hat Schecks auf Dads Konten gefälscht. Er hat die Firmenkreditkarte benutzt, um Waren zu bezahlen, und das Zeug dann verkauft. Dad, Gott segne ihn, hat ihn immer noch gedeckt. Ich habe ihn gebeten, Guy fallenzulassen, aber er konnte sich einfach nicht dazu durchringen. Guy hielt ihn hin, indem er eine Lüge nach der anderen erzählte.
Was soll ich Ihnen sagen? Dad wollte ihm glauben. Er stellte ihn zur Rede. Ich meine, es hatte den Anschein, als würde er diesmal wirklich hart durchgreifen, aber wenn es wirklich zur Sache ging, gab er regelmäßig nach und bot ihm noch ›eine letzte Chance‹ an. Herrgott, ich hatte die Schnauze voll davon, ihn das sagen zu hören. Ich tat, was ich konnte, um die Hintertürchen zuzumachen, aber damit kam ich auch nicht besonders weit.« Donovan tippte sich gegen die Schläfe. »Bei dem Jungen war eine Schraube locker. Ihm hat wirklich ein wichtiges Zahnrädchen in der Moralabteilung gefehlt. Jedenfalls war das letzte Ding, das er gedreht hat – das kam allerdings erst raus, als er schon ein paar Monate weg war –, eine Gaunerei, bei der er eine arme alte Witwe um ihren Notgroschen gebracht hat. Das brachte das Faß zum Überlaufen. Dad hatte ihn zwar bereits vor die Tür gesetzt, aber wir saßen nun trotzdem mit dem Scherbenhaufen da.«
»Wo waren Sie damals? Sie haben ja vermutlich schon für Ihren Vater gearbeitet.«
»O ja. Ich hatte damals bereits meinen College-Abschluß gemacht, war in Vietnam gewesen und wieder zurückgekommen und arbeitete hier als Bergbauingenieur. Ich habe an der Colorado School of Mines studiert. Mein Dad war Bauingenieur. Er hat Malek Construction 1940 gegründet, im selben Jahr, in dem ich zur Welt kam, und 1943 hat er sich seine erste Kiesgrube zugelegt. Zuerst waren wir eine Baufirma, und schließlich gehörten uns all unsere Rohstoffe selbst. Ja, wir haben die Firma auf dieser Grundlage aufgebaut, weil uns das einen Wettbewerbsvorteil verschafft hat. Es gibt eine Menge Baufirmen hier in der Gegend, die nicht über eigene Rohstoffe verfügen, und die kaufen dann bei uns. Ich bin der einzige der Söhne, der in den Familienbetrieb eingestiegen ist. Ich habe erst mit fünfunddreißig geheiratet.«
»Ich habe gehört, daß Ihre Mutter in dem Jahr gestorben ist, als Guy das Haus verlassen hat«, sagte ich.
»Das stimmt. Etwa zehn Jahre zuvor war bei ihr Lungenkrebs diagnostiziert worden. Hat gekämpft wie eine Straßenkatze und trotzdem verloren. Das ganze Theater hat ihr bestimmt auch nicht gutgetan. Dad hat nie wieder geheiratet. Er schien es einfach nicht übers Herz zu bringen. Das einzige, woran ihm noch etwas lag, war die Firma, und deshalb war ich auch so erstaunt über das Testament. Meiner Meinung nach kann er nicht einmal 1965 gewollt haben, daß Guy auch nur einen Nickel aus seinem Nachlaß bekommt.«
»Vielleicht findet ja noch jemand das zweite Testament.«
»Das würde mich freuen, aber ich habe schon das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Im Safe war nichts dergleichen. Mir graut schon davor, was passieren wird, wenn Guy wieder auftaucht.«
»Soll heißen?«
»Er wird in irgendeiner Form Ärger machen. Das garantiere ich Ihnen.«
Ich zuckte die Achseln. »Vielleicht hat er sich geändert. Manchmal kommen die Leute zur Vernunft.«
Donovan machte eine ungeduldige Geste. »Klar, und manchmal gewinnt man im Lotto, aber die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen. So ist es eben, und ich schätze, wir werden damit leben müssen.«
»Haben Sie irgendeine Ahnung, wo er sein könnte?«
»Nein. Und ich liege auch nachts nicht wach und grüble darüber nach. Offen gestanden macht es mich ganz irre, wenn ich mir vorstelle, daß er zurückkommt, um sich hier niederzulassen. Mir ist klar, daß er von Gesetzes wegen Anspruch auf seinen Anteil am Nachlaß hat, aber ich finde, er sollte Anstand beweisen und die Finger davon lassen.« Er nahm einen Zettel und schob ihn mir herüber. »Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer. Sein zweiter Vorname ist David. Was kann ich Ihnen sonst noch sagen?«
»Wie lautet der Mädchenname Ihrer Mutter?«
»Patton. Brauchen Sie das zur Feststellung der Identität?«
»Genau. Wenn ich ihn finde, hätte ich gern etwas in der Hand, das mir bestätigt, daß es sich tatsächlich um Guy handelt.«
»Sie denken an einen Schwindler? Das kann ich mir nur schwer vorstellen«, sagte er. »Wer möchte denn schon der Ersatzmann für einen solchen Versager sein?«
Ich lächelte. »So weit hergeholt ist das nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber es ist alles schon dagewesen. Sie wollen doch nicht am Ende einem Wildfremden Geld geben.«
»Da haben Sie recht. Ich bin ganz und gar nicht davon angetan, ihm das Geld zu geben. Leider liegt die Entscheidung nicht bei mir. Gesetz ist Gesetz«, sagte er. »Jedenfalls überlasse ich das Ihnen. Er hat schon wüst gelebt und wüst gesoffen, bevor er einundzwanzig wurde. Über seinen momentanen Aufenthaltsort weiß ich auch nicht mehr als Sie. Brauchen Sie sonst noch etwas?«
»Das wäre für den Moment alles. Ich spreche noch mit Ihren Brüdern, und dann sehen wir ja, wie weit wir kommen.« Ich erhob mich, und wir schüttelten uns über dem Tisch die Hände. »Danke, daß Sie Zeit für mich hatten.«
Donovan kam hinter seinem Schreibtisch hervor und brachte mich zur Tür.
Ich sagte: »Tasha hat ja sicher die entsprechenden Anzeigen in die Lokalzeitung setzen lassen. Womöglich bekommt Guy Wind davon, falls er nicht bereits im Bilde ist.«
»Wie das?«
»Vielleicht hat er noch Kontakt zu irgend jemandem, der hier lebt.«
»Hm. Das ist wohl möglich. Ich weiß nicht, zu wieviel Aufwand wir noch verpflichtet sind. Wenn er nicht auftaucht, vermute ich, daß sein Anteil am Nachlaß eine gewisse Zeit lang auf einem Treuhandkonto bereitgehalten werden muß. Aber danach, wer weiß? Jedenfalls besteht Tasha darauf, daß wir die Geschichte klären, und mit ihr will sich schließlich niemand anlegen.«
»Wohl nicht«, sagte ich. »Außerdem ist ein Abschluß immer etwas Schönes.«
»Kommt darauf an, worum es geht.«
Kapitel 3
Ich fuhr im Büro vorbei und legte eine Akte zu dem Fall an, in die ich die Daten eintrug, die Donovan mir gegeben hatte. Es sah nach nicht viel aus, nur ein Fitzelchen Information, aber das Geburtsdatum und die Sozialversicherungsnummer wären eine ungemein wertvolle Hilfe zum Nachweis der Identität. Im Notfall konnte ich immer noch bei Guy Maleks früheren Klassenkameraden nachfragen, ob er sich bei irgend jemandem gemeldet hatte, seit er verschwunden war. Nachdem er sich jahrelang so schlimm aufgeführt hatte, war nicht anzunehmen, daß andere ihn gut gekannt oder Wert darauf gelegt hatten, ihn überhaupt zu kennen, aber vielleicht hatte er ja Gesinnungsgenossen gehabt. Ich notierte mir den Namen, den Donovan genannt hatte. Paul Trasatti könnte eine Spur sein. Womöglich war Guy ja im Laufe der letzten fünfzehn Jahre solider geworden und hin und wieder zu Klassentreffen gekommen. Oft sind es gerade die größten »Versager« aus der Schulzeit, die am begierigsten darauf sind, mit ihren späteren Erfolgen zu prahlen.
Wenn ich um einen Tip gebeten würde, wohin er wohl seine Schritte auf dem Weg ins Exil zuerst gelenkt hatte, würde ich San Francisco sagen, das nur sechs Stunden Autofahrt oder eine Flugstunde im Norden lag. Guy hatte Santa Teresa verlassen, als Haight-Ashbury auf dem Gipfel seiner Beliebtheit stand. Jedes Blumenkind, das nicht bereits hirntot von Drogen war, zog es damals nach Haight. Dort tobte die Party aller Partys, und mit zehntausend Dollar in der Tasche war Guy seine Einladung dazu sicher.
Um halb vier schloß ich mein Büro ab und ging in den ersten Stock hinunter, um mir Instruktionen für die beiden Vorladungen zu eidlichen Zeugenaussagen geben zu lassen. Dann holte ich mein Auto und fuhr zu den Maleks hinaus. Das Haus stand am Ende eines schmalen Sträßchens, und das sechs Hektar große Grundstück war von einer zweieinhalb Meter hohen Mauer umgeben, die hin und wieder von einem hölzernen Tor durchbrochen wurde. Ich war in dieser Stadt aufgewachsen und hatte gedacht, ich würde jede Ecke von ihr kennen, aber das hier war mir neu, eine erstklassige Santa-Teresa-Immobilie, die auf die dreißiger Jahre zurückging. Die Maleks besaßen offenbar das letzte Stück flachen Landes im Umkreis von Meilen. Das hintere Ende des Anwesens mußte steil bergauf gehen, da über mir die Umrisse der Santa Ynez Mountains aufragten und so nahe wirkten, als könnte man sie berühren. Von der Straße aus konnte ich vereinzelte Büschel violettblühenden Salbeis und Eismyrtensträucher erkennen.
Die eisernen Torflügel am Eingang zum Anwesen standen offen. Ich folgte der langen, gebogenen Auffahrt an einem rissigen, vernachlässigten Tennisplatz vorbei auf eine gepflasterte Wendefläche, die innerhalb der L-Form des Haupthauses lag. Sowohl das Haus als auch die Mauer, die das Grundstück umgab, waren mit dunklem Terrakotta in einem merkwürdigen Farbton irgendwo zwischen Ziegelrot und Staubrosa verputzt. Wuchtige Nadelbäume überragten das Anwesen, und ein Wald aus immergrünen Eichen erstreckte sich zur Rechten des Hauses, so weit das Auge reichte. Durch das Dach aus Zweigen drang kaum Sonnenlicht. Neben der Vorderfront des Hauses hatten die Kiefern eine Nadeldecke hinterlassen, die den Boden völlig übersäuert haben mußte. Es wuchs kaum oder gar kein Gras, und der feuchte Geruch der nackten Erde war durchdringend. Hier und da konnte sich eine zerzauste Palme behaupten. Auf der rechten Seite standen mehrere Nebengebäude – ein Bungalow, ein Gärtnerschuppen, ein Gewächshaus –, und links befand sich eine lange Reihe von Garagen. Die Zufahrt ging offenbar hinter dem Haus weiter. Auf einer gekiesten Fläche war eine Harley-Davidson geparkt. Es gab Blumenbeete, doch selbst der gelegentlichen Andeutung von Farbe gelang es nicht, die bedrückende Düsternis des herrschaftlichen Hauses und die tiefen Schatten, die es umgaben, aufzulockern.