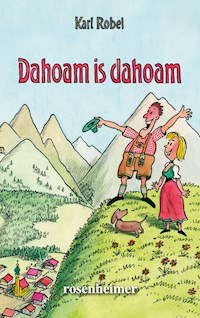
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Heut gibt's doch nix mehr, was's net gibt", meint der Mundartdichter Karl Robel. Und was es heute so alles gibt, nimmt er in seinen treffenden Versen aufs Korn: bald heiter-ironisch, bald nachdenklich-kritisch, aber immer in seinem unverwechselbaren Stil. Und trotz manchmal fast grantelnder Töne offenbart er überall seine Liebe zu seiner Heimat, dem Rupertiwinkel. Dort spielt auch eine Reihe der Geschichten, die er zu erzählen weiß: Er berichtet von früheren Zeiten, den Freuden und der Mühsal, und stellt diese humorvoll der schnelllebigen Gegenwart gegenüber.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2013
© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Titelillustration: Sebastian Schrank, München
Illustrationen im Innenteil: Georg Friedrich Winter, Traunstein †
Satz: Satzpunkt Ursula Ewert GmbH, Bayreuth
eISBN 978-3-475-54546-7 (epub)
Worum geht es im Buch?
Karl RobelDahoam is dahoam
„Heut gibt’s doch nix mehr, was’s net gibt“, meint der Mundartdichter Karl Robel.
Und was es heute so alles gibt, nimmt er in seinen treffenden Versen aufs Korn: bald heiter-ironisch, bald nachdenklich-kritisch, aber immer in seinem unverwechselbaren Stil. Und trotz manchmal fast grantelnder Töne offenbart er überall seine Liebe zu seiner Heimat, dem Rupertiwinkel. Dort spielt auch eine Reihe der Geschichten, die er zu erzählen weiß: Er berichtet von früheren Zeiten, den Freuden und der Mühsal, und stellt diese humorvoll der schnelllebigen Gegenwart gegenüber.
Inhalt
Man möcht dazuaghörn
Gemeindewahl
Zeitgeist und Zivilkurasch
Schö toa auf Boarisch
Z’ruck zur Natur
Da Kropf
Nebnwirkungen
Die falschen falschen Zähne
Postlerpech
Der Heinrich und die Liebe
De giftign Schwammerl
Des kalte »Mailüfterl«
Sicher is sicher
Sauverlosung
Die sieben Missetäter
Farbspray als Ausdrucksmittel
Volkstanz
Wattn
Teisendorfer Feuerwehrchronik
Der Schädel im Birnbaum
Haussegen
Da stumme Schroa
Bescheidene Ferienfreuden
Der Spuk im Getreidekasten
Zeit fürn Herrgott?
Lebnslange Jugnd
Kindheit in den Dreißigerjahren
In da Klinik
Beim Schülertreffen an die Lehrerschaft
Sonderzuteilung
Titlsucht
Einer Lehrerin zum Abschied
Großeltern und Enkerln
Wartezeit an da Grenz
Hausaufgab
Rückspiagl und Spiagl
Man möcht dazuaghörn
Heut gibt’s doch nix mehr, was’s net gibt,
grad des Verruckte is beliebt.
Zo dene Zeiterscheinungen
gibt’s zwar verschiedne Meinungen.
Doch is a Sach nia so verkehrt,
dass’ vo de Leut net nachgmacht werd.
De meistn laffan mit da Schar,
wia’s halt früahra aa scho war.
Wennst di allwei zuawepasst
und di einfach mitschwoabn lasst
vom Zeitgeist und vo seiner Strömung
und di treibn lasst ohne Hemmung:
Auf dera Spur bist mittndrin
und ghörst dazua und dann bist »in«.
Dafür gibt’s allerhand Beweise
in de jugendlichn Kreise.
Man moant, de Blutschins san recht flott,
de Junga sagn: »De san kommod,
aber z’ wenig ordinär,
drum müassn z’rissne Hosn her«
– man möcht doch gern mitn Haufa laffa –
»mir möchtn s’ als a zrissna kaffa.«
Für so a Trumm mit lauter Löcher
muasst natürlich mehra blecha.
Des san scho sonderbare Bräuch’!
Wenn iatz a Metzger zum Vergleich
o’bissne Würscht’ verkaffa taat
mit Aufpreis, des waar doch akrat
ganz genau da gleiche B’schiss,
wia’s bei de z’rissna Hosn is.
Doch bein Metzger gang des net,
denn sei’ Kundschaft is net bläd.
Es gibt Leut, de san für gwöhnlich
zur Rockmusik ganz unversöhnlich;
de andern mögn des Mordsgeplärr
und rennan in jeds Open Är.
De Klampfn- und de Schlagzeugwerker
mit de Megawattverstärker,
lauter wia a Presslufthammer,
fürs G’hör de reinste Folterkammer
mit über hundert Dezibel
und Liachteffekte farbig-grell.
De Technomusi, diktatorisch,
macht psychedelisch und euphorisch.
Man werd, auf Deutsch gsagt, dazua bracht,
des hoaßt, man werd ganz damisch gmacht.
Der Schmarrn hat Vorbildfunktion
für de junge Generation;
wia si de verarschn lassn,
siehgst ja an de z’rissna Hosn.
Doch wenn ’s G’hör amal kaputt is
und da HNO akut is,
dann stehst alloa mit dein’ Problem
und koana konn da’s wiedergebn.
Wenn ma net dazuaghört hätt,
waar’s gscheider gwen, doch iatz is’s z’ spät!
Gemeindewahl
Es is wieder amal so weit,
Wahlkampf habn ma, liabe Leut.
Man plagt se um de Wählergunst,
hoffentlich net umasunst.
Zwoarasiebzge kandidiern,
manche möchtn’s grad probiern,
in vierzehn Tag’, da wiss ma’s gwiss,
wia des Rennats glaffa is.
Es möcht doch jeder Kandidat
schließlich in’ Gemeinderat,
doch zwoarasiebzge san vui z’ vui,
denn auf da Gmoa habn s’ bloß zwanzg Stuih.
Habn s’ dann am End mit letzter Kraft
vo zwoarasiebzge zwanzge gschafft,
knirscht so mancher mit de Zähn’,
er is bloß in da Hoffnung gwen!
Zeitgeist und Zivilkurasch
Da Zeitgeist is a Zeiterscheinung,
der zwingt de Leut zu oaner Meinung.
Und weil er stur da drauf besteht,
was oaner sagn derf und was net,
drum is ma ständig drauf bedacht,
dass ma nur ja koan Fehler macht
und nia was gegan Zeitgeist sagt,
sunst werst womöglich no verklagt.
Und auffe bis zur Prominenz
erweist ma eahm de Reverenz
und macht vor eahm an Buckl krumm
und sagt nix und bleibt liaber stumm.
Des hoaßt so vui wia: Liaber Freund,
mach dir an Zeitgeist net zum Feind.
Doch mancher prominente Mo
hat si’s mit eahm scho lang verto,
weil er des laut beim Nama nennt,
was alle auf de Nägl brennt.
Wer so was sagt, hat nix mehr z’ lacha
beim Gschroa vo unsre Meinungsmacher.
Zivilkurasche waar heut gfragt,
so werds uns allwei wieder gsagt.
Und wenn si oaner traut, was dann?
Den haut ma boshaft in de Pfann!
Schö toa auf Boarisch
D’ Rosi is a Sennerin
mit Haar’ auf ihrane schöna Zähn’.
Da Michei kimmt zo ihr auf d’ Hüttn,
er tuat ihr schö und nimmt s’ um d’ Mittn:
»Du bist mei Schatz, mei Liab, mei große,
du ... behaarte Alpenrose!«
Z’ruck zur Natur
Unsane Vorfahrn habn se plagt
mit Pfeil und Wurfspieß auf da Jagd,
habn Falln aufgstellt und fleißig gfischt
und ab und zua was Grouß’ derwischt.
Dann habn s’ de Beute voller Freud
hoambracht zo Kind und Weiberleut
und habn s’ am offan Feuer bratn.
Dann habn s’ d’ Nachbarschaft ei’gladn,
weil des Fleisch schnell weiterghört,
dass’ am End net stinkert werd.
A Kühlschrank war im ganzn Land
daselm natürlich unbekannt.
Des alles is zwar vorgeschichtlich,
aus Grabungsstättn grad ersichtlich;
aus solche Funde konnst da nacha
ungefähr a Buidl macha.
Jager warn s’ daselm und Sammler
und ausgschaugt habn s’ als wia de Gammler.
Des is scho lang her und inzwischn
braucht neamad mehr aus Hunger fischn
und a Fleisch zon Siadn und Bratn
kafft ma si im Metzgerladn.
Heut geht alls schnell und ohne Gfahr,
was vordem no recht müahsam war.
War’s früahra in da Küch oft hektisch,
heut is’s leicht, alls geht elektrisch
und d’ Arbat is so unbeschwert
mitn Kombi-Einbauherd.
Da Technikfortschritt is perfekt,
de Küchnarbat sehr gepflegt
und des moderne Essn schmeckt.
Doch da Mensch, so gscheit und wief,
mag’s iatz auf oamal primitiv;
geht vo da Küchntechnik weg
und brat’ im Gartn in aran Eck
am offan Feuer voller Freud
sei’ Fleisch wia in da Jungsteinzeit!
Des is zwar recht romantisch-szenisch,
aber net ganz hygienisch,
denn de knusprig bratna Stückl
san dann voller Rauchpartikl;
doch des scheniert neamd vo de Gäst
hintern Haus bein Gartnfest.
Da Opa, der sitzt aa dabei,
als Rentner hat er’s leicht derweil.
Man siehgt’s, wia eahm de Brotzeit schmeckt,
er schaugt und denkt und überlegt,
dann brummt da alte Kritisierer:
»Alls is anderst heut wia früahra.
Brotzeit gmacht ... mei liaber Mo,
des habn mir in da Stubn drin do
und für de, wo müassn habn,
war ’s Häusl draußt bein Lindnbaam.
Heut is heraußt da Brotzeitschmaus
und ’s Häusl, des is drin im Haus.«
Da Kropf
In dera Gegnd untern Kopf,
da wachst bei manche Leut a Kropf.
Des is a Fleisch, a überschüssigs,
und außerdem was Überflüssigs.
De Dokter nennan’s »kalter Knotn«
(der ghörat eigentlich verbotn).
Neamad woaß, was der bedeut’,
aa net, wenn ma’n außerschneidt.
Und is er dann heraußt, da Kropf,
dann liegst im Bett und hängst am Tropf
und gspürst im Hals bei jedn Schluck
wia wenn was gschwolln waar, so an Druck
und überlegst: »Ja, Herrschaftseitn,
was sollt iatz so a Kropf bedeutn?
Er hängt ganz umasunst da dro
und du hast gar nix ghabt davo!«
Bloß fürn Dokter und sei Kunst,
da war da Kropf net umasunst.
Nebnwirkungen
Des hat doch jeder scho derlebt:
Du kriagst vom Dokter a Rezept.
Da steht dann drauf, was d’ nehma muasst
und weilst de ganze Zeit scho huast’,
kriagst was zon Schlucka, net zon Schlecka,
des holst da dann bein Apotheker.
Tablettn san’s, de muasst dahoam
glei nachn Essn obeschwoabn,
a so wia’s draufsteht, oans – null – oans,
des hoaßt so vui wia »mittag koans«.
Dann muasst du no vorm Abndessn
’s Gebrauchsanweisungsblattl lesn:
A kloana Druck, zwoa lange Seitn,
da machan d’Augn scho Schwierigkeitn.
Da Text is fachchinesisch-klinisch,
pharmakologisch-medizinisch.
So Wörter san oft nimmer kenntlich
und für an Laien unverständlich.
Da Wirkstoff hoaßt Frivolstramin,
dreihundert Milligramm san drin.
Dann steht da no ganz unergründlich:
»Sind Sie frivolstramin-empfindlich?«
Als wia wennst du des wissn kunntst,
a bläde Frag, ganz umasunst.
Dann hoaßt’s no, solltst as net vertragn,
dann liaber no an Dokter fragn.
Was steht net alls im Blattl drin?
Auf jedn Fall: »Frivolstramin
erhält Sie dauerhaft gesund.«
Doch lafft’s halt manchmal net ganz rund;
es kunnt ja sei’, und doch net gwiss,
dass da a Nebnwirkung is:
Zum Beispui du kunntst nimmer schlaffa,
oder müassatst allwei laffa;
und rutscht de Wirkung ausn Gleis,
dann kriagst womöglich de Beiß-Beiß.
Auf alle Fälle nia nix Gscheits,
vialleicht an Wehdam hint im Kreiz.
Wennst weiderlest und bist net gfasst,
dann stellt’s da d’ Haar’ auf – wennst oa hast.
Hast dann den ganzn Zettl glesn,
dann werds da sauer auffastessn,
dann traust da des gar nimmer nehma,
es kunnt a Nebnwirkung kemma!
Am End werst sagn: »I bin net bläd,
i glaab, i nimm’s doch liaber net.«
Die falschen falschen Zähne
Wir verbrachten unsere Schulzeit vor dem Krieg in für heutige Begriffe sehr bescheidenen Unterrichtsräumen. Die sechste bis achte Klasse war im selben Zimmer untergebracht. Unser Lehrer, ein etwas dickleibiger Vierziger, hatte also in diesem Raum etwa fünfzig Buben zu unterrichten, die sich auf drei Jahrgänge verteilten. Das Klassenzimmer war recht einfach ausgestattet. In der hinteren Ecke standen ein alter, hoher Kachelofen, daneben eine große Kiste mit Brennholz und anschließend an der hinteren Wand zwei verstaubte Schränke mit Büchern, Akten und Lehrmitteln. Der geschwärzte Bretterboden war ausgetreten und verbreitete einen etwas abgestandenen Ölgeruch. Wände und Schranktüren waren mit Bildern, Plakaten und Schautafeln bepflastert.
An ein Plakat mit grünweißer Umrandung kann ich mich noch gut erinnern, da es dicht neben meiner Schulbank hing. Es stand da in großen Lettern: »Putze täglich deine Zähne mit Chlorodont«, und dann folgten noch einige handfeste Argumente über die Nützlichkeit der Mundhygiene. Was aber an dem Plakat besonders auffiel, waren einige Nachbildungen menschlicher Kiefer mit schneeweißen Zähnen, die mit dünnen Gummilitzen draufgeheftet waren. Man konnte sie der Färbung und Form nach bei oberflächlicher Betrachtung für richtige Unterkieferprothesen halten.
Da meinte der Lehrer eines Tages, das Plakat sei nun lange genug ausgehangen, und er forderte mich auf, es abzunehmen und in die Brennholzkiste zu werfen. Dabei ergänzte er noch: »Die Gebisse kannst du behalten!« Er ahnte wohl nicht, dass er damit Dinge heraufbeschwor, die eigentlich nicht geplant waren.
In unserem Nachbarhaus befindet sich ein Friseursalon, damals hieß das noch schlicht und einfach Baderstube. Der Geselle, der dort arbeitete, hieß Max, und weil es eben im Ort mehrere Maxln gab, nannten ihn die Leute den »Badermax«. Im dritten Stock wohnte die Nachbarsgroßmutter. Ihr jüngster Enkel nannte sie immer Gromu.
Wir wollten nun die Wirkung der Gebissattrappen gleich ausprobieren und legten eine davon dicht an der nachbarlichen Hausmauer aufs Straßenpflaster, gerade unter die Fenster von Gromus Wohnung. Kurze Zeit später kam der Badermax von einer Besorgung zurück und wollte gerade ins Haus gehen, als er plötzlich das Gebiss entdeckte. Etwas erschrocken starrte er es an, schaute dann zu den Fenstern im dritten Stock hinauf und kombinierte sofort einen Zusammenhang. Er scheute aber offensichtlich den direkten Kontakt mit seinem Fund, denn er ging eilig ins Haus und kam gleich darauf mit einem Schneuztüchl zurück um das Ding diskret eingewickelt abzuholen.
Die resolute Gromu hat ihn aber dann gründlich aufgeklärt: »Ham S’ des gar net gspannt, dass des bloß a Nachbildung is? Ham Sie gmoant, i leg meine Zähn’ zum Trocknen vors Fenster außi? Und außerdem, wenn a so a Prothesn vom drittn Stock aufs Pflaster abifallat, waarn’s doch lauter Trümmer!«
Dieses war also der erste Streich, der nächste folgte ein Jahr später.
Ich hatte die Volksschule inzwischen beendet und in der nahen Stadt meine Lehre angetreten. Wir hatten Kost und Wohnung im Haus. Der Meister mit seiner Familie nahm die Mahlzeiten in der Küche im ersten Stock ein und die Belegschaft aß stets gemeinsam im Erdgeschoß. Bis auf die Köchin Thekla, die um diese Zeit immer vollauf mit der Essensausgabe in der Küche beschäftigt war.
Mir als dem jüngsten Stift fiel die Aufgabe zu, das Essen für die Belegschaft mit einem großen Serviertablett in der Küche abzuholen. Da fiel mir eines Tages ein, dass man bei dieser Gelegenheit eigentlich ...
Tags darauf hatte ich also so ein Ding dabei, und als die Meistersfamilie schon beim Essen saß und die Köchin geschäftig am Herd hantierte, zog ich es heimlich aus dem Hosensack und legte es hinter mich unbemerkt mitten in die Küche auf die Bodenfliesen. Als ich mit meinem Tablett, auf dem fünf gefüllte Suppenteller standen, über die Stiege hinunterbalancierte, sah ich gerade noch durch die offene Tür die Köchin. Sie wollte eben vom Spülbecken quer durch die Küche zum Herd zurück, als sie das Gebiss entdeckte, sichtlich zusammenzuckte und sich danach bückte. Aber auch sie hatte Hemmungen, das Ding direkt zu berühren, denn sie zog ihre Hand wieder zurück. Was weiter vorging, konnte ich nicht mehr sehen.
Wir saßen alle noch beim Essen, als der Chef herunterkam und sich in bester Laune mit seinen Leuten unterhielt. Da erschien die Köchin in der offenen Tür. Sie trug zwischen Daumen und Zeigefinger ein kleines, weiß eingewickeltes Packerl und spreizte dabei den Arm etwas nach auswärts, so wie man etwas trägt, vor dem es einen ekelt. Durch dieses etwas ungewöhnliche Benehmen erregte sie sofort die Aufmerksamkeit aller Anwesenden, die Unterhaltung brach jäh ab und alle schauten verwundert zu Thekla, die nach einem verlegenen Räuspern zwar ein wenig zaghaft, aber doch für alle vernehmlich fragte: »Entschuldign S’, Herr Müller, habn Sie vielleicht Eahna Gebiss verlorn?«
Der Chef schnappte förmlich nach Luft und fragte gereizt: »Sagn S’ amal, wia kemman S’ denn do drauf? Warum soll i mei Gebiss verlorn habn?«
Der Köchin wurde nun die Peinlichkeit ihrer Frage erst bewusst und sie versuchte sich zu rechtfertigen: »I hob nämlich oans gfundn, und weil sonst neamd oans hat, hab i mir denkt, es müassat vo Eahna sei!«
Hans, der Oberstift, der von der Sache wusste, grinste verstohlen und ich stand auf und schlüpfte an der Köchin vorbei zur Tür hinaus, schnappte draußen den Kohlenkübel und verschwand im Keller. Jeden Augenblick konnte sich nämlich herausstellen, wer der Urheber war, und da wollte ich außerhalb der meisterlichen Watschenreichweite sein. Ich kannte seine »Handschrift« und wusste, dass in solch brisanten Situationen nur ein ausreichender Sicherheitsabstand helfen konnte.
Gleich nach meinem Verschwinden musste er es dann erfahren haben, denn er rief nach mir, und als ich mich aus dem Keller meldete, drohte er durch die offene Tür zu mir herunter: »Des sag i dir, wennst no amal solchane Tanz machst, nacha ruck ma amal richtig z’samm!«
Mir war nicht mehr ganz wohl dabei, doch als mich unsere Bedienung, die Resi, unter vier Augen erwischte, sagte sie: »Brauchst dir fei nix draus macha, i hab’s der Chefin erzählt und de hat recht lacha müass’n.«
Postlerpech
A Bekannter vo mein’ Schwager
is bei da Post als Briefaustrager.
A Postbot no vom altn Schlag,
der allerweil no jedn Tag
sei Zuastellstreck mitn Radl fahrt
und da Post ’s Benzin derspart.
Da war in da vorign Woch
aufn Weg a ausgschwoabts Loch,
des werd an Postler zum Verhängnis,
des Schlagloch bringt’n in Bedrängnis.
Genau gsagt war der guate Mo
mit sein’ Radl vui z’ schnell dro,
drum hat’s eahm d’ Lenkung gach verrissn
und natürlich hats’n gschmissn.
De ganze Post im hochn Bogn
is in d’ Wiesn einegflogn
und er landt nebar an Äpfebam
gstreckterlängs im Straßngrabn.
Durch so a unverhoffte Wendung
werd a Post zur »Postwurfsendung«.
Der Heinrich und die Liebe
Im wunderschönen Monat Mai,
als alle Knospen sprangen,
da ist in meinem Herzen
die Liebe aufgegangen ... *
Des hat da Heinrich Heine gschriebn,
bei dem war ’s Herzweh oft recht schlimm.
Der schreibt so vui vom Busserlgebn,
vom Schmusn und vom Handerlhebn.
Er hat de Dirndln onebenzt
und dann bei jedn Abschied trenzt.
Und hat a Liabschaft gar net klappt,
dann hats glei was mitn Bluatdruck ghabt.
Is er mit Herzweh sitzn bliebn,
dann hat er glei alls niedergschriebn
in dichterischm Arbatsdrang,
und des a ganze Seitn lang.
I moan iatz, wenn der Mo nu lebn taat
und wenn’s den Dichter heit nu gebn taat,
dann waar’s a ganz uralter Mo,
der schiaga nimmer weiterko.
Er sitzat da im Altnheim
und kunnt glei lebenslänglich bleibn.
Er waar aa nimmer ganz verlässlich
und sicher aa scho recht vergesslich.
I glaab, wenn der nomal was schreibat,
dass vo da Liab nix überbleibat.
No ja, er is a alter Mo,
womöglich hoaßat’s dann a so:
Dereinst im Wonnemonat Mai,
als alle Knospen sprangen,
bin ich, i hab ja leicht derwei,
im Park herumgegangen.
Ja gibt’s des aa, wia konn des sei’,
mir fallt heit überhaupt nix ei’!
Da war da Wonnemonat Mai ...
war net da sunst nu was dabei ...?
O mei, des is scho so lang her.
Da woaß i überhaupt nix mehr!!
De giftign Schwammerl
Vo Draxlbach da Wenger Damerl
is ganz weg mit seine Schwammerl.
Der Mo hat vui Naturverständnis
und a große Artnkenntnis.
Er hat ja scho als kloana Fratz
vom Vatta gwisst de bestn Platz
und hat alle Schwammerl kennt
und bein richtign Nama gnennt.
Drum hat er aa zur rechtn Zeit
Schwammerl brockt als wia net gscheit:
Stoapuiz, Täuberl, Parasol,
Hallimasch, a Körbe voll,
Reherl und Maronipuiz
im Bergwald oder draußt im Fuiz.
Und wenn eahm Schwammerl unterkemman,
de de andern Leut net nehman,
wo im Schwammerlbüache lesbar
»guter Speisepilz« und »essbar«,
dann hat er glustig nachsinniert:
»... den habn ma aa no nia probiert.«
Doch so was hat sei Gattin gschiecha,
sie war si selber aa net sicher
und sagt si: »Wenn er s’ doch am End
samt’n Büache z’ wenig kennt,
waar’s a gfährlichs Experiment.
Drum hat sie bei da Schwammerlzeit
meistns mehra Angst wia Freud
und scho deswegn aa koan Nutzn.
D’ Wocha zwoamal Schwammerl putzn,
dass d’ de schierga net derfangst,
und allwei de Vergiftungsangst.
Da war’s natürlich scho manchmal,
des hoaßt, so hie und da der Fall,
dass se bei ihr da Zweife meldt
und d’ Essbarkeit in Frage stellt:
»Is der echt? Woaßt du des gwiss?
I moan, dass er giftig is.
Dem Schwammerl taat i net ganz trau’n,
der Huat is unt ganz dunklbraun!«
»Geh, Muatta«, sagt er, »du bist guat,
de braune Farb da untern Huat
kimmt grad vo da Sporenreife,
da gibt’s doch überhaupt koan Zweife!«
Da hat si d’ Muatta zfriedn gebn,
doch dann hat s’ wieder a Problem:
»Schaug her, der werd bein Schneidn ganz blau!«
Er sagt geduidig: »Muatta schau,
wia oft hast mi deswegn scho gfragt
und allwei wieder hab i gsagt,
dass des Blauwerdn nix bedeut’t,
kimm, hör auf iatz und sei gscheit.«
An aran Samstag im August
hat er wieder Schwammerlglust.
Bringt vormittag scho voller Stolz
an Korb voll Schwammerl hoam vom Holz
und sagt: »I hätt an Küchnzettl:
Schwammerlsuppn! Semmeknödl!«
»Ja, Babba«, sagt sie, »is scho recht,
hoffentlich san s’ alle echt.«
Da winkt da Damerl ab ganz müad,
er hat gar nimmer reagiert:
»Geh weida, Frau, frag net so vui,
hol Knödlbrot und Petersui
und mach a guate Mittagkost,
dass d’ für uns was z’ essn hast.«
Sie macht si an de Kocherei,
doch ihr is net ganz guat dabei:
»Wenn grad oana giftig waar,
waar’s mit uns zwoa aus und gar.«
Wenn ma si da einesteigert
und jeglicher Vernunft verweigert,
dann werd de Angst ganz übermächtig
und fast jeder Puiz verdächtig.
Und so war des ganz genau
bein Wenger Damerl seiner Frau,
des hat ihr allweil auffagstessn.
Um halbe zwölfe war’s zon Essn.
Sie hat a so a unguats Gfuih
und ruckt verlegn auf ihran Stuih
und hat umanandadruckt
und a paar Mal abigschluckt.
De Angst werd allweil fürchterlicher:
»Babba, bist da scho ganz sicher ...?«
Weiter is s’ gar nimmer kemma,
er muass si richtig z’sammanehma
und fragt ganz ruhig und gefasst:
»I woaß net, was du allweil hast?
Du zweifelst doch in oaner Tour
und traust ma überhaupt nix zua!«
Er moant, sie hat’n unterschätzt,
des hat sein’ Kennerstolz verletzt.
»Naa, Babba«, sagt s’, »i trau da scho!«
Er ärgert si, man kennt’s eahm o:
»Was fragst denn nacha allweil wieder?!«
Da schlagt sei Weibe d’ Augn nieder
und isst de Suppn ganz ergebn
und denkt si: »... Wern ma’s überlebn?«
Sie seufzt und flüstert: »In Gott’s Nam«,
man kennts ihr o, sie reißt si z’samm.
Doch auf amal werd s’ weiß wia d’ Wand,
ihr fallt da Löffe aus da Hand,
sie sinkt z’samm auf ihran Stuih.
Da Damerl, der glei helfa wui,
is selm so fürchterlich derschrocka,
er fallt schierga vo sein’ Hocka.
Dann hebt er s’ aber sacht in d’ Höh
und legt s’ ganz sanft aufs Kanapee
und fragt: »Was is’s?« Sie sagt koan Ton,
da rennt er glei ans Telefon
und jammert: »Mensch, was hab i to?«
und ruaft sofort an Dokter o.
»Ja ... Grüaß Gott ... da waar da Damerl ...
mei Frau ... i glaab, a giftiger Schwammerl,
i woaß net, ebba war’s der oane,
der Wiesnegerling, der kloane,
da waar a Verwechslung möglich
mit’n Knollnblätter!«, sagt er kläglich.
»Wenn das so ist, dann wird es kritisch,
das Gift wirkt nämlich hämolytisch,
mehr kann ich im Moment nicht sagen,
ich ruf sofort den Krankenwagen.«
Da Damerl wart’ voll Ungeduld
und jammert allweil: »I bin schuld!
Amatoxine! Kruzinäsn ...
i hab’s im Schwammerlbüache glesn ...
des Gift, des hat da Teife gmischt,
da wennst a bissl was derwischt ...«
Er jammert, weil sei Frau in Not is
und denkt net, dass er aa bedroht is.
Tatü – tatü! Mit’n fünftn Gang
pretscht daher da Rettungswagn
und bringt sofort und in oan Saus
Mo und Frau ins Kranknhaus.
Da warn s’ alle zwoa recht tapfer:
Magn auspumpn, Bluat abzapfa!
Doch ’s Ergebnis vom Labor:
Eigentlich liegt gar nichts vor.
Schließlich war des Resultat,
dass neamad a Vergiftung hat.
Es war alles halb so wuid,
da Damerl tragt de ganze Schuid:
Ihr is’s bloß deswegn so schlecht ganga:
Sie is im zwoatn Monat schwanger!
Des kalte »Mailüfterl«
Heuer hat da Monat Mai
zon schöna Weda net derweil.
So nass is’s allweil und so kalt,
zon Warmwerdn waar’s doch nimmer z’ bald.
De greana Laabfrösch’ mögn net springa
und bei de Vögl mag neamd singa
und d’ Schweiberl, ohnehin de Schwächern,
de friert de ganz Zeit an de Zechern.
Was waar denn des für Früahlingsweda?
Da kalte Regn, da Barometer,
a jeder fallt und fallt und fallt
und windig is’s und so saukalt.
’s »Mailüfterl« hat bloß fünf, sechs Grad
und alle friert, is des net schad?
Aa an da Wedakartn feit’s,
im Fernsehn sagn s’ uns aa nix Gscheits.
Trauts eahna net, de Meteorologn,
es wissts doch, de habn oft scho glogn.
D’ Leut müassn stattn Barfuaßlaffa
Holz und Kohln und Heizöl kaffa
und da Petrus moant recht grob:
»So lang i koa schöns Weda hab,
lass i euch in da Stubn drin boazn,
und wenns net friern wollts, müassts halt hoazn!«
Sicher is sicher
Da Oberlechner Sepp is krank.
Er is verheirat’ Gott sei Dank,
sunst hätt er neamad, der’n pflegt,
er hat si nämlich niederglegt
dahoam mit Schüttlfrost und Fiaber.
Es war a Wintertag, a trüaber,
da hat sei Frau mit vui Geduid
bei eahm de Kranknschwester gspuit.
Sie bringt an Tee und was zon Essn,
hat allweil wieder ’s Fiaber gmessn,
hat eahm des hoaße Gsicht abgwaschn
und geht dann um a Bauchwarmflaschn,
denn er hat danach verlangt,
weil eahm de Bettwärm nimmer glangt.
Sie hat glei zwoa Warmflaschn bracht,
da hat da Sepp a wengl glacht
und gmoant: »I brauch doch koane zwoa,
da glangt doch oane leicht alloa.«
Da sagt sei Frau: »Des woaß i scho,
doch i bin ma net ganz sicher,
vo außn kennst as eah net o
und i hab s’ aa net verglicha,
tua s’ nur all zwoa eine gschwind,
i glaab allweil, dass oane rinnt!«
Sie wollen wissen, wie es weitergeht? Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Weitere E-Books im Rosenheimer Verlagshaus
Mia san Bayern eISBN 978-3-475-54381-4 (epub)
Mia san Bayern! Dies bringt Herbert Schneider in seinem Buch auf den Punkt. »Mia san Bayern« ist eine Sammlung von Geschichten und Gedichte des Kolumnisten über den Alltag in Bayern. Humorvoll beschreibt er das bayerische Lebensgefühl und die Menschen mit ihren Sorgen, Wünschen, Traditionen und liebenswerten Eigenheiten. Und so wird auch der Leser ohne bayerische Wurzeln mit jeder Seite ein kleiner Teil dieses schönen Landes.
Bayerische Gschicht im Gedicht eISBN 978-3-475-54545 (epub)
Wie unterhaltsam und kurzweilig Geschichte sein kann, zeigt der bekannte Autor Franz Freisleder in diesem Buch. In originellen Mundartversen berichtet er mit einem Augenzwinkern, was sich seit der Entstehung des Bayernstammes bis zur Gegenwart innerhalb der weißblauen Grenzpfähle zugetragen hat. Wer etwas über den legendären Herzog Tassilo wissen will, über den »Märchenkönig« Ludwig II., über den unvergessenen Franz Josef Strauß oder die Regierungszeit Edmund Stoibers – der bekommt all das von Freisleder nicht nur historisch korrekt, sondern auch auf ungemein originelle Art erzählt. Ergänzt wird dieses Stück bayerischer Geschichte durch amüsante Zeichnungen aus der Feder von Sebastian Schrank. So ist der Leser, ehe er sich’s recht versieht, auf ganz entspannte Weise zum Spezialisten für bayerische Geschichte geworden!
Anmerkungen
* Heinrich Heine, »Buch der Lieder«, Insel Taschenbuch 33, S. 69
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com





























