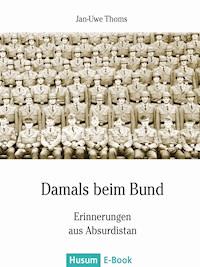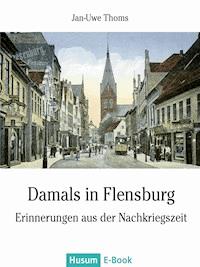
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jan-Uwe Thoms (geb. 1944) ist ein echter Flensburger Jung – der Hafen und die Ballastberge, die Flensburger Straßen und Höfe waren seine Heimat und sein Abenteuerspielplatz. Seine Kindheitserinnerungen aus der Nachkriegszeit zeigen die Stadt und ihre Bewohner aus der Perspektive des Jungen: Das Leben im Mietshaus und der Hunger in den Jahren nach Kriegsende, erste Ausflüge mit dem Tretwagen, Begegnungen mit englischen Soldaten und mit den „schlechten Frauen“ im Oluf-Samson-Gang, Schulerlebnisse und Bandenkriege, Jahrmärkte und technische Neuerungen prägen seine Welt. Teils frech, teils naiv, immer lebendig und ganz unmittelbar kommen diese Erinnerungen daher und vermitteln ganz nebenbei ein Gutteil Flensburger Lokalkolorit und (Stadt-)Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ISBN 978-3-89876-831-3 (Vollständige E-Book-Version des 2014 im Husum Verlag erschienenen Originalwerkes mit der ISBN 978-3-89876-728-6) Umschlaggestaltung: Flensburg, Große Straße (Postkarte um 1920) © 2016 by Husum Druck- und Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG, Husum Gesamtherstellung: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft
Vorwort
Nichts ist so trügerisch wie die Erinnerung. Sie verändert sich im Laufe des Lebens und manchmal ist sie sogar komplett ausgelöscht. Deshalb kann Erinnerung auch nicht objektiv sein. Erinnerung ist immer subjektiv. Sie ist die Summe dessen, was ich noch von der Vergangenheit weiß, keine wissenschaftliche Abhandlung. Manchmal sind es nur Bruchstücke, die sich zu einer Geschichte zusammenfassen lassen. Manchmal sind es Bilder, die sich in eine Geschichte wandeln. Und manchmal sind es Gespräche mit anderen, die dabei waren … und doch erinnert sich jeder an verschiedene Details.
Was ich hier erzähle, erhebt weder den Anspruch auf eine objektive Berichterstattung noch auf die Schilderung historisch exakter Abläufe. Meine einzige Quelle ist ganz bewusst ausschließlich meine Erinnerung, so fehlerhaft sie auch sein mag. Ob die Waggons der Flensburger Straßenbahn nun 1952 oder 1953 mit Schiebetüren ausgestattet wurden, ist für einen Stadthistoriker sicher von besonderer Bedeutung. Meine Erinnerung daran ist die Bedeutung dieser Veränderung für mich: Mir wurde das Schwarzfahren erschwert, da ich nun beim Anfahren der Straßenbahn nicht mehr auf eine offene Plattform aufspringen konnte – egal ob mit acht oder neun Jahren.
So wie ich es schildere, habe ich meine Kindheit in Flensburg in Erinnerung, in der Nachkriegszeit und in den 1950er-Jahren.
Jan-Uwe Thoms
Ladelund, 2014
Damals in Flensburg
Das Haus, in dem ich am 20. Juli 1944 geboren wurde, steht nicht mehr. Es musste einem Neubau weichen. Die alte Bausubstanz sei nicht erhaltenswert gewesen und der Neubau brachte den Besitzern mehr Geld. Dennoch erinnere ich mich gern an das kleine Fischerhaus mit der dicken Linde dahinter. Hühner liefen frei im Hof und hinter einer schmutzig-weißen Brettertür grunzten zwei fette Schweine.
Ich habe zwar keine eigene Erinnerung an die Zeit, in der meine Mutter und ich in der Flensburger Waitzstraße lebten – aber später hat sie mir das Haus gezeigt und ich bin als Kind oft dorthin gegangen. Irgendwie faszinierte mich der Gedanke, hier geboren worden zu sein. Wenn ich einmal erwachsen wäre, würde ich es kaufen und darin wohnen wollen. Das Haus steht nicht mehr und auch die Linde ist gefällt. Nichts erinnert mehr an die Treppenstufen, auf denen meine Mutter im Schock des Attentats auf ihren „geliebten Führer Adolf Hitler“ ihren Sohn als Sturzgeburt zur Welt brachte.
Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, steht noch. Ein hässliches, viergeschossiges Mietshaus in der Marienstraße mit einem Haupt- und einem noch hässlicheren Hinterhaus. Dunkle Flure im Haupthaus und finstere Kellergewölbe im Hinterhaus machten mir Angst. Das Hinterhaus beflügelte meine Fantasie und im fensterlosen Keller vermutete ich die Hexen, Geister und Unholde, von denen Oma Henningsen mir so oft aus einem alten und zerfledderten Märchenbuch vorlas. Meine Angst wuchs ins Unermessliche, wenn mein aus dem Krieg zurückgekehrter Vater mir androhte, mich in den Keller einzusperren. Und die Hölle war es für mich, wenn er es dann wirklich tat. Ich hatte Rüben geklaut, war stundenlang mit den älteren Nachbarsöhnen Holger und Rolf von zu Hause fort gewesen. Rolf und Holger waren sechs und sieben Jahre alt, ich „schon fast fünf“. Drei Rüben konnte ich tragen. Die beiden „Großen“ schafften ein paar mehr von einem Acker an der Marienhölzung bis in die Marienstraße.
Stolz präsentierte ich meinen Eltern die Beute, von der wir uns sicher zwei Tage satt essen konnten. Wie ungerecht, dass ich dafür in den Keller musste – aber der Duft der gekochten Rüben kroch bis in mein Verlies.
Wir haben häufig Hunger gehabt in der Zeit nach dem Krieg in der Marienstraße. Beneidet habe ich so manche Nachbarsfamilie, der es offenbar viel besser ging als uns. „Schwarzmarkthändler“, sagte mein Vater und in seiner Stimme lag eine abgrundtiefe Verachtung. „Lieber hungern als unehrliche Geschäfte machen.“ Konnte es aber etwas Schöneres geben, als ständig satt zu sein und nicht mit knurrendem Magen an den aus anderen Wohnungen dringenden Gerüchen vorbeizulaufen? Ich verstand meinen Vater nicht – schon gar nicht, warum er mich in den Keller sperrte, als ich, wie meine großen Vorbilder, etwas Essbares nach Hause brachte.
Einmal in der Woche wurde ich satt. Da ging es zur Kinderspeisung in die Heiliggeistkirche. Weiß-blau uniformierte Frauen musterten jedes Kind mit strengem Blick. Ich wurde nackt ausgezogen und auf eine kalte Waage gesetzt. Ich muss damals noch sehr klein gewesen sein, aber die eiskalte Waage hat sich tief eingeprägt. Doch nach diesem Martyrium kam der schöne Teil: Endlich warmes und reichliches Essen!
Auf dem Rückweg nach Hause trafen wir mitunter Soldaten. „Engländer“, sagte meine Mutter und spuckte auf den Boden. „Die hätten wir alle bei Dünkirchen ins Wasser werfen sollen!“ Wie gut, dass meine Mutter die Engländer nicht bei Dünkirchen ins Wasser geworfen hatte. Woher hätte ich sonst heimlich Schokolade und bunte Bonbons bekommen sollen. Schokolade und Bonbons ließen mich sogar meine Kellerangst vergessen. So oft ich konnte, suchte ich den verbotenen Weg zu den englischen Soldaten, die es so schwer hatten Scho-ko-la-de auszusprechen und immer „Tschockleed“ sagten. Und wie sie lachten, wenn ich „Tschockleed“ antwortete. So kam ich immer an meine Ration, obwohl mir zu Hause eingeschärft worden war, nie zu betteln. „Wir kommen auch so irgendwie durch“, habe ich meinen Vater oft sagen hören. Wo wir durchmussten, habe ich allerdings nie verstanden. Nur dass mein Vater nicht in der Lage war, „Tschockleed“ zu besorgen – das verstand ich.
Wir – meine Mutter und ich – mussten aber den Vater regelmäßig mit einer warmen Mahlzeit versorgen. Durch ganz Flensburg bin ich mit meiner Mutter gelaufen, um meinem Vater in einem alten Kochgeschirr warmes Essen zu bringen. Bald nach dem Krieg hatte mein Vater Arbeit im „Versehrtenwerk“ gefunden – ohne dass ich jemals in Erfahrung bringen konnte, was ein Versehrtenwerk war. Bis Mürwik mussten wir laufen. Manchmal allerdings fuhren wir auch mit der Straßenbahn, natürlich erst von der anderen Stadtseite, von St. Jürgen aus. Dann brauchten wir nicht mehr umzusteigen und sparten einen Groschen. Und mit dem gesparten Groschen konnten wir wieder eine Zeitlang den Gasautomaten in der Wohnung füttern, der uns das Gas zum Kochen für Vaters Mahlzeit lieferte. Wer Geld hatte, hatte Gas, wer Gas hatte, konnte kochen, wer kochte, hatte keinen Hunger. So einfach war meine vierjährige Lebensphilosophie.
Schnell strebte ich danach, selbst Geld zu besitzen. Zwei Pfennige für einen Dauerlutscher waren ein Vermögen, wer zehn Pfennige besaß, war reich. 10 Pfennige bekam ich beim Schrotthändler für zwei Kilogramm Eisen. Buntmetalle brachten noch mehr. So hatte eines Tages der Ofen des Nachbarn keine Ringe mehr. Mein Gewinn: 12 Pfennige und die Hundepeitsche. 12 Pfennige für Eis und Bonbons waren ein kurzer Genuss. Die Hundepeitsche wurde von nun an neben dem Kellerverlies ständiges Erziehungsmittel.
*
Körperliche Züchtigungen erfanden meine Eltern in den unterschiedlichsten Variationen und mit allerlei verschiedenen Züchtigungsmitteln. Das Schlimmste war die Hundepeitsche. Noch heute spüre ich ihre Lederriemen auf meinen Hintern und meine Oberschenkel klatschen. Die Peitsche bestand aus einem etwa 25 Zentimeter langen hölzernen Griffstück mit einer Schlaufe, die sich mein Vater zeremoniengleich über sein Handgelenk streifte. Vorn waren sieben fingerdicke Lederriemen von etwa 30 Zentimetern Länge angeschlagen. Wie ein Riese aus Omas Märchen kam mir mein Vater vor, wenn er mich packte und über seine Knie legte.
Meine Mutter setzte weniger schmerzhafte Züchtigungsmittel ein. Ich weiß nicht, wie viele hölzerne Kochlöffel zerbrochen sind, wenn ich meine kleine Hand zur Faust ballte und sie beim ersten Schlag schnell zwischen „Schlef“ und Hintern legte. Es tat zwar einen Moment höllisch weh, wenn der Kochlöffel an der Faust zerbrach, aber danach schlug meine Mutter nur mit ihrer bloßen Hand weiter – und daran konnte man sich gewöhnen.
Ich verstand überhaupt nicht, über was sich meine Eltern alles aufregen konnten. Alles, was ein wenig Erlebnis versprach, war bei Strafe verboten. Erwischt haben sie mich eigentlich immer. Besonders meine Mutter muss überall Augen gehabt haben. Ob ich nun im Burghof eine Scheibe eingeworfen hatte oder meiner Mutter heimlich die Zunge herausstreckte – sie merkte alles.
Besonders streng verboten war es, zum Hafen zu laufen. Und gerade dort war es doch so spannend. Ich turnte auf den Schiffen herum und wusste sehr bald, wo die Kombüsen eingerichtet waren. Niemand jagte mich fort! Im Gegenteil – oft gab es knackige Kekse oder auch mal ein beidseitig gebratenes Spiegelei von einem der Smutjes. Hier war die Angst vor Schlägen vergessen. Stundenlang vergaß ich jede Zeit, wenn ich zwischen Schiffswand und Kaimauer Schwärme winziger Fische im blaubraunen Hafenwasser beobachten konnte.
Besondere Achtung meiner inzwischen großen Schar an Freunden aus der Marienstraße und dem Burghof erwarb ich mir, als ich mich traute, auf Baumstämmen quer über den Freihafen zu laufen. Tagelang waren dort Baumstämme entladen worden, die nun alle wie ein riesiges Floß Stamm an Stamm im Wasser schwammen. Wenn ich mich nun auf einen Stamm stellte, fing er an, sich im Wasser des Freihafens zu rollen. Nun konnte man auf diesem rollenden Stamm mitlaufen oder auf den nächsten Stamm springen. Je weiter ich mich vom Ufer entfernte und ins offene Hafenwasser geriet, desto größer wurden die Abstände von Baum zu Baum. Man musste schon einige Zeit mit einem Stamm rollen, um den nächsten zu erreichen! Weshalb sollte ich schwimmen können? Es reichte doch, dass die Bäume schwimmen konnten und mich trugen – ganz so wie auch die Eisschollen im Winter auf der Förde, auf denen meine Freunde und ich uns vom Ostseebad aus bis an die Fahrrinne der Schiffe wagten. Wurde ich erwischt, gab es die Hundepeitsche – und ich wurde mehr als einmal erwischt.
Oft fragte ich mich, wieso die Eltern nichts davon verstanden, wie schön es war, mit dem gummibereiften Holzroller, den mir Oma Henningsen geschenkt hatte, den Nordergraben hinunterzurasen.
„Die Straße ist zu steil, Du brichst Dir das Genick, da fährst Du nicht mit dem Roller!“, lautete der eindeutige Befehl. Natürlich fuhr ich doch, gerade weil der Nordergraben so schön steil war. Und weil ich mit dem letzten Schwung das „Kindergefängnis“ noch erreichen konnte. Das Kindergefängnis war für mich der Kindergarten am Flensburger Theatergebäude. Immer zwei Kinder mussten sich anfassen und wurden von „Tanten“ durch die Straßen geführt. Zum Beispiel den Nordergraben hinauf zum Stadtpark. Ich raste dann mit meinem Roller an ihnen vorbei und brachte die geordneten Reihen zum Leidwesen der Tanten immer wieder durcheinander! Niemals hätte man mich in so ein Kindergefängnis stecken dürfen! Auch nicht als Strafe für eine zerrissene Hose, wenn ich dann doch einmal gestürzt war. Aber einen Kochlöffel waren diese Erlebnisse schon wert.
Einen Kochlöffel wert waren auch die nassen Füße, wenn ich im Winter regelmäßig im noch viel zu dünnen „Gummieis“ des Stadtparkteiches eingebrochen war – oder am 1. Mai die neuen weißen Kniestrümpfe in einem Sumpf an der Marienhölzung braun einfärbte.
Zwischen Peitsche und Kochlöffel gab es noch den Teppichklopfer. Jedes Vergehen verlangte die gerechte Züchtigung mit dem geeignetsten Zuchtmittel. Der Teppichklopfer war aus biegsamem Rohr geflochten und hatte für mich den großen Nachteil, dass er nicht zerbrach. Ich konnte meine Faust ballen, wie ich wollte – das Biest war einfach stärker als ich. Typische Teppichklopferdelikte waren die Spiele auf dem Heuboden bei Onkel Hans. Meine Höhle aus Heu oder Stroh war wohl zu tief und die Statik ebenso falsch berechnet wie heute in manchen öffentlichen Bauten. Jedenfalls war ich plötzlich unter meterhohem Stroh begraben. Sicher hatten einige Bauernjungs nachgeholfen, dass meine Höhle einstürzte – aber ich bekam den Teppichklopfer trotzdem zu spüren, eben nachdem ich ausgegraben worden war.
Onkel Hans war genauso streng wie mein Vater, aber er hat mich nie geschlagen. Dennoch höre ich ihn noch heute brüllen: „Ungekämmt sitzt bei mir keiner am Tisch!“ Und dann flog ich hochkant aus seiner Küche. Das Frühstück fiel aus. Noch heute denke ich an Onkel Hans, wenn ich als Morgenmuffel unausgeschlafen zum Frühstück schlurfe – aber immer frisch gekämmt.
Die Besuche bei Onkel Hans in Tastrup, einem kleinen Dorf gleich hinter Adelby, bescherten nicht nur Abenteuer auf dem Heuboden. Es gab auf den Bauernhöfen Unmengen an Schrott und Altmetallen. Einmal pro Woche kam ein Schrotthändler durch Tastrup. Immer an diesem Tag drängte ich meine Mutter zu einem Besuch bei Onkel Hans. Abends fuhr ich dann mit Mutter auf dem Fahrrad um ein paar Groschen reicher zurück nach Flensburg.
Auch die großen Jungs aus der Marienstraße – vor allem auch die schlimmen Petersens aus dem Burghof – hatten mich schnell akzeptiert. Ich stand wohl hervorragend Schmiere, wenn wir in Flensburg in der Nähe der Werft einen großen Schrotthändler hinten beklauten und ihm vorn seinen eigenen Schrott wieder verkauften.
Ich denke heute bei Fernsehberichten über Kinderbanden in Südamerika oft an unsere Straßenbande aus der Marienstraße und dem Burghof. Mit fünf war ich 1949 wohl eines der jüngsten Mitglieder. Unsere Ältesten waren vielleicht 13 oder 14 Jahre alt – richtige Männer eben. Wir klauten wie die Raben und machten zu Geld, was nicht niet- und nagelfest war.
Jede Straßenbande hatte in Flensburg ihr eigenes Revier. Wurden die Reviergrenzen überschritten, gab es Krieg. Die Anführer trafen sich und handelten den Kampfplatz aus. Meistens ging es zum Krieg in die Ballastberge. „Heute, zwei Uhr, Marienstraße gegen Große Straße, Ballastberge, keine Eisenstangen – nur Knüppel!“, so ging es wie ein Lauffeuer durch die beteiligten Straßen und alle zogen mit. Schläge, Kampf, Sich-durchsetzen-Müssen waren ständige Bestandteile meiner ersten Kindheitsjahre, lange schon vor der Schulzeit.
Trost fand ich immer bei meiner Großmutter. Bei ihr konnte ich mich ausweinen, wenn ich wieder einmal in den Ballastbergen verprügelt worden war. Oma Henningsen wohnte mit uns in unserer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Das Wohnzimmer war Omas Bereich, das Schlafzimmer teilte ich mir mit meinen Eltern. Die kleine Küche bot die einzige Waschgelegenheit. Und die Toilette auf dem Flur mussten wir uns mit den Nachbarn teilen.
Oma Henningsen war es dann auch, die mir mitunter eine Kerze und Streichhölzer zusteckte, wenn ich wieder einmal in den Keller im Hinterhaus musste. Dann war es dort nur noch halb so schlimm. Überhaupt hatte meine Oma viel mehr Verständnis für mich als meine Eltern. Sie gab mir auch den entscheidenden Tipp, unseren beinamputierten Hausmeister nicht länger zu foppen, sondern ihm die Haustür aufzuhalten. So tat sich plötzlich eine neue Quelle für allerlei Leckereien auf, die ich zuvor noch nie probiert hatte. Bonbons und Kaugummi aus Amerika, woher unser Hausmeister jeden Monat „Fresspakete“ bekam.
Meine kleine Welt geriet ins Wanken, als ich meine Mutter eines Tages zu meinem Vater sagen hörte: „Oma muss weg!“ Von da an überlegten die beiden oft, wohin man Oma wohl bringen könnte. Von einem Tag auf den anderen war es dann so weit: Oma Henningsen zog aus. Ein Altersheim am anderen Ende der Stadt nahm sie auf. Ihre Tränen werde ich nie vergessen. So oft ich konnte, habe ich sie besucht. Sie hatte ein Zimmer mit einem riesigen gusseisernen Ofen, der so warm war, dass sogar die Eisblumen am Fenster abtauten.
*
Die Marienstraße gehörte damals sicher nicht zu den besten Wohngegenden in Flensburg. Unser viergeschossiges Mietshaus war das größte Haus der ganzen Straße. Darauf war ich immer ein bisschen stolz. Der untere Teil der Marienstraße war geprägt von kleinen, fast reihenhausartig aneinandergebauten Fachwerkhäusern, die zum großen Teil schon mehrere hundert Jahre dort standen. An der Einmündung zur Großen Straße befand sich ein Fischgeschäft, in dem ich jede Woche gemeinsam mit meiner Mutter einkaufte. Drei Pfund grüne Heringe für 90 Pfennige.
Zu Hause wusch meine Mutter die Heringe und schnitt ihnen den Bauch auf. Fasziniert habe ich zugesehen, wie sie mit nur einem Finger die Innereien aus den silbrig glänzenden Fischen herausholte. Nachdem meine Mutter die Heringe gesalzen hatte, legte sie sie in die heiße Bratpfanne. Schon nach kurzer Zeit zog ein herrlicher Geruch von gebratenem Fisch durch die ganze Wohnung. Die dunkelbraun gebratenen Heringe legte meine Mutter dann in eine Essigtunke ein. Die letzten beiden Fische, die frisch gebraten aus der Pfanne kamen, waren unser Mittagessen. Meistens gab es noch zwei oder drei Kartoffeln dazu, die ich manchmal auch zu herrlichem Kartoffelmus stampfen durfte. Mitunter, wenn Onkel Hans uns bei einem unserer Tastrupbesuche ein paar Eier geschenkt hatte, rührte meine Mutter ein rohes Eigelb unter den Kartoffelbrei, der dadurch eine leuchtend gelbe Farbe erhielt – und noch viel besser schmeckte.
Die sauren Heringe aus dem braunen Tontopf bestimmten unser tägliches Abendessen: ein Brot mit Schmalz und ein saurer Brathering. Je länger die gebratenen Heringe in der Tunke lagen, desto besser schmeckten sie. Nach einer Woche waren sogar die Gräten so weich, dass man sie mitessen konnte. Nur der Fischkopf blieb ziemlich hart – aber ihn nach Herzenslust auszulutschen, war für mich täglich wieder ein kulinarischer Hochgenuss.
Im unteren Teil der Marienstraße wohnten in kleinen windschiefen Häusern ein paar ziemlich alte Frauen, älter noch als meine Mutter. Und die war 1949 ja schon dreißig! Von diesen alten Frauen musste ich mich fernhalten. Sie waren so ganz anders als meine Mutter. Am deutlichsten sind mir ihre dick geschminkten Lippen und ihre roten Fingernägel in Erinnerung geblieben. „Das sind schlechte Frauen“, warnte meine Mutter immer wieder, allerdings ohne zu begründen, warum diese Frauen schlecht seien. Aber begründet haben meine Eltern ihre Aussagen und Anordnungen ohnehin nie.
*