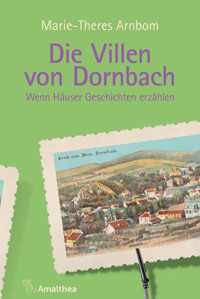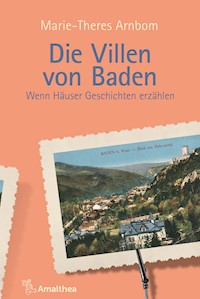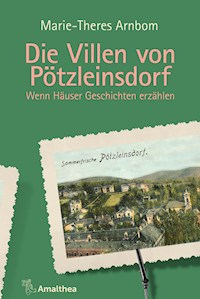Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein historisches Panorama der »Welt von gestern" »In dieser Epoche war meine Heimat." Sie sind Fabrikanten oder Wissenschaftler, Schriftstellerinnen oder Rabbiner, Industrielle oder Journalisten, Operettenkönige oder Pädagoginnen, Architekten oder Ärzte. Ihre Geschichten rekonstruieren im Kleinen eine große Gesellschaft, geprägt von enormer Vielfalt, unglaublicher Kreativität und wachem Innovationsgeist. Die Menschen, von denen Marie-Theres Arnbom erzählt, haben etwas gemeinsam: Sie haben ihre Wurzeln im Judentum und zählen zum Wiener Großbürgertum. Manchen ist Religion wichtig, andere stammen aus Familien, deren Eltern oder Großeltern konvertiert sind; erst 1933 respektive 1938 werden viele brutal an weit zurückliegende Ursprünge erinnert, die mit ihrem eigenen Leben kaum etwas zu tun haben. Marie-Theres Arnbom zeichnet ungewöhnliche, mitunter skurrile Lebenswege nach, die von Wien nach Kansas führten oder aus Bad Ischl nach Afrika. Ein großartiges historisches Panorama der Welt des Wiener jüdischen Großbürgertums und ihres Fortlebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marie-Theres Arnbom
Damals war Heimat
Marie-Theres Arnbom
Damals
war Heimat
Die Welt des
Wiener jüdischen
Großbürgertums
Mit 75 Abbildungen
Besuchen Sie uns im Internet unter: www.amalthea.at
© 2014 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Silvia Wahrstätter, vielseitig.co.at
Umschlagfoto: Gruppenporträt dreier Damen im Modehaus
»Zwieback«, Wien 1913. © Madame d’Ora/Imagno/ÖNB
Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der 11/14,85 Pt Minion Pro
Printed in the EU
ISBN 978-3-85002-877-6
eISBN 978-3-902862-97-6
INHALT
DER ROTE FADEN
Begegnungen von heute führen in die Welt von gestern
I
RABBINER UND SCHRIFTSTELLER
Die Familie Hirschfeld
Victor Léons Ursprünge
Die Hausfrau: »Ein neuer Pfad der Journalistik«
»Der Redner nur, der unter seines Gleichen der beste ist«: Rabbiner Jakob
Victor Léon, der Operettenkönig
»… aus dem Born der Wissenschaft mit vollen Zügen getrunken«: Rabbiner Moriz
Robert Hirschfeld, der Gesinnungsenthusiast
»Dem Theater zugeboren«: Leo Feld
Eugenie: Das Fräulein
Maximilian Hirschfeld, der Arzt und Volksbildner
Joseph Hirschfeld, der Badearzt
»Immer nur lächeln …« Victor Léons Schicksal
II
WAS WÄR’ DIE WELT OHNE DÉSIRÉE?
Annemarie Selinko
Erster Weltkrieg
»Zuerst waren die Papiere nichts mehr wert …«
Die Meisterin der »Sternderl«-Reportagen
Das Hochhaus
»Frauenromane«
Die Bühne als Bühne
»Tote Farben sind große Mode«: 1938
»Die Winkerin«: Neues Leben in Kopenhagen
Frohsinn und Herzensgüte: die kleine Schwester Liselotte
Désirée: ein Plädoyer für die Menschenrechte
Nach dem Krieg: »Ein Paradies und eine Hölle voll Erinnerungen«
III
ZWEI FRÄULEIN DOKTOR UND EIN BRILLANTER JURIST
Familie Bienenfeld
Intellektuelle Ressourcen
Bianca, die erste Sekundarärztin
Elsa, die erste weibliche Musikkritikerin
Korrespondenz mit Wilhelm Furtwängler
Fünf Knöpfe: Elsas Ende
Rudolf, der brillante Jurist
Deutsche und Juden
Die Religion der religionslosen Juden
Rudolfs Leben und Wirken in England
IV
ABENTEURER JENSEITS ALLER KONVENTIONEN
Familie Koritschoner
Mauritius Maria Koritschoner, Arzt der Wiener Künstler
Robert Koritschoner, Pathologe in Kansas City
Hans Koritschoner, genannt Cory, Ethnologe in Tansania
»Richesse dans la lune«: Julius Koritschoner, Kriegsgewinnler und Morphinist
Franz Singer, der Bauhausarchitekt
Mia Hasterliks unstetes Leben
Paul Hasterlik, der liebevolle Idealist
Die Schwestern Mia und Gusti in Amerika
Susi Weiss im afrikanischen Busch
Giulia Koritschoner und das »Federbett«
ANMERKUNGEN
LITERATURVERZEICHNIS
BILD- UND TEXTNACHWEIS
PERSONENREGISTER
DER ROTE FADEN
Begegnungen von heute führen in die Welt von gestern
Wie kommt man auf die Idee, ein Kaleidoskop verschiedener Menschen zusammenzustellen, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben? Meine große Leidenschaft ist es seit Jahrzehnten, größere soziale Zusammenhänge herauszufinden, ob familiär oder gesellschaftlich. Ich habe schon mit vierzehn Jahren einen Riesenstammbaum meiner Familie gezeichnet und bis heute fragen mich meine zahlreichen Cousinen immer wieder, wie wir denn genau miteinander verwandt sind. Die Antwort lautet fast immer: Unsere Ururgroßmütter waren Schwestern. Und da sieht man schon, dass das familiäre Netzwerk sehr weit gespannt ist. Mittlerweile ist es ein Sport geworden, mit Freunden Verwandtschaften zu konstruieren – und über mehrere Verschwägerungen und einige Ecken kommen wir auch erstaunlich oft zu einem positiven Ergebnis.
Aber vielleicht ist das weniger erstaunlich als historisch erklärbar. Dieses Buch unternimmt den Versuch, eine Gesellschaftsschicht zu rekonstruieren, die viele Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede aufweist. Sie ist geprägt von enormer Vielfalt, großer Kreativität und wachem Innovationsgeist und hat einen gemeinsamen Nenner: Alle diese Familien, von denen in diesem Buch erzählt wird, haben ihre Wurzeln im Judentum. Manche waren sich dessen bewusst und übten die Religion auch aus. Andere stammten aus Familien, in denen Eltern oder Großeltern konvertiert waren und die Abstammung damit ad acta gelegt hatten. Erst 1933 resp. 1938 wurden viele Menschen brutal an weit zurückliegende Ursprünge erinnert, die mit ihrem eigenen Leben nicht viel zu tun hatten.
Nach welchen Kriterien wurden die in diesem Buch porträtierten Menschen ausgewählt? Sie alle symbolisieren das große Netzwerk des jüdischen Großbürgertums, das, rasant aufgestiegen, seinen Kindern und Kindeskindern alle Türen öffnen konnte: Alle Berufe standen ihnen offen, Bildung und Kultur gehörten selbstverständlich zum Alltag, die finanzielle Basis eröffnete viele Chancen. Viele der Kinder nützten diese auch aus, und bis zum Ersten Weltkrieg ging alles seinen wohlbestallten, gewohnten Gang. Dann kam der Bruch, der die Welt zum Einsturz brachte und die gesellschaftlichen Bedingungen grundlegend änderte. Die Männer wurden eingezogen und kehrten verletzt an Leib und Seele nach Hause zurück – vielen war auch das nicht vergönnt. Die Frauen hatten vier Jahre lang die Infrastruktur und den Alltag bewältigen müssen. 1918 war das Land zusammengebrochen, die alten Werte waren nichts mehr wert. Gerade die Männer des Großbürgertums vertrauten jedoch darauf, ihr Vermögen würde ihnen nun weiterhin die notwendige Lebensgrundlage bieten. Felix Selinko beispielsweise verzichtete großzügig auf seine staatliche Pension, meinte er doch, genügend Rückhalt in seiner eigenen Firma zu haben. Doch Kriegsanleihen und Inflation ließen die Vermögen rasch schmelzen. Oft blieb nur eine herrschaftliche Wohnung übrig, die immerhin die Möglichkeit bot, das gewohnte Leben in einer vertrauten Umgebung so weit als möglich weiterzuführen. Gerade junge Frauen passten sich den neuen Lebensbedingungen rasch an: Sie wurden selbstständig, suchten sich Arbeit, chauffierten eigene Autos, viele zogen in neu gebaute kleine Wohnungen und führten einige Jahre ein eigenverantwortliches Leben, bevor sie selbst eine Familie gründeten. Über diese neuen Lebensumstände schreibt Annemarie Selinko in ihren Romanen. Sie zeichnete darin ein lebendiges Bild der jungen Frauen, die Tradition mit Moderne verbanden: »Wir haben eben einen gewissen Standard«, meint der Vater einer ihrer Heldinnen. Und sie fügt hinzu: Aber kein Geld mehr, um diesen wie in früheren Zeiten aufrechtzuerhalten.
Dieses Buch wurde während seiner Entstehung von Begegnungen begleitet. Das erklärt auch die Auswahl der porträtierten Menschen, die sich ergeben hat und nicht konstruiert werden musste. Alle diese Familien kommen in Wer einmal war, dem großen und großartigen Buch meines Mannes Georg Gaugusch, vor. Dort findet man unzählige Fakten und viele Informationen über innovative Geister, bewundernswerte Wohltäter, große Künstler, skurrile Herren und Damen und Originale. Mir lag daran, dieser Gesellschaftsschicht einmal mehr Leben einzuhauchen, den Faktenskeletten Fleisch und Seele hinzuzufügen und so eine anschauliche Ergänzung zu schaffen.
Warum ich gerade diese vier Familien ausgewählt habe, hat mit persönlichen Begegnungen zu tun. Ich hätte hundert andere Familien, die sicher ebenso bunt und vielfältig sind, porträtieren können – aber bei den hier vorgestellten bin ich hängen geblieben. Was war der Beweggrund? Es gibt verschiedene Antworten, eine davon ist sicherlich diese: Empfindet man für die Nachkommen besondere Sympathie, erstehen auch die Vorfahren in einem anderen Licht – auch wenn dieses Licht nicht verklärt, sondern durchaus Platz für kritisches Hinterfragen macht.
Oder vielleicht haben diese Familien mich gewählt, wie es schon in Wagners Meistersingern heißt? Ein merkwürdiger Vergleich, meint vielleicht der eine oder andere Leser. Doch so merkwürdig auch wieder nicht, waren doch die Wagner-Vereine des 19. Jahrhunderts ein Hort des jüdischen Großbürgertums. »Gestern war ich in den Meistersingern mit Dlabac. Es war wunderbar und ich musste an Dich und Ernstl und Mia denken, da es ja die Lieblingsoper von Euch allen ist«, schreibt Paul Hasterlik seiner Tochter Gusti im Jahr 1916 – und beweist so auch gleich meine These.
Der Begriff »jüdisches Großbürgertum« birgt Probleme – mir selbst ist es viel lieber, von Familien zu sprechen, die aus der jüdischen Tradition stammen. Denn viele ließen sich aus unterschiedlichsten Gründen taufen und vermeinten, damit die jüdische Vergangenheit ein für alle Mal hinter sich zu lassen. Ein totales Fehlurteil. Katholische Mädchen wurden von Wienern mit faulem Obst beworfen. Warum? Das Sakrament der Taufe wurde außer Kraft gesetzt. Warum? Dekorierte Helden des Ersten Weltkrieges, die ihr Leben für Heimat und Vaterland aufs Spiel gesetzt hatten, mussten nicht nur das Trauma des Zusammenbruchs der Alten Ordnung verkraften, sondern auch die Aberkennung ihrer Verdienste. Warum? Weil ihre Familien einmal jüdisch gewesen waren. Wer maßte sich dies an?
Wo lag der große Unterschied? Oder, wie Rudolf Bienenfeld, von mir besonders verehrter Jurist und Porträtierter dieses Buches, 1936 festhielt: Warum fürchteten sich 60 Millionen Deutsche vor 500 000 Juden? Dies bedenkend wird die Absurdität und Unmenschlichkeit erneut und besonders bewusst: Denn eine Antwort kann es nicht geben. Und doch findet sie Rudolf Bienenfeld zu Recht in den Folgen des Ersten Weltkrieges – ein Faktum, das bis heute viel zu wenig beachtet wird: Die Demütigung der Deutschen – und auch des verbliebenen Österreichs – brachte ein »Jetzt erst recht«-Selbstbewusstsein hervor – und isolierte sie damit von den anderen europäischen Nationen. Statt eines gemeinsamen Neuanfangs gab es ausschließlich Ressentiments. Der Status des Opfers führte zu einer Isolation, die keinen Platz für Gemeinsames ließ. Alle waren gegen Deutschland, daher waren die Deutschen gegen alle. Und vor allem gegen diejenigen, denen sie sich intellektuell unterlegen fühlten: den Künstlern, den Schriftstellern, deren Geist geschärft worden war durch eine Erziehung, in der Sprache eine große Rolle spielte. Moderne Lebensformen standen biederer Häuslichkeit gegenüber, geschäftliche Internationalität nationaler Engstirnigkeit. Und angeblich »jüdische« Emanzipation gegen braves deutsches Hausfrauentum.
Dieses Buch handelt von unkonventionellen Menschen, die einen Zeitraum von 200 Jahren prägten. Von Rabbinern, die sich der Moderne zuwandten. Von Schriftstellern, die die Gegenwart abbildeten und analysierten. Von Abenteurern, die die alte und die neue Welt miteinander verknüpften. Welche Faktoren hatten dies überhaupt ermöglicht?
Das führt gleich zum nächsten Thema: dem enormen Stellenwert der Bildung. Die Rabbiner Jakob und Moriz Hirschfeld hatten sich in besonderem Maße dafür eingesetzt – denn nur höhere Bildung war ein Garant für Assimilation. Zahlreiche Mitglieder der porträtierten Familien setzten sich mit glühendem Eifer für Bildung ein. Ein Forum bot die Wiener Volkshochschule – eine bewundernswerte Initiative, vielen Bevölkerungsschichten den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Dies war ein wesentlicher Aspekt, der die hier porträtierten Familien verband. Ob sie über Musik sprachen, wie Robert Hirschfeld und Elsa Bienenfeld, ob sie Konzertreihen konzipierten, wie Irma Hasterlik, Mikroskopier-Kurse abhielten, wie Robert Koritschoner, über Cholera-Prophylaxe sprachen, wie Moriz Koritschoner, über die Biologie des werdenden Menschen, wie Bianca Bienenfeld, oder über das Mittelmeer als Schicksalsweg unserer Kultur referierten: Sie alle stellten ihr Schaffen auch in den Dienst der Bildung anderer Menschen, aus dem Bewusstsein heraus, dass nur Wissen mündige Menschen hervorbringt.
Dass sich dann die Welt in eine so andere Richtung entwickelte, sahen sie mit Besorgnis, Angst und Fassungslosigkeit. Rudolf Bienenfeld schuf mit seinem Buch Deutsche und Juden aus dem Jahr 1936 eine der brillantesten Analysen. Er verschloss die Augen nicht vor der Realität – und konnte doch nicht ahnen, welche Dimensionen diese Entwicklung annehmen sollte.
Dies führt zu einer weiteren Verbindung: All die vorgestellten Familien vertrauten auf den Rechtsstaat, glaubten an Zivilisation und Gleichheit der Menschen. Fast alle Jungen konnten unter schwierigsten Umständen entkommen, die ganz Alten jedoch blieben übrig, wurden aus ihrer vertrauten Umgebung gerissen, von einer Wohnung in die nächste mit anderen Menschen zusammengepfercht, jeglicher Privatsphäre beraubt und schließlich im hohen Alter nach Theresienstadt transportiert, um dort unter entsetzlichen Bedingungen weitere Monate zu vegetieren. Andere wurden nach Auschwitz oder Maly Trostinec deportiert und dort sofort ermordet. Auch Annemarie Selinkos vierjährige Nichte fiel dem Morden zum Opfer. Für sie hat es kein Leben gegeben.
Alle diejenigen, die im hohen Alter einen so würdelosen und grausamen Tod erleiden mussten, hatten ein erfülltes Leben gehabt, Großartiges geleistet, Neues geschaffen, sich für das Gemeinwohl eingesetzt. Im Mittelpunkt dieses Buches steht der Wunsch, ihre vielfältigen Geschichten, ihre spannenden Persönlichkeiten dem Vergessen zu entreißen.
Viele Menschen haben dieses Buch begleitet. Ohne die Begegnungen mit ihnen wäre vieles nicht möglich gewesen, und sie alle bereichern mein Leben. Ihnen allen sei mein innigster Dank gesagt.
Meiner geduldigen Familie.
Tom Anninger, Heinrich Berg, Godfrey Dawkins, Hanna Ecker, Wolf-Erich Eckstein, Renate Eissing-Suchy, Ernst Gečmen, Giulia Hine-Koritschoner, Harvey Hine, Clara Huber, Nick Kary, Barbara Kühnelt-Leddihn, Stefanie Leimser, Georg Male, Juliane Schenk, Benigna Schönhagen, Georg Schrom, Ruth Steiner, Katharina Stourzh, Astrid Wallner, dem Team von Anno und natürlich Brigitte Sinhuber-Harenberg, Carmen Sippl und den Mitarbeitern des Amalthea Verlages.
I
RABBINER UND SCHRIFTSTELLER
Die Familie Hirschfeld
Zu kaum einer Familie habe ich eine so vielschichtige Beziehung wie zur Familie Hirschfeld. Doch wo beginnen? Vielleicht bei der Musik, die mich mein Leben lang begleitet. Victor Léon, Librettist der Lustigen Witwe, ist eine faszinierende und wahrlich nicht unumstrittene Persönlichkeit – gerade eine solche Polarität übt immer einen besonderen Reiz aus, denn es steckt etwas Außergewöhnliches dahinter. Dem nachzuforschen, erwies sich als wahre Detektivarbeit, die die historische Recherche spannend macht. Wer waren die Eltern dieses herausragenden Kindes, fragt man sich. Und stößt auf eine Dynastie von Rabbinern und Ärzten, denen die Bildung über alles ging. Wortgewaltige und streitbare Persönlichkeiten, die ihren Kindern eines auf den Lebensweg mitgaben: Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Eigenschaften, die diese Familie bis heute prägen.
Victor Léon hatte einen nebenehelichen Sohn, natürlich Victor genannt. Dessen Mutter war die erfolgreiche Soubrette Margit Suchy – und der Zufall (wenn es einer war) ließ mich Victor Suchys Großneffen heiraten. Dieser hatte das zweifelhafte Glück, in derselben Woche Geburtstag zu haben wie sein mehr als sechzig Jahre älterer Großonkel, aus praktischen Gründen wurde dieser immer gemeinsam begangen. Die Beziehung zu Victors Nachkommen ist dennoch innig – und Victor Léons Ururenkelin ist unser Patenkind.
Im Zuge meiner Recherchen für eine Operetten-Ausstellung im Österreichischen Theatermuseum lernte ich auch die ehelichen Nachkommen kennen und tauchte in die Familiengeschichte ein. Im Hause von Victor Léons Urenkel fand ich viele Schätze: ein Deckerl, bestickt mit einem Zitat aus der Lustigen Witwe, Fotos, Bücher und Libretti – und Erinnerungen, die lange Jahre verschüttet waren und nun wieder zum Vorschein kamen. Eine der wunderbarsten Freundschaften entstand daraus – ich habe das Gefühl, fast ein Teil dieser Familie zu sein.
Und dann fand ich per Zufall einen weiteren Nachkommen: einen Reverend in Nairobi, der mir das Foto seines Ururgroßvaters Maximilian Hirschfeld, Zahnarzt in Karlsbad und Meran, per E-Mail zusandte. Plötzlich wurde auch dieser Teil der Familie lebendig – und ich begab mich auf weitere Spurensuche: zuerst nach Augsburg in die jüdische Gemeinde, wo Jakob Hirschfeld Rabbiner gewesen war. Dann nach Schoßberg in der heutigen Slowakei, dem Geburtsort des »Urvaters«. Eine beeindruckende und zugleich traurige Reise in die Vergangenheit: Die Synagoge, von der alles seinen Ausgang genommen hat, ist eine Ruine, in der Tauben statt Gläubigen ihr Zuhause gefunden haben.
Ein Besuch in einer Wohnung in Pötzleinsdorf am Rande Wiens, wo ich selbst wohne, gab der Suche eine neue Facette: Dort lebten und arbeiteten die Geschwister Adele und Eugenie Hirschfeld, im Stockwerk darüber ihr Bruder Leo Feld. Sie empfingen Literaten wie Stefan Zweig und Felix Braun. Die heutigen Besitzer erlaubten mir einen Blick in die Wohnung, aber auch hinaus ins Grüne – ein Blick, der sich in den vergangenen hundert Jahren nur wenig verändert hat.
Victor Léons Ursprünge
»Im Alter von 82 Jahren starb völlig verarmt der Librettist Victor Leon, der für Strauss, Lehár und andere Komponisten Texte schrieb. Sein Vermögen und sein Grundbesitz waren nach dem deutschen Einmarsch in Österreich beschlagnahmt worden. Leon war der Sohn des Philosophen und Rabbiners Dr. Heinrich Hirschfeld.«
Mit dieser beinahe lakonischen Pressemeldung informiert der Aufbau, die Zeitschrift der Emigranten in New York, seine Leser am 3. Mai 1940 über den Tod eines der bedeutendsten Librettisten der Operettenszene. Ein Leben, das enorme Erfolge, Ruhm und Ehre beinhaltet hatte, war am 23. Februar dieses Jahres zu Ende gegangen, erst zehn Wochen später gelangte die Nachricht an die Öffentlichkeit. Wie hätten die Nachrufe geklungen, wäre alles noch in Ordnung gewesen? »Die Wiener Operette verliert einen ihrer begabtesten und erfolgreichsten Librettisten«, hätte es geheißen. Und der Hinweis auf den enormen Erfolg hätte sicher nicht gefehlt: »Der erste wirkliche Welterfolg der modernen Wiener Operette war Lehars ›Lustige Witwe‹, deren Buch Victor Leon und Leo Stein verfaßten. In diesem Buche hatte Stein sich auf jene moderne internationale Tonart eingestellt, deren Pathos und Eleganz zwar nicht ganz echt waren, aber sehr stark wirkten.« So ist es jedenfalls im Nachruf auf Léons Coautor Leo Stein am 30. Juli 1921 in der Neuen Freien Presse zu lesen. Victor Léon blieb diese Würdigung verwehrt.
Geboren wurde Victor Hirschfeld, wie er eigentlich hieß, am 4. Jänner 1858 im ungarischen Szenitz, nur eineinhalb Stunden von Wien entfernt und doch in einer völlig anderen Welt. Nichts erinnert heute mehr an die jüdische Gemeinde, bis auf den kreisrunden Friedhof, der zwischen Fußballstadion und Tragluft-Tennishalle ein Relikt einer untergegangenen Welt ist. Victors Vater Jakob war als Rabbiner in Szenitz tätig; als Victor fünf Jahre alt war, wurde der Vater nach Augsburg berufen. Dort beginnt Victor seine Schullaufbahn, um sie dann im niedersächsischen Seesen fortzusetzen. Warum gerade in Seesen, fragt man sich. Die Antwort verblüfft: In Seesen war 1802 die Jacobson-Schule gegründet worden, ein Institut im Sinne der Aufklärung und des Reformjudentums, interkonfessionell ausgerichtet und für jüdische und christliche Kinder gleichermaßen offen. Auf hebräische Grammatik und Schreiben wurde ebenso Wert gelegt wie auf naturwissenschaftliche Fächer und alte Sprachen sowie Französisch. Wie die Morgenandacht für die Schüler aller Konfessionen zur Zeit Victor Léons begann, beschreibt der damalige Direktor Josef Arnheim: »Dies beginnt mit den rituellen Gebeten für die jüdischen Schüler und schließt mit einem allgemeinen Choral, der von sämmtlichen Schülern ohne Ausnahme gesungen wird.«1 Dass ein Rabbiner seinen Sohn in eine solch modern ausgerichtete Schule schickt, spiegelt seine eigene Geisteshaltung und beweist, dass Jakob dem Reformjudentum sehr nahe steht.
Vergangenheit und Gegenwart: Der jüdische Friedhof in Szenitz und das Fußballstadion
Am 6. März 1878 erscheint Victor Léon, wie er sich mittlerweile nennt, erstmals als Theaterautor in der Öffentlichkeit mit dem Lustspiel Falsche Fährte, das am Wiener Sulkowski-Theater aufgeführt wird. Valentin Niklas, der Leiter dieses kleinen Theaters, fördert mit Kräften junge Talente – so auch den erst zwanzigjährigen Léon. Im folgenden Jahr wird das Stück unter dem Namen Postillon d’amour publiziert – ein zugegebenermaßen sehr seichtes Stück, gewidmet dem »verehrten Bühnenschriftsteller f. Zell«.
Die Jacobson-Schule in Seesen
Die Hausfrau: »Ein neuer Pfad der Journalistik«
Bereits 1877 ist Léon journalistisch tätig und redigiert Die Hausfrau. Blätter für Haus und Wirtschaft samt der Beilage Der Damensalon. Diese Zeitschrift, mag der Titel heute auch sehr altmodisch klingen, war eine Novität. »Ein solches Organ ist ein Bedürfnis der Zeit; und diese Lücke nach besten Kräften auszufüllen, das ist es – was wir wollen.«
Eigentümer der Zeitschrift Die Hausfrau ist Sigmund Popper, der auf eine recht bunte berufliche Laufbahn verweisen konnte: So taucht er als Wollhändler im ungarischen Holitsch auf, um dann die Branche zu wechseln und als Redakteur und Herausgeber des Bade- und Reise-Journals in Wien und ab 1877 Herausgeber und Verleger der brandneuen Zeitschrift Die Hausfrau mit der Beilage Der Damensalon aufzuscheinen. Dieses neue Blatt gibt er gemeinsam mit seinem Sohn Julius heraus, redigiert wird es von Victor Léon. Wie kommen diese Herren nun zueinander? Ganz einfach: Sigmund Popper ist mit Amalie Hirschfeld verheiratet, der Schwester von Victor Léons Vater Jakob, der ebenfalls als Autor dieser Zeitschrift beschäftigt ist: Aus seiner Feder stammen unter anderem »Rhapsodien über Erziehung«. Somit ist die ganze Familie vereint, denn ein weiterer Bruder Amalies, der Arzt Dr. Maximilian Hirschfeld, gibt als ärztlicher Ratgeber unermüdlich Tipps, so in seinen »Betrachtungen über den Kindergarten« in mehreren Fortsetzungen. Das Geschick der neuen Zeitschrift liegt also in den Händen von zwei Geschwistern, einem Schwager und zwei Cousins.
Eine journalistische Pionierleistung
Im ersten Leitartikel am 8. September 1877 erklären die Herausgeber, was sie mit dieser für die damalige Zeit eher ungewöhnlichen Zeitschrift wollen: »Wir wollen mit diesen Blättern ein Organ gründen für die Interessen der Hausfrau; zunächst und vorwiegend in Bezug auf Hauswirthschaft. Auf dem Gebiete der Haushaltung, in all den tausendfachen Einzelheiten, welche zusammen die Ökonomie des Familienlebens bilden, soll die ›Hausfrau‹ der Hausfrau mit Rath und Fingerzeig an die Hand gehen. Sie soll zeigen, wie man all die in der Haushaltung erforderlichen Gegenstände, seien es Consumartikel, seien es Einrichtungsgegenstände, seien es Mittel des Bedürfnisses, seien es die des Luxus – die ›Hausfrau‹ soll zeigen, wie man all diese Güter der häuslichen Ökonomie in bester Qualität und doch zu den billigsten Preisen sich anschaffen kann.«
Und weiter wird auf die Novität hingewiesen: »Wir betreten – wir wissen es – hiemit einen neuen, noch ungeahnten Pfad der Journalistik. Aber eben hierin liegt die Berechtigung, ja das Bedürfnis dieses Unternehmens, indem wir für eine Sphäre des menschlichen Lebens, die bisher über kein öffentliches Organ verfügte, und dessen sie doch so dringend bedarf, ein solches ins Leben rufen. Oder ist es nicht eigenthümlich, daß in einer Zeit, wo die Journalistik sich über alle Gebiete des Lebens ausdehnt, so alle Gebilde und Vereinigungen der menschlichen Gesellschaft, von Staat und Kirche bis hinab zu Sport- und Spielvereinen, in der Regel eine Zeitung zur Pflege und Vertretung ihrer Interessen haben – doch EIN Institut jedes öffentlichen Organes entbehrt! Ein Institut – das wichtigste unter allen, die Grundlage, auf der die ganze civilisierte Gesellschaft sich aufbaut – die Familie!«
Doch nicht nur praktischen Belangen will die neue Zeitschrift dienen, im Damensalon »werden die mannigfachsten schöngeistigen Gaben geboten werden, spannende und lebensvolle Erzählungen, wie überhaupt Dichtungen in Prosa, Poesie, Berichte über Literatur und Kunst, namentlich über Theater und Musik, Mittheilungen über Mode und was sonst die elegante Welt interessiert.« Hauptaufgabe soll sein, »literarische Producte von Damen zur Veröffentlichung zu bringen, sowohl von anerkannten hervorragenden Schriftstellerinnen, die uns auch bereits ihre schätzenswerthe Mitarbeiterschaft zugesagt, als auch Geisteserzeugnisse von aufstrebenden Talenten, wenn sie der Veröffentlichung würdig, so daß der Damensalon zur Förderung der Literatur in und aus den weiblichen Kreisen dienen wird.«
Drei Jahre zuvor hat Lina Morgenstern in Berlin die Deutsche Hausfrauenzeitschrift gegründet und somit eine Pioniertat geleistet. Sigmund Popper überträgt diese Idee nun auf Österreich und kann Lina Morgenstern auch als Autorin gewinnen. Sie engagiert sich besonders für die Einrichtung von Kindergärten und die höhere Bildung für Frauen. Sätze wie dieser aus dem Jahre 1877 haben nichts an Brisanz verloren: »In der Schule, wo Massen von Schülern einem Lehrer gegenüberstehen, kann nur bis zu einem gewissen Grade individuelles Eingehen stattfinden.«2
Victor Léon nützt das Forum dieser Zeitung natürlich auch für sich selbst: Er veröffentlicht Fortsetzungsnovellen wie Eine Liaison oder Gedichte wie Madonna und ist in jeder Ausgabe auch mit Theater-Causerien oder Leitartikeln präsent. Anlässlich der Hochzeit seines Cousins Julius Popper mit Marie Kohn im Jahre 1877 verfasst Léon am 24. November ein überschwängliches Jubelgedicht mit dem Titel Hochzeitscarmen:
Und wir, »Die Hausfrau«, Deine erste Favorite,
Sind eifersüchtig nun, fürwahr!
Wir kennen das! Und es scheint rar,
Bei der vielweiberischen Sitte,
Daß Du die gleiche Lieb’ uns noch wirst schenken,
Da Du Maria nun gefreit.
Und fast hätt’ es uns auch gereut,
Daß wir Dich mit dem Carmen hier bedenken!
Zwar wie’s behaupten böse Mäuler:
»Der Frauen zwei thun selten gut!«
Doch ohne Sorg! Und guten Muth!
Die »Hausfrau« stehet fest wie Marmelpfeiler.
1879 jährt sich der Hochzeitstag von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth zum 25. Mal – für Victor Léon Anlass genug, das Dramatische Festgedicht Mein Österreich! auf Seite 1 der Hausfrau zu veröffentlichen. Die auftretenden Personen: Austria samt ihren Töchtern Hungaria, Bohemia, Istria und Bosnia. Ein sehr melodramatischer Verlauf: Bosnia sucht Hilfe, Istria antwortet: »Du strupp’ges garst’ges Ding! Wer bist Du?« In blumiger Gedichtform schildert Bosnia die Situation in ihrem Heimatland, wo »kein hurtig’ Dampfroß durch die Ebene jagt« und Moschee und Kirche einander feindlich sind: »Verarmt ist Alles; ohne Kraft und Muth.« Selbstverständlich verspricht Austria Hilfe und will »in Dein Land den Segen der Cultur, der Bildung bringen« und Bosnia zur Tochter wählen. In all ihren Unterschieden »in Sprach’, in Sitte und Gewohnheit« vereint Austrias Töchter ein Band: »Ein ganzes sind wir, wir sind Austria.« Doch die Dramatik steigert sich noch mehr, denn das wahre Band hat auch einen Namen: »Der Kaiser, Ritter ohne Tadel, ohne Fehl, die Kaiserin Öst’reichs schönstes Kronjuwel.« Und nun steuert das Gedicht seinem Höhepunkt zu, die Regieanweisung verheißt Folgendes: »Der hintere Vorhang öffnet sich; in bengalischer Beleuchtung erblickt man die bekränzten Büsten des Kaisers und der Kaiserin. Melodram: die Volkshymne.« Ein verheißungsvoller Ausblick auf Victor Léons kommende Operettenkarriere …
»Der Redner nur, der unter seines Gleichen der beste ist«: Rabbiner Jakob
Jakob Hirschfeld wurde 1817 in Schoßberg geboren, das ungarisch Sasvár und slowakisch Šaštín heißt, damals in Ungarn und heute in der Slowakei gelegen. In Schoßberg, von Wien in weniger als zwei Stunden zu erreichen, erinnert noch die einstige Synagoge an das jüdische Leben. In dieser Synagoge wurden Jakob und seine Brüder beschnitten, feierten sie ihre Bar-Mizwa, ihre Schwestern heirateten hier – dies war ihre Heimat. Heute ist die Synagoge eine Ruine, einzig der Plafond lässt an manchen Stellen noch den alten Glanz erahnen.
Die traurigen Reste der Synagoge in Schoßberg. Nur mehr der Plafond lässt die vergangene Schönheit erkennen.
Jakobs Vater Emanuel Isak stammte aus Mähren und wirkte als Rabbinats-Assessor, ein altmodischer Ausdruck für Rabbiner-Gehilfe, in Schoßberg. Dreizehn Kinder setzte er gemeinsam mit seiner Frau Marie Landesmann in die Welt, zwei Söhne wurden Rabbiner3, zwei Ärzte. Jakob versucht sich zunächst auch in der Medizin, wendet sich aber doch der Theologie zu und wird in Wien promoviert. Vorerst schlägt er eine fast konventionell wirkende Berufslaufbahn ein: Drei Jahre lang ist er Rabbiner im ungarischen Szenitz (heute Senica), die nächsten fünf Jahre Rabbiner im rund 400 km südlich gelegenen Fünfkirchen (ungarisch Pécs) sowie Oberrabbiner des dazugehörigen Komitats Baranya im südlichsten Teil Ungarns. Die Geburtsorte seiner Kinder aus der Ehe mit Pauline Ausch spiegeln die Stationen seiner Karriere wider: Victor wird wie erwähnt am 4. Jänner 1858 in Szenitz, Adele am 23. März 1862 in Fünfkirchen, Eugenie nur neuneinhalb Monate später, am 1. Jänner 1863, ebenfalls in Fünfkirchen und Leo sechs Jahre später, am 14. Februar 1869, in Augsburg geboren. Dorthin ist Jakob Hirschfeld 1863 als Rabbiner berufen worden; ein nicht ganz einfacher Posten, muss der Rabbiner doch zwischen verschiedenen Gruppierungen vermitteln: Einerseits darf er nicht zu konservativ agieren und gegen Händler opponieren, die am Sabbat auf der Augsburger Dult, dem zweimal jährlich stattfindenden Jahrmarkt, verkaufen wollen, andererseits aber auch nicht zu liberal sein, um die Traditionen zu bewahren.4
Ein Inserat in der Zeitschrift Der Israelit, Centralorgan für das orthodoxe Judentum vom 10. Februar 1864 macht auf eines von wohl vielen ähnlichen Angeboten aufmerksam: »Eltern, die ihre Töchter an trefflichen Lehranstalten eine höhere Ausbildung angedeihen zu lassen und Augsburg wegen seines gesunden Klima’s vorzuziehen geneigt sein dürften, erbietet sich eine Dame von höherem Stande und höherer Bildung Mädchen nach zurückgelegtem 7. Lebensjahre in ihrem Hause unter annehmbaren Bedingungen aufzunehmen. Nebst häuslichem Komfort und der Beaufsichtigung und Leitung in Arbeiten der Instituts-Aufgaben von Seite der Dame wird auf wahre Herzens- und Geistesbildung hingestrebt werden. Der Religionsunterricht wird so wie die öffentlichen Religionsschulen des Distrikts unter Überwachung und Leitung Seiner Hochwürden des Herrn Distrikts-Rabbiners Dr. Hirschfeld stehen; auch kann gegen besondere Vergütung Klavier- und Singunterricht ertheilt werden. Reflektionen belieben sich zu wenden an Seine Hochwürden Herrn Distrikts-Rabbiner Dr. Hirschfeld in Augsburg.«
Sieben Jahre später urteilt der Israelit nicht mehr so gütig über den Rabbiner Hirschfeld – seine liberalen Ansichten verunsichern die Vertreter der Orthodoxie und verändern die Berichterstattung über seine Tätigkeit radikal.
In den vielen Artikeln, die über Jakob und seinen Bruder Moriz publiziert werden, fällt beider enorme rhetorische Begabung auf. So hält Jakob auf den verstorbenen Rabbiner Ullmann aus Makó eine »Rede mit der ihm eigenen Meisterschaft, die den Namen eines hervorragenden Redners, den er hier zu Land hat, vollkommen rechtfertigt. Diese Feuerrede zündete in allen Gemüthern.«5 Tags darauf beim Sabbat-Gottesdienst geht es gleich weiter: »Diese Predigt, in Bau und Form so kunstgerecht, durch blühende Diktion so ausgezeichnet, daß sie auf der Kanzel einer Residenz hätte gerechte Bewunderung erregen müssen, war zugleich von jenem glühend jüdischen Geiste getragen, der das Herz des Weltlings wie des Altfrommen tief ergreifen muß.« Sein fünfjähriger Sohn Victor lauscht sicher mit offenen Ohren – wer in einem Haus mit solcher Liebe zur Sprache aufwächst, von dem kann Großes erwartet werden.
Bereits Jakob und Moriz waren in einem wortgewandten und gebildeten Hause aufgewachsen: In einem Nachruf auf ihre Mutter Marie, der »Gattin des wegen seiner rabbinischen Gelehrsamkeit wie Frömmigkeit in weitern Kreisen rühmlich bekannten Herrn E. I. Hirschfeld«6, werden die Verdienste ihres Ehemanns gewürdigt: »Herr Hirschfeld, von rabbinischen Autoritäten seit langem für das Rabbinat autorisiert, fungierte bereits vor 20 Jahren bei Sitzungen des collegii rabbinici in Wien als Rabbinats-Assessor unentgeltlich.« Aus diesem Grunde oder weil »der edle Greis vor etwa einem halben Jahrhunderte Vorsteher der frommen Brüderschaft in Wien war«, erhält er ein Ehrengrab. Doch eigentlich gilt der Nachruf seiner Frau Marie und ihrem Trauergottesdienst, den natürlich ihr Sohn Jakob abhält. »In einer längeren ergreifenden Rede, die die Versammlung in steter Rührung hielt und oft zu Thränen brachte, lernte dieselbe in der Betrauerten eine jener durch Geist und Gemüth sich auszeichnenden frommen Frauen in Israel kennen, deren Reihe mit jedem Tage mehr sich lichtet und verdient sie wol in dieser Rücksicht ihres eigenen Werthes, als etwa auch in Rücksicht dessen, daß sie ihrer Glaubensgenossenschaft 4 Söhne gegeben, die sämmtlich der Intelligenz – 2 der theologischen, 2 der medicinischen – angehören, daß ihr der Nachruf werde: Friede ihrer Asche!«
An all seinen Wirkungsstätten setzt sich Jakob Hirschfeld für Bildungsinstitute und die Errichtung von Schulen ein. Die Allgemeine Zeitung des Judentums berichtigt am 20. Juli 1857 die Darstellung, dass in Ungarn die Schulen »kaum entstanden, wieder zu Grabe gehen«. Dagegen spricht sich Leopold Silberstern als erster Lehrer der Hauptschule aus und berichtet über die Zustände in Szenitz: Dort »besteht nicht nur eine Schule, und zwar eine vierclassige Hauptschule unter der ebenso umfassend einsichtigen, als eifrigst thätigen Leitung des Herrn Rabb. Dr. Hirschfeld, der ihr als Director vorsteht, sondern sie befindet sich in so blühendem Zustande, und genießt einen solchen Ruf der Vorzüglichkeit, daß selbst Eltern aus fern gelegenen Gemeinden mit großen Opfern ihre Kinder in die hiesige Schule bringen.« Und weiter heißt es: »Und in der That, wo sollte eine Schule bestehen und blühen, wenn nicht in einer Gemeinde, wo Herr Dr. Hirschfeld an der Spitze steht? Wir sagen dies nicht in Bezug auf seine Eigenschaften als Gelehrter oder Kanzelredner, sondern eben in Bezug auf seine ganz außergewöhnliche, hingebungsvolle Thätigkeit auf dem Gebiete der Jugenderziehung.«7
1858 wird Jakob Hirschfeld nach Fünfkirchen berufen, »er entspricht vollkommen allen von ihm gehegten Erwartungen«, meint der Hauptschullehrer Joachim Gutmann für Ben Chananja im 10. Heft 1858. »Sein Feuereifer für das Judenthum gewinnt ihm alle Herzen. Sein moralischer Einfluß auf die Schule ist sehr wohlthätig, sein Umgang mit den Lehrern sehr liebreich. ›Ich will nur der erste Kollege der Lehrer sein!‹«
Aus Fünfkirchen sind zwei von Jakob Hirschfeld verfasste Nekrologe erhalten: Einer ist in der Zeitschrift Ben Chananja erschienen, der andere als kleines Büchlein. Ersterer gilt Jakob Stern und weist auf eine Besonderheit hin: Im Normalfall erhalten nur reiche Wohltäter einer Gemeinde die Auszeichnung eines ausführlichen Nachrufs, nicht jedoch Jakob Stern, der kein reicher Mann war, sich jedoch durch ideellen Reichtum große Verdienste erworben hatte, denn »sein ganzes Wesen war Wohlwollen. Er athmete Liebe zu Gott und zu seinen Nebenmenschen.«8 Und einem weiteren Mitglied der Fünfkirchener Gemeinde widmet Jakob Hirschfeld sein Andenken: Ludwig Engel, siebzehnjährig gestorben, entstammt der berühmten Familie Engel-Janosi.
Jakob Hirschfeld setzt sich auch in seiner Gemeinde in Fünfkirchen stark für die Einrichtung einer eigenen Rabbinerschule ein und unterstützt die Ausbildung »bedürftiger Handlungs- und Handwerkslehrlinge«, wie die Zeitung Die Neuzeit am 11. April 1862 berichtet. Die bereits existierende jüdische Volksschule genügt nicht, Hirschfeld propagiert eine Gemeinde-Hauptschule, die einen »Unter- und Oberbau« erhält: der Unterbau als »Kinderbewahranstalt« für die Kleinen, der Oberbau als »Fortbildungsanstalt« zur Ablegung der Matura. Der Weg an die Universitäten wird geebnet. Bildung gilt als wichtigstes Instrument des sozialen Aufstieges, Jakob Hirschfeld vertritt diese Position nicht nur für seine Gemeinde, sondern auch bei der Erziehung seiner eigenen Kinder.
1863 wechselt er nach Augsburg und hält am 13. April, »vor seinem Austritte aus dem Vaterlande«, noch eine begeistert aufgenommene Predigt in Altofen. Eine Dankesadresse bleibt als Erinnerung: »Schmerzlich ist es, daß das Vaterland Sie verliert, aber der Baum, in fremdes Erdreich verpflanzt, um dort seine goldenen Früchte zu tragen, muß dem heimatlichen Boden Ehre verschaffen«, schreibt Die Neuzeit am 8. Mai 1863 in blumigen Worten.
Jakob hält 1865 einen Trauergottesdienst für seinen Vater, »den gelehrten Theologen Herrn Emanuel Isak Hirschfeld«, ab. »Die außerordentlich große Zuhörerschaft, während eines siebenviertelstündigen Vortrages, durch seine glänzende und tief ergreifende Beredsamkeit war wahrhaft gefesselt und erschüttert«, berichtet die Allgemeine Zeitung des Judentums am 29. März 1865. »Siebenviertelstündig« – also 1 ¾ Stunden – fesselt Hirschfeld die Trauergemeinde mit dem ihm eigenen enormen dramaturgischen Talent. Leider ist auch diese wie die meisten seiner Reden (oder Predigten) nicht erhalten.
Im selben Jahr wird in Augsburg eine neue Synagoge eingeweiht, mit der ersten Orgel in einer bayerischen Synagoge. Ein Zeichen großer Liberalität, denn die Traditionalisten sprechen sich vehement dagegen aus. In Augsburg dürfte die Gemeinde jedoch tatsächlich sehr liberal eingestellt gewesen sein, denn, wie es 1917 in einer Festschrift zur Einweihung der neuen Synagoge heißt, die Konservativen fügten sich »wenn auch nicht wortlos, so doch friedlich in die neue Ordnung«. Leider ist Jakob Hirschfelds Eröffnungsrede ebenfalls nicht erhalten, sie muss fulminant gewesen sein. Vielleicht sogar ein wenig zu fulminant, wie die enthusiastischen Reaktionen der Anwesenden vermuten lassen. Die Zeitschrift Ben Chananja schreibt am 19. April 1865: »Es hat die Rede die Feierlichkeit fast weniger gehoben, als eigentlich verdunkelt, indem Alles unter dem überwältigenden Eindrucke, den die Rede hervorgerufen, nur mit dieser und ihrem durch Sprache, Gedanken wie Geistesblitze glänzenden Gehalte sich beschäftigt und man beinahe die Veranlassung aus dem Auge verliert.«
Die Allgemeine Zeitung des Judentums berichtet ebenfalls über dieses Ereignis, das in Anwesenheit von Vertretern der christlichen Konfessionen, Repräsentanten der königlichen Regierung, des Stadtmagistrats, der Stadtbehörden und des Offizierscorps begangen wurde. Eine beeindruckende Aufzählung. Von mehreren Seiten wurde gefordert, diese Rede doch drucken zu lassen, und »mehrere christliche Bürger erklärten im Vorhinein, die Einen 50, die Andern 100 Exemplare der gedruckten Rede zur Verbreitung derselben zu nehmen«.9
Zwei Reden sind jedoch erhalten und geben Einblick in Jakobs unglaubliches Talent, nicht nur sprachlich die Zuhörer zu fesseln, sondern den Text dramaturgisch perfekt aufzubauen, wie einen Theatermonolog. Auf temperamentvolle Ausbrüche folgen elegische Teile, die Abfolge bannt die Gemeinde und lässt sie die Aufmerksamkeit nie verlieren. Eine dieser erhaltenen Reden ist die auf den Tod König Maximilians II. von Bayern vom 14. März 1864 und zeigt eine weitere Facette: Bescheidenheit ist Jakob Hirschfelds Sache nicht. (Auch diese Charaktereigenschaft zeigt sich bei seinem Sohn Victor.) Am Beginn heißt es: »Eine Trauerrede soll ich halten auf König Maximilian II. von Bayern! Wer vermöchte einem so erhabenen Vorwurf würdig zu entsprechen? Daran sollte sich nur Einer wagen. Der Redner nur, der unter seines Gleichen der beste ist. Denn der König, dem die Rede gilt – o der war unter Seines Gleichen – der Beste!« Nun wartet der Leser auf die Abschwächung, dass Jakob Hirschfeld sich selbst eben doch nicht als den Besten ansieht – aber auf den 25 Seiten der Rede wird diese doch recht anmaßende Selbsteinschätzung niemals in Zweifel gezogen.