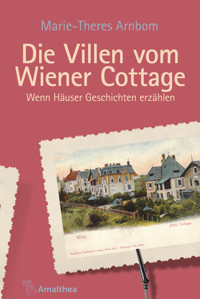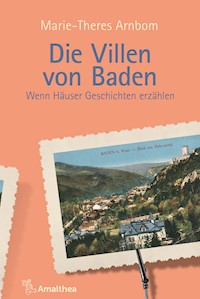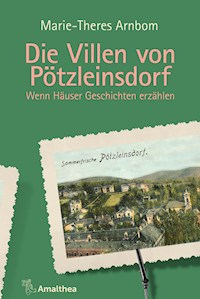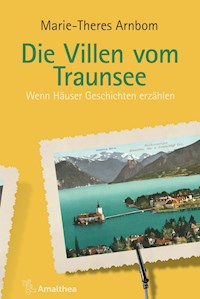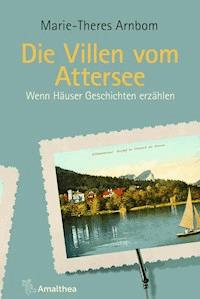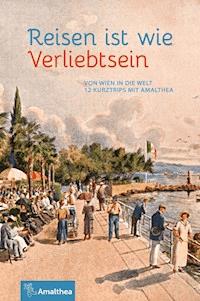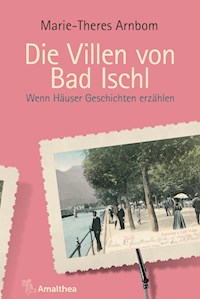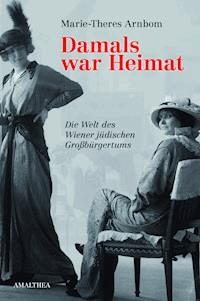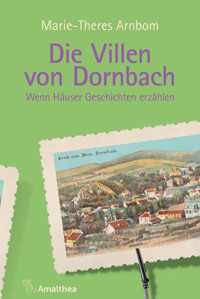
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dornbach und Neuwaldegg zählen zu den Sommerfrischen, die sich bereits im 18. Jahrhundert großer Beliebtheit erfreuten. Kein Wunder, dass sich schon früh renommierte Familien Sommervillen erbauen ließen. Und was für Villen! Beeindruckende Gebäude in enormen Parks. Auch wenn sich diese kaum erhalten haben, zeichnen die Geschichten über die Familien weiterhin ein vielfältiges und erstaunliches Bild dieser Viertel. Da gab es den Konditor Demel, den Zuckerwarenfabrikanten Manner und den Erfinder des europäischen Supermarkts Meinl. Dazu gesellten sich ein Fabrikant für Fotopapiere, Kaufleute, Ärzte und die Bankierfamilie Schoeller. Tabakmonopolisten der Zwischenkriegszeit verbrachten hier ebenso Zeit wie der große Schauspieler Alexander Moissi. Eine vielfältige, bunte und bis heute weitgehend unbekannte Gesellschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Marie-Theres Arnbom
Die Villenvon Dornbach
Wenn Häuser Geschichten erzählen
Mit 108 Abbildungen
Gefördert vom Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus
Bleiben wir verbunden!
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage amalthea.at und abonnieren Sie unsere monatliche Verlagspost unter amalthea.at/newsletter
Wenn Sie immer aktuell über unsere Autor:innen und Neuerscheinungen informiert bleiben wollen, folgen Sie uns auf Instagram oder Facebook unter @amaltheaverlag
Sie möchten uns Feedback zu unseren Büchern geben?
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an [email protected]
Informationen zur Sicherheit unserer Produkte finden Sie hier: amalthea.at/gpsr
© 2025 by Amalthea Signum Verlag GmbH, Wien
Am Heumarkt 19, A-1030 Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung und Satz: Elisabeth Pirker/OFFBEAT
Umschlagillustration: Ansichtskarte (Privat)
Lektorat: Martin Bruny
Herstellung: VerlagsService Dietmar Schmitz, Erding
Gesetzt aus der 11/14 pt Minion Pro Regular
Designed in Austria, printed in the EU
ISBN 978-3-99050-296-9
eISBN 978-3-903441-50-7
Inhalt
Dornbach und Neuwaldegg. Verschwundene Schönheit
Gebrauchsanweisung
Weg 1
1 Kronen-Zeitung und katholische Kunst.Familie Winternitz
Braungasse 43–45
2 »Der Nachlass besteht nur aus Rückstellungsansprüchen.«Familie Hirsch
Andergasse 12 (Pointengasse 9)
3 »Das Maß ist voll.«Bernhard Popper von Artberg und seine Familie
Heuberggasse 9
4 Konserven, Kunst und Theater.Georg Terramare
Heuberggasse 8–10
5 »Unwienerisch, unprovinziell«.Familie Meinl
Pointengasse 12–14
6 Die Villen der Familie Stern-Kriser
Pointengasse 28–36
7 Von Dornbach nach Vancouver.Familie Pollack von Parnau
Andergasse 38–40 (Pointengasse 25)
Weg 2
8 Öl, Branntwein und Theater.Die bunte Mischung der Familie Andorff
Promenadegasse 11–15
9 »Die Nazis haben gewonnen, und die Kuffners haben verloren.«
Promenadegasse 17–23
10 »Moissis Wesen vereinigt das Proletarische und das Königliche.«
Promenadegasse 31
11 Felsen aus Pappmaché.Die Welt der Familie Wachtl
Promenadegasse 49
12 Golf, Kunst und Wissenschaft.Familie Rapoport von Porada
Promenadegasse 57
Weg 3
13 Die Pressspanplatten der Familie Lourié
Zwerngasse 15–17
14 250 Obstbäume abgeholzt.Die Villa des Architekten Alexander Wielemans
Zwerngasse 16 (Alszeile 118)
Weg 4
15 Haben schon gewählt?Familie Demel
Neuwaldegger Straße 2
16 Hermine Kobližek und Camillo Castiglioni
Neuwaldegger Straße 2
17 Das Neuwaldegger Netzwerk der Familie Artaria
Neuwaldegger Straße 18
18 Millionär – Hunger – Selbstmord.Charilaos Stavro
Neuwaldegger Straße 38
19 Familie Wittgensteins Biedermeier-Fest in Neuwaldegg
Neuwaldegger Straße 38
20 Christoph Drecoll, der Modekönig
Neuwaldegger Straße 51
21 Die Berger-Madeln
Artariastraße 5
22 Ein Salon, eine Rosenkultur, China und französisches Flair.Der Lindenhof der Familien Gerold und Bunzl
Geroldgasse 7
Anmerkungen
Literatur und Quellen
Bildnachweis
Namenregister
Die Autorin
Dornbach und Neuwaldegg. Verschwundene Schönheit
Ein Besuch mit Folgen. Meine Freundin Katrin Vohland lädt mich in ihre neue Wohnung in Dornbach ein und zeigt mir auch den Garten, in dem eine alte Steintreppe bergauf in ein terrassenartig angelegtes Terrain führt. Ein Relikt aus vergangener Zeit. Auf diesem Spaziergang kommt mir der Gedanke, dass hier wohl früher ein anderes Haus gestanden ist – es handelt sich um die Villa Wachtl. Ich beginne noch am selben Abend mit der Recherche – der Startpunkt einer intensiven Forschung, die Unerwartetes und Erstaunliches zutage bringt. Grundstücke in der Größe von 20 000 oder auch »nur« 6000 Quadratmetern sind die Norm. Bei genauer Betrachtung kann man auch heute noch Restbestände in Gärten entdecken: Steinstiegen, Terrassen, Fundamente, kleine Pavillons. Doch das heutige Erscheinungsbild von Dornbach und Neuwaldegg entspricht kaum mehr der einstigen Großzügigkeit und Schönheit dieser frühen Biedermeier-Sommerfrische.
Man muss ziemlich tief graben, um dies alles zu finden. Vor allem ein Gebiet zwischen Pointengasse, Andergasse und Heuberggasse ist kaum mehr wiederzuerkennen. Dort stehen Gemeinde- und Genossenschaftsbauten aus den 1950er- und 1960er-Jahren, doch ursprünglich hatte dieser Teil Dornbachs einen völlig anderen Charakter. Dort befanden sich die Villen der Familien Hirsch, Stern, Pollack-Parnau und Eisler-Terramare. Die Grundstücke umfassten eine Villa, Nebengebäude und große Parkanlagen mit unzähligen Obstbäumen. Eine grüne Oase.
Was ist passiert? Das Jahr 1938 ändert auch in diesem Teil von Wien vieles radikal. Viele der Eigentümer müssen flüchten, sind von einem Tag auf den anderen vogelfrei und werden von Menschen, die jahrelang Nachbarn waren, geschnitten und ignoriert. Sie müssen mit Lauge die Straße waschen, werden verhaftet, manche ermordet.
Andergasse/Heuberggasse damals …
Die Besitzungen werden enteignet, niemand kümmert sich um die Pflege der Gebäude und der Parks, denn dies kostet viel Geld, allein schon für die Grundsteuer, aber auch für die Instandhaltung der Villen, Nebengebäude und Parks. Nach dem Krieg dauern die Rückstellungsverfahren oft bis 1953 – also acht weitere Jahre. Zu diesem Zeitpunkt sind die Häuser verfallen, Einkünfte können nicht lukriert werden. Wer hat nach dem Krieg, in den 1950er-Jahren, die finanziellen Möglichkeiten, diese großen Grundstücke aufzukaufen oder umwidmen zu lassen? Die Stadt Wien und Wohngenossenschaften. In den Akten und Gesprächen wird deutlich: Nach dem Krieg fallen da 250, dort 350 Bäume dem Bauboom zum Opfer. Und mit ihnen Villen, erbaut von Ringstraßenarchitekten wie Alexander Wielemans, der die Villa für seine eigene Familie baute, oder Franz von Neumann, der eine fast schon schlossartige Villa für Familie Kuffner schuf.
Und so verändern Dornbach und Neuwaldegg ihren Charakter. Aus der einst sehr frühen, bereits im 18. Jahrhundert beliebten Sommerfrische entwickelt sich über die Jahrzehnte mit seinen grausamen Kriegen ein neues Stück Wien, das keiner mehr kennt und doch unerwartet spannende Geschichten bietet.
… und heute
Einige Nachkommen kann ich aufspüren, sie alle schicken mir Dokumente, Bilder und Erinnerungen, um die Geschichten ihrer Familie zu erzählen, wiederzuentdecken, der Vergessenheit zu entreißen. Ein Film taucht auf, der eine Familienfeier in den 1930er-Jahren im Garten einer Villa festhält – und auch die Villa kommt ins Bild. Zwei kleine Mädchen springen herum, die Tochter eines der Mädchen lebt heute in Amerika und schickt mir diverse Informationen. Ein Geschenk, das ich mit großer Dankbarkeit annehme und weitergebe.
Mir fällt auf, dass viele der in Dornbach und Neuwaldegg ansässigen Familien ihre Geschäfte am Kohlmarkt betreiben, so Artaria, Demel und Drecoll. Gibt es da einen Zusammenhang? Dies führt noch weiter: Nach 1938 flüchten viele dieser Familien nach Vancouver und treffen dort wieder aufeinander – ein Zufall?
Dornbach und Neuwaldegg erweisen sich als eine Gegend, die viele bisher unbekannte interessante Geschichten bietet. Es zahlt sich aus, sich auf Spurensuche zu begeben.
Die Recherche der vergangenen Monate belebte viele langjährige Kontakte; so wird der wunderbare Fritz Kalmar in meiner Erinnerung wieder lebendig, er erzählte mir viel über Georg Terramare. Oder auch Hilde Randolph, die aus Hawaii regelmäßig nach Wien auf Besuch kam. Ihnen möchte ich danken, genauso wie vielen anderen, die mir geholfen haben, den Geist und die Atmosphäre des vergangenen Lebens ans Licht zu bringen. Dazu zählen Barbara Bacher, Nina Beattie, Christof Baiersdorf, Hedy Feierl und Naomi Goldstick-Rosner, Herbert Hild, Alois Husser, Harald Klien, Olivia Kraus, Georg Male, Gerald Piffl, Marina Socher und Nikolaus Hartig, Ruth Jolanda Weinberger, Hilde Umdasch und Laurie White.
Miguel Herz-Kestraneks Liebe zur Kaffeehausliteratur prägt mich seit Jahrzehnten – viele Texte interpretiert er großartig, einer davon ist Lenin und Demel, der im Demel-Kapitel zu finden ist. Aber auch seine Liebe zu Georg Terramares Weihnachtsgeschichte Uns ward ein Kind geboren begleitet mich schon sehr lange – da diese Geschichte in Dornbach spielt, kommt ihr ein besonderer Stellenwert zu.
Herzlichen Dank an Barbara Sauer, die für mich im Staatsarchiv noch einen letzten Akt durchgeschaut hat.
Trude Neuhold leitet das Bezirksmuseum Hernals mit Begeisterung und großem Wissen. Sie hat mir Einblicke in diverse historische Pläne gewährt und mir bereitwillig Fotomaterial zur Verfügung gestellt.
Mein Dank gilt auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Österreichischen Staatsarchivs, des Wiener Stadt- und Landesarchivs, der Österreichischen Nationalbibliothek mit der immer wieder inspirierenden Plattform ANNO und des Denkmalamts. Ich danke Thomas Meier vom Grundbuch im Bezirksgericht Hernals für seine umsichtige Betreuung.
Meine treuen Mitleserinnen korrigieren rastlos und stellen die richtigen Fragen. Danke Christiane Arnbom, Hanna Ecker, Monika Kiegler-Griensteidl und Elisabeth Kühnelt-Leddihn.
Blick Richtung Heuberg
Blick Richtung Schafberg
Und natürlich danke ich meinem Mann Georg Gaugusch, der mit seiner Forschung immer die Basis bildet, auf der ich aufbauen kann, der viele Aspekte mit mir diskutiert und durch dieses Buch selbst zu neuer Forschung angeregt wurde.
Der Amalthea Verlag bleibt ein treuer und zuverlässiger Partner – danke!
Marie-Theres Arnbom
St. Gilgen, August 2025
Gebrauchsanweisung
Viele Spaziergänge führten mich durch Dornbach und Neuwaldegg, ich entdeckte schöne, idyllische Ecken ebenso wie Teile, die heute völlig verbaut sind, wo jedoch Relikte wie imposante Eingangstore und massive Steinmauern verraten, dass hier einstmals andere Gebäude standen. Da braucht es Fantasie und Vorstellungsvermögen, um den einstigen Glanz zu erahnen – und es ist doch Teil der Wiener Stadtgeschichte. Ich lade Sie ein, genau zu schauen, Relikte zu finden und mit offenen Augen Neues zu entdecken.
Vier Wege bieten die Möglichkeit, sich dieses Buch zu ergehen und vor Ort Geschichte lebendig zu erleben.
Natürlich muss man nicht physisch anwesend sein, auch auf dem Sofa lassen sich die Schicksale der beschriebenen Menschen erlesen, denn die Lebenswege führen in die ganze Welt, nach Kanada, Amerika und Bolivien.
Das Buch möchte dazu anregen, in die Atmosphäre einzutauchen, die all diese Menschen prägten und ihnen viele unvergessliche Jahre beschert hat, in guten wie in schlechten Zeiten.
Braungasse 43
Weg 1
1Kronen-Zeitung und katholische Kunst.Familie Winternitz
Braungasse 43–45
»Gustav Winternitz, der Miteigentümer unseres Blattes und geschäftlicher Kopf, ist einem Herzleiden erlegen. Das Ende war für ihn eine Erlösung. Für ihn. Für uns bedeutete es Schmerz und bittere Wehmut, denn wir waren mit ihm durch tausend Fäden der Erinnerungen und durch tausend Bande gemeinsamen Schaffens verknüpft. Er gehörte zu jenen, die von allem Anbeginn da waren und bei der Maschine standen, als die erste Nummer unseres Blattes in die Welt hinausflog. Mit einer Leidenschaft, die an Besessenheit grenzte, stürzte er sich in die Arbeit. Winternitz war nicht nur eine blendende kommerzielle Begabung, sondern auch ein ausgezeichneter Charakter, aufrecht in der Gesinnung, streng in seinen Anschauungen, die Rechtschaffenheit in Person. Hinter der etwas schroffen Außenseite verbarg sich ein mildes und gütiges Herz.«1
Mit diesen Worten verabschieden sich die Mitarbeiter der Kronen-Zeitung vom Miteigentümer Gustav Winternitz am 18. November 1931. Und weisen auch darauf hin, dass er in der – noch heute bestehenden – Familiengruft am Dornbacher Friedhof beigesetzt wird.
Fünf Jahre davor erwerben Gustav und Clara Winternitz ihre Villa in der Braungasse 49 (heute 43). Ein halbes Jahr vor seinem Tod kann Gustav gemeinsam mit seinen Kindern Adolf und Gertrud das Nachbargrundstück, Nummer 51 (heute 45), dazukaufen und den Gesamtbesitz um mehrere dahinterliegende Gärten auf die Größe von 10 000 Quadratmeter erweitern.
Bereits im Jahr 1900 gründet Gustav Davis die Kronen-Zeitung, 1908 steigt Gustav Winternitz gemeinsam mit Leopold Lipschütz als Einzelprokurist in den »Buchdruckerei und Zeitungsverlag G. Davis & Co« ein – und bleibt. Vier Jahre später ist er bereits Vorsitzender des Vereins Österreichischer Zeitungsverleger, 1914 wird seine Prokura gelöscht, er fungiert nun als Gesellschafter. Er heiratet Clara Wurmser aus Mannheim, gemeinsam haben sie zwei Kinder, die 1902 geborene Gertrude und den 1906 geborenen Adolf, der sich später an seine Kindheit erinnert: »In der Geborgenheit unseres Hauses verlief unser Leben mit dem Rhythmus guter Musik, nicht mit dem eines Militärmarsches, aber mit einer Regelmäßigkeit, in der Pünktlichkeit und Heiterkeit zusammenflossen.«2
Der Vater, der selbst »keinen Zugang zur Kunst hatte«, führt Adolf und seine Schwester Trude jeden Sonntag ins Museum und ins Philharmonische;3 er ist ein Kind seiner Zeit, von ihm lernt Adolf »strenge Disziplin, die er uns auferlegte«.
Adolf und Trude wenden sich denn auch den Künsten zu: Trude studiert Klavier und hat 1917 mit 15 Jahren bereits ihren ersten öffentlichen Auftritt beim Schülerabend der Klavierpädagogin Flora Jeschek-Groß. Außerdem besucht sie das Realgymnasium in der Albertgasse. Ihr Bruder hat keinen großen Erfolg in der Schule: »Also verkündete mir eines Tages mein Vater in strengem und gleichzeitig zuversichtlichem Ton, dass er mich aus der Schule nehmen und von einem Privatlehrer zu Hause unterrichten lassen werde. Dieser Hausunterricht gefiel mir sehr und ich verwandelte mich prompt in einen guten Schüler.«4 Adolf malt und spielt Geige, mit 15 Jahren das Violinkonzert von Felix Mendelssohn Bartholdy. Im selben Jahr wird er auch Schüler an der Kunstakademie bei Karl Sterrer.
Trude heiratet 1922 Karl Norbert, Buffobass an der Staatsoper, wohin ihn deren Direktor Franz Schalk engagiert hat, »ein Wiener Opernsänger, nicht weil er hier engagiert war, sondern, weil er zum Haus gehört hat und mit dem Haus verwachsen war, was (neben dem Talent) viel Treue, viel gute menschliche Eigenschaften voraussetzt«.5 1920 gastiert Norbert erstmals in Wien und begeistert das Publikum als Falstaff in Die lustigen Weiber von Windsor. »Man hörte eine kräftige Baßstimme und stand einem echten Theatertemperament gegenüber, das sich in Buffoscherzen breit ausgelebt hat.«6 Ab 1922 tritt er vor allem in Mozart-Opern auch bei den Salzburger Festspielen auf.
Nobert Ernst, der Verwandlungskünstler, Die Bühne 29.1.1925
Über die Hochzeit in der Augustinerkirche berichten viele Zeitungen. Nicht nur die väterliche Kronen-Zeitung. »Die Kirche ist bis zum letzten Platz gefüllt, das Mitglied der Staatsoper, Kammersänger Thiemer, sang Hildachs ›Wo du hin gehst, dort will auch ich sein‹ mit ergreifendem Ausdruck. Das Mitglied der Staatsoper, Frau Anna Eder, entzückte die Hörer und ergriff sie mit dem Ave Maria von Gounod, das sie mit herrlichem Ausdruck und tiefer Empfindung sang.«7 So soll es sein, wenn ein Opernsänger heiratet.
Trudes Bruder Adolf muss diese Stimmung immer schon gefallen haben, denn er schleicht sich bereits als Kind in Kirchen und ist fasziniert von dieser mystischen Atmosphäre. »Wir werden sehen, wie mich diese frühen Gefühle und Erlebnisse letztendlich nach einem langen, verschlungenen Weg der spirituellen Suche zum katholischen Glauben führten und dazu, auch meine Kunst christlichen Themen zu widmen.«8 Mit 15 Jahren beginnt er, an der Kunstakademie bei Karl Sterrer zu studieren – ein neuer junger Lehrer, der Neuen Sachlichkeit zugewandt und für Adolf von großem Einfluss für sein weiteres Leben. »Der Einfluss auf die Religion kam von Sterrer«9, erinnert sich Adolf in den 1990er-Jahren. Dazu kommen fernöstliche Weisheiten und chinesische und japanische Holzschnitte. Sterrer gilt als Persönlichkeit, als Philosoph, als liebenswürdiger Mensch und als sehr religiös.10 Seine Art des freien Unterrichts, um einen eigenen Stil zu entwickeln, übernimmt Adolf ebenfalls – und wird in diesem Geiste selbst unterrichten.
Im August 1927 lernt Adolf in Bad Ischl die Pianistin Hannah Pollak kennen, beide wohnen im Kurhotel Elisabeth. In Wien inseriert sie im Dezember desselben Jahres: »Hannah Pollak, Absolventin der Staatsakademie, Wien 17. Bezirk, Pointengasse 7, erteilt Klavierunterricht und übernimmt Korrepetitionsstunden.«11 Ein Zufall? Die Pointengasse ist gerade einmal zehn Minuten von der neu erworbenen Villa der Familie Winternitz entfernt. Adolf reist 1929 nach Florenz, um sich künstlerische Inspiration zu holen – und er bleibt.
Die neunjährige Susi Mirjam, Die Bühne, 19.2.1925
Im selben Jahr kehrt Hannah nach Bad Ischl zurück und begleitet die Tänzerin Susi Mirjam bei einem Abend im Ischler Stadttheater – hinter diesem Künstlernamen verbirgt sich ihre jüngere Schwester, die bereits 1925 als Neunjährige am Ischler Theater debütiert hat. Ein Abend, »der der Bodenwieserschülerin starken Erfolg brachte. Rhythmisches Gefühl, Ausdrucksfähigkeit und Technik sind bei der kindlichen Künstlerin überraschend reich vertreten und lassen sie als neue Hoffnung der Wiener Schule erscheinen.«12 Bei dem Auftritt in Bad Ischl wird auch Hannah nicht vergessen: »Das Publikum zeichnete das junge Fräulein mit herzlichem Beifall aus und vergaß auch nicht, Hannah Pollak für die verständnisvolle, diskrete Begleitung am Flügel zu danken.«13
Ein Jahr später heiraten Hannah und Adolf, gemeinsam übersiedeln sie nach Italien. 1933 holt Hannah ihre Schwester Susi Mirjam nach Florenz und ermöglicht ihr einen viel beachteten Auftritt an der königlichen Accademia dei Fidenti: »Wie ein junger Frühlingswind schwebte Susi Mirjam über die Bretter«, schreibt Nazione laut Neuem Wiener Tagblatt am 19. Mai 1933. 1934 übersiedelt die Familie nach Rom – dort konvertiert Adolf zum Katholizismus, der sein Leben weiter dominieren wird.
Auch Susi bleibt bei der Familie, steht weiter auf Bühnen in Italien und Wien. Ab 1937 tritt Susi Mirjam unter dem Namen Susanne Maria Polla auf – man ist versucht zu sagen, dass sie ihrem Namen die jüdisch klingenden Teile nimmt – aus Mirjam wird Maria, aus Pollak Polla.14
Susi Mirjam, ca. 1935
Adolfs Schwester Trude verliert im Sommer 1936 in Salzburg ihren Mann Karl Norbert. Mit nur 43 Jahren erliegt er einem Herzleiden. Im Jahr davor wirkte er noch bei den Salzburger Festspielen in der legendären Faust-Produktion Max Reinhardts mit. »Karl Norbert war bei seinen Freunden und Kollegen hoch angesehen und wegen seines heiteren, offenen Wesens ungemein beliebt«, schreibt das Neue Wiener Journal am 8. August 1936 in einem sehr persönlichen Nachruf. Karl Norbert beschreibt seine Herangehensweise selbst: »Man muß sich mit dem erfolgten Umzug so stark in die Partie einleben, daß man alle privaten und persönlichen Dinge vollständig vergißt und gänzlich in seiner Partie aufgeht.«15
Adolf Winternitz, Selbstporträt, Österreichische Kunst 1936
Nach Ausstellungen in Florenz und Rom zeigt auch die Neue Galerie Wien Adolfs Werke, darunter ein Porträt seiner Frau. »Auf gelbem Holz ist es gemalt; die Farben sind zart, duftig, wie hingehaucht«, schreibt der Kunstkenner Artur Gerber in der Zeitschrift Österreichische Kunst. »Das Wichtigste, das an dieser Ausstellung den kritischen Kunstfreund interessiert, ist die Überzeugung, daß hier ein sehr begabter, junger Mensch einen geraden, ernsten, nach aufwärts führenden Weg eingeschlagen hat.«16 Artur Gerber hält 1936 anlässlich einer weiteren Winternitz-Ausstellung in der Casa d’Artisti in Mailand einen Vortrag über dessen Werke. Auch in der Neuen Galerie bleibt Adolf präsent in einer Ausstellung zum Thema Salzburg und das Salzkammergut vor 100 Jahren und heute.
Adolf Winternitz, Porträt seiner Frau Hannah, Österreichische Kunst 1934
1937 publiziert die Kunsthistorikerin und Schriftstellerin Else Hofmann einen langen Artikel über Adolf Winternitz: »Ein sanftes Licht scheint von den Bildern dieses knapp dreißigjährigen Künstlers zu strahlen, dem Ernst und religiöse Vertiefung so früh zu eigen geworden sind. Zwei große Schauräume und mehrere Vorräume der ausstellenden Galerie sind von Ölgemälden und Aquarellen, Pastellen und Kohlezeichnungen erfüllt, die fast durchgängig aus den letzten zwei Jahren stammen und den steten schöpferischen Fleiß, das stille, vertiefte Wachsen und Reifen des jungen Künstlers mit Deutlichkeit aufzeigen. Das große Thema ›Familie‹ ist es vor allem, das den Künstler beschäftigt. Die Einordnung des Menschen in den nächsten Kreis, die tiefe Bindung, die Vater, Mutter, Kinder zusammenschließt, erfüllt sein Empfinden aus eigenem früh und tief erlebten Schicksal. ›Ich male Kinder erst, seit ich selbst welche habe und sie erlebe‹, sagt der ernste junge Künstler. ›Ich habe das Gefühl, daß ich bis zur religiösen Gestaltung des Themas ›Familie‹ reifen werde und reifen muß. Ich will darauf warten und es dann formen …‹«17 Zwei Kinder haben Hannah und Adolf zu diesem Zeitpunkt, zwei weitere folgen.
Adolf Winternitz mit seiner Familie, Österreichische Kunst 1936
Am 12. Februar 1938 unterschreiben Adolf Hitler und Kurt von Schuschnigg das sogenannte Berchtesgadener Abkommen, mit dem Arthur Seyß-Inquart, der am vis-à-vis-Hang in Dornbach wohnt, zum Innenminister avanciert. An diesem Abend findet in Rom der Ball der Vereinigung der Österreicher statt: »Der akademische Maler Adolf Winternitz hatte die Säle in geschmackvoller Weise ausgeschmückt und einen festlichen Rahmen für die elegante Welt der Ewigen Stadt geschaffen.«18 Wie wohl die Stimmung auf dem Ball ist?
Adolf und seine Familie schützt der Katholizismus nicht. Ein Bekannter in Rom, Monsignore Celso Costantini, verhilft der Familie zur Flucht nach Peru und empfiehlt sie an den dortigen Nuntius Fernando Cento.
Doch was passiert in Wien mit den beiden Villen und dem großen Besitz? Die Eltern Clara und Gustav Winternitz sind 1929 und 1931 gestorben und müssen das Ende ihrer Welt nicht mehr miterleben. Der Dornbacher Besitz wird geteilt: Die Familienvilla, in der Trude wohnt, wird am 22. Juli 1938 an die Städtische Versicherung der Gemeinde Wien verkauft – vom Kauferlös sehen Trude und Adolf natürlich nichts, er liegt auf einem sogenannten Sperrkonto.
Laut eigener Angabe muss Adolf 99 000 Reichsmark Reichsfluchtsteuer und 100 000 Reichsmark Judenvermögensabgabe zahlen.19 »Adolf Winternitz war stiller Gesellschafter zu 1/16 Anteil G. Davis und Co (Verlag der Kronen-Zeitung). Dieser Anteil wurde am 20.3.1938 vertraglich an Hofrat Dr. Franz Geyer verkauft und zwar wurde als Kaufpreis jener Betrag vereinbart, der im Laufe der nächsten 10 Jahre als Reingewinn auf den 1/16 Anteil entfallen würde. Auf Adolf Winternitz entfielen RM 312 500. Diese Summe wurde abzüglich der Kosten für die im Auftrag der Vermögensverkehrsstelle vorgenommenen Schätzung und für die Kosten Dr. Mayrgündter in der Höhe von 291 125 auf ein Sperrkonto beim ehemaligen Bankhaus Fried und Thiemann erlegt.«20
1941 wird das gesamte Vermögen der Familie beschlagnahmt.21
Die zweite Villa (heute Nr. 45) ist immer vermietet, Trudes Hälfte wird 1938 mit hohen Steuerschulden aus der sogenannten Reichsfluchtsteuer belastet und später beschlagnahmt, Adolfs Teil zieht das Deutsche Reich ein.22 1944 wird ein Schätzungsgutachten von Trudes beschlagnahmter Hälfte erstellt:23 »Die oben erwähnten Katastralparzellen mit einem Ausmaß von 5945 m2 bilden ungefähr eine rechteckige Mittelparzelle. Die Parzellen sind als Garten mit altem Baum- und Obstbaumbestand angelegt. Auf der Parzelle 1178/3 wurde im Jahre 1887 ein Familienhaus angelegt. Im Jahre 1931 wurde im Souterrain eine Garage eingebaut. Im Garten rechts ist noch eine verfallene Kegelbahn sowie ein Holzschupfen errichtet. Die Ausstattung ist eine mittlere. Die Fenster haben innere und äußere Flügeln mit Holzverkleidung. Ein Zimmer ist als Bauernstube ausgestattet und besitzt Holzplafond, Fenster mit Putzenscheiben, Kachelofen und 1 Kamin mit Dauerbrandeinsatz. Die Türen sind ein- und zweiflügelig. Die Küchen haben verkachelte Herde und Wassermuscheln montiert. Gasrechaud und elektrisches Licht ist überall vorhanden. Schätzwert: RM 84.000, Hälfteanteil RM 35.000.«24
Trude lebt mit ihren Kindern in der Schweiz, Adolf mit seiner Familie in Peru. Dort eröffnen sich tatsächlich rasch neue Möglichkeiten. Schon Mitte August 1939 wird in den peruanischen Zeitungen von der geplanten Gründung einer katholischen Kunstakademie berichtet »mit dem Ziel, interessierte Laien sowie professionelle Künstler unter der Anleitung von Professor Adolfo Cristóbal Winternitz in dieses weitere und fruchtbare Gebiet künstlerischer Betätigung einzuführen«25. Bereits 1940 gründet Adolf die Academia de Arte Católico in Lima. Eine der Studentinnen dort ist Adolfs Schwägerin Susanne. Sie konvertiert ebenfalls zum Katholizismus und flüchtet mit der Familie ihrer Schwester nach Peru. Der Einfluss ihres Schwagers Adolf scheint stark zu sein, denn sie studiert an der neuen katholischen Kunsthochschule Bildhauerei und erweist sich als äußerst talentiert. In zahlreichen Ausstellungen sind ihre Werke zu sehen, auch nach dem Krieg in Europa, wohin sie gemeinsam mit ihrer Schwester 1950 zurückkehrt. Sie ändert einmal mehr ihren Namen und nennt sich nun Susana Polac, lebt in Spanien, gestaltet viele Kirchen, auch in Österreich – der Altar der Stadtpfarrkirche Gänserndorf zählt dazu.
Adolf und Hannah ziehen ihre Kinder bilingual auf – sie eliminieren die deutsche Sprache nicht aus ihrem Leben, sondern geben den Kindern beide Kulturen mit auf ihren Weg.
Nach dem Krieg ergeben sich für Adolf überraschend rasch wieder Ausstellungsmöglichkeiten in Europa – ein sehr blumiger, fast kitschiger Artikel in der Weltpresse vom 13. Juni 1951 verklärt Adolfs Schicksal: »War es nur eine Laune des Schicksals oder bestand ein innerer Zwang, der dem Maler den Weg nach Südamerika wies? … Die Landschaft rief den Künstler, und der Künstler, der diesen Ruf vernahm, wuchs und erstarkte in ihr. … Noch ehe der zweite Weltkrieg Europa zu verwüsten begann, befand sich Adolf Winternitz auf dem Wege nach Peru, wo seiner große Aufgaben harrten. Als Sendbote europäischer, österreichischer Kultur hatte er viel zu geben, er war aber auch Empfangender, weil sich in der unberührten Wildnis der Landschaft die Kunst des Träumers, des Lyrikers, ins Dramatische verwandelte.« Die Flucht als »Laune des Schicksals« zu bezeichnen, erscheint doch etwas kühn.
Trude und Adolf bemühen sich um die Rückstellung ihres Besitzes und bekommen die beiden Villen samt Grundbesitz bereits 1949 wieder zurück – vier Jahre erscheinen lang, doch für die überbürokratischen Vorgänge bei all diesen Fällen kann dies als vergleichsweise zügig gelten. Beide Villen werden verkauft und zeigen auch heute noch ihre gediegene Schönheit.
2»Der Nachlass besteht nur aus Rückstellungsansprüchen.«26Familie Hirsch
Andergasse 12 (Pointengasse 9)
Ein Kapitel, das in der Gegenwart beginnt. Mit einem Gespräch mit Olivia Kraus im Café Prückel Ende Juni 2025. Sie gibt mir Einblick in das Leben der Familie Hirsch.
Moritz Hirsch und Moritz Karpeles begründen 1864 ein Speditionsunternehmen, Moritz Hirsch verlässt dieses nach einigen Jahren. Mit seinem Anteil investiert er für seine Söhne Ernst und Fritz in ein anderes Geschäftsgebiet, dem die Familie treu bleibt: Bugholzmöbel. Sie kaufen die Firma D. G. Fischel Söhne im nordböhmischen Niemes – den dritten großen Player neben Thonet und Kohn. Sogar Ernst Hirschs Exlibris, gestaltet vom österreichischen Kupferstecher Alfred Cossmann, bildet sein Unternehmen ab: Ein Hobel und Holzspäne verweisen auf die Möbel, ein Segelschiff und ein übergroß dargestellter Merkurkopf symbolisieren die Reichweite des Handels mit Möbeln.27
Ernst heiratet Martha Lang, deren Vater 1915 stirbt – noch im selben Jahr beginnen sie, das Erbe in Dornbach zu investieren, zunächst mit dem Kauf eines Grundstücks in der Andergasse 12, das bis zur Pointengasse 7 reicht. Nach und nach kaufen sie die Nachbargrundstücke Pointengasse 9 und 11 dazu, ihr Besitz umfasst insgesamt 20 000 Quadratmeter.
Ernst Hirsch, um 1936
Martha Hirsch, Wien vor 1938
Wieso gerade Dornbach? Es muss bereits eine längere Verbindung zu dieser Sommerfrische geben, da Ernsts Schwester Ottilie bereits im Sommer 1867 in der Dornbacher Straße 21 geboren wird. Familie Hirsch wohnt im 1. Bezirk in der Reichsratsstraße – von dort ist Dornbach bequem zu erreichen, immer nur die Alser Straße geradeaus stadtauswärts.
Ernsts und Marthas Kinder Emma, Richard und die Zwillinge Gertrud und Elisabeth sind zu diesem Zeitpunkt zwischen 13 und 17 Jahre alt und verbringen ihre Sommer nun in der eigenen Dornbacher Villa mit großem Park. Die Ehepartner der Kinder verweisen auf das soziale Umfeld der Familie: Emma heiratet Herbert Zucker, dessen Familie im böhmischen Strakonitz Feze herstellt, Gertruds Mann Hans Jarno-Niese ist der Sohn von Josef Jarno, Direktor unter anderem des Theaters in der Josefstadt von 1899 bis 1923 und zugleich in den Sommermonaten des Theaters in Bad Ischl, und Hansi Niese, der beliebten und erfolgreichen Volksschauspielerin. Elisabeth heiratet Walter Schwadron – seine Familie produziert Fliesen, die noch heute in vielen Wiener Häusern das Stiegenhaus schmücken.
Der Bereich zwischen Andergasse und Pointengasse ist geprägt von vier großen Besitzungen mit Parks, durchbrochen von mehreren kleinen Villen und Häusern – in den Beschreibungen wird dieser Teil Dornbachs immer als Villenviertel bezeichnet. Heute sind der große Park und die Villa nicht mehr erhalten – wenige Beschreibungen müssen ausreichen, sich diesen großen Besitz vorzustellen.
1938 muss die Familie flüchten, zuerst in die Schweiz, wo Ernst Hirsch stirbt. Seine Frau und seine Töchter können nach Amerika gelangen, Martha erreicht New York am 17. November 1939 von Genua aus mit dem Passagierschiff »Saturnia«. Richard Hirsch stirbt unter ungeklärten Umständen bei einem Flugzeugunglück in Zürich.
»Die Liegenschaft Pointeng. 9–11 besteht aus einem Villenbau (Nr. 11) und einem ganz separierten Pförtnerhaus (Nr. 9), seinerzeit Gärtnerwohnung mit anschließendem Glashaus. Die beiden Häuser werden von einem parkartigen Garten umgeben, der auch einen Tennisplatz und ein Schwimmbecken besitzt. Die beiden letzteren sind infolge Verwahrlosung dem Verfall preisgegeben. Der sehr ausgedehnte Garten ist ebenfalls ungepflegt. Das Villengebäude wird von drei Mietern bewohnt, der Bauzustand weist einige Schäden auf, die durch die jahrelange Vernachlässigung als ernst bezeichnet werden müssen. … Die zwei großen Wohnungen bestehen aus 4 ½ Zimmern und sämtlichen Nebenräumen, die gartenseits im Parterre liegende Kleinwohnung besteht aus 2 Räumen. … Der vom Straßenniveau 2 Stock tief liegende Keller im Ausmaß des ganzen Villenbaues ist unbenutzt und wäre für eine Vermietung an eine Weinkellerei oder Champignonzucht geeignet. Sämtliche Räume sind mieterschutzfrei. Im Haus Nr. 9 (Dienstwohnung) befindet sich auch eine Garage, die vom Hausbesorger, der Taxiunternehmer ist, gemietet ist (S 50,–) monatlich. Der ganze Besitz macht einen sehr verlotterten Eindruck.«28 So lautet die Beschreibung des Besitzes im Jahr 1951.
Gertrud Jarno-Niese muss wie auch alle anderen ihr Vermögen anmelden. Jedes Schmuckstück wird aufgelistet, auf einer ganzen Seite, zu der es ein Bewertungsgutachten vom 15. Mai 1938 gibt – die Erfassung des Vermögens geht rasch voran. Die Gesamtsumme beträgt 5864 Reichsmark. Dazu kommen 13 Kilo Silbergebrauchsgegenstände und ein Flügel der Firma Wirth.29
Um den großen Besitz in Dornbach gibt es unter den verschiedenen Nazi-Organisationen viele Begehrlichkeiten. 1942 zieht die Gestapo den Besitz ein, es dauert aber bis zum Jahr 1944, bis Tatsachen geschaffen werden und die Reichsfinanzverwaltung ins Grundbuch eingetragen wird. Villa, Nebengebäude und den Park zu erhalten, ohne dementsprechende finanzielle Mittel, erweist sich als unmöglich. Die Villa wird in drei Wohneinheiten unterteilt und vermietet, doch reichen die Einnahmen kaum für die Grundsteuer. Auch das Glashaus und das Pförtnerhaus werden vermietet, eine Gärtnerei bewirtschaftet einen Teil des Parks und Gartens. Doch das sind nur Tropfen auf den heißen Stein – der Besitz verfällt.
Martha stirbt am 7. August 1948 in Lake Placid. In ihrem Verlassenschaftsakt steht: »Der Nachlass besteht nur aus Rückstellungsansprüchen.«30 Zu diesem Zeitpunkt liegen die Ansprüche in Händen von Rechtsanwälten, die noch weitere vier Jahre um die Rückgabe der heruntergekommenen Villa und des abgeholzten Parks kämpfen müssen.
Doch in ihrer Verlassenschaft zeigt sich auch, dass die Familie in Amerika zusammenhält: Marthas Schwiegersohn Herbert Zucker, der in Wien in der Bugholzfabrik mitarbeitet, kauft die Hale Company, eine Möbelproduktion in Vermont, in die die Familie investiert. Herbert und Emma Zucker ändern ihren Namen in Zucker-Hale und zeigen so die Verbundenheit mit ihrem neuen Unternehmen. Tochter Hanni heiratet bald nach ihrer Ankunft in New York einen Buchhändler, der ebenfalls aus Wien stammt: Hans Peter Kraus wird in Amerika zu einem der bedeutendsten und größten Buchantiquare.31 Kraus will hoch hinaus: Er erwirbt den Besitz Sugar Hill in Ridgefield, Connecticut, ein fast schlossartiges Anwesen, das zum Treffpunkt der weitverzweigten Familie wird. Meine Gesprächspartnerin Olivia Kraus verbringt dort viele Sommer und erzählt, dass das Haus wie eine Zeitkapsel im Stil der 1960er-Jahre belassen wird. Cocktails werden gereicht, es gibt einen Innen- und Außenpool und am Esstisch neben jedem Gedeck einen Kristallaschenbecher. Ein bisschen denkt man dabei an den großzügigen Besitz in Dornbach.