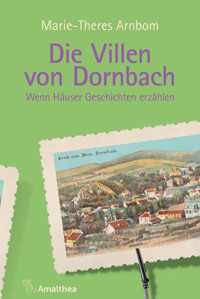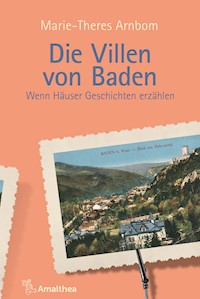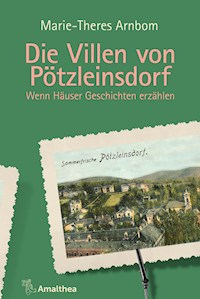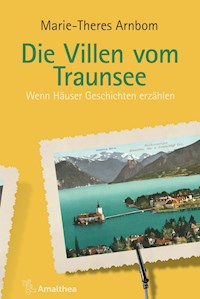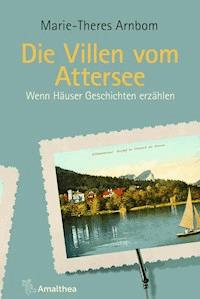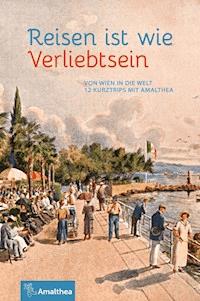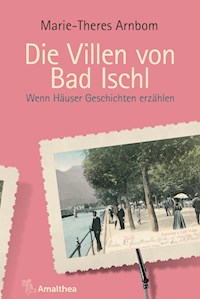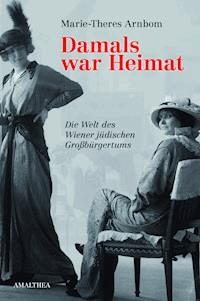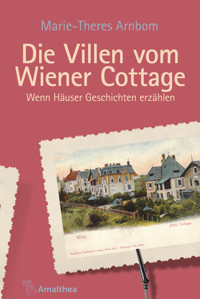
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Villen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Rundgang durchs Cottage Ein Villenviertel mit Grünflächen bietet dem Wiener Bürgertum ab 1872 ein attraktives neues Wohngebiet – das Währinger und Döblinger Cottage nach einer Idee des Architekten Heinrich von Ferstel. Bald siedeln sich aufstrebende Familien aus Kunst, Kultur und Wissenschaft hier an. Der Musikwissenschaftler Guido Adler, die intellektuellen Schwestern Elise und Helene Richter, die Bildhauerin Hanna Gärtner, die Ärztinnen Melanie Adler und Marianne Stein leben hier ebenso wie Felix Saltens Kinder. Später folgen Persönlichkeiten aus Industrie und Wirtschaft wie der Tabakimporteur Kiazim Emin Bey oder der Handelsvertreter und Radrennfahrer Alfred Montor. Wer ist der Schöpfer des Schlagers »Sag beim Abschied leise Servus«? Was hat das »Rote Wien« mit dem Cottage gemeinsam? Und wie legt sich der Schatten des Nationalsozialismus auch über das idyllische Cottageviertel? Dieser einzigartigen Welt von gestern widmet sich Marie-Theres Arnbom in ihrem neuen Buch, das so manch vergessener Familie ihre Geschichte zurückgibt. Mit zahlreichen Abbildungen und Karte
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marie-Theres Arnbom
_____________________________
Die Villen vom Wiener Cottage
Marie-Theres Arnbom
Die Villen vom Wiener Cottage
Wenn Häuser Geschichten erzählen
Mit 134 Abbildungen
Gefördert vom Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus
Bleiben wir verbunden!
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage amalthea.at
und abonnieren Sie unsere monatliche Verlagspost unter
amalthea.at/newsletter
Wenn Sie immer aktuell über unsere Autor:innen und Neuerscheinungen informiert bleiben wollen, folgen Sie uns auf Instagram oder Facebook unter
@amaltheaverlag
Sie möchten uns Feedback zu unseren Büchern geben?
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an [email protected]
© 2024 by Amalthea Signum Verlag GmbH, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEAT
Umschlagabbildungen: Postkarte: Sternwartestraße um 1890
© Bezirksmuseum Währing; Fotohalter: © iStock.com
Lektorat: Martin Bruny
Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz, Erding
Gesetzt aus der 11/13,96 pt Minion Pro und der Myriad Pro
Designed in Austria, printed in the EU
ISBN 978-3-99050-254-9
eISBN 978-3-903441-25-5
Inhalt
Was ist das Cottage?
Gebrauchsanweisung
Weg 1
1 Fanatismus des Wahrheitssuchers. Guido Adler Lannerstraße 9
2 Elise Richter: »Eine gescheite Frau ist mir lieber als ein dummer Mann« Weimarer Straße 83
3 Von Erbsen und Pferden. Familie Tonelles Lannerstraße 22
4 Géza Kobler, »der Hakim aus dem Abendlande« Lannerstraße 30
5 Warum lügst Du, Chérie? Lannerstraße 32
6 Unser Freund Tom Anninger Lannerstraße 36
7 Das Schwimmbecken unserer Kindheit Blaasstraße 12
8 Marianne Stein. Ärztin aus Herz und Seele Blaasstraße 4
9 Der Fez in Strakonitz. Familie Fürth Hasenauerstraße 32
10 Ein Erfinder. Eine Schriftstellerin. Eine Bildhauerin. Familie Gärtner Gustav-Tschermak-Gasse 26
11 »Grete Weinberger. Bildnis meines Vaters« Gregor-Mendel-Straße 36
12 Solo-Zündhölzer im Cottage Gregor-Mendel-Straße 36
Weg 2
13 Die arme Gretl Sonnenthal ist ins Wasser gegangen Anton-Frank-Gasse 20
14 Der Tabakkönig Kiazim Emin Bey Weimarer Straße 49
15 Ein magischer Silberschein, wie im Hause eines Gnomenkönigs Weimarer Straße 59
16 Ephraim Herdan-Bey. Zwischen Jassy, Kairo und dem Cottage Hasenauerstraße 17
17 »Bob und Baby«. Die Geschichte von Paul und Anna Salten Cottagegasse 37
18 Eine verschwundene Villa. Familie Schwarz Gustav-Tschermak-Gasse 11
19 Diamanten, Autos und Radfahren. Ein Clan zwischen Singapur und Wien Hasenauerstraße 51
20 Der große Architekt Friedrich Schön Türkenschanzstraße 44
21 Hubert Gessner Sternwartestraße 70
22 Zucker und Musik. Familie Strakosch Sternwartestraße 56
Anmerkungen
Literatur und Quellen
Bildnachweis
Namenregister
Die Autorin
Eine der vielen Cottage-Villen. Der Architekt, 1895
Was ist das Cottage?
Ein Buch über das Cottage zu schreiben, klingt eigentlich überflüssig. Denn viele Menschen haben sich mit diesem so speziellen Viertel Wiens bereits beschäftigt. Gerade feierte der Cottage-Verein 150. Bestandsjubiläum, alte Postkarten schmückten das Gitter des Türkenschanzparks und führten in die Vergangenheit. Ein umfangreicher Jubiläumsband ist erschienen, mehrere Bücher porträtieren bekannte Bewohner. Wir wissen: Arthur Schnitzler lebte im Cottage ebenso wie Erich Wolfgang Korngold, die Schauspielerdynastien Thimig und Sonnenthal, Schauspieler wie Josef Kainz, die Industriellenfamilie Gutmann, der Komponist Emmerich Kálmán.
Doch im Cottage entstehen mehrere Hundert Villen – kleiner und größer, bombastisch und bescheiden. Ich habe mich also auf die Spuren von Familien begeben, die in Vergessenheit geraten sind und die ich nun kennenlernen durfte. Die Recherchen haben sich ausgezahlt. Und einen völlig neuen Blick auf das Cottage mit sich gebracht.
Die Fläche, auf der das Cottage entstand, war eine brachliegende Sandgrube. Wer baut dort ein Haus, umgeben von Sand und bei Regen von Lehm, außerhalb des Linienwalls, ohne öffentliche Verkehrsanbindung?
Idealisten, von manchen auch als Spinner bezeichnet. Exzentrische Künstler, über die so mancher Kutscher den Kopf schüttelt. Menschen, denen die Idee des Cottages gefällt, die im Grünen wohnen wollen. Mit den Jahren und der zunehmenden Anzahl an Villen, mit einem Bus, der die Anbindung in die Stadt vereinfacht, ändern sich auch die Bewohner des Cottages. Industrielle siedeln sich ebenso an wie die Intelligenzia, Ärzte lassen sich hier nieder.
Viele der Töchter zählen zu der ersten Generation der Studentinnen, sie erkämpfen ihr Recht auf akademische Bildung und gehen verschiedene berufliche Wege. Elise Richter, die erste Privatdozentin Österreichs, lebt ebenso hier wie Hanna Gärtner, die erste Bildhauerin, die einen Auftrag für den öffentlichen Raum erhält.
Das soziale Engagement vieler Cottage-Bewohner und -Bewohnerinnen überrascht in seiner Dichte. Der Einsatz für die Volksfürsorge, die Volksbildung, den sozialen Wohnbau des Roten Wien zeigt sich in vielen Aspekten: Bücher und Beratungen, Vorträge zu unterschiedlichen Themen legen Zeugnis ab für den großen sozialen, aber auch politischen Einsatz, oftmals für die Anliegen der Sozialdemokratie.
Das Cottage also als Wiege der Sozialdemokratie? Auf den ersten Blick erstaunlich, doch stammen die Begründer der Bewegung oftmals aus dem sozial denkenden Großbürgertum, dem es ein wahres Anliegen ist, die Lebensbedingungen der Arbeiter und Arbeiterinnen zu verbessern.
Erstaunliche Persönlichkeiten bevölkern nun dieses Buch, sie alle haben Spuren hinterlassen, denen es nachzugehen gilt. Die meisten waren mir unbekannt, manche verehre ich seit Studienzeiten, wie Guido Adler, den Begründer des Instituts für Musikwissenschaft. Manche gehören in unterschiedlicher Art zu meiner eigenen Familiengeschichte, wie die Familien Strakosch, Sonnenthal, Friedmann und Gessner.
Viele Menschen lernte ich kennen und tauchte mit ihnen in mir zum Teil völlig unbekannte Welten ein: die Welt des Tabaks, der Abnehmkuren, der Musikwissenschaft, der Fürsorge, der Architektur, der Zündholzproduktion, der Bildhauerei, der Pferderennen und der Operettenschlager. Die Spuren führten mich nach Ägypten wie auch nach Singapur und Thessaloniki – eine bunte Gesellschaft.
Das Jahr 1938 ändert alles radikal. Enteignung, Vertreibung, Ermordung verschonen das Cottage nicht. Viele der Menschen, die hier leben, gelten für die Nationalsozialisten als jüdisch, und einmal mehr zeigt sich, dass Religion keine Rolle spielt, sondern allein der »rassische« Aspekt gilt. Viele der Familien sind lange schon getauft, die Familien haben ihre Familiengräber auf dem Döblinger Friedhof, wie auch heute noch zu sehen ist. Die Villen im Cottage sind begehrt, viele werden an Privatpersonen »verkauft«, manche vom Deutschen Reich beschlagnahmt und weiterverkauft. Vielen der vor allem älteren Bewohner gelingt die Flucht nicht mehr, sie kommen in den Vernichtungslagern um.
Das Cottage leidet besonders unter Bombardements, viele Villen werden beschädigt oder zerstört. Nach dem Krieg versuchen die Familien, die 1938 flüchten mussten, ihren Besitz zurückzubekommen – ein schwieriges und meist langwieriges Unterfangen. In den 1950er-Jahren stehen viele der Villen wieder zum Verkauf, oft in sehr schlechtem Zustand.
Ohne Archive wäre die Forschung unmöglich. Die Mitarbeiter des Wiener Stadt- und Landesarchivs haben unermüdlich zahlreiche Aktenbestände zusammengetragen. Ich danke auch den Mitarbeitern des Österreichischen Staatsarchivs, die immer meine vielen Bestellungen bearbeitet und vorbereitet haben. Das Leo Baeck Institute in New York digitalisiert bereitwillig die umfangreichen Bestände und stellt sie zur Verfügung – eine große Hilfe und Unterstützung. Die Public Library of Performing Arts in New York hat mir ein unbekanntes Manuskript von Hans Lengsfelder in wenigen Tagen digitalisiert und geschickt.
Die unersetzbare Plattform ANNO der Österreichischen Nationalbibliothek hat wieder unbezahlbare Dienste geleistet – die digitalisierten Tageszeitungen bringen Details zutage, die man gar nicht sucht.
Ulrike Polnitzky vom Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek hat mich in der heißen Phase der Bilderfindung rasch und unbürokratisch unterstützt.
Auch im Familienbesitz erhalten sich manche Erinnerungen, Briefe und Fotografien, Familiengeschichten werden niedergeschrieben, in denen der Geist und die Atmosphäre zu spüren sind. Ich danke Tom Anninger für seine langjährige Freundschaft und das Buch, in dem er sich so ausführlich mit seiner Familie beschäftigt. Ich durfte Marietta Pritchard kennenlernen, deren Buch viele Details der Familie Fürth beinhaltet. Eva Newbrun teilte mit mir per E-Mail und telefonisch ihre Erinnerungen an eine wunderschöne Villa, die schon lange nicht mehr existiert. William Hall gab mir Einblick in die Familienalben der Familie Freund. Giuliana Schnitzler erzählte mir Geschichten, die ich nur aus anderer Perspektive kannte, und ließ mich Bilder und Artefakte ihrer Familie kennenlernen.
Ein Familienhaus-Modell namens »Heimchen am Herde«. Was das wohl bedeuten mag? Wochenschrift des Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereines, 1887
Viele Gespräche und Hinweise haben neue Aspekte mit sich gebracht. Ich danke Miguel Herz-Kestranek, Julia Krenslehner, Markus Kristan, Christiane Mühlegger, Sylvie Reidlinger, Solveigh Rumpf-Dorner, Ursula Storch und Christopher Wentworth-Stanley für Informationen, Fotos und Übersetzungshilfen von Französisch bis Türkisch. Verdient gemacht um die Erfassung der Cottagevillen hat sich Heidi Brunnbauer.
Mein bewährtes Mitleser-Team hat einmal mehr Durchhaltekraft bewiesen: mein Mann Georg Gaugusch, ohne dessen Recherchen vieles viel schwieriger gewesen wäre, meine Mutter Christiane Arnbom, die sehr genau alle Unklarheiten und Fehler findet; meine Schwester Elisabeth Kühnelt-Leddihn, meine Freundinnen Silke Ebster, Hanna Ecker und Monika Kiegler-Griensteidl, die gelesen, diskutiert, angeregt haben.
Der Amalthea Verlag hat mich einmal mehr unterstützt – danke!
Das Leben der in diesem Buch geschilderten Menschen bewirkte viel und muss gewürdigt werden – das grauenhafte Ende darf die Verdienste niemals übertünchen. Die Erinnerung bleibt.
Gebrauchsanweisung
Ich bin mir dieses Buch ergangen und habe neue Ecken, alte Häuser und interessante Details entdeckt. Für all die Kenner des Cottages und auch die vielen Neuentdecker habe ich zwei Wege zusammengestellt, die gemächlichen Schrittes eine gemütliche Runde ermöglichen und Geschichten aus den Villen zum Leben erwecken – ein Weg führt durch Währing, der andere durch Döbling.
So viele Geschichten hätte ich noch gerne geschrieben, doch jedes Buch hat nun einmal ein Limit. Leider. Immer, wenn ich durch das Cottage fahre, möchte ich noch viel mehr entdecken und erforschen – dieses Buch bietet wirklich nur einen Bruchteil der Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden.
Natürlich muss man nicht physisch anwesend sein, auch auf dem Sofa lassen sich die Schicksale der beschriebenen Menschen erlesen, denn die Lebenswege führen in die ganze Welt, nach Amerika, Singapur und Kairo.
Das Buch möchte dazu anregen, in die Atmosphäre einzutauchen, die all diese Menschen prägte und ihnen viele unvergessliche Jahre beschert hat, in guten wie in schlechten Zeiten. Aber es möchte auch neugierig machen, sich für die eigene Umgebung, die eigene Villa zu interessieren. Wer waren die Menschen, die dieses Viertel geformt haben, die eine außergewöhnliche Atmosphäre geschaffen haben? Jedes Buch steht am Anfang der Forschung – viele Geschichte schlummern noch und wollen entdeckt werden!
Weg 1
1 Fanatismus des Wahrheitssuchers. Guido AdlerLannerstraße 9
Drei unscheinbare braune dtv-Taschenbücher begleiteten mich durch mein Studium: das dreibändige Handbuch der Musikgeschichte, herausgegeben von Guido Adler, 1924 erstmals erschienen. Kleine Schrift, wenig Ränder, Notenbeispiele und unglaublich dichte, interessante und spannende Information zur Musikgeschichte der verschiedenen Epochen. In vielen Kapiteln finde ich beim Durchblättern meine eigenen Unterstreichungen, mit Bleistift und Lineal. Von Guido Adler selbst stammt das Kapitel über die Wiener klassische Schule, aus jedem Satz leuchten seine Begeisterung und sein fundiertes Wissen.
Guido Adler begleitet mich also schon viele Jahrzehnte. Und nun folge ich ihm in seine Villa im Cottage. Doch noch ist es nicht so weit, Guido Adler muss sich erst etablieren. Seine Liebe gilt der Musik, eigentlich der Musikgeschichte. Er studiert am Konservatorium und Jus an der Universität Wien – und aus dieser Kombination entsteht 1898 das von ihm begründete Institut für Musikwissenschaft. »Das musikhistorische Institut in Wien heißt: Guido Adler«, schreibt seine ehemalige Studentin, die Journalistin Elsa Bienenfeld. »Mit diesem Namen ist seine Gründung, sein Aufblühen verknüpft und weit darüber hinaus die Bedeutung, die es gewonnen hat. Guido Adler begann damit, die Geschichte der Musik nach den Methoden einer exakten Wissenschaft auszubauen. Er brachte System in die musikalische Forschung. Die Musik hat, als einzige unter den Künsten, die Eigenschaft abzusterben, wenn sie nicht von lebendigen Menschen gepflegt wird.« Und dann folgt ein bezeichnender Satz, der als Motto seines ganzen Schaffens gelten kann: »Er setzte den Fanatismus des Wahrheitssuchers dafür ein.«1
Als glühender Verehrer Richard Wagners ist Adler federführend 1873 an der Gründung des Wiener Akademischen Wagner-Vereins beteiligt und begegnet dem verehrten Meister auch in Bayreuth. Mit Gustav Mahler verbindet Adler eine innige Freundschaft – er lebt in der Welt der Komponisten im Wissen, dass sein Talent dafür nicht ausreicht und er der Musik eben auf andere Weise dienen will und kann.
1887 heiratet er Betti Berger, deren Großvater Simon und Vater Heinrich zu den einflussreichsten Persönlichkeiten des Wiener orthodoxen Judentums zählen.2 Sie etablieren in Wien ein erfolgreiches Indigo- und Farbwarengeschäft, das es Heinrich ermöglicht, die Parzelle Gonzagagasse 5/Salztorgasse 3 an der Wiener Ringstraße zu erwerben und ein Zinshaus errichten zu lassen. Er stirbt 1899 und hinterlässt seiner Tochter Betti genügend Vermögen, um im Jahr 1900 das Grundstück Lannerstraße 9/Ecke Vegagasse 13 zu kaufen. Guido und Betti lassen sich von den Stadtbaumeistern Viktor Fiala und Oskar Laske eine Villa erbauen mit genügend Platz für die Kinder Melanie und Hubert Joachim – und die stets wachsende Bibliothek.
Villa Adler in der Lannerstraße 9
Guido Adler zu seinem 70. Geburtstag. Der Tag, 1. November 1925
Guidos Kollege Carl Engel beschreibt die Atmosphäre: »Das große Fenster von Adlers Arbeitszimmer blickte auf seinen Garten mit seinen schattenspendenden Bäumen, in denen die Vögel fleißig sangen. Die Wände des Raumes waren mit Bücherregalen bedeckt, die bis zur Decke reichten. Sein Schreibtisch stand in der Nähe des Fensters; der mit Büchern und Noten bedeckte Flügel stand in einer Ecke; eine Etagere mit Farnen und Blumentöpfen trug den Garten ins Zimmer; und zu guter Letzt war da noch das Sofa für seine Siesta, an der er ebenso konsequent festhielt wie an seiner Nachmittagsjause – Kaffee und Kuchen –, unverzichtbar für jeden echten Wiener.«3
Die Beschäftigung mit Musik entwickelt sich zur Wissenschaft – eine völlig neue Herangehensweise, die Studenten und Studentinnen anzieht, wie Elsa Bienenfeld erzählt: »Während früher die Vorlesungen kaum beachtet waren, nahm die Frequenz unter Adler einen rapiden Aufschwung, und vor Ausbruch des Krieges gab es mehr als hundert im Semester inskribierte Studenten und Studentinnen. Die größte Zahl der an österreichischen und deutschen Bühnen wirkenden Kapellmeister hat musikwissenschaftliche Bildung genossen. Es gehört nicht zu den geringsten Verdiensten Adlers, diesen Stand intellektuell bedeutend gehoben zu haben.«4
1905 erhält Guido Adler von seinem Freund Gustav Mahler ein ganz besonderes Geschenk: die Originalpartitur des Liedes Ich bin der Welt abhanden gekommen mit einer ganz besonderen Widmung: »Meinem Freund Guido Adler (der mir nie abhanden kommen möge) als ein Andenken an seinen 50. Geburtstag.«
Doch wie kann man sich diesen Wissenschafter, der auf allen Fotos vollbärtig ernst in die Kamera blickt, vorstellen? Sein Kollege Carl Engel, Leiter der Musikabteilung der Library of Congress in Washington, beschreibt ihn: »Er ging mit elastischem Schritt und führte lebhafte Gespräche in seinem flotten Wiener Vokabular. Wenn ihm danach war, hielt er Menschen jeden Alters und jeder Herkunft auf der Straße an und redete mit ihnen über alles, was ihm passierte.«5
Die Kinder Hubert Joachim und Melanie treten in die Fußstapfen ihres Großvaters Joachim Adler und studieren beide Medizin – ein Karriereschritt, der ihrem Vater verwehrt wurde, musste doch seine Mutter ihrem Mann am Totenbett versprechen, dass keines ihrer Kinder Medizin studiere.6 Für die Enkelkinder gilt dieses Versprechen aber nicht mehr. Hubert Joachim eröffnet eine Ordination in dem ihm und seiner Schwester gehörenden Haus in der Gonzagagasse 5. Melanie studiert in Wien und Innsbruck und promoviert 1936, übt ihren Beruf jedoch nie aus.
Tom Adler, Hubert Joachims Sohn, erinnert sich an Erzählungen über seine Tante: »Ihre eigene Familie, möglicherweise mit Ausnahme ihres Vaters, sah Meli als einen seltsamen Vogel an. Nach ihrem Abschluss ließ sie sich nirgendwo nieder, arbeitete nie, hatte nur wenige oder keine Freunde in Wien und lebte getrennt von der Familie an einem unbekannten Ort – bis sie 1938 zu Guido zog. Sie ›ging weg‹ nach München, Graz oder einem der vielen Kurorte auf dem Land, und niemand in der Familie wusste, warum. Möglicherweise suchte sie nach einem Heilmittel für eines ihrer mysteriösen und möglicherweise eingebildeten Leiden.«7 Für ihre Familie bleiben Meli und ihr Lebensstil ein Rätsel. »Auf keinem der Familienfotos lächelt sie, ihre Kleider waren schlicht, sie verwendete kein Makeup. Ihr Lebensstil sorgte für Gerüchte in der Familie, Betti meinte über ihre Tochter: ›Sie tat Dinge, über die man nicht sprach.‹«8 Für Spekulationen bleibt auch innerhalb der Familie reichlich Platz.
1927 endet Guido Adlers Zeit als Vorstand des von ihm gegründeten und entwickelten Instituts für Musikwissenschaft. Man sollte meinen, dass seine Meinung bei der Nachbesetzung seiner eigenen Stelle eine gewichtige Rolle spielt – doch die immer stärker spürbaren politischen Gegensätze weisen in eine völlig andere Richtung, sogar die Zeitungen schreiben darüber. Favorit der Universität ist Professor Robert Lach, der im schärfsten Gegensatz zu Guido Adler steht. »Die Angelegenheit hat nämlich eine Wendung genommen, aus der hervorgeht, daß bei der Besetzung der Lehrkanzel bei Guido Adler keineswegs sachliche, sondern in erster Reihe politische Momente extremster Natur maßgebend gewesen sind«, berichtet das Neue Wiener Journal am 30. September 1927. »Der Kandidat der Universität ist nämlich niemand anderer als Professor Doktor Robert Lach, über dessen unkünstlerische Einstellung in Fragen der modernen Musik keine Zweifel vorherrschen können. Hat sich doch Lach nicht gescheut, das Künstlertum eines Gustav Mahler in einer kritisch kaum ernst zu nehmenden Weise herabzusetzen, ebenso spielt er sich als Gegner von Richard Strauss auf, ohne jedoch auch nur einen Gedanken auszusprechen, der ein tieferes Verständnis für Strauß und seine künstlerische Mission verraten würde.«
Drei Jahre zuvor hat sich Guido Adler dafür eingesetzt, Richard Strauss das Ehrendoktorat der Universität Wien zu verleihen, doch opponierte Robert Lach dagegen und »versuchte der Fakultät glaubhaft zu machen, daß Richard Strauss ein nicht ernst zu nehmender Blender und ein ›musikalischer Faiseur‹ sei. Seinen Haupttrumpf spielte er jedoch damit aus, daß er folgendes zu bedenken gab: Richard Strauss hat seine Hauptwerke gemeinsam mit Hugo von Hofmannsthal, der Jude ist, geschrieben, und es wäre gegen den Geist der Fakultät, einem derartigen Künstler den Hut des Ehrendoktors aufzusetzen.«9
Robert Lach wird zu Guido Adlers Nachfolger berufen.
Dieser zieht sich in seine Bibliothek, seine Villa zurück und widmet sich umso intensiver der Forschung und der Kontaktpflege mit Absolventen und Absolventinnen. 1933 stirbt seine Frau Betti, Tochter Melanie kümmert sich zunehmend um den Vater und zieht 1938 wieder ganz in die Lannerstraße. In Zeiten von Angst rücken Vater und Tochter eng zusammen.
Hubert Joachim gelingt mit seiner Frau Marianne und den beiden Kindern die Flucht. Am 22. August 1938 erreichen sie mit der siebenjährigen Evelyn und Tom, gerade vier Monate alt, New York.
Und was wird aus Guido? »Der alte Adler ist des Fliegens müde geworden.«10 Dieser Satz, gerichtet an seinen Freund und Schüler Mosco Carner, sagt alles aus. Der 82-jährige Wissenschafter möchte seine vertraute Umgebung, seine Bibliothek, seine Villa, sein Zuhause nicht verlassen. Und Melanie bleibt bei ihm. Sie bewohnen die Villa nicht mehr allein, zwei Mieter sind eingezogen. Knapp vor der Nazi-Machtübernahme kommt Mosco Carner zu Besuch: »Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich die Ehre, den großen Gelehrten in seinem Haus in Döbling, einer wunderschönen Gartenstadt im Nordwesten Wiens, zu besuchen. Hier lebt Adler im Alter von zweiundachtzig Jahren, fast vollständig von der Welt zurückgezogen. Ich hatte ihn seit vielen Jahren nicht mehr gesehen, und als einer seiner ehemaligen Schüler, und da ich die Jahre, die ich unter ihm verbrachte, zu meinen schönsten Erinnerungen zähle, war ich besonders glücklich, ihn besuchen zu dürfen. Er empfing mich mit der Freundlichkeit und dem großen Interesse, die uns als Studenten begeisterten. Ich betrat sein Haus mit Gefühlen der Ehrfurcht und des Respekts und verließ es mit der Hochstimmung, die man nach einem langen Gespräch mit einem alten und weisen Freund verspürt. Das war charakteristisch für den Lehrer Adler. Er behandelte uns nie mit der kalten, distanzierten Art des ›Herrn Professors‹, sondern machte sich beliebt, indem er uns als gleichberechtigt oder in manchen Fällen als Freunde betrachtete. Das Alter konnte seine kraftvolle Persönlichkeit nicht verändern. Auch in seinem äußeren Erscheinungsbild ist er weitgehend derselbe geblieben wie in früheren Jahren. ›Herr Hofrat‹, wie wir ihn nannten, ist von kleiner Statur. Sein kräftiger Körper, der immer noch voller Lebensenergie ist, könnte einen über das wahre Alter des Mannes täuschen. Ein riesiger eisengrauer Bart umrahmt sein Gesicht, und seine hellen, klaren Augen, die durch schmale, altmodische Brillengläser glänzen, zeugen von einem überraschend wachen Geist. Unser Gespräch hat gezeigt, dass dieser Geist mit aktuellen Ereignissen bestens vertraut ist. Während meines kurzen Besuchs haben wir die unterschiedlichsten Themen angesprochen. Im Vordergrund stand natürlich die Musik.«11
Guido Adler 1927 im letzten Jahr als Vorstand des Instituts für Musikwissenschaft
Im Zuge des Novemberpogroms erscheint die Gestapo mit Alfred Orel, um Guido Adlers Bibliothek zu enteignen und ihm seinen Lebensinhalt zu rauben. Adlers Sekretär Carl Rosenthal muss dies mitansehen: »Am 10. November, ein Tag, den ich nie vergessen werde, übergab ich die Bibliothek einem alten Parteimitglied und ehemaligen Schüler Adlers, Alfred Orel, während Adlers Haus nach jüdischen Bewohnern durchsucht wurde. Adler wurde aus Altersgründen verschont, und da ich neben einem Mann stand, der das Emblem eines ehemaligen Untergrundmitglieds der NSDAP trug, schaute mich zu meinem Glück niemand an …«12 Rosenthal gelingt die Flucht: »Ich verließ Wien im März 1940, und ich glaube nicht, dass mein angesehenster Lehrer jemals bemerkt hat, dass ich ihn für immer verlassen habe – zumindest körperlich –, denn in meinem Kopf stelle ich mir ihn immer noch vor, wie er am Schreibtisch sitzt, seine Zigarre raucht und tief in Gedanken versunken ist. Er hält seine Feder in der Hand, hört sich meine Berichte an und teilt mir seine Entscheidungen mit.«13
Immerhin gelingt es, dass Guido und Melanie weiter in der Villa wohnen können, obwohl die Begehrlichkeiten groß sind. Am 15. Februar 1941 stirbt Guido Adler, was Melanie ihrem Bruder mitteilt: »Lieber Joachim, nun ist Vater seit dem 15. Februar tot. Ich will Dir noch einige Worte über die letzten Wochen schreiben. Ganz allmählich schlich sich der Tod ein – gute und schlechte Tage wechselten miteinander ab. Einmal eine kleine Grippe, dann Ruhepause. Dann ein kleiner Schlaganfall mit Lähmungserscheinungen in den Füßen. In 24 h war fast alles behoben. Manchmal große Unruhe in der Nacht, Herumirren im Finstern; oft 3 Mal im Tag mußte ich die Wäsche wechseln, so naß war Vater. Dann wurde er bettlägrig, wollte nichts mehr zu sich nehmen. Mehrere Tage vor Vaters Tod verfiel ich in tiefe Bewußtlosigkeit und erwachte erst, als er längst auf dem Urnenfriedhof am Zentralfriedhof ruhte. Vaters Wunsch, neben Mutter beerdigt zu werden, konnte nicht entsprochen werden. Ich werde aber, sobald es möglich ist, die Urne bei Mutter beisetzen. Vater starb hochangesehen und seine Leistungen wurden von allen Seiten anerkannt.«14
Nach dem Tod des Vaters versucht Melanie, die Bibliothek zu retten und zu verkaufen – sie verhandelt mit München auf Vermittlung Rudolf von Fickers, einem Schüler Guido Adlers. Sie wendet sich sogar an Winifred Wagner mit der Bitte um Vermittlung – und einen Schutzbrief für sie selbst. Alles umsonst. Viele Institutionen wollen diese Bibliothek, die ins Institut für Musikwissenschaft gebracht und von dort aufgeteilt wird – inklusive verschlossener Kisten, die bei der Finanzprokuratur gelagert werden.15
Melanie bezahlt den Versuch, die Bibliothek und damit das Lebenswerk ihres Vaters zu retten, mit ihrem Leben. Am 20. Mai 1942 wird sie nach Maly Trostinec deportiert, wo sie sechs Tage später ermordet wird.
Was passiert mit der Villa? Hubert Joachims und Melanies Anteile werden zugunsten des Deutschen Reichs einverleibt, doch aufgrund der langsam mahlenden Mühlen der Nazi-Bürokratie wird Guido Adlers Hälfteanteil an der Villa nie enteignet.16 Nach dem Krieg stellt Hubert Joachim einen Rückstellungsantrag, dem auch stattgegeben wird. Doch muss die Verlassenschaft erst abgehandelt werden, und es fällt Erbschaftssteuer an. Hubert Joachim wendet sich »An das Bundesministerium für Finanzen. Am 16. Jänner 1948 hat das Bundesministerium für Vermögenssicherung einen Empfehlungsbrief des Herrn Bundeskanzlers an Sie weitergeleitet. Es handelt sich um die Erbschaftserklärung nach meinem Vater, Hofrat Prof. Dr. Guido Adler, dessen Haupterbin und Tochter Melanie Adler verschleppt und für tot erklärt wurde. Diese Erbschaft hat in mir ihren einzigen Erben, da ich der einzig Überlebende der Familie bin. Mein Rechtsvertreter Dr. Hans Wiala hat mich verständigt, daß eine Erbschaftssteuer von 20696 S zu bezahlen ist; das Geld ist nicht vorhanden und ich kann es auch in Dollar nicht aufbringen. Da die Finanzlandesdirektion sich weigert, die Rückstellung des Realbesitzes durchzuführen, ist ein Circulus vitiosus hergestellt, den ich durchzubrechen bitte. Dr. Hubert Joachim Adler.«17
1951 wird die Villa im Grundbuch wieder für Hubert Joachim Adler eingetragen, im selben Jahr verkauft er sie. Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Er kämpft um die Rückstellung der Bibliothek und des Nachlasses und kann dies gegen viele Widerstände auch durchsetzen. Heute befindet sich der Nachlass Guido Adlers im Besitz der University of Georgia.
Im Jahr 2000 kontaktiert die Historikerin Brigitte Hamann Hubert Joachims Sohn Tom Adler für ihr Buch über Winifred Wagner mit der Frage um deren Verbindung zu Melanie Adler. Ein Stein gerät ins Rollen. Tom kann zwar nicht helfen, reist aber nach Wien. Und hier macht ihn der Direktor der Sammlung alter Musikinstrumente des Kunsthistorischen Museums, Günter Brosche, darauf aufmerksam, dass die Originalpartitur zu Gustav Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen gerade zur Versteigerung bei Sotheby’s angeboten wird.18 Wer ist der Einbringer? Der Sohn des Rechtsanwalts Richard Heiserer, der Melanie Adler 1941 bei der Abwicklung der Erbschaft ihres Vaters für kurze Zeit vertritt. Aussage steht gegen Aussage: Heiserers Sohn schreibt, dass sein Vater das Manuskript als Kompensation für seine Rechtsberatung erhalten hat.19 Am Ende steht wie so oft ein Vergleich: Heiserer erhält eine Verwahrgebühr, das Manuskript wird 2004 versteigert.
2 Elise Richter: »Eine gescheite Frau ist mir lieber als ein dummer Mann«Weimarer Straße 83
29. Oktober 1907. »Im Hörsaale 35 der Wiener Universität nahm die erste Privatdozentin Österreichs, Fräulein Dr. Elise Richter, ihre regelmäßigen Vorlesungen auf. Fräulein Doktor Richter, die über ein sehr verständliches Organ verfügt, war in schwarzer Kleidung erschienen und ging ohneweiteres auf ihr Vorlesungsthema über. In dem zahlreichen Auditorium sah man auch viele Damen.«20
Ein bedeutender Tag. Denn zum allerersten Mal hält an der Wiener Universität eine Frau eine Vorlesung. Was für ein Moment für die Frauenbewegung! Doch dieser Aspekt interessiert Elise Richter nicht. »Ich betrat die Universität nicht als Frauenrechtlerin«21, meint sie später.
»So ganz glatt ging es übrigens mit dieser ersten Vorlesung nicht«, erinnert sich Elise Richter. »Um Zeitungslärm zu verhüten und wohlgemeinte Teilnahme, die leicht Veranlassung zu Gegendemonstrationen geben konnte, wurden Tag und Stunde des Kollegs erst am letzten Abend angeschlagen, und so gelang es, dem ›Novum‹ das häßlich Sensationelle zu nehmen und die ›weibliche‹ Antrittsvorlesung auf den Maßstab einer ›männlichen‹, wenn auch einer besonders gut besuchten, zu bringen. Ein paar Spötter hatten sich eingefunden; aber das Lachen verging ihnen. In der Angst, man könnte von mir eine seichte Plauderei erwarten oder zur Befriedigung gemeiner Neugier zu mir kommen, hatte ich ein ganz abstraktes Thema gewählt und mutete den Hörern Schwereres zu als jemals später.«22
Auch die folgende Vorlesung soll gestört werden: »Ich mußte meine Hörer mittels Postkarte benachrichtigen, daß die nächste Vorlesung um eine Stunde früher, im anstoßenden Hörsaal stattfinden müsse, und schritt nach beendeter Vorlesung, natürlich unerkannt, mitten durch die sich in größerer Zahl sammelnden Demonstranten. ›Was gibt’s denn hier?‹, fragte ein zufällig des Wegs Spazierender. ›Komm nur mit‹, hörte ich den anderen sagen, ›das wird eine große Hetz.‹«23
Elise Richter, ein erstaunlicherweise schüchterner Mensch, will einfach ihre Forschungserkenntnisse präsentieren unter dem Titel »Zur Geschichte der Indeklinabilien«. Was soll das bedeuten? Die Geschichte des Nichtbeugsamen?24 Und so geht es wohl auch den Studenten, die 1907 gegen Elise protestieren. Klerikale und studentenverbindungsoffene Kreise stehen an erster Stelle der Demonstrationen. Kurzfristig und geheim muss die Vorlesung in einen anderen Hörsaal verlegt werden, um die Demonstranten zu täuschen – das also ist der Anfang des neuen weiblichen Lehrpersonals.
Am 8. April 1933 würdigt Gisela Urban die zukunftsweisende und unbeirrbare Elise Richter anlässlich der Feier ihres 50. Semesters: »Am 29. Oktober 1907 hatte sich in einem Hörsaal der Wiener Universität eine schöne und distinguierte Frau eingefunden, nicht um als Hörerin einer Vorlesung beizuwohnen, sondern um als erste Österreicherin ihre erste Vorlesung im Bereich unserer altehrwürdigen Alma mater zu halten. Doktor Elise Richter stand wohl am Ziele ihrer Wünsche; sie hatte ferner die Genugtuung, durch die Energie und Beharrlichkeit, die sie bei ihrer Bewerbung um eine Dozentur ins Treffen führte, ihrem Geschlecht den akademischen Lehrberuf erschlossen zu haben.«25
Doch müssen wir einige Jahrzehnte zurückgehen. Denn Elise ist zum Zeitpunkt ihrer Antrittsvorlesung bereits 40 Jahre alt. Die Jugendjahre hat sie gemeinsam mit ihrer Schwester Helene ausschließlich dem Lernen gewidmet. Eine preußische Lehrerin unterrichtet (oder besser gesagt trainiert) die Schwestern intensiv, hart und unbarmherzig – und schafft zwei Wissenschafterinnen ersten Ranges und der ersten Stunde: Elise, die Romanistin und Dozentin. Helene, die Anglizistin und Theaterkritikerin.
Welches Erziehungskonzept steckt da dahinter? »Wir sahen nur Pflichterfüllung ohne viel Worte, Liebe ohne Süßlichkeit, Ehrlichkeit, Sauberheit – innerlich und äußerlich.«26 So analysiert Elise ihre Kindheit. Ihre Mutter Emmy Lackenbacher, deren Vater Bernhard als Großhändler in Budapest tätig ist, verfolgt gemeinsam mit dem Vater Maximilian ein puritanisches Konzept: totale Abhärtung, jeden Tag frische Luft, strikter Unterricht, kein Müßiggang. »Unsere Erziehung wurde mit größter Sorgfalt und zwar nach damals wie auch heute nicht gewöhnlichen Grundsätzen geleitet.«27 Und doch beeindruckt mich dieser Satz am meisten: »Sie hatte die Begabung, das Dasein so einzurichten, daß das Nichtzusollende gar nicht vorhanden war.«28
Elise Richter: »Ich hatte den einzigen Wunsch zu studieren.«
Der Alltag wirkt etwas hypertroph: »Sterbe- und Geburtstage großer Männer, Erinnerungstage großer Ereignisse begingen wir, so wie wir sie lernten, durch Aufhängen eines schön geschriebenen Gedenkblattes an der Speisezimmerlampe.«29
Die Strenge mischt sich mit Liberalität: Die Kinder werden täglich kalt gewaschen und müssen eine Stunde ausgehen, daher »glaubten Tanten und Großmütter an unseren sicheren Tod. Als der Vater uns – etwa siebzehn- und zwanzigjährig – gestattete, zu zweit ›allein‹, d. h. ohne ältere Begleitung, und wäre es die Köchin, über die Straße zu gehen, schüttelte die ganze Nachbarschaft die Köpfe. Als er um dieselbe Zeit einführte, daß wir jeden Sonntag mit ihm zum schwarzen Kaffee eine Zigarette rauchten, wurde über den Sonderling das Kreuz gemacht.«30 Nach dem Ende des Privatunterrichts bleiben die Schwestern sich selbst überlassen. Doch sie wollen weiterlernen – die Reaktion des Vaters verwundert: »Der Wunsch nach einem Lehrbuch wurde grundsätzlich als ›unmädchenhaft‹ und ›verrückt‹ nicht erfüllt. ›Ja, wenn du ein Bub wärst!‹ Wir haßten unser Geschlecht.«31 Wozu dann die ambitionierte Erziehung? Die Mädchen bleiben Mädchen.
Wer ist dieser Vater? Maximilian Richter ist Chefarzt der Südbahngesellschaft – und entwickelt als Pionier deren Sanitätswesen, das in ganz Europa übernommen wird. Davon profitiert die Familie: »Ein wichtiges Moment war auch, dass wir in den eigentlichen Reisejahren, vor dem Weltkrieg, über die Mittel verfügten, so bequem als möglich zu reisen. Als Eisenbahnkinder in diesem Punkte sehr verwöhnt – selbstverständlich reserviertes ganzes Abteil erster Klasse, aber gelegentlich auch Salonwagen –, machte später meine Krankheit bequemes Reisen zur Voraussetzung irgendeines Vergnügens.«32
Elise beginnt, die Männerdomäne der Universität Wien zu erobern. Bewundernswert: Sie geht ihren Weg, ohne nach links und rechts zu blicken, sie lässt sich nicht beirren. Mit 32 Jahren gelingt es ihr endlich, die Matura ablegen zu dürfen – und dann findet sie den Weg an die Universität. Sie promoviert, sie habilitiert sich. Und sie ist permanent krank, hat Schmerzen, muss ein enges Mieder tragen, kann keine Stiegen steigen, muss liegen – »Ich habe mein ganzes Leben gegen meinen Körper gekämpft.«33 Nichts davon bringt sie von ihrem Weg ab.
Eine erstaunliche Argumentation, ja Motivation verrät Elise: »Als ich heranwuchs, konnte es mir nicht entgehen, dass ich sehr häßlich war.«34 Ein harter Satz. Und sie trifft eine Entscheidung: »Die große Frage im Leben einer Frau: Heiraten oder nicht? hatte ich in sehr frühen Jahren mir selbst mit ›Nicht‹ beantwortet.«35 Diesen Weg geht sie konsequent: »Die Lust am Studium überwog alles andere. Die eigene Leistung sollte entscheiden. Ich wollte nur sachliche Beurteilung. Nichts hat mich mehr angewidert als die Rederei, besonders von Seiten der Frauen: ›Sie wollen Matura machen? Mit den Professoren ein bißchen kokettieren? Die Dozentur? Einen hübschen Hut kaufen und zum Minister gehen; alles erledigt.‹ – Solche Reden haben der Frauenbewegung ernstlichen Schaden zugefügt.«36 »Eine gescheite Frau ist mir lieber als ein dummer Mann.«37
Elise Richter, »der erste weibliche Privatdozent«. Wiener Bilder, 18. September 1907
Die ältere Schwester Helene erscheint ganz konträr: »Ihr eignete alles, was mir fehlte: Sie war hübsch, frühzeitig groß, begabt, gescheit, schlagfertig, glänzte im Gespräch, hatte Geschmack und Geschick für Kleidung, sie schreibt Novellen und Märchen – sie besaß eine Freundin.«38 Diese Wahrnehmung teilen auch andere Weggefährtinnen – Elise, die Schüchterne, und Helene, die Charmante.
Helene macht sich als Anglizistin einen Namen, sie verfasst bedeutende, ja bahnbrechende Biografien über William Blake, George Eliot und Lord Byron, aber auch über die englische Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft.
Elise ist eine Pionierin, die aber gar nicht für Frauenrechte kämpft. Sondern für sich. Für ihre Forschungen. Für ihre wissenschaftliche Leidenschaft. Und auch zugibt, dass sie nie darüber nachgedacht hat, wer eigentlich für ihre Rechte gekämpft hat, und sich daher auch nicht als Vorkämpferin der Frauenrechte sieht. Ihr Fokus liegt bei ihrer Forschung – und sonst nirgends.
Was sie damit auslöst und in Bewegung setzt, interessiert Elise nicht.
In einer Umfrage zum Thema »Wie ich zur Frauenbewegung kam« antwortet Elise sehr ehrlich: »Strenggenommen bin ich nie zu ihr gekommen und sie nicht zu mir. Ich bin, einem inneren Drang folgend, meines Weges gegangen, und es hat sich herausgestellt, daß er durch das Gebiet der Frauenbewegung führte.
Ich hatte den einzigen Wunsch zu studieren, kam aber nie auf den Gedanken, mir das Recht zum Studium theoretisch zu erfechten. Ich studierte eben für mich. Als mir 1896 aus blauem Himmel der Ministerialerlaß in den Schoß fiel, der zur Ablegung einer staatsgültigen Matura berechtigte, dachte ich – zu meiner Schande will ich es berichten! – nicht einen Augenblick darüber nach, wem, wessen Arbeit ich das wohl zu danken hätte. Ich machte es mir nur gleich zunutze. Und ganz ebenso war es dreiviertel Jahre später, 1897, als mir – mitten in der Matura – der Ministerialerlaß zukam, wonach ich berechtigt war, mich gleich als ordentliche Hörerin an der Universität einzuschreiben. Wiederum fragte ich nicht, wie und wer mir den Weg bereitet haben mochte. Ich machte nur Gebrauch davon und – genoß.«39
Man ist versucht, diese Einstellung als egoistisch zu interpretieren – das stimmt vielleicht auch zu einem gewissen Teil. Doch gesellen sich soziales Wirken und Engagement dazu: »Professor Dr. Richter hat den Verband der akademischen Frauen Österreichs gegründet und ihn dem Weltbund der akademischen Frauen angegliedert.«40 Dieser Umstand gewinnt in späteren Jahren noch an Bedeutung. Elise und Helene engagieren sich außerdem auch für Volksbildung und halten zahlreiche, thematisch ihren Forschungsgebieten entsprechende Vorträge – ein wichtiger Beitrag für die Verbreiterung des Bildungsangebots.
Helene Richters 70. Geburtstag. Die Österreicherin, 1931
Aber kommen wir endlich ins Cottage. 1895 erwerben die Schwestern aus ihrem Erbe – die Eltern sterben 1889 und 1890 – ein Grundstück im Währinger Cottage in der heutigen Weimarer Straße 83, beraten von Wilhelm Gutmann, einem engen Freund und Verwandten ihres verstorbenen Vaters. »Wir erstanden dort einen Acker mit wunderschöner Rundsicht bis auf die Berge.«41 Gutmann vermittelt den renommierten und erfolgreichen Architekten Max Fleischer für den Bau einer bequemen Villa, an deren Planung sich Elise sehr aktiv beteiligt. Dies soll ein Heim für immer werden. »Kurz entschlossen bauten wir unser eignes Heim, von wo aus es kein Ausziehen mehr gebe als auf den Friedhof«, schreibt Elise.42 In erstaunlich ironischer Weise verweist sie auf die Anreise: »Die beschwerliche Stellwagenfahrt rückte das Cottage der Stadt nicht näher, sondern eher in märchenhafte Ferne.«43
Bei der Planung spielen auch ökonomische Aspekte eine Rolle, obwohl die Schwestern noch keine finanziellen Probleme haben. »Es wurde beschlossen, einen Stock zum Vermieten aufzusetzen. Ich konnte ja keine Treppen steigen. Im Mai 1896 zogen wir ein. Da stand der große Kasten an der noch unbenannten und keineswegs gangbaren Straße in einem wüsten Fleck Erde, der sich ›Garten‹ nannte, nicht gerade erhebend. Aber im Innern war alles zweckmäßig und viel schöner, als wir es je gekannt hatten. Wir gingen von der Petroleumlampe unmittelbar zur elektrischen Beleuchtung über, die damals noch gar nicht allgemein eingeführt war. Die Eingangs- und Treppenbeleuchtung erregte das Staunen aller Kinder, die nur zu dem Zwecke uns besuchen wollten, um dieses Wunder zu sehen.«44
Zeichnung der Villa Richter
Von ihren ausführlichen Reisen bringen die Schwestern vor allem Pflanzen aus ganz Europa ins Cottage: Im Wintergarten vor Helenes Studierzimmer befinden sich vier Palmen aus Cannes und eine Opuntie aus Korfu. Im Garten kann die größte Glyzinie Wiens von einem Markt in Rom45 bewundert werden, eine Blautanne wird zum Wahrzeichen des Hauses. Eine neue Erfahrung für die Schwestern, die nun plötzlich lernen, »einen Ahorn von einer Eiche zu unterscheiden«46.
Der Garten gewinnt immer mehr an psychologischer Bedeutung, denn »der Garten, den man selbst anlegt, die als ein- oder zweijährige Pflanzen gesetzten Bäume, die man heranwachsen sieht, verknüpfen einen mit dem Fleck Erde. Was das Wort ›bodenständig‹ bedeutet, habe ich erst hier gelernt.«47 Eine Erkenntnis, die