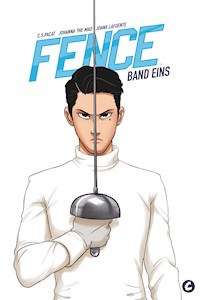12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dark Rise
- Sprache: Deutsch
"Der strahlende Stern hält stand, selbst während sich die Dunkelheit erhebt."
Die alte Magie ist in Vergessenheit geraten. Lediglich der Orden der Stewards hält seinen Schwur, die Menschheit vor der Rückkehr des Dunklen Königs zu schützen - die unmittelbar bevorsteht. All dies erfährt Will von den Kämpfern des Lichts, als sie ihn vor den Mördern seiner Mutter retten. Und seine Welt wird noch mehr auf den Kopf gestellt, als die Stewards ihm offenbaren, dass er der Auserwählte im Kampf gegen die Dunklen Mächte sein soll. Während Will versucht, sich in kürzester Zeit auf diese Rolle vorzubereiten, trifft er auf James St. Clair, den General des Dunklen Königs - und somit Wills Gegenspieler. Doch von Anfang an spürt Will, dass ihre Schicksale durch ein unsichtbares Band miteinander verbunden sind und dass ihr Aufeinandertreffen immer vorherbestimmt war ...
"Eine fesselnde Fantasy-Geschichte, die dem Hype um sie mehr als gerecht wird." POPSUGAR
Erster Band der DARK-RISE-Trilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 735
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Danksagung
Autor:innenvita
Die Romane von C. S. Pacat bei LYX
Impressum
C. S. PACAT
Dark Rise
Roman
Ins Deutsche übertragen von Anika Klüver
ZU DIESEM BUCH
Die magischen Schlachten zwischen dem Licht und der Dunkelheit sind längst in Vergessenheit geraten. Lediglich der Orden der Stewards bewahrt diese Erinnerungen und hält sich an seinen Schwur, die Menschheit vor dem Dunklen König zu schützen – dessen Rückkehr kurz bevorsteht. All dies wird Will Kempen offenbart, als er vor den Männern flieht, die seine Mutter getötet haben. Um ihn vor seinen Verfolgern zu schützen, wird er von den Stewards in eine Welt voll alter Magie entführt, wo er erfährt, dass er laut einer Prophezeiung der Auserwählte des Lichts im Kampf gegen die Dunklen Mächte sein soll. Während er versucht, all den Erwartungen gerecht zu werden und sich auf die Herausforderungen vorzubereiten, die mit dieser unverhofften Rolle einhergehen, schließt Will Freundschaften und knüpft Verbindungen, die ihn für immer verändern werden. Unter anderem begegnet er James St. Clair, dem wiedergeborenen General des Dunklen Königs und somit Wills Gegenstück. Von Anfang an spürt er, dass ihre Schicksale durch ein unsichtbares Band miteinander verbunden sind, dass ihr Aufeinandertreffen immer vorherbestimmt war. Doch was tatsächlich passieren wird, wenn sich jahrhundertealte Prophezeiungen erfüllen, kann niemand vorhersehen …
Für Mandy
Ich frage mich, ob wir beide eine Schwester brauchten.
PROLOG
London, 1821
Weck ihn auf«, sagte James. Der mürrisch dreinblickende Seemann hob umgehend den hölzernen Eimer, den er in den Händen hielt, und kippte dessen Inhalt ins Gesicht des Mannes, der zusammengesackt und gefesselt vor ihnen hockte.
Wasser klatschte auf Marcus und riss ihn aus seiner Bewusstlosigkeit. Er hustete und keuchte.
Selbst klitschnass, angekettet und verprügelt strahlte Marcus eine aristokratische Haltung aus. Er wirkte wie ein edler Ritter auf einem verblichenen Wandteppich. Die Arroganz der Stewards, dachte James. Sie klebte an ihm wie der Gestank des Flusses, obwohl Marcus so gründlich gefesselt war, dass er sich kaum bewegen konnte, und sich im Bauch von Simon Creens Frachter befand.
Hier unten wirkte der Laderaum des Schiffs mit seinen hölzernen Wänden wie das Innere eines Wals. Die Decke war niedrig. Es gab keine Fenster. Die einzige Lichtquelle stellten die beiden Lampen dar, die die Seeleute aufgehängt hatten, als sie Marcus vor vielleicht einer Stunde hereingeschleppt hatten. Draußen war es noch dunkel, auch wenn Marcus das nicht wissen konnte.
Marcus blinzelte mit nassen Wimpern. Seine dunklen Haarsträhnen hingen ihm tropfend in die Augen. Er trug die zerrissenen Überreste der Tracht seines Ordens. Der silberne Stern war mit Schmutz und Blut beschmiert.
James beobachtete, wie Entsetzen in Marcus’ Augen aufstieg, als er erkannte, dass er noch am Leben war.
Er wusste es. Marcus wusste, was mit ihm geschehen würde.
»Also hatte Simon Creen in Bezug auf die Stewards recht«, sagte James.
»Töte mich.« Marcus’ Kehle war rau, und seine Stimme klang heiser, so als würde James’ bloßer Anblick bedeuten, dass er nun vollauf begriff, was vor sich ging. »Töte mich. James. Bitte. Wenn du je etwas für mich empfunden hast.«
James schickte den Seemann neben sich weg und wartete, bis der Mann den Laderaum verlassen hatte und er abgesehen vom Plätschern des Wassers und dem Knarren des Holzes keine Geräusche mehr vernahm. Nun waren er und Marcus ganz allein.
Marcus’ Hände waren hinter seinem Rücken gefesselt. Er kauerte seltsam unbeholfen da, nicht in der Lage, sein Gleichgewicht zu finden, denn die dicken Ketten, mit denen er an den vier schweren eisernen Halterungen des Schiffs fixiert war, ließen ihm keinerlei Spielraum. James ließ den Blick über die massiven, unbeweglichen Eisenglieder wandern.
»All diese Schwüre. Du hast nie wirklich gelebt. Wünschst du dir nicht, dass du mal bei einer Frau gelegen hättest? Oder bei einem Mann?«
»Bei einem Mann wie dir?«
»An diesen Gerüchten ist nichts Wahres dran«, sagte James ruhig.
»Wenn du je etwas für irgendwen von uns empfunden hast …«
»Du hast dich zu weit von der Herde entfernt, Marcus.«
»Ich flehe dich an«, sagte Marcus.
Er sagte diese Worte, als gäbe es auf der Welt einen Ehrenkodex, als müsste man lediglich an die Güte einer Person appellieren, um sie zu erfahren.
Diese Selbstgerechtigkeit stieß James sauer auf.
»Dann fleh mich an. Fleh mich auf Knien an, dich zu töten. Tu es.«
James hätte nicht gedacht, dass Marcus es tun würde, aber natürlich tat er es – vermutlich liebte er es, sich in einem Akt der märtyrerhaften Selbstaufopferung auf die Knie zu begeben. Marcus war ein Steward. Er hatte sein Leben damit verbracht, sich an Schwüre zu halten und Regeln zu befolgen. Er glaubte an Begriffe wie »nobel« und »wahrhaftig« und »gut«.
Marcus bewegte sich unbeholfen. Ohne seine Hände war er nicht in der Lage, sein Gleichgewicht zu halten. Mit demütigender Mühe fand er schließlich eine neue Haltung, die die Ketten ihm gestatteten, und spreizte mit gesenktem Kopf die Knie auf den Planken.
»Bitte. James. Bitte. Für das, was von den Stewards übrig ist.«
James starrte auf den gesenkten Kopf hinunter, auf dieses zerschlagene, hübsche Gesicht des Mannes, der immer noch naiv genug war zu hoffen, dass es für ihn einen Ausweg gab.
»Ich werde an Simons Seite stehen, während er das Geschlecht der Stewards auslöscht«, sagte James. »Ich werde nicht aufhören, bis es niemanden mehr gibt, der in eurer Halle stehen kann, bis auch euer letztes Licht flackert und erlischt. Und wenn die Dunkelheit kommt, werde ich neben demjenigen stehen, der über all das herrschen wird.« James’ Stimme war klar und deutlich. »Du denkst, dass ich etwas für dich empfunden habe? Du hast wohl vergessen, wer ich bin.«
Daraufhin schaute Marcus auf. Seine Augen blitzten. Es war die einzige Warnung, die James bekam. Marcus zerrte an den Ketten. Er brachte seine ganze Kraft auf, sodass sich seine Muskeln anspannten und hervortraten, als er sich gegen das Eisen stemmte.
Für einen einzigen erschreckenden Augenblick ächzte die Konstruktion und bewegte sich …
Marcus gab einen gequälten Laut von sich, als sein Körper versagte. James stieß ein erleichtertes Lachen aus.
Stewards waren stark. Aber nicht stark genug.
Marcus keuchte. Sein Blick war wutentbrannt. Darunter lag jedoch entsetzliche Angst.
»Du bist nicht Simons rechte Hand«, sagte Marcus. »Du bist sein Wurm. Sein Stiefellecker. Wie viele von uns hast du getötet? Wie viele Stewards werden deinetwegen sterben?«
»Alle außer dir«, erwiderte James.
Marcus’ Gesicht wurde aschfahl. Für einen Augenblick glaubte James, dass er wieder anfangen würde zu flehen. Das hätte ihm gefallen. Doch Marcus starrte ihn nur schweigend an. Für den Moment genügte es. Marcus würde noch öfter flehen, bis das alles vorbei war. James musste es nicht herausfordern. Er musste einfach nur abwarten.
Marcus würde flehen, und hier auf Simons Schiff würde niemand kommen, um ihm zu helfen.
Zufrieden machte James kehrt, um die hölzernen Stufen hinaufzusteigen, die ihn an Deck führen würden. Er hatte den Fuß gerade auf die erste Stufe gesetzt, als Marcus’ Stimme laut hinter ihm erklang.
»Der Junge ist am Leben.«
James ärgerte sich, dass ihn dieser Satz innehalten ließ. Er zwang sich dazu, sich nicht umzudrehen, Marcus nicht anzuschauen, den Köder nicht zu schlucken. Er sprach mit ruhiger Stimme, während er weiter die Stufen zum Deck des Schiffs hinaufstieg.
»Das ist das Problem mit euch Stewards. Ihr denkt immer, dass es noch Hoffnung gibt.«
1
Drei Wochen später
Noch vor Sonnenaufgang konnte Will einen ersten flüchtigen Blick auf London werfen. Der Wald aus Masten auf dem Fluss erhob sich als pechschwarze Silhouette vor dem Himmel, der kaum heller war. Dazu gesellten sich Hebekräne, Gerüste und jede Menge aufragende Schornsteine und Ofenrohre.
Der Hafen erwachte zum Leben. Am linken Ufer wurden die ersten Lagerhallentore entriegelt und aufgestoßen. Männer hatten sich versammelt und brüllten ihre Namen in der Hoffnung, Arbeit zu erhalten. Andere befanden sich bereits in den flachen Booten und wickelten Taue auf. Ein Maat in einer Satinweste rief einem Vorarbeiter eine Begrüßung zu. Drei Kinder mit hochgekrempelten Hosenbeinen balgten sich im Schlamm um einen Kupfernagel, ein kleines Stück Kohle, ein Seilende oder einen Knochen. Eine Frau in einem voluminösen Kleid saß neben einem Fass und pries die Waren des Tages an.
Auf dem Flusskahn, der langsam durch das schwarze Wasser glitt, zwängte sich Will hinter einigen vertäuten Rumfässern hervor, bereit, ans Ufer zu springen. Er hatte die Aufgabe, die Taue zu überprüfen, die die Fässer sicherten, damit nichts verrutschte. Dann sollte er die Fracht an Land bringen – mithilfe eines Krans oder indem er das schwere Gewicht selbst trug. Er war nicht so massig gebaut wie viele der Hafenarbeiter, aber er war tüchtig. Er konnte sich gegen Taue stemmen und ziehen oder dabei helfen, Säcke in einen Karren oder ein Boot zu verladen.
»Da vorn ist der Pier, bring sie hin!«, rief Abney, der leitende Kahnführer.
Will nickte und griff nach einem Tau. Den Frachtkahn zu entladen, würde den ganzen Morgen dauern. Danach würden sie eine halbe Stunde Pause machen, damit sich die Männer Pfeifen und Alkohol teilen konnten. Seine Muskeln schmerzten bereits von der Anstrengung, doch schon bald würde er den Rhythmus finden, der ihn durch die Arbeit tragen würde. Am Ende des Tages würde er eine harte Brotkruste mit heißer, dampfender Erbsensuppe erhalten, die direkt aus dem Topf kam. Er freute sich bereits darauf und stellte sich den wärmenden Geschmack der Suppe vor. Er schätzte sich glücklich, dass er fingerlose Handschuhe besaß, die seine Hände vor der Kälte schützten.
»Bereitet die Taue vor!« Abney hielt selbst eins in der Hand, direkt neben einem von Wills Knoten. Seine Wangen waren vom Alkohol gerötet. »Crenshaw will, dass dieser Kahn vor Mittag abgefertigt ist.«
Auf dem Kahn brach geschäftiges Treiben aus. Ein dreißig Tonnen schweres Boot nur mithilfe von Strömung und Stangen zum Stehen zu bringen, war schon bei Tageslicht schwer, aber in der Dunkelheit des frühen Morgens noch anstrengender. Wenn man zu hektisch vorging, zerbrachen die Stangen. Wenn man zu langsam war, rammte das Boot den Pier, und das Holz zersplitterte. Die Kahnführer senkten ihre Stangen in den Schlamm des Flussbetts und stemmten sich dagegen. Mit aller Kraft drückten sie gegen das ganze schwere Gewicht des Kahns an.
»Vertäut sie!«, kam der Ruf, denn bevor sie den Kahn entladen konnten, mussten sie ihn sicher festmachen.
Langsam kam er zum Stehen, hob und senkte sich kaum auf dem dunklen Wasser. Die Schiffsführer verstauten ihre Stangen und warfen Festmacher aus, damit man den Kahn am Pier vertäuen konnte. Sie zerrten an den Tauen, um sie straff zu ziehen, und verknoteten sie dann weiter.
Will war der Erste, der von Bord sprang. Er legte seinen Festmacher um einen Poller und half der Mannschaft an Bord, den Kahn fest an den Pier zu ziehen.
»Der Vorarbeiter wird heute Abend mit den Kaufleuten des Schiffs trinken«, sagte George Murphy, ein Ire mit einem beeindruckenden Backenbart, während er Seite an Seite mit Will die Taue straff zog. Das war das Thema, über das alle Männer am Hafen redeten – Arbeit und wie man sie bekommen konnte. »Vielleicht bietet er mehr Arbeit an, wenn dieser Auftrag erledigt ist.«
»Alkohol macht ihn waghalsig, sorgt aber auch dafür, dass er unnötige Risiken eingeht«, sagte Will, und Murphy schnaubte gutmütig. Will fügte nicht hinzu: Meistens.
»Ich dachte mir, dass ich mal versuche, ihn danach zu erwischen, um zu sehen, ob ich mich anheuern lassen kann«, sagte Murphy.
»Das ist besser, als vor dem Tor herumzulungern und darauf zu hoffen, dass man für den Tag Arbeit bekommt«, stimmte Will zu.
»Womöglich kann ich mir dann am Sonntag sogar ein bisschen Fleisch leisten …«
Ein Krachen ertönte.
Will riss gerade noch rechtzeitig den Kopf herum, um zu sehen, wie sich ein Tau aus seiner Halterung löste und hoch in die Luft flog.
Auf diesem Boot befanden sich dreißig Tonnen Fracht, nicht nur Rum, sondern auch Kork, Gerste und Schießpulver. Das Tau, das wie eine Peitschenschnur nach oben und durch die Eisenringe schnellte, entließ das alles aus der sicheren Vertäuung. Das Segeltuch wurde weggeschleudert, und die Fässer rollten polternd los. Direkt auf Murphy zu. Nein!
Will warf sich gegen Murphy und stieß ihn aus dem Weg, damit ihn die Kaskade aus Fässern nicht überrollte. Dann verspürte er einen entsetzlichen explosionsartigen Schmerz, als ihn eins der Fässer an der Schulter erwischte. Schwer atmend rappelte er sich auf und schaute in Murphys schockiertes Gesicht. Sofort überkam ihn eine Welle der Erleichterung, weil der Mann noch lebte und in dem Tumult lediglich seine Mütze verloren hatte, sodass man sein platt gedrücktes Haar sah, das in seinen Backenbart überging. Für einen Augenblick starrten er und Murphy einander einfach nur an. Dann dämmerte ihnen das ganze Ausmaß der Katastrophe.
»Zieht sie hoch! Holt sie aus dem Wasser!«
Männer stapften umher, und Wasser spritzte auf, während sie verzweifelt versuchten, die Facht zu retten. Will blieb ebenfalls nicht trocken, als sie die Fässer ans gepflasterte Ufer rollten. Er ignorierte seine schmerzende Schulter. Die Erinnerung an das fliegende Tau und Murphy in Lebensgefahr zu ignorieren, fiel ihm deutlich schwerer. Er hätte sterben können. Er versuchte, sich auf den Trümmerhaufen zu konzentrieren. Wie schwer war die Fracht beschädigt? Kork schwamm, und die Rumfässer waren luftdicht, doch Salpeter löste sich in Wasser auf. Würden sie den Inhalt ruiniert vorfinden, wenn sie eins der Fässer mit Schießpulver mithilfe einer Brechstange öffneten?
Eine ganze Kahnladung voller Schießpulver zu verlieren – was würde das bedeuten? Würde Crenshaws Geschäft einbrechen und sein Reichtum den Fluss hinuntertreiben?
Unfälle ereigneten sich am Hafen recht häufig. Erst letzte Woche hatte Will gesehen, wie ein schwerfälliges Zugpferd unerwartet gescheut hatte, während es einen Kahn den Kanal entlanggezogen hatte. Die Taue waren gerissen, und das Boot war gekentert. Abney kannte eine Geschichte über eine zerbrochene Kette, die vier Männer tötete und eine Bootsladung voll Kohle auf den Grund des Flusses sinken ließ. Murphy fehlten zwei Finger, was er schlecht gestapelten Frachtkisten verdankte. Jeder kannte die tägliche Realität: Man knauserte so sehr, dass es riskant wurde, und sparte an allen Ecken und Enden.
»Ein verdammtes Tau ist weggerutscht!«, fluchte Beckett, ein älterer Arbeiter in einer ausgeblichenen braunen Weste, die er bis zum Hals fest zugeknöpft hatte. »Dort.« Er deutete auf die zerbrochene Halterung. »Du.« Er wandte sich an Will, der ihm am nächsten war. »Besorg uns ein paar neue Taue und eine Brechstange, damit wir diese Fässer öffnen können.« Er deutete mit einem Nicken auf die Lagerhalle. »Und beeil dich. Jedes bisschen verlorene Zeit wird von deinem Lohn abgezogen.«
»Ja, Master Beckett«, sagte Will. Er wusste, dass es nichts bringen würde, mit dem Mann zu diskutieren.
Hinter ihm befahl Beckett den anderen bereits, wieder an die Arbeit zu gehen. Unter seinen Anweisungen wurden Säcke und Kisten aus dem Wasser geholt und um die tropfenden Fässer herum am Ufer aufgestapelt.
Will eilte zur Lagerhalle.
Crenshaws Lagerhalle war einer von vielen großen Ziegelbauten, die den Uferbereich säumten. Sie war mit Ware in Fässern und Kisten gefüllt, die dort für ein oder zwei Nächte verstaut wurde, um dann ihren Weg in Gesellschaftszimmer, auf Esstische und in Pfeifenköpfe zu finden.
Die Luft im Inneren war kalt und stank nach dem Schwefel, der in gelben Eimern aufbewahrt wurde. Außerdem roch es nach Tierhäuten, die dort aufgestapelt lagen, und nach Fässern mit übermäßig süßem Rum. Will presste seine Nase an seinen Arm, als die strenge Note von frischem aufgestapeltem Tabak vom beißenden Geruch intensiver Gewürze überlagert wurde, die er nie gekostet hatte. Vor zwei Wochen hatte er einen halben Tag damit verbracht, in einer ähnlichen Lagerhalle Kisten zu schleppen. Der Husten, den ihm das eingebracht hatte, hatte ihn noch tagelang begleitet, und es war sehr lästig gewesen, ihn vor dem Vorarbeiter verbergen zu müssen. An den üblen Gestank des Flusses war er gewöhnt, aber die Dämpfe des Teers und des Alkohols trieben ihm die Tränen in die Augen.
Ein Arbeiter mit einem groben knallbunten Tuch um den Hals hielt beim Stapeln von Holz inne. »Hast du dich verlaufen?«
»Beckett schickt mich. Ich soll Taue besorgen.«
»Weiter hinten.« Er deutete mit seinem Daumen in die Richtung.
Will schnappte sich eine Brechstange, die neben ein paar älteren Fässern und einer aufgehäuften Reihe Leinen lag, die nach Teer rochen. Dann hielt er nach einer unbenutzten Taurolle Ausschau, die er sich um die Schulter schlingen konnte, um sie zurück zum Kahn zu bringen.
Hier ist nichts, und hinter den Fässern kann ich auch nichts entdecken … Links von sich sah er einen Gegenstand, der teilweise mit einem weißen Laken bedeckt war. War da etwas? Er streckte eine Hand aus und zog an dem staubigen Laken, das hinunterglitt und zu Boden fiel.
Darunter kam ein Spiegel zum Vorschein, der an einem Frachtbehälter lehnte. Er bestand aus Metall und war alt, eine Antiquität aus einer längst vergangenen Epoche. Offenbar stammte er aus einer Zeit, in der man Spiegel noch nicht aus Glas hergestellt hatte. Er war verbogen und voller Schlieren, sodass Wills Spiegelbild auf der metallenen Oberfläche vollkommen verzerrt wirkte. Er erhaschte nur flüchtige Blicke auf blasse Haut und dunkle Augen. Hier ist auch nichts, dachte er und wollte sich wieder seiner Suche widmen, als etwas in dem Spiegel seine Aufmerksamkeit auf sich zog.
Ein Flackern.
Er schaute sich ruckartig um, weil er dachte, dass der Spiegel eine Bewegung hinter ihm eingefangen haben musste. Doch da war niemand. Seltsam. Hatte er sich das bloß eingebildet? An diesem Ende war die Lagerhalle vollkommen verlassen. Überall waren nur lange Gänge zwischen gestapelten Kisten. Er schaute wieder zu dem Spiegel.
Seine matte Metalloberfläche war vom Alter und von allerlei Makeln ganz stumpf geworden, daher konnte er sich selbst kaum darin erkennen. Doch er sah es dennoch, eine Bewegung auf der verschwommenen Oberfläche des Spiegels, die ihn wie erstarrt innehalten ließ.
Das Spiegelbild veränderte sich.
Will starrte es an und wagte kaum zu atmen. Die undeutlichen Formen auf dem Metall setzten sich vor seinen Augen neu zusammen zu Säulen und weitläufigen Räumen … Das war unmöglich, und doch passierte es. Das Spiegelbild veränderte sich, als wäre der Raum vor dem Spiegel ein Ort aus einer längst vergangenen Zeit. Und hier war niemand, der ihm verbot, vorzutreten und durch die Jahre zurückzuschauen.
Im Spiegel war eine Dame. Das sah er als Erstes, zumindest glaubte er es. Dann folgten das goldene Licht der Kerze neben ihr und der goldene Schimmer ihres Haars. Es war zu einem einzelnen Zopf geflochten, der ihr über die Schulter fiel und bis zu ihrer Taille reichte.
Sie schrieb etwas, leuchtende Buchstaben auf Seiten mit reich verzierten Rändern und winzigen Figuren, die sich in die kunstvoll gestalteten Großbuchstaben einfügten. Von ihrem Zimmer aus konnte man auf einen Balkon und in die dahinterliegende Nacht hinausschauen. Es verfügte über eine Gewölbedecke und eine Reihe flacher Stufen, die – irgendwoher wusste er das – in den Garten hinausführten. Er hatte diesen Anblick noch nie gesehen, doch in ihm war eine Erinnerung an den Abendduft des Grüns und die dunkle Bewegung von Bäumen. Instinktiv trat er näher heran, um alles besser zu erkennen.
Die Frau hielt beim Schreiben inne und drehte sich herum.
Sie hatte Augen wie seine Mutter. Sie schaute ihn direkt an. Er kämpfte gegen den Instinkt an, einen Schritt zurückzutreten.
Sie kam auf ihn zu. Ihr Kleid entfaltete sich zu einer Schleppe, die hinter ihr über den Boden glitt. Er konnte die Kerze sehen, die sie in ihrem Ständer hielt, das schimmernde Medaillon, das sie um den Hals trug. Sie kam ihm so nah, dass es sich anfühlte, als würden sie einander gegenüberstehen. Plötzlich hatte er das Gefühl, dass sie lediglich die Entfernung einer ausgestreckten Hand trennte. Er glaubte, sein eigenes Gesicht in ihren Augen gespiegelt sehen zu müssen, klein wie eine Kerzenflamme, ein Zwillingsflackern.
Stattdessen sah er den Spiegel in ihren Augen, silbern und nagelneu.
Sämtliche Haare standen auf seinen Armen zu Berge, und diese seltsame Situation jagte ein Kribbeln durch seinen Körper. Das ist derselbe Spiegel … Sie schaut in denselben Spiegel …
Eine Stimme fragte: »Wer bist du?«
Er zuckte unvermittelt zurück, stolperte und erkannte dann, wie töricht er gewesen war. Denn die Stimme war nicht aus dem Spiegel gekommen. Sie war direkt hinter ihm erklungen. Einer der Lagerhallenarbeiter starrte ihn misstrauisch an und hob eine Lampe an. »Mach dich wieder an die Arbeit!«
Will blinzelte. Die Lagerhalle mit ihren nasskalten Kisten lag vor ihm, vollkommen unspektakulär und gewöhnlich. Der Garten, die hohen Säulen und die Dame waren verschwunden.
Es fühlte sich an, als wäre ein Zauber gebrochen worden. Hatte er sich das alles nur eingebildet? Lag das an den Dämpfen in der Lagerhalle? Er verspürte den Drang, sich die Augen zu reiben. Ein Teil von ihm wollte dem Bild nachjagen, das er gesehen hatte. Doch der Spiegel war bloß ein Spiegel und gab die gewöhnliche Welt um ihn herum wieder. Die Vision darin war verschwunden: eine Fantasie, ein Tagtraum, eine optische Täuschung.
Will schüttelte das benommene Gefühl ab und zwang sich zu nicken und »Ja, Sir« zu sagen.
2
Das Herumtrödeln in der Lagerhalle brachte Will eine dreiwöchige Lohnkürzung sowie eine Degradierung zu einigen der härtesten Arbeiten im Hafen ein. Er zwang sich, es durchzustehen, doch seine Muskeln brannten, und sein Magen krampfte ohne Essen. Die ersten drei Tage bestanden aus Ausheben und Schleppen. Dann musste Will am Rad arbeiten. Er mühte sich ab, um den großen hölzernen Zylinder der Lagerhalle zusammen mit sechs deutlich stärkeren Männern zu drehen. Seine Beine brannten, während die Flaschenzüge der Vorrichtung gewaltige Fässer fünf Meter hoch in die Luft hoben. Jeden Abend kehrte er in seine anonyme, überfüllte Unterkunft zurück, zu müde, um auch nur an den Spiegel oder die seltsamen Dinge, die er darin gesehen hatte, zu denken. Tatsächlich war er zu erschöpft, um irgendetwas anderes zu tun, als auf die schmutzige Strohmatte zu fallen und zu schlafen.
Er beschwerte sich nicht. Crenshaw war nach wie vor im Geschäft. Er wollte diese Arbeit. Selbst mit gekürztem Lohn war Hafenarbeit besser als das Leben, das er geführt hatte, als er damals nach London gekommen war. Er hatte Tage damit verbracht, von zusammengeklaubten Abfällen zu leben. Erst dann hatte er gelernt, die ausgebrannten Stummel von Zigarren aufzusammeln, sie zu trocknen und sie als Pfeifentabak an die Hafenarbeiter zu verkaufen. Diese Männer hatten ihm schließlich verraten, dass man am Hafen auch ohne Ausbildung Arbeit bekommen könne, wenn man bereit sei, hart genug zu schuften.
Nun hievte Will den letzten Sack Gerste auf den Stapel, lang nachdem die meisten anderen Männer beim Bimmeln der Glocke gegangen waren. Es war ein harter Arbeitstag gewesen, mit doppeltem Tempo und ohne Pausen. Er hatte versucht, die verlorene Zeit wettzumachen, weil der Kahn verspätet eingetroffen war. Die Sonne ging unter, und am Ufer befanden sich weniger Leute, die letzten Nachzügler beendeten ihre Arbeit.
Er musste sich nur noch beim Vorarbeiter abmelden, und dann hätte er für heute Feierabend. Er würde zur Hauptstraße gehen, wo sich die Essensverkäufer versammelten, um den Arbeitern einen Bissen für den richtigen Preis anzubieten. Ein später Feierabend bedeutete, dass er seine Portion Erbsensuppe verpasst hatte, aber er hatte eine einzelne Münze, mit der er sich eine heiße Ofenkartoffel kaufen konnte, und die würde ausreichen, um ihm genug Energie für den morgigen Tag zu verschaffen.
»Der Vorarbeiter ist da vorn.« Murphy nickte flussaufwärts.
Will beeilte sich, den angegebenen Ort zu erreichen, bevor der Vorarbeiter aufbrach. Er bog um die Ecke und rief Beckett und den letzten verbliebenen Arbeitern, die in Richtung Wirtshaus stolperten, einen Abschiedsgruß zu. Als er am Ufer entlanglief, entdeckte er in der Ferne einen Maronenverkäufer, der den letzten Hafenarbeitern lautstark seine Ware anpries. Sein bärtiges Gesicht schimmerte rot, weil es sich direkt über dem Feuer befand, das durch die Löcher in seinem Ofen flackerte. Dann erreichte er den leeren Pier.
Und das war der Moment, in dem sich Will wirklich umschaute, um zu erkennen, wo er gelandet war.
Mittlerweile war es so dunkel, dass Männer nach draußen gekommen waren, um die Talglampen anzuzünden, die unruhig flackerten und zischten. Doch diese Lichter hatte Will längst hinter sich gelassen. Hier waren die einzigen Geräusche das Plätschern des schwarzen Wassers am Ende des Piers und die fernen Signale eines Schleppers, der sich langsam vom Kanal zum Fluss bewegte und dabei mit seinem Netz alles einsammelte, was er finden konnte. Der Pier war vollkommen verlassen. Es gab keinerlei Anzeichen von Leben.
Abgesehen von drei Männern in einer ausrangierten Jolle, die halb verborgen neben den dunklen Planken lag.
Will konnte den Augenblick, in dem er es erkannte, nicht benennen und wusste auch nicht, was seine Erkenntnis ausgelöst hatte. Vom Vorarbeiter war weit und breit keine Spur. Niemand befand sich in Hörweite, um einen Hilferuf zu vernehmen. Die drei Männer stiegen aus dem Boot.
Einer von ihnen schaute nach oben. Direkt in sein Gesicht.
Sie haben mich gefunden.
Er wusste es sofort, erkannte den zielstrebigen Ausdruck in ihren Augen, die Art, wie sie sich verteilten, um ihm den Weg abzuschneiden, als sie aus der Jolle stiegen.
Wills Herz klopfte ihm bis zum Hals.
Wie? Warum sind sie hier? Was hatte ihn verraten? Er blieb stets für sich. Er verhielt sich unauffällig. Er verbarg die Narbe an seiner rechten Hand mit fingerlosen Handschuhen. Manchmal musste er über sie reiben, um seine Finger beweglich zu halten, aber er achtete immer sehr genau darauf, dass es niemand bemerkte. Er wusste aus Erfahrung, dass ihn selbst die kleinste Geste verraten konnte.
Vielleicht waren es diesmal die Handschuhe selbst gewesen. Oder vielleicht war er einfach nur unvorsichtig gewesen. Womöglich war der anonyme Junge am Hafen nicht ganz so anonym, wie er es gehofft hatte.
Er trat einen Schritt zurück.
Es gab keinen Ausweg. Hinter ihm ertönte ein Geräusch: Da waren zwei weitere Männer, die sich näherten, um ihm den Weg abzuschneiden, finstere Gestalten, die er nicht erkannte. Doch er erkannte die koordinierte Art, auf die sich die Männer bewegten und verteilten, um seine Flucht zu verhindern.
Dieses Verhalten war ihm auf unerträgliche Weise vertraut, ein Teil seines neuen Lebens, als würde er sie erneut auf dem blutüberströmten Boden liegen sehen und nicht wissen, warum, als würde er sich erneut monatelang verstecken, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, warum sie sie umgebracht hatten oder was sie von ihm wollten. Er dachte an das letzte Wort, das seine Mutter zu ihm gesagt hatte.
Lauf.
Er sprintete in die einzige Richtung los, in der er einen Ausweg sah – auf einen Stapel Kisten zu, der links neben der Lagerhalle stand.
Er sprang an den Kisten hoch und zog sich verzweifelt daran empor. Eine Hand grabschte nach seinem Knöchel. Er ignorierte sie. Er ignorierte das Zittern und die Panik, die sein Herz rasen ließ. Dieses Mal sollte es leichter sein. Dieses Mal lähmte ihn keine frische Trauer. Er war nicht länger naiv, wie er es in jenen ersten Nächten gewesen war, als er nicht gewusst hatte, wie man davonlief oder sich versteckte, als er nicht gewusst hatte, wie man die Straßen mied oder was passierte, wenn man es sich gestattete, jemandem zu vertrauen.
Lauf.
Als er im Matsch auf der anderen Seite landete, blieb ihm keine Zeit, um seinen Sturz abzufangen. Keine Zeit, um sich zu orientieren oder zurückzuschauen.
Er rappelte sich auf und rannte los.
Warum? Warum sind sie hinter mir her? Seine Füße klatschten auf die nasse, matschige Straße. Er konnte die Männer hinter sich rufen hören. Es hatte angefangen zu regnen, und er rannte blind in die nasse Dunkelheit, schlitterte dabei über rutschiges Kopfsteinpflaster. Schon bald war seine Kleidung vollkommen durchnässt, und das Laufen fiel ihm schwerer. Der Atem in seiner Kehle klang viel zu laut.
Doch er kannte das Gewirr aus Straßen und kleineren Gassen, in denen ständig Bauarbeiten durchgeführt wurden. Sie bildeten ein Durcheinander aus Gerüsten und neuen Gebäuden. Er hielt darauf zu und hoffte, dass sein Vorsprung ausreichen würde, um seine Verfolger in die Irre zu führen und sich zu verstecken, damit die Männer an ihm vorbeilaufen würden. Geduckt lief er im Zickzackkurs zwischen den Planken und Streben der Baustellen hindurch. Er hörte, wie die Männer langsamer wurden und auf der Suche nach ihm ausschwärmten.
Ich darf sie nicht wissen lassen, dass ich hier bin. Er verhielt sich ganz ruhig, schlüpfte zwischen die Streben und dann in einen Hohlraum hinter einem hohen Gerüst, das zu einem halb fertigen Bauwerk hinaufführte.
Eine Hand packte seine Schulter. Dann spürte er heißen Atem an seinem Ohr und eine Hand an seinem Arm.
Nein. Mit hämmerndem Herzen wehrte sich Will verzweifelt, und als eine nasse Hand fest auf seinen Mund gelegt wurde, hielt er vor Schreck den Atem an …
»Hör auf.« Die Stimme des Mannes war aufgrund des Regens schwer zu verstehen, aber sie sorgte dafür, dass Will ein Schauer über den Rücken lief. »Hör auf, ich bin keiner von denen.«
Will nahm die Worte des Mannes kaum wahr. Der Laut, den er von sich gab, klang unter der schweren Hand des Mannes gedämpft. Sie sind hier. Sie sind hier. Sie haben mich erwischt.
»Hör auf«, sagte der Mann erneut. »Will, erkennst du mich denn nicht?«
Matthew?, sagte er beinahe. In dem Augenblick, in dem der Mann seinen Namen ausgesprochen hatte, hatte er die Stimme schlagartig erkannt. Der Umriss des Mannes aus der Truppe vom Fluss verwandelte sich in eine ihm bekannte Gestalt.
Er hielt still und traute seinen Augen kaum, als der Mann langsam die Hand von seinem Mund nahm. Der Regen erschwerte die Sicht, doch der Mann war eindeutig Matthew Owens. Er war ein Diener seiner Mutter gewesen, als sie noch in ihrem alten Haus in London gelebt hatten. In ihrem ersten Haus, in ihrem ersten Leben, bevor sie in eine Reihe unterschiedlicher abgelegener Unterkünfte gezogen waren. Seine Mutter hatte ihm nie den Grund dafür verraten, war aber immer nervöser geworden. Sie war Fremden gegenüber misstrauisch gewesen und hatte stets die Straße im Blick behalten.
»Wir müssen leise sein«, sagte Matthew und senkte die Stimme noch stärker. »Sie sind immer noch da draußen.«
»Du gehörst zu diesen Männern«, hörte Will sich selbst sagen. »Ich habe dich am Fluss gesehen.«
Er war Matthew seit Jahren nicht mehr begegnet, und nun war er hier. Er hatte ihn vom Hafen aus verfolgt, und womöglich verfolgte er ihn schon seit Bowhill …
»Ich gehöre nicht zu denen«, sagte Matthew. »Das denken sie nur. Deine Mutter hat mich geschickt.«
Erneut überkam ihn Angst. Meine Mutter ist tot. Er sprach es nicht laut aus, starrte einfach nur auf Matthews graues Haar und blaue Augen. Einen vertrauten Diener aus dem alten Haushalt zu sehen, rief in ihm ein kindliches Bedürfnis nach Sicherheit hervor, so als sehnte er sich nach dem Trost eines Elternteils, nachdem er sich in die Hand geschnitten hatte. Er wollte, dass Matthew ihm erzählte, was vor sich ging. Doch der Sog des Vertrauten aus seiner Kindheit traf auf die kalte Realität seines Lebens auf der Flucht. Die bloße Tatsache, dass ich ihn kenne, bedeutet nicht, dass ich ihm vertrauen kann.
»Sie sind dir dicht auf den Fersen, Will. Kein Ort in London ist sicher.« Matthews leise Stimme klang in dem düsteren Versteck unter dem Gerüst drängend. »Du musst zu den Stewards gehen. Der strahlende Stern hält stand, selbst während sich die Dunkelheit erhebt. Aber du musst dich beeilen, sonst werden sie dich finden. Und dann wird die Dunkelheit uns alle überkommen.«
»Ich verstehe nicht.« Die Stewards? Der strahlende Stern? Matthews Worte ergaben keinen Sinn. »Wer sind diese Männer? Warum verfolgen sie mich?«
Matthew holte etwas aus der Tasche seiner Weste, als wäre es sehr wichtig, und hielt es Will hin.
»Nimm das hier. Es gehörte deiner Mutter.«
Meiner Mutter? Gefahr und Verlangen rangen in seinem Inneren miteinander. Er wollte den Gegenstand nehmen. Die Sehnsucht war wie ein Schmerz, selbst während er sich an jene entsetzlichen letzten Augenblicke erinnerte, als sie zu ihm aufgeschaut hatte und ihr blaues Kleid mit Blut besudelt gewesen war. Lauf.
»Zeige es den Stewards, und sie werden wissen, was zu tun ist. Sie sind die Letzten, die es noch wissen. Sie werden dir Antworten liefern, das verspreche ich. Aber uns bleibt nicht viel Zeit. Ich muss zurückkehren, bevor sie bemerken, dass ich weg bin.«
Wieder hatte er dieses ihm unbekannte Wort ausgesprochen. Die Stewards. Matthew legte das, was er in der Hand hielt, auf eins der Bretter des Gerüsts, das sie voneinander trennte. Dann wich er zurück, als wüsste er, dass Will nicht nach dem Gegenstand greifen würde, solange er sich in seiner Nähe befand. Will umklammerte das Gerüst hinter sich fest. Er wollte nichts lieber tun, als auf den Mann zuzutreten, dessen graues Haar und abgenutzte schwarze Satinweste so vertraut waren.
Matthew wandte sich zum Gehen, hielt aber im letzten Augenblick inne und schaute zu ihm zurück.
»Ich werde tun, was ich kann, um sie von deiner Spur abzubringen. Ich versprach deiner Mutter, dass ich dir von innen heraus helfen würde, und genau das habe ich vor.«
Dann war er verschwunden und eilte zurück zum Fluss.
Will blieb mit hämmerndem Herzen zurück, während Matthews Schritte verklangen. Die Geräusche der anderen Männer verklangen mit ihm, als würden sie ihre Suche anderswo fortsetzen. Will konnte den Umriss, die Form dessen erkennen, was Matthew zurückgelassen hatte. Er kam sich wie ein wildes Tier vor, das auf den Köder in einer Falle starrte.
Warte!, wollte er dem alten Diener hinterherrufen. Wer sind sie? Was weißt du über meine Mutter?
Er starrte in den Regen hinaus in die Richtung, in die Matthew verschwunden war. Dann richtete er seine ganze Aufmerksamkeit wieder auf das kleine Päckchen auf dem Gerüst. Matthew hatte gesagt, dass er sich beeilen müsse, doch Will konnte nur noch an den Gegenstand denken, der vor ihm lag.
Hatte seine Mutter ihm den wirklich hinterlassen?
Er trat vor. Es fühlte sich an, als würde er von einer unsichtbaren Schnur in die Richtung gezogen.
Das Päckchen war von einer kleinen, runden Form, die mit einem ledernen Band umwickelt war. So hatte Matthew es aus seiner Westentasche gezogen. Zeige es den Stewards, hatte der alte Diener gesagt, doch Will wusste nicht, was Stewards waren oder wo er sie finden konnte.
Er streckte eine Hand aus. Beinahe erwartete er, dass sich die Männer vom Hafen jeden Moment auf ihn stürzen würden. Irgendwie rechnete er damit, dass das hier ein Trick oder eine Falle war. Mit vor Kälte tauben Fingern nahm er das Päckchen an sich. Er wickelte das lederne Band ab und sah ein rostiges Stück Metall. Ihm war so kalt, dass er die zackigen Kanten kaum spüren konnte. Doch das Gewicht des Gegenstands spürte er. Er war unerwartet schwer, als bestünde er aus Gold oder Blei. Will hielt ihn so, dass mehr Licht auf ihn fiel.
Und sofort überkam ihn ein Schauer, der durch seinen ganzen Körper fuhr.
Der Gegenstand war ansatzweise rund, aber verbogen. Es handelte sich um ein altes, zerbrochenes Medaillon. Er erkannte es. Er hatte es schon mal gesehen.
In dem Spiegel.
Eine Welle aus Benommenheit spülte über ihn hinweg, während er auf das Unmögliche in seinen Händen hinunterstarrte.
Die Dame hatte exakt dieses Medaillon um den Hals getragen. Er erinnerte sich daran, wie es gefunkelt hatte, als sie auf ihn zugekommen war und ihn dabei so unverwandt angeschaut hatte, als würde sie ihn kennen. Es war wie eine Weißdornblüte mit fünf Blütenblättern geformt gewesen und hatte wie neues Gold geschimmert.
Doch nun war die Oberfläche stumpf, rissig und uneben, als wäre das Medaillon viele Jahre alt – als hätte man es verbuddelt und wieder ausgegraben. Es war abgenutzt und ruiniert.
Aber die Dame im Spiegel war nur ein Traum, nur eine optische Täuschung …
Will drehte das Medaillon um und sah, dass auf der Rückseite etwas eingraviert war. Es war ein Schriftzug, und obwohl er die Sprache nicht kannte, konnte er die Worte dennoch verstehen. Als wären sie ein Teil von ihm, kämen tief aus seinem Inneren, als wäre die Sprache stets da gewesen und er müsste nur danach greifen.
Ich kann nicht zurückkehren, wenn man mich zum Kampf ruft.
Also werde ich ein Kind bekommen.
Ohne den Grund dafür zu kennen, fing er an zu zittern. Die Worte in dieser fremden Sprache brannten in seinem Verstand. Er sollte nicht in der Lage sein, sie zu lesen, doch er konnte es – er konnte sie spüren. Wieder sah er das Bild der Augen der Dame im Spiegel, als würde sie ihn direkt anschauen. Die Augen meiner Mutter. Alles um ihn herum verschwand, bis er nur noch die Dame sehen konnte, zwischen ihnen ein schmerzhaftes Gefühl der Sehnsucht, während sie einander anschauten. Ich kann nicht zurückkehren, wenn man mich zum Kampf ruft. Sie schien es direkt zu ihm zu sagen. Also werde ich ein Kind bekommen. Er zitterte noch heftiger. »Aufhören«, keuchte er und legte die Hände fest um das Medaillon. Mit reiner Willenskraft und aller Macht, die er aufbringen konnte, versuchte er, die Vision zum Verschwinden zu bringen. »Aufhören!«
Sie löste sich auf.
Will blieb flach atmend zurück. Er war allein, Regen tropfte von seinem Haar und durchnässte seine Mütze und seine Kleidung.
Genau wie der Spiegel war nun auch das Medaillon wieder ganz gewöhnlich. Ein altes, stumpfes Stück Metall, das keinerlei Hinweis auf das gab, was er gerade gesehen hatte. Will schaute auf und starrte erneut in die Richtung, in die Matthew in den Regen verschwunden war.
Was war es? Was hatte Matthew ihm gegeben? Er umklammerte das Medaillon so fest, dass die zackigen Kanten in seine Haut schnitten.
Die Straßen waren mittlerweile leer. Niemand hatte gehört, wie er angesichts der Vision des Medaillons nach Luft geschnappt hatte. Die Männer, die nach ihm suchten, waren weitergezogen. Das war seine Chance, davonzulaufen und zu entkommen.
Doch er brauchte Antworten – in Bezug auf das Medaillon und die Dame und die Männer, die ihn verfolgten. Er musste wissen, warum das alles passierte. Er musste wissen, warum diese Männer seine Mutter getötet hatten.
Er legte sich die Kette des Medaillons um den Hals und rannte durch den Regen zurück. Seine Füße klatschten im Matsch. Er musste Matthew finden. Er musste in Erfahrung bringen, was Matthew ihm nicht erzählt hatte.
Die Straßen rauschten an ihn vorbei. Die Augen der Dame im Spiegel brannten in seiner Erinnerung.
Als er schließlich keuchend zum Stehen kam, sah er, dass er fast den ganzen Weg zurück bis zur Lagerhalle gelaufen war.
Matthew saß auf einer Bank an der Straße ein paar hundert Meter vom Fluss entfernt. Diese Straße war besser beleuchtet als diejenigen, die er hinter sich gelassen hatte. Will erkannte, dass Matthew mit Schnallen versehene Schuhe und eine plissierte Pluderhose zu seinem weißen Hemd und seiner schwarzen Weste trug.
Will hatte so viele Fragen, dass er nicht wusste, wo er anfangen sollte. Er schloss die Augen und holte tief Luft.
»Bitte. Du hast mir dieses Medaillon gebracht. Ich muss wissen, was es bedeutet. Die Stewards – was sind sie? Wie finde ich sie? Und diese Männer – ich verstehe nicht, warum mich diese Männer verfolgen, warum sie meine Mutter töteten – ich verstehe nicht, was ich tun soll.«
Stille schlug ihm entgegen. Will hatte hektisch gesprochen. Als sich die Stille nun ausbreitete, spürte er, wie sich sein Bedürfnis nach Antworten in eine dunkle, pochende Angst verwandelte.
»Matthew?«, fragte er mit leiser Stimme. Doch er wusste es bereits. Er wusste es.
Es regnete heftig, und doch saß Matthew seltsam ungeschützt da. Er trug keinen Mantel. Seine Arme hingen in seinen durchnässten Hemdsärmeln schlaff herunter. Seine Kleidung klebte an seinem Körper. Wasser tropfte von seinen reglosen Fingern. Der Regen prasselte auf ihn ein und lief in Strömen über sein Gesicht, in seinen offenen Mund und über seine toten, offenen Augen.
Sie sind hier.
Will stürmte los – nicht über die Straße, sondern seitlich auf eine der Türen zu. Er folgte einer letzten verzweifelten Hoffnung, dass es ihm gelingen könnte, den Besitzer zu alarmieren oder einen Weg ins Gebäude zu finden. Den ersten Schlag musste er bereits am äußeren Tor einstecken. Bevor er die Tür erreichen konnte, packte eine Hand seine Schulter. Eine weitere legte sich um seinen Hals.
Nein …
Er sah die Haare auf dem Arm des einen Mannes und spürte den heißen Atem des anderen an seinem Gesicht. So nah war er seit jener Nacht keinem von ihnen mehr gekommen. Er kannte ihre Gesichter nicht, aber mit lähmendem Entsetzen entdeckte er etwas, das er sehr wohl erkannte.
An der Unterseite des Handgelenks prangte ein eingebranntes S im Fleisch des Mannes, der nach ihm griff.
Dieses S hatte er schon einmal gesehen – in Bowhill. Es war in die Handgelenke der Männer eingebrannt gewesen, die seine Mutter getötet hatten. Er sah es, wenn er nicht schlafen konnte, und es schlich sich in seine Träume. Es fühlte sich alt und dunkel an, wie etwas uraltes Böses. Nun schien sich dieses S als erhabenes, bewegliches Fleisch über die Haut des Mannes zu winden und auf ihn zuzukriechen …
Alles, was er während der neun Monate auf der Flucht gelernt hatte, verschwand. Es war, als wäre er wieder in Bowhill und stolperte vom Haus fort, während die Männer ihn verfolgten. Der Regen hatte ihm auch in jener Nacht die Sicht erschwert, und es war leicht gewesen, auszurutschen und hinzufallen. Er war Uferböschungen hinuntergekraxelt und durch Wassergräben gewatet. Er hatte nicht gewusst, wie lang er durchgehalten hatte, bis er zitternd und durchnässt zusammengebrochen war. Er hatte – das war dumm – seine Mutter gewollt. Aber sie war tot, und er war nicht in der Lage gewesen, zu ihr zurückzukehren, weil er ihr ein Versprechen gegeben hatte.
Lauf.
Für einen Augenblick war es so, als würde sich das S aus einer tiefen Grube nach ihm ausstrecken.
Lauf.
Mit einem harten Aufprall landete Will rücklings auf dem nassen Kopfsteinpflaster. Er versuchte, sich aufzurichten, und verlagerte sein Gewicht dabei auf einen Ellbogen. Sofort schnappte er geschockt und schmerzerfüllt nach Luft. Seine Schulter tat höllisch weh, und sein Arm brach unter ihm zusammen. Sie überwältigten ihn sofort, obwohl er sich mit aller Kraft wehrte. Vor dieser Nacht in Bowhill hatte er nie kämpfen müssen, und er war nicht wirklich gut darin. Sie hielten ihn fest, und einer der Männer schlug methodisch auf ihn ein, bis er in seiner durchnässten Kleidung hilflos auf dem Rücken lag und gerade noch atmen konnte.
»Du hattest ein unbeschwertes Leben, nicht wahr?« Der Mann hob seinen Fuß, um Will kurz mit der Stiefelspitze anzustupsen. »Ein Muttersöhnchen, das sich an den Rockzipfel seiner Mama klammert. Das ist jetzt vorbei.«
Als er versuchte, sich zu bewegen, traten sie ihn wieder und wieder, bis ihm schwarz vor Augen wurde und er nur noch reglos dalag.
»Fesselt ihn. Wir räumen hier auf und bringen ihn dann zu Simons Schiff.«
3
Aus dem Weg, Ratte.«
Rücksichtslos stieß eine Hand Violet zurück und sperrte sie von dem Spektakel aus, das sich auf Deck abspielte. Obwohl sie immer wieder hin und her geschubst wurde, reckte sie den Hals, um einen Blick auf das Geschehen zu erhaschen. Die Schultern der Seeleute versperrten ihr größtenteils die Sicht. Ihre dicht gedrängten Körper stanken nach Vorfreude, Salzwasser und Schweiß. Also arbeitete sie sich zu den Webleinen vor und schlang ihren Arm um die verknoteten Seile, um sicheren Halt zu haben. Über eine Masse aus Mützen und Kopftüchern hinweg erhaschte sie ihren ersten Blick auf Tom. Die Seeleute hatten ihn auf dem Deck eingekreist.
Heute war Donnerstag, und Simons Schiff, die Sealgair, lag auf dem überfüllten Fluss vor Anker. Sie war bis zum Bersten mit Fracht beladen, und am Hauptmast wehte die Flagge mit den drei schwarzen Jagdhunden – Simons Wappen. Violet hätte sich nicht an Bord schleichen dürfen, doch sie kannte das Schiff aufgrund der Arbeit, die ihre Familie für Simon erledigte und auf die sie alle sehr stolz waren. Der älteste Sohn des Earl of Sinclair, der Mann, den ihre Familie Simon nannte, hatte seinen eigenen Titel: Lord Crenshaw. Er kümmerte sich im Namen seines Vaters um ein lukratives Handelsimperium. Es hieß, dass er mehr Einfluss als König George habe und ihn überall auf der Welt ausleben könne. Violet hatte nur ein einziges Mal einen flüchtigen Blick auf Simon geworfen. Er war eine mächtige Gestalt in einem prachtvollen schwarzen Mantel gewesen.
Heute bewachten Männer mit Pistolen die Reling und versperrten den Zugang zum Pier. Alle anderen befanden sich auf dem Achterdeck. Das Verladen und Sichern der Fracht war für den Moment unterbrochen worden. Von ihrem Aussichtspunkt hoch oben in der Takelage aus konnte Violet das wilde Gebaren der Männer sehen, die sich dicht gedrängt in einem groben Kreis zusammengefunden hatte. Diese Männer hatten sich alle versammelt, um einer einzigen Sache beizuwohnen.
Tom würde mit dem Brandmal geehrt werden.
Sein Oberkörper war nackt, und er trug keine Kopfbedeckung, sodass sein dunkles rotbraunes Haar um sein Gesicht herumfiel. Er kniete auf den Planken des Schiffs. Seine nackte Brust hob und senkte sich sichtbar. Er atmete schnell in freudiger Erwartung dessen, was nun geschehen würde.
Die Stimmung unter den Zuschauern war erwartungsvoll – teilweise war auch Neid zu spüren, denn die Männer wussten, dass sich Tom die Ehrung, die er gleich erhalten würde, verdient hatte. Ein, zwei von ihnen tranken Whiskey, als wären sie diejenigen, die ihn bräuchten. Violet verstand, wie sie sich fühlten. Es war, als würde die Zeremonie zu ihrer aller Ehren abgehalten werden. Und in gewisser Weise traf das auch zu, denn es war wie ein Versprechen: Erbringt gute Leistungen für Simon, stellt Simon zufrieden, dann werdet ihr das hier erhalten.
Ein Seemann trat vor. Er trug eine braune Lederschürze wie ein Schmied.
»Ihr müsst mich nicht festhalten«, sagte Tom. Er hatte alles abgelehnt, was man ihm angeboten hatte, um ihm zu helfen, den Schmerz zu ertragen – Alkohol, eine Augenbinde, ein Stück Leder, auf das er beißen konnte. Er kniete einfach nur und wartete. Die erwartungsvolle Anspannung nahm zu.
Mit neunzehn war Tom der Jüngste, der je das Brandmal erhalten hatte. Ich werde sogar noch jünger sein, schwor sich Violet, während sie zusah. Genau wie Tom würde sie sich einen Namen in der Welt des Handels machen und Simon ihre eigenen Trophäen mit nach Hause bringen. Und dann würde er sie ebenfalls befördern. Sobald ich eine Chance erhalte, werde ich mich beweisen.
»Simon belohnt dich mit diesem Geschenk für deine Dienste«, sagte Captain Maxwell. Er nickte in Richtung des Seemanns, der daraufhin an die Feuerschale mit den heißen Kohlen trat, die man an Deck gebracht hatte. »Wenn es vollendet ist, wirst du ihm gehören«, fuhr der Captain fort. »Geehrt durch sein Brandmal.«
Der Seemann zog das Brenneisen aus den heißen Kohlen.
Violet spannte sich an, als wäre sie bei dem folgenden Geschehen an Toms Stelle. Das Eisen war lang wie ein Schürhaken, hatte aber ein S an der Spitze, das von den Kohlen so heiß war, dass es rot glühte wie eine flackernde Flamme. Der Seemann trat vor.
»Ich schwöre Simon diesen Eid«, sprach Tom die rituellen Worte. »Ich bin sein treuer Diener. Ich werde gehorchen und dienen. Brandmarke mich.« Tom hatte seine blauen Augen direkt auf den Seemann gerichtet. »Besiegele meinen Schwur, indem du ihn in mein Fleisch brennst.«
Violet hielt den Atem an. Das war der Moment. Diejenigen, die das Brandmal trugen, wurden zu einem Teil des inneren Kreises. Simons Favoriten: Sie waren seine treusten Gefolgsleute, und man munkelte, dass sie besondere Belohnungen erhielten – und darüber hinaus Simons Aufmerksamkeit, was für viele bereits Lohn genug war. Horst Maxwell, der Captain der Sealgair, trug das Mal, was ihm eine Befehlsgewalt verlieh, die seinen Rang noch überstieg.
Tom streckte seinen Arm aus, sodass die makellose Haut an der Unterseite seines Handgelenks sichtbar war.
Violet hatte bislang nur ein einziges Mal dabei zugesehen, wie ein Mann das Brandmal erhalten hatte, und der hatte geschrien und gezuckt wie ein Fisch auf dem Boden eines Boots. Tom hatte ebenfalls dabei zugesehen, doch das schien ihn nicht zu entmutigen. Er schaute dem Seemann entschlossen in die Augen und bewahrte seine Haltung allein mithilfe seines Muts und seiner Willenskraft.
»Es ist so weit, Junge. Sei tapfer«, sagte Captain Maxwell.
Tom wird nicht schreien, dachte Violet. Er ist stark.
Die Männer waren jetzt so still, dass man das Plätschern des Wassers an der Schiffswand hören konnte. Der Seemann hob das Brenneisen. Violet sah, wie ein Matrose den Kopf drehte und sich abwandte, weil er nicht hinschauen wollte – er war nicht so tapfer wie Tom. Genau das bewies Tom gerade: Ertrag den Schmerz, und zeig, dass du würdig bist. Violet umklammerte die Seile fest, wandte sich aber nicht ab, während der Seemann das glühende Eisen auf die Haut an Toms Handgelenk presste.
Der plötzliche Gestank von verkohltem Fleisch war entsetzlich. Heißes Metall drückte sich länger, als es nötig erschien, in die Haut. Toms Muskeln traten hervor, sein ganzer Körper verspürte zweifellos den Drang, sich vor Schmerz zusammenzukrümmen. Doch er gab ihm nicht nach. Er blieb auf den Knien hocken und atmete angestrengt ein und aus. Sein Körper bebte wie ein erschöpftes Pferd, das am Ende eines wilden Ritts mit Schweiß bedeckt war.
Ein Brüllen ertönte, und der Seemann riss Toms Arm nach oben und zerrte ihn gleichzeitig auf die Füße, um jedem sein Handgelenk zu präsentieren. Tom wirkte benommen und rappelte sich torkelnd auf. Violet erhaschte einen kurzen Blick auf die Haut an seinem Handgelenk, in der nun ein S-förmiges Brandmal prangte. Dann kippte der Seemann Alkohol darüber und umwickelte sein Handgelenk mit einem Verband.
So werde ich sein, dachte Violet. Tapfer wie Tom.
Er verschwand aus ihrem Sichtfeld, als die Menge ihn umstürmte und ihn förmlich unter sich begrub, um ihm zu gratulieren. Sie reckte erneut den Hals, um einen weiteren Blick zu erhaschen. Da sie von ihrer aktuellen Position aus keine Chance hatte, ließ sie sich an den Seilen entlang nach unten gleiten und versuchte, Tom durch den Pulk aus Männern zu erreichen. Doch sie wurde ständig unachtsam zur Seite gestoßen und zurückgeschubst. Sie konnte ihn in dem Gewühl nicht entdecken, obwohl der widerlich starke Geruch von verbranntem Fleisch immer noch in der Luft hing. Ein schmerzhafter Griff an ihrem Arm riss sie beiseite.
»Ich habe dir doch gesagt, dass du aus dem Weg gehen sollst, Ratte.«
Der Mann, der ihren Arm gepackt hatte, hatte strähniges Haar, das unter einem schmutzigen Kopftuch hervorschaute. Sein Bart bedeckte seine Wangen wie ein Ausschlag. Er hatte die raue Haut eines Seemanns, und sein ganzes Gesicht war von winzigen roten Adern überzogen. Der feste Griff seiner Finger schmerzte. Violet konnte abgestandenen Gin in seinem Atem riechen und verspürte einen Anflug von Ekel. Sie überwand ihn und bohrte ihre Absätze in die Schiffsplanken. »Lass mich los. Ich habe ein Recht darauf, hier zu sein!«
»Du bist eine hässliche braune Ratte, die die Kleidung eines Bessergestellten gestohlen hat.«
»Ich habe gar nichts gestohlen!«, protestierte sie, obwohl sie Toms Weste und Hose und auch sein Hemd trug. Außerdem steckten ihre Füße in den Schuhen, aus denen er herausgewachsen war. Und dann hörte sie demütigenderweise Toms Stimme. »Was geht hier vor?«
Tom hatte sich ein Hemd übergestreift, doch die zwei oberen Knöpfe des hochgeschlossenen Kragens standen noch offen, und die Rüschen hingen herab. Violet hatte freie Sicht auf ihn, als sich zwischen ihnen eine Gasse auftat. Alle Anwesenden hatten die Blicke auf sie gerichtet.
Der Seemann hielt sie am Kragen fest. »Dieser Bursche macht Ärger …«
Auf Toms Gesicht schimmerte immer noch der feine Schweißfilm, den er dem Brandmarken verdankte. »Das ist kein Bursche«, sagte er. »Das ist meine Schwester, Violet.«
Sie sah, wie der Seemann auf die gleiche Weise reagierte wie jeder, der diese Enthüllung erlebte: zuerst mit Ungläubigkeit und dann mit einer neuen Sichtweise auf Tom, so als hätte er etwas über seinen Vater erfahren.
»Aber sie ist …«
»Zweifelst du meine Worte an, Matrose?« Dank des frischen Brandmals hatte Tom mehr Befehlsgewalt als jeder andere auf dem Schiff. Er gehörte nun Simon, und sein Wort war Simons Wort. Der Matrose klappte hastig den Mund zu und ließ sie so überstürzt los, dass sie stolpernd auf die Planken fiel. Sie und Tom sahen einander an. Ihre Wangen fühlten sich heiß an.
»Ich kann das erklären …«
In London hätte niemand vermutet, dass Tom Violets Halbbruder war. Sie sahen einander nicht ähnlich. Tom war drei Jahre älter und teilte ihr indisches Erbe nicht. Er war das Ebenbild seines Vaters: groß, breitschultrig und blauäugig, mit heller Haut und rotbraunem Haar. Violet war zierlich und kam nach ihrer Mutter. Sie hatte braune Haut, dunkle Augen und dunkles Haar. Das Einzige, was sie gemeinsam hatten, waren ihre Sommersprossen.
»Violet. Was machst du hier? Du solltest zu Hause sein.«
»Du hast das Brandmal erhalten«, sagte sie. »Vater wird stolz sein.«
Instinktiv umfasste Tom seinen Arm oberhalb des Verbands, als wollte er nach der Wunde greifen, obwohl er wusste, dass das nicht möglich war. »Woher weißt du davon?«
»Jeder am Hafen weiß davon«, erwiderte Violet. »Es heißt, dass Simon seine besten Männer brandmarkt und sie in der Rangfolge aufsteigen und er ihnen allen besondere Belohnungen zukommen lässt und …«
Er ignorierte sie und sprach mit einer leisen, drängenden Stimme, während er einen angespannten Blick zu den Männern in der Nähe warf. »Ich habe dir doch gesagt, dass du nicht herkommen sollst. Du musst das Schiff verlassen.«
Sie schaute sich um. »Schließt du dich seiner Expedition an? Wird er dir die Leitung einer Grabung überlassen?«
»Das reicht jetzt«, sagte Tom und setzte eine verschlossene Miene auf. »Mutter hat recht. Du bist zu alt hierfür. Mir ständig zu folgen. Meine Kleidung zu tragen. Geh nach Hause.«
Mutter hat recht. Das tat weh. Engländer, die ins Ausland reisten, brachten ihre unehelichen Töchter normalerweise nicht mit zurück nach England. Das wusste Violet dank der Streitereien zwischen ihrem Vater und Toms Mutter. Doch Tom hatte sich immer für sie eingesetzt. Er hatte stets an einer ihrer Locken gezupft und gesagt: »Violet, lass uns einen Spaziergang machen.« Und dann hatte er sie mit zu einem Verkaufsstand genommen und ihr einen heißen Tee und ein Rosinenbrötchen gekauft, während seine Mutter im Haus ihren Vater angeschrien hatte: Warum erlaubst du diesem Mädchen, in diesem Haus zu wohnen? Um mich zu demütigen? Um mich zum Gespött zu machen?
»Aber du hast mir diese Kleidung gegeben«, hörte sie sich sagen, und die Worte wirkten unbedeutend.
»Violet …«, begann Tom.
Später würde sie merken, dass es Anzeichen gegeben hatte – die Männer am Hafen, die angespannten Blicke der Matrosen, die Patrouillen mit den Pistolen, sogar die Anspannung in Toms Miene.
Nun bestand die einzige Warnung jedoch darin, dass Tom ruckartig den Kopf hob.
Ein plötzlicher Ruck erschütterte das Schiff und sorgte dafür, dass sie zur Seite stolperte. Violet hörte, wie ein Schuss erklang, und drehte sich zu dem Matrosen um, der ihn abgefeuert hatte. Sein Gesicht war blass, und seine Pistole zitterte in seiner Hand.
Dann sah sie, worauf er geschossen hatte.
Mithilfe von Enterhaken und Planken stürmten Männer und Frauen in weißer Tracht, die mit Strahlenkränzen versehen war, die Seite des Schiffs. Ihre Gesichter waren erhaben, wie etwas aus einem alten Märchenbuch. Ihre Züge waren ganz unterschiedlich, als stammten sie aus vielen verschiedenen Ländern. Sie schienen aus dem Nebel aufzusteigen und hatten keine modernen Waffen – sie waren wie Ritter mit Schwertern bewaffnet.
Etwas Derartiges hatte Violet noch nie zuvor gesehen. Sie waren wie ein zum Leben erweckter Mythos.
»Stewards!«, schrie eine Stimme und riss sie aus ihrem Tagtraum. Um sie herum brach schlagartig Chaos aus, während sich das unbekannte Wort wie ein Lauffeuer verbreitete. Stewards?, dachte Violet. Der altmodische Name hallte in ihren Ohren wider. Tom und Captain Maxwell reagierten, als wüssten sie, was das bedeutete. Doch die meisten von Simons Männern rannten einfach zu ihren Waffen oder zückten ihre Pistolen und fingen sofort an, auf die Angreifer zu schießen. Das Deck füllte sich mit dichtem Rauch und dem erstickenden Gestank von Schwefel und Salpeter aus den Schusswaffen.
Violet wurde zurückgeschleudert und sah alles als verschwommenes Durcheinander. Drei der Angreifer – Stewards – schwangen sich über den Bugspriet herum nach oben. Einer von ihnen, der Violet näher war, sprang mit sonderbarer Mühelosigkeit über die Reling. Ein weiterer stieß einen der Frachtbehälter, die eine halbe Tonne fassten, mit einer Hand aus dem Weg, was unmöglich war. Sie sind stark, dachte Violet schockiert. Diese Stewards in ihrer weißen Strahlenkranztracht verfügten über eine Stärke und Schnelligkeit, die nicht natürlich waren – nicht natürlich sein konnten. Sie wichen der ersten Salve an Pistolenschüssen aus und stürzten sich in den Kampf. Simons Männer stießen Schreie und Schmerzlaute in den Rauch aus, während die Stewards sie niedermähten …
Sie spürte, wie Tom seine Hand auf ihre Schulter legte.
»Violet.« Die Stimme ihres Bruders klang stark. »Ich werde ihnen hier den Weg abschneiden. Du musst in den Frachtraum gehen und Simons Fracht beschützen.«
»Tom, was ist hier los? Wer sind diese …?«
»In den Frachtraum, Violet. Sofort.«
Schwerter. Niemand benutzt heutzutage noch Schwerter, dachte Violet und beobachtete schockiert, wie ein männlicher Steward mit hohen Wangenknochen seelenruhig den Bootsmann des Schiffs fällte, während eine weibliche Steward mit blondem Haar ihre Klinge in die Brust eines der mit Pistolen bewaffneten Matrosen stieß.
»Findet Marcus!«, befahl die blonde Steward. Die anderen schwärmten aus, um ihren Befehl zu befolgen.
Tom trat vor, um sich ihnen entgegenzustellen.
Violet musste los. Auf dem Deck herrschte ein vollkommenes Chaos aus Bildern und Geräuschen, und das Kampfgetümmel kam immer näher. Doch sie stand wie angewurzelt da.
»Simons Löwe«, sagte die blonde Steward, während ein anderer neben ihr bemerkte: »Er ist bloß ein Junge.«
Löwe?, dachte Violet. Das fremde Wort hallte in ihrem Kopf wider, selbst als sie erkannte, dass sie über ihren Bruder redeten.
Tom hatte sich das Brenneisen geschnappt und hielt es wie eine Brechstange. Inmitten des Pistolenfeuers und der Schwerter sah das töricht aus, doch Tom stellte sich vor die anderen und starrte der Reihe aus Stewards entgegen, als wäre er bereit, es ganz allein mit ihnen aufzunehmen.
»Wenn ihr wisst, dass wir Marcus gefangen genommen haben, dann wisst ihr auch, dass ihr nicht unverwundbar seid«, sagte Tom.
Die blonde Steward lachte. »Denkst du wirklich, dass ein Löwe ein Dutzend Stewards aufhalten kann?«
»Ein Löwe tötete einst Hunderte wie dich«, erwiderte Tom.
»Du bist nicht wie die Löwen von damals. Du bist schwach.«
Das Schwert der Steward blitzte silbern auf, als sie es in einem Bogen schwang. Es ging schnell – so schnell. Violet sah nur eine Sekunde des Schocks auf dem Gesicht der blonden Steward. Dann schlug ihr Tom das Schwert aus der Hand und rammte ihr die grobe Eisenstange in die Brust. Schließlich zog er die Stange wieder aus der Frau heraus und erhob sich, um sich den anderen zu stellen.
Tom war nicht schwach. Er war stark. Tom war schon immer stark gewesen.
Violet starrte ihn an. Auf Toms Gesicht klebte Blut. Auch die Eisenstange und sein weißes Hemd waren mit Blut besudelt, Letzteres so sehr, dass es fast ganz rot war. Mit seinen rotbraunen Locken, die seinen Kopf wie ein Heiligenschein umgaben, sah er tatsächlich wie ein Löwe aus.
Er warf ihr einen einzigen Blick zu.
»Geh, Violet. Ich werde dir nach unten folgen, sobald ich kann.«
Sie nickte blind. Dann setzte sie sich in Bewegung. Sie kroch rückwärts, duckte sich und rannte dann quer über die Planken, während das Schiff erneut erbebte, als wäre es von etwas Schwerem getroffen worden. Über ihr schwankte und wackelte die Takelage. Ein Fass rollte unkontrollierbar über das Deck. Mehr Schüsse ertönten. Violet hob einen Arm an ihren Mund, damit sie nicht an dem Rauch erstickte. Ihre Schuhsohlen schlitterten über das blutgetränkte Deck. Sie erhaschte einen Blick auf Captain Maxwell, der eine Pistole lud. Dann wich sie zur Seite aus, um drei von Simons Männern aus dem Weg zu gehen, die mit einem Steward kämpften. Schließlich ließ sie das Chaos hinter sich und erreichte den Frachtraum.
Als sich die Luke über ihr schloss, durchströmte sie Erleichterung – hier war niemand. Die Geräusche über ihr an Deck klangen gedämpft, all die Rufe und Schreie und das abgeschwächte Krachen von Pistolenschüssen.
Sie bemühte sich, nicht an das Gefühl zu denken, als sich die Türen zum Arbeitszimmer ihres Vaters geschlossen hatten, nachdem man Tom hineingeführt und sie ausgesperrt hatte.
Stewards, so hatte Tom sie genannt. Sie hatten ihn als Löwen bezeichnet. Dieses Wort pochte in ihrem Blut. Sie erinnerte sich daran, wie ein jüngerer Tom eine Kupfermünze mit seinen Fingern zusammengedrückt und ihr gesagt hatte: Violet, ich bin stark, aber du darfst es niemandem verraten.