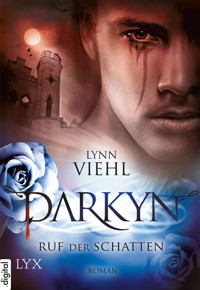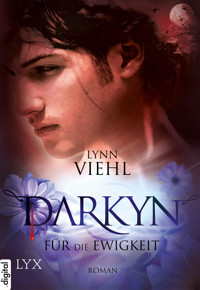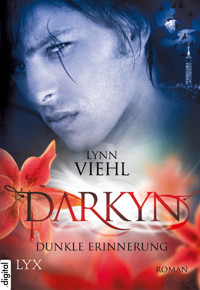9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Darkyn-Reihe
- Sprache: Deutsch
Aufgrund einer schweren Erkrankung hat Jema Shaw nicht mehr lange zu leben. Um sich abzulenken, vergräbt sie sich in ihre Arbeit als Beraterin der Polizei von Chicago. Bei der Untersuchung eines Tatorts wird sie von dem Vampirkrieger Thierry beobachtet, der sie fortan nicht mehr vergessen kann. Thierry gehört zu den Darkyn und ist auf der Suche nach einer Geheimsekte, die ihn einst gefoltert und übel zugerichtet hat. Er glaubt, in Jema den Schlüssel zu seiner Vergangenheit gefunden zu haben und verschafft sich Zutritt zu ihren Träumen. Doch was er in ihrer Traumwelt entdeckt, bricht ihm das Herz ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Titel
Widmung
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Impressum
LYNNVIEHL
IMBANNDERTRÄUME
Roman
Ins Deutsche übertragen von Katharina Kramp
Für Katherine Rose,meine kleine Dämonin
Wo ein blasses Licht einsam branntHaust ein Dämon, den ich gekanntUnd so viele, sie warnen mich, nein, „Das dunkle Haus“, geh nicht hinein. Doch hier, wundert euch nicht, will ich sein.
Edwin Arlington Robinson, The Dark House
1
Schlampe im Lexus. Großartig.
Todd Brackman beobachtete, wie der silberne Geländewagen um die Ecke bog. Die Ampel über der Spur, die für die Kontoinhaber der Bank reserviert war, war bereits vor einer Stunde von Grün auf Rot gesprungen, als die Bank schloss, aber die für den Bankautomaten leuchtete noch immer grün.
Grün für die mit den grünen Scheinen. Brackman wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß vom Gesicht. Komm her und hol mir Geld.
In die Stadt zu fahren und sich auf diesen Job vorzubereiten, hatte ewig gedauert. Brackman hatte sich mit dem Schwitzen, dem Schüttelfrost und dem Fieber abgefunden und jedes Auto beobachtet, weil er wusste, dass es nur einmal funktionieren würde. Er hatte sich den halben Tag lang nicht sehen lassen und hinter dem Müllcontainer der Bank versteckt.
Und jetzt war sie da. Meine Schlampe. Großartig.
Sie gehörte nicht wirklich Todd, aber er kannte Frauen wie sie. Gingen ständig in den Schönheitssalon und kamen mit lackierten Fingernägeln nach Hause. Fuhren zu schnell und jammerten am Telefon, während sie sich noch mehr Bargeld vom Konto holten. Hatte diese nicht ein Telefon am Ohr und einen Klunker an ihrer verheirateten Hand, den er sogar von hier aus sehen konnte?
Anspruchsvolle Möse hätte Todds alter Onkel George sie genannt. Nimmt dein ganzes Geld und lässt dich nicht ran.
Metall schlug auf Metall und ließ Brackman zusammenzucken. Der Wind musste den Deckel des Müllcontainers zugeworfen haben, den er am Nachmittag geöffnet hatte, um sich vor der Sonne zu schützen.
Brackman vergaß das Geräusch und beobachtete den Geländewagen. Er hatte sich schon gedacht, dass sie ihn sehen würde, deshalb machte er sich an dem Baum zu schaffen. Dass er so schwitzte, hätte ihn vielleicht verraten, aber hier ließ es alles so wirken, als sei er tatsächlich beschäftigt.
Als wenn er jemals bereit wäre zu schuften wie ein Landschaftsgärtner.
Todd dachte an seinen Onkel George, der unglaublich viel geschuftet hatte. Der alte Mann hatte kaum genug zu essen gehabt, eine Qualm furzende Chevette gefahren und in einem baufälligen kleinen Wohnwagentrailer auf einem der hinteren Stellplätze im Lake View Trailer Park gehaust. War Todd himmlisch vorgekommen, als er bei George einzog, nachdem seine Eltern ihn rausgeschmissen hatten. Aber dann war ihm aufgefallen, dass sein Onkel viermal die Woche Käse-Nudel-Auflauf aß und nur Spaß hatte, wenn er sich am Wochenende mit Wild-Turkey-Whiskey besaufen konnte. Und was hatte es dem alten George gebracht? Sein Herz hatte ihn im Stich gelassen, vor der Standbohrmaschine, die er bedient hatte, seit Kennedy erschossen worden war.
Das Amphetaminzeug, das Brackman dem alten Mann morgens in die Thermoskanne gekippt hatte, hatte dabei geholfen, aber was blieb ihm anderes übrig, nachdem George ihm angedroht hatte, ihn rauszuschmeißen? Der Trailer war ohnehin zu klein für zwei.
Brackman hatte von seinem Onkel geträumt, als er hinter dem Müllcontainer schlief. Der alte George war wie immer wütend gewesen; nicht weil Todd ihm den Kaffee vergiftet hatte, sondern wegen seines Plans. Er hatte ihm gesagt, er solle niemanden überfallen und bestehlen. Aber der alte Scheißkerl hatte komisch gesprochen und gerochen.
Es ergab keinen Sinn: George war ein dämlicher alter Sack gewesen, aber er hätte sich lieber selbst die Kehle durchgeschnitten, als so ein schwules Parfüm zu tragen wie in dem Traum.
Brackman konzentrierte sich wieder auf den Baum. Scheiß auf George. Das war eine hübsche Idee, wirklich großartig, und wenn nichts schieflief, dann würde er richtig abräumen.
Schweiß tränkte sein O’Malley’s-Lawn-and-Tree-Service-Uniformhemd. Der Name Bobby war auf der Tasche eingestickt, weil Todd sie von Georges altem Nachbarn gestohlen hatte. Das und ein paar Werkzeuge aus dem Anhänger, der an Bobbys rostigem alten El Camino hing. Er hatte kurz überlegt, den Wagen zu klauen, aber diese neugierigen Arschlöcher in Lake View hätten das gesehen und die Bullen gerufen.
Lausiger Job, um Weiber aufzureißen, hatte Bobby mal gesagt, als sie nach einem Paintball-Match ein bisschen Gras geraucht hatten. Beachten mich gar nicht,wenn ich arbeite.
Bobbys viel zu große Uniform hing um Brackman herum. Letztes Jahr hatte Bobby aufgehört mit dem Paintball-Spielen und war ein fauler, fetter Wichser geworden. Er musste der Schnalle, die sich passenderweise All-Night-Lisa nannte, sogar Geld für Sex zahlen. Brackman fand, sich eine Möse zu mieten, solange man eine funktionierende Hand besaß, war so, als würde man Hunderter verbrennen, um es warm zu haben.
Bobby verlor auch den Respekt vor Todd. Warum sagst du ständig »großartig« und »verdammt«? Das klingt behindert. Bobby wollte kein Paintball mehr spielen, und er hatte sich nach Georges Tod schäbig verhalten. Bobby wollte ihm noch nicht mal das leihen, was er für diesen Job brauchte.
Deshalb hatte Todd auch kein schlechtes Gewissen, dass er Bobby heute Morgen mit einem Steakmesser des alten Mannes erstochen hatte.
Die Schlampe hielt vor dem Geldautomaten und stellte die Gangschaltung des Geländewagens auf »Parken«. Brackman blickte hinüber, ohne den Kopf zu drehen. Sie hatte das Handy zur Seite gelegt und durchwühlte suchend ihre Handtasche. Zwei Autos standen an einer Ampel einen Block südlich.
Perfekt. Verdammt großartig.
Brackman lief um den Baumstamm, um näher heranzukommen. Er suchte in seiner Tasche nach dem Paintball und stellte fest, dass seine Sachen total durchnässt waren. Er schwitzte wie ein Schwein; wenn die Schlampe erst die Kohle rausgerückt hatte, dann musste er sofort zu seinem Dealer.
Das Fenster an der Fahrerseite glitt lautlos herunter, und eine gebräunte Hand fütterte den Bankautomaten mit einer Kreditkarte. Die fröhliche Computerstimme begrüßte die Schlampe im Anytime Money Service Center und bat um die PIN-Nummer.
Brackman drückte den dünnen Plastikball so fest, dass er für eine Sekunde glaubte, er würde platzen. Warte, Mann, warte noch. Der Bankautomat gab mehrere gleich klingende Töne von sich, während die Frau die Nummer in das Tastaturfeld eintippte.
Das Servicemenü erschien.
Brackman rannte auf die Fahrerseite, legte die Hand auf die Windschutzscheibe und drückte den Paintball gegen das Glas. Als die dicke weiße Farbe explodierte und die Schlampe kreischte, griff er sich ihr Handgelenk und drückte die fünfunddreißig Zentimeter breite Kettensägenklinge gegen ihren Unterarm. Der kleine Gasmotor der Kettensäge tuckerte im Leerlauf.
Die Augen quollen ihr beinahe aus dem Kopf, als er sich vorbeugte. »Beweg dich«, sagte er zu ihr und drückte die heiße, schmutzige Säge in ihre Haut, »und ich schneid ihn dir ab.«
»Bitte.« Es war nur ein ersticktes Flüstern. »Nicht. Bitte.«
Brackman benutzte seinen Daumen, um eine Eins und fünf Nullen in die Tastatur des Bankautomaten einzugeben. Während das Gerät seine Anfrage bearbeitete, versuchte er, ihr den riesigen Diamantring von ihrem knochigen Finger zu ziehen. »Gib mir den verdammten Klunker.«
Sie benutzte eine Hand, um sich mit ungelenken, hastigen Bewegungen ihre Ohrringe herauszunehmen. »Sie werden so viel nicht kriegen.«
»Du gibst mir alles, was ich haben will.« Er hörte, wie die Automatenstimme irgendetwas sagte, und blickte das Gerät an. »Wo ist die Kohle? Warum kommt sie nicht raus?«
»Sie können noch nicht mal einen Tausender abheben. Das tägliche Limit liegt bei zweihundert.« Sie schnappte nach Luft, und ihre kleinen Titten hoben sich unter ihrer Bluse.
Zweihundert? Dafür bekam er gerade mal vier Joints, und er konnte das Land nicht verlassen. Hier konnte er nämlich auf keinen Fall bleiben. Er blickte in den Lexus und blinzelte, als ein starker, blumiger Duft ihm in der Nase brannte. »Was hast du noch dabei?«
Eine Faust, die aus dem Nichts kam, schlug die Kettensäge vom Arm der Frau weg und aus Brackmans Hand. Brackmans Gesicht knallte gegen die farbverschmierte Windschutzscheibe.
»Connor.« Der Penner benutzte Brackmans Gesicht wie einen Putzlappen, um damit ein Loch in die Farbe zu wischen, bevor er ihn zurückzog. Zu der Schlampe zischte er: »Flieh.«
Reifen quietschten, als die Schlampe davonraste. Brackman spuckte Farbe aus und wischte sich über die Augen, schlug nach dem Penner. Selbst als er wieder sehen konnte, war das Gesicht des Arschlochs von wirren, verfilzten Haaren verborgen.
Saufbruder auf Tour. Brackman fing an zu fluchen, und dann packte ihn der Penner vorne am Hemd. »Hey …«
Die Finger des Penners drückten ihm nicht länger den Hals zu, aber er ließ ihn auch nicht los. In der anderen Hand hielt er ein Messer mit einer komischen Klinge.
»Ich hab dir« – Brackman hustete – »nichts getan, Mann.«
»Die Frau?« Heiße, brennende Augen funkelten. »Hat sie dir was getan?«
Das Arschloch klang komisch. Das Messer, das er wieder in die Scheide gleiten ließ, die an seinem Gürtel befestigt war – das war kein Silber, sondern irgendein dunkleres Metall. Brackman konnte keine anderen Waffen sehen. Vielleicht hatte der Penner sonst keine dabei.
»Schuldete mir Geld.« Er legte in seiner Tasche die Finger um das Steakmesser, an dem noch Bobbys Blut klebte. »Dir geht’s schlecht, stimmt’s?«
»Schlecht.« Die breiten Schultern des Penners sanken nach unten.
Brackman entdeckte die Kettensäge, die in mehrere Teile zerlegt war. »Oh, nein, Mann, was hast du gemacht?« Der Parfümgestank verursachte ihm Übelkeit. »Lass mich los, Mann; du stinkst, verdammt noch mal.«
Die riesige Hand ließ ihn los. »Flieh, Connor.« Als Brackman sich nicht rührte, rief er: »Lauf.«
»Sicher.« Brackman drehte sich zur Seite, um seine Hand zu verstecken, mit der er das Steakmesser aus seiner Tasche holte. Er würde dem Mistkerl, der sich einfach eingemischt hatte, die Kehle durchschneiden. Und was dann? Die Schlampe war weg; die Kettensäge war kaputt. Vielleicht konnte sein Dealer ein paar von Bobbys Sachen gebrauchen. »Großartige Arbeit, Mann.«
Der Penner drehte sich weg.
Brackman sprang auf seinen breiten Rücken und zog ihm die beiden Spitzen des Steakmessers über den Hals. Heißes Blut lief Todd über die Hand. Nachdem er ihm die Kehle aufgeschnitten hatte, rammte er ihm die Klinge seitlich in den Hals. Der Mann hörte auf, sich zu bewegen und stand wie erstarrt, ein Dominostein, der gleich fallen würde.
»Tut’s dir jetzt leid, dass du dich mit mir angelegt hast?«, fragte Brackman an seinem Ohr und drehte das Messer noch mal halb.
»Dass wir uns messen!«
Dreckige Finger legten sich über seine Hand. Brackman schrie auf, als drei seiner Finger brachen, und dann lag er auf dem Rücken, unter den Arm des Penners geklemmt, und alles bewegte sich. Nein, sie bewegten sich. Der Penner trug ihn über den Parkplatz und warf ihn mit Wucht in den Müllcontainer.
Die Mülltüten im Container waren wie ein dickes Kissen, das sich zusammendrückte und seinen Fall bremste. Er spürte den Aufprall kaum. Ich habe ihm doch die Kehle durchgeschnitten. Ich habe ihm verdammt noch mal die Kehle durchgeschnitten.
Brackman hielt die gebrochene Hand gegen seine Brust gepresst und versuchte aufzustehen, aber die Tüten gaben unter ihm nach. Tränen der Wut schwammen in seinen Augen, und seine Nase setzte sich zu. Das Arschloch ruinierte seinen Plan, machte seine Kettensäge kaputt und wollte nicht sterben. Wie unfair war das denn?
»Warum mischst du dich in meine Angelegenheiten, Mann?«, schrie er die Öffnung über ihm an. »Ich habe nichts. Nichts, und du brichst mir einfach mein verdammtes Kreuz.«
Der Container wackelte, als der Penner hineinsprang und über ihm landete. Todd blickte auf, und heiße Nässe breitete sich zwischen seinen Beinen aus, als er in die Hose machte.
Das Steakmesser steckte noch im Hals des Penners. An seiner Kehle war keine Wunde zu sehen. Die dreckige Haut an seinem Hals sah aus, als wäre sie um den Schaft des Messers herumgewachsen.
»Warte.« Dieser Typ war wie einer dieser Zombies aus Dawn of the Dead oder so was. Brackman musste sich aus dieser Sache rausreden, ihn bestechen. Der Wild-Turkey-Vorrat vom alten George. Seine gebrochenen Finger und der angenehme, süße Duft im Müllcontainer machten es ihm schwer, ein Wort rauszubringen. »Sprit. Willst du saufen? Ich habe jede Menge Sprit bei mir zu Hause.«
Der Penner riss sich das Messer aus dem Hals. »Nein.« Das Steakmesser fiel aus seiner Hand auf Todds Brust.
»Dann hilf mir doch, Mann.« Brackman tastete mit seiner gesunden Hand nach dem Messer. »Ich hab echt Schmerzen.« Er krallte seine Hand um den Plastikgriff. »Hilf mir.«
Der große Mann zögerte, dann griff er nach ihm.
»Scheißkerl.« Todd rammte das Steakmesser in seinen Bauch, einmal, zweimal, dreimal. »Jetzt wirst du sterben, verdammt noch mal.«
»Nein.« Unter dem wirren dunklen Haar öffneten sich die aufgeplatzten Lippen des Penners, und etwas Langes und Scharfes glitzerte. »Ich bin bereits tot.« Er beugte sich herunter.
Endlich sah Todd Brackman genau, welche Waffen der Penner dabeihatte, und schrie.
»Miss Shaw?«, rief Thomas, der jüngste Wachmann des Shaw-Museums, während er eine Sackkarre hereinfuhr, auf der eine große Holzkiste stand. Er blickte sich im Labor um.
Jema Shaw stellte den alten Krug mit den zwei Griffen weg, den sie gerade datierte, und wandte sich vom Arbeitstisch ab. »Hier, Tom.«
»Oh. Hey.« Der Wachmann brachte die Holzkiste vorsichtig in eine waagerechte Position. »Gut, dass ich Sie finde. Soll ich das in den Säuberungsraum oder ins Lager bringen?«
»Ins Lager, bitte.« Sie sah einen kleinen Riss in der Handinnenfläche ihres Latexhandschuhs und zog ihn aus, um ihn durch einen neuen zu ersetzen. »Ich packe erst wieder jemand Neues aus, wenn ich mit den Sogdies fertig bin.« Sie wandte sich wieder dem Krug zu.
»Dann ist es ja gut, dass er schon tot ist, hm?« Thomas kam herüber und sah über Jemas gebeugte Schulter. Auf dem mit einem Baumwolltuch bedeckten Tisch lagen alle möglichen weichen Pinsel, Nadeln und Glasphiolen. Eine große, an einem ausfahrbaren Arm befestigte Linse vergrößerte das dunkle Orange des Tonkrugs, der einen Sprung hatte, aber ansonsten intakt war, abgesehen von einem Stück abgebrochenem Rand. »Ich dachte, das Museum stellt griechische Sachen aus, und nichts von den Saudis.«
»Sogdies, kurz für Sogdier«, korrigierte sie ihn. »Das war ein rebellischer griechischer Stamm, der in den Bergen im Norden von Afghanistan lebte.« Jema benutzte einen kleinen Pinsel, um einige Sandkörner zu entfernen, die in der seitlichen Bordüre des Kruges steckten. »Wo jetzt Usbekistan liegt.«
»Usbekistan.« Thomas runzelte die Stirn. »Genau.«
»Einer der Rebellenführer der Sogdier, Oxyartes, hielt dem Angriff einer feindlichen Armee stand, die von Alexander dem Großen angeführt wurde. Er konnte nicht geschlagen werden, und er wollte nicht aufgeben, bis Alexander bereit war, seine Tochter zu heiraten. Das hier gehörte vielleicht Oxyartes’ Feldherrn. Sein Zeichen sah aus wie das hier.« Sie fuhr mit der Fingerspitze durch die Luft über die stilisierte Tierfigur, die in die Seite des Kruges geritzt war.
Thomas beugte sich weiter vor und blinzelte. »Ist das ein Wolf?«
»Ein Wolf oder ein großer Hund. Es repräsentiert vielleicht einen der persönlichen Götter des Feldherrn. Ich glaube nicht, dass er ein Einheimischer war. Sogdier waren auch sehr tolerant gegenüber anderen Religionen. Eine unglaublich fortschrittliche Kultur für ihre Zeit.« Jema warf dem verwirrten jungen Wachmann einen Seitenblick zu. Seit Usbekistan konnte er ihr offensichtlich nicht mehr folgen. »Soll ich Ihnen noch was über das Leben in der Garnison des Feldherrn in Kurgan-Tepe erzählen? Ich habe ein paar Dutzend Speerstiele und Pfeilspitzen, die ich als Nächstes datieren muss.«
Seine Augen weiteten sich, und er machte einen Schritt zurück. »Ich wünschte, das ginge, Miss Shaw, aber ich muss meine Runde machen.« Er rückte den Gürtel auf seinen dünnen Hüften zurecht und nickte zur Uhr über der Werkbank. »Is’ auch schon reichlich spät für Sie, oder?«
Jema blickte auf die Uhr, 18 Uhr 57, was bedeutete, dass das Museum seit drei Stunden geschlossen hatte und vor siebenundfünfzig Minuten im Shaw-Haus das Essen serviert worden war. Verdammt. Hatte ihre Mutter heute Abend jemand Wichtiges eingeladen? »Ja.« Wenn es so war, dann hätte sie schon angerufen und mich strammstehen lassen. »Ich bin gleich fertig.«
»Noch eine Sache«, sagte er mit einem ernsten Ausdruck auf seinem jungen Gesicht, »Sie sollten auf dem Weg nach Hause an keinem Bankschalter vorbeifahren.«
Das war eine so merkwürdige Bitte, dass Jema beinahe lachte. »Warum nicht?«
»Wegen dieses Straßenräubers. Hat eine Kettensäge benutzt, um eine Lady auszurauben, als sie an einem Bankschalter hielt.« Er nannte eine Bank zwei Blocks vom Museum entfernt. »Sie ist davongekommen, aber die nächste hat vielleicht nicht so viel Glück.«
Jema schluckte. Toms Warnung rief ihr ein Bild von einem dunklen, runden Gesicht, wunderschönen braunen Augen und einem schüchternen Lächeln ins Gedächtnis. Luisa Lopez, die halbtags als Reinigungskraft im Museum gearbeitet hatte, war vor einem Jahr das Opfer eines genauso brutalen Überfalls während eines Einbruchs geworden. Luisa hatte nicht so viel Glück gehabt davonzukommen; sie lag noch immer im Krankenhaus und erholte sich von den Verletzungen, die sie hätten umbringen sollen.
Luisa hatte kein schüchternes Lächeln mehr, aber die Ärzte ersetzten allmählich die verbrannte Gesichtshaut. Irgendwann würden sie dazu kommen, ihre Lippen zu rekonstruieren.
Jema besuchte Luisa jede Woche, doch die junge Frau sprach kaum je oder nahm ihre Anwesenheit zur Kenntnis. Verbände bedeckten die braunen Augen, während die neuen Lider heilten, die man ihr transplantiert hatte. Luisa war jedoch von dem Feuer geblendet worden, das sie umbringen sollte, und würde niemals wieder jemanden sehen.
»Schönen Abend noch«, meinte Thomas. Er schob die Sackkarre in den Flur, der ins Museumslager führte.
Jema schob die Gedanken an Luisa beiseite, während sie den sogdischen Krug sorgfältig wieder verpackte. Sie stellte die Kiste auf ihr In-Arbeit-Regal und beschloss, zu Hause anzurufen und die notwendigen Entschuldigungen hinter sich zu bringen.
Ursprünglich war Jemas Büro ein Abstellraum gewesen, und es hing immer noch der Geruch von Bohnerwachs und nassen Wischmopps in der Luft. Mit zwei Meter fünfundsiebzig mal zwei Meter zehn wäre es als Gefängniszelle kaum durchgegangen, aber es bot genug Raum für einen Tisch und Regale für ihre Nachschlagewerke. Sie musste niemanden mit ihrem Büro beeindrucken – keine Aufsichtsräte oder Würdenträger fanden je den Weg hierher. Sie fielen in das Aufgabengebiet ihrer Mutter. Jemas Territorium war das Labor, wo sie derzeit damit beschäftigt war, die Bestände des Museums zu datieren und zu katalogisieren.
Du bist sehr empfindlich, hatte Meryl Shaw gemeint, als Jema vorgeschlagen hatte, aus dem Keller nach oben zu ziehen, um die Angestellten des Museums bei den Ausstellungen und Führungen zu unterstützen. Dukannst nicht riskieren, mit so vielen Menschen in Kontakt zu kommen.
Jema stellte den kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher an, der auf dem Büffet stand, und schaltete die Nachrichten ein. Sie hasste die Einsamkeit der Arbeit im Museumskeller, aber sie liebte ihren Tisch, einen verzierten kleinen antiken Schreibtisch, an dem irgendeine viktorianische Lady früher Einladungen zum Tee und zu Bällen geschrieben hatte. Anstatt in Richtung Tür stand der Tisch an der Wand. Das Büro hatte kein Fenster, aber unter dem Lüfter der Klimaanlage hingen ihre Diplome, Auszeichnungen und Zertifikate, zusammen mit ihrem Lieblingsgemälde, in einem schlichten schwarzen Holzrahmen.
Im Fernsehen stand ein Reporter vor einem kleinen Bankgebäude und beendete eine Livereportage. »Die Leiche des Verdächtigen Todd Brackman wurde im Müllcontainer der Bank gefunden. Bei der Polizei läuft derzeit eine Großfahndung nach einem noch nicht identifizierten Mann, der vielleicht Brackmans Komplize war. Brackmans Nachbar Robert Pechowsky, ein Mitarbeiter von O’Malley’s Lawn and Tree Service, wurde heute ebenfalls erstochen aufgefunden. Wir halten Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Spencer Holt, Channel Five News.«
Jema schaltete den Fernseher aus und rieb sich die müden Augen, während sie versuchte, nicht an Luisa zu denken. Als sie sich wieder ihrem Schreibtisch zuwandte, sah sie den Telefonhörer auf der Schreibtischunterlage liegen und stöhnte auf. Sie musste vergessen haben, ihn aufzulegen, nachdem sie vorhin einen Anruf von der Eventmanagerin bekommen hatte. Ich muss das endlich lassen.
Das kleine rote Licht der Voicemail blinkte, deshalb legte sie den Hörer auf, stellte das Telefon auf Lautsprecher und drückte die PIN zum Abhören.
»Guten Abend, Shaw-Museum-Nutzer«, sagte die automatische Computerstimme, »Sie haben eine neue Nachricht von« – es entstand eine Pause für die Identifikation der Anruferin, die mit einer sehr viel kühleren Stimme sagte – »Jema, du bist zu spät.« Nach einer zweiten Pause fuhr das automatische System fort: »Um die Nachricht noch einmal anzuhören …«
»Schon gut.« Jema drückte die Lautsprechertaste. »Ich höre das noch früh genug, wenn ich nach Hause komme.«
Sie räumte das Labor auf und ging noch einmal in die winzige Toilette, um sich eine Insulininjektion zu setzen. Sie war froh, dass sie sich immer jeden Tag zur gleichen Zeit spritzen konnte; vielen Diabetikern ging es nicht so gut wie ihr, und sie mussten ständig ihren Blutzuckerwert messen. Jema bekam seit ihrer Geburt Insulin, deshalb waren Nadeln kein Problem, aber sie hätte den Gedanken gehasst, niemals zu wissen, wann sie eine Spritze brauchte.
Jema ging nach oben und in den Hauptausstellungsraum des Museums. Obwohl ihr Vater James Shaw das Shaw-Museum bauen ließ, um darin die Artefakte auszustellen, die er sein Leben lang in Übersee ausgegraben hatte, hatte Jema das riesige Gebäude nie gefallen. Der glänzende importierte Marmor und die gewaltigen griechischen Säulen waren unglaublich ehrwürdig, aber sie erinnerten sie eher an ein Mausoleum als an ein Museum.
Auf eine Art hatte das Museum ihren Vater kurz nach Jemas Geburt umgebracht.
Sie blieb vor dem Büro des Sicherheitsdienstes stehen, wo der Leiter der Nachtschicht das computergesteuerte Sicherheitssystem von der Hauptkonsole aus hochfuhr. »Gute Nacht, Roy.«
»Miss Shaw.« Er fuhr erschrocken herum. »Ich wusste nicht, dass Sie noch da sind.«
Wusste das überhaupt jemand außer ihrer Mutter? »Bis morgen.« Sie lächelte und lief dann zum Seitenausgang.
»Ich begleite Sie nach draußen.« Roys fünfzehn Kilo Übergewicht ließen ihn keuchen, als er sie einholte. »Haben Sie von dem Schei… – äh, von dem Vorfall in Grandview gehört?«
»Tom hat es erwähnt.« Sie wartete, während er aufschloss und ihr dann die Tür aufhielt. »Diese arme Frau. Sie muss schreckliche Angst gehabt haben.«
»Sie hatte Glück. Chicago ist voller Junkies und Obdachloser.« Roy trottete neben ihr über die kurze Treppe auf den Angestelltenparkplatz. »Die Polizei sollte unsere Steuern sparen und sie erschießen, anstatt sie zu verhaften.«
»Das meinen Sie nicht so«, schimpfte Jema.
»Gute Sache, dass Sie mich keine Waffe tragen lassen.« Roy blickte in das Fenster von Jemas Mercedes Cabriolet, bevor er zusah, wie sie die Tür aufschloss. »Sie fahren direkt nach Hause, Miss Shaw.«
Hielt sie denn jeder für hilflos? Jema dachte an ihre Mutter, und ihre Wut verebbte. »Das mache ich, Roy, danke.«
Die Fahrt vom Museum nach Shaw House dauerte normalerweise zwanzig Minuten, aber Jema beeilte sich nicht. Sie musste noch ihre Entschuldigung üben, bevor sie zu Hause ankam.
»Tut mir leid, dass ich zu spät komme, Mutter«, erklärte Jema dem Lenkrad. Nein, das klingt zu fröhlich. »Es tut mir so leid, dass ich zu spät komme. Schon wieder zu spät komme. Entschuldige, Mutter. Entschuldige, dass ich das Essen verpasst habe.«
Jema würde nicht viel verpasst haben. Ihren Blutzucker unter Kontrolle zu behalten, erforderte eine strikte Diät, und die Köchin kochte ihr andere Mahlzeiten als die, die von Meryl Shaw und ihren Gästen gegessen wurden. Es spielte keine wirkliche Rolle, was sie aß oder ob sie überhaupt etwas aß; ihre Mutter erwartete einfach, dass sie am Tisch saß. In Meryls Augen war Pünktlichkeit eine Höflichkeit und Säumigkeit eine absichtliche Beleidigung.
Ichweiß, dass du nicht absichtlich unhöflich sein willst, hatte ihre Mutter beim letzten Mal gesagt, als sie so spät nach Hause gekommen war, aber du solltest auch mal an mich denken. Wenn du nicht pünktlich kommst, mache ich mir Sorgen, dass dir was passiert ist.
»Ich wurde bei der Arbeit aufgehalten – nein, nicht die Arbeit erwähnen; das hasst sie«, murmelte sie leise, bevor sie mit ihren Proben fortfuhr. »Es war rücksichtslos von mir. Ich war rücksichtslos. Dir gegenüber. Es tut mir leid, dass ich so rücksichtslos war, Mutter.« Sie machte ein finsteres Gesicht. »Ich klinge, als wäre ich zwölf. Ich benehme mich, als wäre ich zwölf.«
Jema wusste nicht, warum sie sich genötigt fühlte, Entschuldigungen zu üben, bevor sie sie vorbrachte. Was immer im Auto aufrichtig und akzeptabel klang, würde völlig unangemessen sein, wenn sie es Meryl Shaw in ihr ausdrucksloses Gesicht sagte. Dennoch versuchte Jema jedes Mal, wenn sie etwas Gedankenloses tat, wenigstens reuevoll zu klingen. Sie wusste, dass sie eine riesige Enttäuschung für ihre Mutter war; sie wollte es nicht noch schlimmer machen.
»Wenn du es mit Überzeugung sagst«, erklärte Jema dem Armaturenbrett, während sie durch die schwarzen schmiedeeisernen Tore fuhr, die alle abhielten, die neugierig waren oder sich verfahren hatten, »vielleicht glaubt sie dir dann.«
Sie blickte zum Haus und erhaschte einen Blick auf ihr Gesicht im Rückspiegel. Ein oval geformtes Auge und ein Stück der Stirn. Hager, blass, mitleiderregend, aber zumindest war es da. Sie wandte sich ab, bevor sie mehr sah. Sie hasste Spiegel.
Der akute Diabetes saugte ihr seit ihrer Geburt das Leben aus, aber jetzt schien er sie regelrecht zu verzehren.
»Es tut mir nicht leid.« Jema war heiß und schwindelig. Sie lehnte sich vor und berührte mit der Stirn das kühle Leder des Lenkrades. »Es ist mein Leben. Lass es mich leben.«
Das zu Meryl zu sagen, die Jema seit neunundzwanzig Jahren am Leben hielt, wäre für sie wie ein Schlag in den Magen.
Selbstmitleid kam nicht infrage, deshalb richtete sich Jema auf, drückte auf die Fernbedienung, die an ihrer Sonnenblende befestigt war, und fuhr durch das breite Eisentor, als es sich öffnete. Sie parkte neben der Garage, in der der imposante Rolls-Royce ihrer Mutter stand, und ging durch den Kücheneingang ins Haus. Die Köchin hatte bereits aufgeräumt und war gegangen, aber Jema konnte zwei Stimmen aus dem Wohnzimmer hören und folgte ihnen.
»Ich bin nicht an deiner Meinung interessiert, Daniel. Ich bezahle dich als Arzt«, sagte Meryl Shaw mit sachlicher Stimme. »Nicht als Familientherapeuten.«
Jema blieb im Flur stehen und lauschte.
»Soll ich dir erklären, wie sich mentaler Stress auf den Körper auswirkt?« Dr. Daniel Bradford klang genauso sachlich und kontrolliert, aber Zuneigung machte seine Stimme wärmer als Meryls. »Du kannst Jema nicht einsperren. Sie braucht ihre Arbeit und ein gewisses Maß an Freiheit.«
»Ich entscheide, was Jema braucht«, erklärte Meryl leise. »Nicht du und auch sonst niemand.« Sie hustete mehrmals. »Ich habe Schmerzen in der Brust.«
Und wieder die üblichen Brustschmerzen. Jema lehnte sich gegen die Wand und schloss die Augen.
Es entstand ein Schweigen, und dann sprach Dr. Bradford, diesmal viel weicher. »Du weißt, dass es dein Magengeschwür ist, nicht dein Herz. Diese Wut macht es nur schlimmer. Nein«, sagte er, als Meryl etwas murmelte, »das wirst du nicht. Trink das, um deinen Magen zu beruhigen, und dann bringe ich dich nach oben.«
Der auf stumm geschaltete Pieper, den Jema trug, begann zu vibrieren – eine wütende Biene, die in ihrer Tasche gefangen war. Sie sah auf das Display, aber eigentlich wusste sie, was dort stand. Der andere, geheime Teil ihres Lebens rief sie.
Sie sah zur Tür, steckte den Pieper wieder ein und entfernte sich vom Wohnzimmer. Als Jema vom Herrenhaus wegfuhr, sah sie nicht zurück. Sie bemerkte die geduckte Gestalt des Mannes nicht, der aus der Dunkelheit trat, als sich die Tore von Shaw House schlossen.
Der Mann hob das Walkie-Talkie in seiner Hand und sprach hinein. Das Licht von den Torlampen ließ den polierten schwarzen Kamee-Ring glänzen. »Miss Shaw hat das Grundstück verlassen.«
Die Antwort kam sofort und knapp. »Folge ihr.«
2
Valentin Jaus hob sein Langschwert über den Kopf, sodass sich die Klinge hinter seinem Rücken befand. Sein Gegner und Seneschall Falco Erhart umrundete ihn links, anstatt die Öffnung auszunutzen. In den hohen Spiegeln an der Wand hinter ihnen bewegten sich ihre Spiegelbilder, ein großer, dunkelhaariger Goliath gegen einen kleinen, blonden David.
Obwohl Jaus der Meister von Falco, Derabend Hall und allen war, die sie beobachteten, war er in diesem Kampf nicht Goliath.
»Zornhau«, sagte die trockene Stimme von Jaus’ Tresora Gregor Sacher von der Seite. Der Trainingsraum, bekannt als Turnierplatz, war so groß, dass jede Stimme hallte – jedenfalls dann, wenn aneinanderschlagende Klingen sie nicht übertönten. Er murmelte zu dem Jugendlichen, der neben ihm stand: »Achte darauf, wie der Meister die spanische Arrebatar-Technik ausnutzt, was einem Fechtmeister erlaubt, mit dem ganzen Arm zu schlagen.«
»Falco nutzt die Öffnung nicht, um anzugreifen, Opa.« Wilhelm Sacher beobachtete beide Männer mit großen Augen. Als Tresora in der Ausbildung war es ihm gestattet, den Großteil von Jaus’ Leben innerhalb von Derabend Hall zu beobachten. »Er geht zur Seite.«
»Ein erfahrener Schwertkämpfer lässt sich nicht locken«, erklärte Sacher dem Jungen. »Falco benutzt das Überlaufen, um sich dem Angriff zu entziehen und herauszufinden, welche Schwächen der Angriff eröffnet.«
Jaus hätte die Bewegung zu Ende geführt und die flache Seite des Schwerts auf Falcos Schulter geschlagen, wenn sein Seneschall leichtsinnig genug gewesen wäre, auf seinen Trick hereinzufallen. Ungeschicktes Verhalten zu tolerieren, lief dem Sinn der Übungskämpfe entgegen. Falco jedoch machte kaum je Fehler und kannte Jaus besser als jeder andere Mann im Jardin. Er besaß außerdem den Vorteil, größer zu sein und längere Arme zu haben, und nutzte ihn.
Dennoch hatte Falco seinen Meister noch nie geschlagen. Jaus dominierte ihre Kämpfe nicht, weil er stärker war, sondern weiser. Seine Erfahrung war zehnmal so groß wie die seines Seneschalls.
Außerdem erlaubte sich Valentin Jaus nicht mehr, Kämpfe zu verlieren.
Als zweiter Sohn eines wohlhabenden und einflussreichen Barons war Valentin durch ganz Europa geschickt worden, um bei spanischen, englischen und französischen Meistern zu trainieren. Mit der Zeit hatte er ihre Techniken in seinen Kampfstil aufgenommen. Seine ursprüngliche Ausbildung in Österreich hatte mit den »drei Wundern« angefangen, den drei Hauptangriffen der deutschen Meister, aber er hatte sich niemals auf diese beschränkt. Es gab auch außerhalb der europäischen Fechtschulen so viel zu lernen; seinerzeit war Jaus an Orte wie Russland gereist, um von den Kosaken zu lernen und in Japan von den Samurai.
Es half, dass Jaus kein Mensch war. Genauso wenig wie alle anderen auf dem Turnierplatz, abgesehen von Sacher und Wilhelm, die die schwarzen Kamee-Ringe der Tresori trugen, der Menschen, die den Darkyn dienten.
»Warum kämpfen sie mit Schwertern mit Kupferspitze, Opa?«, fragte Wilhelm. »Du hast gesagt, es sei das einzige Metall, das die Haut der Vrykolakas durchdringen und ihr Blut vergiften kann. Wäre es nicht sicherer, einfachen Stahl zu benutzen?«
»Unser Meister benutzt die gleichen Waffen wie unsere Feinde«, sagte Sacher. »Mit weniger Gefährlichem zu trainieren, würde sie nicht gut genug vorbereiten. Es gibt Wege, wie man die Darkyn mit einfachem Stahl oder anderen Metallen verletzen kann, aber darüber sprechen wir ein anderes Mal.«
Falco achtete nicht auf das Gespräch zwischen dem Tresora und dessen Enkel. Er konzentrierte sich auf Jaus und griff von links an – was er mit enormer Geschwindigkeit tat und was eine zweite, nicht zu verteidigende Lücke hätte öffnen müssen. Doch Jaus erahnte den Gegenangriff und benutzte den Parier-Dolch in seiner linken Hand, um Falcos Schwert abzufangen.
»Spade e pugnale«, rief Sacher aus, bevor er Wilhelm zuflüsterte: »Jetzt wird der Meister seine Kriege benutzen.«
Bevor der alte Mann zu Ende gesprochen hatte, entwaffnete Jaus seinen Seneschall mit seinem Parier-Dolch. Als Falcos Schwert über den polierten Eichenfußboden rutschte, drückte Jaus die Spitze seiner Klinge gegen die nackte Brust des Seneschalls und ritzte die Haut, ohne dass Blut floss.
»Nachreißen. Mit dem Schwert«, sagte Sacher wieder laut. »Zielen, Oberhau und Sieg.«
Die Männer am Rand, die während des Kampfes schweigend und bewegungslos dagestanden hatten, entspannten sich. Diejenigen, die wussten, dass sie irgendwann Falcos Platz einnehmen und Jaus’ Gegner sein würden, tauschten entmutigte Blicke. Der Seneschall war ein mutiger und geschickter Schwertkämpfer, aber der Suzerän ihres Jardin focht, als flösse Eis in seinen Adern.
Jaus blieb stehen, ließ das Schwert, das auf das Herz des anderen Mannes gerichtet war, jedoch sinken. »Heute Abend warst du nicht schnell genug.«
»Ich war noch nicht jagen.« Falko machte einen plötzlichen Ausfallschritt und ließ ein paar Zentimeter des kupferüberzogenen Stahls in seine Haut eindringen. Als Jaus’ Handgelenk nach hinten schoss, um das Schwert herauszuziehen, rieb der Seneschall mit der Hand über sein Blut und ließ es die Zuschauer sehen. »Was versehrt, das lehrt.«
Leiden schult uns.
»Genauso wie Training.« Jaus sah zu, wie sich die Wunde auf Falcos Brust schloss, noch bevor er sein Langschwert Sacher übergeben und eine dunkelblaue Robe von ihm entgegengenommen hatte. Er bemerkte Wilhelms Pupillen, die erweitert waren, und seinen Mund, der leicht offen stand. »Wilhelm?«
»Kamelien«, murmelte der Junge und starrte Jaus an. »So viele.«
Jaus schlüpfte in die Robe, die ein wenig den attrait überdeckte, jenen blumigen, hypnotisierenden Duft, den sein Körper produzierte. »Hans, bring unseren jungen Freund nach draußen an die frische Luft.«
Einer der Männer kam und führte den widerstandslosen Teenager zu einem nahe gelegenen Ausgang.
»Entschuldigt den Jungen, Meister«, sagte Sacher, während er mit einem weißen Taschentuch das Blut von Jaus’ Klinge abwischte. »Er hat noch keine Immunität entwickelt.«
»Vielleicht sollten wir in ein Paar Nasenstöpsel investieren.« Zu den Männern des Jardin, die den Kampf beobachtet hatten, sagte er: »Benutzt hart und weich – Schwäche gegen Stärke, Stärke gegen Schwäche –, und ihr findet die Balance, mit der ihr alles kontrollieren könnt.«
Sacher presste die Hand seitlich an seinen Kopf und bedeckte den kleinen Übertragungssender in seinem Ohr. Dann murmelte er zu Jaus: »Ein Anruf von Cyprien im Haupthaus.«
Jaus hatte nicht mehr mit seinem alten Freund und Gegner Michael Cyprien gesprochen, seit dieser von Richard Tremayne, dem Highlord der Darkyn, zum Seigneur aller amerikanischen Jardins ernannt worden war. Er hatte Michael schon vor seiner Einsetzung die Treue geschworen, und er würde seinen Schwur halten, ganz egal, was es kostete.
Weil er Michaels Entschlossenheit kannte, die Darkyn aus dem Mittelalter ins einundzwanzigste Jahrhundert zu führen, nahm Jaus an, dass die Kosten durchaus spürbar sein würden.
»Das wird dauern«, sagte Jaus zu seinem Seneschall. »Mach Ausdauertraining mit den Männern, bis ich wieder zurück bin.« Er verließ mit Sacher und seinen Wachen den Turnierplatz und ging über das Grundstück hinüber zum Haupthaus. »Abgesehen von seiner fehlenden Immunität gegenüber l’attrait scheint dein Enkel sich gut einzugewöhnen, Gregor.«
»Wenn Ihr damit meint, dass er mir jeden Tag tausend Fragen über die Darkyn stellt, dann ja, das tut er«, antwortete Sacher. Sein Lächeln schwand. »Er erinnert mich so sehr an Kurt in dem Alter.«
Kurt Sacher, Wilhelms Vater, hatte seit seiner Kindheit in Jaus’ Haus gelebt. Wie es bei den Tresori üblich war, hatte Gregor seinen Sohn ausgebildet, damit dieser eines Tages seinen Platz einnehmen konnte. Kurt war mit den Darkyn aufgewachsen und willens gewesen, dem Jardin zu dienen. Dann kam jene schreckliche Nacht, in der Kurt nicht von einem Ausflug in die Stadt zurückgekehrt war. Die Polizei erklärte Gregor, dass sein Sohn während eines versuchten Raubüberfalls erschossen worden war. Kurts Frau Ingrid bekam Depressionen und nahm drei Monate nach Kurts Beerdigung eine Überdosis Schlaftabletten.
Der plötzliche Verlust hatte Sacher, einen Witwer ohne weitere Verwandte, verzweifeln lassen. Eine Zeit lang hatte Jaus befürchtet, seinen treuesten Diener auch noch zu verlieren, und angeboten, Sacher aus dem Tresori-Schwur zu entlassen, damit er den schmerzhaften Erinnerungen entfliehen konnte, die ein Leben mit den Darkyn für ihn bedeuten musste. Aber es war Kurts und Ingrids verwaister Sohn Wil gewesen, der seinen Großvater davon abgehalten hatte, sich aufzugeben, und Gregor wollte Wils Zukunft nur Jaus anvertrauen.
Ich kann nicht ewig für ihn da sein, Meister, hatte Sacher zu Jaus gesagt, als er Wilhelm nach Derabend Hall brachte. Das könnt nur Ihr.
Auf dem Weg ins Haupthaus bemerkte Jaus, dass die rechte Hand des alten Mannes mit einem fleischfarbenen Verband umwickelt war, und erinnerte sich an den kleinen Unfall in der Küche, der die Wunde verursacht hatte. »Diese Verbrennung ist noch nicht verheilt.«
»Nein, aber das wird sie, Meister.« Sacher steckte die verletzte Hand in seine Tasche. »Gebt einem alten Mann Zeit.«
Jaus fragte sich, wie viel sie davon noch haben würden. Gregor diente ihm seit sieben Jahrzehnten als Tresora, seit er während der Besetzung Österreichs durch die Nazis seine Eltern verloren hatte. Tresori schworen, dem Jardin bis zu ihrem Tod zu dienen, aber in einem gewissen Alter war eine Pensionierung normalerweise unumgänglich.
War die Zeit so schnell gekommen?
Jaus blieb stehen und legte dem alten Mann eine Hand auf die Schulter. Der Duft von Kamelien erfüllte die Abendluft. »Warum warst du noch nicht bei einem Arzt?«
»Mein Arzt trägt eine Zahnspange«, erklärte Sacher milde. »Ich bin nicht sicher, ob er die Pubertät schon hinter sich hat. Solche Dinge lassen mich an seinem Urteilsvermögen zweifeln.« Er blickte auf Jaus’ Hand. »Ihr hättet einfach nur zu fragen brauchen, Meister.«
»Vergib mir. Ich mache mir Sorgen um dich.« Jaus nahm die Hand weg, um den Code in das Tastenfeld der Alarmanlage einzutippen, die das elektronische Schloss öffnete. Einer der vier Leibwächter, die sie begleiteten, öffnete die Tür, während zwei sich seitlich von ihm aufstellten. »Es ist schade, dass Cypriens Quacksalberin bei ihm in New Orleans ist. Sie ist eine talentierte Heilerin.«
»Diese Frau.« Gregor seufzte und schüttelte den Kopf. »Sie macht mir mehr Angst als der Arzt mit der Zahnspange.« Er sah auf seine Uhr. »Ich werde Wilhelm jetzt reinholen und an seine Hausaufgaben setzen. Ich hoffe, sein Kopf ist jetzt klar genug zum Rechnen, denn meiner wird das, fürchte ich, niemals sein.« Der alte Diener verbeugte sich und ließ Jaus allein.
Valentin ging durch das kühle weiße Licht und die nüchternen Schatten seines Hauses. Er hatte drei verschiedene Baufirmen damit beauftragt, das verfallene Herrenhaus aus dem achtzehnten Jahrhundert abzureißen, das zuvor auf dem Seegrundstück gestanden hatte, und sie Derabend Hall dann nach seinen eigenen Plänen bauen lassen. Der Verlust des historischen Gebäudes hatte die Stadt und seine reichen Nachbarn zuerst aufgebracht, bis der Ersatz sich aus der Asche erhob. Derabend Hall, ein riesiges Schloss aus schwarzem Granit und grauem Schiefer, dominierte die Landschaft. Das fertige Gebäude sorgte dafür, dass Chicagos Elite Valentin als Architektur-Rebellen und Visionär feierte.
Niemand merkte, dass er einfach nur eine moderne Version der alten Familienburg im österreichischen Tirol nachgebaut hatte. Das Original, Schloss Jaus, war schon lange verschwunden, von Napoleons Armee zur Ruine gemacht und durch viele Kriege und die Zeit zu Staub zerfallen.
Bunte Farben und fröhliche Muster und der meiste Plunder der modernen Zeit nervten Jaus, deshalb hatte er einige Innenarchitekten damit beauftragt, sein neues Zuhause spartanisch in Schwarz, Weiß und Silber einzurichten. Einer der Innenarchitekten veröffentlichte Fotos der schlichten Räume von Derabend Hall, was einen minimalistischen, farblosen Trend in der Inneneinrichtung auslöste, der sich im ganzen Land ausbreitete. Erst da hatte Jaus aufgehört, Menschen außerhalb des Jardin damit zu beauftragen, seine Wünsche umzusetzen, da die Aufmerksamkeit seinen bereits nervösen Jardin richtig paranoid werden ließ.
Das einzige Farbzugeständnis, das sich Jaus erlaubte, war das Mitternachtsblau in seinem Schlafzimmer und seinem Büro. Letzteres war ein großer und funktioneller Arbeitsraum, in dem die neueste Technik im Bereich der Informationsverarbeitung und der Datenspeicherung stand. Seine Computerdatenbank, ein Prototyp, der für ihn persönlich von einem Milliardär-Software-Mogul entworfen worden war, sammelte Daten aus hundert verschiedenen Quellen für Analysen und konnte für ihn jede Person, die ihn interessierte, finden und überwachen.
Informationen waren das Schild des modernen Mannes. Je mehr man davon besaß, desto besser geschützt kämpfte man.
Jaus öffnete seinen Hauptbildschirm und nahm gleichzeitig den Hörer in die Hand und schaltete die Leitung frei, die die ganze Zeit über gehalten worden war. »Seigneur Cyprien, was für eine unerwartete Ehre.«
»Suzerän Jaus, die Ehre ist ganz meinerseits«, sagte Michael, »über Zeit verfüge ich jedoch nicht.«
»Dann lasst uns direkt über Euer Anliegen sprechen.« Jaus setzte sich in seinen Lieblingsledersessel. »Womit kann ich Euch dienen, mein Lord?«
»Einer von Jofferoins Spähern hat Thierry Durand vor sechs Tagen in Memphis gesichtet. Der Späher versuchte, ihm zu folgen, hat ihn jedoch am Copley Square verloren.« Michael hielt inne. »Offensichtlich benutzt er die Obdachlosen und Unglücklichen als Tarnung.«
Jaus erinnerte sich an Cypriens Beschreibung der Verletzungen, die Durand von der Bruderschaft beigebracht worden waren, einer Organisation von ehemaligen Priestern, die die Darkyn jagten, folterten und töteten, seit sie Vrykolakas geworden waren. »Ist er immer noch in diesem Zustand? Ich dachte, Dr. Kellers Behandlung sei erfolgreich gewesen.«
»Sie hat die Schäden an seinem Körper beseitigt, nicht aber jene an seinem Verstand«, sagte Michael zu ihm. »Thierry hatte einen kurzen Moment der Klarheit, als er genau wie wir entdeckte, dass Angelica die Verräterin unter uns war. Ich fürchte, dass der Verrat seiner Frau seitdem zu Ende gebracht haben könnte, was die Brüder begonnen haben.«
»Wenn er sich tarnen und den Spähern ausweichen kann, dann ist er nicht völlig verrückt.« Jaus rief eine Landkarte der Vereinigten Staaten auf und zog eine Linie von der Stadt New Orleans nach Memphis. Die Richtung war unverkennbar. »Ihr glaubt, er kommt hierher nach Chicago.«
»Als Thierry New Orleans verließ, nahm er die Akte mit den Informationen mit, die Ihr über die Männer gesammelt hattet, die für den Angriff auf Alexandras Patientin Ms Lopez verantwortlich waren«, sagte Michael. »Vielleicht sinnt er auf Rache.«
Jaus, der häufiger an der Seite Thierry Durands gekämpft hatte, als er zählen konnte, seufzte. »Er konnte es niemals tolerieren, wenn jemand eine Frau bedrohte oder verletzte. Selbst zu Zeiten, als Schweine mehr wert waren als Frauen. Ich habe das immer an ihm bewundert.«
»Genau wie ich.« Die Stimme des Seigneurs veränderte sich. »Er muss gefasst werden, Val. Lebend gefasst und nach New Orleans zurückgebracht werden. Ich werde dir mehrere Dosen des Mittels zusenden, das Alexandra entwickelt hat. Es wird ihn wehrlos machen.«
»Das haben auch die Sarazenen versucht, oft. Erinnert Ihr Euch?« Jaus lehnte sich zurück und rieb sich über die Augen. »Sie versuchten immer, den Größten und Stärksten von uns auf dem Schlachtfeld gefangen zu nehmen. Wie oft haben wir Durand dabei zugesehen, wie er sie einen nach dem anderen niedermähte?«
»Das kann ich nicht sagen.«
»Er war wie eine Sense im Kornfeld.« Jaus blickte auf das einzige Bild im Raum, einen Schnappschuss in einem Kristallrahmen. Es war das einzige Foto, das von Valentin Jaus existierte. Darauf saß er mit einem dunkelhaarigen schlafenden Säugling auf dem Arm in einem Schaukelstuhl. »Er wird das Gleiche mit der Polizei und jedem anderen machen, der versucht, ihn zu betäuben.«
»Sicher, aber wir sind die Einzigen, die ihn aufhalten können. Das Beruhigungsmittel wird helfen.«
Jaus traute weder Cypriens Quacksalberin noch ihren Mitteln, aber mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen konnte er Durand vielleicht in eine Falle locken. »Es wird geschehen, wie Ihr es wünscht.«
»Nutzt, was immer Ihr braucht. Wenn ich es Euch geben kann, reicht es, darum zu bitten.« Cyprien klang, als hätte er es eilig. »Ich muss Schluss machen, alter Freund, aber haltet mich über die Situation auf dem Laufenden. Adieu.«
Jaus legte auf und rief eine seiner Leibwachen. »Falco soll sich bei mir melden, sobald er mit den Männern fertig ist.« Als der Leibwächter gegangen war, hob er erneut den Hörer ans Ohr und rief den zuletzt ernannten amerikanischen Suzerän an, dessen Rat er ebenso vertraute wie Michael Cypriens. Weiter reichte sein Vertrauen in ihn allerdings nicht.
»Hier spricht Jaus. Ich brauche einen Rat.« Er erklärte die Situation. »Ihr habt ihn aus Dublin hergebracht. Was erwartet uns?«
»Ich musste Durand mit Kupferketten fesseln, nur um ihn aus dem Spielzimmer der Brüder zu bekommen. Sie hatten ihm die Beine gebrochen, seine Füße zermalmt und ihn an ein paar Stellen gekocht, aber er hat dennoch versucht, mir den Kopf abzureißen.« Lucan, ehemaliger Hauptkiller des Highlords Tremayne und Michael Cypriens ältester Feind, unterdrückte ein Gähnen. »Wir haben alle gesehen, was für wunderbare Arbeit Cypriens süße kleine Chirurgin an ihm geleistet hat. Durand ist jetzt sehr gesund, sehr stark – und verrückt wie Monte Christo.«
»Ja.«
»Ihr braucht keinen Rat von mir, Valentin«, sagte Lucan. »Ihr wisst bereits, was Ihr tun müsst. Ihn umbringen.«
Jema hielt an einer Telefonzelle, um das Büro der Gerichtsmedizin anzurufen, und nachdem sie die Details erfahren hatte, saß sie ein paar Minuten da und überlegte, ob sie zurück zum Shaw House fahren oder ihre nächtliche Arbeit fortsetzen sollte. Meryl würde jetzt im Bett sein, und Dr. Brandford blieb nie auf und wartete auf sie. Die übliche Konfrontation würde erst morgen früh stattfinden, wenn ihre Mutter sie am Frühstückstisch ausfragte.
Wo warst du? Meryl rief oft im Museum an, um zu überprüfen, wann Jema gefahren war, deshalb konnte sie diese Frage nicht ehrlich beantworten. Wie spät warst du gestern Abend zu Hause? Das würde sie so beantworten müssen, dass es zur ersten Frage passte. Warum bist du immer so rücksichtslos? Das würde ihr Stichwort sein, um sich dafür zu entschuldigen, ihrer Mutter Sorgen gemacht zu haben, was Meryl nicht zufriedenstellen würde, aber es wurde trotzdem erwartet.
Jema wünschte, sie könnte Meryl von ihrem geheimen Leben erzählen. Ich arbeite für die Gerichtsmedizin, Mutter. Ich untersuche nachts Tatorte von Verbrechen. Ich sammle und identifiziere ungewöhnliche Spuren. Ich schreibe Berichte für die Polizei. Auf eine Art helfe ich, Mörder zu fangen.
Meryls Reaktion würde sofort erfolgen, negativ ausfallen und unvermeidlich sein. Du bist eine Shaw. Shaws arbeiten für niemanden.
Voller Selbstverachtung fuhr Jema in die Stadt zum Tatort in einem privaten Park, der den Bewohnern einer exklusiven Wohnanlage zur Verfügung stand. Als sie ihren Ausweis zeigte, ließen die uniformierten Beamten, die das Gelände abriegelten, sie passieren, aber es beeindruckte den Inspektor der Mordkommission nicht, der die Spurensicherung überwachte.
»Shaw? Sie haben sich aber verdammt viel Zeit gelassen.« Detective Stephen Newberry streckte die Hand aus und verlangte nach ihrem Ausweis. Sein ausdrucksloses Gesicht und seine kleine, schmale Gestalt hätten auch zu einem Englischlehrer gepasst, aber seine harten blauen Augen zeigten den Polizisten. »Im Berufsverkehr stecken geblieben?«
»Ich war gerade erst mit meiner normalen Arbeit fertig, Detective«, sagte sie und reichte ihm die Marke, die sie als Mitarbeiterin der Gerichtsmedizin auswies. Er betrachtete sie mit beleidigender Gründlichkeit. »Ich bin sofort gekommen, als ich die Nachricht auf dem Pieper erhielt und bestätigt bekam.« Nach einer inneren Debatte von nicht mehr als zehn oder fünfzehn Minuten, fügte sie in Gedanken hinzu.
»Wir warten seit zwanzig Minuten auf Sie«, erklärte ihr Newberry. Sein kurzes kupferfarbenes Haar entzog seinem blassen Gesicht alle Farbe, während die tief eingegrabenen Fältchen um seine Augen und seinen Mund ihn zehn Jahre älter aussehen ließen. »Vielleicht könnten Sie das nächste Mal ein bisschen schneller fahren. Ich werde das Ihrem Boss berichten.«
»Ich bin unabhängige Beraterin der Gerichtsmedizin, Detective, keine städtische Angestellte«, erwiderte Jema, während sie Schuhschutzhüllen und den Plastikanzug anzog, die verhindern würden, dass sie in der Nähe der Leiche Fasern hinterließ. »Wenn Sie mir Schwierigkeiten machen wollen, dann sprechen Sie mit dem Besitzer des Shaw-Museums. Soll ich Ihnen die Telefonnummer meiner Mutter geben?«
»Schon gut. Im Moment bin ich dafür zu wütend.« Newberry führte sie durch das Chaos aus Mitarbeitern der Spurensicherung und Ermittlern, bis sie die Leiche erreichten. »Sie haben schon ein paar von denen untersucht, oder?«
»Ja.« Jema lächelte ein wenig. »Ich wurde erstmals von der Chicagoer Gerichtsmedizin als Beraterin hinzugezogen, als ein Importeur ermordet aufgefunden wurde. Der Mörder hatte ihn mit etwas erstochen, das wie ein alter Dolch der Spartaner aussah. Ich identifizierte die Waffe als Fälschung, aber ich fand auch ein archaisches griechisches Symbol, das in der Nähe des Opfers mit Blut aufgemalt war. Das führte zur Verhaftung eines bekannten Sammlers. Offenbar hatte ihm der Importeur einige Fälschungen verkauft.«
»Nur weil man alte Messer identifizieren kann, kriegt man noch keinen Job bei der Gerichtsmedizin«, meinte Newberry.
»Nein, aber wenn man einen Abschluss in Forensik hat und bereit ist, nachts zu arbeiten, dann schon.« Sie blieb stehen, als sie das Opfer sah.
Der nackte Körper eines Mannes lag mit dem Gesicht nach unten im braunen Gras. Am Hinterkopf klaffte eine so tiefe Wunde, dass der gesamte Schädel deformiert war, und der Rest des Körpers zeigte Spuren von zahllosen brutalen Schlägen.
Jema hatte täglich mit dem Tod zu tun, wenn sie Artefakte katalogisierte, von denen viele als Beigaben in Gräbern oder Gruften gefunden wurden. Doch der getrocknete, brüchige Oberschenkelknochen des Bediensteten eines Edelmannes, der tausend Jahre vor Christi Geburt rituell geopfert worden war, ließ sich nicht mit dem misshandelten Körper eines Mannes vergleichen, der noch vor wenigen Stunden gelebt hatte.
Es war real. Es war abscheulich. Man konnte es nicht wegreden.
»Man hat mir gesagt, wenn man so etwas ständig sieht, entwickelt man mit der Zeit eine emotionale Distanz«, sagte sie und ballte die Hände in den Taschen zu Fäusten. »Wie lange dauert das?«
»Ungefähr fünfzig Jahre, plus minus ein paar Jahrzehnte«, antwortete Newberry mit schmalen Lippen. »Es hilft, wenn man trinkt.«
Jema zog ein Paar Latexhandschuhe an und holte eine Spurensicherungstüte aus ihrer Tasche. Der Detective blieb zurück, während sie zuerst um die Leiche herumging, dann innehielt und sich das Gras und die Erde genauer ansah. »Da ist nicht genug Blut. Er wurde wahrscheinlich nicht hier umgebracht.«
»Das sehen wir auch so.« Newberry deutete auf einige kleine Schildchen der Spurensicherung, die in einem Stück Erde einen Meter von der Leiche entfernt steckten. »Keine Fußabdrücke neben den Reifenspuren. Vielleicht wurde er von der Ladefläche eines Pick-ups geworfen, der durch die Einfahrt für die Gärtner kam.« Er klang leicht überrascht, so als hätte er ihre Beobachtung nicht erwartet.
»Hat er hier gearbeitet oder gelebt?« Jema wusste, dass Morde oft in der Wohnung oder am Arbeitsplatz des Opfers oder in der Nähe von beidem passierten.
»Er hat sechs Blocks entfernt einen kleinen Laden geleitet.« Newberry kam näher. »Der Angestellte der Nachtschicht hat ihn zuletzt vor zwei Tagen lebend gesehen. Er verließ den Laden um zehn Uhr abends und kam nie zu Hause an.«
»Die Leiche lag zuerst mit dem Gesicht nach oben; sie wurde umgedreht.« Jema deutete auf zwei Erdflecken am Rücken und den Beinen. »Aus irgendeinem Grund wollte man, dass er mit dem Gesicht nach unten liegt.« Sie ging in die Hocke und nahm mit der Pinzette ein feines Büschel kurzer brauner Haare aus dem Gras in der Nähe des bewegungslosen rechten Fußes. »Das hier könnten Tierhaare sein. Geht hier jemand abends mit seinem Hund spazieren?«
»Nein. Im Gebäude sind keine Haustiere erlaubt. Wir überprüfen das, wenn wir die Wohnungen abklappern, und sehen nach, ob sich jemand nicht an die Regeln hält.« Newberry nahm ihr den Spurensicherungsbeutel ab, markierte ihn und gab ihn einem wartenden Mitarbeiter, zu dem er sagte: »Wenn der Fotograf fertig ist, holt ein paar Männer her, damit wir ihn umdrehen und wegschaffen können.«
Jema betrachtete die Lage der Gliedmaßen, den Zustand der Fingernägel und die hellen Flecken der Kopfhaut, die durch das dicke schwarze Haar schimmerten. »Er hat gekämpft, solange er konnte, aber irgendwann wurde er gefesselt. Die Verletzungen an seinen Handgelenken deuten auf Seil oder Schnur hin.« Als die Leute von der Spurensicherung ihn umdrehten, blickte Jema in das Gesicht des Opfers. Es war das eines jungen Asiaten, und es war total zugeschwollen und voller Schnittwunden. »Mein Gott.«
Jemand hatte mit einem Messer ein Hakenkreuz in das Gesicht des Opfers geritzt. Die Schnitte waren so tief, dass man die Knochen sah.
Blitzlicht zuckte auf, als der Tatortfotograf mehrere Bilder von den Gesichtswunden des Opfers machte. Newberry holte sein Handy raus und lief auf und ab, während er seinem Vorgesetzten Bericht erstattete. Jema konzentrierte sich darauf, die Vorderseite des Opfers zu untersuchen, aber ihre Augen wanderten immer wieder zu dem schrecklichen Symbol, das in das Gesicht des jungen Mannes geritzt worden war.
»Fertig?«, fragte der Detective, nachdem er seinen Anruf beendet hatte.
»Fast.« Sie fand Gewebespuren im Gras, sicherte sie und übergab sie der Spurensicherung. »Ich will das mit den Wunden in seinem Mund abgleichen.«
Jetzt sah Newberry sie verdutzt an. »Woher wollen Sie wissen, dass er Wunden im Mund hat?«
»Da sind Bissspuren auf seiner Unterlippe. Er hat wiederholt draufgebissen und dasselbe wahrscheinlich mit seiner Zunge und den Innenseiten seiner Wangen getan. Er hat versucht, nicht zu schreien.« Sie beugte sich vor und sammelte noch mehr Haare von der geschundenen Brust des Mannes. »Diese passen zu denen, die ich im Gras gefunden habe, aber es sind keine Hunde- oder Katzenhaare; sie sind zu grob und dick, fast wie Wolle.«
»Wir schicken sie ins FBI-Labor«, sagte Newberry, obwohl er darüber nicht glücklich zu sein schien. »Die sollten uns in ein oder zwei Wochen mehr sagen können.«
»Ich kenne eine Anthropologin aus der Gegend, deren Spezialgebiet die Identifizierung von tierischen Überresten ist. Sie kann diese Proben mit ihrer Datenbank abgleichen und feststellen, zu welcher Spezies sie gehören. Und sie kann auch einen DNA-Test durchführen«, bot Jema an. »Dafür bräuchte sie einen, höchstens zwei Tage.«
Der Detective sah auf die Leiche. »Ich bespreche das mit meinem Vorgesetzten. Wenn wir Ihre Expertin damit beauftragen, brauchen wir Kopien aller Berichte, und die Proben müssen an die zuständige Stelle bei der Polizei zurückgegeben werden.« Detective Newberry gab ihr ein Klemmbrett mit einem Formular, das sie unterzeichnete. Es bewies, dass sie am Tatort gewesen war. »Sie sagten, er hätte sich auf die Lippe und die Zunge gebissen, um nicht zu schreien. Warum?«
Sie hatte zu viel gesagt. »Das ist nur eine Schlussfolgerung, und ich könnte mich irren.«
»Aber?«
»Ich habe schon mehrfach mit asiatischen Studenten zusammengearbeitet, die über den Sommer für ein Praktikum ins Museum kommen. Einem fiel mal eine schwere Kiste auf den Fuß, und er brach sich drei Zehen, doch er gab keinen Laut von sich.« Sie sah zu, wie die Bestatter das Opfer in einen geöffneten Leichensack legten. »Einige asiatische Kulturen empfinden es als erniedrigend, Schmerzen zu zeigen.«
»Sie prügeln ihn zu Tode, aber er beißt sich auf die Lippen, um nicht zu schreien, weil das schlimmer wäre?« Newberry klang ungläubig.
Jema versuchte nicht zusammenzuzucken, als der Reißverschluss des Leichensacks geschlossen wurde. »Wenn Sie wüssten, dass Sie sterben müssen, Detective, würden Sie nicht versuchen, wenigstens Ihre Würde zu wahren?«
»Ich würde lieber schreien und jemanden auf mich aufmerksam machen, damit ich nicht sterben muss. Nicht so etwas.« Detective Newberrys Augen wurden schmal. »Sie sprechen vom Tod, als hätten Sie persönliche Erfahrungen damit.«
Die würde sie bald haben. »Die Toten sind mein Geschäft.«
3
Thierry Durand wusste, dass er wahnsinnig war.
Sein Zustand machte ihm keine Angst. Dadurch hatte er einen Ort auf der Welt und eine Aufgabe. Keine Schlacht wurde jemals von völlig normalen Männern gewonnen. Jede große Familie hatte ein oder zwei Irre aufzuweisen; jedes Dorf hatte einen Trottel. Er war nie von etwas bezwungen worden, weder von den Sarazenen noch von den Brüdern oder der verrückten Frau, die er geliebt hatte. Er würde sich dem Wahnsinn nicht ergeben.
Er würde ihn überleben …
Er schob eine Hand unter die zerfetzten Überreste seines Hemdes. Aus den Wunden an seinem Bauch und seinen Rippen floss kein Blut mehr, aber sie schlossen sich nicht. Es waren zu viele, und sie waren ihm zu schnell hintereinander zugefügt worden. Wenn er nicht wollte, dass seine Gedärme herausquollen und sich über die Straße verteilten, dann musste er jagen.
Jagen, wo er der Gejagte war.
Er hatte einigen Abstand zwischen sich und den toten Verbrecher gebracht und sich etwas sicherer gefühlt, aber er konnte nicht blutverschmiert und nach Abfall stinkend in diesem Teil der Stadt herumlaufen. Die sich drehenden roten und blauen Lichter der Polizeiautos hatten ihn im Schatten dieser kleinen Gasse Schutz suchen lassen, und innerhalb weniger Augenblicke wurden es immer mehr. Erst da hatte er entdeckt, dass es sich um eine Sackgasse handelte und dass er in der Falle saß. Während er kampfbereit an der Wand lehnte, war die Polizei vorbeigefahren. Es dauerte einen Moment, bis ihm klar wurde, dass sie nicht hinter ihm her waren.
Als die Straße wieder frei war, schob sich Thierry an der Wand entlang, um einen Blick zu riskieren. Die schwarz-weißen Autos hatten sich mit immer noch blinkendem Blaulicht vor einem hohen, eleganten Gebäude am anderen Ende der Straße versammelt. Es musste ein schlimmes Verbrechen passiert sein, wenn sie mit so vielen Leuten anrückten, aber sie waren nicht seinetwegen gekommen. Ein paar Polizisten sperrten das Gebäude ab, andere gingen an der Straße auf und ab und sprachen mit den Leuten, die aus anderen Häusern kamen.
Wenn er jetzt aus der Gasse trat, würde man ihn entdecken. Sie würden ihn nicht befragen. Sie würden sehen, wie blutig und verdreckt er war, und versuchen, ihn zu verhaften. Oder ihn erschießen. Er konnte nicht riskieren, von Menschen angegriffen zu werden, nicht in seinem derzeitigen Zustand.
Er würde warten müssen, bis sie weg waren.
Thierry setzte sich hinter einen Haufen zusammengefalteter Kartons und beobachtete die Ratten, die vor dem Licht Schutz suchten. Genau das brauchte er jetzt auch: ein Haus oder ein Geschäft, in dem er sich waschen und ausruhen konnte und nicht von menschlichen Augen gesehen wurde. Aber hier, in Chicago, lebten die Leute so, als wäre jeder Tag ihr letzter. Sie ließen keine Türen unverschlossen, keine Fenster geöffnet.
Die Stadt war wie eine Faust, die zu fest zusammengedrückt wurde.
Thierry war schwindelig und kalt. Er schloss die Augen und legte einen Arm schützend über seinen Bauch. Mit der anderen Hand zog er seinen Dolch. Seine Hand fühlte sich leer an ohne das Messer, und er konnte nicht schlafen, ohne es zu halten. Er hatte viele Dolche in seinem langen Leben besessen, aber dieser war etwas ganz Besonderes für ihn. Es war ein Geschenk von Tremayne gewesen, der ihm vor zweihundert Jahren gezeigt hatte, wie man ihn benutzte, nachdem Thierry und Michael ihm geholfen hatten, aus Rom zu entkommen.
Wenn du gefangen wirst, und es gibt keine Hoffnung auf Rettung, stich hier hinein. Thierry konnte noch immer die Berührung von Tremaynes entstellter Hand an seinem Nacken spüren. Ein schneller Schnitt, der das Rückenmark durchtrennt. Es ist das Gleiche wie eine Enthauptung.
Thierry hätte das getan, als ihn die Brüder in Frankreich gefangen nahmen, aber er hatte mit seiner Frau Angelica geschlafen, und das war der einzige Zeitpunkt, zu dem er nackt und ohne Waffen war.
Sie hatte das gewusst. Sie hatte es ihnen gesagt.
Nur das Ziel, nach Chicago zu kommen und die Männer zu suchen, die Luisa Lopez überfallen hatten, hielt ihn davon ab, ganz im Wahnsinn zu versinken. Er war des Englischen mächtig, deshalb hatte er, als er die Akte öffnete, lesen können, was dem Mädchen passiert war. Luisa war von den Brüdern gefoltert worden. Cyprien würde das nicht wissen; er hatte nicht gesehen, mit welchen sadistischen Methoden die Mönche Menschen quälten. Thierry schon. Deshalb hatte er sich auf den Weg gemacht, sicher, dass er so seinen Angriff auf Alexandra sühnen konnte, die nur versucht hatte, ihm zu helfen. Und um sich an den Brüdern zu rächen, die sein Leben und seinen Körper zerstört hatten.
Ein helles Cabriolet hielt vor der Gasse und parkte auf der anderen Straßenseite, anstatt näher an den Tatort heranzufahren. Er sah auf, als eine Menschenfrau allein in der Dunkelheit ausstieg. Sie war jung, dünn und dunkelhaarig, eine katzenhafte Frau. Sie bewegte sich unsicher, als erwarte sie Gefahr. Ihr Blick war jedoch starr auf das Blaulicht der Polizeiautos gerichtet, und sie nahm sonst nichts um sich herum wahr.
Wie er.
Ich könnte einfach hingehen und sie mir nehmen. Thierry erhob sich, und seine Hand schloss sich fester um den Dolch, während er sich umsah. Dass sie ihm so nah kam, wo der Blutdurst in ihm so groß war, machte ihn eher wütend als gierig. Er war nicht das einzige Raubtier hier draußen heute Nacht. Hat sie niemanden, der sich um sie kümmert? Der sie zu Hause hält, wo sie sicher vor Dingen wie mir ist?
Die Frau achtete nicht auf ihn oder auf die Gasse, sondern ging auf den Tatort zu und verschwand im Gebäude, nachdem sie einem Polizisten ihre Brieftasche gezeigt hatte.
Thierry sank zurück hinter die kaputten Kartons. Er war nicht mehr als ein Sieb auf zwei Beinen, und sie war zu klein. Frauen jeder Größe waren die schlimmste Versuchung. Aber wenn er nicht bald jagte, dann würde er so schwach sein, dass er sich nur noch tiefer im Schmutz der Gasse verkriechen konnte. Dann würde er warten müssen, bis ihm jemand nah genug kam, um ihn zu fassen.
Nicht die Frau. Keine Frau.
Seine Einsamkeit war inzwischen schwerer zu ertragen als sein Wahnsinn. Er konnte sich nicht dazu bringen, Frauen zu jagen, nicht nach dem, was er in seinem Wahnsinn Alexandra angetan hatte, deshalb hatte er sich nur von Männern ernährt.
Auf den Straßen von Memphis zu jagen, war Thierrys größter Fehler gewesen.