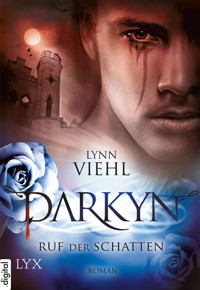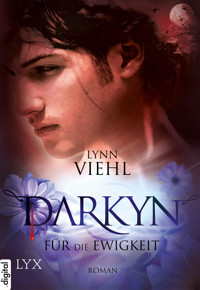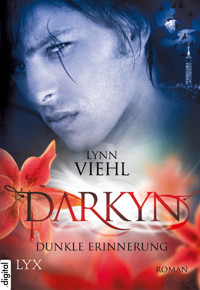9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Darkyn-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Vampir Gabriel wird von den Priestern der Bruderschaft entführt , in einer Kirche gefangen gehalten und grausamer Folter unterzogen. Das Einzige, was ihn davor bewahrt, den Verstand zu verlieren, sind die Träume von einer wunderschönen jungen Frau. Nicola Jefferson fährt auf ihrem Motorrad quer durch Europa. Getarnt als Fotografin stiehlt sie wertvolle Gegenstände aus Kirchen, auf der Suche nach einem alten Familienerbstück. Dabei entdeckt sie die Kirche, in der Gabriel sich befindet und befreit ihn. Der Vampir erkennt Nicola sofort: Sie ist die Frau aus seinen Träumen! Zwischen beiden scheint eine rätselhafte Verbindung zu bestehen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Titel
Widmung
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Impressum
LYNNVIEHL
BLINDES VERLANGEN
Roman
Ins Deutsche übertragen von Katharina Kramp
Für Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger und Daniel Adair voller Respekt, Wertschätzung und unendlicher Dankbarkeit. Eure Musik hat dieses Buch genauso geschrieben wie ich.
Wenn die weiße Flamme in uns stirbtund Freuden die Welt uns nicht mehr macht,liegen steif wir im Dunkeln, wenn der Körper verdirbt,zerfallen einsam jeder in seiner eigenen Nacht.
Wenn dein wehend Haar im Tode wird still,und Fäulnis durch deine Lippen dringt,ich nicht länger um Atem kämpfen will –wenn wir Staub sind, wenn wir Staub sind!
Noch tot nicht, nicht ganz von Begier verlassen,noch fühlend, unbefriedigt, noch nicht fortdurch die Luft wir flirren, zurückgelassen,schimmernd an unseres Todes Ort.
Wie Staub in der Sonne tanzen wir,folgen leichtfüßig, grenzenlos dem Wind,Straßen nach Straße, mal dorthin, mal hier,bis wir gänzlich fortgetragen sind.
Rupert Brooke, Staub
1
Immer weiter.
Nicole Jefferson lag zusammengrollt auf dem schmalen, unebenen Bett des Motels und bewegte im Schlaf die Augen unruhig unter den geschlossenen Lidern. Ein schwarzer Shoei-Motorradhelm mit einem rauchgrauen Visier hing am Riemen an einem Messingknauf des Bettrahmens und wirkte im Dunklen wie der abgeschlagene Kopf eines Außerirdischen.
Auf dem kleinen Tisch in der Zimmerecke stand ihr Laptop und summte mit schwarzem Bildschirm vor sich hin, während er seinen täglichen Virenscan durchführte. Ein zerschrammter, abgestoßener Baseballschläger stand aufrecht an die Matratze gelehnt, ein paar Zentimeter von Nicks rechter Hand entfernt.
Nick schlief nie weit von dem Schläger entfernt.
Vor sehr langer Zeit, als es noch einfacher gewesen war, auf dieser Welt zu leben, hatte Nick mit dem Lötkolben ihres Stiefvaters ihren Namen in das Holz des Schlägers gebrannt. Sie konnte es nicht ertragen, die letzte Verbindung zu ihrer Vergangenheit zu kappen, zu diesen langen Sommerabenden, an denen Malcom den Fernseher ausgeschaltet und ihr den richtigen Schlägerschwung beigebracht hatte. Seit sie aus England weggegangen war, hatte Nick den Schläger jeden Abend mit Schmirgelpapier abgerieben, bis die kindlichen, weit geschwungenen Buchstaben zu feinem sandigen Staub geworden waren.
Schade nur, dass Nick das nicht auch mit ihren Erinnerungen tun konnte.
Nick schlief nicht gern, hatte auch kein Bedürfnis danach. Wie andere Notwendigkeiten vermied sie das Schlafen, sooft sie es wagte. Schlaf war ein Boxenstopp, einer, den ihr Körper dringend brauchte, aber sie verschwendete damit nur wertvolle Zeit. Nur drei oder vier Stunden pro Tag konnte sie dafür erübrigen.
Immer wachsam.
Sie musste weiterkommen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, und ihre Suche fortsetzen. Sie hatte sich in einige regionale Polizeicomputer reingehackt und ein paar brauchbare Hinweise gestohlen, die sie überprüfen würde. Jede Minute, in der sie sich nicht bewegte, war eine, in der es an ihre Tür klopfen konnte. Dann würde die Polizei höflich nach ihrem Pass fragen, und dann würde sie das kalte Metall der Handschellen spüren. Wenn sie ihren Computer beschlagnahmten, würden sie sich hineinhacken und herausfinden, wer sie war und was sie getan hatte. Sie würden sie ins Gefängnis werfen, und dann war die Jagd vorbei.
Sie konnte jetzt nicht aufhören. Sie war so nah dran, die Goldene Madonna zu finden. Sie konnte es spüren.
Nie erinnern.
Nick wusste, dass sie träumte, aber sie spürte keine Angst. Sie konnte sofort aufwachen, wenn sie es wollte, ganz egal, wie tief sie schlief oder wie beängstigend ihr Traum wurde. Selbst die schlimmsten ihrer Träume waren nichts im Vergleich zu den realen Albträumen da draußen im kalten, erbarmungslosen Sonnenlicht: den Bullen, den Dieben, den Freaks, den Monstern und diesem kaltblütigen Verrückten, der täglich Tausende zu Tode erschreckte: der europäische Taxifahrer.
Nicht, dass der Traum, den Nick gerade träumte, wirklich ein Albtraum gewesen wäre. Das wurde er erst am Ende.
Der Traum fing so an wie immer: Nick ging allein durch den Wald auf etwas zu. Was es war, wusste sie nicht. Und auch den Grund kannte sie nicht. Doch was es auch war, es zog sie an wie der Duft von Creme Chantilly in hauchdünnem, goldbraunem Blätterteig.
Nick ging durch den Wald, umrundete dabei hin und wieder dicke Baumstämme, und weiche Nadeln streiften ihre Arme und Beine. Ihre Schritte zerstörten den Teppich aus alten Blättern und neuem Moos und schreckten zahllose blaue Schmetterlinge auf, die sich dort versteckten und nun davonflatterten.
Die Strahlen der untergehenden Sonne, die am von Bäumen gesäumten, rosaroten Himmel stand, versteckten sich immer wieder erfolglos vor Nick. Sie wich einem tellergroßen Spinnennetz aus und blieb einen Moment stehen, um die schwarz-gelb gestreifte Weberin zu bewundern. Die Spinne hob zwei Beine und winkelte sie an, lockte oder winkte, Nick war sich da nicht sicher.
Sie mochte die Natur. Waldspaziergänge waren okay für sie. Dank ihres Stiefvaters, der sie wie den Sohn behandelt hatte, den er und ihre Mutter niemals bekamen, stellte Nick sich nicht an, wenn es um Insekten ging. Und so merkwürdig der Kerl auch war, von dem sie wusste, dass sie ihn auf dem Weg zu jenem unbekannten Ort treffen würde, er brauchte sie. Wofür wusste sie nicht, aber es fühlte sich gut an, so wichtig für jemanden zu sein.
Immer weiter.
Die Kiefern und Tannen wurden lichter und öffneten sich zu jener Wiese, die sie schon hunderte Male gesehen hatte, aber nur in ihren Träumen. Sie lächelte und trat aus den Bäumen, glücklich, sie erreicht zu haben. Es war ein guter Ort, diese Wiese, dieser Platz. Wildblumen, weiches grünes Gras und Vogelgezwitscher hüllten sie ein. Schirmchen von Löwenzahnsamen flogen vor ihrem Gesicht in der milden Brise vorbei, trugen die Wünsche anderer Träumer mit sich. Sie fing einen mit den Fingern, hielt ihn einen Moment fest und entließ ihn dann wieder.
Ma bien-aimée.
Nicks Herz setzte für eine Sekunde aus, als sie aufsah. Da bist du ja.
Auf der anderen Seite der Lichtung erschien der Grüne Mann, genau an der Stelle, wo er jedes Mal stand, in der schmalen Öffnung zwischen zwei alten Eichen, deren dicke Äste sich mit der Zeit ineinandergeschlungen hatten. Er war so braun gebrannt wie sie blass und trug nur eine locker sitzende braune Lederhose.
Immer wachsam.
Wer immer er war, er war groß und wie ein Langstreckenläufer gebaut, mit einer breiten Brust und kräftigen Oberschenkeln, die in wohlgeformte, schlanke Beine mündeten. Der Gurt eines Köchers hing über seiner linken Schulter, aber Nick wusste aus vorangegangenen Träumen, dass der zylindrische Lederbehälter auf seinem Rücken leer war, und er trug niemals einen Bogen. Ein Teil von ihr wusste, dass er, obwohl er wie ein Jäger aussah, nichts töten konnte oder wollte.
Niemals verletzen.
Ein absolut normaler, definitiv gut aussehender Kerl, ihr Traummann, wenn man die Tannennadeln ignorierte, die statt Haaren sein Gesicht umrahmten, und den dunkelgrünen Ton seiner Haut.
»Die Prinzessin hätte dich länger küssen sollen«, murmelte Nick vor sich hin, während sie ihn betrachtete.
Er streckte die Arme aus und legte die Hände gegen die schuppige braun-schwarze Baumrinde, als versuche er, die Bäume auseinanderzuschieben. Er stand zu weit weg, als dass Nick hätte sehen können, welche Farbe seine Augen hatten, aber sein Blick ruhte die ganze Zeit über auf ihr.
Eine Handvoll großer grüner und brauner Motten flog um ihren Kopf, als eine Stimme in ihrem Innern sprach. Warum kommst du zurück, ma bien-aimée? Hast du dich wieder verlaufen?
»Ich träume das nur.« Sie machte einen zögernden Schritt nach vorn. Sie wusste, dass es der Grüne Mann war, der mit ihr sprach, obwohl er seine Lippen nie bewegte. Sie wusste auch, dass sich der Traum verändern würde, wenn sie zu schnell ging, und dass sie dann keine Gelegenheit mehr haben würde, mit ihm zu sprechen, bevor sie weitermusste. »Wie steht es mit dir?«
Ich bin für immer verloren.
So tragisch poetisch wie immer. Es hätte dumm klingen müssen, aber er meinte es ernst, und sie spürte ein Echo derselben Verzweiflung in ihrer eigenen versteckten hohlen Einsamkeit. »Für immer ist eine lange Zeit. Kannst du nicht nach dem Weg fragen?«
Niemand außer dir kann mich hören.
So hübsch sie auch waren, Nick konnte die kryptischen Bemerkungen des Grünen Mannes kaum je verstehen. Dieses Mal fragte sie sich, ob er verloren im wortwörtlichen Sinne meinte: dass er irgendwo war und darauf wartete, gefunden zu werden. »Ich bin in einer lausigen Jugendherberge am Rand von Paris. Wo bist du?«
Ich weiß es nicht. Er riss seine Arme von den Bäumen zurück und trat auf die Wiese. Doch sobald sein Fuß das kühle, köstliche Gras berührte, zog es sich von ihm zurück, lief wie eine abebbende Welle auf Nick zu und hinterließ nichts als Unkraut und Gestrüpp und Haufen von zerbrochenen Steinen. Der Wald hinter dem Grünen Mann verschwand hinter zusammengestürzten Mauern, schiefen Türmen und leeren, von Spinnweben überzogenen Fenstern. Sie haben mich hier zurückgelassen. Kennst du diesen Ort?
Hunderte von Ringelblumen schossen aus dem Gras auf Nicks Seite der Wiese. Sie starrte nach oben, während sie weiterging, betrachtete die Ruinen hinter ihm. Sie hatte schon andere Orte als diesen gesehen, aber keinen so verfallenen. »Nein, tut mir leid. Warum sollte dich jemand hierherbringen? Es sieht verlassen aus.«
Sie registrierte, wie er sich anspannte, und blieb abrupt stehen. Sie spürte wieder die gleiche unerklärliche Frustration, die sie in jedem Traum vom Grünen Mann überkam. Irgendwie wusste sie, dass ihnen beiden die Zeit davonlief, aber aus unterschiedlichen Gründen, und dass dieser Mann ihr nicht dabei helfen konnte, die Madonna zu finden. Auf der anderen Seite war sie jedoch auch ziemlich sicher, dass das alles irgendein Spiel war, das sie in ihrem Unterbewusstsein mit sich selbst spielte und in dem sie den Grünen Mann als surrealen Liebhaber erfunden hatte. Bei dem Gedanken seufzte sie innerlich.
Zumindest ist er nicht aus Gold.
»Ich könnte mich umsehen«, bot sie an. »Wenn ich ihn finde, diesen Ort, dieses Gebäude, finde ich dich dann auch?«
Er wandte den Blick von ihr ab. Ich bin verloren.
»Ja, das sagtest du schon.« Sie setzte sich auf den Rand eines zerbrochenen Steins, der die Größe eines Sessels hatte. Der Marmor fühlte sich kalt und glatt unter ihren Händen an. Darunter, wusste sie, hatte jemand einen alten Mann und eine alte Frau begraben, die in irgendeinem vergessenen Krieg getötet worden waren. Vielleicht war dieses Gefühl ja wechselseitig.
»Weißt du, wo ich bin? Kannst du zu mir kommen?«
Nur hier, im Nachtland. Er streckte die Hand nach ihr aus, zog sich jedoch in die Schatten zurück, bis man nur noch das Leuchten seiner Augen sah. Komm zu mir, ma bien-aimée. Komm jetzt zu mir.
Schmetterlinge und Motten flogen um Nick herum auf, als sie sich von dem Stein erhob. Der Traum veränderte sich, die Farben wurden dunkler und verschmolzen zu einer schwarzen Leere, in der nichts sie leiten konnte. Sie bewegte sich gleichgültig hindurch und suchte nach der Wärme, die der Grüne Mann bedeutete, bis sie langfingrige Hände spürte, die ihre Schultern umfassten, und starke Arme, die sich um sie legten.
In Sicherheit.
Ich bin hier. Du bist hier. Wir sind nicht allein. Wir träumen. Wir leben. Wir werden uns eines Tages finden.
Sie presste sich an ihn, so überwältigt von dem Körperkontakt, dass sie nicht sprechen konnte, nichts tun konnte, außer in seiner Umarmung zu stehen. So mit ihm zusammen zu sein, ließ sie alles andere vergessen. Es war lächerlich; alles, was sie miteinander teilten, war ein Traum. Sie wusste, dass er nur ein Traum war.
Immer weiter.
Nick hielt sich trotzdem an ihm fest und legte die Wange an sein Herz, während seine Hand über ihr lockiges Haar strich.
Der Grüne Mann stieß sie weg, als heißes Licht ihre Augen erfüllte, und der Boden zwischen ihnen zusammenbrach. Nick fiel nach hinten und erschauderte, als die Erde in zwei tiefen, gezackten Gräben verschwand. Käfer und Schaben krochen aus dem größten Loch und waberten über den gesamten Boden, bis es so aussah, als würde dieser sich bewegen.
Immer wachsam.
Der Grüne Mann starrte auf Nicks Hände. Was hast du getan?
Eine Ratte mit einem kurzen weißen Stock zwischen den langen gelben Zähnen kam auf sie zugelaufen. Wie ein Hündchen legte sie den Stock vor Nicks Füßen ab. Sie bückte sich danach, und ihre Hand war jetzt schwarz von Erde und Blut, ihre Fingernägel abgebrochen und rau. Sie hielt erst inne, als sie den einfachen Goldring ein Stück über dem abgenagten Ende glänzen sah.
Nie erinnern.
Nick wachte auf und weinte wie immer.
»Zu schwach, um zu entkommen«, sagte eine Stimme in der Dunkelheit, »und zu stark, um zu sterben.«
Als er in seinem neuen Raum in der Hölle aufwachte, bewegte sich der Gefangene nicht. Reaktionen waren genau wie Gefühle ebenso bedeutungslos wie nutzlos geworden. Er machte sich nicht mehr die Mühe, sich innerlich zu wappnen oder zusammenzuzucken; auf das zu warten, was passieren würde, kostete ihn seine gesamte Selbstbeherrschung.
Viel war Gabriel Seran angetan worden.
Und sie würden ihm noch mehr antun, doch er würde es aushalten. Fähigkeiten, die er während mehrerer Jahrhunderte seiner Existenz erworben hatte, ließen ihn das überleben, was ihn während seines kurzen menschlichen Lebens schon tausende Male getötet hätte. Sie hatten ihn auch diese letzten zwei Jahre als Gefangener der Bruderschaft überstehen lassen. Durch sein Talent war sein Körper nicht schwächer geworden, und seine Seele, von denen seine Geiselnehmer nicht glaubten, dass er sie besaß, hatte für den Rest gesorgt.
Was seinen Verstand anging, war er nicht sicher. Er hatte Gefühle gegen den Willen zum Überleben eingetauscht und fühlte jetzt kaum noch etwas – abgesehen von Schmerz. Er war zu einem Gletscher geworden, umgeben von gefoltertem Fleisch.
Vielleicht verdankte er sein Leben einem Phantom. Als er an sie dachte, diese Erfindung seiner eigenen verzweifelten Einsamkeit, sah er ihr Bild vor sich: ein blasses, blondes Mädchen, das im Wald herumirrte. Was sie suchte, wusste Gabriel nicht; und er hatte sie außerhalb seiner Träume auch noch nie gesehen. Aber so ausgedacht sie sein mochte, die Tatsache, dass sie in den letzten Monaten zu ihm gekommen war, hatte ihn davon abgehalten, sich den ewigen Freuden des Vergessens hinzugeben. Dank ihr konnte er mit dem Wissen leben, dass es niemanden auf der Welt gab, dem er noch etwas bedeutete oder der an ihn dachte.
»Wenn du nicht zum Licht kommen willst, dann muss ich es zu dir bringen.« Ein leises Kratzen und das Zischen von brennendem Schwefel brachten eine kleine Flamme in die stickige, stockdunkle Kammer. Der Mensch, der das Streichholz entzündet hatte, hielt es an den geschwärzten Docht der Kerosinlampe, die der alte Priester zurückgelassen hatte, und der Lichtkreis wurde größer. Er hob die Lampe, sodass sie einen gelben Schein auf sein Gesicht und auf Gabriel warf. »Siehst du, Vampir? Im Gegensatz zu dir bin ich kein Monster.«
Jemand, der nicht zu sehen war, knurrte. Ein Sack wurde mit einem lauten Klatschen fallen gelassen.
Der Mensch trug das Gewand eines Monsters: eine schwarze Kutte mit drei auf seiner linken Brust aufgestickten Kreuzen aus blutroter Seide. Eines, das wusste Gabriel, für jeden Darkyn, den dieser Mensch persönlich getötet hatte. Die Brüder trugen die Kreuze wie moderne Soldaten ihre Medaillen.
Gabriel fragte sich, ob er dem Menschen sein viertes Kreuz einbringen würde und warum es ihm egal war, wenn es so war.
»Wir sind uns noch gar nicht richtig vorgestellt worden, nicht wahr?« Stumpfe kleine Zähne glänzten zwischen roten Lippen. »Ich bin Vater Benait.«
Benait gab vor, ein katholischer Priester zu sein, genauso wie alle Mitglieder des geheimen Ordens der Frères de la Lumière, der Bruderschaft des Lichts. Dieser Mensch und seine Mitgläubigen besaßen die blinde Entschlossenheit echter Fanatiker, die aus dem Glauben gespeist wurde, dass Gabriel und andere wie er ein Fluch für die Menschheit waren.
Den Brüdern war es egal, dass Gabriel und seine Art, die Darkyn, gelernt hatten, ihren Durst nach menschlichem Blut, das ihre einzige Nahrungsquelle war, zu zügeln, und nicht länger Menschen umbrachten. Während des ersten Jahres seiner Gefangenschaft hatte Gabriel all seine Überzeugungskraft eingesetzt, um Frieden mit seinen Geiselnehmern zu schließen, aber nichts konnte sie umstimmen. Sie waren nur an dem Erhalt ihres verzerrten Glaubens interessiert und der Perversionen, die sie in seinem Namen ausüben durften. Wie zum Beispiel Vrykolakas wie Gabriel gefangen zu nehmen und zu foltern, bis sie andere Kyn verrieten.
Gabriel gab sich keine Mühe mehr mit sinnloser Diplomatie. Was immer ihm die Brüder an diesem Ort antaten, er würde es ertragen. Es war seine Pflicht, das zu tun. Selbst wenn er sich gewünscht hätte zu sterben, sorgten die spontanen Selbstheilungskräfte seines Körpers dafür, dass er fast alles überlebte. Der betäubende Graben, den er durch sein Talent schaffen konnte, hielt alles andere von ihm fern.
Das war der wahre Fluch der Kyn: auch noch zu leben, wenn der Wunsch danach längst erloschen war.
Bin ich innerlich längst tot, und mein Körper weiß es nur noch nicht? Gabriel konnte es nicht sagen.
Räder in der Nähe quietschten, während sie sich drehten; noch eine schwerere Last wurde vor dem Raum abgestellt, und die Vibrationen des Aufpralls hallten an den Wänden wider. Benait lächelte, als er ein Handy aus seiner Robe holte und eine Nummer wählte. Unbewusst entfernte er sich von Gabriel, während er in schnellem Italienisch hineinsprach.
Gabriel nutzte das Licht, um sich den unbekannten Raum anzusehen, in dem er sich befand. Keine Fenster, keine Ein- oder Ausgänge, abgesehen von der einen offenen Tür, durch die der Mensch offenbar hineingekommen war. Nichts in dem Raum ließ darauf schließen, wohin man ihn gebracht hatte; als sie ihn aus dem Lieferwagen holten, hatte er im Mondlicht nur das zugewachsene Grundstück eines großen Anwesens und die Umrisse eines verfallenen, alten Gemäuers erkennen können. Die Fahrt von Paris bis zu diesem Ort hatte viele Stunden gedauert, doch er war ziemlich sicher, dass er sich noch in Frankreich befand.
Warum bin ich immer noch in Frankreich?
Dass die Brüder ihn nicht außer Landes gebracht hatten, verwirrte ihn. In Paris hatte er das Gespräch zweier Aufseher belauscht, bei dem es um eine Diebesbande ging, die es auf die Stützpunkte der Brüder abgesehen hatte und dort Kultobjekte und religiöse Schätze stahl. Offenbar waren sie bei einem dieser Einbrüche von mehreren eingesperrten Kyn angelockt worden und hatten diese freigelassen. Gabriel nahm an, dass man ihn aus der Stadt gebracht hatte, um zu verhindern, dass man auch ihn befreite.
Er würde vielleicht nie wieder frei sein. Gabriel hatte diese Tatsache schon vor langer Zeit akzeptiert. Aber die Hoffnung, dass er den Kyn vielleicht mitteilen konnte, was er als Gefangener der Brüder erfahren hatte, war noch nicht erloschen. Dieses Wissen lag wie ein weiterer Fluch auf seinen Schultern.
Leider hatte Benait recht mit seinen Worten: Gabriel war derzeit durch den Blutverlust und die Verletzungen zu geschwächt, um sich zu befreien. Seine einzige Hoffnung bestand in der vagen Chance, eines Tages sein Talent wieder benutzen zu können, um vielleicht einen der Einheimischen dieses neuen Ortes zu sich zu locken – oder das Mädchen aus seinen Träumen. Wenn er weiter von ihr träumte, musste das doch bedeuten, dass es sie wirklich gab.
Er konnte doch nicht verrückt sein.
Die Brüder gingen davon aus, dass Gabriel schon vor langer Zeit verrückt geworden war, so wie Thierry Durand in Irland, deshalb ließen sie ihn jetzt häufig unbewacht. Es war eine Schande, dass das letzte Verhör ihn in diesen schrecklichen Zustand versetzt hatte, sonst hätte er sich befreien können. Weder seine alten noch seine neuen Wunden würden sich jedoch schließen, bis er entweder sein Talent benutzen konnte oder ein Mensch ihm genug Blut gab, um diese zu heilen.
Wenn er sich überhaupt noch heilen wollte …
Die düstere und hässliche Realität traf ihn mit voller Wucht, ein gnadenloser eiserner Panzerhandschuh, der das wackelige Bild der hellhaarigen Frau aus dem Wald zerschlug. Solche Träume bedeuteten nichts. Alle, die Gabriel geliebt hatte, waren tot; seine gesamte Familie war von den Brüdern abgeschlachtet worden. Seine Loyalität und sein Schweigen waren umsonst gewesen; kein Kyn war gekommen, um für ihn zu kämpfen oder ihn zu befreien. Nach zwei Jahren konnte er nur annehmen, dass man ihn vergessen, für tot erklärt oder absichtlich im Stich gelassen hatte. Trotz der Bürde dessen, was er über die Brüder erfahren hatte, konnte er der Aussicht, seine Existenz zu verlängern und seinen sadistischen Geiselnehmern weiter als Spielzeug zu dienen, nichts mehr abgewinnen.
Am Ende war selbst das nobelste Durchhalten sinnlos, genauso vergeblich wie die Verhöre der Brüder.
Benait sprach erneut mit ihm. »Fragst du dich nie, warum sie dein Gesicht unangetastet gelassen haben, Vampir?«
Gabriel hatte nach dem ersten Jahr seiner Gefangenschaft fast nichts mehr hinterfragt, was man ihm antat. Er hätte das gesagt, aber ungefähr zur gleichen Zeit hatte er aufgehört, mit seinen Folterern zu sprechen. Ursprünglich hatte er das Schweigen als einzige Möglichkeit des Widerstandes gesehen, die ihm noch geblieben war. Jetzt war es seine einzige Rückzugsmöglichkeit, der letzte Zufluchtsort. Aus einem Bollwerk aus Eis drang nie ein Laut.
Er hätte nicht sprechen können, selbst wenn er gewollt hätte; sie hatten ihn in Paris mit einem dünnen, breiten Kupferband geknebelt, das um seinen Mund geschmiedet war. Das gab ihm ebenfalls wertvolle Informationen über seine derzeitige Lage. Sie hatten ihn offenbar an einen Ort gebracht, an dem sie es sich nicht leisten konnten, dass er Lärm machte.
Benait trat näher. »Meine irischen Brüder hatten die Anweisung, dein Gesicht nicht zu verletzen. Ich schätze, sie haben Fotos von dir gemacht und sie eurem König geschickt. Als Beweis, dass wir dich zumindest vom Hals aufwärts gut behandeln.«
Gabriel hörte noch mehr Geräusche, die auf Aktivitäten auf der anderen Seite der Wand deuteten. Stein, der auf Stein traf, Wasser, das Kratzen von Metall an Mauerwerk. Er starrte auf die Glaskugel der Lampe, die halb mit Flüssigkeit gefüllt war. Sie hatten ihn wiederholt mit glühenden Stäben und Eisen sowie mit zahllosen Kupferwerkzeugen verbrannt, aber noch nie mit Kerosin oder Öl. Wie lange würde es dauern, bis sein ausgedörrter Körper brannte? Stunden? Tage?
Warum war ihm das egal? Hatten sie ihm das letzte Entsetzen – seine ganzen restlichen Gefühle – in Paris ausgetrieben?
»Euer König hat ihre Bedingungen für deine Freilassung nie erfüllt.« Benaits rote Lippen wurden schmal. »Stattdessen schickte er seinen Attentäter nach Dublin, kurz nachdem wir dich nach Paris gebracht hatten.«
Lucan.
»Er hat jeden Einzelnen dort abgeschlachtet«, fuhr Benait fort. »Sowohl die Brüder als auch die Maledicti. Die Überwachungskameras haben das alles aufgezeichnet.«
Eine Frau schrie in Gabriels Erinnerung und übertönte die menschliche Stimme. In Dublin hatte sie wiederholt in der Zelle neben Gabriels geschrien. Er hatte sie nie gesehen, aber sie hatte etwas in alter Sprache gerufen, in der, die die Priester nicht beherrschten. Sie hatte geschrien, dass sie ihr bei lebendigem Leib die Haut abzogen. Fast ein ganzes Jahr lang waren ihre Schreie durch seinen Kopf gehallt. Er wusste immer noch nicht, ob es eine Fremde gewesen war oder seine jüngere Schwester Angelica, die ebenfalls mit ihm und den Durands gefangen genommen worden war.
War es Angelica gewesen? Hatte Lucan sie so gefunden, gebrochen und zerschunden, unfähig, sich von den entsetzlichen Dingen zu erholen, die man ihr angetan hatte? Hatte er sie getötet, um sie zu erlösen?
Es nicht zu wissen trug stündlich zu Gabriels trostlosem inneren Winter bei, ließ eine ätzende Schneeflocke nach der anderen fallen.
»Wir wissen aus den Berichten, dass sie dich in Dublin niemals brechen oder euren König davon überzeugen konnten, ihre Bedingungen zu erfüllen«, sagte sein Geiselnehmer. »Trotz der hingebungsvollen Bemühungen meiner Brüder in Paris während des letzten Jahres hast du auch ihnen getrotzt.« Benait stellte die Lampe auf einen wackeligen Tisch neben dem Kamin und streckte die Arme aus, stöhnte erleichtert, als ein Gelenk knackte. »Du hast dich als praktisch nutzlos für uns erwiesen.«
Praktisch nutzlos. Eine Ächtung. Ein Kompliment. So sinnlos wie die Wahrung seiner Ehre.
Nein, dachte Gabriel. Denn wenn sie mich gebrochen hätten, dann hätte ich die Kyn verraten, und andere hätten mein Schicksal ebenfalls erleiden müssen. Es war richtig, standhaft zu bleiben.
Würde das Mädchen aus seinen Waldträumen es verstehen, wenn es sie wirklich gab? Würde sie ihm vergeben, dass er nicht in der Lage gewesen war, zu ihr zu kommen?
»Du brauchst keine Angst zu haben, Vampir.« Benait drehte den Docht herunter, sodass das Licht weicher wurde. »Du hast deinen endgültigen Aufenthaltsort erreicht, und ich werde jetzt die wenigen letzten Riten ausführen.«
Erleichterung und Scham setzten den letzten Rest von Gabriels strenger Selbstdisziplin und Gleichgültigkeit in Flammen. Sein Kopf verlangte von ihm, zu kämpfen, zu ertragen und zu überleben, aber die Worte des Menschen wärmten sein eingefrorenes Herz. Keine endlosen Verhöre mehr, keine sinnlose Folter. Es würde ihn nicht länger quälen müssen, dass er von seinen Leuten aufgegeben worden war, dass er allein und verzweifelt in den schweigenden Schatten existierte. Er würde nicht mehr traurig sein müssen darüber, dass er alle überlebt hatte, die jemals von ihm geliebt worden waren. Er würde nicht länger mehr und mehr von sich selbst seinem Talent opfern müssen. Er musste nicht länger in der eisigen Hölle in seinem Innern ausharren, nur um am Leben zu bleiben. Jetzt würde dieser Mensch seine Gebete sprechen, sein Schwert ziehen und Gabriel den Kopf abschlagen, und diese Stufe der Hölle würde seine letzte sein.
Am Ende, ich bin am Ende angelangt, es ist vorbei.
Alles, auf das er zurückgegriffen hatte, um sein Schweigen zu wahren, war auf diesen einen Punkt ausgerichtet gewesen. Solange er nicht um sein Leben flehte, würde es vorbei sein. Er hatte verloren, aber er hatte auch gewonnen. Sie hatten ihn nicht gebrochen. Nicht ein Mal. In dieser Hinsicht hatte er gesiegt.
Sie würde es verstehen, sein blasses Mädchen. Sie würde ihn allein und ohne Angst in die Dunkelheit gehen lassen. Dort … dort würde er auf sie warten.
Hinter den Mauern schlug etwas gegen einen Eimer, und jemand fluchte in einer anderen Sprache.
»Es wäre anders gelaufen, wenn du mit uns kooperiert hättest«, sagte Benait und nickte, als stimme er Gabriels Gedanken zu, während er näher kam. »Wir hätten dich mit zu uns ins Licht genommen, wir hätten dich zu einem Krieger Gottes gemacht. Und du hättest schließlich deine schwarze Seele gerettet.«
Die Brüder fühlten sich immer berufen, solche Reden zu halten, bevor sie ihn irgendwelchen monströsen Qualen aussetzten. Nicht seinetwegen, glaubte Gabriel, sondern um sich selbst eine Art Absolution zu erteilen, bevor sie ihre Gräueltaten ausführten. Es funktionierte nicht immer; einer der Unmenschen in Dublin war wahnsinnig geworden und hatte Gabriel seine Halluzinationen zugeflüstert.
Benait holte eine Bibel heraus und schlug das letzte Kapitel auf, bevor er zu lesen begann. »… den Engel des Abgrunds; sein Name heißt auf Hebräisch Abaddon …«
Sie versuchten, die Heilige Schrift als eine weitere, subtilere Form der Folter zu benutzen, aber Gabriel, der von seinem Vater nach Gottes himmlischem Boten benannt worden war, hatte schon vor langer Zeit Frieden mit seinem Schicksal geschlossen. Er war kein Engel, aber er glaubte nicht länger daran, dass die Kyn verflucht waren. Er hatte zu viele Gräueltaten in seinem menschlichen Leben und in seinem Leben als Kyn gesehen; Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die obszöner und brutaler gewesen waren als alle seine eigenen bedauernswerten Sünden. Der Gott, dem er während seines menschlichen Lebens gedient hatte, würde nicht eine Handvoll in die Irre geleiteter Kreuzritter-Priester für die göttliche Rache aussondern und erlauben, dass die Schlächter von Millionen Menschen alt wurden und in Betten aus Gold starben.
Metall schabte erneut am Mauerwerk, doch diesmal war das Geräusch leiser, fließender.
Benait beendete seine Lesung aus der Offenbarung, schloss die Bibel und küsste den Deckel, bevor er sie beiseitelegte.
»Du hast deine Sünden nie gebeichtet, Vampir, und es kann keine Absolution für dich geben.« Er holte eine kleine Glasphiole mit einer rötlichen Flüssigkeit aus seinem Ärmel und öffnete sie. »Aber dein engelsgleiches Gesicht können wir noch für eine Sache gebrauchen. Vielleicht wird D’Orio sich deinen Kopf an die Wand seines Arbeitszimmers hängen, wenn das hier vorbei ist.«
Gabriels Blick wurde auf eine alte, fleckige Hand gelenkt, die in der Öffnung seiner Kammer erschien und Mörtel über der Schwelle verteilte. Die Kelle verschwand wieder, und dieselbe Hand legte vorsichtig Ziegel in den feuchten Mörtel. Ihm wurde klar, was auf der anderen Seite der Wand vor sich ging, und das Entsetzen, das ihn erfasste, löschte alles andere aus, was man ihm bis zu diesem Moment schon angetan hatte. Sie versiegelten den Raum. Sie schlossen ihn ein.
Er drehte das Gesicht weg und riss an seinen Ketten.
»Du wolltest das Licht nicht sehen, Vampir.« Benait krallte seine Hand in Gabriels verfilztes Haar und zwang ihn, sich anzusehen, wie die Mauer aus Ziegeln und Mörtel auf der Schwelle höher und höher wurde, bevor er ihm die Phiole vor das Gesicht hielt. »Deshalb wird dich von nun an nichts als Dunkelheit umgeben.«
2
Eintausend Kilometer entfernt von Frankreich kämpfte eine weitere Gefangene in den schweigenden Mauern einer einsam gelegenen, streng bewachten Festung gegen ihre Gefangenschaft. Diese Gefangene akzeptierte ihr Schicksal nicht; und sie schwieg auch nicht. Genauso wie jeden Tag, seit sie nach Dundellan Castle gebracht worden war, kämpfte und schrie Dr. Alexandra Keller.
»Ich will da nicht reingehen. Ich habe dir doch schon gesagt, dass mir das nicht gehört. Und jetzt lass mich endlich los, du dämlicher Idiot.«
Richard Tremayne, Highlord der Darkyn, legte die Berichte nicht beiseite, die er gerade gelesen hatte, beendete jedoch die Lektüre über die Details der neuesten Aktivitäten der Bruderschaft in Südfrankreich. Als Alexandras Proteste näher kamen und lauter wurden, dachte er kurz über die Vorteile von Schallschutz und einseitigen Verriegelungen nach. Keins von beidem würde die Probleme mit seiner neuesten, lästigen Akquisition lösen, aber vielleicht würde dadurch zumindest ein Anflug von Frieden in seinen frühen Abend zurückkehren.
Oder die Illusion davon, dachte Richard, als ein Klopfen seine Lieblingskatze von seinem Schoß aufscheuchte. »Herein.«
Ein Diener erschien.
»Dr. Alexandra Keller, Seigneur«, verkündete der Diener, während Richards Seneschall und ein Wachmann eine kleine Gestalt, die sich heftig wehrte, in die Bibliothek führten.
»Ich war nur draußen ein bisschen spazieren«, protestierte sie, als die beiden sie in den Lichtkegel vor Richards Schreibtisch zerrten. »Was, darf ich nicht mal ein bisschen frische Luft schnappen?« Sie stieß die Luft aus und blies sich einige ihrer kastanienbraunen Locken aus dem Gesicht.
Schwarze Erde lag wie Puder auf ihrer Nase, ihrer Wange und ihrem Kinn. »Ich bin hier doch angeblich Gast, oder?«
Die Katze näherte sich vorsichtig der Amerikanerin und roch zögernd an dem nackten Zeh ihres dreckigen rechten Fußes. Ein offener, zu großer Turnschuh bedeckte ihren linken.
Wenige Dinge verärgerten den Highlord der Darkyn mehr, als wenn etwas seinen Tagesablauf störte, aber sein widerspenstiger Hausgast hielt das vermutlich für ihr Recht. Sich mit ihren Fluchtversuchen auseinanderzusetzen war schon beinahe zur täglichen Routine geworden.
»Wo habt ihr sie diesmal gefunden?«, fragte er Korvel, seinen Seneschall.
»An der Mauer des Vorhofs, Mylord.« Korvel, der der Wache vorstand, hielt die Ärztin mit eisernem Griff.
»Es ist ausnahmsweise mal ein schöner Abend, also war ich ein bisschen draußen«, beharrte Alexandra. Wie seine Männer sah sie ihn nicht direkt an. »Für einen kleinen Spaziergang. Um dem endlosen Sonnenschein und dem Glück dieses Ortes für einige Minuten zu entkommen, okay? Das ist alles.«
Richard betrachtete ihre Kleidung und den noch übrigen Schuh, die er als Besitz eines der jüngeren Pförtner erkannte. »Angezogen wie ein Mitglied meines Personals?«
»Sie haben mir meine Sachen ja weggenommen, und ich bin diese dämlichen Ballkleider so leid.« Sie reckte das Kinn. »Versuchen Sie doch mal, etwas mit fünf Reifröcken und einem eingenähten Korsett zu tragen; mal sehen, wie Sie das finden.«
»In der Tat. Und was trägt der junge Jamison in diesem Moment? Wenig mehr als die zerrissenen Streifen Ihres Bettlakens, mit dem seine Arme und Beine gefesselt sind, nehme ich an.« Als sie ihn finster anblickte, wies er den Diener an, ihr Zimmer zu durchsuchen.
»Wir haben auch das hier gefunden.« Stefan, der Wachmann, zeigte ihm einen verbogenen eisernen Schürhaken, an dem ein langes Seil befestigt war. »Es hing an der Mauerzinne hinter ihr.«
»Ich habe doch schon gesagt, dass er mir nicht gehört«, verteidigte sich die Ärztin. »Ich habe keine Ahnung, wie der dahingekommen ist. Vielleicht hat ihn jemand vergessen, als er die Mauer runterkletterte. Sollten Sie nicht lieber nach einer der anderen Geiseln suchen?«
Korvel und Stefan tauschten über den Kopf der zierlichen Amerikanerin hinweg leidgeprüfte Blicke.
Richard streckte eine behandschuhte, deformierte Hand aus und griff nach dem selbst gebastelten Enterhaken, um ihn sich näher anzusehen. Er war beeindruckt; das dicke Eisen war mit einer solchen Leichtigkeit verbogen worden, als wäre es dünnes Reet. »Ich hätte nicht gedacht, dass sie so stark ist.«
»Sie hat Martin letzte Woche den Arm zweimal gebrochen, als er sie daran hinderte, vom Dach zu springen, Mylord«, erinnerte ihn Korvel.
»Ich habe Martins Arm wieder gerichtet, nachdem ich ihn gebrochen hatte«, erklärte Alexandra. »Und ich habe auch gesagt, dass es mir leidtut und ich versuchen würde, niemandem mehr die Knochen zu brechen. Hört auf, über mich zu reden, als wäre ich nicht da. Ich bin nicht einer von euern Zombies.«
Zombies. Niemand, nicht einmal die Kyn, wagten es, die Menschen, die Richard sich besorgte und in Entrückung versetzte, auf eine so beleidigende Art und Weise zu bezeichnen. Sie wurden höflich ignoriert, genauso wie Richards Zustand. Er ging zu ihr und beugte sich dicht an ihr Ohr.
»Ich sollte Ihnen die Zunge rausschneiden«, sagte er leise und wandte ein kleines bisschen seines Talents an. Er wusste, wie sehr seine mächtige Stimme sich in ihren Kopf bohrte und dass sie ihr kurzzeitig ziemliche Schmerzen bereitete.
Alexandra wurde blass, blieb jedoch standhaft. »Bei Ihrer Eispickel-Stimme doch gar nicht nötig. Sie können mir sagen, dass ich den Mund halten soll, und ich werde es tun. Oder Sie können mich umbringen. Es gibt Ärzte wie Sand am Meer; Sie können so viele kidnappen, wie Sie wollen.« Sie starrte ihm in die Augen, und ihr Duft hüllte ihn ein. »Meinetwegen müssen Sie sich nicht zurückhalten.«
Diese dumme Frau legte es darauf an, ihn zu provozieren.
»Sollen wir sie nach unten bringen, Mylord?«, fragte Stefan ein bisschen zu bereitwillig. »Gunther hat eine Zelle hergerichtet. Ein Wort von Euch reicht.« Sein Blick glitt zu Alexandras Kopf, und seine freie Hand zuckte, als würde er gerne ihr Haar berühren.
Stefan und sein mürrischer Kerkermeister sehnten sich wie die meisten von Richards Männern danach, dass Dr. Keller ihnen ausgeliefert war und sie mit ihr tun konnten, was sie wollten. Das war das andere Problem mit der Amerikanerin: Ihre Anwesenheit versetzte fast jeden männlichen Kyn, der ihm diente, in einen Dauerzustand angewiderter, verwirrter Lust.
»Sie werden mich nicht in den Kerker werfen«, erklärte Alexandra, während sie nach Stefan trat und sich aus seinem Griff befreite. »Lassen Sie mich endlich hier raus, Tremayne, oder ich werde …«
»Seien Sie still, Dr. Keller, und setzen Sie sich.« Richard sah zu, wie sein widerspenstiger Hausgast ihm gehorchte, dann befahl er den Männern: »Lasst mich jetzt mit ihr allein.«
Als sich seine Wachen zurückgezogen hatten, betrachtete Richard die Frau, die im Schneidersitz auf dem Teppich vor seinem Schreibtisch saß. Sie hätte sich auf einen der Stühle setzen sollen, nicht auf den Boden. Aber sein besonderes Talent – diese Stimme, die so mächtig war, dass sie einem anderen Wesen Freude bereiten, es kontrollieren, verstümmeln oder sogar töten konnte – beeinflusste Alexandra nicht immer so, wie es sollte. Sie hätte seine Anweisung ganz genau befolgen müssen, aber es gelang ihr immer öfter, sich auf minimale Weise gegen ihn aufzulehnen.
War sie, wie er vermutete, weder Mensch noch Darkyn, sondern etwas anderes? Etwas Neues?
Richard betrachtete seine Gefangene. Alexandra entsprach nicht seinem Schönheitsideal, aber er konnte verstehen, was sie so anziehend machte. Ihre unauffälligen Gesichtszüge und ihre zierliche Figur konnten den exotischen cremefarbenen Ton ihrer Haut, das Strahlen ihrer intelligenten braunen Augen und das gebändigte Feuer ihrer langen kastanienbraunen Locken nicht schmälern.
Obwohl sie ein echtes Biest war, strahlte Alexandra Keller Wärme und Leben aus wie das Licht eines Leuchtturms mitten in einem Wintersturm.
Selbst ihre Stimme hatte, obwohl sie meistens vor Sarkasmus und Verachtung triefte, einen sehr angenehmen Klang. Vielleicht war sie mit mehr als einem Talent gesegnet. Einem Talent, das nach seinen Recherchen sowohl bei den Kyn als auch bei Menschen wirkte.
So versucht er auch war und so gefährlich sie vielleicht werden mochte, er konnte eine solche Frau nicht vernichten. Nicht, wo sie vielleicht die Einzige war, die die Kyn vor der Ausrottung retten und ihm die Mittel an die Hand geben konnte, die Bruderschaft endlich zu besiegen.
»Diese Fluchtversuche sind genauso ärgerlich wie sinnlos«, sagte er zu ihr. »Meine Männer werden Ihnen nicht gestatten, Dundellan zu verlassen, es sei denn, ich wünsche es so. Verstehen Sie das, Dr. Keller?«
»Ich verstehe, dass Sie ein Wahnsinniger sind«, sagte sie ganz höflich. Die Katze war auf ihren Schoß gekrochen, und sie streichelte sie abwesend. »Sie können mich nicht ewig hier festhalten. Michael kommt mich holen. Sonst noch was?«
Richard erhob sich, bevor es sein unberechenbares Temperament tat, und humpelte hinüber zu dem Fenster mit den Vorhängen, von dem aus man in den Irrgarten blicken konnte. Perfekt getrimmte Weißdornhecken bildeten die lebendigen, zweieinhalb Meter hohen Wände des Labyrinths, das ein früherer Burgherr angelegt hatte, um zu seiner Belustigung Stallburschen und Küchenjungen hindurchzujagen. Obwohl die Sonne schon vor einer Stunde aufgegangen war, leuchtete der Himmel im Westen noch immer in einem tiefen Porzellanblau.
Michael würde kommen; da war Richard ganz sicher. Die Fluchtversuche der Amerikanerin machten das nur zu deutlich. Cyprien würde jedoch mit ihm verhandeln. Er konnte Dundellan nicht angreifen, und er würde nicht wagen, wegen einer Frau einen Bürgerkrieg unter den Kyn zu beginnen.
Dr. Keller aus Amerika zu entführen und nach Irland zu bringen war vielleicht nicht unbedingt Richards weiseste Entscheidung der vergangenen Monate gewesen. Sie war noch nicht lange Kyn und schien alles an ihnen zu hassen. Auf jeden Fall erkannte sie sein Herrschaftsrecht über sie nicht an. Doch er brauchte eine Antwort auf sein Dilemma, und die einzigen Alternativen, die ihm derzeit blieben, reichten nicht.
Diese Frau war eine moderne Frau, eine Medizinerin und eine erfahrene Chirurgin. Eine von nur drei Menschen, die in den letzten sechs Jahrhunderten die Verwandlung vom Menschen in einen Darkyn überlebt hatten, obwohl ihre Verwandlung mehr als ungewöhnlich gewesen war. Es blieb jedoch die Tatsache, dass sie jetzt zu seiner Art gehörte, und ob es ihr gefiel oder nicht, sie schuldete ihm völlige und dauerhafte Lehnstreue. Letztlich gehörte ihr Talent ihm, genau wie sie mit ihrem Blut, ihrem Körper und ihrer unsterblichen Seele.
Michael musste das akzeptieren. Und Alexandra auch.
»Ich bin Ihr König«, erklärte Richard ihr. »Sie sind meine Untertanin, und Sie werden meine Befehle befolgen.«
»Ich bin Amerikanerin. Wir haben keine Könige. Wir wählen Präsidenten. Ich habe Sie nicht gewählt.« Alexandra fuhr mit den Fingernägeln über den Rücken der schnurrenden Katze. »Ihre Katze ist ein Schatz. Wie heißt sie?«
»Ich gebe Tieren keine Namen.« Er hatte nicht an die kulturellen Unterschiede gedacht. »Amerikaner sollten ein Talent für Unterwürfigkeit haben. Ihr seid nichts weiter als die Nachfahren von Schuldknechten und afrikanischen Sklaven.«
»Vergessen Sie die Religionsflüchtlinge nicht.« Sie hob die Katze hoch und rieb ihre Nase gegen ihre. »Wir sind auch die größten Einkaufsfanatiker, wir besitzen mehr Plutonium als alle anderen, und wenn Sie uns wütend genug machen, bombardieren wir Ihr Land.« Sie lächelte ihn strahlend an.
Richard nahm ihr die Katze weg. »Ich werde Sie nicht gehen lassen, und ich werde auch nicht zulassen, dass Sie fliehen«, sagte er. »Akzeptieren Sie das und tun Sie, was Sie ohnehin vorhatten – finden Sie ein Heilmittel für die Veränderten.«
Die Katze jaulte auf, bevor sie aus seinen Armen sprang und davonhuschte.
Alexandra tat so, als müsste sie gähnen. »Tut mir leid, aber da ich ja eine minderwertige Amerikanerin bin, darf ich in diesem Land nicht medizinisch arbeiten. Nehmen Sie doch Ihre eigenen Ärzte.«
Er wurde nicht gerne an seinen Kontrollverlust erinnert. Unter seinem Umhang zogen sich seine veränderten Muskeln und Knoten zusammen. »Sie sind alle tot.«
»Was?«
»Ich wurde wütend und habe sie alle getötet.«
Das brachte sie zumindest zum Schweigen.
»Ich habe ihre Labore und ihre Untersuchungsergebnisse zerstört, bevor ich mich wieder unter Kontrolle hatte.« Er drehte sich um, zog dabei einen seiner Handschuhe aus und zeigte ihr seine entstellte Hand, ließ die Klauen auf ihre volle Länge ausfahren. »Was von meiner Menschlichkeit noch übrig ist, verschwindet jetzt schnell, denke ich. Was wird passieren, Doktor, wenn ich das nächste Mal wütend werde?«
Sie starrte einen Moment lang auf die schwarzen Klauen, bevor sie den Kopf abwandte. »Ich werde Ihnen nicht helfen.«
»Ich glaube, das werden Sie.« Richard rief seine Männer und wies Stefan an, sie in einem der gepanzerten Zimmer einzusperren. »Korvel, Ihr bleibt.« Er wartete, bis der Wachmann Alexandra aus der Bibliothek geführt hatte, bevor er sagte: »Sie hat offenbar Jamison auf ihre Seite gebracht; wir können keinem menschlichen Diener mehr vertrauen. Postiert eine Kyn-Wache rund um die Uhr vor ihrer Tür.«
»Wie Ihr wünscht, Mylord.« Sein Seneschall sah aus, als wollte er noch etwas hinzufügen, doch er schwieg.
»Ich kann es noch so sehr versuchen, aber Eure Gedanken kann ich nicht lesen, Hauptmann.«
»Es fällt mir nicht leicht, die richtigen Worte zu finden, Mylord. Nicht, wenn ich Euch solche Neuigkeiten überbringen muss.« Korvel verlagerte sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen. »Keiner von Cypriens Suzeränen hat auf Eure Aufforderung reagiert oder will mit mir sprechen. Ich bekomme ständig nur irgendwelche Ausreden von ihren menschlichen Dienern zu hören.«
»Michael konnte immer auf die Loyalität seiner Männer zählen«, sagte Richard. »Deshalb habe ich ihn zum Seigneur von Amerika gemacht.«
»Seine Finanzberater haben unsere amerikanischen Konten und Besitztümer eingefroren«, fuhr Korvel fort. »Alle unsere üblichen Transportwege in die Vereinigten Staaten stehen uns vorübergehend nicht zur Verfügung. Er hat im Grunde dafür gesorgt, dass seine Grenzen dicht sind und wir nicht mehr zu ihm gelangen können.«
Richard kicherte. »Ich habe ihm viel beigebracht.«
»Seine Sygkenis sorgt für ähnlich viel Ärger«, erklärte Korvel ausdruckslos. »Ich fürchte, dass sie gefährlicher ist als ihr Meister.«
»Wieso?«
»Sie hat keinen Anstand, kein Benehmen. Ihre Anmaßungen Euch gegenüber sind offensichtlich und abstoßend. Außerdem ist sie sehr einfallsreich.« Sein Seneschall deutete auf den Enterhaken, den Alexandra hergestellt hatte. »Doch sie ist auch unglaublich charmant. Sie bringt die Männer mit ihren Mätzchen zum Lachen und verführt sie mit ihrem Lächeln. Ihr habt Stefan gesehen. Zweimal musste ich ihn davon abhalten, ihr zu nahe zu kommen.«
Richard weigerte sich zu glauben, dass diese Quacksalberin, die halb Mensch, halb Kyn war, so viel Macht über seine Männer haben sollte. »Es ist nur die Tatsache, dass sie von Cyprien getrennt ist, nichts weiter.«
»Das ist die andere Gefahr. Ihr Duft ist verführerisch, und sie verströmt jede Stunde mehr davon. Wie lange sie sich noch kontrollieren kann, weiß ich nicht, aber die Männer werden täglich unruhiger.« Korvel nickte in Richtung der Quartiere. »Bald werde ich nicht mehr in der Lage sein, die Männer von ihr fernzuhalten oder sie von ihnen.«
Alexandra in Korvels Hände zu geben machte sie vielleicht müde – sein Seneschall nahm Menschen- und Kynfrauen mit methodischer Gleichgültigkeit –, aber Richard hatte sie nicht nach Dundellan gebracht, um sie zu unterwerfen oder um seinen Männern körperliche Erleichterung zu verschaffen. Für diese Zwecke gab es die entrückten Menschen. Und in ein paar Wochen würde es ohnehin keine Rolle mehr spielen. »Was sollen wir mit ihr machen?«
»Ich kann Euch keinen Rat geben, Mylord.« Der Hauptmann legte eine Hand auf seinen Schwertgriff. »Die einzige Lösung, die ich kenne, ist ein bisschen zu endgültig.«
Richard dachte darüber nach, Alexandra in ihrem Zimmer einzusperren, aber das würde sie nicht dazu bringen, mit den Tests zu beginnen. »Ich werde darüber nachdenken.«
»Kann Korvel sie nicht verführen, bevor sie die ganze Garnison verhext hat?«, fragte eine blonde Frau von kühler Schönheit, die eben das Zimmer betrat.
»Mylady.« Korvel verbeugte sich ehrfürchtig. Zu Richard sagte er: »Mylord, ich muss mich um die Gefangene kümmern.« Ohne ein weiteres Wort verließ er den Raum.
»Wie schnell Euer Hauptmann beleidigt ist«, sagte Elizabeth, während sie ihren langen Rock zu einem eleganten Knicks zurückschlug. »Meine Zofe hat mir erzählt, dass die Quacksalberin wieder versucht hat zu fliehen. Sie scheint fest entschlossen, uns zu verlassen.«
Richards Katzen verließen alle fluchtartig das Zimmer.
»Sie muss sich noch an ihre neue Situation hier gewöhnen«, meinte Richard und zog den Handschuh wieder an. »Wenn sie das getan hat, wird sie mir dienen.«
»Zweifellos.« Lady Elizabeth verzog selten eine Miene, weil sie gerne die ernste Fassade hoheitsvoller Gleichgültigkeit wahrte. Jetzt jedoch erschien eine klar erkennbare Falte zwischen ihren hellen Brauen. »Aber dürft Ihr der Frau das alles durchgehen lassen? Könnt Ihr Euch das angesichts Eurer schwindenden Selbstkontrolle leisten?«
Richard hatte Elizabeth nicht wegen ihrer kühlen Schönheit oder ihrer liebreizenden Figur geheiratet, so atemberaubend beides auch war. Sie war in ein altes Adelsgeschlecht hineingeboren worden und hatte die Intrigenspiele am Hofe quasi mit der Muttermilch eingesogen. Sieben Jahrhunderte, nachdem er sie zur Frau genommen und zu einer Kyn gemacht hatte, betrachtete Richard ihr Talent für Ränke und Manipulation als eine seiner schlagkräftigsten Waffen.
»Sag mir, wie ich es ändern kann.«
»Da fallen mir viele Wege ein.« Elizabeth zuckte bescheiden mit den Schultern, bevor sie sich auf einen breiten Sessel in der Nähe seines Schreibtisches setzte. »Diese Quacksalberin scheint ein sehr emotionales Wesen zu sein. Sie liebt mit der Hingabe eines Kindes, oder nicht? Ich hätte nicht erwartet, dass sich eine studierte Frau außerdem so leichtsinnig und respektlos wie ein solches verhalten würde. Aber es sind nachweislich diese primitiven Regungen, die sie antreiben.«
Richard legte den Kopf schief.
»Ihr werdet feststellen, dass Ihr diesen leidenschaftlichen Trotz für Eure Zwecke nutzen könnt.« Elizabeth zupfte ihren Rock zurecht, bevor sie ihn verschlagen unter ihren langen Wimpern hindurch ansah. »Ihr werdet mir zustimmen, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun würde, um die zu schützen, die sie liebt. Wenn Ihr einen davon als Euren besonderen Gast hier nach Dundellan bringt, dann würde die Quacksalberin Eurer Bitte vielleicht nicht mehr ganz so ablehnend gegenüberstehen.«
»Wir können niemanden aus Amerika entführen«, sagte Richard. »Dafür hat Michael gesorgt.«
»Es gibt immer noch einen von Cypriens Suzeränen, der Euch treu ergeben ist, und er ist höchst einfallsreich. Ihr müsst ihn nur fragen.« Seine Frau hob den Hörer vom Telefon auf seinem Schreibtisch ab. »Soll ich das arrangieren?«
»Suchst du was Bestimmtes, garçon?«, fragte der Mann im Buchladen in einem kurz angebundenen, verärgerten Englisch.
Nick stellte das Buch über mittelalterliche Schlösser zurück und ließ den Blick über den Rest des Regals gleiten. Es machte ihr nichts aus, dass der Verkäufer sie für einen Jungen hielt; sie hatte sich das Haar kurz geschnitten und braun gefärbt, um genau diesen Eindruck zu erwecken. Er musste angenommen haben, dass sie Engländerin war, weil sie in der Abteilung mit den Livres en anglais suchte.
Fast alle ihre Recherchen erledigte sie über das Internet, aber ab und zu durchforstete sie auch einen Buchladen. Das Lesen war eine der wenigen Freuden, die sie sich regelmäßig erlaubte. Sie konnte unterwegs allerdings keine Bücher mit sich herumschleppen, deshalb ließ sie sie immer zurück, nachdem sie sie gelesen hatte, oder verkaufte sie einem anderen Buchladen.
»Ich suche einen Bildband über alte französische Herrenhäuser«, erklärte sie ihm. Als sie über die Schulter blickte, sah sie, dass der Verkäufer die Vorhänge vor dem Schaufenster geschlossen hatte und bedeutungsvoll auf die Uhr sah. Die Sonne war schon hinter dem Horizont verschwunden; offensichtlich wollte er den Laden schließen und nach Hause gehen. »Alles vom Landgut bis zur Villa.«
»Ah.« Der Verkäufer, ein Mann mittleren Alters mit von grauen Strähnen durchzogenem braunen Haar und einer Lesebrille, die an einer Kette um den glatten Kragen seines gebügelten Hemdes hing, griff nach einem Buch über seinem Kopf. »Vielleicht gefällt dir das?«
Nick blätterte die Seiten des Bildbandes durch, auf denen fast immer mindestens zwei oder drei Farbfotos abgebildet waren. Sie würde zwei Stunden brauchen, um es durchzugehen und auf ihrer Karte eine Route einzuzeichnen, aber es war zumindest ein Anfang.
»Genau das, was ich brauche, danke.« Sie holte ihr Portemonnaie aus der Hosentasche und folgte dem Verkäufer zur Kasse.
Da das Buch gebraucht war, gab der Verkäufer ihr fünfzig Prozent Nachlass auf den ursprünglichen Preis und wickelte das Buch dann sorgfältig in Papier ein. »Studierst du mittelalterliche Geschichte, garçon?«
»Ich sehe mir einfach gerne alte Gebäude an«, log Nick. Sie zog am Band ihrer Kamera. »Ich mache Fotos davon. Behalten Sie den Rest«, fügte sie hinzu, als er ihr eine Handvoll Münzen zurückgeben wollte.
Als der Verkäufer ihr das Buch gab, wanderte sein Blick über ihre kurzen, dunklen Locken und ihre zarten Wangen. »Für einen professionellen Fotografen siehst du nicht alt genug aus.«
»Es ist nur ein Hobby.« Nick sah etwas und griff in den Spalt zwischen der Kasse und der Ladentheke. Sie zog einen Personalausweis heraus, der dort gesteckt hatte, und gab ihn dem Verkäufer. »Ist das Ihrer?«
»Oui.« Der Mann runzelte die Stirn, während er den staubigen Ausweis betrachtete. »Ich habe ihn vor einem Monat verloren. Ich hatte noch keine Zeit, mir einen neuen zu besorgen.« Er seufzte und steckte ihn in seine Tasche. »Du hast mir stundenlanges Stehen in einer Warteschlange erspart. Merci beaucoup, garçon.«
»Gern geschehen. Kennen Sie zufällig ein wirklich altes Haus, eins, wo die Mauern schon eingestürzt sind? Es ist verlassen, und auf der Wiese davor stehen eine Million Ringelblumen.« Sie biss sich fast auf die Zunge, als ihr klar wurde, nach was sie sich da erkundigte. Sie interessierte sich nicht für dieses Haus; es existierte nicht.
»Pardonne-moi, je t’en prie. Ich kenne es nicht.«
»Okay, schon gut, danke …«
»Touristen dürfen nicht an solche Orte, weil sie nicht sicher sind.« Der Verkäufer tippte sich mit dem Finger an die Nase, während er nachdachte. »Aber vielleicht möchtest du dich mit Sarmoin darüber unterhalten, dem Bäcker gegenüber.«
Sie hob die Augenbrauen. »Dem Bäcker?«
»Seine Frau malt.« Der Verkäufer ließ es so klingen, als sei das eine Form des Verrats. »Er fährt jeden Sonntag mit ihr aufs Land, wenn seine Öfen ausgestellt sind, um abzukühlen. In der Bäckerei hängt ein Bild von einem Haus, wie du es beschreibst.«
Nick dankte ihm und verließ schnell den Laden. Die Bäckerei auf der anderen Straßenseite hatte grüne Läden, und am Fenster stand in weißen Buchstaben SARMOIN. Drinnen konnte sie zwei Hausfrauen mit Einkaufskörben sehen, die Auslagen mit dünnen, knusprigen Baguettes inspizierten.
Sie ging über die unebene Straße, bis sie die Tür erreichte, und zögerte dort erneut. Was wollte sie denn beweisen? Sie sollte sich wieder auf ihr Motorrad setzen und zurück in die Jugendherberge fahren, um ihre Sachen zu holen. Sie konnte es sich nicht leisten, noch eine Nacht in der Stadt zu verbringen.
Was, wenn es das Haus doch gibt? Was, wenn das alles dazugehört?
Nick öffnete die Tür und atmete den wundervollen Duft von Teig und Hefe und Butter ein, als sie eintrat. Die beiden Hausfrauen stritten gerade laut über die Art und die Anzahl der Baguettes, die sie für das Wochenende brauchten; Französinnen nahmen ihr Brot sehr ernst. Die junge Verkäuferin sah Nick mit amüsierter Resignation an.
Ein Blick auf die Wand hinter der Theke ließ Nicks Kehle eng werden, bevor sie nach dem Bäcker fragen konnte. Sie starrte auf ein kleines, ungerahmtes Bild, das neben einem Foto des Papstes hing.
Das Mädchen hinter der Theke überließ die Hausfrauen sich selbst und lächelte Nick an. »Wie kann ich Ihnen helfen, Monsieur?«
»Ist das zu verkaufen?«, fragte sie auf Französisch und deutete auf das Bild.
»Das kann ich nicht sagen, Monsieur. Meine Mutter … einen Moment bitte.« Das Mädchen verschwand hinten im Laden und kam mit einem dicken Mann in Shorts und einem mehlbedeckten T-Shirt zurück. »Der Monsieur möchte Mamas Bild kaufen, Papa.«
Der Bäcker versteifte sich und musterte Nick. »Warum?«
»Es ist wunderschön.« Nick blieb bei der Lüge, die sie schon dem Verkäufer im Buchladen erzählt hatte, und zeigte auf ihre Kameratasche. »Ich fotografiere gerne solche Häuser.«
»Es ist nicht zu verkaufen«, erklärte er ihr. »Sie würden keine Erlaubnis bekommen, die Kapelle von St. Valereye zu fotografieren. Der Verwalter schickte meine Frau schon wenige Minuten nach ihrer Ankunft wieder weg. Und sie hatte ihre Leinwand an der Straße aufgestellt, nicht auf dem Grundstück, Sie verstehen?«
Nick nickte und ignorierte die nervöse Aufregung, die ihr die Brust eng machte. Die Kapelle war wie die Dinge, die sie gefunden und versteckt hatte – ein Teil von ihnen, ein Teil auf dem Weg, der zur Goldenen Madonna führte. Sie musste nach St. Valereye fahren und sich diese Kapelle ansehen. Jetzt. »Ich würde trotzdem gerne wissen, wo sie liegt.«
Der Bäcker seufzte. »Zweiunddreißig Kilometer südlich von hier.« Er gab ihr knappe Instruktionen, welche Landstraßen sie nehmen musste, und nach einem Blick auf ihre abgetragene Jeans und ihre alte braune Lederjacke fügte er hinzu: »Es gibt dort am Fuße des Berges eine kleine Pension. Nennen Sie den Leuten meinen Namen, dann werden Sie nicht wie eine gewöhnliche Touristin behandelt.«
Nick grinste. »Das mache ich. Vielen Dank, Monsieur.«
Um ihre Dankbarkeit zu zeigen und sich noch ein paar Minuten länger das Innere der Bäckerei einprägen zu können, damit sie sich später bei ihrem Einbruch leichter zurechtfand, kaufte sie eine Tüte Mini-Fruchtgebäck. Sie würde später zurückkommen, nach Mitternacht, und sich das Bild holen.
Als sie aus der Bäckerei ging, kam Sarmoin hinter der Ladentheke hervor und lief ihr nach.
»Junger Mann.« Sarmoin blickte sich nach allen Seiten um, bevor er ihr das kleine Bild entgegenhielt. »Hier, nehmen Sie.«
So viel zum Thema zurückkommen und es stehlen. Ein merkwürdiges Schuldgefühl überfiel Nick. »Wie viel wollen Sie dafür haben, Monsieur?«
»Nichts. Ich will es nie wiedersehen.« Er drückte es ihr in die Hände und verzog dann das Gesicht. »Es ist falsch, es Ihnen zu sagen«, sagte er in einem Englisch mit starkem Akzent. »Ge’en Sie nischt zum Schloss. Etwas Böses – très mal – ist dort.«
»Wie meinen Sie das?«
»Diese Kapelle …« Den Bäcker verließ sein Englisch, und er wechselte in schnelles, geflüstertes Französisch. »Meine Frau war nur ein paar Minuten dort, und sie wachte jede Nacht schreiend auf, nachdem wir von der Besichtigung zurückkamen. Bis auf dieses eine hat sie alle Bilder verbrannt, die sie davon gemalt hat, und ich musste das letzte an einen anderen Platz hängen. Sie hat noch immer Albträume.«
Nick starrte hinunter auf das hübsche Bild mit seinen liebevollen Details. »Was hat ihr solche Angst gemacht?«
»Etwas in der Kapelle«, sagte Sarmoin. »Was, weiß ich nicht. Aber in ihren Träumen versteckt es sich darin. Es beobachtet sie; es will etwas Schreckliches.«
»Was will es?«
Er sah unglücklich aus. »Sie sagt, es will sie fressen.«
3
»Wir waren schon in Disney Land, in den Universal Studios und in Sea World, weil ihr das wolltet«, sagte ein Mann mittleren Alters mit einer beginnenden Glatze und einem Sonnenbrand im Gesicht, während er vier mürrisch aussehende Jungen durch den Haupteingang ins Knight’s Realm führte. »Hier könnt ihr was lernen. Ihr könntet einen Schulaufsatz über diesen Ort schreiben.«
»Das hier wird öde.« Der älteste Junge blickte sich nach der Frau um, die ihnen müde folgte. »Mom, müssen wir?«
»Es geht ums Mittelalter«, sagte sie und lächelte gezwungen. »Nach dem Essen werden wir Ritter in glänzenden Rüstungen bei einem Turnier sehen. Ist das nicht aufregend?«
Im Sicherheitsraum des Gebäudes beobachtete Michael Cyprien die Familie, die gerade den Eintritt bezahlte, auf den Bildschirmen der Überwachungskameras. Viele solcher Touristen, die die Zeichentrickfilme und die Märchenschlösser leid waren, strömten in die Attraktion zum Thema Mittelalter. Im großen Wachraum des Schlosses aßen die Gäste gebratene Truthahnschenkel und tranken Bier aus Zinnkrügen, während sie sich von Hofnarren, Harfe spielenden Barden und der stets anwesenden Schlossherrin mit ihren sittsam in lange Seidenkleider gehüllten und mit strahlend weißen Wimpeln verschleierten Zofen unterhalten ließen.