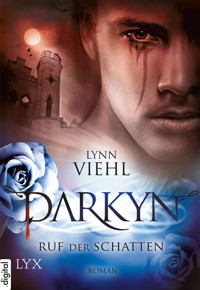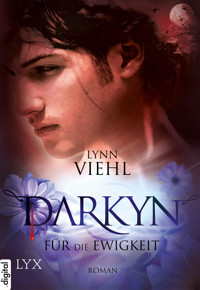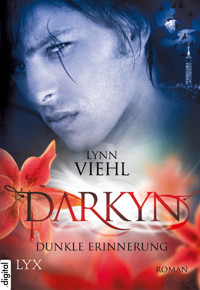9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kyndred
- Sprache: Deutsch
Samuel Taske kann in die Zukunft blicken. Niemals hätte er jedoch vorhergesehen, dass er sich in die hübsche Sanitäterin Charlotte Marena verlieben könnte - die Frau, die er beschützen soll. Denn die kriminelle Biotech-Firma GenHance ist den beiden auf den Fersen, da auch Charlotte eine besondere Gabe besitzt - eine Gabe, die nun ihre einzige Rettung sein könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Motto
Erster Teil - Golden Gate
29. September 1520: Templo Mayor
1
2
3
4
5
Zweiter Teil - Das Siebte Haus
6
7
8
9
10
11
Dritter Teil - Nacht der Tränen
12
13
14
15
16
17
Vierter Teil - Brennende Morgendämmerung
18
19
20
21
22
23
Epilog
Die Autorin
Die Romane von Lynn Viehl bei LYX
Impressum
LYNN VIEHL
Kyndred
Blick ins Dunkel
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Andreas Heckmann
Zu diesem Buch
Ein Notfall auf der Golden Gate Bridge ist das Letzte, woran sich die Sanitäterin Charlie Marena erinnert, als sie auf einer abgelegenen Insel vor der Küste Mexikos wieder zu sich kommt. Der einzige andere Mensch weit und breit ist der charismatische Multimillionär Samuel Taske, der schon seit geraumer Zeit über Charlie wacht. Denn die beiden teilen ein dunkles Geheimnis: Sie gehören zu den Kyndred, gentechnisch veränderten Menschen mit übernatürlichen Begabungen. Sofort vermuten sie die Biotech-Firma GenHance hinter der Entführung, die ihnen auch prompt eine strikte Regel auferlegt: Charlie und Samuel sollen täglich das Bett miteinander teilen. Die Alternative sind brutale Misshandlungen. Charlie ist wild entschlossen, sich dem nicht zu beugen, doch Tag für Tag fühlt sie sich stärker zu Samuel hingezogen. Während beide mit ihren Gefühlen hadern, müssen sie allmählich erkennen, dass womöglich jemand anderes, weitaus Gefährlicheres hinter dem Ganzen steckt …
Für Isabelle, meine Geburtshelferin –immer wenn ich meine Tochter sehe, denke ich an Sie.Herzlichen Dank.
Längst ist dies keine Mai-Nacht mehr,wo nur noch kalte Sterne funkeln;Wie ein endloser, schimmernder OzeanZieht sich mein ruheloses Dasein;Meine Harfe, an eisiger Küste zerschellt,Kann nimmermehr erwachen –Wann endet diese Nacht des Todes?Wann wird es endlich Morgen?
William Winter, Nachtwache
Mutation:
1.: unvermutete Abweichung vom Ausgangstypus in mindestens einem erblichen Merkmal, verursacht durch eine Veränderung in einem Gen oder Chromosom.
2.: Einzelwesen, Gattung o.Ä., das aus einer derartigen Abweichung hervorgeht.
»Die Forschungsergebnisse der letzten zwanzig Jahre zur genetischen Basis der Anpassung haben uns vor ein großes Darwinsches Paradox gestellt: Die offenkundig veränderlichen Gene von Populationen scheinen nicht Ausgangspunkt vieler wesentlicher Anpassungsveränderungen zu sein, während all die Gene, die anscheinend die Grundlage vieler oder gar der meisten wesentlichen Anpassungsveränderungen darstellen, in Populationen anscheinend nicht veränderlich sind.«
John McDonald, Genetiker an der University of Georgia
ERSTER TEIL
Golden Gate
29. September 1520
Templo Mayor
Der Herr über Täuschung und Verhängnis musterte Sokojotsin mit den Augen des Eroberers. Er erkannte den großen Betrüger am Schwarz seiner Kleidung, der Farbe des Nordens und des Todes. Er hatte die stinkenden, schmutzigen Hunde über das große Wasser gelockt und durch die Sümpfe und Maisfelder, die den Doppeledelstein in der Mitte der Welt umgaben. Die Schlangenmauer hatte sie so wenig abhalten können wie alle Krieger des Hauses der Adler.
Denn Sokojotsin hatte ihnen das Stadttor geöffnet, hatte diese bösartigen Kreaturen willkommen geheißen und ihnen seine Überlegenheit vorgeführt, indem er ihnen viele Geschenke gemacht und ihnen erlaubt hatte, in der Stadt zu leben, damit er sie kennenlernte wie ihre Vorgänger. Aber ihre Priester hatten ihn betrogen, und bald entdeckte er, dass keiner von ihnen je auf dem Pfad des schönen Todes gewandelt war. In seinem Zorn hatte Sokojotsin die tausend Schwerter gezückt, um viele von ihnen zu töten und die Übrigen zu vertreiben.
Dieser Zorn war von allen Fehlern der größte gewesen.
Die Hunde waren voller Angst geflohen, doch bald siegte ihre Gier über ihre Feigheit, und sie schlossen ein Abkommen mit seinen Feinden, vereinigten sich mit ihnen, zogen gegen die Stadt und eroberten sie im Namen ihres gesichtslosen Gottes. Siebzehn Tage lang tränkten sie den gleichgültigen Altar mit dem Blut derer, die sie niedergemetzelt hatten. Die Übrigen warfen sie ins Gefängnis, um sie zu verhören … und verhört wurden sie, bis sie unter der Folter gestorben waren.
Sokojotsin gehörte zu den letzten Überlebenden. Bald würden sie auch ihn töten, das wusste er. Sie würden ihn mit ihren hässlichen Schwertern durchbohren oder ihm den Kopf vom Nacken trennen. Sein Herz würde in der Brust sterben. Sein Tod würde keinen Sinn haben.
Er hatte sie in ihren lächelnden, sich windenden Priestern beschimpft und ihnen von seiner Herrlichkeit und Größe vorgebrüllt. Er, der alle vier Stunden gebadet worden war, nie ein Kleidungsstück zweimal getragen hatte und binnen eines Jahres nur einmal mit der gleichen Frau schlief; der Sonnengott, Herrscher des Universums und Sohn des stillen Todes, der Kriegsherr und der Regen, geliebt von den höchsten Wolken und den kältesten Stürmen, Licht des Krieges, Seelenhäuter.
Vorbei. Das dunkle Metall der Götter hatte ihn grausam vor den Eroberern niedergeworfen, und er war erledigt. Es würde keinen Frühling mehr für ihn geben, keine Tänze zu seinem Gedenken, keine Geschenke aus Jade und Serpentin. Sie würden ihn in eine ihrer Gruben werfen, auf dass er dort unter Bauern verwese, ohne auch nur ein paar Maiskörner auf die Zunge gelegt bekommen zu haben.
Er warf einen Blick auf den Haufen Brot neben dem Loch in den Gitterstäben, durch das sie es jeden Tag in seine Zelle schoben. Grüngrauer Schimmel bedeckte die Kruste. Staub und tote Insekten trieben auf dem unberührten Wasser im Eimer. Sie verstanden nicht, warum er nicht aß oder trank, aber sie kamen nicht in die Zelle, um ihm Nahrung einzuflößen. Feiglinge, sie alle.
»Sünder.«
Obwohl der Schreiber als einer der wenigen Hunde seiner Sprache mächtig war, sah Sokojotsin nicht zu der gedrungenen, in eine Robe gekleideten Gestalt vor den Gittern auf, um seine Augen nicht mit der Sanftmut des Schreibers zu besudeln.
»Sünder, der Hauptmann schickt mich, um dich ein letztes Mal zu fragen«, begann der Schreiber in seiner aufgeblasenen Art. »Verrate mir das Geheimnis der tausend Schwerter, und dein Tod wird schnell und gnädig sein.«
Sokojotsin fing einen Käfer, der munter im schimmelnden Brot wühlte, und hielt das zappelnde Insekt zwischen zwei Fingern. »Wäre ich doch wie du, kleiner Fresssack, und könnte ich zwischen Steine krabbeln, mich im Dunkeln verbergen und mich von den Abfällen dieser Hunde ernähren.« Er zerquetschte den Käfer und warf ihn dem Besucher zu, der zurückschrak.
»Du hast dich an dem einen und einzigen Gott versündigt«, zeterte der Schreiber. »Du bist verflucht in alle Ewigkeit. Dies ist die letzte Gelegenheit, deine Seele zu retten.«
Sokojotsin schloss die Augen vor dem brennenden Licht, das in seine Zelle strömte, und wartete. Als Nächstes würden sie eines seiner neunzehn Kinder bringen oder vielleicht eine seiner Frauen. Seine Lieblinge würden nicht betteln, aber die Hunde würden drohen, die Frauen vor seinen Augen zu vergewaltigen oder seinen Söhnen die Zunge abzuschneiden, wenn er nicht bekenne. Das war bei ihnen so Sitte.
»Majestät.«
Die tiefe, beruhigende Stimme seines Botschafters schien Sokojotsin aus Träumen aufzusteigen, und er lächelte ein wenig, bis er das Blut roch. Er öffnete die Augen und sah seinen intimsten Vertrauten auf der anderen Seite der Gitterstäbe stehen.
Blutstropfen liefen beim Sprechen über Tendiles zerfetzte Lippen. »Man hat mich gebracht, um Euch zu bitten, Majestät, zu tun, was sie von Euch verlangen. Könnte ich mir die Zunge abbeißen, ich täte es, aber …« Er lächelte und zeigte seinen aller Zähne beraubten Mund. »Diesen Gefallen zu erweisen, haben sie mir leider unmöglich gemacht.«
Mühsam erhob sich Sokojotsin und humpelte ans Gitter. Er konnte nicht mehr aufrecht stehen, doch das konnte auch Tendile nicht – und er wich seinem Blick aus. »Sieh mich an, Pipiltin.«
Die blutunterlaufenen, schmerzumflorten Augen seines Botschafters bewegten sich so widerwillig, dass Mitleid Sokojotsins Herz erfüllte. »Herr, vor Euch steht der Abschaum des Tempels.«
»Aber nein, mein Kind.« Sokojotsin schob die Hand zwischen den Stäben durch und ehrte seinen intimsten Vertrauten mit einer Berührung des geschwollenen Gesichts. »Ich bin es, der dich gesandt und der dich enttäuscht hat. Dich und mein ganzes Volk.«
Tränen zitterten auf den Wimpern seines Gegenübers. »Majestät, wir sind schuld an dieser Schande. In unseren beschämten Augen seid Ihr wie die Sonne.«
»Dein starkes Herz könnte mich nie enttäuschen«, versicherte er ihm. »Darum werde ich dich so schön sterben sehen, wie dein Herz schön ist.«
Tendile war von diesen Worten so überwältigt, dass er nur nicken konnte.
Der Schreiber tauchte neben dem Botschafter auf. »Schluss mit dem Unsinn«, fuhr er Tendile an. »Sag ihm –« Seine Worte zergingen in einem mädchenhaften Kreischen, als ihm Blut ins Gesicht spritzte.
Sokojotsin riss die Hand aus der Brust seines intimsten Vertrauten und hatte dabei Tendiles Herz in den Fingern, das ein letztes Mal schlug und dann stillstand. Er hob es zur Sonne empor, pries die Seele des Kriegers, setzte es an den Mund und trank.
Das Gitter öffnete sich, und dornenbesetzte Keulen schlugen auf Sokojotsin ein, bevor die Hunde ihn aus der Zelle schleiften. Tendiles Gabe hatte ihm Kraft genug gegeben, sie anzugreifen, doch er leistete keinen Widerstand und schlug nicht zurück. Ihnen würde er die Ehre des Todes nicht gönnen.
Sie zerrten ihn durch das Gefängnis, in das sie seinen Palast verwandelt hatten, zum Tempel, wo ihr Hauptmann stand und Sokojotsins Metallarbeiter beaufsichtigte. Der Schreiber sprach schnell in ihrer unschönen Sprache und wies dabei auf den blutigen Gefangenen.
Der Hauptmann zerrte Sokojotsin an den Haaren und stieß ein paar Worte hervor.
»Du hast die Todsünde des Mordes begangen«, übersetzte der Schreiber. »Dafür und für all deine anderen Verfehlungen wirst du brennen, sofern du uns jetzt nicht das Geheimnis der tausend Schwerter verrätst.«
Sokojotsin hielt die Augen geschlossen und leckte sich das letzte Blut von den Lippen.
»Nun gut. Möge Gott sich deiner bösen Seele erbarmen.«
Sie zerrten ihn zu den dröhnenden Steinen und ketteten ihn mit dunklem Metall fest. Er würde auf den Knien sterben, doch gleich schon würde er sich zu denen gesellen, die vor ihm den Weg zu den Sternen genommen hatten, den schönsten aller Wege.
»Gib es mir.«
Sokojotsin spürte die Hitze an seinem Gesicht, und als er die Augen öffnete, sah er den Hauptmann vor sich. Mit schweren Handschuhen hielt er den Griff einer Schöpfkelle, in deren tiefer Mulde geschmolzenes Gold gelb-weiß und so heiß blubberte, dass winzige Flammen auf dem Rand der Kelle züngelten.
»Öffnet seinen Mund.«
1
1. Juni 2010
»Sie meint, ich versteh die Frauen nicht. Dann steht sie auf und verlässt das Restaurant«, sagte Vincent O’Hara und kippte den Rest Kaffee aus dem Seitenfenster des Wagens. »Einfach so. Und ich muss unsere erste Verabredung allein absitzen und für siebzig Dollar Hummer und Rostbraten essen.«
»Du verstehst die Frauen wirklich nicht.« Charlotte Marena blätterte gähnend die Einsatzberichte an ihrem Klemmbrett durch und zeichnete sie ab. »Warum hast du dir das Essen nicht einpacken lassen und bist ihr nach?«
»Weil ich Hunger hatte.« Sie lachte leise, und Vince warf ihr einen finsteren Blick zu. »Im Ernst, Charlie. Und wäre ich ihr nachgegangen, hätte sie doch alles nur gewaltig aufgebauscht, und ich hätte noch stundenlang Kohldampf schieben müssen.«
»Ich hatte dir davon abgeraten, dich mit einer gebotoxten Bulimikerin zu verabreden«, sagte Charlie.
»So ist sie nicht.« Ihr Kollege klang jetzt nicht mehr so sicher. »Du hast nicht immer recht, was Frauen angeht.«
Sie überlegte kurz. »Na ja – die Letzte war geschieden und nicht Single, die Vorletzte hatte gerade einen Entzug hinter sich, und die Vorvorletzte war schwanger. Also habe ich doch immer recht, was Frauen angeht.«
»Jaja. Und woran hast du es diesmal gemerkt?«
Ihrem Kollegen genau zu erklären, wie sie diesmal hatte wissen können, dass seine neue Flamme abwechselnd von Ess-Brechsucht und ungezügelten Fressanfällen heimgesucht wurde, kam nicht infrage. »Mir ist sofort zweierlei an ihr aufgefallen.« Sie tippte sich an die Stirn. »Nadelstiche.« Sie legte den Zeigefinger an die Lippen. »Und ein etwas strenger, säuerlicher Atem.«
Vince stöhnte. »Das hättest du dir verkneifen können, bis ich mit ihr geschlafen habe, was auch nicht passiert ist.« Er sah auf die Uhr und wechselte auf die Abbiegespur. »Schluss für heute. Übrigens hab ich auf dem Heimweg bei ihr gehalten, um mich zu vergewissern, dass es ihr gut geht. Sie ist weder an die Tür gekommen noch ans Telefon gegangen.«
»Vermutlich war sie gerade damit beschäftigt, alles rauszuwürgen.« Charlotte gähnte erneut, diesmal mit der Hand vor dem Mund. »Du solltest was mit einer Kollegin anfangen. Wir sind zu müde, um neurotisch zu sein.«
Er schnaufte verächtlich. »Du gibst mir doch ständig einen Korb.«
»Ich warte, bis Taylor Lautner volljährig ist.« Sie griff nach dem Funkgerät am Armaturenbrett. »Zentrale, hier Echo Eins-Sieben.« Nachdem die Zentrale die Nummer des Rettungswagens wiederholt hatte, fuhr Charlie fort: »Möchten umkehren zum Allgemeinen Krankenhaus San Francisco.«
Nach einer kurzen Pause kam von der Zentrale: »Echo Eins-Sieben, bitte Position durchgeben.«
Überrascht schaute Charlie auf das GPS. »Zentrale, wir sind mehr als drei Kilometer südlich von Doyle Drive Bayside.«
Die Antwort kam sofort. »Echo Eins-Sieben zur Golden Gate Bridge – Auffahrunfall mit vielen Fahrzeugen und Verletzten. Autobahnpolizei vor Ort.«
Golden Gate Bridge. Charlie gefror das Blut in den Adern.
»Na bravo.« Stöhnend wendete Vince und hielt auf die gewaltige, orangerote Hängebrücke zu, die praktisch von überall in der Stadt zu sehen war. »Verdammte Pendler. Können die keine Viertelstunde später zur Arbeit fahren?«
»Verstanden, Zentrale.« Charlotte schaltete das Blaulicht an, um nicht auf die Brücke zu schauen. »Echo Eins-Sieben trifft in zwei Minuten ein.« Um ihre Phobie in den Griff zu bekommen, erzählte sie ihrem Kollegen eine selbst erlebte Abenteuergeschichte. »Sei froh. Als Tom und ich neulich einen Notruf bekamen, mussten wir eine Schwangere bergen, die sich das Schienbein bei einem bösen Sturz gebrochen hatte. Ich musste die Bahre mit ihr drauf vom äußersten Ende des Anlegers bis zum Rettungswagen schieben.«
»Toll«, meinte Vince. »Das würde ich im Schlaf mit zwei Liegen schaffen.«
»Sie wog dreieinhalb Zentner, schrie ständig nach ihrer Mutter und hätte sich fast die Fixierungen abgerissen«, erwiderte Charlie. »Außerdem lag sie in den Wehen, und als ich sie endlich an der Bordsteinkante hatte und der Hubschrauber sie aufnehmen konnte, war die Geburt in vollem Gange.«
»Du bekommst immer die besten Einsätze, Marena.« Vince schrie auf, als sie ihn gegen die Schulter boxte. »Wirklich!«
Während er mit hohem Tempo Richtung Golden Gate Bridge fuhr, nahm Charlie ihr Handfunkgerät und das von Vince vom Ladegerät am Armaturenbrett und hängte sie an ihre Gürtel. Nach dem letzten Einsatz hatte sie die Sanitätstaschen hinten verstaut, um sie bei Schichtwechsel auszutauschen, und sie hatten kaum noch Verbände. Zum Glück nahmen sie und Vince es sehr genau damit, ihre Reserven bei Schichtbeginn zu überprüfen und aufzufüllen. »Ich packe noch Verbände ein – brauchst du sonst noch was für deine Tasche?«
»Ich hab meine letzte Halsmanschette vorhin verbraucht.« Ihr Kollege überholte einen langsamen Sattelschlepper und überfuhr eine rote Ampel. »Hoffentlich passen alle Fahrer hier auf. Ich bin nicht scharf darauf, Gaffern oder Spurwechslern auszuweichen.«
Den Bürgern einer geschäftigen, dicht bevölkerten Metropole eine qualitativ hochwertige Notfallmedizin zu bieten hatte stets eine große Herausforderung dargestellt, doch seit Gouverneur Schwarzenegger das Gesetz 2917 unterzeichnet hatte, waren die zuständigen Bezirksbehörden verpflichtet, den Großteil der bestehenden Verträge zu überarbeiten. Das Gesetz sollte sicherstellen, dass alle Sanitäter und Notfallmediziner zertifiziert und zugelassen waren und ein polizeiliches Führungszeugnis beibrachten, hatte jedoch dazu geführt, dass fast die Hälfte der privaten Rettungsdienste in der Stadt wegen Verstößen gegen diese Auflagen nur mehr auf Probe zugelassen waren. Viele Notfallmediziner, die eine wenig schmeichelhafte Vergangenheit verschwiegen hatten, waren gefeuert worden, und andere, die sich darüber empört hatten, Fingerabdrücke abgenommen zu bekommen und auch sonst wie Kriminelle behandelt zu werden, hatten gekündigt, was zu einem dramatischen Mangel an qualifizierten Sanitätern geführt hatte.
Die Feuerwehr – seit vierzehn Jahren größter städtischer Dienstleister im Rettungswesen – hatte ohnehin überall Schwierigkeiten, die eingehenden Anrufe innerhalb der eng bemessenen Reaktionszeit zu beantworten. Leider hatte Kalifornien aufgrund seiner wirtschaftlichen Probleme einen Einstellungsstopp verhängt, sodass Charlie und ihre Kollegen praktisch jede Woche Doppelschichten ableisten mussten. Auch kämpften sie mit der neuen Politik des »flexiblen Einsatzes«, nach der Rettungswagen an diversen Verkehrsknotenpunkten der Stadt postiert waren, anstatt am Heimatstandort auf Anrufe zu warten. Das hatte die Anfahrtszeiten verkürzt, doch wenn aus der gleichen Gegend ein zweiter Anruf kam, während die Sanitäter noch beim ersten Einsatz waren, mussten andere Rettungswagen von ihren Posten abgezogen werden, was sofort zu Löchern im Netz führte.
Da half es auch nicht, dass ein Drittel der Anrufe, die die Abteilung jedes Jahr erhielt, keine Notfälle waren. Die meisten dieser Anrufer erwiesen sich als Leute, die nur eine Transportmöglichkeit zum Krankenhaus brauchten und meinten, die Feuerwehr sollte ihnen ein kostenloses Taxi stellen. An manchen Tagen fühlte Charlie sich eher als Busfahrerin und weniger als Sanitäterin.
Die Frontscheibe wurde weiß, als der dichte Nebel der San Francisco Bay sie umfing, die Zufahrt zur Brücke praktisch unsichtbar machte und die beiden Brückentürme wie grellrote Haarklammern erscheinen ließ, die aus dem weißen Schopf einer alten Dame hervorsahen.
Vince schaltete die Nebelscheinwerfer ein und blinzelte durch die Windschutzscheibe. »Siehst du die Autobahnpolizei?«
Charlie sah die roten und blauen Lichter gedämpft durch den Nebel blitzen. »Anscheinend ist der Streifenwagen beim Brückenpfeiler.« Sie ignorierte die zunehmende Beklemmung in ihrer Brust und nahm das Mikrofon. »Echo Eins-Sieben für Zentrale. Bitte geben Sie der Autobahnpolizei Bescheid, dass wir wegen eines Unfalls mit Personenschaden am Südende der Golden Gate Bridge sind.«
»Echo Eins-Sieben, der Sheriff von Marin County leitet den Verkehr Richtung Süden an der Mautstelle auf der anderen Seite der Brücke um«, erwiderte die Zentrale. »Verstärkung seitens der Autobahnpolizei trifft in vier Minuten ein.«
Marin County hatte die Mautstellen geschlossen, sodass keine Pendler mehr Richtung San Francisco auf die Brücke fuhren, doch der Unfall war am Südende der Brücke passiert, wo es keine Mautstellen gab, und die Autobahnpolizei war zwei Minuten hinter ihnen. War der nach Norden strömende Verkehr vormittags noch recht überschaubar, so waren doch in der Hauptverkehrszeit Tausende Autos unterwegs. Die schlechte Sicht aufgrund des Nebels bedeutete eine weitere Gefahr, da sie einen simplen Blechschaden in eine Massenkarambolage verwandeln konnte.
»Was treibt der Polizist da? Steht der bloß rum, statt die Straße zu sperren?«, murmelte Vince. »Bestimmt ein Anfänger, der Kaffee samt Donut übers Geländer kotzt.«
Charlie biss sich auf die Unterlippe und sprach dann erneut ins Mikrofon: »Zentrale, hier Echo Eins-Sieben, kann ich den Polizisten am Unfallort anfunken?« Normalerweise wandten sie sich nicht direkt an die Autobahnpolizei, doch die nach Norden führenden Fahrspuren mussten dringend gesperrt werden.
»Echo Eins-Sieben, der Polizist vor Ort antwortet nicht.«
»Hab ich dir doch gesagt«, so Vince. »Der kotzt sich die Seele aus dem Leib.«
»Oder er reanimiert.« Charlie runzelte die Stirn. Selbst blutige Anfänger wussten, dass sie ihr Handfunkgerät mitzunehmen hatten, wenn sie aus dem Streifenwagen stiegen. Etwas stimmte nicht.
»Was würde ihn sonst so beschäftigen, dass er auf eine Anfrage der Zentrale nicht antworten kann?«, fragte Vince.
Das wusste Charlie genau. »Jemand, der von der Brücke springen will.«
Die Golden Gate Bridge hielt den grausigen Rekord, der weltweit beliebteste Ort für Selbstmorde zu sein. Ungefähr zweimal im Monat sprang jemand von der Brücke knapp fünfundsiebzig Meter tief ins Wasser, und fast alle starben. Wer den Sturz überlebte, der dem Aufprall gegen eine Betonwand mit hundertzwanzig Stundenkilometern entsprach, ertrank danach entweder oder starb an Unterkühlung.
Einige Jahre zuvor hatte Charlie mit Empörung vernommen, dass ein Dokumentarfilmer von der zuständigen Behörde die Erlaubnis bekommen hatte, die Brücke als Denkmal zu filmen, dass er diese Erlaubnis aber dazu missbraucht hatte, dreiundzwanzig der vierundzwanzig Selbstmorde heimlich zu filmen, die sich in jenem Jahr dort zugetragen hatten.
Vince wusste als einer von wenigen, dass Charlie die Brücke mied, doch niemandem war klar, warum. Nun warf er ihr den raschen Seitenblick eines Mannes zu, der zu schnell fahren, sich vorher aber noch vergewissern wollte, ob seine Begleiterin sich deswegen aufregte.
»Ich fordere noch einen Rettungswagen an«, sagte er und griff nach dem Mikrofon.
»Nicht.« Sie legte ihre Hand begütigend auf seine. »Das musste irgendwann passieren.«
»Aber wir müssen da hoch – trotz deiner Brückenphobie«, erwiderte Vince. »Willst du dir das wirklich antun?«
»Aber ja. Mir geht’s gut.« Nein, es ging ihr nicht gut, doch so gern sie den Einsatz anderen überlassen hätte: Sie durfte der Verantwortung nicht ausweichen. Und sie konnte Vince nicht bitten, sie an der nächsten Ecke rauszulassen und den Einsatz allein zu übernehmen. Sie würde ihre Arbeit erledigen – egal, wie viele Geister am Einsatzort auf sie warteten.
»Du hast denen da oben nie davon erzählt, oder?«, fragte Vince.
»So was setzt man nicht in seinen Lebenslauf, Kollege.« Sie rieb sich die Augen. »Ich fahr nicht mal über die verdammte Brücke, sondern nehme immer die Fähre.«
»Dann ist es ein guter Tag, diese Angst zu überwinden«, sagte Vince und gab ihr einen leichten Klaps auf die Schulter. »Die Fähre ist zu langsam.«
Um nicht zu schreien, konzentrierte Charlie sich auf den Einsatz und darauf, was womöglich schiefgegangen war. Die Autobahnpolizei kam, wenn Selbstmörder gemeldet wurden, und oft gelang es ihr, den Lebensmüden ihren fatalen Sprung auszureden. Falls der Beamte vor Ort damit beschäftigt war, hatte er sein Funkgerät vielleicht zeitweise ausgeschaltet, um sie nicht zu beunruhigen.
Doch als sie sich dem Südpfeiler der Brücke näherten, entdeckte Charlie niemanden auf Fußweg oder Geländer, wohl aber den schwarzen Streifenwagen der Autobahnpolizei mit der charakteristischen weißen Tür und dem goldenen Stern – und der Polizist saß noch am Steuer. Er hatte sein Auto vor einem blauen Mittelklassewagen, einem silbernen SUV und einer schwarzen Stretchlimousine geparkt. Den Schäden zufolge war der SUV auf den Mittelklassewagen aufgefahren und hatte dabei dessen Kofferraum und die eigene Motorhaube eingedrückt. Die Limousine stand dem Mittelklassewagen so gegenüber, als sei sie in Gegenrichtung unterwegs gewesen und auf die andere Fahrbahn gewechselt, um Hilfe zu leisten.
Oder der reiche Mistkerl hat seinem Chauffeur befohlen, auf der Brücke zu wenden, und so den Unfall verursacht, dachte Charlie. Das wäre einleuchtender.
Sie musste möglichst viel erfahren, bevor die Sonne aufging; also schloss sie die Augen und horchte. Das Jaulen der Martinshörner und ihr flatternder Herzschlag ebbten ab, und ein anderes Geräusch erfüllte ihre Gedanken.
Der Gedankenstrom durchfuhr sie rauschend. Darf nicht nachgeben, darf nicht zulassen, dass sie erschossen wird, er wird nicht sterben, sie schon, der Schmerz, ich kann ihn nicht ertragen, Mist, ich muss nachdenken.
Die Qual, die er empfand, erreichte sie mit seinen Gedanken und erfüllte sie mit solchem Schmerz, dass sie sich beinahe gekrümmt hätte. Es gelang ihr, den Gedankenstrom zu unterbrechen und sich das Fahrzeug der Autobahnpolizei anzusehen, doch sie wusste nicht, ob es sich um die Gedanken des Ordnungshüters gehandelt hatte.
Vince hielt hinter dem Streifenwagen, und Charlie nahm die Szene mit kurzen, intensiven Blicken in sich auf, als machte sie Schnappschüsse davon. Autotüren standen offen; ein orangefarbenes Rücklicht blinkte; zwei Menschen lagen auf dem Mittelstreifen, ein dritter halb auf dem Fahrersitz des Mittelklassewagens, halb auf der Brücke. Charlie konzentrierte sich auf das Wichtigste der Szene – auf die Opfer – und schätzte die Situation vorsichtig ein. Blutige Kleidung, erschlaffte Gesichter, groteske Körperstellungen. Keiner der drei bewegte sich.
Tod. Einmal mehr war die Brücke in ihn eingehüllt.
»Mist.« Vince legte den Rückwärtsgang ein, wendete so, dass sie dem ankommenden Verkehr entgegenblickten, und schaltete die Rundumleuchte ein. »Bist du bereit?«
Sie nickte. »Los.«
Charlie sprang aus dem Wagen, rannte nach hinten, riss die Hecktüren auf, schnappte sich die beiden Notfallkoffer, hielt kurz inne, um zwei Handvoll Bandagen in eine Seitentasche zu stopfen, trabte um den Wagen herum und warf ihrem Kollegen einen Koffer zu. Er eilte zu den beiden Opfern auf der Straße, während sie sich an den Polizisten wandte.
»Warum sind Sie …« Charlie hielt inne, als sie das verräterische Spinnennetz rings um das kleine Loch in der Frontscheibe des Streifenwagens sah – und das entsprechende Loch in der Stirn des Polizisten. Sie langte in den Wagen, um einen Puls zu erfühlen, den es nicht mehr gab, und griff nach ihrem Handfunkgerät. »Zentrale, hier Echo Eins-Sieben. Notfallsanitäterin Charlie Marena am Südpfeiler der Brücke. Polizist mit Kopfschuss. Sofortige Unterstützung nötig –«
Etwas knackte laut, und das Funkgerät zerbarst in ihrer Hand. Im selben Moment rief ein Mann: »Runter!«
Charlie riss die Tür des Streifenwagens auf, hockte sich dahinter und sah zu Vince, der die Opfer mit seinem Leib zu schützen suchte.
Ein weiterer Strom unverbundener Gedanken drang in sie ein: Goldenes Mitternachtsmädchen, jetzt bist du gekommen – Meister, ich kann es, ich kann sie bringen und meine Belohnung erhalten, ewiges Leben, ja, ewiges Leben an seiner Seite für alle Zeit, in Ewigkeit.
»Charlie.« Vince packte beide Opfer am Kragen und schleifte sie zu ihr rüber. »Ein Schütze.«
Möglichst weit vorgebeugt, kam sie ihrem Kollegen auf halbem Weg entgegen und packte eines der Opfer unter den Armen.
»Was ist mit dem Polizisten?«, fragte Vince.
»Tot.« Sie sah, dass sich die Brust ihres Patienten hob und senkte und Blut aus der Kopfwunde des Mannes sickerte, für den Vince zuständig war. »Aber diese beiden leben. Also vorwärts.«
Es gelang ihnen, die beiden hinter den Streifenwagen zu ziehen und sich Charlies Koffer zu schnappen, ehe ein neuer Schuss fiel, der die Heckscheibe der Limousine zerschmetterte.
Als sie mit der Versorgung der Opfer begannen, hob Vince kurz den Kopf und blickte sich um. »Hast du gesehen, woher die Schüsse kamen?«
Andere Fahrzeuge waren nicht in der Nähe, und es gab kaum einen Ort, wo ein Schütze sich verstecken konnte. Aber der Morgennebel lag wie eine Decke hinter dem Südpfeiler. Der Schütze konnte also ganz ungedeckt auf dem Gehsteig stehen oder sogar auf dem Geländer.
Als der Schütze erneut feuerte, packte sie Vince an der Schulter und zerrte ihn runter. »Pass auf.«
»Hast wieder mal … recht.« Ihr Kollege schwankte und kippte um. Blut floss ihm aus einer langen, tiefen Wunde übers Gesicht.
»Vince.«
Sie legte ihn vorsichtig auf den Asphalt, ließ sich mit gespreizten Beinen auf ihm nieder, musterte die Verletzung, verband sie und versuchte ihn dabei wieder zu Bewusstsein zu bringen. »O’Hara? Komm schon, Kollege. Bei der Arbeit wird nicht geschlafen.«
Seine Lider flatterten, und er stöhnte. »Dieser Drecksack … hat mich erwischt.« Er blinzelte. »Wie schlimm … ist es?«
Sie prüfte seine Pupillen mit der Stiftlampe und war sehr erleichtert, als er normal reagierte. »Ich schätze, du wirst den Scheitel jetzt anders tragen.«
»Charlotte, sind Sie verletzt?«
Dass der Mann im Fond der Limousine sie beim Namen rief, ließ Charlie die Stirn runzeln. »Uns geht’s gut.« Er musste gehört haben, wie sie ihr Funkgerät benutzte, und hatte daraus offenbar geschlossen, dass es sich bei Charlie um die Kurzform von Charlotte handelte. »Bleiben Sie, wo Sie sind. Sind Sie verletzt?«
»Nein, aber meinem Fahrer wurde in die Brust geschossen«, rief er zurück. »Er hat viel Blut verloren.«
Der Fahrer musste es gewesen sein, dessen Gedanken und Schmerzen sie aufgefangen hatte. Oder diesen Fahrer gab es gar nicht, und der Kerl in der Limousine war der Schütze und versuchte, sie aus der Deckung zu locken. Solange sie nicht ganz in die Nähe der beiden käme, würde sie das nicht erfahren. »Sir, wissen Sie, wo der Schütze ist?«
»Am Südpfeiler«, antwortete er. »Auf der linken Seite.«
Charlie warf einen raschen Blick über den Kofferraum des Wagens auf den Pfeiler, sah zunächst aber bloß Nebel und vage Umrisse. Dann drangen erste Sonnenstrahlen durch den Nebel, und ein winziges Schimmern blitzte unten am Pfeiler auf. Im nächsten Moment zersprang ein weiteres Fenster der Limousine in tausend Stücke.
Charlies Erleichterung war von kurzer Dauer. Der Mann in der Limousine versuchte nicht, sie zum siebten Opfer zu machen, wohl aber der Mann am Südpfeiler, und wenn er aus solcher Entfernung so treffen konnte, musste er die Fähigkeiten und die Treffsicherheit eines hervorragenden Heckenschützen besitzen. Das Jaulen näher kommender Martinshörner besserte die Lage nicht – mit genügend Munition konnte der Schütze jeden erschießen, der die Brücke betrat.
Irgendwie musste Charlie die Polizisten warnen.
Rasch durchsuchte sie die Kleidung der beiden Opfer nach einem Handy: Fehlanzeige. »Sir«, rief sie zur Limousine. »Haben Sie ein Telefon dabei?«
»Im Wagen sind zwei, aber ich kann James nicht allein lassen.«
»In Ordnung. Bleiben Sie bei ihm.« Sie schlang sich den Riemen ihres Notfallkoffers um den Hals und hielt ihn so, dass er ihre Brust schützte. Dann begab sie sich auf Unterarme und Knie, sodass der Nebel sie verhüllte, und kroch langsam zu der Limousine.
Das schien ewig zu dauern, und der raue Asphalt war trotz Ärmeln und Hosenbeinen deutlich zu spüren. Charlie hielt den Atem an, wenn sie durch Bereiche ohne Deckung kroch, und betete im Stillen, der Nebel möge sie möglichst gut verbergen. Als sie die glänzende vordere Stoßstange des großen Wagens erreichte, zitterte sie am ganzen Leib.
Kaum war endlich genug Limousine zwischen ihr und dem Scharfschützen, riss Charlie sich den Notfallkoffer vom Leib, richtete sich halb auf, begab sich eilig zu den beiden Männern und ging hinter dem Hinterrad der Limousine in Deckung. Der eine war schlank und dunkelhaarig und steckte in einer Chauffeuruniform, aus deren rechter Jackettseite Blut quoll; der andere hatte goldblondes Haar und einen Bart und war ein Hüne in schwarzem Trenchcoat. Der Hüne wiegte den Chauffeur in den Armen und drückte ihm einen gefalteten, mit roten Flecken übersäten weißen Seidenschal an die Brustwunde.
Er sah aus schmalen, schwarzen Augen zu ihr hoch, die so gar nicht zu seinem nordischen Blondhaar und seiner herrlichen, kaffeebraunen Haut passten.
Eine Art Déjà-vu überkam sie. Charlie hätte auf einen Stapel Bibeln schwören mögen, diesen Mann noch nie gesehen zu haben. Er war zu groß, zu seltsam, zu unvergesslich – und doch … kannte sie ihn.
Diese unvermutete Vertrautheit muss Zufall sein, dachte sie und schüttelte den Eindruck ab. Jemanden wie ihn habe ich schon gesehen – das ist alles.
»Er kann kaum atmen«, sagte der Mann zu ihr.
Sie warf einen Blick auf die bläulich angelaufenen Lippen des Fahrers und seine stark hervortretenden Adern am Hals und war sofort wieder auf ihre Arbeit konzentriert.
»Haben Sie einen Schuss abbekommen?«, fragte sie den Mann im Fond, während sie das Jackett des Chauffeurs aufriss und ihm mit dem Stethoskop Herz und Lunge abhörte.
»Mir geht’s gut«, kam es von hinten. »Was ist mit James?«
»Die Lunge ist kollabiert.« Sie zog ihr Pneumothorax-Pack aus dem Notfallkoffer. »Ich muss die Luft aus seiner Brust bekommen, sonst versagt sein Herz. Wie heißen Sie?«
»Ich bin Samuel, und Sie sind Charlotte.« Er sprach ihren Namen sehr klar und mit nicht geringer Befriedigung aus.
»Charlie, wenn’s recht ist.« Sie lächelte, um den scharfen Unterton ihrer Antwort abzuschwächen. »Und jetzt betten wir James auf den Rücken.«
Kaum hatten sie den Fahrer vorsichtig auf den Asphalt gelegt, entblößte Charlie seine Brust und nahm das Skalpell aus dem Pneumothorax-Pack.
Samuel runzelte die Stirn. »Sie wollen ihn doch wohl nicht operieren? Jedenfalls nicht hier?«
»Nein, ich mache nur einen kleinen Schnitt, um einen Schlauch einzuführen und die Luft abzusaugen.« Während sie alles dazu Nötige auf der Brust des Fahrers arrangierte, bemerkte sie Samuels Miene. »Ich weiß, es klingt unheimlich, aber ich habe das schon hundertmal getan, ohne dass mir jemand dabei gestorben wäre. Also machen Sie mir jetzt keine Szene, okay?«
Er nickte.
»Und los.« Sie schnitt durch Haut und Gewebe und schob den Katheter zur Druckverminderung in seinen Brustkorb. Binnen Sekunden atmete der Fahrer weniger beschwerlich, und seine Lippen röteten sich langsam wieder.
»So gefällt er mir schon besser.« Sie pflasterte den Katheter fest, hörte die Atemgeräusche des Fahrers erneut ab und wandte sich dann dem blutgetränkten Schal zu. »Sam, Sie müssen jetzt Ihre Hand bewegen. Als auf James geschossen wurde, haben Sie da Blut aus seiner Wunde spritzen sehen? Wie einen kleinen Geysir oder Springbrunnen?«
»Es war eher ein Rinnsal. Ein pulsierendes Rinnsal.« Als sie nach einem Ende des Schals griff, nahm er die Hand widerstrebend weg. »Ist es sein Herz?«
Behutsam hob sie den provisorischen Verband an und inspizierte die Wunde – ein kleines, sauberes Loch – und das Blut, das daraus hervorsickerte. »Danach sieht es nicht aus. Die Kugel hat womöglich nur die Lunge gestreift. Näheres erfahren wir, wenn wir ihn ins Krankenhaus gebracht haben.« Sie begann, die Verletzung zu verbinden. »Wo befinden sich die Telefone in Ihrem Wagen?«
»Das eine in der Konsole neben dem Fahrersitz«, sagte Samuel und wies mit dem Kopf darauf, »das andere rechts auf der gegen die Fahrtrichtung zeigenden Sitzbank im Fond.«
An beide Telefone war schwer ranzukommen, sofern sie nicht eine Tür öffnete und in die Limousine kroch. »Die Zentrale weiß nichts von dem Scharfschützen. Ich muss das melden, bevor Verstärkung eintrifft.« Sie fuhr zusammen, als eine Kugel vom Dach des Wagens abprallte. »Dieser Mistkerl. Wie viel Munition er wohl hat?«
»Die Rücksitze sind genau in seiner Schusslinie«, sagte Samuel und wechselte dabei auf die andere Seite des reglosen James. »Ich hole das Telefon von der Konsole.«
Er war schon auf dem Weg zur Fahrertür, ehe sie widersprechen konnte. »Ziehen Sie den Kopf ein«, rief sie ihm nach.
Der Scharfschütze feuerte drei weitere Schüsse ab, ehe Samuel mit dem schnurlosen Telefon zurück war. Als Glas über ihren Köpfen zerbarst, duckte er sich, verlor die Balance und wäre fast gestürzt.
»Oha!« Charlie griff ihn am Ärmel und half ihm, das Gleichgewicht wiederzufinden. »Sagten Sie nicht, Sie seien nicht verletzt?«
»Ich bin nur etwas unbeholfen.« Er beugte sich nach links und rieb sich einen Oberschenkel. »Normalerweise benötige ich einen Gehstock zum Laufen.«
Den sah Charlie zwei, drei Meter weg am Brückengeländer liegen. Der goldene Griff hatte die Form eines Löwenkopfs. »Vorläufig müssen Sie ohne Stock auskommen.« Sie schaltete auf Freisprechen und wählte den Notruf der Zentrale. Sofort war der Schichtleiter dran. »Hier Echo Eins-Sieben, Sanitäterin Marena. Wir haben fünf Angeschossene auf der Brücke und einen Scharfschützen unten am Südpfeiler links.« Sie rasselte die Verwundungen runter und setzte hinzu: »Mein Kollege wurde angeschossen, und ich bin mit zwei Opfern in Deckung gegangen.«
»Warten Sie.« Der Schichtleiter wiederholte die Details am Notfalltelefon der Polizei, dirigierte mit knappen Anordnungen weitere Rettungswagen zum Einsatzort und sagte schließlich: »Echo, wir können erst zu Ihnen kommen, wenn das SEK im Einsatz war. Bleiben Sie auf Empfang und folgen Sie den bei größeren Verletztenzahlen üblichen Verhaltensregeln.«
»Verstanden, Zentrale.« Wieder barst eine Scheibe über ihren Köpfen und ließ Scherben auf sie regnen. »Sagen Sie dem SEK aber, es soll sich beeilen.«
»Ist schon unterwegs«, versprach der Schichtleiter. »Durchhalten, Echo.«
»Was sind das für Verhaltensregeln?«, fragte Samuel, während sie dem Fahrer eine Infusion legte.
Sie riss einen Streifen Klebeband ab und befestigte damit den Mullverband über der Nadel. »Die legen fest, wie wir auf größere Mengen von Verletzten reagieren.«
»Fällt denn die Lage hier unter diese Kriterien?«
»Ja – wie jeder Fall, bei dem es mehr Patienten gibt, als die Sanitäter vor Ort behandeln oder transportieren können. Wir halten uns dann an eine einfache Abfolge von Maßnahmen, die wir schnell durchführen und zu denen auch gehört, jedes Opfer zu markieren.« Sie zog ihre Marken aus der Tasche. »James bekommt ein rotes Zeichen, ist also zu retten, muss aber dringend behandelt werden.« Sie klebte die übergroße Marke auf den Ärmel des Fahrers und steckte Samuel ein anderes Zeichen ans Revers. »Sie sind gehbehindert, darum bekommen Sie die hier.«
Sam sah auf die grüne Marke. »Ich bin nicht verwundet.«
»Wir haben leider nichts für Unverletzte.« Sie schob die übrigen Marken griffbereit in ihre Tasche und schlang sich den Notfallkoffer wieder um. »Ich muss auch den anderen jetzt Marken verpassen. Sie bleiben auf Tauchstation und rufen mich, falls James wieder Probleme bekommt.«
Seine Pranke umspannte ihr Handgelenk. »Sie gehen nirgendwohin.«
Samuel Taske war es nicht gewöhnt, Frauen mit körperlicher Gewalt zu bändigen. Trotz seiner Größe und Kraft, die etwas nahezu Übermenschliches hatten, war er praktisch von Geburt an dazu erzogen worden, Frauen freundlich und respektvoll zu behandeln.
Das war ihm nie auch nur im Ansatz schwergefallen. Er bewunderte alles an Frauen: ihren Geruch und ihr Lächeln, ihre Intuition und Intelligenz. Oft beobachtete er sie mit der Sehnsucht eines Mannes, der sich aufgrund seiner Begabung, die Zukunft einzelner Menschen zu sehen, schon damit abgefunden hatte, sein Leben allein zu beenden. Er hatte diese Fähigkeit nämlich genutzt, um die eigene Zukunft zu erkunden, und einen einsamen Pfad vor sich erblickt, den nie eine Frau kreuzen und keine Kinder beleben würden.
Dass er Charlotte Marena notfalls das Handgelenk brechen würde, damit sie ihn nicht verließ, hatte nichts mit seinen Gefühlen Frauen gegenüber zu tun. Er war nur auf diese Brücke gekommen, um für ihr Überleben zu sorgen – auch wenn sie dafür notfalls in einen Gipsverband musste.
»Sam, ich muss das tun«, sagte sie in dem vorsichtigen und sanften Ton, den sie vermutlich bei Menschen anschlug, die eine psychische Krise durchmachten. »Ich muss sehen, wie es den anderen Verletzten geht, und mich davon überzeugen, dass ihr Zustand einigermaßen stabil ist. Das ist mein Job.«
»Sie können nichts für sie tun, wenn Sie tot sind, Charlotte.« Er ließ sie nicht los. »Die Polizei ist gleich da. Ich höre schon die Martinshörner.«
»Vermutlich ist ein Psychologe dabei, der Geiselnehmer zur Aufgabe bewegen soll«, erwiderte sie. »Das dauert meist ziemlich lange.«
»Dann muss ich Sie derweil mit Geschichten von meiner letzten Reise nach Übersee unterhalten.« Er durfte nicht länger in ihre großen, dunklen Augen schauen, wenn er nicht darin versinken wollte. »Waren Sie schon mal in Paris? Eine sehr alte, prächtige Stadt. Mit hinreißender Kochkunst, aber entsetzlichen Kellnern.«
»Leider nein.« Statt sich aufzuhellen, wurde ihre Miene grimmig. »So gern ich mir Ihre Ausflüge rund um den Globus anhören würde –«
»Hör mal, cabrón!«
Die schrille Stimme kam vom Brückenpfeiler hinter ihnen, und Charlottes Augen wurden schmal.
»Ich weiß, dass du mich hörst, Dummkopf.« Diesem Ausruf folgte ein kurzes Lachen. »He, Schwester – ese tipo tiene mucha lana, was? Vielleicht gibt er dir hinterher ja eine ordentliche Belohnung?«
Samuel runzelte die Stirn. »Ich spreche kaum Spanisch.«
»Ich schon. Er sagt, Sie haben viel Geld«, sagte Charlotte mit geschürzten Lippen. »Kennen Sie den Mistkerl?«
»Aber nein.« Die halbe Wahrheit war besser als eine Lüge. »Ob Sie ihn überreden können, das Feuer einzustellen?«
Charlotte rieb sich die Augen, seufzte und rief: »Señor, deje lo que estás haciendo y escúchame.«
Von nun an sprach Charlotte so schnell, dass Taske ihr nicht folgen konnte, doch er nutzte ihre Konzentration auf den Scharfschützen dazu, einen Handschuh auszuziehen und die Rechte in seinen Mantel zu schieben. James aus dem Wagen zu zerren hatte seine Operationsnaht in der Seite aufreißen lassen, doch aufgrund der Körperwärme war das blutgetränkte Hemd teilweise getrocknet und half nun, die alte Wunde zu stillen. Er hatte überlegt, sie als Vorwand zu benutzen, um Charlotte bei sich zu behalten, doch da sie sich nun auf ein Gespräch mit dem Scharfschützen eingelassen hatte, brauchte er sie nicht mehr zu erwähnen.
Das hatte er ohnehin nicht tun wollen. Charlotte würde dann nämlich fragen, wie er sich die Verletzung zugezogen hätte, und er durfte ihr nicht die Wahrheit sagen. Sie würde nie glauben, dass Werwölfe und wilde Tiere ihn angefallen hatten, gesteuert von Lilah Devereaux, einer mächtigen Kyndred-Freundin, die – so Taske – auch den Schlüssel dazu besaß, seine Krankheit zu kurieren. Er hatte Lilah verfolgt und Detektive engagiert, um sie dingfest zu machen, doch durch sein dummes Verhalten wären sie beide fast umgebracht worden. Schließlich hatte Lilah ihm vergeben, doch Taske schämte sich noch immer.
Charlottes sanfte Altstimme wirkte so beruhigend auf ihn, dass er sich gegen den Wagen sinken ließ und die Sanitäterin beobachtete. Zum ersten Mal, seit seine Begabung aufgetreten war, lieferte sie ihm jämmerlich wenige Details; anders als bei den übrigen Menschen, die er in all den Jahren gerettet hatte, lag die künftige Lebenslinie dieser Frau im Dunkeln. Er konnte nicht erkennen, wer sie war, wo sie wohnte und arbeitete oder wie ihr Nachname lautete. Auch hinsichtlich ihrer Bestimmung tappte er im Dunkeln, obwohl er spürte, dass sie für die Menschheit von großer Bedeutung war. Schließlich hatte er wegen des einzigen ihm bekannten Umstands eingreifen müssen: aufgrund des Wissens, dass Charlotte auf der Golden Gate Bridge von einem Lebensmüden getötet werden würde, falls er sie nicht davor bewahrte.
Ehe sie aus dem Nebel gekrochen kam, hatte Taske nicht mal gewusst, wie Charlotte aussah – auch das war neu für ihn. Irgendwie hatte er einen zierlichen, dunklen Engel mit verführerischem Lächeln erwartet, keine Amazone mit leidenschaftlichem Blick und so vielen Muskeln wie Kurven. Zweifellos hatten ihre üppigen Formen manche Kritik bei denen hervorgerufen, die die ausgezehrten Knochengestelle der aktuellen Mode bevorzugten, doch bei ihrem Anblick dachte er an die Herrlichkeiten vergessener Zeitalter, als hoch aufragende Kriegerköniginnen noch als Göttinnen verehrt worden waren.
Gefolgsleute Apollos hätten sie zu ihrer Hohepriesterin gemacht; die Sonne malte goldene Streifen in ihr brünettes Haar und schenkte ihren braunen Augen bernsteingelbe Tupfer. Ihre gebräunte Haut hatte einen köstlichen Flaum und ließ an reife Pfirsiche denken. Er war nie einer Frau begegnet, die lebendiger und gegenwärtiger wirkte als Charlotte Marena, und das machte seine Mission umso unerlässlicher. Etwas in ihr ließ sie glühen wie ein Leuchtfeuer der Hoffnung; ihre rätselhafte Bestimmung musste direkt mit Hunderten, wenn nicht Tausenden Leben verbunden sein.
Nachdem sie die gleiche Frage dreimal gestellt hatte, schwieg Charlotte und lauschte. Eine Minute verging, ohne dass der Scharfschütze antwortete. Schließlich schüttelte sie den Kopf und sah Taske an. »Das ist kein Chicano … kein US-Amerikaner mexikanischer Abstammung«, setzte sie erklärend hinzu. »Auch den Akzent kann ich nicht zuordnen. Er versucht, wie ein Straßenschläger zu reden, verwendet aber ein sehr formelles Spanisch. Außerdem spricht er etwas undeutlich.«
»Inwiefern ist das von Bedeutung?«
»Es könnte auf Drogen oder eine Psychose hinweisen.« Sie zögerte kurz. »Manchmal schnappen diese Kerle über, weil sie krank sind. Whitman, der im Texas der Sechzigerjahre viele Leute von einem Turm herunter erschossen hat, hatte einen bösartigen Tumor.«
Taske hörte Enttäuschung und Bedauern in ihrer Stimme und sah, dass sie immer nach Osten schaute. »Mit Verrückten kann man nicht verhandeln, Charlotte.«
»Ich weiß. Das können auch die Polizisten nicht.« Sie griff wieder zum Telefon. »Zentrale, hier Echo Eins-Sieben.«
»Ja, Echo?«
»Bitte sagen Sie Stadt- und Autobahnpolizei Bescheid, dass –«
Die schrille Stimme des Scharfschützen meldete sich erneut vom Brückenpfeiler.
»Zentrale, bitte warten.« Charlotte hörte dem Schützen zu und runzelte die Stirn.
»Was sagt er?«, wollte Taske wissen.
»Ich weiß nicht. Etwas über weiße Weidenbäume.« Sie wandte ihm den Kopf zu. »›Die Zeit ist reif für uns zu gehen, bei Tag oder Nacht in die Rätsel des Todes hinab. Ich leiste meinen Tribut‹ oder vielleicht ›meinen Beitrag‹ …«
Ein Schrei kam vom Brückenpfeiler: »¡La Raza Cósmica!«
Sie sah beunruhigt drein. »Oh Gott, jetzt springt er.« Sie erhob sich rasch. »Señor, por favor, escúchame ahora –«
Charlotte war zu weit weg, als dass Taske sie hätte zu Boden ziehen können. Er vergaß die brennend sich um sein Rückgrat windende Schlange, sprang auf und stolperte vor, um sie mit seinem Leib zu schützen. Schon hatte er die Arme um sie geschlungen, als sie aufschrie – aber nicht, weil sie getroffen worden war.
Der schlaffe Körper eines Mannes stürzte vom Brückenpfeiler. Erst verstand Taske nicht, doch dann sah er das Blut in dem ausdruckslosen Gesicht. Im nächsten Moment krachte die Gestalt aufs Brückengeländer, prallte davon ab und verschwand in der Tiefe.
Anscheinend hatte der Schütze ein letztes Menschenleben ausgelöscht – sein eigenes.
Charlotte schloss die Augen und drückte das Gesicht an seine Brust. Sie schwieg, zitterte aber am ganzen Leib.
Er strich ihr über den Rücken und starrte den leeren Pfeiler hinauf. Obwohl der Schmerz in Rücken und Seite noch nicht nachgelassen hatte, spürte er nicht nur überwältigende Erleichterung, sondern auch heftiges Mitleid.
»Ich muss nachsehen, wie es den anderen geht«, sagte Charlotte mit vor Bewegung noch immer belegter Stimme und löste sich von ihm. »Können Sie mir helfen und die Transportliege aus dem Rettungswagen holen?«
Liebend gern wäre er einfach nur zu Boden geglitten, nickte aber und humpelte mit ihr dorthin, wo ihr Kollege und die anderen Opfer lagen. Mit jedem Schritt schoss der Schmerz sein Rückgrat hoch und zerrte an der Wunde. Während sie ihre Marken aus der Jackentasche zog, humpelte er weiter, öffnete die Hecktüren des Rettungswagens, musste kurz innehalten, um Atem zu schöpfen, und schnallte dann den Gurt los, der die Transportliege an Ort und Stelle hielt. Sie aus dem Wagen zu ziehen hätte ihn beinahe auf die Liege kippen lassen, und er hielt sich mit den Händen an der Pritsche fest, um vor Schmerz nicht in die Knie zu gehen.
Sie muss sich bereits um genug Dinge kümmern, dachte Taske und starrte auf seine weiß hervortretenden Fingerknöchel. Ich kann warten, bis weitere Hilfe kommt.
Jahrelange unermüdliche Selbstdisziplin ermöglichte ihm, sich trotz der Schmerzen zu bewegen, bis sie so weit nachgelassen hatten, dass er wieder atmen konnte. Mühsam griff er unter das Gestell und ließ die Räder einrasten.
Charlotte erschien auf der anderen Seite der Liege und wirkte noch bleicher als zuvor. »Sam.«
»Wo haben Sie –« Er verstummte, als er den Mann hinter ihr sah und das Gewehr, das auf ihren Hinterkopf zielte. Es war der Mann, der vom Pfeiler geschossen hatte. Taske war so schockiert, ihn zu sehen, dass er sagte, was er dachte: »Sie haben jemand anderen von der Brücke geworfen.«
»Maul halten.« Der Mann wies mit dem Kinn auf die offenen Hecktüren des Rettungswagens. »Rein da.«
Ehe Taske antworten konnte, raunte Charlotte: »Tun Sie, was er sagt.«
Samuel schob die Transportliege in den Wagen zurück und stützte sich auf die offene Tür, um sich hineinzuhieven. Diese Anstrengung ließ ihn in die Knie gehen, doch er erholte sich schnell.
Charlotte folgte ihm, drehte sich aber sofort zu dem Scharfschützen um. »Bitte hören Sie auf. Lassen Sie uns hier; wir werden nicht versuchen, Sie aufzuhalten. Sie können noch immer fliehen.«
»Niemand entkommt dem Meister.« Die Lippen des Schützen öffneten sich, und herrlich weiße Zähne kamen zum Vorschein, die zu scharfen Spitzen gefeilt waren und ihn wie einen Hai grinsen ließen. Krachend warf er die Hecktüren zu.
Charlotte nahm den Griff und riss daran. »Verriegelt«, sagte sie zu Taske, fuhr herum und musterte das Innere. Als die Tür zum Führerhaus auf- und wieder zuging und der Motor angelassen wurde, erstarrte sie. »Er kann doch nicht … verdammt.« Sie drängte sich an Taske vorbei und trommelte mit der Faust ans Schiebefenster. »He, hören Sie, das dürfen Sie nicht! Die Leute da draußen sind –«
Etwas zischte, und sie taumelte hustend gegen Taske zurück.
Er sah auf ihre Brust und erwartete Blut und eine Schusswunde, doch stattdessen stieg Rauch aus einem kleinen Metallbehälter in ihrem Schoß. Er hielt den Atem an, beugte sich vor und wollte den Gegenstand nehmen, doch der rollte ihr übers Bein und verschwand unter der Transportliege.
Mit brennenden Augen zerrte Taske Charlotte zum Heck des Wagens und warf sich gegen die Türen. Metall knirschte, doch das Schloss hielt. Er rammte die Schulter so lange gegen die Türen, bis weiß glühender Schmerz in seinem Rückgrat loderte und er zu Boden ging und den angehaltenen Atem ausstieß.
Taske hustete hemmungslos, konnte Charlottes schlaffen Körper aber festhalten. Er zog sie an sich und heftete den verschwimmenden Blick auf ihre reglosen Züge. Auch falls der Scharfschütze sie nicht beide tötete, wusste Samuel aufgrund der warmen Nässe, die er aus seiner Seite dringen spürte, wie unwahrscheinlich es war, ihr Gesicht je wiederzusehen.
Sein letzter Gedanke war, sie vollständig enttäuscht zu haben. Ich wünschte, ich wäre stärker gewesen, Charlotte. Dann hätte ich uns beide vielleicht retten können …
2
Der Chef des mächtigsten Biotechnologieunternehmens der Welt musterte die Gesichter seiner Abteilungsleiter am langen Konferenztisch. Keiner war so dumm, Jonah Genaros Blick auszuweichen oder seine Gefühle zu zeigen, doch er spürte die Angst im Raum, eine unsichtbar wallende Wolke über ihren Köpfen.
»Ich habe mir alle Berichte über die Vorfälle in Denver und New York angesehen.« Er ließ seinen Aktenstapel auf den Tisch fallen. »Demnach hat diese Firma es nun zum dritten Mal versäumt, Dinge zu beschaffen, die für eine erfolgreiche Entwicklung des Transerums von essenzieller Bedeutung sind.«
Einer seiner Anwälte rückte unauffällig die Krawatte zurecht. »Mr. Genaro, es wird immer schwerer, unerwünschter Aufmerksamkeit von Medien und Bundesbehörden zu entgehen. Ich rate dringend zu einem neuen Zugang beim … Erwerb dieser besonderen … Güter für unser Projekt.«
»Das sehe ich genauso«, pflichtete ihm Eliot Kirchner, Genaros Chefgenetiker, bei. »Wir wissen seit einiger Zeit, dass eine Gruppe von Leuten untereinander kommuniziert, und wir haben Beweise für eine diesbezügliche Zusammenarbeit. Gut möglich, dass diese Personen sich organisieren.«
»Ich bin anderer Ansicht. Diese Leute wollen sicher nicht, dass jemand erfährt, wer sie sind«, widersprach Don Delaporte, Genaros Sicherheitschef. »Die eröffnen schon keinen Club nur für Mitglieder.«
»Und wie erklären Sie sich die Verluste hier in Atlanta?«, wollte Kirchner wissen. »Hätte Bellamy keine Helfer gehabt, wäre sie nicht entkommen. Genauso wenig wie die Gestaltwandlerin in New York.«
»Wir wissen, dass Andrew Riordan sich in den Bellamy-Fall eingemischt hat«, antwortete Delaporte und bezog sich dabei auf Genaros früheren Cheftechniker. »Aber wir konnten keine Verbindung zwischen ihm und Gerald King aufdecken, der der Gestaltwandlerin dazu verhalf, der Gefangennahme in New York zu entgehen.«
»Verzeihung«, begann Evan Shores, der Oberbuchhalter.
Delaporte beachtete ihn nicht. »Und Riordan war auch nicht in Tina Segretas Unternehmung in Denver verwickelt – Sie sehen überall Verschwörungen, Doktor.«
»Verzeihung.« Shores hatte sich diesmal überlaut zu Wort gemeldet und wand sich etwas, als ihn alle anstarrten. »Es tut mir leid, aber jemand war in beiden Fällen beteiligt, jedenfalls am Rande.«
Genaro setzte sich. »Wer?«
»Ein Antiquitätenhändler namens Samuel Taske, Sir.« Der Buchhalter setzte sich etwas aufrechter hin. »Vor seinem Tod hat Gerald King ihn zum Vogt seines Anwesens bestimmt sowie zum Vormund seiner minderjährigen Tochter.«
»Kings Tochter haben wir bereits überprüft«, fuhr Kirchner ihn an. »Sie ist zu jung, um ins Profil zu passen.«
»Darum geht es nicht, Sir«, versicherte ihm Shores. »Samuel Taske ist auch einen Tag nach Ihnen und Miss Segreta nach Denver geflogen.« Er zog ein Blatt Papier aus seiner Akte. »Ich habe hier die Hotelrechnungen.«
»Was wissen wir über Taske?«, fragte Genaro.
»Als er die Vormundschaft für die Tochter von Gerald King beantragte, haben wir ihn routinemäßig überprüft«, erwiderte Delaporte. »Er ist der Sohn von Davis Taske, dem Eigentümer der großen Discounterkette. Als Einzelkind hat er fünfzehn Milliarden Dollar Familienvermögen geerbt und diese Summe seither verdoppelt, vor allem durch den Handel mit seltenen Kunstwerken und Antiquitäten. Er hält eine Mehrheitsbeteiligung an der Taske AG, arbeitet aber weiter als Antiquitätenhändler in Boston. Seinen Steuerunterlagen zufolge hat er im Laufe der Jahre mehrere Kunstwerke an King verkauft. Auch hat er bei Kings Begräbnis die Grabrede gehalten und ihn dabei seinen ›guten Freund‹ genannt.«
Genaro wandte sich an seinen Buchhalter. »Warum war Taske in Denver?«
»Das weiß ich nicht, Sir«, räumte Shores ein, »aber seinen Steuerunterlagen zufolge ist er oft im ganzen Land unterwegs.«
»Nicht ungewöhnlich für jemanden, der mit Antiquitäten handelt«, gab Delaporte zu bedenken. »Taske ist in seiner Branche gut bekannt und hat die Öffentlichkeit nie gemieden, im Gegenteil: Wir haben Dutzende Fotos von ihm in Zeitungen und Fachzeitschriften gefunden.«
Weil Genaro wusste, wie vorteilhaft es war, sich vor aller Augen zu verstecken, war er nicht überzeugt. »Wo war er denn, als unser Vorhaben in New York scheiterte?«
Shores sah in seine Unterlagen. »Er ist eine Woche vor Gerald Kings Tod nach New York geflogen.«
»Zweifellos, um dessen Tochter aufzuspüren«, sagte der Sicherheitschef. »Die lief von zu Hause weg, nachdem bei King ein unheilbares Krebsleiden diagnostiziert worden war. Nach dem Tod des Alten hat Taske sie gefunden.«
»Und dieser gute Freund von Gerald King reiste zufällig dann nach Denver, als wir dort zwei unserer Erwerbungen verloren.« Genaro setzte sich. »Mr. Delaporte, ich wünsche eine gründliche Durchleuchtung dieses Samuel Taske. Finden Sie alles über ihn raus, was nicht in Antiquitätenmagazinen steht. Mr. Shores, ich erwarte eine vollständige Übersicht seiner persönlichen und finanziellen Angelegenheiten.«
Shores nickte eifrig. »Von welchem Zeitpunkt an, Sir?«
»Von Geburt an, Mr. Shores.« Er musterte seine übrigen Abteilungsleiter. »Alle anderen sammeln weitere Fakten. Ich brauche Listen seiner Geschäftspartner und Mitarbeiter, seiner ärztlichen Unterlagen und Schulzeugnisse – ich will vom ersten Lebenstag an genau wissen, was er getan hat. Bis heute Abend erwarte ich Ihre Zwischenberichte. Und jetzt raus mit Ihnen.«
Alle Angestellten eilten aus dem Konferenzraum. Nur Kirchner blieb zurück und schloss die Tür, als der letzte Abteilungsleiter auf den Flur getreten war.
Genaro würdigte ihn keines Blickes. »Ich bin nicht in der Stimmung, mir einen Ihrer Wutanfälle anzuhören, Eliot.«
»Damit brauchen Sie zum Glück auch nicht zu rechnen.« Der Genetiker legte Genaro eine CD hin. »Die kam gestern Abend aus unserem Labor in Denver. Mehr ließ sich nicht von Segretas Laptop bergen.«
Genaro runzelte die Stirn. »Lassen Sie sie von unseren Technikern analysieren.«
»Ich glaube nicht, Sir, dass Sie Segretas letzte Skype-Sitzung mit Ihnen von Technikern analysiert haben möchten.« Er nahm neben Genaro Platz. »Sie haben sie angewiesen, mich im Flugzeug zu betäuben und zu durchsuchen. Warum?«
Natürlich hatte Tina alles aufgezeichnet; sie hatte ja nicht bloß sich selbst verkauft. »Segreta hat mir den Eindruck vermittelt, Sie würden für andere arbeiten.«
Kirchner zog sein Jackett aus und krempelte die Ärmel hoch.
»Was machen Sie da?«
»Sie haben vergessen, warum ich an Ihrem Projekt forsche.« Er drehte die Handgelenke so, dass die alten, dunklen Narben zu sehen waren. »Sie wissen, unter welchen Bedingungen ich früher gearbeitet habe. Jahrelang war ich in einem Labor eingesperrt, wo man mich zur Steigerung meiner Motivation heroinabhängig gemacht hatte. Nur weil Sie mich gekauft haben, bin ich noch am Leben. Sie haben mich da rausgeholt, für meinen Entzug gesorgt und mir meine Freiheit zurückgegeben.« Er streckte einen Arm aus. »Da draußen wartet der Abgrund auf mich. Und nun sagen Sie mir, warum ich Ihnen das vergelten sollte, indem ich freiwillig in diese Verhältnisse zurückkehre?«
»Sie sind mein wichtigster Mitarbeiter«, erwiderte Genaro. »In letzter Zeit waren Sie launisch und paranoid. Ich muss wissen, warum.«
Kirchner zog den Arm zurück. »Ich experimentiere nicht an Ratten oder Affen, Jonah. Um ein erfolgreiches Transerum zu schaffen, habe ich Entführung, Folter, Mord und das Sezieren von Menschen abgesegnet. Falls wir scheitern, habe ich nur noch ein paar elende Jahre in der Todeszelle vor mir, bevor mir die letale Spritze verabreicht wird. Oder ich stürze wieder in den Abgrund.«
»Wir werden nicht scheitern.« Er blickte hoch, als die Tür aufging und Delaporte eintrat. »Was gibt’s?«