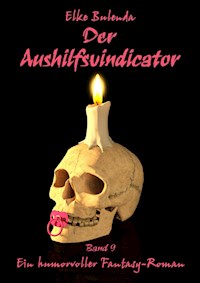Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Es klingt wie ein Witz: Was haben ein verrückter Umweltaktivist, ein Entführer und ein rachsüchtiger Gott gemeinsam? Ganz einfach: Sie gehen dem rüpelhaften Vampir Ragnor gehörig auf die Nerven. Und das gerade jetzt, wo er endlich ans Ziel seiner Wünsche angelangt ist: Frau, Kinder, Eigenheim. Doch bevor er sich mit seinen Lieben in die langersehnten Ferien begeben kann, muss er mal wieder gehörig aufräumen. Eine Weltreise braucht er für sein Team nicht zu buchen, die Spur führt ihn ohnehin bis ans andere Ende der Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elke Bulenda
Das vierte Buch George
Imprint
Das 4. Buch George
Elke Bulenda
Published by: epubli GmbH, Berlin, www. Epubli.de
Nicht hoffe, wer des Drachen Zähne sät, Erfreuliches zu ernten.
(Friedrich Schiller)
Die Mokiki-Krokodilfarm, in der Nähe von Balimo, Papua-Neuguinea.
Drückende, feuchte Hitze. Der überforderte Ventilator versuchte vergebens, im Raum ein annähernd erträgliches Lüftchen herzustellen. Mit dem kläglichen Ergebnis, dass er lediglich die Hitze umrührte und ein verzweifeltes Quietschen von sich gab. Von Kühlung jedoch keine Spur. Jay Stevens, der stolze Besitzer der Krokodilfarm, blätterte in den Unterlagen, kramte ein Taschentuch aus seiner Westentasche hervor und wischte sich den strömenden Schweiß von der Stirn. Vor seinem Schreibtisch, dessen Ähnlichkeit mit einem Schlachtfeld nicht zu leugnen war, saß mit geradem Rücken, der Bewerber namens Sandy Bay. Alles war an ihm seltsamerweise sandig... Sein Haar war sandfarben, die Farbe seiner Augen, selbst die Kleidung besaß den Ton von Sand, und auch seine Haut war ebenfalls sandartig, dazu trocken wie Wüstenstaub. Überhaupt schien ihm die Bullenhitze nicht das Geringste auszumachen. Nicht einmal eine Schweißperle benetzte seine Stirn. Jay Stevens sah verwirrt von den Bewerbungsunterlagen auf, blätterte fahrig darin herum und fragte sich, was ihm hier so spanisch vorkam. War es das aalglatte Auftreten des Bewerbers, das Nichtblinzeln seines Gegenübers, oder die Tatsache, dass dieser über außerordentlich gute Zeugnisse verfügte? Was es auch immer sein mochte, dennoch besaß dieser Typ eindeutig genug Schneid und Kaltblütigkeit, um diesen nicht gänzlich ungefährlichen Job - dank seiner Erfahrung - mit Bravour zu meistern.
Jay stand auf und winkte dem Bewerber.
»Ihre Zeugnisse sind tadellos, ihre Erfahrungen sagen mir, Sie sind der Richtige für diesen Job. Na, dann folgen Sie mir mal unauffällig, Mister Bay.«
»Nennen Sie mich Sandy«, bemerkte der Eiskalte freundlich mit einer Stimme wie Sandpapier und verzog die Mundwinkel, was ihm das Aussehen einer Echse verlieh. Dabei blieben sowohl die Augen, als auch der Rest der Mimik von dem Treiben der Lippen gänzlich unbeeindruckt. Lediglich eine feuchte, sich wie eine Schlange windende Zunge, glitt über seine Lippen. Trotz der vorhaltenden und überaus drückenden Hitze, sandte die Hypophyse des Züchters den Befehl des Fröstelns an den Rest von Stevens Körper. Was dessen Rückenmark sofort und willig weitergab. Er schüttelte kurz das Unbehagen ab und ließ Mister Bay den Vortritt. Irgendetwas in ihm sagte, es sei ungesund, diesen Mann im Rücken zu haben. Er stellte das Radio vor der Tür leiser. Bei Krokodilzüchtern ein gängiger Trick, um durch die Beschallung den Stresspegel der Tiere zu senken, und sie damit an ein gewisses Maß an Nebengeräuschen zu gewöhnen. Er öffnete einen dunklen, nichtsdestotrotz recht tropisch-heißen Raum.
»Wir betreuen hier über Eintausend Exemplare verschiedener Größen. Dort sind die Brutkästen. Die frisch Geschlüpften werden hier vorerst isoliert gehalten. Wenn sie erst mal ein gewisses Alter erreicht haben, setzen wir sie in die Außengehege«, referierte Mister Stevens. Die kleinen Krokodile saßen in den Zuchtbecken und schienen von dem Neuankömmling regelrecht fasziniert zu sein. Der Farmer blickte sich um, und sämtliche Reptilaugen waren auf Sandy Bay gerichtet. Nebenbei stießen sie Quiektöne aus, die sie normalerweise nur in Anwesenheit ihrer Mütter von sich gaben. Stevens kratzte sich verwundert am Kopf. »Seltsam, sie denken, Sie wären ihre Mami. Das habe ich bisher auch noch nicht erlebt!«
»Ja, das scheint so etwas wie eine Gabe von mir zu sein. Obwohl den Reptilien nachgesagt wird, sie seien nicht sehr sozial, kam ich bisher bestens mit ihnen aus. Nicht dass ich mich über den grünen Klee loben möchte, doch schöpfen die Tiere recht schnell Vertrauen zu mir«, bemerkte Mister Bay.
»Ja, wenn das so ist, dann steht ihrer Beschäftigung nichts mehr im Wege. Willkommen im Team der Mokiki Krokodilfarm. Kommen Sie, ich will Ihnen noch unsere Comodowarane zeigen. Wir züchten sie erst seit Kurzem. Wir haben sie aus Indonesien und sie sind mir gelinde gesagt, nicht gerade sympathisch. Aber die Mediziner zeigen großes Interesse an ihren Giftdrüsen, so wie sie Interesse am Immunsystem der Krokodile angemeldet haben«, berichtet Jay Stevens begeistert. »Und das bedeutet für uns ein weiteres, lukratives Geschäft.« Er führte den Neuankömmling durch die Gehege mit den Krokodilen, die alle ihre Köpfe drehten, als die beiden Männer ihren Weg passierten.
»Zum Glück sind diese versponnenen Umweltaktivisten noch nicht auf die Idee gekommen, unsere Tiere in die Freiheit zu entlassen. So schnell können sie wahrscheinlich gar nicht laufen, wie sie selbst in der Nahrungskette landen würden«, lachte Stevens. »Dabei sind wir es doch, die den Umweltschutz unterstützen. Würden wir keine Krokodile züchten, wären die Tiere durch die Bejagung längst ausgerottet. Und solange die Menschen Taschen, Gürtel und Geldbörsen aus diesem Leder begehren, wird sich daran auch so schnell nichts ändern.« Der Farmer betrachtete die Reptilien nachdenklich. »Es sind eben Produkte, ja so hart es klingen mag, diese Tiere sind nichts anderes als Gürtel, Taschen und Krokodilschnitzel. Auf dem Markt für Delikatessen heiß begehrt. Schon probiert? Schmecken ganz hervorragend, fast wie Hähnchenfleisch!«
Der neue Mitarbeiter schüttelte emotionslos den Kopf.
Stevens blieb vor dem Gehege der Comodowarane stehen, die sich in der Sonne aalten. Zuerst hatte es den Anschein als schliefen sie. Doch ihr züngeln verriet etwas anderes. Wie auf ein stilles Kommando hoben sie erst die Köpfe, danach den Rest ihrer massigen Körper. In geschlossener Formation kamen fünf ausgewachsene Exemplare züngelnd und krummbeinig an den Gitterzaun geschlendert.
Das ausgewachsene Männchen stellte sich auf die Hinterbeine und hakte die Krallen vor den Männern ins Gitter.
»Dieser Kerl hier, das ist unser Oskar, der Herr im Haus«, erläuterte Stevens. »Er hat seinen Harem ganz gut im Griff.«
Sandy Bay streckte die Hand aus und kraulte dem großen Reptil den Bauch.
Der Züchter gab eine Warnung von sich: »Das würde ich unter keinen Umständen tun! Wenn er sie beißt, bekommen Sie eine schlimme Infektion!«
»Er wird mich nicht beißen, glauben Sie mir!«
Als ein seltsames Geräusch von Oskar ertönte, das fast schon wie ein Lachen klang, verzog der Farmer das Gesicht. »So wie sich das anhört, glaube ich es fast schon selbst. Das ist außerordentlich bemerkenswert, und obendrein gruselig!«
Doch als er selbst dem Reptil den Bauch kraulen wollte, ertönte ein warnendes Fauchen. »Gut, Oskar, dann eben nicht. Sandy, wie mir scheint, sind Sie ab heute Oskars persönlicher Bauchkrauler. Dann mal viel Spaß. Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo sich das Futter befindet. Die Jungs schieben Kohldampf. So haben Sie gleich die Möglichkeit, sich noch ein wenig beliebter zu machen.«
Wie sich herausstellte, enttäuschte Sandy Bay die Erwartungen seines Chefs wirklich nicht. Er erwies sich als zuverlässiger, mit guten Instinkten ausgerüsteter Mitarbeiter. Er ließ große Sorgfalt walten, was die Hege und Pflege der Tiere betraf. Mit den anderen Mitarbeitern verstand er sich allerdings nicht ganz so gut. Sie respektierten ihn zwar, doch so richtig warm wurde niemand mit diesem seltsamen Menschen. Der Krokodilflüsterer lehnte es strikt ab, mit ihnen nach Feierabend ein Bier zu trinken. Erst recht sprach er nicht über sich, seine Gedanken oder sein Leben. Ein Insiderwitz machte die Runde, dass es sich bei Sandy nicht wirklich um einen Menschen handelte, sondern eher um ein Reptil, das in eine Menschenhaut genäht worden war. Diese Vermutung wurde zuerst laut, weil Sandy der einzige war, der nicht vom Steg aus die Krokodile fütterte, sondern inmitten der hungrigen Reptilien stand, die geduldig warteten, bis er ihnen die Hühner zuwarf, die von der nahen Geflügelfarm geliefert wurden. Wenn Sandy im Gehege stand, herrschte so etwas wie ein Ausnahmezustand. Nicht weil die Krokodile ausnahmsweise Menschenfleisch fressen wollten, sondern Sandy wie ein Dompteur die Echsen zur Ordnung rief und alles völlig gesittet vor sich ging. Wenn er ein Tier, aus der sich windenden Menge herausholen sollte, gab er lediglich einen Schnalzton von sich, und das gewünschte Tier folgte ihm wie ein frommes Lamm.
Alles lief bestens, bis er mit Quindo, dem einheimischen Arbeiter, die Tore der Farm abschließen wollte.
»Willst du dich nicht von den Großen nochmals verabschieden? Morgen geht es ihnen ans Leder«, grinste Quindo, und in seinem dunklen Gesicht strahlten Zähne wie Suchscheinwerfer in der Finsternis.
»Was? Morgen schon? Warum hat mich niemand davon unterrichtet?«, erkundigte sich Sandy.
»Wir dachten, wir verschonen dich vor dieser Hiobsbotschaft, weil du sonst in deinem stillen Kämmerlein Krokodilstränen weinst«, tröstete ihn der Kollege. »Aber weil du mit ihnen so eine besondere Beziehung hegst, dachte ich, du solltest das wissen. Das ist doch nur fair, oder? Hör zu, mir gefällt das auch nicht, es ist sozusagen gegen meine Natur, uns Ureinwohnern sind die Krokodile heilig. Aber damit verdienen wir nun mal unser Geld. Schließlich habe ich eine Familie zu ernähren.Willst du nochmal rein?«
Sandy verfiel augenblicklich in eine Schockstarre. Sein Blick schien Tür und Tor zu durchdringen. Dann kam er wieder zu sich und sah zu seinem Kollegen. »Nein, ich werde jetzt nach Hause gehen. Danke, Quindo, dass du so aufrichtig zu mir warst. Wir sehen uns morgen«, nickte er dem Eingeborenen zu und machte sich auf den Nachhauseweg.
Quindo sah seinem Kollegen bekümmert hinterher, schüttelte den Kopf und murmelte: »Armer Kerl, das bricht ihm glatt das kalte Herz.«
Danach zuckte er mit den Achseln und trollte sich.
Mitternacht. Kein Beobachter ist zugegen, um das sich anbahnende Schauspiel zu betrachten. Folgendes: Ein Schlüssel wird im Schloss gedreht. Das Tor bleibt weit geöffnet. Ein Mann betritt das Gelände und verschafft sich Zugang zu den Gehegen. Auch hier kommt wieder der Schlüsselbund zum Einsatz. Unzählige Augen sind auf eine vertraute Person gerichtet. Diese gibt ihnen das Signal, ihm zu folgen. Unerwarteterweise geht alles mucksmäuschenstill vonstatten. Krallen kratzen leise über Holz und Fliesen. Unzählige Krokodilmütter nehmen die Fährte zu ihrer Brut auf. Bereitwillig werden Mäuler geöffnet, um Eier und die kleinsten Echsen, die nicht Schritt halten können, sicher in Empfang zu nehmen. Die stille Karawane bewegt sich fast lautlos durch das Gebäude. Nur ein Mann steht noch an einem wassergefüllten Becken. Er wirft seinen Hut hinein. Den wird er jetzt nicht mehr brauchen. Er ist offiziell gestorben. Zerrissen und nur noch aus halbverdauten Fleischfetzen bestehend, verteilt in unzähligen Mägen von aggressiven Krokodilen. Möge Sandy Bay in Frieden ruhen, denn er war echt kein übler Kerl.
Der Mann tritt leise an die Spitze dieser seltsamen Prozession. Seine Augen scheinen von innen zu leuchten. Er kniet sich nieder, er reckt und streckt sich. Ehrfürchtige Blicke werden ihm zuteil, als sich seine Proportionen verändern. Er wird größer, seine Haut wird rissig und darunter schuppig; seine Gliedmaßen sind nun stämmiger. Fingernägel werden zu mächtigen Krallen. Hände und Füße mutieren zu großen, Fleisch zerreißenden Pranken. Er schält sich heraus, aus dem beengenden Mantel, menschlichen Fleisches, der ihn bisher umgab. Und aus seinem Rücken sprießen ledrige Schwingen. Der Drache wirkt wie ein König, stehend vor seinen Untertanen. Er wirft einen Blick auf sein Volk und gibt ihnen nickend das Zeichen für den Aufbruch ins gelobte Land. Wie eine ledrige Welle bewegen sich die Reptilien vorwärts. Nur der Comodowaran, Oskar, nimmt sich noch etwas Zeit, um vor dem Tor der Mokiki-Farm einen mächtig dampfenden Haufen zu hinterlassen. Leises, zischelndes Gekicher ertönt. Dann verebbte, die sich windende dunkle Welle, in den tiefen des Dschungels. Immer weiter der Freiheit entgegen; unzählige Leiber gleiten in Bäche, Flussläufe und Seen. Die Natur zeigt ihnen ihren angestammten Platz. Ein Leben in Freiheit, unbehelligt von der Gier und den Waffen der Menschen, fern des Profits. Das jahrtausendealte Gesetz des Stärkeren kommt wieder zum Einsatz: Fressen und gefressen werden. Als das letzte Reptil seinen Platz in der ökologischen Nische findet, schwingt sich der Drache in die Lüfte. Seine Mission ist noch nicht beendet. Es gibt noch viel zu tun. Packen wir es an!
Es ist wohl nur zu verständlich für das, was sich am nächsten Tag in der Mokiki-Krokodilfarm abspielte. Die Polizei war vor Ort. Nicht nur, weil es einen großangelegten Diebstahl zu melden gab, sondern auch einen mehr als tragischen Todesfall. Nur, dass vom Toten nicht mehr allzu viel übriggeblieben war. Kopfschüttelnd und nahezu in Tränen aufgelöst, jammerte der Besitzer der Farm in sein feuchtes Taschentuch, während der Polizist mit stoischer Miene das Gesagte in sein Protokoll aufnahm.
»Gar kein Zweifel! Ich hatte schon gleich so ein seltsames Gefühl bei diesem Burschen. Er blinzelte nie und war viel zu sehr vernarrt in die Tiere, als dass es einem normal erscheinen konnte. Haben Sie das?«, fragte Stevens und ballte die Hand zur Faust. Der Polizist nickte, und der Farmer fuhr fort. »Er hat mein Vertrauen aufs Übelste missbraucht! Ich habe heute mal etwas im Internet recherchiert und ein paar Telefonate getätigt. Die Farmen, die er als seine vorherigen Arbeitgeber nannte, sie kennen den Kerl gar nicht! Er hat seine Identität gefälscht. Prüfen Sie nach, ob jemand in der Psychiatrie diesen Typen vermisst!«
»Es wurde schon alles in die Wege geleitet, Sir«, brummte der Officer und schob sich die Mütze etwas weiter aus dem Gesicht. Obwohl noch recht früh, herrschte schon wieder drückende Hitze.
Stevens war immer noch aufgebracht. »Dieser Bursche hat mich ruiniert! Weg, alle Tiere sind weg! Selbst die Eier im Brutkasten sind verschwunden! Aber eins sage ich ihnen! Das, was mit ihm passiert ist, das geschieht ihm nur zu recht!« Stevens riss sich den verschwitzten Hut vom Kopf und warf ihn wütend zu Boden.
»Sir, beruhigen Sie sich. Der Täter kann unmöglich allein für das Ereignis zuständig gewesen sein. Schließlich können die Eier nicht mit Beinen aus der Farm spazieren. Wir sind mit der Spurensicherung beschäftigt, und ich versichere Ihnen, wenn es Mittäter gibt, dann werden wir sie fassen. Sie werden dann zur Rechenschaft gezogen und ihre Existenz wird nicht den Bach runter gehen müssen«, beruhigte ihn der Officer und blickte auf den staubigen Hut.
Doch wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, konnten keinerlei Wagenspuren, oder Fußabdrücke anderer Menschen festgestellt werden. Die Fingerabdrücke stammten nur von Sandy Bay und den Mitarbeitern der Farm. Die einzigen, vorhandenen und verwertbaren Abdrücke, waren die der flüchtigen Krokodile.
Die Polizei sah es als zu mühsam an, für jedes entlaufene Krokodil eine Fahndung in Gang zu setzen. Zumal die Tiere nicht mit Marken gekennzeichnet waren und somit ihre Identität von einem freilebenden Exemplar nicht zu unterscheiden war.
Bei der Überprüfung von Sandy Bays Konten wurde lediglich bemerkt, dass er den Betrag seines Lohnschecks bei der Bank in Goldmünzen, Krügerrand, umtauschte und dann an sich nahm. Trotz eines vorliegenden Verbrechens, traten die Ermittler auf der Stelle und der Fall wurde wenig später eingestellt. Die Mokiki-Krokodilfarm musste durch diese Folgen ihren Betrieb einstellen und Konkurs anmelden, was auf Zustimmung bei allen befreiten Krokodilen in Papua-Neuguinea und Umgebung traf. Nur einer glaubte nicht an Sandy Bays Tod. Nicht nachdem Quindo eine Krügerrand-Münze in seinem Briefkasten fand, der ihm gut über die Runden half, bis er einen neuen Job als Ranger in einem Naturschutzgebiet fand.
Es gibt kein problematisches Kind, es gibt nur problematische Eltern.
(Alexander S. Neill)
Nicht gerade darum bemüht leise zu sein, stiefelte ein kleiner, blondgelockter Junge in mein Schlafzimmer, kletterte auf mein Bett und hüpfte darauf herum, was mir nicht nur beinahe eine Hirnerschütterung einbrachte, sondern den Kater Joey auch noch dazu veranlasste, die Krallen auszufahren. Und er lag dabei auf meinem Bauch...
Überhaupt frage ich mich, wieso er jedes Mal auf meinem Bauch lag, wenn ich erwachte. Egal wo ich ihn zuletzt ließ, beim Erwachen saß er grundsätzlich dort, wo ich ihn nicht haben wollte. Außer ich befand mich gerade im Ausland. Wäre ich nicht so müde und verkatert gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich über den Besuch der beiden gefreut. Zumindest über den blonden Derwisch, der mein Bett erbeben ließ.
»Papa? Warum liegen da überall trockene Blumen in deinem Bett?«
»Was?«, fragte ich und versuchte den Jetlag abzuschütteln, der mich obendrein auch noch plagte.
… Wir waren gerade wieder aus Chichén Itzá, Mexiko, zurückgekommen, wo wir einem Dämonen das Fell über die Ohren gezogen hatten, der sich für einen Gott der Maya ausgab und keinesfalls auf die obligatorischen Menschenopfer verzichten wollte. Ich arbeite für die geheime Organisation »Salomons Ring« und bin rund um die Welt unterwegs, um Monster, Dämonen und magische Bösewichte zu jagen, die der Menschheit Schaden zufügen wollten. Ich weiß, ein seltsamer Job für einen Vampir, aber es ist eben etwas, das ich besonders gut kann. Früher jagte ich Menschen, doch jetzt setze ich meine destruktiven Kräfte für die Monsterjagd ein ...
»Na, die Blumen! Da, guck doch mal!«, meinte Agnir noch immer hüpfend.
»Hör mal mit dem Springen auf, ich habe Kopfschmerzen. Welche Blumen? Oh, ja, jetzt wo du es sagst. Äh, das ist aus rein medizinischen Gründen.«
… Natürlich ist das nur die halbe Wahrheit, oder eher, eine faustdicke Lüge. Wie gesagt, wir kamen frisch aus Mexiko. Und so manch einer unserer Auftraggeber ist mehr als froh, wenn wir unseren Job zu seiner vollsten Zufriedenheit ausführten. Und so ließen sie schon mal ein kleines Extra springen. In diesem Fall waren es etliche Flaschen besten Tequilas. Und der Rückflug war verdammt lang, und dem Zoll wollten wir schließlich auch nichts schenken. Ja, und als wir ankamen, war ich noch immer sternhagelvoll wie eine Haubitze. Und damit Amanda gar nicht erst auf die Idee kam, darüber aufgebracht sein, schenkte ich ihr einen Strauß Blumen, und trällerte ein kleines Minnelied für sie. (Seltsamerweise kann ich nur betrunken einen Ton halten). Im Grunde genommen sagt sie nie etwas, wenn ich mal einen über den Durst trinke, was nicht mehr allzu oft vorkommt. Zuletzt war ich bei meinem Junggesellenabschied so richtig stramm gewesen. Während die Damen sich mit Prosecco und Chippendales vergnügten, füllten mich die Jungs tierisch ab. Ich feierte mit meinen Kollegen Barbiel, Silent Blobb, Dracon, Simon und den Zwergen. Ach ja, mein Blutsbruder Cornelius war auch anwesend. Während der Party wurde ich das Gefühl nicht los, jemand hätte mir meinen Drink mit K.o.-Tropfen gepanscht, denn als ich nach meinem Blackout wieder zu mir kam, war ich an einem Baum gefesselt. Allerdings guckte die Clique recht bescheiden, als ich wenig später - samt Baum - wieder auf der Party erschien. Nur hätten mir diese Pfeifen ruhig sagen können, dass sie mir zuvor die Hosen ausgezogen hatten. Es war schon eine ziemlich wilde Feier, die mächtig Spaß machte. Sicherlich hatten wir Kerle mehr Action als die gesitteten Damen. Im Nachhinein frage ich mich, wieso sich Frauen damit vergnügen können, Englische Möbel mit einem Gläschen Sekt zu betrachten...
Jedenfalls wäre heute Nacht mit Amanda alles bestens gelaufen, wenn ich nur das richtige Lied parat gehabt hätte. Mir fiel kein besseres ein, als eins von Tannhäuser vorzutragen. Er war damals zu meiner Zeit ziemlich populär. Das Dumme daran ist, er war gewissermaßen der Erfinder des gesungenen Pornos, was Amanda überhaupt nicht zusagte. Erzürnt über mein frivoles und freches Verhalten, schollerte sie mir den Blumenstrauß um die Ohren und rauschte angefressen ins Gästeschlafzimmer, um ihre unschön unterbrochene Nachtruhe fortzusetzen. Statt heißer Liebeständeleien musste ich mit einer kalten Dusche vorliebnehmen, und stürzte anschließend todmüde ins Bett. Jetzt, bei Tageslicht betrachtet, erscheint mir meine Beschwichtigungstrategie weniger brillant, das würde auch den Begriff »Schnapsidee« selbstredend erläutern. Aber sie wird Augen machen, wenn ich ihr die goldenen Ohrringe mit den Türkisen schenke, passend zu ihrer Halskette.
»Aha... Übrigens, ich heiße jetzt Triple A!«, erzählte Agnir stolz grinsend.
Zweifelnd betrachtete ich meinen kleinen Sohn. Sicher, er ist ein Geschenk der Götter, genauer gesagt eins von Odin. Trotzdem war ich wieder mal ein wenig enttäuscht darüber, dass er mir überhaupt nicht ähnlich sieht. Er hat die dunkelbraunen Augen seiner Mutter, und das hellblonde Haar meines Vaters. Na ja, vielleicht bekommt er später mal einen roten Bart, so wie ich. Wer weiß das schon.
»Nein, du heißt Agnir Arvid Amadeus. Ich muss es doch wissen, schließlich haben deine Mutter und ich dir diese schönen Namen gegeben. Und du heißt nicht anders und schon gar nicht ›Triple A!‹. Das hast du doch bestimmt wieder von deinem großen Bruder Gungnir!«, brummelte ich verärgert. Nichts gegen Gungnir, doch er ist ein verdammt geldgeiler Bursche. Und meinem kleinen Sohn so einen Floh ins Ohr zu setzen, finde ich abstoßend.
»Hm, kann schon sein... «, grummelte er und zuppelte Joey am Klappohr herum, so als wollte er es wieder aufrichten, wobei er kläglich scheitern musste. »Ach, Papa, jetzt bist du ja wach! Gehen wir fischen? Du hast versprochen, wenn du wieder da bist, zeigst du mir, wie man Fische fängt. Nana sagte, wenn du wieder wach bist, soll ich dich noch mal darauf ansprechen«, grinste er spitzbübisch und hüpfte wieder auf und ab.
»Verdammt, ich bin in eine Falle getappt!«, stöhnte ich und verzog das Gesicht. »Au, wenn du noch ein Geschwisterchen haben willst, dann solltest du schnellstens deinen Fuß da weg nehmen, klar?« Erleichterung machte sich in mir breit und der Schmerz, der bis in meinen Bauch gezogen war, ebbte langsam ab. »Normalerweise sollte ich mit dir nirgendwo mehr hingehen. Nicht, seitdem du letztens diese Show im Baumarkt mit mir abgezogen hast!«, brachte ich aufs Tapet.
»Aber Nana sagte, wenn mich ein Mann mitnehmen will, soll ich laut schreien!«
… Nana heißt eigentlich Annie und ist seine Großmutter. Eigentlich ist Nana die Großmutter von Agnirs Halbschwester Sascha und Amandas damalige Schwiegermutter. Doch als Amanda und ich uns das Ja-Wort geben wollten, fragte ich mich, wie Agnir reagieren würde, wenn er erfuhr, dass seine heißgeliebte Nana gar nicht seine richtige Großmutter war. Also lösten wir das Problem weitestgehend, indem Annie einfach Amanda, und ich Sascha adoptierte. Ich weiß, das ist alles ein bisschen verwirrend, aber damit haben wir eindeutig unsere Familienbeziehung gefestigt ...
Leicht angefressen sah ich meinen Sohn an: »Ja, im Prinzip ist das schon richtig, aber nicht, wenn der Mann dein eigener Vater ist! Und es ist nicht lustig, wenn mein Sohn schreit: ›Hilfe! Dieser Mann will mich mitnehmen!‹ Das ist überhaupt nicht witzig! Schon gar nicht, wenn man sich in der Gartenabteilung befindet, zwischen Forken, Sensen, Schaufeln und Hacken! Das ist ungesund und weckt unschöne Erinnerungen in mir!«, schniefte ich beleidigt.
»Okay, Papa, das war ein Missverständnis!«, rechtfertigte er sich altklug.
»Oh, ja! Gewiss eines, das deine Schwester Sascha für dich aufklären musste, weil du es nicht bereinigen wolltest, und alle Anwesenden die Absicht hatten mich zu lynchen und mir deshalb absolut kein Gehör schenken wollten! Hör zu, Sohn. Lass Papa noch etwas schlafen, ja? Geh draußen ein bisschen spielen, oder male mir ein Bild. Ich bin echt total gerädert, bin spät, bzw. früh nachhause gekommen. Wenn ich wieder fit bin, dann verspreche ich, mit dir zu fischen, okay?«
Davor musste ich aber noch dringend etwas für Amanda tun. Der Junge wuchs so schnell, dass er schleunigst in die Schule musste. Nun, eigentlich war er noch nicht mal ganz ein halbes Jahr alt, aber Vampirhybriden wachsen schneller als Menschenkinder. Und Agnir sollte kein großes, dummes Kind werden. Denn er hat die besten Anlagen, dank seiner Mutter, ein guter Schüler zu werden. Das Problem ist nur, wir können ihn unmöglich in eine reguläre Schule schicken. Es würde einfach auffallen, wenn er schon nach zwei Monaten so groß wie ein Achtjähriger wäre. Aber ich habe da schon eine Idee. Nur muss Cornelius mitspielen, er wusste nur noch nichts von seinem Glück. Aber das später...
Ganz der Vater, konnte Agnir sich schnell für etwas Neues begeistern.
»Okay, ich male dir jetzt ein Bild und wenn du noch weiterschlafen willst, gehe ich nach draußen. Gut Papa, dann schlaf schön!«, bückte er sich über mich und gab mir einen Schmatzer. »Oh, du piekst!«, grinste er und hüpfte wieder aus dem abgedunkelten Raum. Mal ehrlich, so einem kann man doch wirklich nichts übelnehmen, oder? Noch vor ein paar Monaten war Agnir ein so süßes Baby, ein richtiger kleiner Sonnenschein. Er trank immer schön mein Blut, schlief gut durch und machte nie Probleme, außer mich beim Wickeln anzupinkeln.
Erleichtert und dankbar drehte ich mich auf die Seite und war froh, dass Agnir den Kater mitgenommen hatte. Also ließ ich mich wieder in die Arme von Morpheus gleiten und horchte noch ein wenig an der Matratze. Ein, zwei Stündchen schlummerte ich, bis die Erde zu beben begann...
»Oh, verdammt, das darf doch nicht wahr sein! Warum sagt mir niemand, wenn Handwerker im Haus sind!«, stöhnte ich verzweifelt, jagte abermals den verdammten Kater von meinem Bauch, schlüpfte aus dem Bett, nahm nochmals eine kalte Dusche und rasierte mich. Definitiv war ich jetzt wach. Da ich frei hatte, kleidete ich mich im saloppen Räuberzivil. Angefressen folgte ich dem Lärm und stapfte die Treppe hinunter, wobei ich einen Flip-Flop verlor und beinahe dem Latschen hinterher gekugelt wäre. Vor dem Musikraum blieb ich stehen und lauschte. Dort drin röhrte ein Hirsch und jemand machte sich mit einem Presslufthammer an irgendetwas zu schaffen. Mit boshafter Dramatik riss ich die Tür auf. Sofort verstummte der Lärm. Vor mir saßen die Zwergenjungs mit lächerlich orangefarbigen Zipfelmützen und glotzten mich aus großen Augen an. Ebenso perplex glotzte ich zurück: »Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Und wer hat euch hier reingelassen?«
Herausfordernd tippte ich mit dem Fuß auf.
»Äh ... Und was willst du darstellen? Möchtest du Mister Bein werden, mit deinen Bermudas und den Flip-Flops? Hey, wir üben hier für einen Zwergen-Musik-Contest. Wir sind die Musizierenden Möhrchen. Unser Motto ist: ›Zurück zu den Wurzeln!‹ Und diesmal holen wir uns Gold!«, betonte Tutnix, der olle Klugscheißer, während Jokurt, Jimmy das Eichhörnchen, Weißnix, Kannnix und Franky zustimmend nickten.
»Frau Annie uns lassen gehat rein«, meinte Franky, der eigentlich Kong co Gai heißt. Da aber Trixie meinte, das klänge wie »Ein großer Affe wird schwul«, so nannte sie den Erdlingsmann eben Franky. Seltsam, sonst hat sie einen ausgesprochen schlimmen Geschmack, was Namen betrifft, doch bei ihm handelte es sich eindeutig um eine Ausnahme. Ach ja, meine Tochter Mara schleppte sechs tibetanischen Zwerge an. Fünf Mädchen und einen als Mädchen verkleideten Jungen, eben dieser Franky. Verwundert schüttelte ich den Kopf.
»Was habt ihr gegen legere Freizeitkleidung? Hä, was? Zurück zu den Wurzeln? Mir dünkt, ich werde gleich ein paar Wurzeln schlagen! Potzblitz! Und warum bläst er da in eine Gießkanne, und Jokurt hämmert auf einem Stück Stein herum, und was soll, zum Teufel auch, dieser Presslufthammer?«
»DAS IST SO: ZWERGEN-MUSIK WIRD MIT UNSEREN WERKZEUGEN GEMACHT. NA JA, HEUTZUTAGE BENUTZEN WIR AUCH SCHON MAL EINEN PRESSLUFTHAMMER. DER TUNNELBOHRER IST EINDEUTIG ZU GROSS«, erläuterte Jimmy, indem er durch sein Megaphon brüllte.
»Argh! Du Schwachkopf!«, entriss ich ihm wütend die Flüstertüte und briet ihm eins damit über seine Pelzmütze, die er unter seiner albernen Zipfelmütze trug. »Wenn Annie geahnt hätte, was ihr für Lärm macht, hätte sie euch sicherlich nicht reingelassen! Musik? Das soll Musik sein? Das ist nur Krach! Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, besteht Musik aus einem Rhythmus, etlichen Noten und einer Melodie!«, klärte ich sie auf. »Ich verabscheue es, wenn jemand Musik spielt, und nur Lärm produziert! Immer wenn ich Schostakowitschs Violinkonzert höre, klingt es für mich, als würde jemand ein Fenster mit einer Rasierklinge abkratzen!«
»Lärm? Das musst du gerade sagen!«, rückte sich Jimmy die Mützen wieder gerade. »Du kannst noch nicht mal einen Ton halten, geschweige denn Noten lesen. Wie willst du gute Musik bewerten können?«
»Jetzt mach mal halblang, du Gartenschmuck! Wir Vampire haben das absolute Gehör!«, klärte ich ihn auf.
Der Kleine fühlte sich provoziert, krempelte die Ärmel hoch und setzte sich auf den Klavierhocker. Allerdings kam er nicht an die Klaviatur heran, also rief er Jokurt, der sich wiederum auf den Sessel legte. Dann setzte sich Jimmy auf seinen keuchenden Bruder: »So, welcher Ton ist das?«, fragte er neunmalklug.
»Äh, ich höre nichts!«
»Gut, denn das war nur der Notenschlüssel!«, grinste er und ich verdrehte die Augen. »Höre und lerne! Welcher Ton ist das?«, fragte er und schlug eine Taste an.
»Das ist ein gestrichenes G. Noch Fragen?«, meinte ich.
»Woher weißt du das, wenn du gar keine Noten lesen kannst?«, hakte er nach.
»Ich kann zwar keine Noten lesen, aber ich weiß wie ein gestrichenes G klingt!«
»Hm, das peile ich nicht, aber egal. Sag, welcher Ton ist das?«, schlug er die nächste Taste an.
»Das ist ein dis!«, grinste ich. Danach versuchte er es noch mit einem a, einem gis und sogar mit einem Dreiklang-Akkord. »Wie wäre es, wenn du in unterschiedlichen Farben dazu blinkst, dann können wir ein bisschen Senso spielen«, kommentierte ich.
»Gut, das ist richtig, das gebe ich neidlos zu. Okay, ich glaube dir. Senso? Sieh dir Jokurt an, er ist schon ganz blau im Gesicht«, schmunzelte er und pumpte noch das letzte bisschen Luft aus Jokurts Lungen, indem er gehässig auf und ab hüpfte. Darauf entbrannte zwischen den beiden Brüdern eine Keilerei, die ich geflissentlich ignorierte.
»Gut, ich gebe euch eine Stunde, während ich außer Haus bin, danach macht ihr einen Abgang, klar? Wo ist Annie eigentlich?«, wollte ich wissen.
Franky meldete sich wieder radebrechend zu Wort: »Okay Boss. Annie geht holen kleine Sascha von Schule ab.«
Dafür, dass er noch nicht lange zu unserer Crew gehörte, sprach er schon ganz ordentlich unsere Sprache. Kein Wunder, wenn er die ganze Zeit mit diesen Schwatzbacken verkehrte, musste zwangsläufig bei ihm ihr Vokabular hängen bleiben. Ich schloss die Tür und überließ sie ihrer Radaumusik. Beinahe hätte ich Agnir über den Haufen getreten. Er wollte mich gerade am Poloshirt zupfen.
»Huch, schleich dich nicht so an! Ich weiß, dass du es kannst, aber lass das lieber bleiben. Solange du noch so ein Zwerg bist, kann das gefährlich werden!«
»Papa, guck mal, ich habe dir ein Bild gemalt!«, verkündete er stolz wie Oskar.
»Hm, lass mal sehen.« Daraus wurde ich nicht schlau, es sah aus wie eine Kreuzung eines Da Vinci, mit Experimenten von Dr. Frankenstein. »Ähhhh...«, sagte ich und machte eine etwas unbeholfene Geste.
»Das ist eine Zeichnung von Link Rattus. Hier, guck mal. Aus seinem Schwanz werden zwei Wirbel entnommen, in der Mitte gespalten und dann an seine Hand genäht, dann hat er zwei prima Daumen!«, strahlte er über beide Backen.
»Grundgütiger! An jeder Hand zwei Daumen? Ach so, einen Daumen an jeder Hand! Wer bist du, und was hast du mit meinem Jungen angestellt? Sag mal, bist du ganz von allein drauf gekommen?«, fragte ich leicht verdattert.
Agnir nickte stolz: »Jawoll! Ich hörte, wie Mama darüber sprach und da habe ich mir ein paar Bücher aus unserem Regal genommen und mir die Anna Toni angesehen!«
»Du meinst wohl Anatomie. Hm, und wie sollen seine Daumen heilen?«
»Papa! Natürlich mit Vampir-Spucke!«, verkündete er im Brustton.
»Ach so...«
»Weißt du, ich will das Gleiche werden wie Mama!«, verriet er mir.
»Wie jetzt? Du willst Ärztin werden?«, grinste ich.
»Nee, ich bin doch nicht schwul! Nein, ich werde Arzt! Aber erst mal muss ich in die Schule. Papa, wann komme ich endlich in die Schule?«, quengelte er.
»Gut, dass du dieses Thema gerade ansprichst...« Ich stutzte. »Warum willst du nicht das Gleiche werden wie ich?«, hakte ich nach.
»Nö, ich will doch kein Seeräuber werden!«
»Wie kommst du darauf, ich sei ein Seeräuber?«
»Na ja, deine Haare! Und du bist immer eine Zeitlang weg. Und wenn du wiederkommst, bringst du Mama immer Gold mit!«, erklärte er geduldig.
… Früher, als ich noch ein Mensch war, war es als Nordmann sozusagen Pflicht, ein paar Raubzüge zu machen. So gesehen hat Agnir recht. Andererseits, könnte ich auch bei einer Versicherung gearbeitet haben. Denn wir cleveren Nordmänner haben die Versicherung gewissermaßen erfunden. Wir drangsalierten die Leute solange, bis sie uns Schutzgeld zahlten. Danach konnten sie versichert sein, dass wir so schnell nicht wieder auftauchten...
»Seltsam, viele Jungen würden alles geben, um Pirat zu werden. Aber ich bin kein Pirat! Jedenfalls jetzt nicht mehr. Siehst du vielleicht einen Handhaken und eine Augenklappe?«
»Nein, aber du hast Ohrringe!«, versicherte er mir.
»Ja, das ist schon richtig, aber ich habe keine Augenklappe! Weißt du, was das Schlimme an einer Augenklappe ist?«
»Dir würde ein Auge fehlen?«
»Das auch, aber mit einer Augenklappe sieht keiner, wenn du schielst!«, lachte ich und verwuschelte meinem Sohn das Haar. »So, und jetzt tigern wir gleich los. Du willst doch in die Schule, damit du mal ein gescheiter Doktor wirst. Geh du schon mal raus, ich hole noch ein paar Sachen und dann treffen wir uns vor der Garage, alles klar?«
»Jepp, ich wollte dir da sowieso etwas zeigen!«, meinte er und stürmte hinaus.
»Langsam!«, mahnte ich, doch er hatte schon die Tür hinter sich ins Schloss geknallt. Seufzend ging ich nach oben und packte ein paar Klamotten zusammen.
… Was wollte dieser neunmalkluge Knirps in der Schule? Er konnte doch schon lesen. Seine Schwester weihte ihn in dieses Geheimnis ein. Das merkte ich daran, als er sich beschwerte, dass die Sieben Zwerge keinesfalls mit ihren Keulen auf die böse Stiefmutter einschlugen. Dabei wollte ich das Märchen einfach nur mit mehr Action ausschmücken. Er nahm mir das Buch aus der Hand und las mir vor. Ich war nicht nur erstaunt, sondern wenig später auch eingeschlafen und wachte nur auf, weil mir der Sabber aus dem Mundwinkel tropfte und den schlafenden Kater Joey weckte...
Ich suchte wie blöde und fand meine goldene Geldklammer nicht, die ich von Gungnir zu Weihnachten bekommen hatte. Auch Amanda vermisste eine goldene Kette. Und Annie suchte ihre goldene Gartenkugel. Ebenso meinte Sascha, sie hätte ihren Schlüsselanhänger verloren, den mit der großen Strasskugel. Ich hoffe nur, der Junge steckt nicht dahinter... Obwohl, ich kann mir nicht denken, er könnte anderen Leuten das Eigentum wegnehmen. Dafür ist er zu klug. Das Reinigungspersonal ist auch absolut integer. Zwar gehen bei uns die Zwerge ein und aus, aber bisher hatten sie unserem Besitz - außer meinen Getränken - noch nie große Beachtung geschenkt. Und wenn sie es auf Gold abgesehen hätten, würden sie einfach diesen dämlichen Contest gewinnen. Auch mein Team hielt sich bei unseren Pokerpartien im Haus auf. Doch sind sie wie Brüder für mich und keiner würde den Schneid besitzen, mich zu bestehlen. Sie würden wohl kaum den Anschiss mit heiler Haut überstehen. Nun denn, falls es in unserem vier Wänden einen Dieb geben sollte, würde ich ihn früher oder später in die Finger bekommen. Ich werde einen Köder auslegen und wenn die Falle zuschnappt - dann gnade ihm Gott!
*
Die Welt, obgleich sie wunderlich, ist genug für dich und mich.
(Wilhelm Busch)
Es ist wirklich toll, noch einmal nach über 600 Jahren Vater zu werden, bzw. zu sein. Natürlich habe ich aus meiner zweiten Ehe drei Kinder - Gungnir, seinen Zwillingsbruder Wally, zu dem ich keinen Kontakt habe, und meine Tochter Mara -, doch wie gesagt, sie sind schon mehr als nur erwachsen, so gesehen, regelrecht steinalt. Meine beiden Zwillingssöhne waren schon zwei steinharte Brocken, trotzdem bin ich immer wieder überrascht, was kleinen Kindern für denkwürdige Sachen einfallen. Und die Fragen erst mal, die sie ständig stellen! Da gehen mir schon mal die Antworten aus. Irgendwie überraschte es mich gar nicht, was ich unten vor der Garage zu sehen bekam. Agnir spielte sehr oft mit Karl-Heinz, dem depressiven, letzten Einhorn. Und diesmal hatte mein Sohnemann den Bogen doch für meinen Geschmack ein wenig zu sehr überspannt. Verständlicherweise finde ich es gut, wenn der Kleine den armen Karl-Heinz auf andere Gedanken bringt, ihn aber so zu hintergehen, finde ich schon mehr als geschmacklos.
»Moin Ragnor, na? Wie sehe ich aus?«, fragte Karl-Heinz in ungewohnt heiterem Ton.
»Moin, Flauschi. Äh, na ja. Unter uns, du siehst ganz schön gefährlich aus!«, log ich.
»Ja, ich bin ein Indianerpferd, das bereit ist, in die Schlacht zu ziehen!«, bekundete er. »Weißt du, es befriedigt mich nicht auf Dauer, nur meinen Kopf in den Schoß einer Jungfrau zu legen. Früher freuten sich die jungen Damen, brachen gerührt in Tränen aus, aber heutzutage? Sie treten dir in den Hintern und brüllen etwas von ›Sexueller Belästigung‹ und ob ich pervers sei!«, schüttelte er seinen Kopf. »Die Jungfrauen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren! Und immer nur als Motiv für die Federmäppchen kleiner Mädchen herzuhalten, nein, das macht mich regelrecht unglücklich! All diese Pastellfarben, Glitzer und Regenbogen; Plastikfiguren mit frisierbarer Mähne! Also, das habe ich wirklich nicht verdient!«, seufzte er resigniert. Ständig öffnete ich den Mund, um etwas zu erwidern, aber Karl-Heinz redete sich dermaßen in Rage, dass ich keine Lücke fand, um etwas einzuwerfen.
»Du hast es gut, Ragnor! Du hast einen sinnvollen Job, darfst immer wieder die Welt retten und hast somit eine Daseinsberechtigung -, aber ich? Nein, ich wäre wirklich lieber ein Streitross und würde vorzugsweise im Schlachtengetümmel sterben, als weiterhin niedlich genannt zu werden! Wolltest du was sagen?«, fragte das Einhorn.
»Nee, ist alles okay, sehe ich genauso!«, winkte ich ab. Meine Aufmerksamkeit richtete sich auf meine Lendenfrucht. »Agnir, kann ich dich mal für einen Moment sprechen?«, nickte ich in Richtung Garage, die ich öffnete. Brav folgte er mir.
»Ja? Papa, was gibt´s?«
»Was es gibt? Wenn ich nicht so ein friedlicher Zeitgenosse wäre, eine Handvoll Schläge! Was denkst du dir nur dabei, Karl-Heinz mit einer Fleischzerlegungsskizze zu verzieren? Bisher sah ich noch nie ein Indianerpferd, dass für das Filetieren beschriftet war! Und woher hast du den Lippenstift? Der ist doch bestimmt von Mama, habe ich recht?«
»Äh, ja... Wenn er auf dem Schlachtfeld sterben will, hat er sicherlich nichts gegen ein Schlachthaus einzuwenden. Den Plan sah ich beim Metzger, da dachte ich mir, er sieht aus, wie eine Bemalung für Indianerpferde«, erklärte er mir. »Und den Lippenstift habe ich von Mama, die sagte, sie hätte sich in der Farbe vergriffen und sähe mit diesem Rot aus, wie eine Hure. Er lag im Mülleimer! Also wollte sie ihn nicht mehr. Papa? Was ist eine Hure?«
… Huch, ich wusste, eines Tages würde diese Frage kommen, so wie jede andere Frage, die es auf dieser Welt gab. Agnir wollte immer alles ganz genau wissen...
»Ja, eine Hure ist eine Liebesdienerin, eine Dienerin der Käuflichen Liebe.«
»Hm, komisch, ich wusste gar nicht, dass man Liebe kaufen kann. Wie viel kostet denn Liebe, und warum will Mama keine Liebesdienerin sein?«
»Na ja, das ist Körperliche Liebe, die man kauft, und der Preis ist je nach Dienstleistung unterschiedlich. Ich will mich jetzt nicht auf einen Preis festlegen. Außerdem machen das Frauen, die das Geld brauchen. Und Mama verdient recht gut, also braucht sie keine Liebe zu verkaufen. Sie hat uns so sehr lieb, dass gar keine Liebe mehr übrigbleibt, die sie verkaufen könnte. Hast du das jetzt verstanden?«
»Ja, ich glaube schon«, nickte er nachdenklich.
Ehrlich gesagt, fand ich diesen roten Lippenstift sehr erotisch auf Amandas Lippen. Und ich fände es nicht schlimm, wenn sie speziell für mich wie eine Hure aussähe. Wie heißt es immer so schön? Eine Frau soll in der Küche ein Engel sein und im Bett eine Hure. Für mich darf sie aber auch mal gern in der Küche eine Hure sein, das macht mir nicht das Geringste aus. Ehrlich nicht!
»Okay, wir wollen los. Fährst du mit deinem Rad?«, fragte ich und sah die Lücke in der Garage, wo eigentlich mein roter Sportwagen stehen sollte.
»Nein, ich reite! Und zwar auf Karl-Heinz!«
»Wie? Du reitest auf Karl-Heinz... Wie kommst du denn auf ihn rauf? Du bist noch viel zu klein für so ein großes Ross. Reiten solltest du lieber auf Duffy, dem Haflinger deiner Schwester. Aber der steht drüben im Stall und da latsche ich jetzt nicht erst hin.«
»Das wirst du schon sehen wie ich auf Heinzis Rücken komme, das habe ich schon x-mal gemacht«, prahlte der kleine Angeber.
»Aha, jetzt hast du dich verplappert! Hier, dann setz gefälligst deinen Fahrradhelm auf! Den wirst du noch brauchen!«, stöpselte ich ihm das Ding auf den Kopf.
»Och, Männo!«, moserte er zurück und machte den Kinngurt zu.
… Am liebsten hätte ich auch gemosert, denn Annie nahm statt unserer Familienkutsche, wieder mal meinen Sportwagen. Mir ist klar, dass er ein wenig mehr Wumms hat, als unser SUV. Doch ist ein Zwölfzylindermotor, mit 6,5 Litern Hubraum und über 500 KW, einfach kein Gefährt, womit man Sascha von der Schule abholt. Mal ganz davon abgesehen, wie es aussieht, wenn vorne auf dem Beifahrersitz ein Kindersitz festgeschnallt ist! Der Wagen war ein Geschenk von Gungnir, den ich eigentlich nicht haben wollte (Den Wagen, nicht Gungnir!), weil es mir peinlich war, vom eigenen Sohn ein Auto zum Geburtstag geschenkt zu bekommen. Zuerst wollte ich ihn verkaufen (Ich rede immer noch vom Wagen, nicht von meinem Sohn!), doch als ich dann das erste Mal mit dem Wagen fuhr, überlegte ich es mir anders. Das war eindeutig ein Spielzeug für mich. Nichts für eine ältere Dame, denn das Geschoss fährt sich wie ein Römischer Kampfwagen. Dringend musste ich mal ein paar Takte mit Annie sprechen...
»Gut, dann kann es ja losgehen. Und überlege dir schon mal, wie du wieder das Fell von Karl-Heinz sauber bekommen willst.«
»Ach, Männo!«, sprach´s, trat an das Einhorn heran, das bereitwillig den Kopf senkte. Agnir fasste das Horn, hielt sich daran fest, während Karl-Heinz ihn auf den Rücken hievte. Das sah wirklich nach einem eingeübten Stück aus. Der Junge wickelte seine Hand in die lange weiße Mähne und gab Bescheid, dass er soweit wäre. Endlich konnte wir los zuckeln. Karl-Heinz nahm mir die Jutetasche ab und ließ sie an seinem Horn baumeln.
»Hurra, wir gehen jetzt fischen!«, jubilierte Agnir.
»Ja, aber erst gehen wir zur Zentrale, danach fischen wir, klar?«
Wieder kam ein »Ach, Männo!«, doch wenn er den Grund unseres Besuchs erfuhr, würde er darauf anders reagieren. Sehnsüchtig blickte er dem kleinen See hinterher, an dem wir vorübergingen. Von der Villa Ballerburg bis zur Zentrale ist es schon ein gutes Stück Fußmarsch. Endlich angekommen, nickte ich den Wachposten zu, verschaffte uns mit meiner Mitarbeiterkarte Einlass und blickte zum Einhorn. »Gehst du mit rein?«
»Nein, ich gehe nicht mehr zu Dr. Dr. Gütiger. Ich bin austherapiert, er bekommt nur meinetwegen auch noch Depressionen. Ich geh mal zu Yak, dem Ripper rüber, mal sehen, was es Neues gibt. Man sieht sich!«, seufzte er.
Wir winkten ihm hinterher. Er wischelte mit dem Schweif, trottete seines Weges, nicht ohne vorher noch zu versuchen, sich von einem Jeep anfahren zu lassen. Nur kannten wir alle unseren Depri-Karl-Heinz. Wenn er sich nähert, werfen alle sofort die Micke rein, damit sein Selbstmord keinen Erfolg hat. Armer Kerl.
Agnir ist, so wie seine Schwester Sascha, der Liebling aller Mitarbeiter. Kaum einen Meter kommen wir weit, nicht ohne von jemanden angesprochen zu werden. Agnirs Kopf wird mehr getätschelt, als Ernestine, das kleine Socken-Monster. Außer Agnir, Sascha und die Tochter von Simon und Delia, die den obskuren Namen »Nevia Navi« trägt, gibt es keine weiteren Kinder in unseren Reihen. Natürlich haben andere Mitarbeiter auch Kinder, doch ist ihnen der Zutritt unserer geheimen Zentrale verwehrt. Niemand würde glauben, was hier bei uns alles herumläuft. Außerdem müssen alle Mitarbeiter eine Schweigeklausel unterschreiben, was ihre Angehörigen betrifft. Annie weiß zwar, dass ich ein Vampir bin, denn wie anders hätten wir ihr erklären können, wieso unser Agnir wie Unkraut wuchs? Mir fiel es nicht leicht, ihr dieses Geständnis zu machen, doch tätschelte sie mir lediglich die Wange und sagte: »Ich wusste gleich von Anfang an, dass du etwas Besonderes bist. Es ist schön, einen starken Mann im Haus zu haben, der die Gläser aufschrauben kann, aber eins sage ich dir, Freundchen! Wenn du jemanden von uns beißt, dann ergeht es dir schlecht. Und dies ist keine leere Drohung!«
Ja, das ist Annie. Doch merkte sie sehr bald, dass ich keinerlei Interesse an ihrem, oder am Blut meiner Lieben hatte. Es war sehr kompliziert ihr das Wichtigste zu erläutern, doch ging sie damit relativ gelassen um. Sascha dagegen wusste es schon, sie begleitete ihre Mutter öfter mal zur Arbeit und ist auch das Patenkind von Cornelius, zu dem sie ein inniges Verhältnis hegt, was ihr daraufhin ein Pony einbrachte. Und Kinder gehen wie selbstverständlich mit Abnormitäten um. Offenbar erstaunt sie nichts so schnell und sie legen eine Toleranz an den Tag, von der wir Erwachsenen uns noch einen Scheibe abschneiden können. Vielleicht liegt es am Fernsehen, weil sie dort alle möglichen CGI-Effekte sehen und schnell abgebrüht gegenüber Absonderlichkeiten sind. Immerhin wachsen sie mit Hobbits, sprechenden Mäusen, singenden Chipmunks, und blauen Schlümpfen auf. Selbstverfreilich nicht das depressive Einhorn zu vergessen, das ständig um unser Haus herumlungert. Ich nahm Agnir auf dem Arm, damit er nicht von Ogern, Zentauren, oder Orks niedergetrampelt wurde. Für ihn war es jedes Mal wie ein Besuch im Disneyland.
»Siehst du da die Topfpflanze in der Ecke?«, fragte ich ihn. Er schaute mich an und nickte.
»Wenn ich nicht mit meinem Aurenblick geguckt hätte, wäre mir der Kerl gar nicht aufgefallen. Wer verkleidet sich schon als Ecke eines Raumes?«, meinte Agnir verwundert.
»Das ist unser Spezialist der Abteilung ›Tarnen, Trügen und Täuschen‹ er nennt sich ›Will Inkognito‹, er will in cognito bleiben. Manchmal gibt er sich aber auch die Namen: ›Mister X‹, ›John Doe‹, und ›Dr. Strange‹, wobei er es deutsch ausspricht, und nicht englisch. Letztens war er ›Wer? Meinen Sie mich?‹ Wenn du mich fragst, hat der Kerl eine Persönlichkeitsstörung! Damit du es verstehst, der Typ ist balla balla!«
Ich flüsterte dem Kleinen etwas ins Ohr und er grinste. Wir liefen an der getürkten Zimmerecke vorbei, während Agnir winkte und rief: »Hallo, Herr Inflagranti!« Worauf ein leise gemurmeltes: »Ach! So ein Mist!« ertönte. Ja, bei Salomons Ring laufen schon die absonderlichsten Leute herum. Und wenn sie nicht herumlaufen, sitzen sie in irgendwelchen Büros.
»Agnir? Wollen wir erst mal Anna Stolz besuchen? Ich kann jetzt einen Kaffee gebrauchen, mit dir kleinem Quälgeist kommt man ja zu nichts!«
»Klar, ohne Kaffee kann man nicht kämpfen!«, grinste er und tätschelte mir die Wange.
»Wo hast du den Spruch schon wieder aufgegabelt?«, fragte ich erstaunt.
»Von Nana, den sagt sie immer, wenn sie sich einen Kaffee eingießt.«
Bereitwillig ließ Agnir sich von mir in die Kantine tragen. Er besuchte diese Räumlichkeiten nur zu gern, weil Anna, meine Diätassistentin, immer eine kleine Überraschung für ihn parat hat. Als sie uns beide sah, strahlte sie über beide drallen Backen. »Ja, wer kommt denn da? Wenn das nicht unsere beiden Hünen sind! Was kann ich für euch tun? Eine Portion Blut für jeden?«, fragte sie und drehte sich schon halb in Richtung des Schranks, in dem sie das Blut aufbewahrte.
»Hallo Anna, für mich einen Blut-Kaffee, halb und halb.« Ich sah Agnir fragend an. »Möchtest du etwas?«
»Nee, ich trinke doch keinen Kaffee!«, beschwerte er sich.
Anna machte mein Getränk fertig. »Agnir, wie wäre es mit der Überraschung des Tages?«, fragte sie lächelnd.
Agnir war Anna gegenüber immer ein wenig zurückhaltend. Wahrscheinlich aus reiner Kalkulation. Wenn er es sich mit ihr verscherzte, wäre es mit den Überraschungen des Tages aus für ihn.
»Ja, bitte!«, meinte er schüchtern und drückte sein Gesicht an meine Brust.
»Aha, bei Anna kannst du plötzlich ›Bitte‹ sagen. Hey, warum denn so zurückhaltend, das kenne ich gar nicht von dir!«, grinste ich und zwinkerte der Köchin zu.
Sie reichte Agnir ein Wassereis über die Theke. Eigentlich kein herkömmliches Wassereis, sondern ein Bluteis. Der Kleine ergriff es und bedankte sich höflich.
»Ach, Agnir. Du bist so ein süßes und höfliches Kind! Das hast du aber nicht von deinem Papa«, meinte sie lachend, tätschelte Agnirs Gesicht und ging wieder an die Arbeit. Wir setzten uns an einen Tisch. Schon allein aus Gründen der Sicherheit. Dieses Geklecker geht nämlich ganz schlecht wieder aus den Klamotten heraus. Agnir braucht durch sein rasches Wachstum sowieso ständig neue Kleidung. Deshalb war es vernünftiger, nicht auch noch die passende zu ruinieren. Eine kleine bärtige Zwergin erblickte uns, winkte und hielt direkt auf unseren Tisch zu. Trixie Eisenfaust ist die Mutter der musizierenden Zwerge bzw. Möhrchen. Eine sehr resolute Person, die das Zwergenregiment mit strenger Hand führt. Eine kleine Matriarchin, mit der man sich nicht anlegen sollte, zumindest nicht als Zwerg. Nein, ich korrigiere: Auch anderer Gestalt nicht.
»Na, ihr beiden?« Sie setzte sich auf einen Stuhl und konnte kaum über die Tischkante gucken.
»Na, du eine? Was gibt´s Neues?«, fragte ich.
»Hallo Trixie! Ich heiße jetzt Triple A!«, grüßte Agnir und widmete sich wieder seinem Eis.
»Ach wirklich, Triple A? Zu mir sagen sie immer: ›Aua, du hast mich heftig in den verlängerten Rücken getreten!‹«, grinste die Zwergin. »Ragnor, hast du es schon gehört? Wir haben eine neue Präkognitive! Sie heißt Helma Schmidt, kommt wohl von der Küste, habe ich so mitbekommen«, sprach sie im verschwörerischen Ton.
»Und, sieht sie gut aus?«, fragte ich. Bei Delia, die unser vorheriges Orakel war, handelt es sich um eine echte Ausnahmeerscheinung. Jung, blond, blauäugig. Eine fast schon Nordisch zu nennende Schönheit.
Trixie kicherte sich ungehalten in den Bart: »Rechne mit dem Schlimmsten und leg dann noch mächtig eins drauf! Aber sieh selbst. Ach ja, den Kleinen würde ich nicht mitnehmen. Sie ist echt ein bisschen gruselig und dort herrscht ziemlich dicke Luft. Lass ihn mal lieber bei Amanda!«, gab sie besorgt zu Gehör.
Ich verstand die Zwergin nicht ganz. Nun, ich wollte ohnehin zu Amanda. Mich für die letzte Nacht entschuldigen und diese Gelegenheit gleich nutzen, ihr mein kleines Präsent zu überreichen. Es war immer so: Wenn ich nur mal kurz in die Zentrale gehen wollte, ergab sich meistens etwas Größeres daraus. Ich treffe unterwegs so viele Leute, dass ich gar nicht meinen direkt eingeplanten Weg gehen kann, sondern immer ein paar Stunden dranhängen musste.
»Okay Trixie. Ausnahmsweise berücksichtige ich mal deinen Ratschlag. Bist du soweit, Agnir? Warte, du hast da etwas am Mundwinkel!«
Mit einer Serviette wischte ich ihn sauber.
»Dann macht´s mal gut. Man sieht sich!«, nickte Trixie und kicherte wieder.
Selbst wenn ich nicht Amandas Dienstplan kennen würde – ich könnte sie jederzeit in diesem großen Gebäude finden. Quasi immer der Nase entlang. Ihr Duft ist so betörend, dass er mir schon fast als bunte, in der Luft hängende Girlande vorkam. Mittwochs hielt sich meine Angebetete immer in der Leistungskontrolle auf. Dort wurde ich auch schon etliche Male getestet, gewogen und vermessen. Wir traten ohne zu klopfen ein, denn bei diesem Lärm, den die Geräte veranstalteten, hörte sie ohnehin nichts. Als sie uns sah, blitzte ein kurzes Lächeln auf, bevor sich wieder die Maske ihres Pokerface herabsenkte. Sofort nahm sie mir den Jungen ab, gab ihm einen Kuss und setzte ihn an ihren Schreibtisch. »Na, meine beiden Männer? Wir war euer Tag?«, fragte sie und gab mir ebenfalls einen Kuss. Und ich fühlte mich durch diesen Kuss so unendlich geadelt, wodurch mir fast vor Stolz die Brust schwoll. Argwöhnisch blickte ich mich um, doch die Probanden waren alle auf ihre Aufgaben konzentriert.
»Wir waren bei der dicken Frau, die schenkte mir ein Eis und nannte uns Hühner!«, erzählte Agnir aufgeregt. »Warum nennt sie uns Hühner? Wir legen doch keine Eier und gackern?«, fragte er gleich darauf, was wieder bewies, dass es keine Frage auf dieser Welt gab, die er nicht zu stellen imstande war.
»Die dicke Frau heißt Anna Stolz, ist nicht dick, sondern vollschlank. Und sie sagte nicht Hühner zu uns, sondern Hünen. Hünen sind große Leute. Aber du bist ja noch ein kleiner Kerl, sozusagen ein Hünchen«, grinste ich.
»Ach so! Also keine Hühner!« Diese Antwort befriedigte unseren Sohn und er versank sofort in einer anderen Tätigkeit. Er hatte sich einen Bleistift genommen und malte auf einem Block herum. Da Junior jetzt beschäftigt war, zog ich Amanda etwas von ihm weg, denn auch er verfügt über ein ausgezeichnetes Gehör.
»Amanda, es tut mir wirklich leid, wie ich mich heute Morgen benommen habe. Ich hoffe du kannst mir verzeihen. Nur schade um die schönen Blumen!«, bedauerte ich und gab ihr die Schachtel mit den Ohrringen. »Nein, das ist kein Bestechungsversuch, die habe ich schon erstanden, bevor ich diesen verbalen Ausrutscher beging. Na ja, wenn du sie nicht haben willst... Ich würde sie ja selbst tragen, doch Blümchen sind nicht ganz mein Stil.«
Amanda öffnete das Kästchen und betrachtete die Ohrringe, dann warf sie mir einen strengen Blick zu, der mir die Ohren erröten ließ. Dann lächelte sie.
»Du bist ein unverbesserlicher Quatschkopf! Danke, die sind wirklich wunderschön. Nein, ich bin dir nicht wirklich böse. Wie könnte ich, wenn du so lieb, wie ein großer, dummer Junge vor mir stehst und mir diesen Dackelblick zuwirfst? Aber, wie würdest du reagieren, wenn ein schwer angetrunkener, schielender und keinesfalls kleiner Kerl vor deinem Bett stünde?«, machte sie mir mit ruhiger Stimme klar. »Und dann dieses Lied! Du weißt, ich bin dir körperlich nicht gewachsen, also gehe ich lieber woanders hin, ehe die Situation eskaliert. Zum Glück bist du betrunken eher ein wenig anhänglich und tapsig, jedenfalls nicht aggressiv. Aber um die Blumen war es keineswegs schade, denn sie waren schon schwer verwelkt und hinfällig.«
… Oh, ich vergaß: Blumen halten in meiner Gegenwart nicht lange. Es liegt einfach an meiner negativen Aura. Von mir aus, nennt es ein schlechtes Karma. Blumen welken, Spiegel zerspringen und selbst die Milch wird in meiner Gegenwart sauer. Aber wenn ihr mich fragt, gibt es weitaus Schlimmeres. Z. B. eine Ehefrau, die nicht in der Lage ist, einen kleinen Fehltritt ihres Ehemanns zu verzeihen. Zu meinem Glück zählte mein Herzblatt nicht zu dieser Kategorie...
»Puh, danke Liebes! Ich bin dir wirklich dankbar, weil du es mir nicht krumm nimmst. Normalerweise bin ich jemand, der einen Shitstorm provoziert, der ihm anschließend um die Ohren fliegt«, erwiderte ich erleichtert.
»Schade nur, dass die zu den Ohrringen passende Kette verschwunden ist. Ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, sie verloren zu haben. Zuletzt war sie in meinem Schmuckkästchen. Dort hat sie sich anscheinend einfach in Luft aufgelöst!«, bemerkte sie leicht betrübt.
»Ja, irgendetwas geht bei uns zuhause nicht mit rechten Dingen zu. Aber ich werde mich darum kümmern, das verspreche ich dir, Liebes!«
»Das ist nett von dir. Hast du schon mit Cornelius geredet?«, erinnerte sie mich.
»Ja, zu dem grauen Zausel wollte ich gleich hin, aber erst will ich mir unser neues Orakel ansehen. Trixie meinte, ich solle Agnir bei dir lassen. Kann er ein paar Minuten bei dir bleiben? Ich hole ihn nachher ab, es dauert nicht lange.«
Amanda wusste wohl mehr als ich, sie nickte und kurz blitzte wieder dieses wissende Lachen auf. »Na ja, Agnir ist vorerst schwer beschäftigt. Aber schraube deine Erwartungen ein wenig zurück. Helma ist nicht die Spur so wie Delia. Ach, und noch etwas... Nimm eine Gasmaske mit!«
Offensichtlich hatte Amanda einen Clown gefrühstückt. So gut gelaunt habe ich sie selten erlebt. Ich warf ihr einen fragenden Blick zu, gab ihr noch einen Kuss, winkte meinem Sohnemann und machte mich auf den Weg. Hinter mir hörte ich noch meinen Sohn brüllen: »Tschüss Papa, bis nachher!«
*
Die Zukunft ist etwas, das meist schon da ist, bevor wir damit rechnen.
(Unbekannter Verfasser)
Ja, und da war es wieder, das mir bekannte Schild, das verriet: »Bitte Ruhe! Orakel bei der Arbeit!«
Unschlüssig, ob ich sie jetzt stören sollte oder nicht, entschloss ich mich gerade anzuklopfen, als von innen eine brüchige Stimme ertönte: »Du brauchsttt nicht anzuklopfen, Rrragnorrr. Komm einfach rrrein!«
Schon von außen war mir ein ziemlich markanter Geruch aufgefallen, doch als ich die Tür öffnete, wurde er hundertmal intensiver. Und die Sicht betrug gleich null – jetzt verstand ich auch den Witz mit der Gasmaske. Dichter Tabakrauch versperrte mir die Sicht, so dass ich meinen Aurenblick einsetzen musste, um festzustellen, wo sich Frau Helma Schmidt aufhielt. Zum Glück wurden diese Räume recht gut belüftet, sonst hätte ich diese dicke Luft in Würfel schneiden und auf dem Wochenmarkt als Nikotin-Konzentrat an den Mann bringen können. Die Absauganlage röchelte mit Frau Schmidt um die Wette. So weit es mir möglich war, bewegte ich mich in das Epizentrum des Rauchs. Und da saß sie nun, Frau Helma Schmidt. Schnell packte ich auf meine enttäuschten Erwartungen noch heftig eins drauf. Diese Frau war alt – ach was! Uralt... Sie sah aus, als wäre sie schon Noah beim Bau der Arche behilflich gewesen.
»Du bisttt also Rrragnorrr. Falls du es noch nicht weißttt, mein Name isttt Helma Schmidttt, das rrrauchende Orrrakel«, stolperte sie über den spitzen Stein. Das klang eindeutig Hanseatisch. Und irgendwie kam sie mir bekannt vor, nur wusste ich nicht, an wen sie mich erinnerte. Irgendjemanden, den ich schon öfter in Bild und Fernsehen sah. Anscheinend waren dem lieben Gott die Backformen ausgegangen, denn es gibt immer jemanden, der einem anderen ähnlich sieht. Und wenn man so alt wie ich ist, dann hat man schon sehr viele Leute gesehen.
»Ich brauche dich wohl nicht erst zu fragen, woher du weißt wer ich bin, oder?«, fragte ich gerade heraus. Außerdem trug ich meinen Ausweis am Revers. Die Alte drückte ihre Kippe im Aschenbecher aus, der auf ihrem Schoß ruhte. Sie nickte mir zu und ich betrachtete verstohlen ihren Rollstuhl, an dem sie gefesselt war. Also sprichwörtlich, nicht mit Riemen und Gurten, oder so. Um nicht arrogant zu wirken, tastete ich nach einem Stuhl und setzte mich vorsichtig. Das Ding knarrte zwar erbärmlich, hielt aber meinem Gewicht stand.
»Du gucksttt so entsetttzttt, isttt es mein Alterrr, derrr Qualm, oderrr derrr Rrrollstttuhl?«, fragte sie mit einer rauen, vom Quarzen gut trainierte Stimme.
»Äh, warum sitzt du im Rollstuhl? Ein Autounfall?«, fragte ich unverblümt.
Ehe ich wusste wie mir geschah, zog sie die Decke von den Beinen zurück. Es qualmte darunter hervor, als hätte Häuptling Weiße Feder eine Einladung zum Lunch mit anschließendem Verdauungspfeifchen auf den Weg geschickt.
»Rrraucherrrbeine! Ist so eine Familienerrrbsache. Die habe ich von meinem Grrroßvaterrr geerrrbt«, grinste sie.
Geschockt und gleichzeitig fasziniert, betrachtete ich die qualmenden Beine...
»Die sehen auch wirklich wie alte Männerbeine aus! Die brauchte dein Großvater wohl nicht mehr, wie?«, platzte es ganz spontan aus mir heraus. Worauf Helma Schmidt in ein eruptives, heiseres Raucherlachen ausbrach. Dabei röchelte sie dermaßen, dass in mir der Verdacht aufkeimte, es ginge gleich mit ihr zu Ende.
»Jo, mien Jung, das könnte man vermuten. Ich mag es, wenn jemand kein Blatt vorrr den Mund nimmt, die meisttten spppielen nur den Betrrroffenen, aberrr du bisttt witzig, das mag ich«, tätschelte sie mir die Wange. Dabei fragte ich mich, seit wann mir eigentlich neuerdings so oft die Wange getätschelt wurde. Irgendjemand musste doch damit angefangen haben, und bemerkte wohl dabei, dass ich ihm nicht den Arm brach. Normalerweise lasse ich mich von niemanden gern anfassen. Aber anderthalb Jahre bei Salomons Ring, und schon ließ ich mich wie ein dressierter Hund tätscheln. Fehlt nur noch, ich beginne spontan mit dem Schwanz zu wedeln... Aber so gesehen, hatte Helma Schmidt eine Art von Welpenschutz bzw. Greisenschutz. Wir Nordmänner verehren unsere Seherinnen. Sie waren schon immer hoch angesehen, weil sie in direkter Verbindung mit den Göttern stehen.
»Du bist auch witzig. Jetzt bin ich aber doch betroffen! Musst du dir schon wieder eine Kippe anzünden? Das Rauchen ist doch schlecht für die Gesundheit!«, gab ich zu bedenken. »Hast du es schon mal mit Nikotin-Pflastern versucht?«
Das rauchende Orakel warf mir einen vernichtenden Blick zu: »Ja, natürrrlich, was denksttt du denn! Klarrr habe ich schon Nikotin-Pflasttter verrrsuchttt! Aberrr die stttanken bestialisch, als ich sie anzündete, und geschmeckt haben sie mir auch nicht!«
Ob das nun ein Witz sein sollte, ließ ich mal so im Raum stehen, zuckte lediglich mit den Schultern und guckte ratlos. Helma machte eine Geste, die sie von oben bis unten einbezog.
»Meinsttt du, ich sollte in meinem Alterrr mit dem Rrrauchen aufhörrren? Ich bin fast siebzig...«
Kaum merkbar zog ich eine Braue hoch.
»Na ja, du hasttt mich durchschaut, das isttt gelogen, eine Dame schwindelt immerrr ein wenig, wenn es ihrrr Alter betrrrifft. Gut, ich bin neunzig. Nun rrrechne mal: Nikotin ist errrsttt nach zwanzig Jahrrren vom Körrrper abgebaut, oder warrr es Teerrr? Sehe ich wie eine Optimistttin aus? Meinsttt du, ich sollttte mich noch an meinem Lebensende mit einem Entzug quälen? Es gibt nurrr einen Weg zur Lunge... Lass ihn mich teerrren!«
Mein lieber Scholli, das war mal ein Statement! Ich nickte und war leicht irritiert. Doch sie war noch nicht am Ende, schien sogar genervt, weil ich ihr das Rauchen abgewöhnen wollte. »Außerdem rrrauche ich nicht, weil es mir schmeckt. Ich rrrauche, damit die Luft nicht so schlecht isttt, wenn meine Beine die ganze Zeit überrr rrrauchen. Was meinsttt du, wie übel meine Nächte sind. Stttändig muss ich Gefahrrr laufen, mein Bettzeug könnte brennen.«