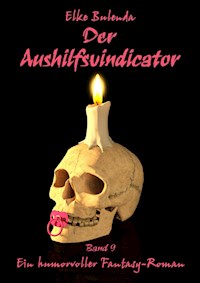Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ragnors siebtes Abenteuer: Der Rüpel-Vampir ist chronisch unzufrieden. Sein Job ödet ihn an; die On-Off-Beziehung zu Molly scheint endgültig den Off-Status erreicht zu haben, und sein Sohn ist schwer am Pubertieren. So kommt es ihm gerade recht, als ausgerechnet ein Dämon namens Qwertz Uiopü Fufluns Pacha um Ragnors Hilfe bittet. Qwertz, einst der Gott von Wein, Weib und Gesang, heute eher unwichtig und vergessen, steckt in schlimmen Schwierigkeiten. Eine Kinder mordende Hexe belegte ihn mit einem üblen Fluch. Na, das kann ja heiter werden… Ragnor auf gemeinsamer Mission mit dem, der Sex, Drugs and Rock ´n´ Roll erfand...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elke Bulenda
Der dämliche Dämon
Ein humorvoller Fantasy-Roman
Der Dame vom Geheimdienst und ihrer Tochter…
Copyright: © 2016 Elke Bulenda
Coverdesign: Elke Bulenda
Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.Epubli.de
Erstes Buch
Prolog
Eine Residenzstadt im finsteren Mittelalter.
»Herrin! Der Pöbel hat bereits die Festung gestürmt und treibt in der Vorratskammer und dem Weinkeller sein Unwesen!«, stürmte derOrdensritter in die Turmkammer. Ohne anzuklopfen, versteht sich.Atemlos fuhr er fort. »Doch die Aufrührer sind noch immer nicht zufrieden und jetzt, nachdem sie die Möglichkeit hatten sich Mut anzutrinken, wollen sie Euer Blut fließen sehen! Sie fordern sogar lautstark Eure Verbrennung!«
Roxana blickte eher gelangweilt von dem dicken Wälzer auf, in dem sie tief versunken gelesen hatte. Mit einem Lesezeichen markierte sie gelassen die zuletzt gelesene Stelle. »Wo sind die Kinder? Von welchem Pöbel redest du da? Die, die dort so einen Lärm veranstalten? Wieso trauen sich diese vermaledeiten Bauerntrampel überhaupt, einen Fuß in die heiligenHallen der Lichtritter zu setzen? Geh gefälligst zu Lord Seraphim und behellige mich nicht länger! Pah! Wie wollen diese Narren dort draußen, ohne einen Klafter Brennholz, ein Feuer entfachen? Verschwinde und sorge für die Einhaltung der Ordnung!«, wedelte sie den getreuen Ritter mit lapidarer Handbewegung wie eine lästige Fliege davon.
Leicht verwirrt betrachtete der Ritter die Dame am Lesepult. Offenbar war ihr nicht klar, wie brenzlig die Situation bereits zu werden drohte. Willibald von Raunheim, so der Name des Ritters,bekleidete das Amt des Leibwächtersfür dieDame vor ihm, die im Allgemeinen von jedermann, allerdings hinter vorgehaltener Hand, nur schlichtweg »die Fremde« gerufen wurde. Keine Frage, Roxana schien dem Lord Seraphim von Anfang an lieb und teuer zu sein, weshalb sie von seiner Lordschaft die Turmkammer, das Astrolabium, die vielen Bücher, Pergamente, Folianten und seltsamen Gerätschaften zur Verfügung gestellt bekam - deren angebliche Wichtigkeit von Raunheim nach wie vor ein Rätsel blieb - und natürlich stellte der Lord ihr einen Leibwächter zur Verfügung, der wie der Name schon sagt, den Leib und natürlich auch den Rest der holden Dame schützen musste. Zwar wurde ihr und Lord Seraphim ein Affäre angedichtet, doch genaue Beweise dafürblieben fällig.
In der Burg und drumherum, kursiertenjedoch dieGerüchte, die Fremde sei eine Hexe. Dabei war noch nicht einmal klar, ob sie überhaupt eine Fremdländerin war, oder nur dementsprechend aussah. Roxana besaß einen eher dunkel zu nennenden Teint, dunkelbraune Augen, die von dichten schwarzen Wimpern umkränzt, ihr das Aussehen einer Südländerinverliehen. Dazu ihr volles schwarzes Haar, welches sie nicht wie andere blasse, hohe Damen, gescheitelt und mit einem Tuch und Reif bedeckt trug, sondern in wilden, wallenden Locken unbändig über Schultern und Rücken fließen ließ.
Zumindest beherrschte Roxana die höhere Magie. Ansonsten wäre sie kaum in der Lage gewesen, die kompliziert gefertigten Runensteine für die Ritter des heiligen Michael herzustellen. Diese Runensteine waren immens wichtig für die Ritter, denn sie zeigten die unmittelbare Nähe eines Vampirs an. Und Vampire waren der Grund, weshalb die Ritter dem Orden des Lichts dienten. Ihre heilige Aufgabe bestand darin, die Menschheit von der Geißel, den Vampiren, zu befreien. Sobald sich ein Vampir in Reichweite eines Lichtritters aufhielt, begann der magische Runenstein grün zu leuchten. So war es den Rittern ein Leichtes, einen Vampir aufzuspüren, der sich ansonsten perfekt in seinem Umfeld zu tarnen und zu bewegen verstand.
»Herrin! Es gibt heute keine Kinder, die Euch zur Notspeisung besuchen. Habt Ihr es denn noch nicht vernommen? Der Komtur, Lord Seraphim, ist tot!«
»Tot?«, echote Roxana verständnislos, und betrachtete die vollen Brotkörbe, die wohl weiterhin voll bleiben sollten, da keine hungrige Kinderhand danach griff. »Wie ist das passiert?«
»Jawohl, tot, Herrin! Vom Vampir Ragnor gemeuchelt!«, bestätigte Ritter von Raunheim.
»Ragnor, dieser anmaßende Trottel!«, knurrte die Fremde abfällig. »Wieso konnte er nicht einfach auf dieser verdammten Insel bleiben? Ich riet Seraphim davon ab, weiterhin Ragnors Dienste in Anspruch zu nehmen! Gerade waren wir ihn und seine unheilige Brut losgeworden. Wie froh alle über seine Entscheidung waren, als er bekannt gab, in den Ruhestand zu gehen. Dieser undankbare Kerl biss also die Hand, die ihn fütterte! Sag nicht, er hat auch noch Mala als neue Führerinausgerufen!«, gab sie ziemlich missgelaunt von sich. »Darüber entscheidet einzig und allein der Kaiser!« Sie selbst brachte es nie fertig, Mala den Rang abzulaufen. In dieser Situation vertrat der Lord nach wie vor die Ansicht, Blut sei dicker als Wasser.
»Klar,der Vampir deklarierte seine Gemahlin als neue Führerin, selbstverständlich ohne Einwilligung des Kaisers. Es war, wie wir bereits alle wissen, nicht Ragnors erster Putschversuch. Beruhigt Euch Herrin, das Beste kommt ja noch: Das Volk war alles andere als begeistert darüber, von einem weiteren Seraphim drangsaliert zu werden. Allein die Dreistigkeit, dass Ragnor seine Ehefrau an die Macht bringen wollten, machte die ohnehin schon aufgebrachte Meute so wütend, dass er ebenfalls dem Zorn desempörten Mobs zum Opfer fiel und von ihnen gemeuchelt wurde!«, meinte der Ritter schadenfroh über den Umstand, Ragnor nie wieder sehen zu müssen. Jeder hasste und fürchtete den Gemahl der Lady Mala Seraphim. Nicht allein, weil er grob und ungehobelt war, und sich obendrein durch die Verbindung zu Mala die Befehlskette hinauf geschlafen hatte, sondern überwiegend, weil er sich für die Rekruten-Ausbildung der Ritter zu verantworten hatte und damit jedem Frischlingdas Grauen lehrte - und sich ebenfalls für die erste Beule in deren nigelnagelneuen Rüstungen verantwortlich zeichnete. Jedermann fürchtete Ragnors Befehl, im Winter das Wasser des Burggrabens mit Spitzhacken aufschlagen zu lassen, um anschließend die Rekruten mit einem erfrischenden Eisbad zu beglücken. Und alle beklagten, wieso Lord Seraphim es überhaupt zulassen konnte, seiner Tochter zu gestatten, so eine impertinente Person wie besagten Ragnor, zum zu Gemahl nehmen. Ausgerechnet den Feind schlechthin - einen Vampir! Wertvoll war Ragnor insofern, da er, der eigentlich im feindlichen Lager zuhause war, alle Kniffe und Schlichen seiner Artgenossen kannte und somit die Rekruten dementsprechend versiert ausbilden konnte.
Nichtsdestotrotz hätte der Ritter Willibald von Raunheim am liebsten ein kleines Freudentänzchen aufgeführt, als er von Ragnors plötzlichem Ableben erfuhr. Schließlich war auch von Raunheim einst ein Rekrut gewesen, der beinahe an einer Lungenentzündung verreckte, die er aufgrund eines Eisbades, dem großen Rüpel-Vampir zu verdanken hatte. Wie heißt es doch so schön? Hochmut kommt vor dem Fall. Na, wenn das kein tiefer Fall war?
»Schnell, Herrin! Ihr müsst fliehen, solange der Pöbel noch beschäftigt ist. Dummerweise bestand der Lord darauf, Ragnor zu rufen, statt die kaiserlichen Truppen zu bitten, den Aufstand niederzuschlagen.«
Wahrscheinlich scheute sich der oberste Führer des Ordens, Hilfe vom Kaiser zu erbitten. Dann hätte er nämlich seine dunklen Machenschaften aufdecken müssen. Niemand konnte sicher sein, ob der Kaiser wirklich im Bilde darüber war, wie Lord Seraphim mit seinem Terror die Bevölkerung bis auf´s Blut auspresste. Die wenigen, die in den entvölkerten Landstrichen von den Grauen der Pest verschont geblieben waren, mussten ohnehin schon starke Einbußen durch Ernteausfälle hinnehmen. Der Sommer war zu kalt und zu nass gewesen, sogar die Ähren auf den Feldern verfaulten. Und dann war da noch die römische Kirche, die gierig ihre Hände nach dem Zehnten ausstreckte, und vom ausgehungerten Volk ihr Recht im Tausch für das Seelenheil einforderte.
»Hilfe naht, meine Dame.Jetzt nachdem der Lord gefallen ist und etliche Ritter sich dem Mob angeschlossen haben, entsandten die restlichen von unsStandhaften einen Kurier, mit einer Depeschefür den Kaiser. Jedoch befürchte ich, dass es ein paar Tage dauern wird, bis hier die Verstärkung eintrifft. Bis dahin kann bereits alles verloren und viel zu spät sein. Also nehmt nur das Nötigste mit...«
Von Raunheims Aussage wurde durch ein misstönendes Krachen splitternden Holzes unterstrichen. Ein paar Sekunden später ergoss sich eine brüllende Menge durch die untere Tür des Turmes. Unter Geschrei und Gezeter strömten die Aufrührer in die enge Wendeltreppe des Turmes hinauf. Zumindest versuchten sie es. Glücklicherweise war es dort eng und die Stufen derart steil, so kam es ungewollt zu einem Stau. Jeder schimpfte und versuchte sich durch die Enge weiter hinauf zu quetschen. Ein paar stark Angetrunkene, die sich nicht mehr aufrecht halten konnten, wurden zu Boden gestoßen und niedergetrampelt.
Im Gesicht des Ordensritters zeichnete sich Panik ab: »Sie haben die Wachen unten vor der Tür überwältigt und sind auf dem Weg zu Euch! Bleibt in der Turmkammer, meine Dame, ich werde versuchen sie aufzuhalten!«, befahl der Ritter.
»Nein!«, schüttelte Roxana energisch den Kopf. »Kommt mit mir in die Turmkammer! Wenn Ihr mir wirklich das Lebenretten wollt, könnt ihr das nur, wenn Ihr bei mir bleibt. Wenn die tobende Meute Euch vor der Tür niedermäht, bin ich ebenfalls so gut wie tot! Zwar wird die Tür dem wütenden Pöbel nicht ewig standhalten, trotzdem schinden wir damit Zeit!«, rief Roxana, und versperrte mit dem mächtigen Riegel den Ausgang. Wie sich zeigte, keinen Moment zu früh, denn schon trommelten wütende Fäuste gegen das Holz. Ebenso wütende Stimmen forderten Einlass. Mistgabeln, Hacken und Knüppel kratzten und schlugen gegen die mächtige Eichentür. Noch hielt das massive Eichenholz gemeinsam mit dem stabilen Riegel stand. Einige der Aufrührer fluchten und rannten wieder die Treppenstufen hinab, um etwas zu suchen, womit sie die Tür einrammen konnten. Der schwere Prellbock, den sie unten benutzten, war definitiv zu lang, um damit eine enge Wendeltreppe zu erklimmen.
Da es für die nicht gerade hellen Aufständischen länger dauerte, dieses Problem zu lösen, konnten Roxana und Ritter von Raunheim eine Weile verschnaufen.
Der Ritter blickte amüsiert auf die vollen Brotkörbe und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. »Sollte die Tür dem Ansturm standhalten, macht es nichts aus, wenn die unsda draußen noch länger belagern. Verhungern können wir nun wirklich nicht.«
Roxana nickte ernst. »Ja, es sieht ganz so aus. Nur glaube ich nicht, dass der Pöbel sich so schnell zufrieden gibt. Hört nur, sie toben dort vor der Tür wie die wilden Tiere!«
Dem Anschein nach wirkte es so, als sei Roxana unverschuldet in diese missliche Lage geraten. Der Ordensritter wusste es allerdings besser. Auch wusste er, dass die milde Gaben der Dame an die Ärmsten der Kinder, nichts mit christlicher Nächstenliebe zu tun hatten, sondern etwas anderes war, nämlich ein billiges Mittel zum Zweck. Immerhin konnte von Raunheim zählen. Es kamen immer der Zahl eins weniger aus dem Turm heraus, als hineingegangen waren. Natürlich scherte sich kein Schwein darum, ob ein armes Waisenkind verschwand oder nicht. Diese schmutzigen, zerlumpten Wesen lebten am Rande des Existenzminimums, und wurden nicht anders behandelt als geprügelte Hunde. Falls wirklich von jemandem ein Kind vermisst wurde, verdächtigte man sofort einen Vampir. Dennoch fragte sich der Ritter stets, was wohl mit dem Kind geschah, welches in der Turmkammer blieb.Wohin waren inzwischen all die Kinder im Laufe der Zeit verschwunden? Sollten sie ihr Ende in dem riesigen Kessel gefunden haben, der dort über dem Kaminfeuer hing? Was war mit all dem Blut, dem Fleisch und den Knochen passiert?
Ohne es zu bemerken, schüttelte er sich, um diesen Gedanken von sich abzuwenden. Vor der Tür wurde es etwas ruhiger, was von Raunheim eher als ein schlechtes Omen ansah. Die sogenannte Ruhe vor dem Sturm.
Roxana zuckte zusammen, als etwas Schweres mit einem gemeinsamen »Hauruck!« gegen die Tür prallte und sie in ihrem Rahmen erschütterte. Die Turmtür blieb jedoch unversehrt.
Vor der Tür wurde es erneut wieder unruhig, ein Fluchen wurde hörbar, danach: »Zusammen!«, brüllte ein Kerl, mit einer ziemlich versoffenen, rauen Stimme. Erneut krachte etwas brachial gegen die Tür. Späne rieselte zu Boden.
Von Raunheim blickte zur Fremden: »Herrin, bevor wir nicht mehr die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen… Es war mir eine Ehre in Euren Diensten zu stehen. Nur wünschte ich, ich hätte Euch retten können. Denn es ist die oberste Prämisse eines heldenhaften Ritters, die edle Dame zu retten. Doch werde ich mein Leben geben, um Euch bis zum letzten Atemzug zu verteidigen«, sprach von Raunheim ehrerbietig und senkte das Haupt.
»Ihr redet ja gleich so, als wäre alles bereits verloren!«, bemerkte Roxana. »Dabei seid Ihr es doch, der mir das Leben retten wird. Nur wisst Ihr es noch gar nicht!«
»Habt Ihr einen Plan? Dann weiht mich ein, damit ich nicht dumm sterben muss«, sagte der Ritter.
»Oh, wie trefflich formuliert! Ich werde es Euch unverzüglich demonstrieren«, entgegnete die Fremde.
*
Als der wütende Mob endlich die obere Tür des Turmes zum Bersten brachte, trat ihnen, statt der Fremden, lediglich ein Ritter des Lichtes entgegen. Er trug eine schwere Gesichtsverletzung. Vor seinem Gesicht trug er ein blutiges Tuch und presste es an die Stirn. Die aufgebrachte Menge war so erstaunt, dass sie den Verletzten mied und nicht weiter beachtete, als er sich blutveschmiertseinen Weg aus dem Turm bahnte. Als jemand fragte wo die Hexe sei, stöhnte er heiser: »Ahhh, diese Schmerzen. Sie ist nicht mehr hier, diese Hexe!Ich wollte sie aufhalten, doch sie nahm mein Schwert und verletzte mich. Danach schwang sie sich auf einen Besen und flog zum Turmfenster hinaus.«
Die Menge strömte an ihm vorbei ins Turmzimmer. Der Mob tobte. Die Brotkörbe wurden geplündert. Bücher, Dokumente und Pergament wurden von den Menschen in ihrer blinden Wut aus den Regalen gerissen. Vieles davon landete im Kamin und fiel den Flammen zum Opfer. Flaschen gingen zu Bruch. Es war ein Toben und Zerstörungsfeldzug ohnegleichen. Allerdings nahm das zornige Marodieren ein vorzeitig abgebremstes Ende.
Zuerst hielt der betrunkene Pöbel dieses seltsam feucht aussehende Ding für ein geschlachtetes Tier. Doch als der Kerl mit der versoffenen Stimme auf etwas Glitschigem ausrutschte und anschließend völlig blutverschmiert wieder auf die Beine kam, brach plötzlich eine namenlose Panik aus. Neben dem grausigen Fund lag ein Berg aus Frauenkleidung. Doch das Seltsamste an dieser Sache war, dass der nackte, menschliche Leichnam, dem die Gesichtshaut fehlte, ganz eindeutig ein Mann war…
*
Nachdem sich die Hexe Roxana zwei Meilen außerhalb der Stadt in Sicherheit befand, nahm sie den Helm ab und zog die blutige Fleischmaske aus menschlicher Haut von ihrem Gesicht, und schüttelte über die Dummheit der Menschen schlechthin den Kopf und ging ihrer weiteren Wege...
*
Realität ist der Zustand, der aus Mangel an Alkohol entsteht.
(Aus Irland)
Für ihn waren Studentenpartys immer noch die schönsten Partys. Aus zwei bedeutenden Gründen. Erstens: Niemand fragte, wer denn wohl der Kerl mit dem dicken, schwarzen Wust aus Rasta-Locken war. Zweitens: Die zweite Frage blieb aus, was er überhaupt auf dieser Party als Fremder zu suchen hatte. Studenten gab es viele, also dachte jeder, er sei der Freund eines Bekannten, oder von dessen Bekannten der Bekannte. Wichtiger für ihn war, dass der Alkohol dabei niemals versiegte. Wenn er dann auch noch die Ukulele zur Hand nahm und ein fröhliches Liedchen trällerte, stimmte jeder mit ein, und sein Glas wurde von den Feierwilligen wie automatisch wieder aufgefüllt. Niemandscherte sich um seinem Namen. Und wenn jemand fragte, vergaß er ihn, sobald er dem Sänger den Rücken zu drehte. Keiner nahm Anstoß daran, dass er nicht sonderlich gut aussah, oder zwei verschiedenfarbige Augen besaß. Hätte man ihm nähere Aufmerksamkeit geschenkt, wäre der Beobachter vielleicht sogar ein wenig verwirrt darüber gewesen. Denn wer ihn sich genauer ansah, wusste nicht, ob er ins grüne, rechte Auge, oder doch lieber ins braune, linke sehen sollte. Zudem konnte man sich sowieso nicht einig darüber werden, in welches Auge man überhaupt sehen sollte. Der Barde besaß einen ausgesprochen heftigen Silberblick. Obwohl er ohne Zweifel menschlich zu sein schien, erinnerten seine Gesichtszüge ein bisschen an einen leicht verschlagenen Fuchs…
Zwar wurde er stets gesehen, wobei auch jeder meinte, ihn schon mal irgendwo gesehen zu haben. Doch spätestens am nächsten Morgen konnte sich niemand mehr genau an ihn erinnern. Das war sein Trick, weil er nur in diesem einen Moment der Trunkenheit für alle anderen existierte. Die Wahrnehmung Betrunkener kann schon mal Streichen erliegen, oder etwa nicht?
Er hingegen konnte sich sogar noch sehr gut an den Tag seiner eigenen Geburt erinnern. Es war genau die Stunde, als die erste vergorene Marula-Frucht irgendwo in Ostafrika von ihrem Baum fiel - und rein zufällig ein Australopithecus afarensis vorbeischlenderte,sie aufhob, verspeiste und anschließend das seltsamste Erlebnis seines Lebens zuteil wurde. Seltsam war es vor allem für den Urmenschen, die volle Kontrolle über seinen Körperzu verlieren und statt zu laufen, nur noch ein Taumeln zustanden zu bringen. Trotzdem war es ein berauschendes Gefühl und das grunzte er an seine Clan-Angehörigen weiter, die diesen Zustand ebenfalls einmal ausprobieren wollten - und wen wundert´s - gefallen daran fanden. Vielleicht war einst im Garten Eden die verbotene Frucht gar nicht die Frucht der Erkenntnis, sondern die Frucht des Rausches?
Ach ja, das waren noch Zeiten… Unglaublich lange her war das.Lag ungefähr 3,8 Millionen Jahre weit zurück. Seitdem besaß er viele Namen und Bezeichnungen. Früher hatte er schöne, wohlklingende Namen. Heute würde erhöchstwahrscheinlich Flatrateheißen. Und seltsamerweise sind bis heute seine Anhänger nicht müde geworden, ihn um seinetwillen zu feiern. Gründe braucht man zum Feiern eigentlich recht wenig, um sich mal ordentlich einen hinter die Binde zu gießen. Denn Feiern und Trinken verbindet, es erzeugt das Gefühl, als gäbe es kein Morgen mehr. Und wenn, dann war es egal. Wogegen jeder, am leider dann doch eintretenden Morgen, an seinem Katzenjammer gänzlich allein herum laborieren musste. Aber dafür fühlte sich der Barde nicht verantwortlich. Für ihn zählten nur Wein, Weib und Gesang.
Damals, während der amerikanischen Prohibition, das waren für ihn die schwierigsten aller Zeiten gewesen. Beinahe hätte er deshalb eine Krise bekommen. Allerdings wich er lieber nach Europa und Asien aus. Lange dauerte sein Exil jedoch nicht, weil das Schwarzbrennen die Sache dann doch wieder interessant für ihn machte. Da geistige Getränke offiziell von der Regierung verboten waren, tranken selbst solche Leute den verbotenen Stoff, die ansonsten niemals welchen getrunken hätten. Das nennt man dann wohl »Reiz des Verbotenen«. Schließlich sah die amerikanische Regierung ein, dass die Mobster durch das Alkoholverbot reich wurden, die meisten vom Holzalkohol (Methanol) blind, und ansonsten der Großteil der amerikanischen Bevölkerung aus Trunkenbolden bestand. Leider musste der Geist des Rausches rein zufällig erfahren, dass man zu St. Valentin keinesfalls zu den Glückspilzen zählte, wenn einem statt Rosen, todbringende Kugeln aus einer Tommy-Gun um die Ohren flogen, wenn man sich am falschen Ort aufhielt. So erklärte die Regierung das Experiment der Enthaltsamkeit für gehörig gescheitert. Zum Glück für ihn. The Roaring Twenties waren zwar aufregende Zeiten – aber Aufregung war definitiv nichts für ihn.
Irgendwann ist auch einmal das prächtigste Fest vorüber. Am frühen Morgen fand auch diese wunderbare Studentenfeier ein Ende. Eigentlich schon, als der letzte Betrunkene hintenüber kippte, um vom Alkohol schwer angeschlagen, seinen Rausch zufrieden wie ein Baby auszuschlafen. Vorsichtig stieg er über die Schlafenden hinweg. Er wollte fort sein, ehe der Erste wieder erwachte. Für den Kater und die obligatorischen Kopfschmerzen fühlte er sich nicht zuständig. Das gehörte nicht zu seinen Aufgaben. Er war derjenige, der anderen die Sorgen vertrieb, von mehr war hier nicht die Rede.
Er trat ins helle Licht des frühen Tages. Für ihn war der Morgen wunderschön. Schließlich bekam er selbst nach der wildesten Zechtour niemals deren Nachwirkungen zu spüren.
An der frischen Luft, atmete er tief durch. Was für ein herrlicher Tag! Der Winter löste langsam seine eisigen Klauen und zog sich aus der Erde zurück, damit die Frühblüher ihre Köpfe jungfräulich schüchtern empor recken konnten. Die Meisen stimmten schon wieder ihre Hochzeitslieder an. Der Tag war klar und kühl, dennoch sonnig. Ja, so liebte er es. Frohgemut marschierte er aus dem Villenviertel und bemerkte kaum, wie die Anzahl der Häuser weiter stetig abnahm, während er nach Herzenslust wandelte. Schließlich durchschritt er ein Waldstück. Fröhlich klimperte er dabei auf seiner Ukulele herum und sang dazu:
»Trink, trink, Brüderlein trink, lass doch die Sorgen zu Haus. Trink, trink, Brüderlein trink, zieh doch die Stirn nicht so kraus. Meide den Kummer und meide den Schmerz,
dann ist das Leben ein Scherz.«
Ein Reh, ein grimmig wirkender Dachs und ein recht verschlafen dreinblickender Igel begleiteten den musikalischen Umzug ein kleines Weilchen, bis sie plötzlich von ungeahnter Panik ergriffen, zurück ins Dickicht flohen.
»Nanu? Was ist denn los? War das etwa das falsche Lied? Ich kann noch etliche andere, wie wäre es?«, fragte der Sänger verblüfft und sah sich genauer um. Ganz in der Nähe befand sich ein abgelegenes Haus mit blinden, schmutzigen Fensterscheiben. Beinahe machte es den Eindruck, wie es da so versteckt zwischen den alten Bäumen lag, als würde es arglosen Fußgänger auflauern, um sie zu erschrecken. Irgendetwas wirkte daran unheimlich, ja sogar verhängnisvoll, obwohl so eine reetgedeckte Kate mitten im Wald eigentlich nichts Ungewöhnliches bedeutet. Doch war ihm so, als höre er leises Flehen und Wehklagen. Ihn wunderte es nicht, wieso ihm unmittelbar die Haare zu Berge standen.
»Nein, das war nichts!«, sprach er zu sich selbst und winkte ab. »Das habe ich mir nur eingebildet. Und wenn schon. Es geht mich nichts an. Ich sollte meine Nase nicht in Angelegenheiten stecken, die mich nichts angehen. Das gibt nur Ärger - und ich will keinen Ärger!«, sprach er zu sich selbst und suchte trotzdem hinter einer dicken Eiche Deckung. Und während seine Ignoranz mit der Neugier rang, riss jemand urplötzlichvon innen die Tür der Kate auf. Daraufhin machte sich der Beobachter noch ein wenig schmaler. Vorsichtig schielte er am Baumstamm entlang.
In der Tür erschien ein kleines blondes Mädchen, vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Es schrie zutiefst verzweifelt: »Hilfe! Nein! Ich will zu meiner Mami!« Und so schnell wie es auftauchte, verschwand es auch wieder. Irgendjemand zog es mit einem heftigen Ruck wieder zurück ins Haus. Ein entsetztes Quieken entrang sich der verängstigten Kehle.
Dann ertönte ein Krächzen: »Das hast du dir wohl so gedacht, du kleine Kröte! Hiergeblieben! Schrei soviel du willst, hier hört dich sowieso keine Sterbensseele.«
Eindeutig war das die Stimme eines alten Weibes. Die Tür fiel mit Schmackes zurück ins Schloss.
Der Barde verharrte und beratschlagte sich offenkundig mit seiner Ukulele. »Hm, die Alte wird ihre Enkeltochter doch nicht mit dem Wort ›Kröte‹ titulieren... Oder? Und wieso sollte das Kind bei seiner Oma so verzweifelt um Hilfe rufen? Das gefällt mir nicht! Mir gefällt aber auch nicht, ein Held zu sein. Helden leben gefährlich oder müssen verdammt schnell laufen können, und darauf habe ich kein Bock! Also gehe ich jetzt weiter. Ja, genau, ich gehe einfach weg von hier, ganz so, als wäre rein gar nichts passiert!«, beschloss er. Doch jeder Schritt schien ihn zu peinigen. Er blieb stehen: »Also gut. Dann eben doch die Superheldennummer. Kann ja nicht schaden, mal nach dem Rechten zu sehen, was es mit diesem Geschrei auf sich hat.«
Vorsichtig pirschte er ans Haus heran, machte dann und wann einen Hechtsprung ins Gebüsch, wo er mit einem Purzelbaum auf der anderen Seite - mit viel Laub im Haar - wieder herausrollte. Währenddessen kam er sich ziemlich albern vor. Dennoch hielt er seine Handlungsweise für rechtmäßig - schließlich machten es die Helden in den Filmen ganz genauso. Wogegen rein zufällig vorbeikommende Spaziergänger ihn höchstwahrscheinlich für eine schlecht gemachte Mister-Bean-Imitation halten könnten. Zum Glück waren keine in Sichtweite, sonst wäre seine ganze Aktion umsonst gewesen, wenn er mit einem neugierigen Publikum Aufmerksamkeit erregt hätte. Endlich beim Fenster der Kate angekommen, brauchte er sich um eine gute Tarnung keine Sorgen mehr zu machen. Durch sein wildes Herumkugeln sah er mittlerweile wie eine Topfpflanze auf Beinen aus. Aus seinem sich auftürmenden Rasta-Wust ragten etliche Zweige und welkes Laub der letzten Saison. Vorsichtig schielte er durch die Fensterscheibe, sah jedoch nichts, was ihn letztendlich dazu bewog, einen kleinen Sichtkreis in die verdreckte Scheibe hinein zu wischen. Was er dann erblickte, verschlug ihm glatt den Atem.
Die Alte, die übrigens auch nicht viel besser auf dem Kopf aussah als er selbst - ihr Kopfbewuchs ähnelte einem verfilzten Flokati -, hatte das kleine, blonde Mädchen wie einen Hund in einen Zwinger gesperrt.
Neugierig spitzte er die Ohren, denn die alte Schachtel redete unablässig auf das kleine Mädchen ein. »Ja, du wirst dich noch ein wenig gedulden, und mir noch weiterhin Gesellschaft leisten müssen. So lange, bis ich von dir habe, was ich will. Danach kann deine Mutter dich wiederhaben!« Allerdings erwähnte sie nicht, in welchem Zustand. Dem Barden schwante Böses.
»Aber ehe es soweit ist, muss ich noch eine kleine Besorgung erledigen. Ein bisschen Liebstöckel besorgen. Bin gleich wieder da, mein kleines Vöglein! Und iss deine Suppe, hörst du?«, säuselte sie mit falscher Fürsorge. Dann wandte sie sich an einen Raben. Ein ausgesprochen hässliche Exemplar. Er wirkte, als befände er sich gerade in der Mauser, oder sei mit knapper Not einer gefräßigen Katze entkommen. »Edgar, pass gut auf die Kleine auf, ja? Du leihst mir in der Zwischenzeit deine Augen und Ohren. Deine liebe Mama kommt gleich wieder«, tätschelte sie dem Raben das struppige Kopfgefieder. Benannter Edgar ging bei jedem Tätschler in die Knie, als bekäme er jedes Mal einen Schlag auf den Kopf verpasst.
»Nimmermehr!«, krähte der Rabe, was der Alten ein wahrhaft schauriges Gegacker entlockte.
»Ja, ja… Etwas anderes kannst du sowieso nicht sagen! Bin gleich wieder da!«, sprach sie jetzt gutgelaunt.
Als sie mit krummen Rücken zur Tür humpelte, war der Barde längst weg vom Fenster. In Windeseile huschte er um die Hausecke, umrundete von hinten die Kate und kam neben der Haustür wieder zum Vorschein. Sein unsteter Blick folgte der Alten, die mit sich im Selbstgespräch vertieft, in Richtung Stadt humpelte. Wahrscheinlich wohnte sie noch nicht mal in der Kate, sondern nahm das abgelegene Haus dafür, ihren dunklen Machenschaften nachzugehen. Womöglich folgte sie einer bösen Logik, dass man nie da morden sollte, wo man wohnt...
Lautlos schlüpfte er aus seiner Jacke. Nicht etwa, weil ihm heiß wäre. Nein, damit hatte er etwas ganz Spezielles vor. Vorsichtig schielte er ins Türschloss. Zum Glück kein komplizierter Schließmechanismus. In der Innentasche seiner Jacke befand sich ein Dietrich. Diesen nahm er zur Hand und öffnete beinahe lautlos das Schloss. Eigentlich hätte er als körperloser Geist durch die geschlossene Tür gehen können, um dahinter wieder zu materialisieren. Nur musste er das Mädchen ebenfalls durch diese Tür nach draußen und in Sicherheit bringen. Nachdem er eine Weile sein Ohr gegen die Tür presste und keine verdächtigen Geräusche wahrnahm, entmaterialisierte er und steckte seinen Kopf durch die Tür. Der Rabe saß auf dem Käfig des Mädchens und funkelte es mit hungrigem Blick hochkonzentriert an.
Es müsste anders herum sein!, dachte der Barde. Der Vogel gehört in den Käfig und das Mädchen in Freiheit.Äh, natürlich ohne das hungrige Funkeln!, korrigierte er sich daraufhin im Gedanken. Dann zog er den Kopf wieder zurück und rematerialiserte seine Gestalt.
Bevor er allerdings zur Tat schritt, sammelte er sich noch ein wenig, schloss für einen Moment die Augen, straffte die Gestalt und ging in Startposition. Es kam vor allem darauf an, dass es schnell und möglichst lautlos vonstatten ging. Das dämmrige Zwielicht machte es ihm dabei wesentlich leichter. Vögel sehen nicht allzu gut in der Dämmerung. Zum Glück hielt die alte Vettel nicht allzu viel vom Fensterputzen.
Na dann mal los!, feuerte er sich gedanklich an, öffnete die Augen, dematerialisierte wieder und stürzte im Affenzahn durch die noch immer geschlossene Tür. Falls der Rabe etwas mitbekam, so war es nur der Schemen einer Jacke, die durch die Luft schwebte und sich auf ihn stürzte. Dunkelheit umhüllte das Federvieh, welches überrascht »Nimmermehr!«, krächzte und danach verstummte. Wer kennt das nicht? Selbst der lauteste Vogel wird ruhig, wenn man ihn mit einer Decke umhüllt.
Kurze Zeit darauf ertönte unter der Jacke ein leises Schnarchen.
Er sah in den Käfig. Das Mädchen schien zu schlafen. »He da! Mach mir nicht schlapp! Ich bin gekommen, um dich zu retten.« Keine Reaktion. »Hallo? Kleines Mädchen? Wie ist dein Name?«
Die Kleine bekam mit Mühe die Augen auf und blinzelte ihn müde an. »Ich will nach Hause!«, stammelte sie verschlafen und rieb sich die Augen. »Mein Name ist Lena«, sprach´s und nickte auf der Stelle wieder ein. Der Suppenschüssel entströmte ein leicht chemischer Geruch. Wahrscheinlich gehörte es zum Plan der Alten, die Kleine mit Medikamenten ruhigzustellen.
»Verdammt! Nun lasse ich mich schon mal zu einer Heldentat hinreißen und dann so was!«, rüttelte er am Käfig. Ein dickes Vorhängeschloss hinderte ihn daran, dem Mädchen die Freiheit zu schenken. »Verflixt noch eins... Okay, ehe ich zur Tat schreite, muss ich erst mal das Terrain sondieren«, redete er sich weiterhin Mut zu. Das Mädchen würde ihm nicht weglaufen. Sie konnte nirgendwo hinlaufen, jedenfalls nicht ohne ihn. Um nicht womöglich durch einen weiteren Mittäter in flagranti ertappt zu werden, schlich er zur Tür des Nebenzimmers. Behutsam und nahezu lautlos drückte er die Klinke herunter. Das Glück war ihm hold. Der Raum war nicht verschlossen. Zögerlich öffnete er die Tür. Schon bevor er ins Zimmer schielte, befiel ihn ein ungutes Gefühl. Dieser Geruch… Und dann dieses seltsame Summen! Die Finsternis, die in diesem Raum vorherrschte, war wesentlich dichter als die, des vorherigen Zimmers. Er blieb unter den Türsturz stehen, bis sich seine Augen an die Düsternis gewöhnten. Die Fensterscheiben dieses Raumes waren von innen mit schwarzem Tonpapier beklebt, welches das Tageslicht und neugierige Blicke aussperrte. Natürlich wäre es einfacher für ihn gewesen, das Licht einzuschalten. Vorausgesetzt, es gab hier überhaupt Elektrizität. Jedoch hinderte ihn seine innere Stimme daran, den Lichtschalter zu berühren. In diesem widerlichen Haus wollte er so wenig wie möglich anfassen. Im Raum befand sich keine lebende, menschliche Gestalt, so viel war schon mal sicher. Schließlich stand er mit dem Rücken zum Gegenlicht. Wäre ein Komplize im Zimmer gewesen, hätte er sich sofort auf ihn gestürzt.
Endlich konnte er erkennen, was sich in diesem Zimmer befand. Vom Kopf abwärts, ergriff ihn die blanke Panik. Seine Füße sprangen automatisch mit ihm in den vorherigen Raum zurück. Schnell schloss er von außen, wie vom Teufel verfolgt, diese verhängnisvolle Tür und würgte anschließend ausgiebig.
»Oh mein Gott!«, stammelte er einer Ohnmacht nahe. Alles in ihm schrie danach, einen ordentlichen Schluck aus der Pulle zu nehmen, um dieses schreckliche Zimmer mit seinem unaussprechlichen Grauen aus seiner Erinnerung zu löschen.Leider musste er nüchtern bleiben. Nimm dich zusammen! Lauf jetzt nicht weg, sondern tue einmal das Richtige! Rette das Mädchen – und zwar schnell!, rief er sich in Gedanken zur Ordnung. Jetzt kam es darauf an, hier so schnell wie möglich zu verschwinden, und zwar mit der Entführten, der kleinen Lena, wenn er nicht wollte, dass ihr das zustieß, was ihr aus dem Raum nebenan dräute. Hurtig trat er an Lenas Zwinger. Die Gitterstäbe lagen glücklicherweise so weit auseinander, dass er mit Daumen und Zeigefinger hindurch langen konnte. Er entwendete Lena eine Haarklemme - eine hübsche mit Blume -, bog daran herum und fummelte konzentriert damit im Schließmechanismus des Vorhängeschlosses herum. Endlich klickte es und der Bügel sprang nach oben. Er ließ sich frei bewegen. Der Barde zog das Schloss aus den Ösen des Käfigs und öffnete das Gefängnis. Verächtlich wollte er das Schloss zu Boden fallen lassen, stattdessen kam ihm in den Sinn, es nochmals in Gebrauch zu nehmen. Aber das erst ein wenig später.
Mit Vorsicht berührte er die Schulter des Kindes: »Hör zu, Lena. Ich bringe dich jetzt weg von hier, in Sicherheit. Es wäre wirklich schön, wenn du nicht um dich schlägst und mir dabei die Nase zu Brei haust!«, hob er die Kleine aus dem Käfig. »Verdammt! Wie viel wiegst du? Nicht zu fassen. Wie ist das möglich, dass kleine, dürre Mädchen eine halbe Tonne wiegen?«, beschwerte er sich.
Sachtemang setzte er Lena auf einem Stuhl ab, bemüht, dass sie nicht davon herunterglitt. Als er sicher war, dass das nicht passierte, schnappte er den Raben, beförderte das garstige Vieh in den Käfig und sicherte die Tür mit dem Vorhängeschloss.
Schleunigst zog er wieder seine Jacke an. Von Eile getrieben, hob er Lena hoch und legte sie über seine Schulter. So schnell es ihm seine Beine ermöglichten, rannte er den Waldweg entlang, immer in Richtung Landstraße. Nichts wäre schlimmer, als ausgerechnet der alten Hexe zu begegnen. Tief besorgt über den Zustand der kleinen Lena, versuchte er ein Gespräch mit ihr zu führen. »Lena, nicht wieder einschlafen!«, mahnte er. »Du musst mir ein paar Fragen beantworten. Wie hat dich die alte Hexe überhaupt in die Finger bekommen?«
»Sie holte mich von der Schule ab. Sie erzählte, meine Mama habe einen schrecklichen Unfall gehabt. Sie sagte, sie wäre eine Bekannte meiner Oma. Die Hexe wollte mich zu meiner Mama bringen. Hat sie aber nicht gemacht...«
»Wie hat sie sich vorgestellt? Erwähnte sie einen Namen?«
»Sie sagte, sie heißt Roxana«, murmelte Lena.
»Hat dir deine Mama eigentlich nicht beigebracht, dass man nicht mit fremden Leuten geht?«
»Du bist doch auch ein Fremder!«, nuschelte das Mädchen.
»Ja, schon… Aber ich rette dich doch - und will dir nichts Böses! Das ist etwas ganz anderes!«, gab er zurück und ärgerte sich über das Misstrauen an falscher Stelle.
Endlich erreichten sie die Landstraße. Dort hielt er nach Autos Ausschau. Ein dunkler Wagen brauste heran.
»Anhalten!«, rief der Barde. Leider fuhr der schwarze Sportwagen viel zu schnell an ihm vorbei. »Idiot! Beim Autofahren mit dem Handy zu telefonieren, das ist strafbar!«, keifte er dem rücksichtslosen Rowdy hinterher und fluchte wie ein Kutscher.
Endlich kam ein weiterer Wagen. Wagemutig stellte er sich ihm mitten auf der Landstraße entgegen. Die Fahrerin des Kleinwagens riss panisch die Augen auf und bremste. Knapp vor seinen Kniescheiben brachte sie das Gefährt zum Stehen.
Schleunigst bewegte er sich um das Auto herum und öffnete die Beifahrertür. »Hallo, junge Frau. Wir haben einen Notfall! Dieses Kind wurde entführt. Ich konnte es seinen Entführern entreißen. Das Mädchen ist kaum bei sich. Sein Name ist Lena. Schnell! Bringen Sie das Kind sofort in ein Krankenhaus!«, bat er dringlich.
»Warten Sie, wir legen die Kleine auf den Rücksitz!«, antwortete die junge Frau. Ohne lange zu fackeln, stieg sie aus dem Wagen und machte sich leicht umständlich am Beifahrersitz zu schaffen. Endlich bekam sie das störrische Ding in den Griff und klappte den Sitz nach vorn. Womöglich bereute sie es in diesem Augenblick, beim Wagenkauf keinen Viertürer genommen zu haben. Sachte betteten sie Lena auf den Rücksitz. Sogar eine Decke holte die Frau, die offenbar nicht einmal zwanzig Jahre zu sein schien, aus dem Kofferraum. Sie deckte das Mädchen damit zu und nahm von der Hutablage einen Plüschteddy, der das matte Kind ein wenig trösten sollte.
»Steigen Sie ein!«, drängte die junge Frau.
»Nein, fahren Sie allein! Ich habe etwas noch viel Dringlicheres zu erledigen!«, sprach er fest entschlossen. »Los, los! Fahren Sie schon endlich los! Ich weiß nicht, was der Kleinen verabreicht wurde! Jede Minute ist eine zu viel, die wir hier vergeuden!«
Die junge Frau sprang wieder in den Wagen, startete den Motor und fuhr davon wie der Teufel. Erleichtert atmete er aus und straffte die Gestalt.
»So, und jetzt mache ich diesem heillosen Horror ein Ende!«, sprach er zu sich selbst und lief schnellen Schrittes zurück zur Kate. Dort angekommen, holte er einen kleinen Flachmann mit Achat-Intarsien aus der Jackeninnentasche. Mit einem »Plopp« öffnete er ihn und verteilte den Inhalt über Möbel und Fußboden. Das Gleiche tat er im Raum mit den vielen Fliegen. Das Seltsame an dieser Sache war allerdings, dass der beschriebene Flachmann nie leer zu werden schien. Tja, der eine besaß die Fähigkeit Brot und Fisch zu vermehren, dem anderen hingegen, mangelte es eben niemals an hochgeistigen Getränken. Schnell trank er selbst noch einen Mundvoll vom Gesöff, ehe er das Streichholz entzündete. Einen Moment wartete er noch, bis die immer größer werdenden Flamme es zu verschlingen drohte. Kurz bevor die Flamme in seine Finger biss, ließ er das Zündholz zu Boden fallen.
Im Nu fraßen sich die Flammen durch das Haus. Die Hitze wurde unerträglich und drohte ihm die Augenbrauen und Haare zu entflammen. Selbst das Reet auf dem Dach fiel den gierig fressenden Flammen zum Opfer.
Panisch krächzte der Rabe in seinem Käfig: »Nimmermehr!« Jedoch beschloss der Barde, dass dieses Tier durch und durch böse war. Es ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass Raben äußerst intelligente Lebewesen sind. Seiner Meinung nach, hätte sich der Rabe für das Gute entscheiden können, statt mit der Hexe gemeinsame Sache zu machen.
Fasziniert von den Flammen und ihrem zerstörerischen Werk, schritt er rückwärts in Richtung der Ausgangstür. Sehr zu seinem Entsetzen wurde seinem Rückzug ein abruptes Ende gesetzt. Ungewollt touchierte er etwas mit seinem Hintern und fühlte damit einen Widerstand. Sein Nackenhaar stand zu Berge. Unsicher warf er einen Blick über die Schulter. Dabei entwich ihm ein: »Oh, oh!«
Im Türsturz stand niemand anderes als die Hexe. Sie war zurückgekehrt...
*
Wer nach fremder Wolle ausgeht, kommt geschoren heim.
(Deutsches Sprichwort)
Sonst nicht unbedingt zur Gewalt neigend, wurde der Barde trotz seiner guten Vorsätze,heftigst handgreiflich. Nachdem, was er im Nebenzimmer der Kate gesehen hatte, beschloss er, der Alten das gleiche Schicksal wie das des Raben angedeihen zu lassen. Brennen sollte sie, diese elendige, menschenfressende Hexe!
Obwohl die Alte ansonsten mit gebeugtem Rücken daherkam und krummbeinig durch die Gegend lief, schien ihr jede Menge Kraft innezuwohnen.
Die Kampfszene wirkte gespenstisch, als der Barde mit der Hexe im brennenden Haus raufte. Flammen loderten überall. Tapeten schälten sich zuerst von den Wänden, rollten sich kurz zusammen, um dann gänzlich zu verbrennen. Das alte Friesensofa schmurgelte erst zu einem Klumpen in sich zusammen, umwenig später eine heftige Stichflamme auszustoßen, die sogleich die Gardinen an den Fenstern in Brand steckte. Alles im Haus brannte lichterloh und mittendrin, wie ein holdes Paar, innig vereint im Tanze, drehten sich die Alte und der Barde immerzu im Kreis. Jeder versuchte bei diesem Kampf die Oberhand zu gewinnen und ihn für sich zu entscheiden. Es wurde gedrückt, geschlagen, geschubst und gedrängelt. Einmal sogar gebissen. Der Barde bereute es jedoch sofort, so ein altes, schlaffes Stück Fleisch zwischen den Zähnen gehabt zu haben.
Pfui, pfui…
Erbarmungslos beabsichtigte jeder, den anderen so nahe als möglich an die Flammen zu drängen und in Brand zu stecken. Glücklicherweise schien unser unfreiwilliger Held ein wenig stärker zu sein, als das rein äußerlich schwächlich wirkende Weib. Mit dem Mut des Verzweifelten, gab er ihr einen kräftigen Stoß, sodass sie lang hinschlug und den Käfig mit sich riss.
Schleunigst versuchte der Barde wieder an die Haustür zu gelangen. Hustend schirmte er seine Augen mit dem Oberarm ab, ganz so, als hätte er Angst, sie könnten vor Hitze platzen. Als er endlich die Tür erreichte, sprang er heraus ins Freie, undgrapschte währenddessen eilig nach dem Dietrich in seiner Jackentasche. Er fand ihn letztendlich, warf die Haustür hinter sich zu und rammte den Dietrich ins Türschloss. Wie von Sinnen drehte er ihn solange herum, bis es nicht mehr ging. Schleunigst brachte er eine gehörige Distanz zwischen sich und der Bauernkate, die mittlerweile zu einer wahren Hölle mutierte.
Erschöpft, aber nicht minder erleichtert, ließ er sich ins weiche Moos plumpsen und sah dem Inferno zu - teils mit Abscheu, teils mit Faszination. Durch die Hitze bekamen die Fensterscheiben knackend Risse, und wenig später ertönte ein Fauchen, welches immer lauter wurde und in einer Rauchgasexplosion kulminierte. Der Backdraft katapultierte alles Mögliche nach draußen - und der Barde glaubte, seine Augen spielten ihm einen Streich - als die alte Hexe durch das Reetdach geflogen kam… Obwohl, vom Fliegen zu reden, wäre womöglich ein Irrtum, denn sie flog weniger, sondern blieb die ganze Zeit über in der Schwebe, hielt ihren leicht angebrannten Raben in Händen und blickte sich zornfunkelnd um, bis sie den Barden erspähte.
Dieser versuchte natürlich mit dem Moos so gut wie eins zu werden, doch zu spät. Erstens wollte es nicht so recht funktionieren, und zweitens hatte ihn die Hexe bereits entdeckt. Die Flammen, die von ihrem Haar ausgingen, verliehen ihr eine schreckliche Korona, die flammende Kleidung umflatterte sie wie ein Umhang aus Feuertentakeln. Seltsamerweise schien sie keinerlei Schmerzen zu empfinden. Drohend zeigte sie mit dem Finger auf den Barden.
»Du törichter Narr! Du weißt ja gar nicht, mit wem du dich anlegst!«, fauchte sie wütend.
»Das habe ich in der Tat auch schon befürchtet. Warum tust du mir nicht einfach den Gefallen und stirbst, dann wäre die Welt ein bisschen besser«, sprach er eigentlich mit sich selbst, doch die Hexe hörte ihn anscheinend, trotz des Lärms, sehr gut.
»Dir wird der Spott sogleich vergehen! Ich weiß, wer du bist. Ich verfluche dich!«, hob sie die Stimme bedrohlich an. »Du nahmst mir den Körper des kleinen Mädchens, der für mich wichtig war. Gleiches soll mit Gleichem vergolten werden! Dafür nehme ich dir den deinen! Niemals mehr sollst du in Zukunft einen eigenen Körper besitzen! Dies ist mein Schwur, er soll gültig sein bis zum letzten Tag aller Tage!«
»Nimmermehr!«, keifte der Rabe Edgar zustimmend.
Und wie es sich für eine echte Hexe gehört, lachte sie gackernd, hüllte sich in eine Rauchwolke und verpuffte.
»Okay… Heftiger Abgang, aber ich dachte, sie wollte mir den Körper nehmen?«, fragte der Barde erstaunt und besah sich. Vorsichtig tastete er an sich herum. »Offenbar noch alles da! Tja, das war wohl nichts!«, triumphierte er.
In der Tat war alles noch dran, nur bestand das Problem viel mehr darin, dass er immer durchsichtiger zu werden drohte. »Nee, ne? Ach Männo! Was ist das?«, fragte er leicht entnervt. Verwirrt raufte er sich die Haare, und als er sich hilfesuchend umsah, bemerkte er, dass er nicht mehr allein war. Ein Typ in einer schwarzen Kapuzenkutte saß auf einem Baumstumpf; eine Motorsense lag ihm zu Füßen. Der Kerl sah ziemlich bleich aus, genauer gesagt, sein Knochenschädel.
»Na, Gevatter Tod, bist du gekommen, um mich zu holen?«, fragte der Barde unsicher, und schluckte laut.
»Quatsch nicht! Ich nehme mir gerade meine Frühstückspause, Dionysos Polyônomos. Weißt du, ich liebe den Wald. Da habe ich meistens meine Ruhe, denn dort gibt es kaum Menschen«, meinte Gevatter Tod und holte eine Thermoskanne mit Kaffee heraus. Jedoch trank er nicht, sondern goss lediglich einen Becher voll ein und wedelte sich das wohlduftende Kaffeearoma zu. »Na ja, mal abgesehen von diesen Idioten, die sich selbst mit der Jagdflinte erschießen, oder die Holzfäller, die viel zu überzeugt von ihrem Können, vom Baum erschlagen werden. Oder gar diese Hirnis, mit ihren Kettensägen, die sich beim Feuerholz sägen die Beinschlagader durchtrennen. Aber ich will nicht über die Arbeit reden, denn ich habe - wie schon gesagt - jetzt meine Frühstückspause.«
»Also bist du gar nicht gekommen, um mich zu holen?«
»Dich holen kommen? Nein, warum sollte ich? Du warst schon immer ein metaphysisches Wesen. Im Gegensatz zu der Hexe, die du eigentlich erledigen wolltest, kannst du gar nicht sterben.«
»Ach so...«, meinte der Barde erleichtert. »Trotzdem ist da etwas gehörig schiefgelaufen!«, seufzte er.
»Ja, ›Shit happens‹ sage ich da nur!«, grinste der Todesengel Azrael. Nicht etwa aus Schadenfreude, sondern weil´s mit seiner Anatomie gar nicht anders möglich war.
»Ja, das kannst du echt laut sagen«, betrachtete der Barde seine Hände, die immer durchsichtiger wurden.
»Hörmal, Bacchus. Mir ist es leider verwehrt, in die Speichen des Schicksalsrads zu greifen. Aber bei so jemandem, wie bei der Alten gerade eben, würde ich schon gern mal eine Vollbremsung einlegen! Ich bewundere dich für deinen freien Willen und für das, was du dort drinnen getan hast. Du solltest dir das nicht bieten lassen, was sie dir antat! Weißt du, ich liebe meinen Job. Inzwischen habe ich schon einiges gesehen und mir dabei ein dickes Fell zugelegt. Einige Todesfälle sind nicht nur tragisch, sondern tragikomisch, wobei ich mich manchmal echt zusammenreißen muss, die Pietät zu wahren. Mittlerweile geht mir kaum noch etwas nahe… Was mir aber an die Nieren geht, das sind die toten Kinder. Um sie trauere ich wirklich. Eigentlich sollten sie die Zukunft der Welt sein, die Chance, aus gemachten Fehlern zu lernen und wirklich etwas zum Besseren zu bewegen. Doch sterben viele früh, und das unter schrecklichen Umständen! Zwar nicht mehr so viele, wie in grauer Vorzeit oder im Mittelalter; dennoch sind es gerade die Umstände, wie sie zu Tode kommen. Und es liegt durchaus nicht an der schlechten Medizinischen Versorgung. Nein, daran liegt es schon lange nicht mehr. Diese Kinder wären niemals zu Tode gekommen, hätte nicht so eine perverse Sau Hand an sie gelegt, oder jemand von der Fürsorge weggesehen! Wie erwähnt, sind mir die Hände gebunden, doch du, Dionysos Bassaros, du hast die Wahl, dich für das Richtige zu entscheiden. Also tu es gefälligst auch!«, sprach Azrael, schüttete seinen Kaffee aus und verstaute die Thermoskanne wieder unter seiner schwarzen Kutte. »Noch eins: Wenn du es schon nicht aus reinem Heldenmut für die Kinder tust, dann doch wenigstens deshalb, dich nicht von der Alten verarschen zu lassen und dir dabei die Blöße zu geben, von ihr deinen Körper stehlen zu lassen. Oder willst du, so wie ich, niemals mehr ein Getränk zu dir nehmen, ohne hinterher aufwischen zu müssen? Und das gerade jetzt, wo sich die Karnevalssaison ihrem Höhepunkt entgegen neigt. Vergiss also das elendige Trübsal blasen. Sage dir stattdessen: ›Jetzt erst recht!‹ Also, in diesem Sinne: Cheerio und Waidmannsheil! Ich besuche jetzt einen Volltrottel, der sich beim nächtlichen Fallenstellen mit der eigenen Schlinge strangulierte. Echt, ich habe den geilsten Job der Welt!«, kicherte Gevatter Tod und schlenderte zu einem mit Flammenmustern verzierten Quad, welches an einer Halterung zwei Urnen mit sich führte. Eine helle und eine dunkle.
»Waidmannsdank, Azrael. Tausend Dank für deinen Rat. Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe«, nickte ihm der Barde zu. Erfüllt von seiner neuen Mission, machte er eine Geste mit der nun völlig durchscheinenden Hand. Ein blauer Riss im Zeit-Raum-Kontinuum entstand, worin er eintrat und entschwand.
Gevatter Tod setzte sich auf´s Quad und verstaute die Motorsense. Bevor Azrael losbrauste, murmelte er grinsend: »Nun zeig mal, Cowboy, ob du mehr bist, als nur ein loser Trunkenbold! Mach sie platt, diese gottverdammte Hexe!«
*
Natürlich musste sich der Barde eingestehen, dieses Hexen-Problem nicht alleine lösen zu können. Deshalb tat er in seinen Augen das einzig Vernünftige: Er wandte sich an seinen Boss. Leider wurde sein Tatendrang dadurch etwas abgebremst, weil er nicht sofort eine Audienz bekam, sondern so lange geduldig sein musste, bis ihm etwas Zeit erübrigt werden konnte. Unruhig lief er vor der mächtigen Doppelpforte auf und ab. Immer wieder marschierte er vorbei an den zwei starr geradeaus blickenden Wachdämonen, die links und rechts der Pforte Spalier standen. Die beiden hatten die ziemlich voluminösen Erscheinungsformen von Minotauren angenommen. Sie waren ungefähr so breit wie hoch. Ob sie sich von seiner Lauferei gestört fühlten, verrieten sie jedenfalls nicht. Sie verzogen keine Miene, demonstrierten wortlos mit ihren vor der Tür gekreuzten Speeren, dass niemand an ihnen vorbei käme. Selbstverständlich befand der Barde sich in der Dämonendimension, wen sollte er denn sonst angehen, so gänzlich ohne eigenen Körper?
Wie immer, wenn er jemandem höheren Ranges begegnen sollte, war es ihm reichlich peinlich, so tief gesunken zu sein. So war es für ihn nur ein schwacher Trost, nicht der Einzige zu sein, dem es nicht gut ergangen war. Einst ein viel gehuldigter Gott, lebte er nun als verschriener Trinker, nur ein Glas breit von der Gosse entfernt.
Derart gab es leider viele. Z. B. Hermes, der seinen Lebensunterhalt damit verdiente, indem er Sportschuhe entwarf und seinen Verdienst mit einem Paketdienst aufbesserte. Oder Hades, der die Unterwelt räumen musste, um sie diesem komischen Satan zu überlassen. Jetzt putzte er in einer Gay-Discothek den Darkroom. Na, wenn das nicht die Hölle ist?
Und erst mal Pallas Athene... Obwohl sie es ziemlich gut getroffen hatte. Sie verdiente sogar recht vernünftig mit ihrem Guerilla-Camp im Dschungel. Phoebus Apollo hatte natürlich wieder mal die Nase vorn. Für ihn sah sein Verdienst recht einträglich aus. Seine von ihm gegründete Optiker-Kette warf genug ab. Zeus lag ebenfalls nicht auf der faulen Haut. Mehrere Griechische Restaurants und eine Firma, die sich auf Blitzschutz spezialisiert hatte, konnte er sein Eigen nennen.
Trotzdem war das Schicksal hart: Einst ein omnipotenter Gott, und jetzt nur noch ein Pseudo-Dämon ohne Tempel und Priesterschaft, gänzlich dem Vergessen preisgegeben. Was waren das damals für herrliche Zeiten, als es noch diese Bacchanale gab! Tagelanger, ungezügelter Genuss, nicht nur geistiger Getränke, sondern auch die der Fleischeslust. Tja, die Zeiten ändern sich eben stetig. Und das leider nicht immer zum Besten.
In der Doppelpforte öffnete sich unten links eine kleine Tür. Ein Mäuse-Dämon mit senkrecht wallendem Haar trat heraus. Er trug eine altmodische Toga, aber nicht nur die am Körper, sondern zusätzlich eine Dokumentenrolle in Händen. Der kleine Römer in Mäusegestalt entrollte das Dokument und räusperte sich theatralisch: »Hmmm, hmmm, hmmm… Qwäh?… Was ist das - verdammich und eins - für ein dämlicher Name?… Egal!« Er zeigte mit seinem knubbligen Winzlingsfinger auf den Barden. »Du da! Du darfst eintreten! Komm in die Puschen!«, winkte er ihn zu sich. Dann drehte er sich zu den wachhabenden Dämonen und räusperte erneut. »Hmmm hmmm hmmm!… Das machen die doch wieder mal mit Absicht, mich so schnöde zu ignorieren!«, raunte er dem Barden zu. Dann legte er seine Hände trichterförmig um den Mund: »HE DA! IHR ELENDIGEN WIEDERKÄUER! ÖFFNET SOFORT DAS TOR!«, brüllte der Winzling, dem bei diesem Geschrei die Adern schwollen.
Die Minotauren zogen die Speere zurück, jeder trat zur Seite und öffnete einen der Torflügel. Das ging so synchron vonstatten, dass es aussah, als wäre es ein einzelner Soldat vor einem Spiegel. Lautlos öffnete das Tor und der kleine Mäuse-Dämon winkte ungeduldig. »Na komm schon, was denn nun? Folge mir unauffällig. Aber tritt gefälligst nicht auf mich!«
»Werde mir Mühe geben!«, murmelte der Barde und folgte so unauffällig wie möglich.
»Deine erste Audienz?«, fragte der kleine Dämon.
»Ja, und hoffentlich auch meine letzte. Man erzählt sich da so Sachen. Es heißt, es könnte gefährlich werden!«, meinte der Barde und bereute sofort, so etwas geäußert zu haben.
»Jessas, bist du ein alter Schisser!«, schnaufte der Mausartige, lief voran, bis er sich fantastisch-elastisch verbeugte. »Euer Gnaden, äh… besagter Besuch!«, verbeugte er sich abermals und blickte erwartungsvoll auf.
Eigentlich dachte der Barde, die Dämonenherrscherin säße auf einem Thron. Tat sie aber nicht, denn er stand vor einem riesigen Schreibtisch, der über und über mit Akten und Dokumentenrollen bedeckt war. Außerdem saß da ein seltsames Wesen auf dem Schreibtisch, das ständig den Blick zwischen seinem Frauchen und einem großen, gläsernen Gefäß, hin und her wechselte. Im Einweckglas schwammen herausgerissene Herzen und sofort ergriff den Barden die blanke Panik, was der Anblick des Monsters nur verstärkte. Er meinte, es schon mal gesehen zu haben. Ja, irgendwo im nahen Osten. Genau, er kannte es aus Ägypten. Es war eine Art Chimäre und trug eine Mähne wie ein Löwe, besaß Ähnlichkeit mit einem Nilpferd, und dazu Merkmale eines Krokodils, vor allem, was die Zähne betraf.
Die Dämonenherrscherin der nördlichen Hemisphäre schrieb zu Ende und blickte dann vom Schreibtisch auf.
»Warum nimmst du eigentlich ständig diese winzige Gestalt an, Enkidu? Kaum jemand kann dich wirklich auf den ersten Blick wahrnehmen!«, schüttelte sie den Kopf.
»Ich dachte, das wäre ein sehr dramatischer Effekt, wenn ich als kleine Gestalt, vor diesem riesigen Schreibtisch stehe. Dann wirkt alles viel beeindruckender, Euer Gnaden. Und manchmal ist es durchaus von Vorteil, mal das Mäuschen zu spielen«, erklärte der Viertel-Gott und änderte daraufhin die Gestalt. Nun sah er wie ein unrasierter Sumerer aus.
»Lass uns allein!«, befahl die Herrscherin und winkte Enkidu davon. »Ich rufe dich, wenn du unseren Gast wieder verabschieden kannst.«
»Sehr wohl, Euer Gnaden«, verbeugte er sich abermals und verpuffte in einer schwarzen Nebelwolke. Die Schwaden hingen noch einen Moment in der Luft, dann waren auch sie fort.
Die Herrscherin nahm den Barden ins Visier. Der sah jedoch noch immer leicht verdattert dem nicht mehr vorhandenen Enkidu hinterher. »Enkidu? Der, der mit seinem Kumpel Gilgamesch die Gegend in Uruk unsicher machte? Ist verdammt lange her, als die beiden zusammen etliche Trinkhörner leerten«, bemerkte der Barde.
»Wie du weißt, spielt die Zeit hier bei uns keine große Rolle«, winkte sie ab. »Du bist doch nicht zu mir gekommen, um über die alten, längst vergangenen Zeit zu reden, oder? Meine Zeit ist kostbar, ich muss noch ein paar Dekrete erlassen, also komm auf den Punkt«, sprach sie, zog einen Handschuh an und nahm den Glasdeckel vom Gefäß, griff hinein und hielt daraufhin ein blutiges Herz in der Hand. »Hier Ammit«, zeigte sie das Herz.
»Yummi, yamm, yamm!«, sagte das Monster, wedelte mit dem Stummelschwanz, machte Männchen und fing das Herz mit seinem offenen Maul. Ammit kaute und schluckte.
Der Barde wurde sichtlich nervös. »Schönste der Schönen… Stimmt es eigentlich, dass Ihr die Herzen Eurer Feinde an Ammit, der Fressdämonin, verfüttert?« Er nahm ein immaterielles Taschentuch zur Hand und wischte damit nervös seine Stirn trocken. Außerdem überkam ihn das Verlangen, einen tiefen Schluck aus dem Flachmann zu nehmen.
»Ja, richtig. Also sieh zu, dass du dich mir nicht zum Feind machst, Vielnamiger«, riet ihm die Herrscherin. Nebenbei zog sie den blutigen Handschuh wieder aus und warf ihn in ein dafür zur Verfügung stehendes Behältnis.
»Äh… ja…«, sagte er daraufhin rhetorisch geschickt. »Herrin, ich habe ein Problem! Und erhoffe mir von Euch Hilfe. Eine Hexe stahl mir meinen Körper, als ich ein kleines Mädchen ihrer Gefangenschaft entriss. Könnt Ihr mir helfen? Allein stehe ich auf verlorenem Posten.«
Die Herrscherin zog eine Braue hoch. »Moment mal, sagtest du, eine Hexe?«
Der Barde nickte aufgeregt. »Jawohl. Eine Hexe, die kleine Kinder fängt, um sie zu verspeisen!«
»Dir dürfte wohl unlängst bekannt sein, dass wir Dämonen nichts mit den Menschen am Hut haben. Es ist uns sogar strikt untersagt, uns in ihre Belange einzumischen! Und sollten wir uns nicht daran halten, wird auf uns das Halali geblasen!«, lehnte sie barsch ab.
»Tja, dann zwingt ihr mich offenbar zu drastischen Maßnahmen. Wenn Ihr mir nicht zu helfen gedenkt, werde ich zum Dämonenherrscher des Südens gehen«, gab er zu bedenken.
»Versuch es. Jeder, der zu Ammon geht, ist ein Verräter! Und was mit Verrätern passiert...«, zeigte sie ihm nicht nur die kalte Schulter, sondern ebenso das Glas mit den Herzen. »Ammon wartet nur darauf, einen Krieg anzuzetteln. Ihm verdanken wir den Schlamassel, dass die Grenze zwischen den Dimensionen immer durchlässiger wird. Es sind seine Dämonen, die den Menschen ständig Schaden zufügen. Dennoch wird es mir in die Schuhe geschoben. Ende der Unterhaltung!«
»Aber... Euer Gnaden! Oh, Weiseste unter den Weisen! Die Hexe hat mich verflucht und mir den Körper genommen. Unter uns gesagt, war es kein wirklich schöner Körper, aber er war meiner! Zusätzlich nahm die Alte mir die Fähigkeit, mich zu materialisieren. Das bedeutet, ich werde bis zum Sankt Nimmerleinstag nie wieder auch nur einen Tropfen zu mir nehmen können! Zudem wird die Hexe Roxana weiterhin Jagd auf kleine Kinder machen - und sie verspeisen. Bitte, könnt Ihr nicht irgendetwas für mich tun?«, flehte er aufrichtig. Sogar seinen Dackelblick setzte er auf, zwar schrecklich schielend, aber immerhin hatte er in der Vergangenheit damit schon durchschlagende Erfolge erzielen können. Schließlich war er nicht nur der Gott des Suffs, sondern auch der der Fruchtbarkeit.
Ob es nun an seinem Blick lag, oder an seinem spröden Charme, konnte er nicht genau sagen. Dennoch schien die Lady am Schreibtisch vor ihm, ziemlich hellhörig zu werden. Sie zog eine Braue hoch: »Sagtest du Roxana?«
»Ja, Mächtigste des Nordens!«
»Hm, da fällt mir ein, es gäbe da doch noch eine Möglichkeit, an wen du dich wenden könntest. Sagt dir die Organisation Salomons Ring irgendetwas?«
»Ja schon, aber macht die nicht überwiegend Jagd auf uns?«, fragte der Barde erstaunt.
»Natürlich nur auf solche von uns, die den Menschen schaden. Wer sich an meine Dekrete hält, der hat vor ihnen nichts zu befürchten. Sehen wir das mal so: Egal, wer gegen meine Dekrete verstößt, landet entweder hier im Glas, oder wird von den Dämonenjägern beseitigt. Wenn du dir nichts zu Schulden kommen lässt, hast du von ihnen nichts zu befürchten. Wende dich an Ambrosius Pistillum. Er ist der Leiter dieser Organisation.«
Schüchtern hob der Barde die Hand. »Äh, wie soll ich dort hineinkommen? Ich hörte, der Bau sei so dämonensicher, dass dort nicht mal Enkidu, verwandelt als Mäuse-Dämon, hineinkommt. Wie soll ich also zu Pistillum gelangen? Könnt Ihr mir das mal verraten?«
Die Dämonenherrscherin schien zu schmunzeln. Das war insofern verdächtig, weil sie ansonsten stets ihr Pokerface wahrte.
»Oh, das dürfte kein Problem sein. Ich wüsste da jemanden, der dir weiterhilft. Rein zufällig kenne ich ihn sehr gut. Glaube mir, wenn du erwähnst, dass du in meinem Auftrag kommst, wird er sich ein Bein ausreißen.«
Sie erzählte ihm, um wen es sich bei der erwähnten Person handelte, und vor allem, wie der Barde vorzugehen habe.
Erleichtert verbeugte er sich vor der Dämonenherrscherin. »Vielen Dank, Lady Mala. Das werde ich Euch nie vergessen!«
»Das will ich doch hoffen. Vergiss nicht, eine Hand wäscht die andere!«, winkte sie ihn davon.
Enkidu stand bereit, um ihn vor die Tür zu begleiten. Er sah dem Barden nach, wie dieser wieder in die Dimension der Menschen zurückglitt. Er ging zurück zu seiner Herrin. »Glaubt Ihr, dass er Glück bei seiner Mission haben wird, Euer Gnaden?«, fragte er ungläubig.
Die Herrscherin beschäftigte sich wieder mit ihren Dekreten. »Glück? Das wird er dringend benötigen. Weißt du, worin das Geheimnis der hohen Diplomatie besteht? Andere glauben zu machen, sie seien als Sieger aus diesem Gespräch hervorgegangen. Wenn ich überlege, wohin ich den Barden schickte, könnte es sehr interessant für ihn werden - und für mich vielleicht auch ein wenig amüsant...«
*
Hüte dich vor allen Unternehmungen, die neue Kleidung erfordern.
(Henry David Thoreau)
Dergrau-braun getigerter Kater, mit dem ziemlich auffällig abgeknickten Ohr, kannte sich im Gebäude bestens aus. Schließlich erblickte er damals im Heizungskeller der Psychiatrischen Klinik das Licht der Welt. Schon als kleines Kätzchen liebte er die Menschen mehr als seine eigenen Artgenossen. Insgeheim hielt er sich womöglich selbst für einen Menschen. Zumindest eroberte er zu dieser Zeit mit seiner tapsig-charmanten Art die Herzen der Patienten und des Personals im Sturm. Irgendwann taufte jemand den Kater auf den Namen Joey.