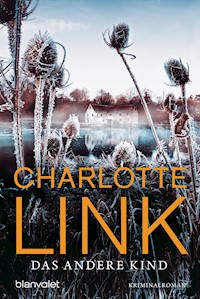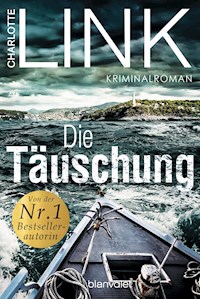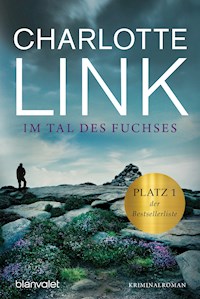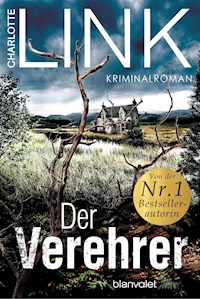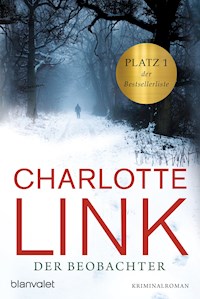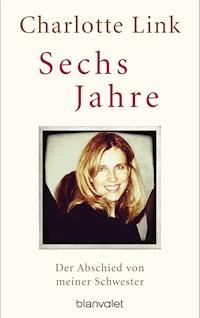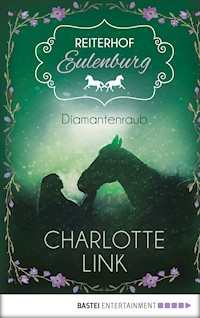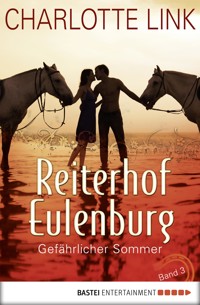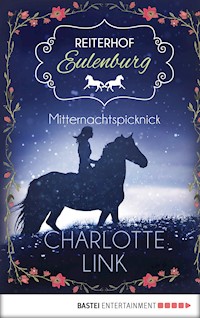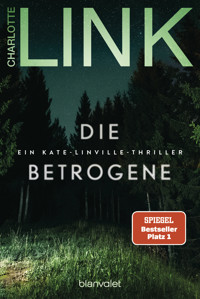Inhaltsverzeichnis
DEZEMBER 1970
SAMSTAG, 19. DEZEMBER
JULI 2008
MITTWOCH, 16. JULI
1
2
OKTOBER 2008
DONNERSTAG, 9. OKTOBER
1
2
3
FREITAG, 10. OKTOBER
1
2
3
SAMSTAG, 11. OKTOBER
1
2
SONNTAG, 12. OKTOBER
1
2
Das andere Kind.doc
1
2
3
SONNTAG, 12. OKTOBER
3
4
5
6
MONTAG, 13. OKTOBER
1
2
3
4
5
Das andere Kind.doc
4
5
6
DIENSTAG, 14. OKTOBER
1
2
3
4
5
Das andere Kind.doc
7
8
9
10
MITTWOCH, 15. OKTOBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Das andere Kind.doc
11
12
Fast angstvoll wiederholte ich meine Frage. »Chad! Wo ist Nobody?«
13
14
DONNERSTAG, 16. OKTOBER
1
2
Das andere Kind.doc
15
16
DONNERSTAG, 16. OKTOBER
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
SAMSTAG, 18. OKTOBER
Copyright
DEZEMBER 1970
SAMSTAG, 19. DEZEMBER
Sie wusste, dass sie so schnell wie möglich verschwinden musste.
Dass sie in Gefahr schwebte und dass sie verloren war, wenn die Leute, die auf dem einsamen Hof lebten, auf sie aufmerksam wurden.
Der Mann stand plötzlich wie aus dem Boden gewachsen vor ihr, gerade als sie am Hoftor ankam und sich eilig auf den Weg hinunter zu ihrem Auto machen wollte. Er war groß und nicht so ungepflegt, wie man es von dem Bewohner eines so heruntergekommenen Gehöfts erwartet hätte. Er trug Jeans und einen Pullover. Seine grauen Haare waren sehr kurz geschnitten. Er hatte helle Augen, in denen nicht die Spur eines Gefühls zu erkennen war.
Semira konnte nur hoffen, dass er sie nicht hinter den Stallgebäuden gesehen hatte. Vielleicht hatte er ihr Auto entdeckt und kam nun, um nachzuschauen, wer sich hier herumtrieb. Ihre einzige Chance bestand darin, ihm Harmlosigkeit und Unbefangenheit überzeugend vorzuspielen, und das, obwohl ihr Herz jagte und ihre Knie zitterten. Ihr Gesicht war feucht von Schweiß, trotz der beißenden Kälte des bereits dämmrigen Dezembernachmittags.
Seine Stimme war so kalt wie seine Augen. »Was tun Sie hier?«
Sie probierte ein Lächeln und hatte den Eindruck, dass es zittrig ausfiel. »Gott sei Dank. Ich dachte schon, hier ist niemand …«
Er musterte sie von oben bis unten. Semira versuchte sich vorzustellen, was er sah. Eine kleine, dünne Frau, keine dreißig Jahre alt, warm verpackt in lange Hosen, gefütterte Stiefel, einen dicken Anorak. Schwarze Haare, schwarze Augen. Dunkelbraune Haut. Hoffentlich hatte er nichts gegen Pakistanis. Hoffentlich bemerkte er nicht, dass er eine Pakistani vor sich hatte, die meinte sich vor Angst jeden Moment übergeben zu müssen. Hoffentlich nahm er ihre Furcht nicht wahr. Semira hatte den beklemmenden Eindruck, dass man sie riechen konnte.
Er machte eine Kopfbewegung hin zu dem Wäldchen am Fuß des Hügels. »Ihr Auto?«
Es war ein Fehler gewesen, es dort unten zu parken. Die Bäume standen zu weit auseinander und trugen kein Laub, sie verbargen nichts. Er hatte es von einem der oberen Fenster seines Hauses gesehen und sich seine Gedanken gemacht.
Sie war ein Idiot. Hierherzukommen und niemandem Bescheid zu sagen. Und dann noch ihr Auto in Sichtweite der gottverlassenen Farm zu parken.
»Ich... habe mich völlig verfahren«, stotterte sie. »Keine Ahnung, wie ich hier gelandet bin. Dann habe ich Ihr Haus gesehen und dachte, ich könnte fragen, ob...«
»Ja?«
»Ich bin neu in der Gegend.« Sie fand, dass ihre Stimme völlig unnatürlich klang, viel zu hoch und etwas schrill, aber er konnte ja nicht wissen, wie sie für gewöhnlich sprach. »Ich wollte eigentlich, ich wollte...«
»Wohin wollten Sie denn?«
Ihr Kopf war leer. »Nach... nach... wie hieß der Ort...?« Sie leckte sich über die trockenen Lippen. Sie stand einem Psychopathen gegenüber. Der Mann gehörte nicht nur in ein Gefängnis, er gehörte in die Sicherheitsverwahrung, davon war sie überzeugt. Sie hätte niemals allein hierherkommen dürfen. Niemand war da, der ihr helfen konnte. Sie war sich der vollkommenen Einsamkeit, der Weltabgeschiedenheit des Ortes, an dem sie sich befand, nur zu bewusst. Kein anderer Hof weit und breit, keine Menschenseele.
Sie durfte keinen Fehler machen. »Nach...«, endlich kam ihr ein Name in den Sinn, »Whitby. Ich wollte nach Whitby.«
»Da sind Sie ganz schön weit von der Hauptstraße abgekommen.«
»Ja. Das schien mir allmählich auch so.« Wieder lächelte sie verkrampft. Der Mann erwiderte ihr Lächeln nicht. Er betrachtete sie aus diesen starren Augen. Aber trotz der Gefühllosigkeit, die von ihm ausging, konnte Semira sein Misstrauen spüren. Seinen Argwohn, der mit jeder Sekunde, da er mit ihr sprach, zu wachsen schien.
Sie musste weg!
Sie zwang sich, ruhig stehen zu bleiben, obwohl sie am liebsten losgestürzt wäre. »Vielleicht können Sie mir sagen, wie ich zur Hauptstraße zurückkomme?«
Er antwortete nicht. Seine gletscherblauen Augen schienen sie zu durchdringen. Sie hatte tatsächlich nie kältere Augen gesehen. So kalt, als sei kein Leben mehr in ihnen. Sie war froh, dass sie einen Schal um den Hals trug. Sie konnte spüren, dass ein Nerv rechts unterhalb ihres Kiefers heftig zuckte.
Das Schweigen dauerte zu lange. Er versuchte etwas herauszufinden. Er traute ihr nicht. Er wog das Risiko ab, das von dieser kleinen Person für ihn ausging. Er taxierte sie, als wollte er in die Tiefen ihres Gehirns vorstoßen.
Dann plötzlich glitt ein Ausdruck der Verachtung über sein Gesicht. Er spuckte vor ihr auf den Boden.
»Schwarzes Pack«, sagte er. »Müsst ihr jetzt auch Yorkshire bevölkern?«
Sie zuckte zurück. Sie fragte sich, ob er ein Rassist war oder ob er nur provozierte, um sie aus der Reserve zu locken. Er wollte, dass sie sich verriet.
Verhalte dich, als ob das hier eine ganz normale Situation wäre.
Sie merkte, dass ein Schluchzen in ihrer Kehle aufstieg, und sie konnte nicht verhindern, dass ihr ein heiserer Laut entfuhr. Das hier war eben keine ganz normale Situation. Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie ihre Panik noch würde kontrollieren können.
»Mein... Mann ist Engländer«, sagte sie. Für gewöhnlich tat sie das nie. Sie versteckte sich niemals hinter John, wenn sie auf Vorurteile stieß, die mit ihrer Hautfarbe zu tun hatten. Aber ein Instinkt hatte ihr diesmal zu dieser Antwort geraten. Ihr Gegenüber wusste nun, dass sie verheiratet war und dass es jemanden gab, der sie vermissen würde, wenn ihr etwas zustieß. Jemanden, der kein Fremder in diesem Land war, der sofort wissen würde, was im Fall des Verschwindens einer Person zu tun war. Jemanden, den man bei der Polizei ernst nehmen würde.
Sie konnte nicht erkennen, ob ihre Aussage ihn in irgendeiner Weise beeindruckte.
»Verschwinde«, sagte er.
Es war nicht der Moment, sich über seine Unhöflichkeit aufzuregen. Oder mit ihm über die Frage der Gleichberechtigung weißer und dunkelhäutiger Menschen zu streiten. Es galt nur zu entkommen und die Polizei aufzusuchen.
Sie wandte sich zum Gehen. Zwang sich, in gleichmäßigen Schritten zu laufen und nicht zu rennen, wie sie es am liebsten getan hätte. Er sollte denken, dass sie gekränkt war, aber er durfte nicht wissen, dass sie vor Angst beinahe durchdrehte.
Sie war vier oder fünf Schritte weit gekommen, als seine Stimme sie anhielt. »He! Warte mal!«
Sie blieb stehen. »Ja?«
Er trat an sie heran. Sie konnte seinen Atem riechen. Zigarette und saure Milch.
»Du warst bei den Schuppen hinten, richtig?«
Sie musste schlucken. Am ganzen Körper brach ihr der Schweiß aus. »Welche... welche Schuppen?«
Er starrte sie an. In seinen gefühllosen Augen konnte sie lesen, was er in ihren Augen sah: dass sie es wusste. Dass sie sein Geheimnis kannte.
Er hatte jetzt keinen Zweifel mehr.
Sie rannte los.
JULI 2008
MITTWOCH, 16. JULI
1
Er sah die Frau zum ersten Mal, als er gerade die Friarage School verlassen und über die Straße zurück zu seiner Unterkunft gehen wollte. Sie stand in der geöffneten Tür und zögerte ganz offensichtlich, einen Fuß hinaus in den strömenden Regen zu setzen. Es war kurz vor sechs Uhr und bereits ungewöhnlich dunkel draußen für einen frühen Sommerabend. Der Tag war drückend heiß gewesen, dann hatte sich ein krachendes Gewitter über Scarborough entladen, und nun schien die Welt in einem Wolkenbruch unterzugehen. Der Schulhof lag verlassen. In den Unebenheiten des Asphalts bildeten sich sofort riesige Pfützen. Der Himmel bestand aus wütend geballten, blauschwarzen Wolken.
Die Frau trug ein wadenlanges, geblümtes Sommerkleid, etwas altmodisch, aber passend zu dem Tag, wie er gewesen war, ehe das Unwetter eingesetzt hatte. Sie hatte lange dunkelblonde Haare, die sie zu einem Zopf geflochten trug, und hielt eine Art Einkaufstasche in der Hand. Seiner Ansicht nach gehörte sie nicht zum Lehrpersonal der Schule. Vielleicht war sie neu. Oder eine Kursteilnehmerin.
Irgendetwas reizte ihn, näher zu treten und zu überlegen, ob er sie ansprechen sollte. Wahrscheinlich war es das ungewöhnlich Altmodische in ihrer Erscheinung. Er schätzte sie auf Anfang zwanzig, und sie sah vollkommen anders aus als andere Frauen dieses Alters. Es war nicht so, dass man sich als Mann elektrisiert gefühlt hätte bei ihrem Anblick, aber man blieb irgendwie hängen. Man wollte wissen, wie ihr Gesicht aussah. Wie sie sprach. Ob sie wirklich einen Gegenentwurf zu ihrer Zeit und ihrer Generation darstellte.
Er jedenfalls wollte das wissen. Frauen faszinierten ihn sehr, und nachdem er nahezu jeden Typ kannte, faszinierten ihn besonders die ungewöhnlichen.
Er trat an sie heran und sagte: »Sie haben keinen Schirm?«
Nicht dass er sich in diesem Moment sehr originell vorgekommen wäre. Aber angesichts des sintflutartigen Regens draußen drängte sich die Frage einfach auf.
Die Frau hatte sein Herannahen nicht bemerkt und fuhr erschrocken zusammen. Sie drehte sich zu ihm um, und er erkannte seinen Irrtum: Sie war nicht Anfang zwanzig, sondern mindestens Mitte dreißig, vielleicht sogar älter. Sie sah sympathisch aus, aber völlig unscheinbar. Ein blasses, ungeschminktes Gesicht, nicht schön, nicht hässlich, sondern von der Art, die man sich kaum länger als zwei Minuten merken konnte. Die Haare ziemlich lieblos aus der hohen Stirn gestrichen. Sie verkörperte offenbar nicht bewusst einen bestimmten Typ, mit dem sie sich von der Masse absetzen wollte, sondern hatte einfach nicht die geringste Ahnung, was sie hätte tun können, um attraktiver und anziehender auszusehen.
Ein nettes, schüchternes Ding, urteilte er, und vollkommen uninteressant.
»Ich hätte wissen müssen, dass es ein Gewitter gibt«, sagte sie. »Aber als ich heute Mittag loszog, war es so heiß, dass mir ein Schirm lächerlich vorgekommen wäre.«
»Wohin müssen Sie denn?«, fragte er.
»Eigentlich nur zur Bushaltestelle Queen Street. Aber bis ich dort ankomme, bin ich patschnass.«
»Wann geht Ihr Bus?«
»In fünf Minuten«, sagte sie kläglich, »und es ist der letzte heute.«
Offenbar lebte sie in einem der Bauernkäffer rund um Scarborough. Es war erstaunlich, wie schnell man auf dem Land war, kaum dass man die Stadtgrenze verlassen hatte. Man befand sich dann ohne großen Übergang in der Mitte von nirgendwo, in Dörfern, die nur aus wenigen, weit verstreut liegenden Farmen bestanden und über eine jämmerliche Verkehrsanbindung verfügten. Der letzte Bus um kurz vor 18 Uhr! Junge Leute mussten sich da wie in der Steinzeit fühlen.
Wäre sie jung und schön gewesen, er hätte keine Sekunde gezögert, ihr seine Hilfe anzubieten. Sie mit dem Auto nach Hause zu bringen. Vorher hätte er sie gefragt, ob sie mit ihm etwas trinken wolle, irgendwo unten am Hafen in einem der vielen Pubs. Er hatte erst für den späteren Abend eine Verabredung, an der ihm ohnehin nicht allzu viel lag, und er hatte wenig Lust, sich bis dahin in dem Zimmer zu langweilen, das er in einem Haus am Ende der Straße zur Untermiete bewohnte.
Die Vorstellung, diesem ältlichen Mädchen – denn das war ihre Ausstrahlung: ein ältliches Mädchen – in einer Kneipe bei einem Glas Wein gegenüberzusitzen und einen Abend lang das farblose Gesicht zu betrachten, hatte allerdings absolut nichts Verlockendes.
Wahrscheinlich war sogar das Fernsehprogramm unterhaltsamer. Trotzdem zögerte er, sie einfach stehen zu lassen und an ihr vorbei über den Schulhof und dann die Straße hinaufzusprinten. Sie wirkte so... verlassen.
»Wo wohnen Sie denn?«
»In Staintondale«, sagte sie.
Er verdrehte die Augen. Er kannte Staintondale, großer Gott! Eine Landstraße, eine Kirche, ein Postamt, in dem man auch die notwendigsten Grundnahrungsmittel sowie ein paar Zeitschriften kaufen konnte. Einige Häuser. Eine rote Telefonzelle, die zugleich als Bushaltestelle fungierte. Und Farmen, die ringsum hier und da wie in die Landschaft geworfen wirkten.
»Von der Haltestelle in Staintondale haben Sie sicher noch ein gutes Stück zu laufen«, vermutete er.
Sie nickte unglücklich. »Fast eine halbe Stunde, ja.«
Er hatte nun einmal den Fehler begangen, sie anzusprechen. Er hatte den Eindruck, dass sie seine Enttäuschung gespürt hatte, und etwas sagte ihm, dass dies eine schmerzlich vertraute Situation für sie sein musste. Es mochte ihr öfter passieren, dass sie männliche Aufmerksamkeit auf sich zog, dass diese aber sofort erlosch, kaum dass ein Mann ihr dann tatsächlich näher kam. Vielleicht ahnte sie, dass er ihr Unterstützung angeboten hätte, wäre sie nur ein wenig interessanter gewesen, und mit einiger Sicherheit ging sie bereits davon aus, dass daraus nun nichts wurde.
»Wissen Sie was«, sagte er schnell, ehe sein Egoismus und seine Bequemlichkeit über eine Anwandlung von Gutherzigkeit siegen konnten, »mein Wagen parkt nur ein kleines Stück die Straße hinauf. Wenn Sie mögen, fahre ich Sie rasch nach Hause.«
Sie starrte ihn ungläubig an. »Aber... das ist nicht ganz nah... Staintondale ist...«
»Ich kenne den Ort«, unterbrach er sie, »aber ich habe in den nächsten Stunden nichts weiter vor, und eine Fahrt aufs Land ist nicht das Schlechteste.«
»Bei dem Wetter...«, meinte sie zweifelnd.
Er lächelte. »Ich würde Ihnen raten, mein Angebot anzunehmen. Erstens erreichen Sie Ihren Bus wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Und zweitens sind Sie, selbst wenn es Ihnen glückt, morgen oder spätestens übermorgen heftig erkältet. Also?«
Sie zögerte, und er spürte ihr Misstrauen. Sie fragte sich, was seine Motive sein mochten. Er wusste, dass er gut aussah und Erfolg bei Frauen hatte, und sie war vermutlich realistisch genug, um zu erkennen, dass ein Mann wie er von einer Frau wie ihr nicht wirklich angezogen sein konnte. Wahrscheinlich stufte sie ihn entweder als Triebtäter ein, der sie gerade in sein Auto zu locken versuchte, weil er grundsätzlich nahm, was er kriegen konnte, oder als einen Mann, der soeben vom Mitleid überwältigt worden war. Beide Alternativen konnten ihr kaum zusagen.
»Dave Tanner«, sagte er und streckte ihr seine Hand hin. Sie ergriff sie zögernd. Ihre Hand fühlte sich warm und weich an.
»Gwendolyn Beckett«, sagte sie.
Er lächelte. »Also, Mrs. Beckett, ich...«
»Miss«, korrigierte sie ihn rasch. »Miss Beckett.«
»Okay, Miss Beckett.« Er schaute auf seine Armbanduhr. »Ihr Bus fährt in einer Minute. Ich denke, damit ist die Sache entschieden. Fühlen Sie sich bereit für einen Sprint über den Schulhof und ein paar Meter die Straße hinauf?«
Sie nickte, nun überrumpelt von der Erkenntnis, dass ihr kaum eine Wahl blieb, als den Strohhalm zu ergreifen, den er ihr hinhielt.
»Halten Sie Ihre Tasche über den Kopf«, riet er ihr, »das schützt Sie ein wenig.«
Hintereinander rannten sie über den in Pfützen schwimmenden Schulhof. Die hohen Bäume entlang dem schmiedeeisernen Zaun, der das Gelände umgab, bogen sich unter dem rauschenden Regen. Linker Hand erhob sich das riesige Gebäude der Markthallen mit seinen unterirdischen, katakombenähnlichen steinernen Gängen, in dessen Ladengalerien jede Menge Kitsch und gelegentlich auch ein wenig Kunst zu kaufen war. Nach rechts führte eine kleine Wohnstraße weiter, gesäumt von schmalen Reihenhäusern aus rotem Backstein und mit weiß lackierten Haustüren.
»Hier entlang«, sagte er, und sie liefen an den Häusern vorbei, bis sie den kleinen, blauen und ziemlich verrosteten Fiat erreichten, der auf der linken Straßenseite parkte. Er schloss das Auto auf, und beide ließen sich mit einem erleichterten Seufzer auf die Vordersitze fallen.
Aus Gwendolyns Haaren rann das Wasser, und ihr Kleid klebte wie ein nasser Lappen an ihrem Körper. Die wenigen Meter hatten ausgereicht, sie völlig zu durchweichen. Dave versuchte, seine nassen Füße zu ignorieren.
»Dumm von mir«, sagte er. »Ich hätte das Auto holen und Sie an der Schule einsteigen lassen sollen. Dann wären Sie jetzt wenigstens halbwegs trocken.«
»Ach was!« Endlich lächelte sie. Sie hatte hübsche Zähne, wie er feststellte. »Ich bin nicht aus Zucker. Und es ist in jedem Fall besser, nun bis vor die Haustür gefahren zu werden, als im Bus durch die Landschaft zu schaukeln und dann noch einen Fußmarsch vor mir zu haben. Vielen Dank.«
»Gerne«, sagte er. Er unternahm gerade den dritten Versuch, seinen Wagen zu starten, und hatte endlich Erfolg. Röchelnd sprang der Motor an, das Auto machte einen Ruck. Mit zwei Sprüngen war es auf der Straße und fuhr stotternd los.
»Das wird gleich besser«, sagte er, »der Wagen braucht seine Anlaufzeit. Wenn ich mit der Schrottlaube noch über den nächsten Winter komme, kann ich von Glück sagen.«
Der Motor begann nun gleichmäßiger zu brummen. Für diesmal war es geschafft: Das Auto würde bis Staintondale und zurück kommen.
»Was hätten Sie gemacht, wenn Sie den Bus nicht erwischt hätten und mir nicht begegnet wären?«, fragte er. Nicht dass ihn Miss Beckett besonders interessiert hätte, aber sie würden nun eine halbe Stunde lang nebeneinander im Auto sitzen, und er wollte nicht, dass die Situation in ungemütlichem Schweigen erstarrte.
»Ich hätte meinen Vater angerufen«, sagte Gwendolyn.
Er warf ihr einen schnellen Seitenblick zu. Der Klang ihrer Stimme hatte sich verändert, als sie von ihrem Vater sprach. Er war wärmer geworden, weniger distanziert.
»Sie leben mit Ihrem Vater zusammen?«
»Ja.«
»Und Ihre Mutter...?«
»Meine Mutter ist früh gestorben«, sagte Gwendolyn in einer Art, die verriet, dass sie darüber nicht mehr sagen wollte.
Eine Vatertochter, dachte er, die sich nicht lösen kann. Mindestens Mitte dreißig, und Daddy ist immer noch der Einzige für sie. Der Größte. Der Beste. Kein Mann kann ihm das Wasser reichen.
Er mutmaßte, dass sie bewusst oder unbewusst alles daransetzte, Daddys Traumtochter zu sein. Mit dem dicken, blonden Zopf und dem altmodischen Blumenkleid verkörperte sie den Frauentyp aus Daddys Jugend, die in den fünfziger oder frühen sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts stattgefunden haben mochte. Sie wollte ihm gefallen, und wahrscheinlich stand er nicht auf Miniröcke, auffallendes Make-up oder kurz geschnittene Haare. Zugleich blieb sie in ihrer Ausstrahlung vollkommen asexuell.
Im Bett will sie den Alten wahrscheinlich nicht unbedingt haben, dachte er.
Er hatte feine Sensoren und konnte spüren, dass sie sich den Kopf über einen Themenwechsel zerbrach, und er kam ihr entgegen.
»Ich unterrichte übrigens an der Friarage School«, sagte er, »aber nicht die Kinder. Die Schule stellt ihre Räume abends und an manchen Nachmittagen für die Erwachsenenbildung zur Verfügung. Ich gebe Kurse in Französisch und Spanisch, und damit halte ich mich so leidlich über Wasser.«
»Sie sprechen diese Sprachen wohl sehr gut?«
»Ich habe als Kind sowohl in Spanien als auch in Frankreich längere Zeit gelebt. Mein Vater war Diplomat.« Er wusste, dass in seiner Stimme keine Wärme mitschwang bei der Erwähnung seines Vaters. Er musste sich eher Mühe geben, nicht zu viel Hass erkennbar werden zu lassen. »Aber ich sage Ihnen, es ist kein Vergnügen, einer Gruppe total unbegabter Hausfrauen Sprachen beibringen zu müssen, deren Klang und Ausdruckskraft man liebt und deren völlige Verunstaltung man an drei oder vier Abenden in der Woche ertragen muss.« Er lachte verlegen, als ihm aufging, dass er womöglich in ein Fettnäpfchen getreten war.
»Entschuldigen Sie. Vielleicht nehmen Sie ja selbst an einem Sprachkurs teil und fühlen sich nun angegriffen? Es gibt noch drei Kolleginnen, die Kurse veranstalten.«
Sie schüttelte den Kopf. Obwohl es nicht sehr hell war im Auto wegen der Wand aus Regen draußen, konnte er erkennen, dass sich ihre Wangen gerötet hatten.
»Nein«, sagte sie, »ich nehme nicht an einem Sprachkurs teil. Ich...«
Sie sah ihn nicht an, sondern starrte aus dem Fenster. Sie hatten die Straße erreicht, die aus Scarborough in nördlicher Richtung hinausführte. Reihenhausketten und Supermärkte glitten draußen vorüber, Autowerkstätten und trist wirkende Pubs, ein Wohnwagenpark, der in den Fluten zu versinken schien.
»Ich hatte in der Zeitung davon gelesen«, sagte sie leise, »dass in der Friarage School... Nun, es wird mittwochnachmittags ein Kurs angeboten, der... für die nächsten drei Monate...« Sie zögerte.
Schlagartig begriff er, wovon sie sprach. Er verstand nicht, weshalb ihm das nicht sofort klar gewesen war. Schließlich war er ein Teil des Lehrkörpers dort. Er kannte das neue Angebot. Mittwochs. Von halb vier bis halb sechs. Heute zum ersten Mal. Und diese Gwendolyn Beckett passte wie die Faust aufs Auge in das Profil potenzieller Kursteilnehmer.
»Oh, ich weiß«, sagte er und bemühte sich, völlig gleichgültig zu klingen. So, als sei es das Normalste der Welt, an einem Kurs für... ja, was? Versager? Nieten? Verlierer? … teilzunehmen. »Geht es nicht um... eine Art Selbstbehauptungstraining?«
Er konnte ihr abgewandtes Gesicht nun überhaupt nicht mehr erkennen, vermutete aber, dass sie puterrot geworden war.
»Ja«, antwortete sie leise. »Darum geht es. Man soll lernen, seine Schüchternheit zu besiegen. Auf andere Menschen zuzugehen. Seine... Ängste zu beherrschen.« Jetzt wandte sie sich ihm zu. »Das klingt für Sie bestimmt völlig idiotisch.«
»Gar nicht«, versicherte er. »Wenn man glaubt, irgendwo ein Defizit zu haben, sollte man das angehen. Das ist jedenfalls sinnvoller, als untätig herumzusitzen und zu jammern. Machen Sie sich keine Gedanken. Versuchen Sie einfach, das Beste aus diesem Kurs herauszuholen.«
»Ja«, sagte sie und klang ziemlich verzagt. »Das werde ich. Wissen Sie... es ist nicht so, dass ich besonders glücklich bin in meinem Leben.«
Sie wandte sich wieder zum Fenster, und er wagte nicht, genauer nachzufragen.
Sie schwiegen.
Der Regen ließ ein wenig nach.
Als sie am Ortskern von Cloughton in Richtung Staintondale abbogen, riss der Himmel fast schlagartig auf. Abendsonne brach durch die Wolken.
Er fühlte sich urplötzlich angespannt. Aufgeregt. Wachsam. Da war eine Ahnung, dass sich etwas Neues anbahnte in seinem Leben. Es mochte mit dieser Frau zu tun haben, die neben ihm saß.
Es konnte aber auch ganz anders sein.
Er mahnte sich, ruhig zu bleiben. Und vorsichtig.
Er konnte sich nicht mehr allzu viele Fehler leisten in seinem Leben.
2
Amy Mills brauchte das Geld, das ihr der Job als Babysitter einbrachte, andernfalls hätte sie das nie gemacht, aber sie musste sich ihr Studium weitgehend selbst finanzieren und konnte nicht wählerisch sein. Nicht dass es unangenehm gewesen wäre, den Abend in einem fremden Wohnzimmer zu verbringen, ein Buch zu lesen oder fernzusehen und einfach nur Wache bei einem schlafenden Kind zu halten, dessen Eltern unterwegs waren. Aber sie kam dadurch spät in ihr eigenes Bett, und überdies hasste sie den Heimweg durch die Dunkelheit. Zumindest im Herbst und Winter. Im Sommer blieben die Abende lange hell, und oft herrschte auf den Straßen Scarboroughs dann noch lebhaftes Treiben durch die vielen Studenten, die das Städtchen an der Ostküste Yorkshires bevölkerten.
An diesem Abend jedoch sah es anders aus. Das Gewitter und der heftige Regen vom Nachmittag hatten alle Menschen in ihre Häuser getrieben und die Straßen leer gefegt. Zudem war es nach einem sehr heißen Tag deutlich kühler geworden. Ungemütlich und windig.
Niemand wird unterwegs sein, dachte Amy unbehaglich.
Mittwochs war sie immer bei Mrs. Gardner, genau genommen bei deren vierjähriger Tochter Liliana. Mrs. Gardner war eine alleinerziehende Mutter, die sich und ihr Kind mühsam mit den verschiedensten Jobs durchbrachte, und mittwochs hielt sie abends in der Friarage School einen Französischkurs ab. Er endete um neun Uhr, aber danach ging sie mit ihren Schülern stets noch etwas trinken.
»Ich komme ja sonst nie raus«, hatte sie zu Amy gesagt, »und wenigstens einmal in der Woche möchte ich auch ein wenig Spaß haben. Ist es für Sie in Ordnung, wenn ich um zehn daheim bin?«
Das Problem war: Es war nie zehn Uhr, wenn sie endlich eintraf. Halb elf, wenn Amy Glück hatte, Viertel vor elf war eher die Regel. Mrs. Gardner entschuldigte sich jedes Mal wortreich.
»Ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist! Meine Güte, wenn man erst einmal zu quatschen anfängt...«
Eigentlich hätte Amy diesen Job gern gekündigt, aber es war ihre einzige gewissermaßen feste Stellung. Sie betreute auch Kinder anderer Familien, aber das nur unregelmäßig. Auf das Geld vom Mittwoch konnte sie sich verlassen, und in ihrer Situation war das Gold wert. Wäre nur der Heimweg nicht gewesen …
Ich bin richtig feige, sagte sie sich oft, aber das änderte nichts an ihrer Angst.
Mrs. Gardner besaß kein Auto, um ihre Hilfskraft rasch heimfahren zu können, überdies war sie jedes Mal viel zu stark alkoholisiert. Auch an diesem Mittwoch hatte sie wieder recht tief ins Glas geschaut, und es war später geworden als je zuvor: zwanzig Minuten nach elf!
»Wir hatten zehn Uhr vereinbart«, sagte Amy entnervt und packte ihre Bücher zusammen. Sie hatte den Abend mit Lernen verbracht.
Mrs. Gardner gab sich wenigstens zerknirscht. »Ich weiß, und das ist auch wirklich furchtbar mit mir. Aber wir haben eine Neue in unserem Kurs, und die hat ein paar Runden ausgegeben. Sie hatte unheimlich viel zu erzählen, und ehe ich mich’s versah... war es so spät geworden!«
Sie händigte Amy das Geld aus und war so anständig, fünf Pfund mehr zu geben. »Hier. Weil Sie ja wirklich Überstunden machen mussten... Mit Liliana war alles in Ordnung?«
»Sie schläft. Sie ist nicht einmal aufgewacht.« Amy verabschiedete sich etwas unterkühlt von der weinseligen Mrs. Gardner und verließ deren Wohnung. Als sie auf die Straße trat, hob sie fröstelnd die Schultern.
Fast herbstlich, dachte sie, dabei haben wir gerade erst Mitte Juli.
Wenigstens regnete es seit Stunden nicht mehr. Ihr Weg führte sie zunächst ein Stück die Straße am St. Nicholas Cliff hinab, vorbei am ziemlich abgeblättert wirkenden Grand Hotel und dann über die lange, schmiedeeiserne Brücke, die den Bereich der Innenstadt mit dem South Cliff verband und eine Straßenkreuzung überquerte, auf der tagsüber reger Verkehr herrschte. Jetzt, zu dieser späten Uhrzeit, war jedoch auch dort unten alles ausgestorben, allerdings gleißend hell erleuchtet von den Straßenlaternen. Amy empfand die Stille der schlafenden Stadt durchaus als unheimlich, doch hielt sich ihre Angst noch in Grenzen. Schlimmer würde das Stück durch den Park werden. Links unterhalb von ihr das Meer und der Strand, weit oberhalb die ersten Häuser des South Cliff und dazwischen die Esplanade Gardens, die sich terrassenförmig nach oben schraubten, dicht bewuchert von Büschen und Bäumen, durchzogen von einer Vielzahl schmaler Wege. Der kürzeste Aufstieg führte über eine steile Treppe direkt zur Esplanade, der breiten Straße, hinauf, an deren Westseite entlang sich ein Hotel an das andere reihte. Dies war Amys Strecke, die dunkle Treppe der heikle Abschnitt dabei. Sowie sie auf der Esplanade wäre, würde sie sich besser fühlen. Sie musste dann noch ein gutes Stück die Straße hinauf und gleich hinter dem Highlander Hotel in die Albion Road abbiegen, in der das schmalbrüstige Reihenhaus lag, das einer Tante von ihr gehörte, die sie für die Dauer des Studiums aufgenommen hatte. Die Tante war alt und einsam und freute sich über die Gesellschaft, und Amy war das Kind armer Eltern, denen die kostenlose Wohnmöglichkeit sehr entgegenkam. Überdies konnte sie von dort aus gut zu Fuß den Campus erreichen. Sie war dankbar, dass sich doch manches in ihrem Leben besser gefügt hatte, als gedacht. Da, wo sie herkam, aus einer Arbeitersiedlung in Leeds, hätte niemand geglaubt, dass Amy es auf die Universität schaffen würde. Aber sie war intelligent und fleißig, und bei all ihrer übertriebenen Schüchternheit und Ängstlichkeit doch recht zielstrebig. Alle Prüfungen hatte sie bislang mit guten Noten bestanden.
Sie befand sich in der Mitte der Brücke, als sie kurz stehen blieb und sich nach hinten umschaute. Es war nicht so, dass sie irgendetwas gehört hätte, aber sie hatte jedes Mal an ungefähr dieser Stelle die fast reflexhafte Neigung, zu überprüfen, ob alles in Ordnung war, ehe sie in die unheimliche Einsamkeit der Esplanade Gardens eintauchte – ohne dass sie sich darüber im Klaren gewesen wäre, was sie unter in Ordnung eigentlich genau verstand.
Ein Mann kam das St. Nicholas Cliff herab. Groß, schlank, sehr rasche Schritte. Seine Kleidung vermochte sie nicht genau zu erkennen. Nur noch wenige Meter und er würde die Brücke erreicht haben, auf die er unzweifelhaft zusteuerte.
Ansonsten war weit und breit niemand zu sehen.
Mit der einen Hand umklammerte Amy ihre Büchertasche, mit der anderen den Haustürschlüssel, den sie noch bei Mrs. Gardner hervorgekramt hatte. Sie hatte es sich angewöhnt, ihn immer schon bereitzuhalten, wenn sie zu Hause ankam. Natürlich hing auch das wieder mit ihren Ängsten zusammen. Ihre Tante vergaß jedes Mal, die Lampe über dem Eingang einzuschalten, und Amy hasste es, dort zu stehen und blind wie ein Maulwurf in ihrer Tasche nach dem Schlüssel zu graben, rechts und links von sich die beiden drei Meter hohen Fliederbüsche, die den kurzen Plattenweg fast vollständig zuwucherten und die zu beschneiden sich die alte Frau mit alterstypisch unvernünftiger Sturheit beharrlich weigerte. Amy wollte rasch ins Haus gelangen können. Schnell in Sicherheit sein.
In Sicherheit wovor?
Sie war zu ängstlich, das wusste sie. Es war einfach nicht normal, überall Gespenster zu sehen, ständig Einbrecher, Raubmörder, Triebtäter hinter jeder Straßenecke zu wittern. Sie mutmaßte, dass es an der Art lag, wie sie aufgewachsen war – als überbehütetes, beschütztes, kostbares einziges Kind ihrer einfach strukturierten Eltern. Tu dies nicht, tu jenes nicht, dies könnte passieren, das könnte passieren... Diese Sätze hatte sie ständig zu hören bekommen. Zu den meisten Unternehmungen ihrer Klassenkameraden hatte sie nicht mitgedurft, weil ihre Mutter stets Angst hatte, es könnte in irgendeiner Weise schlimm für sie ausgehen. Amy hatte gegen die Verbote nicht revoltiert; sie hatte die Ängste ihrer Mutter frühzeitig geteilt und war recht froh gewesen, den Schulfreunden gegenüber ein Argument zu haben:
Ich darf eben nicht mit...
Was auf die Dauer dazu geführt hatte, dass es kaum mehr Freunde für sie gab.
Sie drehte sich noch einmal um. Der Fremde hatte die Brücke erreicht. Amy ging weiter. Sie lief etwas schneller als zuvor. Es war nicht nur die Furcht vor dem Mann, die sie trieb. Es war auch die Furcht vor ihren eigenen Gedanken.
Einsamkeit.
Die anderen Studenten des Scarborough Campus, einem Ableger der Universität von Hull, wohnten während des ersten Studienjahres im Wohnheim, später taten sie sich dann in kleineren Wohngemeinschaften zusammen und bezogen Wohnungen, die der Universität gehörten und für eine geringe Miete zur Verfügung gestellt wurden. Amy hatte sich selbst immer wieder einzureden versucht, dass ihr Unterkriechen bei der Tante nur natürlich und von Vorteil war, denn gar keine Miete war noch immer weniger als eine geringe Miete, und sie wäre dumm gewesen, sich anders zu entscheiden. Die bittere Wahrheit jedoch war: Sie hatte überhaupt keine Clique, mit der sie sich hätte zusammentun können. Niemand hatte sie je gefragt, ob sie diese oder jene Wohnung mit dieser oder jener Gruppe hätte teilen mögen. Ohne die alte Tante mit dem leer stehenden Gästezimmer hätte es düster ausgesehen, und die Wohnfrage wäre ein echtes Problem geworden, jenseits noch eines möglichen Kostenproblems. Aber darüber mochte Amy am liebsten überhaupt nicht nachdenken.
Vom Ende der Brücke waren es nur noch ein paar Schritte bis zu den Parkanlagen. Gewohnheitsmäßig wandte sich Amy nach rechts, wo die Treppe nach oben begann. In der Wegbiegung stand ein neues Haus, an dem in diesen Wochen die letzten Baumaßnahmen vorgenommen wurden; es war nicht recht ersichtlich, ob das Gebäude einmal Menschen als ein Zuhause oder der Gemeinde Scarborough zu irgendeinem anderen Zweck dienen sollte.
Amy ging mit schnellen Schritten daran vorbei und prallte dann zurück: Zwei der großen, aus Draht geflochtenen Bauzäune, die das Haus umstellten, blockierten nun die Treppe, ebenso wie den ein Stück weiter dahinter verlaufenden Serpentinenweg, der eine Ausweichmöglichkeit dargestellt hätte. Der gewohnte Durchgang war gesperrt. Man hätte sich seitlich vorbeidrücken können, doch Amy zauderte. Am Nachmittag, als sie sich in brütender Hitze auf den Weg in die Fußgängerzone gemacht hatte, wo sie einiges hatte erledigen müssen, ehe sie den Dienst bei Mrs. Gardner und ihrer Tochter angetreten hatte, war der Weg noch frei gewesen. In der Zwischenzeit hatte es ein heftiges Gewitter und einen fast sintflutartigen Wolkenbruch gegeben. Möglicherweise waren die Treppe ebenso wie die Serpentine dabei beschädigt worden. Stufen ausgehöhlt und eingebrochen. Erde weggeschwemmt. Befestigungen abgerissen und Geröll hinweggespült. Es mochte gefährlich sein, diese Wege zu benutzen.
Außerdem war es offensichtlich verboten.
Amy war nicht der Typ, der sich über ein Verbot einfach hinweggesetzt hätte. Sie hatte immer gelernt, sich den Obrigkeiten zu fügen, ob sie deren Anordnungen nun verstand oder nicht. Es gab Gründe, und das reichte. In ihrer aktuellen Situation vermochte sie sich die Gründe sogar vorzustellen.
Unschlüssig wandte sie sich um.
Es gab noch weitere Wege, die in die Esplanade Gardens, dieses Labyrinth für Spaziergänger, hineinführten, aber auf keinem von ihnen konnte sie schnell und direkt nach oben auf die Straße und damit wieder in die Nähe menschlicher Behausungen gelangen. Der unterste Weg führte in die direkt entgegengesetzte Richtung, nämlich zum Strand hinab und dann zum Spa Complex, einer Ansammlung viktorianisch anmutender Gebäude, die direkt am Wasser lagen und der Stadt für kulturelle Veranstaltungen jeder Art dienten, nachts jedoch hermetisch verschlossen und nicht einmal von einem Nachtwächter besetzt waren. Vom Spa Complex aus gab es Seilbahnen, die den Hang hinauf verliefen und vor allem ältere Herrschaften transportierten, die sich nicht mehr durch die in Fels gehauenen, äußerst steil verlaufenden Gärten plagen mochten. Etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht standen die Gondeln jedoch still, und in den Fahrkartenhäuschen tat niemand um diese Zeit Dienst. Natürlich gelangte man auch zu Fuß nach oben, aber der Anstieg von ganz unten war lang und beschwerlich. Der Vorteil dieses unteren Weges lag darin, dass er beleuchtet war: Große bogenförmige Laternen, ebenfalls dem Stil der viktorianischen Epoche nachempfunden, spendeten warmes, orangefarbenes Licht.
Es gab zudem einen mittleren Weg, den schmalsten von allen. Auf halber Höhe des Steilhangs führte er eine ganze Weile praktisch eben an diesem entlang, ehe er sanft anzusteigen und sich so unmerklich nach oben zu schlängeln begann, dass er auch Fußgängern mit wenig ausgeprägter körperlicher Kondition ein halbwegs komfortables Vorwärtskommen ermöglichte. Amy wusste, dass er direkt vor dem Crown Spa Hotel auf die Esplanade mündete. Sie würde auf dem mittleren Weg schneller am Ziel sein, als wenn sie den Umweg über den Strand nahm, aber der Nachteil war: Hier gab es keine Laternen. Der Weg verlor sich zwischen Büschen und Bäumen in schwärzester Dunkelheit.
Sie tat ein paar Schritte zurück, spähte in Richtung Brücke. Der Mann hatte fast deren Ende erreicht. Bildete sie es sich ein, oder bewegte er sich tatsächlich langsamer voran als vorher? Etwas zögerlicher? Was tat er überhaupt um diese Zeit an diesem Ort?
Ganz ruhig, Mills, du bist auch um diese Zeit an diesem Ort, sagte sie zu sich selbst, ohne dass deshalb ihr Herz auch nur einen halben Takt langsamer gerast wäre.
Er kann auf dem Heimweg sein, genau wie du!
Aber wer war denn jetzt, bitte schön, noch auf dem Heimweg? Es war zwanzig Minuten vor Mitternacht. Nicht die Zeit, da Menschen für gewöhnlich von der Arbeit heimkehrten, es sei denn, sie jobbten als Babysitter bei einer rücksichtslosen Mutter, die es grundsätzlich zu spät werden ließ.
Ich werde kündigen. Ich mache das nicht mehr mit. Für kein Geld der Welt, nahm sie sich vor.
Sie erwog jetzt ihre Optionen, die allesamt nicht ausgesprochen verheißungsvoll schienen. Sie konnte über die Brücke zurück zum St. Nicholas Cliff laufen und dann den Weg durch die Innenstadt, die lange Filey Road hinauf nehmen – aber das würde eine halbe Ewigkeit dauern. Natürlich gab es Busverkehr, aber sie hatte keine Ahnung, ob ihre Linie so spät noch verkehrte. Zudem hatte sie den Bus wenige Wochen zuvor wegen schlechten Wetters benutzt und war an der Haltestelle von betrunkenen Jugendlichen mit rasierten Köpfen und allerhand Piercings angepöbelt worden. Sie hatte Todesängste ausgestanden und sich geschworen, in Zukunft lieber vom Regen durchweicht zu werden und eine Erkältung zu riskieren, als sich noch einmal in solch eine Situation zu bringen. Angst – schon wieder. Angst, durch den dunklen Park zu laufen. Angst, an der Haltestelle zu warten. Angst, Angst, Angst.
Sie bestimmte ihr Leben, und das durfte so nicht weitergehen. Sie konnte nicht länger von einer Krise in die nächste stolpern, indem sie einer Furcht auszuweichen versuchte und damit unweigerlich die nächste heraufbeschwor. Um zum Schluss in einer kühlen, regnerischen Julinacht wie paralysiert an einer Wegkreuzung zu stehen, ihren eigenen keuchenden Atem zu hören, ihr Herz wie einen schweren, schnellen Hammer schlagen zu spüren und sich zu fragen, welche ihrer Ängste mehr oder weniger schlimm war. Was letztlich zum berühmten Abwägen zwischen Pest und Cholera wurde, und das fühlte sich einfach nur schrecklich an.
Der Mann befand sich nun auf derselben Höhe wie sie, blieb stehen und blickte zu ihr herüber.
Er schien auf irgendetwas zu warten, womöglich auf etwas, das sein Gegenüber sagen oder tun sollte, und da Amy ein Mädchen war, das gelernt hatte, Erwartungen zu entsprechen, öffnete sie den Mund.
»Der... der Weg ist gesperrt«, sagte sie. Ihre Stimme krächzte etwas, sie räusperte sich. »Zwei Gitter... man kann da nicht durch.«
Er nickte kurz, wandte sich dann ab und schlug den Weg in Richtung Strand ein. Den beleuchteten Weg.
Amy atmete auf. Harmlos, das war harmlos gewesen. Er wollte nach Hause, hätte normalerweise vermutlich die Treppe genommen. Würde nun wahrscheinlich zum Spa Complex laufen und sich dann an den Anstieg machen. Dabei in sich hineinfluchen, weil er länger unterwegs sein würde als gedacht. Zu Hause wartete seine Frau. Sie würde schimpfen. Er hatte sich mit seinen Kumpels ohnehin schon in der Kneipe verspätet, nun auch noch der Umweg. Nicht sein Tag. Manchmal kam eben alles zusammen.
Sie kicherte, merkte aber selbst, wie nervös das klang. Sie neigte dazu, sich die Lebensumstände wildfremder Leute zurechtzufantasieren. Lag wahrscheinlich daran, dass sie zu viel allein war. Wer zu wenig mit Menschen aus Fleisch und Blut kommunizierte, musste sich eben im Reich der eigenen Einbildungen bewegen.
Noch ein Blick zurück zur Brücke. Niemand war dort zu sehen.
Der Fremde war in Richtung Strand verschwunden. Die Treppe war gesperrt. Amy zauderte nicht mehr. Sie nahm den mittleren Weg, den unbeleuchteten. Das bisschen Mondschein, gedämpft hinter langen Wolkenschleiern, reichte aus, sie den Pfad zu ihren Füßen ahnen zu lassen. Sie würde zur Esplanade hinaufkommen, ohne sich die Knöchel zu brechen.
Die dichten, tropfnassen Büsche, die im vollen Sommerlaub standen, hatten sie nach wenigen Sekunden aufgenommen.
Amy Mills verschwand in der Dunkelheit.
OKTOBER 2008
DONNERSTAG, 9. OKTOBER
1
Als das Telefon in Fiona Barnes’ Wohnzimmer klingelte, schrak die alte Dame zusammen, verließ das Fenster, an dem sie gestanden und über die Bucht von Scarborough geblickt hatte, und ging auf das kleine Tischchen zu, auf dem der Apparat stand, unschlüssig, ob sie den Hörer abnehmen sollte. Sie hatte am Morgen einen anonymen Anruf bekommen und einen am gestrigen Mittag, und auch in der letzten Woche hatte es zwei dieser bedrückenden Vorfälle gegeben. Eigentlich wusste sie nicht, ob man das, was ihr da zustieß, überhaupt als anonymen Anruf bezeichnen konnte, denn am anderen Ende der Leitung wurde nie etwas gesagt. Sie konnte jedoch hören, dass jemand atmete. Falls sie selbst nicht sofort den Hörer auf die Gabel knallte, so wie sie es am Morgen entnervt getan hatte, legte der oder die Fremde stets nach etwa einer Minute des Schweigens von sich aus wieder auf.
Fiona war nicht leicht zu erschrecken, sie rühmte sich guter Nerven und eines kühlen Kopfes, aber diese Geschichte störte und verunsicherte sie. Am liebsten hätte sie den Typen einfach auflaufen lassen und wäre nicht mehr an ihren Apparat gegangen, aber damit verpasste sie natürlich auch Anrufe, die wichtig waren oder die ihr am Herzen lagen. Ihre Enkelin Leslie Cramer zum Beispiel, die in London lebte und gerade das Trauma einer Ehescheidung durchmachte. Leslie hatte keinen Verwandten mehr außer der alten Großmutter in Scarborough, und gerade jetzt wollte Fiona für sie da sein.
Also nahm sie nach dem fünften Läuten ab.
»Fiona Barnes«, meldete sie sich. Sie hatte eine kratzige, raue Stimme, die Folge exzessiven Kettenrauchens, das sie ihr Leben lang betrieben hatte.
Schweigen am anderen Ende der Leitung.
Fiona seufzte. Sie sollte sich ein neues Telefon anschaffen. Mit einem Display, auf dem man die Nummer des Anrufers sah. Wenigstens könnte sie dann Leslie stets erkennen und den Rest herausfiltern.
»Wer ist da?«, fragte sie.
Schweigen. Atmen.
»Sie fangen an, mir auf die Nerven zu gehen«, sagte Fiona. »Sie haben offensichtlich ein Problem mit mir. Vielleicht sollten wir darüber sprechen. Ich fürchte, Ihre seltsame Taktik bringt uns beide nicht weiter.«
Das Atmen wurde intensiver. Wäre sie jünger gewesen, hätte Fiona es für möglich gehalten, dass jemand sich in sie verguckt hatte und sich nun am Telefon beim Klang ihrer Stimme irgendwelchen triebgesteuerten Aktivitäten hingab. Aber da sie im Juli neunundsiebzig Jahre alt geworden war, hielt sie das für äußerst unwahrscheinlich. Außerdem schien es nicht diese spezielle, auf sexuelle Stimulation hindeutende Atmung zu sein. Der Anrufer wirkte auf andere Art erregt. Gestresst. Aggressiv. Extrem aufgewühlt.
Es ging nicht um Sex. Aber worum dann?
»Ich lege jetzt auf«, drohte Fiona, aber ehe sie ihre Ankündigung wahr machen konnte, hatte der andere Teilnehmer die Verbindung bereits unterbrochen. Fiona vernahm nur noch ein gleichmäßiges Tuten aus dem Hörer.
»Ich sollte zur Polizei gehen!«, sagte sie wütend, knallte den Hörer auf und zündete sich sofort eine Zigarette an. Allerdings fürchtete sie, dass man sie bei der Polizei abwimmeln würde. Sie wurde ja nicht einmal beschimpft, mit Obszönitäten belästigt oder bedroht. Natürlich würde jeder verstehen, dass auch wiederholtes Schweigen am Telefon als Drohung aufgefasst werden konnte, aber es bot kaum Anhaltspunkte, um wen es sich bei dem Anrufer handeln konnte. Die Polizei würde in diesem völlig vagen Fall auch keine Fangschaltung installieren, abgesehen davon war der Anrufer vermutlich clever genug, ausschließlich von öffentlichen Telefonen aus anzurufen und diese auch noch regelmäßig zu wechseln. Die Leute waren heutzutage fernsehkrimierfahren. Sie wussten, wie man es machen musste und welche Fehler man am besten vermied.
Außerdem …
Sie trat wieder an das Fenster. Draußen war ein wunderbarer, sonnenüberfluteter Oktobertag, windig und klar, und die Bucht von Scarborough lag wie übergossen von goldenem Licht. Das Meer war aufgewühlt, von tief dunkelblauer Farbe, die Wellen trugen leuchtend weiße Schaumkronen. Jeder, der diesen Blick hätte genießen dürfen, wäre in Entzücken geraten. Nicht so Fiona in diesem Moment. Sie nahm gar nichts von dem wahr, was vor ihrem Fenster lag.
Sie wusste, weshalb sie nicht zur Polizei ging. Sie wusste, weshalb sie bislang überhaupt niemandem, nicht einmal Leslie, von den seltsamen Anrufen etwas erzählt hatte. Weshalb sie, bei aller Beunruhigung, die ganze Geschichte für sich behielt.
Die logische Frage, die jeder, der davon erfuhr, sofort gestellt hätte, wäre gewesen: »Aber gibt es denn jemanden, der etwas gegen Sie hat? Irgendjemanden, von dem Sie sich vorstellen könnten, dass er mit dieser Sache in einem Zusammenhang steht?«
Wenn sie ehrlich war, hätte sie diese Frage bejahen müssen. Was zwangsläufig weitere Fragen nach sich gezogen hätte. Und Erklärungen ihrerseits. Und alles wäre wieder hochgekocht. Die ganze furchtbare Geschichte. All die Dinge, die sie vergessen wollte. Die Dinge, von denen vor allem Leslie nichts erfahren sollte.
Würde sie sich jedoch ahnungslos stellen, beteuern, niemanden zu kennen, der etwas gegen sie haben konnte, der sie in dieser Weise drangsalieren würde – dann machte es auch keinen Sinn, überhaupt jemandem davon zu erzählen.
Sie nahm einen tiefen Zug von ihrer Zigarette. Der einzige Mensch, dem gegenüber sie sich öffnen könnte, war Chad. Weil er sowieso Bescheid wusste. Vielleicht sollte sie mit ihm sprechen. Es konnte auch nützlich sein, wenn er die E-Mails löschte, die sie ihm geschickt hatte. Vor allem die angehängten Dateien. Es war leichtsinnig von ihr gewesen, diese Dinge durch das Internet zu schicken. Sie hatte geglaubt, es riskieren zu können, weil längst Gras über die ganze Sache gewachsen war. Weil das alles so weit hinter ihr, hinter ihnen beiden lag.
Möglicherweise hatte sie sich darin geirrt.
Vielleicht sollte sie auch das umfangreiche Material in ihrem eigenen Computer vernichten. Es würde ihr schwerfallen, aber wahrscheinlich war es besser so. War am Ende ohnehin eine Schnapsidee gewesen, alles aufzuschreiben. Was hatte sie sich davon nur versprochen? Erleichterung? Bereinigung ihres Gewissens? Eher schien es ihr, als habe sie etwas für sich klären wollen, für sich und Chad. Vielleicht hatte sie gehofft, sich selbst besser zu verstehen. Aber es hatte nichts gebracht. Sie verstand sich selbst keineswegs besser als vorher. Es hatte sich nichts geändert. Man änderte das eigene Leben nicht rückwirkend, indem man es analysierte, in eine Form zu bringen versuchte, die die Geschehnisse relativieren sollte. Fehler blieben Fehler, Sünden blieben Sünden. Man hatte mit ihnen leben müssen, man würde mit ihnen sterben.
Sie drückte ihre Zigarette in einem Blumentopf aus und ging in ihr Arbeitszimmer, um den Computer zu starten.
2
Der letzte Interessent war der Schlimmste gewesen. Er hatte nicht einen Moment lang aufgehört zu nörgeln. Der Parkettfußboden war abgetreten, die Türgriffe wirkten zu billig, die Fenster schienen nicht ausreichend isoliert, die Räume waren schlecht geschnitten und ungünstig zueinander gelegen, die Küche war unmodern, der Blick in den kleinen Park hinter dem Haus völlig reizlos.
»Nicht geschenkt«, sagte er wütend, ehe er ging, und Leslie musste sich beherrschen, die Wohnungstür hinter ihm nicht laut zuzuschmettern. Es hätte sie erleichtert, aber tatsächlich war das Schloss nicht mehr ganz in Ordnung – wie zugegebenermaßen vieles andere in der Wohnung auch -, und eine solche Gewalthandlung hätte ihm womöglich endgültig den Garaus gemacht.
»Mistkerl«, sagte sie deshalb nur aus tiefstem Herzen, dann ging sie in die Küche, zündete sich eine Zigarette an und schaltete die Kaffeemaschine ein. Ein Espresso würde ihr jetzt guttun. Sie blickte aus dem Fenster in den regnerischen Tag. Natürlich sah der Park bei diesem grauen Nieselwetter nicht besonders verlockend aus, dennoch war es auch dieser baumbestandene Flecken mitten in London gewesen, weshalb sie und Stephen sich zehn Jahre zuvor in die Wohnung verliebt hatten. Ja, die Küche war altmodisch, die Böden knarrten, vieles war abgewohnt und unpraktisch, aber die Wohnung hatte Charme und Seele, und sie fragte sich, wie jemand das nicht erkennen konnte. Großkotziger Typ. Aber herumgemeckert hatten sie alle. Die ältere Frau, die als Zweite gekommen war, noch am wenigsten. Vielleicht hatte sie in ihr endlich eine Nachmieterin gefunden... Die Zeit wurde knapp. Ende Oktober stand Leslies Umzug bevor. Wenn sie bis dahin niemanden hatte, der in ihren bestehenden Mietvertrag einstieg, musste sie doppelt zahlen, und das würde sie sich nicht allzu lange erlauben können.
Nerven behalten, ermahnte sie sich.
Als das Telefon klingelte, war sie kurz versucht, den Apparat zu ignorieren, aber dann dachte sie, dass es ein Interessent für die Wohnung sein könnte, ging in den Flur hinaus und nahm den Hörer ab.
»Cramer«, meldete sie sich. Ihr Ehename kam ihr zunehmend schwer über die Lippen. Ich sollte meinen alten Namen annehmen, überlegte sie.
Eine scheue, leise Stimme am anderen Ende. »Leslie? Hier ist Gwen. Gwen aus Staintondale!«
»Gwen aus Staintondale!«, sagte Leslie. Mit Gwen, der Freundin aus Kinder- und Jugendtagen, hatte sie absolut nicht gerechnet, aber sie freute sich. Sie hatte ewig nichts von ihr gehört. Es mochte ein Jahr her sein, seit sie sie zuletzt gesehen hatte, und an Weihnachten hatten sie kurz telefoniert, aber nicht viel mehr als die obligatorischen guten Wünsche für das neue Jahr ausgetauscht.
»Wie geht es dir?«, fragte Gwen. »Ist alles in Ordnung? Ich habe erst im Krankenhaus angerufen, aber sie sagten, du hättest Urlaub genommen.«
»Ja, habe ich. Für ganze drei Wochen. Ich muss einen Nachmieter suchen und meinen Umzug vorbereiten, und … ach ja, scheiden lassen musste ich mich auch noch. Seit Montag bin ich wieder auf dem freien Markt!« Sie lauschte ihrer eigenen Stimme nach. So locker, wie sie die Neuigkeit verkündete, fühlte sie sich weiß Gott nicht. Es tat erstaunlich weh. Immer noch.
»Ach du liebe Güte«, sagte Gwen betroffen. »Das... ich meine, wir haben es ja alle kommen sehen, aber irgendwie hat man immer gehofft... Wie fühlst du dich?«
»Na ja, wir sind ja schon seit zwei Jahren getrennt. Insofern hat sich nicht viel verändert. Aber da es trotz allem eine Zäsur in meinem Leben ist, habe ich mir eine neue Wohnung gemietet. Diese hier ist auf die Dauer zu groß, und außerdem... irgendwie ist sie zu sehr mit Stephen verbunden.«
»Das kann ich verstehen«, sagte Gwen. Sie klang bedrückt, als sie fortfuhr: »Ich... ich komme mir jetzt ganz taktlos vor, aber... ich wusste wirklich nicht, dass du gerade erst geschieden worden bist, sonst... ich meine, ich hätte nicht …«
»Mir geht’s gut. Ehrlich. Also stottere nicht herum. Weshalb rufst du an?«
»Wegen... also, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, aber... du sollst zu den Ersten gehören, die es erfahren: Ich werde heiraten!«
Leslie war tatsächlich für einen Moment sprachlos.
»Heiraten?«, wiederholte sie dann und dachte, dass die Verblüffung in ihrer Stimme verletzend sein musste für Gwen, aber sie hatte es einfach nicht geschafft, ihre Überraschung zu verbergen. Gwen, der Prototyp der alten Jungfer, das altmodische Mädchen aus der ländlichen Abgeschiedenheit... Gwen, für die die Zeit stehen geblieben zu sein schien, irgendwo in einem vergangenen Jahrhundert, in dem die jungen Frauen daheim warteten, bis der Edelmann auf seinem Pferd kam und um ihre Hand anhielt... Heiraten? Einfach so?
»Entschuldige«, sagte sie hastig, »es ist nur... ich dachte immer, du machst dir nichts aus der Ehe.«
Das war gelogen. Sie wusste, dass sich Gwen danach verzehrt hatte, die Geschichten aus den Liebesromanen, die sie förmlich verschlang, in ihrem eigenen Leben wahr werden lassen zu können.
»Ich bin so glücklich«, sagte Gwen, »so unglaublich glücklich... Ich meine, ich hatte wirklich schon fast die Hoffnung aufgegeben, noch jemanden zu finden, und nun werde ich in diesem Jahr heiraten! Wir dachten, Anfang Dezember wäre ganz schön. Ach, Leslie, es ist auf einmal alles... so anders!«
Leslie hatte sich endlich gefasst.
»Gwen, ich freue mich so sehr für dich!«, sagte sie aufrichtig. »Wirklich, du ahnst nicht, wie sehr! Wer ist der Glückliche? Wo hast du ihn kennengelernt?«
»Er heißt Dave Tanner. Er ist dreiundvierzig Jahre alt, und... er liebt mich.«
»Wie wundervoll!«, sagte Leslie, aber erneut stellte sich leise Verwunderung bei ihr ein. Im ersten Moment hatte sie an einen wesentlich älteren Mann gedacht, einen Witwer vielleicht, abgeklärte sechzig Jahre alt, dem es auch ein wenig darum ging, versorgt zu werden. Sie schämte sich dafür, aber tatsächlich konnte sie sich keinen anderen Grund als einen eigennützigen vorstellen, aus dem heraus ein Mann sich mit Gwen einlassen sollte. Gwen war ein lieber Mensch, aufrichtig und warmherzig, aber sie hatte wenig an sich, was sie in den Augen eines Mannes hätte begehrenswert erscheinen lassen... Es sei denn, jemand blickte ausschließlich auf die inneren Werte eines Menschen, was nach Leslies Erfahrung wenige Männer taten.
Aber vielleicht liege ich mit dieser Einschätzung völlig daneben, dachte sie.
»Also, ich werde dir das alles ganz genau erzählen«, sagte Gwen, deren Stimme vor Freude und Erregung bebte, »aber zunächst möchte ich dich einladen. Wir feiern am Samstag eine Art... Verlobung, und es wäre einfach das schönste Geschenk für mich, wenn du dabei sein könntest!«
Leslie überlegte rasch. Für ein Wochenende war die Fahrt hinauf in den Norden etwas zu lang und zu umständlich, aber praktischerweise hatte sie ja gerade Urlaub. Sie könnte am morgigen Freitag bereits fahren und dann noch drei oder vier Tage anhängen. Yorkshire war ihre Heimat, sie war in Scarborough aufgewachsen, und sie war nun schon viel zu lange nicht mehr dort gewesen. Sie konnte bei ihrer Großmutter Fiona wohnen, die alte Dame würde sich sicherlich sehr freuen. Natürlich hatte sie eigentlich keine Zeit, weil die Frage des Nachmieters drängte, aber es wäre schön, der Vergangenheit wieder einmal einen Besuch abzustatten. Und wenn sie ehrlich war, platzte sie fast vor Neugier auf den Mann, der Gwen – ihre Freundin Gwen! – heiraten wollte.
»Hör zu, Gwen, ich glaube, das könnte klappen«, sagte sie. »So eine Scheidung ist doch... na ja, jedenfalls würde die Reise mich auf andere Gedanken bringen, und das wäre nicht schlecht. Ich könnte morgen schon kommen. Ist das in Ordnung?«
»Leslie, du glaubst nicht, wie glücklich mich das macht!«, rief Gwen. Sie klang anders als früher. Fröhlich und optimistisch. »Wir haben übrigens herrliches Wetter! Alles passt so gut zusammen.«
»Hier in London regnet es«, sagte Leslie. »Noch ein guter Grund für eine Reise. Ich freue mich auf dich, Gwen. Und auf Yorkshire!«
Kaum hatten die beiden Frauen das Gespräch beendet, klingelte Leslies Apparat erneut. Diesmal war es Stephen.
Wie immer, wenn er mit ihr sprach, klang er traurig. Er hatte die Trennung und die Scheidung nicht gewollt.
»Hallo, Leslie. Ich wollte nur wissen... du bist heute schon wieder nicht da, und... Na ja, ist alles in Ordnung?«
»Ich habe drei Wochen Urlaub genommen. Ich ziehe um und suche wie verrückt einen Nachmieter für unsere Wohnung. Du willst sie nicht zufällig haben?«
»Du willst raus aus unserer Wohnung?«, fragte Stephen geschockt.
»Sie ist einfach zu groß für mich allein. Und außerdem … ich brauche einen Neuanfang. Neue Wohnung, neues Leben.«
»So einfach funktioniert das meist nicht.«
»Stephen …«
Er musste die beginnende Ungeduld in ihrer Stimme gehört haben, denn er lenkte sogleich ein. »Entschuldige. Das geht mich natürlich nichts an.«
»Genau. Wir sollten versuchen, uns aus dem Leben des anderen wirklich herauszuhalten. Es ist schwierig genug, dass wir uns im Krankenhaus so oft über den Weg laufen, aber darüber hinaus sollte es keine Berührungspunkte mehr geben.«
Sie arbeiteten beide als Ärzte an demselben Krankenhaus. Leslie hatte lange erwogen, sich eine neue Stelle zu suchen, aber nirgendwo hatte sie so ideale Bedingungen gefunden wie im Royal Marsden in Chelsea. Und schließlich war der Trotz in ihr erwacht: Sollte sie dem Mann, der sie betrogen und hintergangen hatte, auch noch ihre Karriere opfern?
»Entschuldige Stephen, ich bin in Eile«, fuhr sie kühl fort. »Ich muss noch etliches erledigen, und morgen fahre ich für ein paar Tage nach Yorkshire. Gwen wird heiraten und plant für den Samstag ihre Verlobung.«
»Gwen? Deine Freundin Gwen? Heiraten?« Stephen klang genauso verblüfft wie Leslie, als sie die Nachricht vernommen hatte. Sie dachte, wie demütigend sich das für Gwen anfühlen musste: Jeder, dem sie die Neuigkeit verkündete, fiel aus allen Wolken und konnte seine Überraschung nicht verbergen. Hoffentlich begriff sie die Verletzung nicht in vollem Umfang, die sich darin verbarg.
»Ja. Sie ist überglücklich. Und wünscht sich nichts so sehr wie meine Anwesenheit bei ihrer Verlobung. Außerdem möchte ich ihren Zukünftigen natürlich bald kennenlernen.«
»Wie alt ist sie jetzt? Mindestens Mitte dreißig, oder? Es wird wirklich Zeit, dass sie sich von ihrem Vater löst und ein eigenes Leben beginnt.«
»Sie hängt eben einfach sehr an ihm. Im Grunde hatte sie immer nur ihn, und da ist diese enge Bindung vielleicht ganz normal.«
»Aber nicht allzu gesund«, erwiderte Stephen. »Leslie, nichts gegen den alten Chad Beckett, aber es wäre besser gewesen, er hätte seine Tochter zu irgendeinem früheren Zeitpunkt mit etwas Nachdruck ins Leben geschubst, anstatt sie auf dieser abgelegenen Farm langsam vor sich hin welken zu lassen. Schön, dass die beiden ein gutes Verhältnis haben, aber im Leben einer jungen Frau muss es mehr geben. Na ja, nun scheint sie ja in die Gänge zu kommen. Hoffentlich ist der Typ in Ordnung, den sie sich da geangelt hat. Sie ist so hoffnungslos unerfahren.«
»Spätestens am Samstagabend werde ich mehr wissen«, meinte Leslie, dann wechselte sie abrupt das Thema. Stephen stand ihr nicht mehr nah genug, als dass sie mit ihm über eine Freundin und deren mögliche psychische Defizite hätte sprechen wollten. »Meine neue Wohnung ist übrigens wesentlich kleiner als die jetzige«, sagte sie, »und ich kann daher nicht alle Möbel mitnehmen. Wenn du dir etwas aussuchen möchtest, kannst du das gern tun.«
Er hatte damals bei seinem Auszug nichts mitgenommen. Er hatte nichts gewollt.
»Ich bin eigentlich inzwischen komplett eingerichtet«, sagte er, »was sollte ich also noch holen?«
»Den Küchentisch zum Beispiel«, antwortete Leslie spitz, »der landet nämlich andernfalls beim Sperrmüll.«
Der schöne, etwas wackelige alte Holztisch... ihre erste gemeinsame Anschaffung, noch aus Studententagen. Sie hatte so an ihm gehangen. Aber an diesem Tisch sitzend hatte er ihr damals seinen Fehltritt gestanden, seine kurze, idiotische Affäre mit einer Gelegenheitsbekanntschaft aus einer Kneipe.
Nichts war danach mehr so gewesen wie zuvor. Leslie konnte bis heute den Tisch nicht ansehen, ohne mit einem Würgen in der Kehle an jene Szene erinnert zu werden, die der Anfang vom Ende gewesen war. Die brennende Kerze. Die Flasche Rotwein. Die Dunkelheit jenseits der Fenster. Und Stephen, der unbedingt sein Gewissen erleichtern musste.
Manchmal in den vergangenen zwei Jahren hatte sie gedacht, alles würde besser, wenn nur erst dieser Tisch verschwunden wäre. Und hatte es dennoch nicht geschafft, ihn aus der Wohnung zu verbannen.
»Nein«, meinte Stephen nach einem Moment des Schweigens, »ich möchte den Tisch auch nicht.«
»Also dann«, sagte Leslie.
»Liebe Grüße an Gwen«, sagte Stephen nur, und ohne eine weitere Verabschiedung beendeten sie ihr Gespräch.
Sie betrachtete sich in dem runden Spiegel, der ihr gegenüber an der Garderobe hing. Sie sah dünn aus und ziemlich abgekämpft.
Dr. Leslie Cramer, neununddreißig Jahre alt, Radiologin. Geschieden.
Das erste gesellschaftliche Ereignis, an dem sie nach ihrer Scheidung teilnehmen würde, war ausgerechnet eine Verlobung.
Vielleicht kein schlechtes Zeichen, dachte sie.
Obwohl sie gar nicht an Zeichen glaubte. Alberner Gedanke.
Sie zündete sich die nächste Zigarette an.
3
Er sah sie im Licht der Hauslaterne auf sich zukommen und dachte: Ach du lieber Himmel! Wahrscheinlich hatte sie Stunden mit der Überlegung verbracht, wie sie sich besonders hübsch machen konnte, aber wie gewöhnlich war das Ergebnis einfach nur schrecklich. Den geblümten Baumwollrock hatte sie, so mutmaßte er, wohl von ihrer verstorbenen Mutter geerbt, jedenfalls schien er, sowohl was den Stoff als auch was den Schnitt betraf, aus einer anderen, lang vergangenen Zeit zu stammen. Dazu trug sie ziemlich plumpe braune Stiefel und einen ungünstig geschnittenen grauen Mantel, der sie, obwohl sie eigentlich recht schlank war, dick wirken ließ. Eine gelbe Bluse lugte darunter hervor, und mit Gelb hatte sie ausgerechnet die einzige Farbe erwischt, die in dem wildbunten Rock nicht vorkam. Was sie nachher, wenn sie im Restaurant waren und sie den Mantel ablegte, wie ein Osterei würde aussehen lassen.
Spontan verwarf er den Plan, mit ihr nach Scarborough zu fahren. Zu peinlich, wenn sie jemanden trafen, der ihn kannte. Irgendein Landgasthof war sicher geeigneter... Er zerbrach sich den Kopf, ob ihm eine Adresse einfiel... und preiswert musste es auch noch sein. Sein Geld reichte wie immer vorne und hinten nicht.
Sie lächelte. »Dave!«
Er trat auf sie zu, schloss sie mit einiger Überwindung in die Arme und hauchte ihr einen keuschen Kuss auf die Wange. Zum Glück war sie so weltfremd, dass sie wildes Geknutsche oder gar Sex bislang weder zu vermissen schien noch jemals einforderte. Er wusste, dass ihre bevorzugte Lektüre aus Liebesromanen in Heftchenform bestand, und vermutete, dass er in seiner zurückhaltenden Art ziemlich genau dem romantischen Bild entsprach, das sie sich schon immer von ihrem künftigen Bräutigam ausgemalt hatte. Manchmal rührte sie ihn fast. Und dann wieder fragte er sich, ob es das wirklich wert war.
»Möchtest du Dad noch begrüßen?«, fragte sie.
Er verzog das Gesicht. »Eigentlich lieber nicht. Er zeigt mir immer so deutlich, dass er mich nicht besonders mag.«
Gwen unternahm nicht den Versuch, dies abzustreiten. »Du musst ihn ein bisschen verstehen, Dave. Er ist ein alter Mann, und das alles geht zu schnell für ihn. Wenn er sich überrumpelt fühlt, verschließt er sich noch mehr als sonst. Das war schon immer so.«
Sie stiegen in Daves klappriges Auto, das wie üblich eine Weile herumzickte, ehe es ansprang. Er fragte sich zum wiederholten Mal, wie lange der Haufen Rost auf vier Rädern überhaupt noch mitspielen würde.
»Wohin fahren wir?«, fragte Gwen, als sie aus der Einfahrt rollten, deren großes, braunes Holztor ganz schief in den Angeln hing. Es ließ sich seit Jahren nicht mehr schließen, aber niemand kümmerte sich darum. Wie sich auf der Beckett-Farm, dem seit Generationen vererbten Familienbesitz der Becketts, überhaupt niemand mehr um etwas zu kümmern schien – sei es aus Unvermögen oder weil es an Geld fehlte.
»Lass dich überraschen«, entgegnete Dave geheimnisvoll, aber er hatte selbst noch keine Ahnung und hoffte auf eine spontane Eingebung.
Gwen lehnte sich zurück, setzte sich jedoch gleich wieder aufrecht in ihren Sitz. »Heute war diese Polizeibeamtin im Fernsehen, Detective Inspector Sowieso, die im Fall Amy Mills ermittelt. Du weißt, dieses Mädchen...«