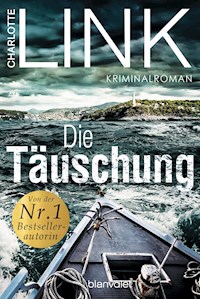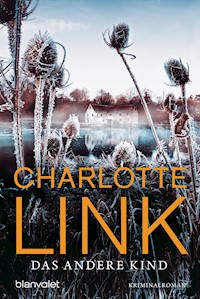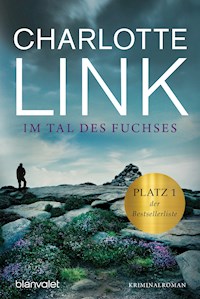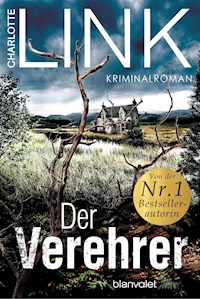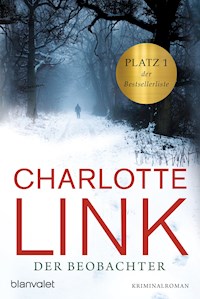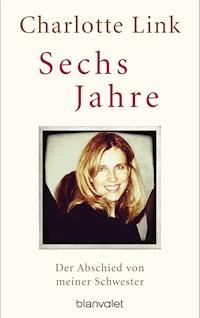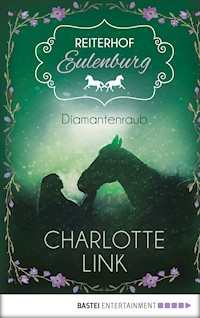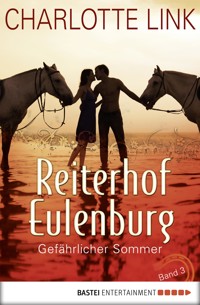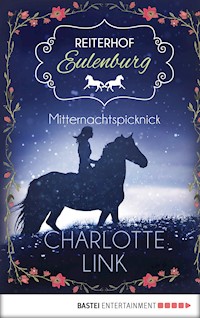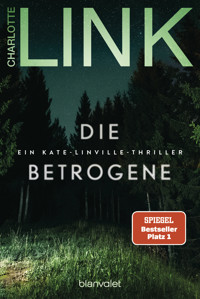10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein einsames Farmhaus im Hochmoor Yorkshires. Ein jahrzehntealtes, bedrohliches Geheimnis. Eine Fremde, die die Mauern des Schweigens zum Einsturz bringt …
Eigentlich war die Weihnachtsreise als Geburtstagsgeschenk gedacht – und als letzter Rettungsversuch einer zerrütteten Ehe. Doch für das deutsche Ehepaar Barbara und Ralph Amberg läuft von Anfang an alles schief und sie werden in Westhill House eingeschneit. Ruhelos und getrieben, durchstöbert Barbara die Räume des alten Farmhauses und sieht sich plötzlich mit der Lebensgeschichte jener Frau konfrontiert, der Westhill House einmal gehört hat: Frances Gray.
Wie in Trance taucht Barbara beim Lesen der Memoiren in ein beklemmendes Geflecht aus Liebe und Hass, Verachtung, Abhängigkeit und unbändigem Freiheitswillen. Mehr und mehr identifiziert sie sich mit Frances und blickt in die Abgründe ihrer eigenen Seele. Schließlich ist eine Entscheidung unausweichlich, die nicht nur Barbaras Leben radikal verändern wird ...
Millionen Fans sind von den fesselnden Spannungsromanen Charlotte Links begeistert. Psychologisch komplexe Figuren, dunkle Geheimnisse und raffiniert komponierte Kriminalfälle erwarten Sie. Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 970
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Eigentlich war die Weihnachtsreise als Geburtstagsgeschenk gedacht – und als letzter Rettungsversuch einer zerrütteten Ehe. Doch für das deutsche Ehepaar Barbara und Ralph Amberg läuft von Anfang an alles schief und sie werden in Westhill House eingeschneit. Ruhelos und getrieben, durchstöbert Barbara die Räume des alten Farmhauses und sieht sich plötzlich mit der Lebensgeschichte jener Frau konfrontiert, der Westhill House einmal gehört hat: Frances Gray.
Wie in Trance taucht Barbara beim Lesen der Memoiren in ein beklemmendes Geflecht aus Liebe und Hass, Verachtung, Abhängigkeit und unbändigem Freiheitswillen. Mehr und mehr identifiziert sie sich mit Frances und blickt in die Abgründe ihrer eigenen Seele. Schließlich ist eine Entscheidung unausweichlich, die nicht nur Barbaras Leben radikal verändern wird …
Autorin
Charlotte Link, geboren in Frankfurt am Main, ist die erfolgreichste deutsche Autorin der Gegenwart. Ihre Kriminalromane sind internationale Bestseller und erobern auf Anhieb die SPIEGEL-Bestsellerliste. Allein in Deutschland wurden bislang über 32 Millionen Bücher von Charlotte Link verkauft; ihre Romane sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. Charlotte Link lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Frankfurt am Main.
Weitere Informationen unter: www.charlotte-link.de
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlagund www.facebook.com/blanvalet
Charlotte Link
Das Haus der Schwestern
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Taschenbuchausgabe 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 1997, 2010 Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: mauritius images/Mike Kipling Photography/Alamy/Alamy Stock Photos; www.buerosued.de
NG · Herstellung: samSatz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-05191-4V008www.blanvalet.de
PROLOG
Yorkshire, im Dezember 1980
Von meinem Schreibtisch, der am Fenster steht, sehe ich hinaus auf die weiten, kahlen Felder des Hochmoors, über das der eisige Dezemberwind weht. Der Himmel ist voll grauer, wütend zusammengeballter Wolken. Man sagt, wir bekommen Schnee über Weihnachten, aber wer weiß, ob das stimmt. Hier oben in Yorkshire weiß man nie, was kommt. Man lebt von der Hoffnung, dass alles besser wird, und manchmal wird diese Hoffnung auf eine harte Probe gestellt – besonders im Frühjahr, wenn der Winter sich nicht verabschieden will wie ein lästiger Besucher, der noch im Hausflur verharrt, statt endlich vor die Tür zu treten. Die hungrigen Schreie der Vögel gellen durch die Luft, und kalter Regen sprüht dem Wanderer ins Gesicht, wenn er, warm verpackt, über die schlammigen Wege geht und seine Erinnerung an Sonne und Wärme wie einen kostbaren Schatz in sich trägt.
Jetzt, im Dezember, haben wir wenigstens noch Weihnachten vor uns. Nicht dass mir Weihnachten allzu viel bedeuten würde, aber es stellt doch einen kleinen Glanzpunkt in einer dunklen Zeit dar. Früher habe ich das Fest geliebt. Aber da war das Haus auch noch voller Menschen, voller Stimmen und Gelächter und Streitereien. Alles wurde geschmückt, wochenlang wurde gebacken und gekocht, und es fanden Partys statt und festliche Diners. Niemand konnte ein Fest so gut organisieren wie meine Mutter. Ich glaube, es war ihr Tod, mit dem meine Freude an Weihnachten dahinschwand.
Laura, die gute alte Laura, meine letzte Gefährtin, bemüht sich, mir alles so schön wie möglich zu gestalten. Vorhin hörte ich, wie sie die Kisten mit dem Weihnachtsschmuck vom Dachboden holte. Nun tönen unten die passenden Lieder vom Plattenspieler, und sie müht sich mit den Tannengirlanden über den Kaminen ab. Wenigstens ist sie beschäftigt.
Sie hängt rührend an mir und an dem Haus, aber oft geht sie mir auf die Nerven, wenn sie wie ein kleiner Hund hinter mir hertrabt und mich aus diesen ängstlichen Kinderaugen anstarrt. Laura ist vierundfünfzig Jahre alt, aber sie trägt immer noch den Ausdruck eines verschreckten Mädchens im Gesicht. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Sie war noch jung während des Krieges, als sie zu viel Schlimmes hat mitmachen müssen, und von der psychologischen Behandlung von Traumata wusste man damals kaum etwas. Man hoffte, dass sich die Dinge von selber regelten, aber manchmal taten sie das eben nicht.
Das war auch das Verhängnis meines Bruders George. Genau wie Laura schaffte er es nicht, die Schrecken aus eigener Kraft zu überwinden. Es gibt solche Menschen. Sie können die Verheerungen nicht aufarbeiten, die das Schicksal in ihren Seelen anrichtet.
Draußen wird es langsam dunkel. Ein paar Schneeflocken wirbeln plötzlich herum. Ich freue mich auf den Abend. Ich werde vor dem Kamin sitzen und einen alten Whisky trinken, und Laura wird neben mir sitzen und stricken und hoffentlich im Wesentlichen den Mund halten. Sie ist nett, aber nicht besonders geistreich oder scharfsinnig. Ich könnte jedes Mal aus der Haut fahren, wenn sie über Politik redet oder über einen Film, den sie im Fernsehen gesehen hat. Es ist immer alles so durchschnittlich bei ihr, und sie kann nur nachplappern, was andere ein Dutzend Mal vorgekaut haben. Aber sie tut eben auch nichts, um ihren Verstand zu schulen. Sie liest nie ein richtiges Buch, immer nur diese Miles & Boone-Liebesromane. Dann seufzt sie vor Wonne und identifiziert sich ganz und gar mit der rosa gewandeten, bildschönen Heldin auf dem Titelbild, die in den Armen eines starken, dunkel gelockten Mannes liegt und ihm ihre schwellenden Lippen zum Kuss darbietet. Laura ist dann stets so hingerissen, dass sich für kurze Zeit sogar der Ausdruck von Angst und Schrecken in ihren Zügen verliert.
Vielleicht werde ich später sogar noch einen zweiten Whisky nehmen, auch wenn sie mich dann wieder missbilligend anblickt und sagt, dass zu viel Alkohol ungesund sei. Lieber Himmel, ich bin eine alte Frau! Was macht es denn noch aus, ob ich trinke und wie viel?
Außerdem habe ich einen Grund zum Feiern, aber davon werde ich Laura nichts erzählen, sonst fängt sie an zu lamentieren. Ich habe vorhin das Wort ENDE unter meinen Roman gesetzt, und nun fühle ich mich wie von einer schweren Bürde befreit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt, und es war mir ein unerträglicher Gedanke, ich könnte nicht fertig werden. Aber nun ist es geschafft, und ich kann mich in aller Ruhe zurücklehnen und abwarten.
Ich habe die Geschichte meines Lebens geschrieben. Vierhundert Seiten, sauber getippt. Mein Leben auf Papier. Na ja – fast mein Leben. Die letzten dreißig Jahre habe ich unerwähnt gelassen, da ist nicht mehr viel passiert, und wer interessiert sich schon für all die Malaisen, die das tägliche Leben einer alten Frau bestimmen? Nicht dass ich überhaupt irgendjemandem die Geschichte aushändigen werde! Aber mein Alter zu beschreiben hätte mir auch selber keinen Spaß gemacht. Ehrlicherweise hätte ich das Rheuma erwähnen müssen, die nachlassende Sehkraft, die Gicht, die meine Finger allmählich zu Klauen krümmt, und dazu hatte ich keine Lust. Man soll nichts übertreiben, auch nicht die Aufrichtigkeit.
Ich bin ohnehin ehrlich genug verfahren. An keiner Stelle habe ich behauptet, besonders schön, besonders edel, besonders tapfer gewesen zu sein. Natürlich war ich einige Male sehr in Versuchung. Es wäre so leicht gewesen. Ein paar kleine Korrekturen hier und da, ein paar liebenswürdige Verschleierungen. Ich hätte so etwas wie einen verbalen Weichzeichner anlegen können, und all das, was ich klar und hart ausgesprochen habe, wäre im Verschwommenen geblieben. Hätte ich manches nicht gesagt und manches anders, schon wäre ein geschöntes Bild entstanden. Und zwangsläufig eine andere Geschichte. Natürlich kann man sich in die Tasche lügen und die eigene Geschichte umschreiben, aber dann stellt sich die Frage, warum man sie überhaupt schreibt.
Und man kann bei der Wahrheit bleiben. Die ist hart und tut manchmal weh, aber wenigstens ist es die Wahrheit. Damit bekommt die ganze Sache einen Sinn. Daran habe ich mich gehalten, auf jeder einzelnen Seite. Zwar frage ich mich, ob die Tatsache, dass ich über mich, Frances Gray, nicht in der Ich-Form, sondern in der dritten Person geschrieben habe, damit zusammenhängt, dass ich unbewusst hoffte, auf diese Weise doch ein bisschen schummeln zu können. Ein »Ich« nötigt zu weit aufrichtigeren Analysen als ein »Sie«. Aber wenn dies tatsächlich mein verstecktes, unehrenhaftes Motiv war, so kann ich sagen, ich habe mich nicht verlocken lassen, das Hässliche zu schönen. Ich bin mit der fiktiven Frances in der dritten Person gewiss gnadenlos verfahren. Das vermittelt mir ein angenehmes Gefühl von Mut und Stärke.
Ich werde meine Aufzeichnungen gut verstecken. Sosehr Laura mich liebt, würde sie doch alles sofort nach meinem Tod vernichten, solche Angst hat sie, dass jemand gewisse Dinge erfahren könnte. Sie kann nicht aus ihrer Haut heraus, aber wer kann das schon? Am sinnvollsten wäre es sicher, alles zu verbrennen, denn ob die vielen beschriebenen Seiten nun in einem Versteck vor sich hin modern oder gar nicht mehr existieren, bleibt sich am Ende gleich. Für mich hat das Schreiben seinen Zweck ohnehin erfüllt: Schreiben zwingt zur Präzision. Schemenhafte Erinnerungen nehmen klare Umrisse, deutliche Farben an. Ich war gezwungen, mich wirklich zu erinnern. Und darüber habe ich mich ausgesöhnt. Mit mir, mit meinem Leben, mit dem Schicksal. Ich habe den Menschen vergeben, und ich habe vor allem mir selbst vergeben. Das war mir ein wichtiges Anliegen, und es ist geglückt. Und dennoch …
Ich kann das alles nicht einfach den Flammen übergeben. Zu viel Arbeit, zu viel Zeit stecken darin. Ich bring’s nicht fertig. Ich ahne, dass das ein Fehler ist, aber ich habe so viele Fehler gemacht in meinem Leben, da kommt es auf einen mehr nicht an.
Inzwischen ist es völlig dunkel geworden; längst brennt meine Schreibtischlampe. Laura spielt unten zum hundertsten Mal dieselben Weihnachtslieder, während sie das Abendessen vorbereitet. Sie wird sich freuen, wenn ich seit Langem wieder einmal mit gutem Appetit esse. Sie denkt ja immer sofort, sie habe schlecht gekocht, wenn jemand nicht richtig zugreift. Aber während der Monate des Schreibens war ich zu angespannt, um richtigen Hunger zu haben. Das kann sich ein Mensch wie Laura, dessen Phantasie sich in ziemlich engen Grenzen bewegt, nicht vorstellen. Irgendwann habe ich deshalb aufgehört, es ihr zu erklären. Nachher wird sie strahlen und denken, sie habe endlich wieder meinen Geschmack getroffen. Und das wird sie unendlich glücklich machen.
Laura ist fast krankhaft abhängig von der Meinung anderer Leute, und am meisten von meiner. Ich frage mich oft, wen sie mit ihrem Bitte-hab-mich-lieb-Blick verfolgen wird, wenn ich nicht mehr bin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Laura dann plötzlich in Freiheit und Unabhängigkeit leben wird. Sie braucht jemanden, um dessen Gunst sie buhlen, dem sie alles recht machen kann. In gewisser Weise braucht sie sogar jemanden, der Druck auf sie ausübt, sonst fühlt sie sich qualvoll verloren in dieser Welt.
Es wird sich etwas finden für sie. Es wird sich jemand finden. Irgendetwas, irgendjemand. Die Dinge werden sich entwickeln. Ich sagte es ja schon: Hier in Yorkshire weiß man nie, was kommt …
Frances Gray
Sonntag, 22. Dezember 1996
Die Reise stand von Anfang an unter einem schlechten Stern.
Ralph war den ganzen Morgen über schon einsilbig und in sich gekehrt gewesen, aber seine Stimmung verdüsterte sich noch, als sie auf dem Flughafen an einem Zeitungskiosk vorübereilten, wo ihnen von einem der davor platzierten Drehständer Barbaras Bild von der Titelseite eines Boulevardblattes entgegensprang. Ralph blieb stehen, starrte die Zeitung an und kramte gleich darauf seine Geldbörse hervor.
»Lass doch!«, rief Barbara nervös. Sie schaute auf ihre Armbanduhr. »Unser Flug geht jeden Moment!«
»So viel Zeit haben wir noch«, sagte Ralph. Er nahm eine Zeitung und schob dem Verkäufer über die Theke hinweg ein Geldstück zu. »Es scheint ein sehr gutes Foto von dir zu sein. Wir sollten es nicht ignorieren.«
Es war ein gutes Foto von Barbara. Sie trug ein schwarzes Kostüm, in dem sie sowohl sexy als auch seriös aussah, hielt den Kopf hoch erhoben und hatte den Mund leicht geöffnet. Die blonden Haare wehten hinter ihr her. Darüber in dicken roten Lettern die Worte: DIESIEGERIN.
»Die Zeitung ist von gestern«, erklärte Barbara nach einem Blick auf das Datum. »Das Foto ist am Freitag im Gericht entstanden, nach dem Kornblum-Prozess. Ich weiß auch nicht, warum der so viel Staub aufgewirbelt hat!«
Es hörte sich wie eine Rechtfertigung an, und das ärgerte sie. Warum sollte sie sich bei Ralph dafür entschuldigen, dass sie einen Prozess gewonnen und dass die Presse daran regen Anteil genommen hatte? Weil Ralph es peinlich fand, wenn seine Frau Gegenstand reißerischer Artikel in der Yellow Press war, weil spektakuläre Fälle sowieso unter seinem Niveau waren, weil er Strafverteidiger als Juristen zweiter Klasse ansah? Ralph unterschied sehr genau zwischen Rechtsanwälten und Strafverteidigern. Er war Rechtsanwalt, selbstverständlich. Er gehörte einer renommierten Frankfurter Kanzlei an und beschäftigte sich hauptsächlich mit großen Versicherungsprozessen, für die sich außer den Beteiligten kaum ein Mensch interessierte. Barbara verteidigte Schwerverbrecher und hatte dabei so viel Erfolg, dass sie immer wieder Fälle angetragen bekam, die die Öffentlichkeit monatelang in Atem hielten. Ralph verdiente mehr Geld, Barbara war das Lieblingskind der Journalisten. Jedem von ihnen war das, was den anderen auszeichnete, ein Dorn im Auge.
Als sie endlich im Flugzeug saßen – sie hatten ihr Gate in letzter Sekunde erreicht – und die Stewardessen Getränke auszuschenken begannen, fragte sich Barbara, wie so oft in den letzten Monaten, wann sich dieser ständig gereizte Ton, diese permanente Aggression in ihre Ehe eingeschlichen hatten. Es musste schleichend passiert sein, denn sie konnte sich nicht an einen bestimmten Zeitpunkt erinnern. Sie selbst hatte sicher erste Warnzeichen übersehen. Ralph, so erinnerte sie sich, hatte schon länger von Problemen gesprochen.
Ihr Blick fiel wieder auf die Zeitung, die auf Ralphs Schoß lag. DIESIEGERIN! Diese Art von Presse trug immer zu dick auf, aber Tatsache war: Sie hatte gesiegt. Sie hatte Peter Kornblum aus einem wirklich schlimmen Schlamassel herausgepaukt.
Kornblum war Bürgermeister einer Kleinstadt, kein hohes Tier zwar, aber zweifellos recht profilierungssüchtig, weshalb er sich bemühte, zumindest in der Lokalpresse eine beständige Rolle zu spielen. Als er plötzlich in Verdacht geriet, seine neunzehnjährige Geliebte mit einer Axt erschlagen und in Stücke gehackt zu haben, wurde er schlagartig einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Bei der Gelegenheit erfuhr auch Frau Kornblum zum ersten Mal davon, dass ihr Mann intime Beziehungen zu einem Mädchen aus dem Rotlichtmilieu unterhalten hatte, was ihre bis dahin heile Welt erheblich ins Wanken brachte. Peter Kornblum verwandelte sich in ein armes Würstchen, das um Gnade und Verständnis flehte und im Übrigen inbrünstig seine Unschuld beteuerte. Wie er Barbara später erzählte, hatte er sich mit seinen engsten Parteifreunden über die Frage beraten, welchen Verteidiger er wählen sollte. Einstimmig sei ihm Barbara Amberg genannt worden. »Die holt jeden raus!«
Das stimmte so natürlich nicht. Aber sie konnte eine Reihe von Erfolgen verbuchen.
»Glaubst du, er war es?«, fragte Ralph. Er tippte mit dem Finger auf das kleine Bild von Peter Kornblum am Fuß der Seite.
Barbara schüttelte den Kopf. »Nie im Leben. Er ist überhaupt nicht der Typ. Aber trotzdem ist er nun politisch ruiniert. Seine Frau hat die Scheidung eingereicht. Er ist fertig.« Sie nahm die Zeitung und schob sie in das Haltenetz am Vordersitz. »Vergiss es jetzt«, sagte sie, »wir verreisen. Und in zwei Tagen ist Weihnachten.«
Er lächelte gequält. Zum ersten Mal begann Barbara ernsthaft daran zu zweifeln, ob es ein guter Einfall gewesen war, ihren Mann in die Einsamkeit zu entführen, um ihre Ehe zu retten.
Seit sechzehn Jahren immer das gleiche: Jedes Mal, wenn Laura Selley Westhill House für mehrere Tage oder Wochen verließ, um es Mietern zu überlassen, die dafür bezahlten, sich hier breitmachen und wie Hausherren aufführen zu dürfen, ging sie auf jene stets ergebnislose, mühselige, deprimierende Suche nach etwas, wovon sie letzten Endes nicht einmal sicher wusste, ob es überhaupt existierte. Jagte sie einem Phantom hinterher? Hatte sie nicht längst jeden einzelnen Winkel dieses alten Farmhauses durchstöbert? Suchte sie nicht immer und immer wieder an denselben Stellen, wohl wissend, dass es kaum in der Zwischenzeit dort aufgetaucht sein konnte?
Keuchend schob sie sich aus dem Wandschrank heraus, in den sie trotz ihrer schmerzenden Knochen hineingekrochen war, um in seinem Inneren zum hundertsten Mal das Unterste zuoberst zu kehren. Mit ihren siebzig Jahren war sie nicht mehr die Jüngste, zudem plagten sie seit Jahren heftige rheumatische Beschwerden, die besonders im Winter oft unerträglich wurden. Die kalten, rauen Winde, die in die Täler Yorkshires brausten, machten die Krankheit nicht besser. Es würde ihr guttun, die Weihnachtstage und den Jahreswechsel bei ihrer Schwester im milden Südosten Englands zu verbringen. Wenn nur nicht in der Zwischenzeit fremde Menschen …
Sie stand vor dem Schrank, richtete sich langsam auf und presste dabei leise stöhnend die Hand ins Kreuz. Ihr Blick ging zum Fenster hinaus über die hügeligen Wiesen Wensleydales, die im Sommer so grün und leuchtend waren, jetzt aber kahl und grau schienen. Nackte Äste bogen sich im Wind. Tief hängende, geballte Wolken jagten über den Himmel. Ein paar Schneeflocken wirbelten in der Luft. Der Radiosprecher hatte heute früh gesagt, dass sie über Weihnachten hier in Nordengland mit Schnee rechnen mussten.
Man wird sehen, dachte Laura, man wird sehen. Wird ein langer Winter werden, so oder so. Es ist immer ein langer Winter hier oben. Ich sollte das Haus verkaufen und in ein warmes Land ziehen.
Dann und wann hegte sie diesen Gedanken, wusste aber gleichzeitig genau, dass sie es nie tun würde. Westhill House war die einzige Heimat, die sie je gekannt hatte, ihre Zuflucht, ihre Insel in der Welt. Sie war gefesselt an dieses Haus, an dieses Land, auch wenn sie die Einsamkeit hasste, die Kälte, die Erinnerungen, mit denen sie hier zusammengesperrt war. Es gab keinen anderen Ort, an dem sie hätte leben können.
»Wo könnte ich noch suchen?«, überlegte sie laut. Im Haus wimmelte es von Wandschränken, kleinen Kammern, verwinkelten Ecken. Laura kannte sie alle, hatte in ihnen allen herumgekramt. Nie hatte sie etwas von Bedeutung gefunden. Vermutlich gab es nichts zu finden. Vermutlich machte sie sich nur verrückt.
Sie verließ das Zimmer und stieg die steile Treppe ins Erdgeschoss hinab, ging in die Küche. Hier brannte ein warmes Feuer im Herd, und es roch nach den Weihnachtsplätzchen, die Laura am Vormittag gebacken hatte, um sie ihrer Schwester mitzubringen. Obwohl es seit fast vierzig Jahren einen Elektroherd in der Küche gab, benutzte Laura mit Vorliebe das eiserne Ungetüm aus der Zeit der Jahrhundertwende, auf dem früher für die ganze große Familie gekocht worden war. Sie hielt an alten Dingen verbissen fest, so ängstlich, als könne sie einen Teil von sich verlieren, wenn sie sich von etwas trennte, das einst zu ihrem Leben gehört hatte. Alles Neue empfand sie als feindselig. Sie fand die Entwicklung, welche die Welt nahm, höchst bedrohlich und bemühte sich, jeden Gedanken daran rasch zu verdrängen.
Sie setzte Wasser auf, denn sie hatte das starke Bedürfnis nach einer Tasse heißen Tee. Dann musste sie packen und die Betten für die Gäste beziehen. Morgen im Laufe des Tages würden sie eintreffen. Ein Ehepaar aus Deutschland. Sie hatte noch nie deutsche Gäste hier gehabt. Für sie waren die Deutschen noch immer Feinde aus zwei Weltkriegen, aber andererseits war auch Peter Deutscher gewesen. Doch an ihn mochte sie auch nicht denken, und es wäre ihr wirklich lieber gewesen, Franzosen oder Skandinavier hier aufzunehmen. Aber sie brauchte dringend Geld, und es hatte sich sonst niemand gefunden, der Westhill House über Weihnachten mieten wollte.
Laura inserierte regelmäßig in einem Katalog, der Ferienhäuser anbot. Mit ihrer bescheidenen Rente hätte sie die vielen anfallenden Reparaturen nicht bezahlen können, hätte das alte Haus dem schleichenden Verfall preisgeben müssen. Das Vermieten stellte die einzige Möglichkeit dar, hin und wieder etwas dazuzuverdienen, auch wenn sie es einfach hasste, Fremde hier einzulassen. Jetzt zum Beispiel musste dringend das Dach neu gedeckt werden, spätestens vor dem nächsten Winter. Aber es war schwer, Gäste zu finden. Wer in den Norden reiste, fuhr in den Lake District oder gleich nach Schottland hinauf. Yorkshire, das Land der Berge und Moore, der kalten Winde, der wuchtigen, aus Kalkstein gebauten Häuser, lockte nicht viele Touristen. Wer an Yorkshire dachte, hatte Blei- und Kohleminen vor Augen, rußige Schornsteine, düstere Arbeitersiedlungen in nebligen Tälern.
Wer wusste schon etwas von den lieblichen, heiteren Frühlingstagen, die das Land mit leuchtend gelben Narzissen überschwemmten? Wer kannte die hellen, graublauen Schleier über dem Horizont in heißen Sommerwochen? Wer hatte je den würzigen Duft gerochen, den der Wind im Herbst in die Täler wehte? Wie immer, wenn Laura an all dies dachte, stieg die Liebe zu diesem Land wie ein plötzlicher Schmerz in ihr auf, ließ ihren Atem stocken. Dann wusste sie wieder, dass sie nie fortgehen würde. Dass sie die langen Winter ertragen würde. Die Einsamkeit. Die Erinnerungen. Wen man wirklich liebt, den verlässt man nicht, das war Lauras feste Überzeugung, auch wenn man sich immer wieder über ihn ärgert. Man geht vielleicht mit ihm zusammen eines Tages zugrunde, aber man geht nicht fort.
Der Wasserkessel pfiff. Laura goss das heiße Wasser über die Teeblätter. Allein der würzige Geruch legte sich besänftigend über ihre Nerven; nach dem ersten Schluck, das wusste sie aus Erfahrung, würde sie ein neuer Mensch sein.
»Laura und ihre Tasse Tee«, hatte Frances immer gespottet, »damit kuriert sie Bauchschmerzen, Wadenkrämpfe, Alpträume und Depressionen. Was sie betrifft, so müsste es auf der ganzen Welt keine andere Medizin geben.«
Frances hatte auch gern Tee getrunken, aber nie Probleme mit seiner Hilfe lindern können. Sie hatte sich an härtere Sachen gehalten.
»Ein guter Scotch auf Eis«, hatte sie gesagt, »und die Welt ist in Ordnung!«
Sie hatte jeden Mann unter den Tisch trinken können. Für ihre Leber schien es keine Schmerzgrenze gegeben zu haben.
Laura zog die dicken, geblümten Vorhänge vor das Fenster, sperrte die einfallende Dunkelheit und den heulenden Wind aus. Der Gedanke an Frances hatte sie wieder nervös werden lassen. Jetzt bedrängte sie erneut die Vorstellung, die fremden Gäste könnten zwei Wochen lang Tag für Tag im Haus herumstöbern. Die Menschen waren neugierig. Sie fanden gern Dinge über andere heraus. Laura wusste das, weil sie auch manchmal in fremde Schubladen blickte. Einmal war ein Brief, der an die Leighs drüben vom Herrenhaus gerichtet war, versehentlich bei ihr abgegeben worden. Einen halben Tag lang war sie um ihn herumgeschlichen, dann hatte sie es nicht mehr ausgehalten und ihn über Wasserdampf geöffnet. Zu ihrer bitteren Enttäuschung enthielt er nichts als eine Einladung einer Familie aus Hawes zum Frühlingsfest.
Mit ihrer Teetasse in der Hand ging Laura hinüber ins Esszimmer, überprüfte, ob sich das gute Porzellan und die Weingläser ordentlich aufgeräumt in den Schränken befanden. Die weißen Leinentischdecken lagen glattgebügelt und Kante auf Kante gefaltet im entsprechenden Fach unter der Anrichte. Das silberne Besteck war nach Löffeln, Messern, Gabeln unterschiedlicher Größe in samtausgeschlagene Kästchen geordnet. Laura nickte zufrieden. Die Deutschen sollten nicht die feinen Nasen rümpfen können.
Sie zog auch hier die Vorhänge zu und schickte sich an, das Zimmer zu verlassen. Die ganze Zeit über hatte sie ihren Blick gesenkt gehalten, hatte darauf geachtet, ihn keinen Moment lang umherschweifen zu lassen. Aber im Hinausgehen blieb er dennoch an der Ecke des Kaminsimses hängen, und sie sah den goldenen Rahmen der großen Fotografie, die dort oben stand. Sie konnte nicht umhin, näher zu treten. Das Foto, eine Schwarzweißaufnahme, zeigte Frances Gray im Alter von siebzehn Jahren. Sie trug ein Matrosenkleid, das sehr sittsam wirkte, hatte die schwarzen Haare glatt aus dem Gesicht gestrichen. Sie war ein durch und durch keltischer Typ gewesen, mit ihrer blassen Haut und den leuchtend blauen Augen. Auf dem Bild trug sie das etwas hochmütige Lächeln zur Schau, das stets dazu angetan gewesen war, Menschen einzuschüchtern, und von dem sie sich auch in ihren schwersten Zeiten nicht getrennt hatte, als die Leute sagten, es gebe wahrhaftig nichts mehr, worauf sie sich etwas einbilden könne. In Wahrheit hatte sie nur nie eine Schwäche gezeigt. Ihre Tapferkeit hatten nur wenige ihrer Mitmenschen honoriert. Die meisten hatten gefunden, sie könne ruhig ein wenig bescheidener auftreten und sich schön im Hintergrund halten.
Frances und bescheiden! Beinahe hätte Laura aufgelacht. Sie sah das junge Mädchen auf dem Bild an und sagte laut: »Du hättest es mir sagen müssen! Du hättest mir einfach sagen müssen, wo du es versteckt hast!«
Frances lächelte und blieb stumm.
Das Flugzeug landete gegen siebzehn Uhr in London. Barbara und Ralph hatten geplant, eine Nacht hier im Hotel zu verbringen und am nächsten Morgen mit einem Mietwagen nach Yorkshire aufzubrechen. Barbara hatte überlegt, dass es nett sein könnte, am Abend durch die weihnachtlich geschmückte Stadt zu schlendern und später irgendwo gemütlich zu essen. Aber als sie aus dem Flugzeug stiegen, regnete es in Strömen, und im Laufe des Abends wurde es immer schlimmer. Nicht einmal die Regent Street mit ihren Lichtern und dem großen Tannenbaum lud unter diesen Umständen zum Verweilen ein.
Völlig durchnässt, retteten sich Barbara und Ralph schließlich in ein Taxi, ließen sich nach Covent Garden fahren und ergatterten bei Maxwell’s den letzten freien Tisch. Es war laut und voll, aber wenigstens auch warm und trocken. Ralph strich sich die nassen Haare aus der Stirn und überflog stirnrunzelnd die Speisekarte.
»Such dir etwas richtig Gutes aus«, sagte Barbara, »die nächsten zwei Wochen bist du auf meine Küche angewiesen, und du weißt ja, was das bedeutet.«
Ralph lachte, aber er wirkte nicht fröhlich. »Auch in Yorkshire wird es Restaurants geben«, meinte er.
»So wie ich die Beschreibung des Hauses verstanden habe, befinden wir uns so ziemlich in der Mitte von Nirgendwo«, erklärte Barbara. »Es ist schon ein Dorf in der Nähe, aber …« Sie vollendete den Satz nicht, zuckte nur mit den Schultern.
Einen Moment lang schwiegen sie beide, dann fragte Ralph leise: »Hältst du das alles wirklich für sinnvoll?«
»Du hast immer von England geschwärmt! Du hast immer gesagt, du willst einmal nach Yorkshire! Du hast …«
»Darum geht es doch gar nicht«, unterbrach Ralph, »sondern um uns. Wie die Dinge liegen … müssen wir uns da unbedingt zwei Wochen lang miteinander vergraben? Aufeinanderhocken, konfrontiert mit allem, was …«
»Ja! Die Misere ist doch, dass wir nie Zeit füreinander haben. Dass wir uns außer ›Guten Morgen‹ und ›Guten Abend‹ kaum mehr etwas sagen. Dass wir jeder nur noch für unsere Berufe leben und gar nicht mehr wissen, was im anderen vorgeht!«
»Das wollte ich anders haben, das weißt du.«
»Ja«, sagte Barbara bitter, »das weiß ich. Auf meine Kosten.«
Wieder schwiegen sie beide, dann sagte Ralph: »Wir hätten aber auch daheim miteinander reden können. Jetzt über Weihnachten.«
»Wann denn? Du weißt doch, wie verplant wir schon wieder waren!«
Er wusste es. Heiligabend bei Barbaras Eltern. Erster Feiertag bei seiner Mutter. Zweiter Feiertag bei Barbaras Bruder. Am 27. Dezember dann sein, Ralphs, vierzigster Geburtstag. Wieder Familie. Die Reise übrigens war Barbaras Geschenk zu diesem Geburtstag. Darum hatte er ja auch nicht ablehnen können. Sie hatte alles bereits geplant, organisiert, bezahlt. Mit den diversen Familienangehörigen geredet, deren Ärger besänftigt, die Lage erläutert. Nicht die Wahrheit gesagt, natürlich nicht! »Wisst ihr, Ralph und ich, wir stehen kurz vor einem Desaster, was unsere Ehe betrifft, und deshalb …« Nein, Ralph konnte sich vorstellen, wie sie alles auf seine Wünsche geschoben hatte und auf ihr Verlangen, ihm diese Wünsche zu erfüllen. »Ralph hat von so etwas immer geschwärmt. Ein einsames Cottage in Nordengland. In Yorkshire, im Land der Brontës. Sein vierzigster Geburtstag ist doch ein würdiger Anlass, findet ihr nicht? Ihr müsst das verstehen. Nächstes Jahr feiern wir wieder alle zusammen!«
Wenn es für uns beide ein nächstes Jahr noch gibt, dachte Ralph.
Ihrer beider Rollen hatten sich auf eigenartige Weise vertauscht. Barbara hatte lange Zeit nicht bemerkt, dass etwas schieflief zwischen ihnen, und jeder seiner Versuche, das Problem anzuschneiden und auszusprechen, war von ihr boykottiert worden. Entweder hatte sie keine Zeit, keine Lust, war zu müde oder überzeugt, dass es überhaupt kein Problem gab. Dass sie beide einander praktisch nur noch im Vorbeirennen sahen, schien ihr nicht aufzufallen.
Irgendwann im Laufe des vergangenen Jahres hatte ihr aber offenbar gedämmert, dass es einige erhebliche Schwierigkeiten gab, und nun hatte sie sich entschlossen, diese aus der Welt zu schaffen. Gewohnt, die Dinge anzupacken und Widerstände zu überwinden, hatte sie die Reise in einen abgelegenen Winkel Yorkshires gebucht, wo sie zwei Wochen lang weder von Verwandten und Freunden noch von beruflichen Verpflichtungen gestört werden würden. Irgendwie hatte sie Ralph mit all dem völlig überrollt, was überaus typisch für sie war – und was ihn ärgerte. Es kam ihm vor, als habe sie gewissermaßen einen Startschuss abgegeben. Ziel: die Rettung unserer Ehe. Zeit: zwei Wochen.
Er fühlte sich wie der Kandidat in einer Fernsehshow. »Sie haben genau sechzig Sekunden!« In den letzten Jahren, in denen er nur noch frustriert gewesen war, den Eindruck gehabt hatte, allein gelassen zu werden, war ihm die Puste ausgegangen. Vielleicht war auch einfach der Glaube daran geschwunden, dass sich etwas ändern könnte. Jetzt wollte er nicht mehr reden. Er wollte nicht um etwas bitten, was sie ihm ohnehin nicht gewähren würde.
Barbara hatte sich in die Speisekarte vertieft. Ihr leises Murmeln verriet ihre Konzentration. Barbara tat immer alles mit äußerster Konzentration. Wenn sie arbeitete, hätte eine Bombe neben ihr detonieren können, ohne dass sie auch nur aufgeblickt hätte.
Wenn sie arbeitet, dachte Ralph bitter, könnte ich neben ihr sterben, ohne dass sie es bemerken würde.
Er wusste, dass er seit einiger Zeit zu sehr zum Selbstmitleid neigte, aber er versuchte nicht ernsthaft, etwas dagegen zu unternehmen. Ab und zu tat es ihm gut, seine Psyche zu streicheln und sich zu versichern, dass er es ziemlich schlecht hatte.
Barbara blickte auf. »Hast du schon etwas gefunden?«, fragte sie schließlich.
Ralph zuckte zusammen. »Oh, entschuldige. Ich war gerade völlig abwesend.«
»Hier gibt es eine Vorspeise für zwei Personen. Ich dachte, die könnten wir teilen.«
»In Ordnung.«
»Wirklich? Du musst nicht, wenn du nicht magst. Ich finde auch etwas anderes.«
»Barbara, ich wäre durchaus in der Lage, es zu sagen, wenn ich nicht wollte«, konterte Ralph etwas heftig. »Es ist okay!«
»Deshalb brauchst du mich nicht gleich so anzufahren. Manchmal habe ich das Gefühl, du lässt mir absichtlich meinen Willen, damit du später behaupten kannst, ich hätte dich überfahren!«
»Das ist doch absurd!«
Sie starrten sich an. Es war wie immer: Ihre viel zu häufig unterdrückten Aggressionen entluden sich an einer Lappalie, drohten, eine harmlose Situation im großen Streit eskalieren zu lassen.
»Auf jeden Fall«, sagte Barbara, »werde ich nicht diese Vorspeise für zwei Personen nehmen. Ich suche mir etwas anderes.«
Sie wusste, sie benahm sich kindisch. Sie wollte sich kindisch benehmen.
»Wahrscheinlich hast du recht«, meinte Ralph, »warum sollten wir eine Vorspeise teilen, wenn wir sonst im Leben nichts teilen.«
»Welch eine tiefgründige Bemerkung! Und so geistreich!«
»Wie soll ich denn sonst auf deine eigenartigen Launen reagieren?«
»Du brauchst überhaupt nicht zu reagieren. Hör mir einfach nicht zu!«
»Ich denke, wir müssen für zwei Wochen verreisen, damit ich dir zuhöre«, entgegnete Ralph kühl.
Barbara erwiderte nichts, vertiefte sich erneut in die Karte. Aber diesmal konzentrierte sie sich nicht, nahm wohl kaum etwas von dem wahr, was sie las. Ralph konnte es an ihren zornigen Augen erkennen. Ihm selber war der Appetit vergangen. Als die Bedienung mit gezücktem Bleistift neben ihnen auftauchte und sie erwartungsvoll ansah, seufzte er.
»Wir konnten uns noch nicht entscheiden«, sagte er.
Montag, 23. Dezember 1996
Sie war bereit zum Aufbruch. Zwei Koffer standen fertig gepackt gleich unten neben der Haustür. Daneben noch eine Reisetasche und eine Plastiktüte. In der Tüte befand sich der Proviant für die Reise. Laura hatte in den letzten Jahren lernen müssen, an allem zu sparen, und das Zugrestaurant war auf jeden Fall zu teuer. So hatte sie belegte Brote vorbereitet und zwei große Thermoskannen mit heißem Tee gefüllt. Schließlich hatte sie eine lange Nachtfahrt vor sich. Aber morgen würde sie bei ihrer Schwester in Kent sein, und dann bekäme sie ein richtiges, warmes Essen. Das hieß, falls Marjorie in der Stimmung war zu kochen. Meist hatte sie zu schlechte Laune, um sich auch noch in die Küche zu stellen, und dann konnte man froh sein, wenn man wenigstens eine Konserve aufgewärmt bekam. Marjorie fand immer einen Grund, um sich einer düsteren Stimmung hingeben zu können: das Wetter, die steigenden Lebenshaltungskosten, die Skandale im Königshaus. Sie deprimierte ihre Umgebung durch üble Prophezeiungen, und ständig beteuerte sie, glücklich über ihr fortgeschrittenes Alter zu sein; denn dies würde ihr ersparen, all die Tragödien durchleiden zu müssen, die auf die Erde und die Menschheit warteten. In ihrem Pessimismus, mit dem sie allem, was mit Fortschritt und Entwicklung zu tun hatte, begegnete, ähnelte sie Laura, war aber in ihrem Verhalten nicht von Angst, sondern von Aggression bestimmt. Marjorie bemühte sich nicht im Mindesten um andere Menschen, während Laura von früh bis spät nichts anderes tat.
Wird wieder trist werden bei Marjorie, dachte Laura. Hätte sie das Haus nicht hin und wieder räumen müssen, um es zu vermieten, sie wäre höchstens mal über ein Wochenende zu Marjorie gefahren. Aus Anstand, weil es sich um ihre einzige lebende Angehörige handelte. Vielleicht hätte sie ihr auch nur dann und wann einen Brief geschrieben.
Je näher der Moment der Abreise heranrückte, desto elender fühlte sich Laura. Um fünf Uhr würde Fernand Leigh von Daleview herüberkommen, um sie zum Bahnhof nach Northallerton zu bringen. Eigentlich hatte sie Lilian, seine Frau, darum gebeten; aber am Vorabend hatte er angerufen und gesagt, er werde das übernehmen. Vermutlich konnte Lilian wieder einmal das Haus nicht verlassen.
Bis er kam, würden die Gäste aus Deutschland hoffentlich eingetroffen sein. In ihrem Bestätigungsschreiben auf die Buchung hatte Laura ausdrücklich betont, wie wichtig eine Ankunft bis um spätestens halb fünf sei. Diese Barbara Sowieso (Laura konnte sich den deutschen Nachnamen beim besten Willen nicht merken) hatte zurückgeschrieben, das sei auf jeden Fall machbar.
Es gab nichts mehr zu tun. Laura wanderte durch die Zimmer, einen Becher Tee in der Hand. Draußen schneite es. Sie hatte die Heizung im Keller hochgestellt, und das Haus war mollig warm. Schön würden sie es hier haben, diese Fremden, die sie vertrieben, die …
Hör auf!, befahl sie sich. Sei nicht ungerecht! Niemand vertreibt dich. Niemand wird das je tun können.
Mit den Augen streichelte sie jeden einzelnen Gegenstand und prägte ihn sich ein. Hin und wieder saugte sich ihr Blick an einer Schublade fest oder an einem lockeren Dielenbrett, dann trat sie rasch näher, untersuchte die Stelle, die ihre Aufmerksamkeit erregt hatte, fand nichts und wandte sich wieder ab.
Hör auf zu suchen, ermahnte sie sich streng, du machst dich verrückt, wenn du immer nur daran denkst!
Sie schaute auf die Uhr. Halb drei. Der Dezembertag war nicht richtig hell geworden und würde sich nun schon bald wieder in Dunkelheit auflösen. Wenn sie nur nicht fortmüsste!
Sie trat an eines der Fenster, die nach vorne zum Hof hinausgingen, und spähte den Weg entlang. Noch nichts zu sehen von den Gästen.
Der Regen ging in Schneeregen über, je weiter sie nach Norden kamen. Barbara und Ralph wechselten einander beim Fahren ab. Beide hatten sich rasch an das Linksfahren gewöhnt. Im dichten Verkehrsaufkommen um London herum hatte es noch einige Schwierigkeiten gegeben, aber die A1, The North, die sie nun vom Süden Englands in den Norden hinauffuhren, bereitete ihnen keine Probleme. Allerdings wurde das Schneetreiben dichter und unangenehmer. Die Scheibenwischer jagten hin und her, und Barbara, die gerade am Steuer saß, stellte fest, dass die Sicht immer schlechter wurde.
»Hoffentlich sind wir bald da«, sagte sie.
»Soll ich dich wieder ablösen?«, fragte Ralph. Er hatte die ganze Zeit über schweigend zum Fenster hinausgesehen.
»Ich fahr noch ein Stück. Dann würde ich mich allerdings über Ablösung freuen. Es wird doch recht anstrengend jetzt.« Barbara löste den Blick für einen Moment von der Straße und sah zu Ralph hinüber. Seit dem frühen Morgen schon betrachtete sie ihn immer wieder verstohlen. Wie albern sie sich benahm! Sie kannte diesen Mann seit fünfzehn Jahren, war seit elf Jahren mit ihm verheiratet. Und nun warf sie ihm Blicke zu, wie sie es als Teenager bei gutaussehenden Jungs getan hatte, die für sie allesamt unerreichbar gewesen waren. Aber so wenig ihr Verhalten zu ihrem Alter und dazu noch Ralph gegenüber passend schien, so wenig vermochte sie es zu ändern. Er sah so anders aus an diesem Tag, und das war ein weiteres alarmierendes Anzeichen dafür, dass sie viel zu wenig Zeit miteinander verbrachten, dass sie sich viel zu weit voneinander entfernt hatten. Sie kannte ihn nur noch in Anzug und Krawatte, kannte nur noch den erfolgreichen Anwalt Ende dreißig, der sich auf den Weg in seine Kanzlei machte, mit abwesendem Blick, da er gedanklich stets mit den Prozessakten beschäftigt war, an denen er gerade arbeitete. Es haute sie einfach um, ihn plötzlich in Jeans und Pullover zu erleben, die dunklen Haare nur flüchtig gekämmt, den Blick ebenfalls abwesend, aber vertieft in die vorüberrauschende Landschaft, weich und entspannt.
»Du siehst eigentlich ziemlich jung aus für einen Mann, der in ein paar Tagen vierzig wird«, sagte sie.
Ralph runzelte die Stirn. »Ist das ein Kompliment?«
»Was denn sonst?«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Schau mal, da vorne an der Gaststätte kannst du rausfahren. Lass uns tauschen.«
Sie tat, was er sagte, und fuhr auf den Parkplatz vor einem Happy Eater. Ralph stieg aus und lief um das Auto herum, während Barbara auf seinen Sitz hinüberrutschte. Als Ralph wieder einstieg, waren seine Haare weiß vom Schnee.
»Das geht ganz schön los da draußen«, meinte er. »Wir sollten sehen, dass wir vorankommen. Wenn es heftiger wird, bleiben wir noch irgendwo stecken.«
»Ich dachte immer, in England schneit es kaum!«
»Relativ selten im Süden. Aber in Nordengland und Schottland hat es schon richtige Schneekatastrophen gegeben.« Ralph lenkte den Wagen wieder auf die Straße. »Das wird aber diesmal sicher nicht der Fall sein«, fügte er beruhigend hinzu.
Gegen halb vier erreichten sie Leyburn, wo sie einen Polizisten nach dem Weg nach Leigh’s Dale fragten.
»Immer der A684 nach«, erklärte er, »Wensley, Aysgarth, Worton. Bei Worton biegen Sie ab in Richtung Askrigg. Leigh’s Dale liegt noch ein Stück weiter nördlich, Richtung Whitaside Moor.«
Nachdem sie die Hauptstraße, die Wensleydale durchschnitt, verlassen hatten, befiel sie mehr und mehr das Gefühl, in eine weltabgeschiedene Einsamkeit vorzudringen. Endlos erstreckten sich die hügeligen, von kleinen Mauern durchzogenen Wiesen nach rechts und links, bereits von einer Schneeschicht bedeckt. Wie schwarze Gerippe ragten Bäume in den Himmel. Dann und wann duckte sich das braune Gemäuer eines Hauses in eine Senke, oder ein anderes trotzte auf einem Hügel dem kalten Wind. Am Horizont verschmolzen Erde und Himmel im Schneetreiben zu einem grauen Inferno. Schwarze Vögel schrien über der Weite. Als ein verwittertes Schild mit der Aufschrift »Leigh’s Dale, 1 Mile« auftauchte, stieß Barbara einen Laut der Erleichterung aus. »Endlich! Ich dachte schon, hier kommt nichts mehr!«
Wie sich herausstellte, bestand Leigh’s Dale aus nicht mehr als einem Dutzend Häuser, die sich entlang der schmalen Dorfstraße aufreihten, dazu eine Kirche und ein Friedhof. Niemand hielt sich draußen auf, nur ein paar Autos parkten am Straßenrand. Immerhin brannten hinter einigen Fenstern bunte elektrische Kerzen, und an zwei Türen hingen Weihnachtskränze mit großen roten Schleifen.
»Da vorne scheint ein Laden zu sein«, sagte Ralph, »dort können sie uns bestimmt erklären, wie wir zum Westhill House kommen. Außerdem sollten wir ein paar Vorräte kaufen. Unsere Vermieterin sorgt sicher nicht für ein Abendessen, und ich habe Hunger!«
»Das ist eine gute Idee«, stimmte Barbara zu, »wir kaufen jetzt das Notwendigste, und morgen decken wir uns für Weihnachten richtig ein. Stell dich doch gleich hier hinter diese Nobelkarosse!«
»Das ist ein Bentley«, sagte Ralph ehrfürchtig, »scheint ziemlich reiche Leute in der Gegend zu geben.«
Die wenigen Schritte vom Auto bis zur Ladentür reichten aus, um sie beide wie Schneemänner aussehen zu lassen. Inzwischen zerbarst der anthrazitgraue Himmel in Millionen von dicken Schneeflocken.
Eine ältere Frau, die gleich neben der Tür stand und in das stürmische Wetter hinausblickte, nickte den Eintretenden freundlich zu und sagte: »Da kommt noch eine Menge runter! Ich hab es schon letzte Woche gesagt. Da hat mir keiner geglaubt. Wir kriegen eine Menge Schnee über Weihnachten, habe ich gesagt, aber meine Enkelkinder meinten, das könnte ich doch gar nicht wissen!« Sie schnaubte verächtlich. »Die jungen Leute haben von nichts eine Ahnung! Sie setzen sich vor den Fernseher und hören einem Wetteransager zu, und daran halten sie sich, egal, wie oft die danebentippen. Das Wetter hier oben habe ich im Blut, wissen Sie. Ich sehe es an der Farbe des Himmels. Ich atme den Geruch, der von der Erde aufsteigt. Und ich weiß, was kommt.« Sie nickte stolz. »Meine Mutter war auch so. Sie hat die Schneekatastrophe von 1947 vorausgesagt. Da lag der Schnee mehr als zwei Meter hoch. Manche Häuser sind darunter verschwunden. Und diesmal wird’s nicht viel besser.« Nach dieser pessimistischen Voraussage lächelte sie und fuhr fort: »Was kann ich für Sie tun? Sie sind nicht aus der Gegend, nicht wahr?«
»Nein. Ich bin Barbara Amberg. Mein Mann Ralph. Wir wollen zum Westhill House.«
»Oh – zum Haus der Schwestern! Ich bin Cynthia Moore. Mir gehört der Laden hier.«
»Schwestern?« fragte Barbara. »Ich dachte, Miss Selley lebt allein dort.«
»Ach, das ist nur ein alter Name. Hat sich eingebürgert in der Zeit, als von der ganzen Familie auf Westhill nur noch zwei Schwestern übrig geblieben waren und dort lebten. Beide gibt es nicht mehr, aber irgendwie nennen es immer noch alle das Haus der Schwestern.« Sie lächelte wieder und senkte gleich darauf die Stimme, als stelle sie eine unanständige Frage: »Obwohl Sie sehr gut Englisch sprechen, scheint es mir, als ob …«
»Wir kommen aus Deutschland«, sagte Ralph.
»Aus Deutschland? Und da verirren Sie sich hierher? Herzlich willkommen in Leigh’s Dale! Westhill Farm wird Ihnen gut gefallen, auch wenn von einer Farm kaum mehr die Rede sein kann. Laura konnte das mit den Schafen und Pferden natürlich nicht alleine weiterführen. Sie ist ein bisschen verrückt, aber ein lieber Kerl!«
»Verrückt?« fragte Barbara.
»Na ja. Eine alte Jungfer. Ein bisschen verschroben, manchmal etwas hysterisch. Seit ihrem dreizehnten oder vierzehnten Lebensjahr kennt sie nur Westhill und Leigh’s Dale, wenn man von den gelegentlichen Reisen zu ihrer Schwester nach Kent absieht. Und da sitzen die beiden dann auch nur in der Wohnung, und Marjorie nörgelt vor sich hin. So ist Laura vielleicht ein wenig wunderlich geworden.«
»Es wäre sehr nett, wenn Sie uns den Weg nach Westhill beschreiben könnten«, sagte Ralph, die kurze Atempause nutzend, die Cynthia einlegte. Ihm schien, dass sie drauf und dran war, Lauras gesamte Lebensgeschichte vor ihnen auszubreiten, und daran hatte er nicht das mindeste Interesse. »Außerdem würden wir gern ein paar Lebensmittel einkaufen.«
»Selbstverständlich«, stimmte Cynthia eifrig zu, »suchen Sie nur aus, was Sie brauchen. Später erkläre ich Ihnen den Weg!«
Der Laden erstreckte sich nach hinten hin weiter, als es von außen den Anschein hatte. Lange Regalreihen unterteilten ihn in mehrere Gänge. Als Barbara um die Ecke in den zweiten Gang einbog, wäre sie beinahe mit einem großen Mann zusammengestoßen, der, einen Stapel Konservendosen in den Händen balancierend, wie aus dem Nichts auftauchte. Er trug einen dunkelgrünen Barbour und hohe Stiefel.
Barbara blieb abrupt stehen, sodass Ralph, der direkt hinter ihr kam, gegen sie stieß. Einen Moment lang sahen sich alle drei überrascht an; jeder hatte geglaubt, es sei sonst niemand im Laden.
»Entschuldigung«, sagte der Fremde schließlich.
»Nichts passiert«, erwiderte Barbara.
Er starrte sie an. Er hatte dunkle Augen, einen eindringlichen Blick. Barbara erwiderte diesen Blick, aber ihr war unbehaglich zumute, und sie wusste, sie würde als erste wegschauen, wenn er sich jetzt nicht abwandte.
Zum Glück löste er sich plötzlich von ihr und drehte sich um. »Lil!« Der soeben noch höfliche Tonfall war völlig aus seiner Stimme verschwunden. Sie klang jetzt hart und schroff. »Kommst du endlich?« Dies schien weniger eine Frage als ein Befehl. Gleich darauf tauchte eine junge Frau auf, ein unscheinbares, verhuschtes Wesen, das den beiden Fremden ein zaghaftes Lächeln schenkte, dann jedoch wieder schüchtern zu Boden blickte. Der Mann löste eine Hand von seinem Konservenstapel, der gefährlich ins Wanken geriet, und umschloss mit festem Griff den Arm der Frau. Ihr entfuhr ein unterdrückter Schmerzenslaut.
»Ich habe nicht ewig Zeit. Ich muss nachher Laura Selley noch zum Zug bringen.«
»Wir sind Miss Selleys Feriengäste«, sagte Barbara.
»Oh – wirklich?« Diesmal schenkte er ihr nicht den tiefen Blick von vorhin, diesmal sah er sie nur flüchtig, fast desinteressiert an. »Dann sind wir Nachbarn in der nächsten Zeit. Leigh. Fernand Leigh.«
»Barbara Amberg. Mein Mann.«
Ralph nickte Fernand kühl zu. Der erinnerte sich wieder an die Frau, deren Handgelenk er noch immer so fest umklammert hielt, dass seine Fingerknöchel weiß hervortraten. »Meine Frau Lilian«, stellte er vor.
Lilian hatte die ganze Zeit unverwandt zu Boden gestarrt, nun blickte sie kurz auf. Barbara erstarrte, und sie hörte, wie auch Ralph hinter ihr scharf einatmete. Im trüben Licht der altersschwachen Deckenleuchte sahen sie jetzt beide, was ihnen im Moment der ersten flüchtigen Begrüßung nicht aufgefallen war: Lilians linkes Auge verunzierten die gerade erst langsam abklingenden Reste eines hässlichen, blaugrünen Blutergusses. Ihre Unterlippe war geschwollen, in einem Mundwinkel klebte ein wenig verkrustetes Blut.
»Hat mich gefreut«, sagte Fernand Leigh. »Man sieht sich vielleicht noch!« Er nickte ihnen zu, dann strebte er, Lilian hinter sich herziehend, zur Kasse.
Barbara und Ralph sahen einander an. »Er würde vermutlich erklären, dass seine Frau die Treppe hinuntergefallen ist«, sagte Ralph, »ich glaube aber eher …«
Er ließ den Satz unvollendet, aber Barbara wusste, was er meinte, und nickte.
»Ich habe viel zu viele solche Gesichter gesehen«, sagte sie, »und ich meine damit nicht nur die Blutspuren und die blauen Flecken. Es ist der Ausdruck in den Augen. Die Art, wie sie lächeln. Wie sie den Kopf senken. Wie sie dich ansehen, als müssten sie um Entschuldigung bitten, dass es sie überhaupt gibt. Diese Frau ist ein Wrack, Ralph. Und vermutlich war sie es nicht, bevor sie ihn kennenlernte.«
Ralph spähte aus dem Fenster. »Ihm gehört der Bentley. Sie steigen gerade ein.«
Unbemerkt war Cynthia herangekommen. »Ihm gehört praktisch alles Land in der Gegend«, sagte sie, »einschließlich sämtlicher Häuser dieses Ortes. Die Leighs waren richtige Feudalherren in früherer Zeit. Der einzig autonome Besitz war die Westhill Farm, die den Grays gehörte. Das hat sie ziemlich gekratzt. Inzwischen hat Fernand eine Menge Westhill-Land gekauft. Viele rätseln allerdings, wovon. Man sagt, er trinke zu viel und mache Schulden. Aber dann musste es plötzlich dieses Auto sein! Irgendwo muss er noch Reserven besitzen.«
»Was ist mit seiner Frau los?« fragte Barbara. »Sie sah ja schrecklich aus!«
Cynthia seufzte. »Ein großes Problem. Wissen Sie, im Grunde ist Fernand Leigh kein schlechter Kerl. Ich weiß nicht, was sich zwischen ihm und Lil abspielt, aber offenbar verliert er regelmäßig die Beherrschung. Sie ist oft noch schlimmer zugerichtet als heute.«
»Und niemand unternimmt etwas?«, fragte Ralph ungläubig. »Der Kerl wäre doch leicht wegen Körperverletzung dranzukriegen!«
»Da müsste Lil mitmachen. Sonst reitet man sie mit all dem ja nur noch tiefer in den Schlamassel«, meinte Cynthia. »Bisher deckt sie ihn beharrlich. Sie ist höchst erfinderisch, wenn es darum geht, Erklärungen für ihre zahlreichen Verletzungen zu finden.«
»So ist das häufig«, sagte Barbara. »Männern wie diesem Leigh ist nicht beizukommen, solange ihre Frauen Angst haben, gegen sie auszusagen.«
»Er ist wirklich kein schlechter Mensch«, beharrte Cynthia. »Er hatte es nicht leicht als Kind. Sein Vater trank auch, und seine Mutter – eine französische Emigrantin, daher auch sein französischer Vorname – wurde mit den Jahren immer schwermütiger, weil sie nie ihr Heimweh loswurde. Fernand wurde zerrieben zwischen den beiden.«
»Offen gestanden, dies ist eine Erklärung für gewalttätiges Verhalten, die mich schon seit Jahren nicht mehr sonderlich beeindruckt«, sagte Ralph. »Der Mensch ist mit einem freien Willen geboren. Ganz gleich, was zuvor in seinem Leben geschehen ist, von irgendeinem Punkt an trägt er die Verantwortung für das, was er mit dem Rest macht.«
Cynthia nickte. »Im Grunde gebe ich Ihnen recht, aber … Nun, also«, sie war bemüht, das Thema zu wechseln, »haben Sie, was Sie brauchen?«
»Vorläufig ja«, meinte Barbara, »wir kommen auf jeden Fall morgen noch einmal vorbei und kaufen für die Feiertage richtig ein.«
Cynthia warf einen zweifelnden Blick hinaus, wo der Sturm heulend die Schneeflocken durcheinanderblies. »Hoffentlich kommen Sie morgen noch bis hierher durch. Wenn es schlimm wird, helfen zwar die von der Catterick Garrison und machen die Hauptstraßen mit ihren Panzern frei, aber um die Nebenstrecken kümmert sich niemand. Und Westhill liegt ein gutes Stück abseits!«
»Ach, es wird schon nicht so schlimm werden!«, sagte Barbara leichthin. »Wir haben auch Schneeketten im Auto. Wir schaffen das schon. Wären Sie jetzt so nett, uns den Weg zu beschreiben …?«
Als der dumpfe Klang des Türklopfers aus Messing durch das Haus dröhnte, zuckte Laura zusammen, obwohl sie jeden Moment mit der Ankunft der Gäste gerechnet hatte. Etwas von dem heißen Tee in ihrer Tasse schwappte auf ihre Hand, und sie stieß einen leisen Schrei aus. Was war nur los mit ihren Nerven? Sie schienen völlig zerrüttet, nur weil ihr die bevorstehende Reise im Magen lag, die Konfrontation mit der Welt, die jenseits der schützenden Mauern von Westhill lauerte. Sie stellte die Tasse ab, lief in den Flur, zupfte im Vorbeieilen vor einem Spiegel ihre Haare zurecht, reckte die Schultern und öffnete.
Der Sturm riss ihr beinahe die Tür aus der Hand, und ein Schwall von Schneeflocken wirbelte ihr ins Gesicht. Es war schon fast dunkel, Laura konnte von den beiden Gestalten, die vor ihr standen, kaum mehr als die Umrisse sehen.
»Guten Tag, ich bin Laura Selley«, sagte sie. Sie musste laut sprechen, um den Wind zu übertönen. »Kommen Sie herein!«
Barbara verstand, weshalb Cynthia diese Laura »wunderlich« genannt hatte. Die ältere Dame war zweifellos nett, aber recht zerstreut und nervös. Sie hatte die beiden Ankömmlinge zuerst in die Küche geführt und ihnen Tee angeboten, und kaum saßen sie mit ihren Tassen da, fiel ihr ein, sie müsste ihnen unbedingt als Erstes das ganze Haus zeigen, da sie jeden Moment abgeholt würde. Sie stellten also ihre Tassen wieder ab und folgten Laura durch das Haus. Im Erdgeschoss befanden sich außer der geräumigen Küche noch das Wohnzimmer und das Esszimmer. Dort blieb Barbaras Blick sofort an der Fotografie auf dem Kamin hängen. »Wer ist das?«
»Frances Gray. Den Grays hat das hier ja alles gehört.«
»Und Sie haben es von ihnen gekauft?«, fragte Ralph, während er überlegte, woher diese einfach wirkende Frau so viel Geld haben sollte.
»Ich habe es geerbt«, antwortete Laura stolz. »Von Frances. Sie war die Letzte der Familie. Es gibt keine Nachkommen.«
»Ist es hier nicht oft recht einsam?«, fragte Barbara. Sie fand die Vorstellung, hier jahraus, jahrein alleine leben zu müssen, recht beklemmend.
Laura schüttelte den Kopf. »Für mich nicht. Ich lebe seit über fünfzig Jahren hier, wissen Sie.« Sie schien das für eine ausreichend plausible Erklärung zu halten.
Über eine weißgestrichene Holztreppe gelangten sie in den ersten Stock. Hier gab es zwei große und drei kleine Schlafzimmer sowie ein altmodisches Bad, in dem die Wanne auf vier verschnörkelten Füßen stand.
»Ich habe Ihnen hier in einem der großen Schlafzimmer das Bett bezogen«, erklärte Laura, »ich dachte, dort haben Sie am meisten Platz.«
Barbara und Ralph warfen einander einen kurzen Blick zu und beschlossen in stillschweigender Übereinkunft, keinesfalls vor Laura zu erwähnen, dass sie seit einigen Jahren nur noch in getrennten Zimmern schliefen.
Laura hatte das flüchtige Unbehagen der beiden jedoch gespürt und mit feiner Intuition richtig gedeutet. Verlegen fügte sie hinzu: »Selbstverständlich steht Ihnen auch jedes der drei kleinen Schlafzimmer zur Verfügung. Nur mein eigenes Zimmer sollte …«
»Natürlich«, sagte Ralph rasch.
Als sie die Treppe hinunterstiegen, fragte Barbara neugierig: »Sie waren eine Freundin von Frances Gray?«
Ralph schüttelte kaum merklich den Kopf; er kannte Barbaras Angewohnheit, fremde Leute recht unverblümt auszufragen, und hatte dafür keinerlei Verständnis. Laura gab jedoch bereitwillig Auskunft.
»Man kann das schon so sagen, ja. Eigentlich war ich die Haushälterin. Aber ich kam schon als Kind hierher, und es war einfach meine Heimat. Frances und ich hatten nur einander.«
»Sie beide lebten ganz allein hier?«
Ein Schatten flog über Lauras Gesicht. »Nachdem Adeline tot und Victoria Leigh fortgegangen war … ja!«
»Victoria Leigh?«
»Frances’ Schwester.«
»Hatte sie etwas mit den Leighs zu tun von … wie heißt es? … Daleview?«
»Barbara!«, mahnte Ralph leise.
»Sie war mit dem Vater von Fernand Leigh verheiratet. Die Ehe wurde aber geschieden.«
»Hat er sie misshandelt?«
»Barbara!«, sagte Ralph nun bereits schärfer. Barbara wusste, was er dachte: Du benimmst dich völlig unmöglich!
Laura schien etwas überrascht. »Nein. Wieso?«
»Wir haben Fernand Leigh und seine Frau in Leigh’s Dale getroffen«, erklärte Barbara, »und Mrs. Leigh war ziemlich übel zugerichtet.«
»Nun«, Lauras Gesicht nahm einen nachdenklichen und etwas wehmütigen Ausdruck an, »es gehören immer zwei zu so etwas, nicht? Ich frage mich manchmal, wird man zum Opfer durch das Schicksal, oder macht man sich selber dazu?«
Während Barbara recht überrascht diese Antwort zu verdauen suchte – sie hatte nicht erwartet, dass Laura die Angelegenheit unter derart komplizierten psychologischen Aspekten zu durchleuchten sich bemühen würde –, ging Ralph hinaus, um das Gepäck aus dem Wagen zu holen. In der Tür stieß er beinahe mit Fernand Leigh zusammen, der als großer, dunkler Schatten aus dem Schneetreiben auftauchte. Die beiden Männer grüßten einander frostig. Fernand trat einen Schritt zurück, um Ralph hinauszulassen, dann kam er in einer Wolke von Schnee und Kälte herein. Er schien sofort den ganzen Flur auszufüllen. Obwohl er nur knapp größer war als Ralph, war sein Wesen und Auftreten von einer Dominanz, die alles um ihn herum scheinbar kleiner werden ließ.
»Miss Selley«, sagte er, »wir müssen los. Das Wetter wird jede Minute schlimmer. Sie erwischen vermutlich den letzten Zug, der in den nächsten Tagen überhaupt wird losfahren können.«
»Liebe Güte, ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm werden würde«, murmelte Laura und fing an, auf der Suche nach Handschuhen, Schal und Mütze hektisch hin und her zu eilen.
»Wir werden doch nicht völlig einschneien?«, fragte Barbara.
Fernand wandte sich ihr zu. Im Dämmerlicht des schmalen Flurs spürte sie seinen Blick mehr, als dass sie ihn sah. »Darauf würde ich mich nicht verlassen«, antwortete er, »kann sein, Sie sitzen hier ab morgen schon völlig fest.«
»Das wäre ziemlich unangenehm!«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich glaube nicht, dass sich das Wetter danach richten wird, was Ihnen angenehm ist und was nicht.«
»Das hatte ich auch nicht angenommen«, erwiderte Barbara steif.
Er lachte und meinte unerwartet friedfertig: »Natürlich nicht. Entschuldigen Sie die dumme Bemerkung.«
Und schon hatte er sich wieder abgewandt und griff nach Lauras beiden Koffern und der Reisetasche, die neben der Tür warteten. »Fertig, Miss Selley?«
»Fertig«, sagte Laura. Sie stülpte sich eine Mütze – ganz offensichtlich selbst gestrickt und etwas zu klein – auf den Kopf, nahm die Plastiktüte mit den Vorräten und ihre Handtasche, die wie eine braune, runde Praline aussah. Sie atmete tief durch. Im letzten Moment erst dachte sie daran, sich von Barbara zu verabschieden. Dann verließ sie ihr Haus mit dem Gesichtsausdruck eines ängstlichen Soldaten, der in eine gefährliche Schlacht ziehen muss und kaum Hoffnung hat, siegreich aus ihr hervorzugehen.
Der junge Mann, der Laura auf dem anderen Fensterplatz gegenübersaß, schnarchte leise. Sein Kopf lehnte seitlich an der Kopfstütze, sein Mund stand ein wenig offen. Er sah wie ein Baby aus, weich und rosig. Er schien einen friedlichen Traum zu träumen, denn seine Gesichtszüge wirkten entspannt und ruhig.
Auch die Studentin an der Abteiltür war eingeschlafen. Genau genommen vermutete Laura nur, dass es sich bei der jungen Frau um eine Studentin handelte. Sie sah einfach danach aus: Jeans und Sweatshirt, intelligentes Gesicht, Nickelbrille, kurzgeschnittenes, etwas verstrubbeltes Haar. Bevor sie einschlief, hatte sie die ganze Zeit über in einem Buch gelesen, das sich, soweit Laura das feststellen konnte, mit Mathematik beschäftigte.
Der Zug donnerte durch die Nacht, und sie fand keinen Schlaf. Im Abteil brannte jetzt nur noch ein schwaches Licht; sie konnte die Schneeflocken jenseits der Fensterscheibe erkennen. Fernand hatte sie mit seinem Jeep zum Bahnhof gebracht; mit keinem anderen Auto wäre er mehr durchgekommen. In York hatte sie umsteigen und dabei lange warten müssen, weil sämtliche Fahrzeiten bereits durcheinandergerieten. Von allen Seiten hatte sie Alarmierendes über das Wetter aufgeschnappt. Man schien damit zu rechnen, dass eine echte Schneekatastrophe über den Norden Englands und über Schottland hereinbrach.
Die beiden werden einschneien, und sie werden jede Menge Zeit haben, im Haus herumzuschnüffeln, dachte Laura düster. Sie wünschte, sie wäre nie abgereist; sie wünschte, sie könnte an der nächsten Station aussteigen und mit dem Gegenzug umgehend zurückfahren. Aber abgesehen davon, dass sie mit ihrem Wiederauftauchen daheim gegen jede Vereinbarung verstoßen und einigen Ärger verursachen würde, schien es auch äußerst fraglich, ob es ihr überhaupt gelingen könnte, Westhill zu erreichen.
»Von jetzt an geht nichts mehr«, hatte Fernand am Bahnhof von Northallerton gesagt und, mit einem Blick hinaus in das Chaos, hinzugefügt: »Drücken Sie mir die Daumen, dass ich noch bis nach Hause komme!«
Sie dachte über Barbara nach. Die fremde Frau war ihr suspekt. Keineswegs unsympathisch, aber nicht ungefährlich. Zielgerichtet und sehr direkt in ihrer Art, Fragen zu stellen. Eigenartigerweise hatte Laura sie durchaus nicht als neugierig empfunden; Neugierde hatte für sie einen unangenehmen Beigeschmack, und unangenehm war nichts an Barbara gewesen. Neugierde wurde begleitet von einem lüsternen Verlangen nach Sensation, und davon war nichts spürbar gewesen bei Barbara. Sie wirkte wie ein Mensch, der besessen ist von einem echten, brennenden Interesse an allem, was um ihn herum geschieht, an jedem, der seinen Weg kreuzt. Von einem Interesse, das auch die Hintergründe, die Vorgeschichte einer Begebenheit kennen will, auch auf die Gefahr hin, dass die Sensation damit erklärbar wird und an Dramatik verliert. Barbara spähte nicht durchs Schlüsselloch, sie marschierte direkt ins Zimmer und fragte, was sie zu wissen begehrte.
Wie Frances, dachte Laura, und im nächsten Moment begriff sie, dass es genau das war, was ihr Barbara sympathisch machte und zugleich Angst und Misstrauen auslöste:
Barbara war wie Frances Gray.
Dienstag, 24. Dezember 1996
Barbara wusste nicht, was sie geweckt hatte, der heulende Sturm oder das Entsetzen über sich selbst, das bis in die Tiefen ihres Traumes vorgedrungen sein musste, denn ihr Gesicht glühte vor Scham, als sie sich nun im Bett aufsetzte. Draußen tobte das Unwetter. Der Sturm schien die ganze Welt aus den Angeln heben zu wollen, jagte um das Haus wie ein wütender Feind, rüttelte an den Fensterscheiben, erfüllte die hohen, alten Kamine mit schaurigen Geräuschen. Was sich da draußen abspielte, hatte etwas von einem Inferno, aber in diesem Moment erschien es Barbara nicht halb so bedrohlich wie das, was in ihrem Inneren vor sich ging. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt einen erotischen Traum gehabt hatte.
»Das ist ja absolut lächerlich«, sagte sie laut in die Dunkelheit hinein, dann warf sie sich auf den Bauch, presste ihr Gesicht tief in die Kissen und wartete ab, dass sich das sanfte, auf eigentümliche Weise fast schmerzhafte Pochen in ihrem Körper beruhigte.
Sie hatte sich von Fernand Leigh auf dem Rücksitz eines Autos gerade die Strumpfhosen abstreifen lassen, als sie glücklicherweise erwacht war, und sie erinnerte sich, dass sie vor Begierde halb wahnsinnig gewesen war. Falls sie im Schlaf gestöhnt oder womöglich sogar obszöne Worte gesagt hatte, würde das Gott sei Dank ihr Geheimnis bleiben, denn sie befand sich allein im Zimmer. Ralph hatte ihr den großen Raum, den Laura ursprünglich für sie beide hergerichtet hatte, überlassen und war mit seiner Decke und seinem Kissen in eines der kleinen Zimmer umgezogen. Sie hatten nicht viele Worte darüber verloren.
»Es ist dir vermutlich lieber so«, hatte er nur gesagt, und sie hatte erwidert: »Es ist einfach so, wie wir es gewöhnt sind.«