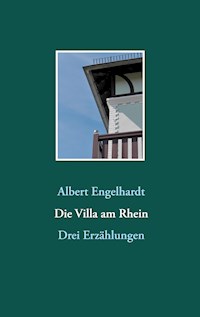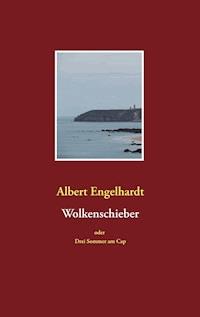Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
2015 taucht ein unveröffentlichter Roman auf. Dieser beschreibt die Vorgeschichte eines 25 Jahre zurückliegenden Unglücksfalls im Frankfurter Stadtteil Bockenheim. Drei damals des Mordes verdächtigte Männer werden von ihrer Vergangenheit eingeholt. Vieles bleibt rätselhaft. Und es stellt sich mehr und mehr die Frage: Was war Realität, was ist Fiktion? Neben dem Verbrechen und vielen Beteiligten verbindet ein Thema die Jahre 1990 und 2015: Das Land, seine Menschen und Kulturen verändern sich. Schicksale und Ängste, Solidarität und Moral fordern uns heraus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Teil I: 1990
Montag Pazartesi Poniedziatek
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Dienstag Sali Wtorek
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Mittwoch Carsamba Sroda
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Donnerstag Persembe Czwartek
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Freitag Cuma Piatek
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Samstag Cumartest Sobota
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Sonntag Pazar Niedziela
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Einige Tage Danach Birkac Gün Sonra Kilka Dni Pózniej
22. Kapitel
Teil II: 1991 bis 2014
Sevgi Keser & Alexandra Tuborg
Helmut Lotz
Waltraud Böckelmann
Oliver Dörnberg
Staatsanwaltschaft II Frankfurt am Main
Rundschau am Abend
Maik Nowak
Freddie Pawlak
Charlotte Burgmann-Kneuch
Anonym
Helmut Lotz
Jürgen Macher
FI Bockenheim
Herbert Böckelmann
Anne Lotz
Oliver Dörnberg
Dimitri Kauffmann
Jenny Udvardy
FFI Bockenheim
Sevgi Keser
Charlotte Burgmann & Jürgen Macher
Tina Nowak
Sophia Kraatz
Birgit Calidis
Charlotte Burgmann, Oliver Dörnberg und Mike Wormser
Tina Nowak
Ela Wybora
Sevgi Keser
Karl Weber
Bisrat Ghebrehariat
Teil III: 2015
Januar
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Februar: Luty
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
März: Marzec, Mars
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
April: Kwiecien, Prill, Miyazya
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Mai: Maj, Maj, Gun‘bet, Maj
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Juni: Czerwiec, Qershor, Sene, Jun, Haziran
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Juli: Lipiec, Korrik, Hamle, Juli, Temmuz, July
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
August: Sierpien, Gusht, Nehase, Avgust, Agustos, August, Agosto
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
September: Wrzesien, Shtator, Meskerem, September, Eylül, September, Setembro, Qaus
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Oktober: Pazdziernik, Tetor, T’q’m’ti, Oktobar, Ekim, October, Outubro, Dschadi, Octobre
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
November: Listopad, Nentor, H’dar, Novembar, Kasim, November, Novembro, Dalw, Novembre, Nojabr
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Dezember: Grudzien, Dhjetor, Tahsas, Decembar, Aralik, December, Dezembro, Hut, Decembre, Dekabr, Decembro
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Epilog
Teil I
1990
MONTAG PAZARTESI PONIEDZIATEK
1.
Der groß gewachsene, nicht direkt übergewichtig, eher nur ungelenk und weich wirkende Mann rückte noch mehr in die Ecke. Die Beine übereinandergeschlagen, den rechten Fuß um die linke Wade geschlungen, darauf achtend, daß er seine Hose nicht beschmutzte, verkroch er sich hinter seiner Zeitung. Er starrte auf die Sportseite, obwohl er die Reportage über den elendigen Tod eines ehemaligen Boxchampions schon einmal gelesen hatte. Auch die Bundesliga-Berichte und das Interview mit dem neuen Stürmerstar der Eintracht. Die Überschriften, Sätze und Buchstaben verschwammen und lösten sich in einzelne Punkte auf. Als ihm schwarz vor Augen wurde, schlug er die FR wieder zu und packte sie, ordentlich zusammengefaltet, in den auf seinen Knien liegenden Aktenkoffer, zu seinem Schreibmäppchen, dem Päckchen Tempo und der Tüte Malzbonbons.
Auch ein Blick aus dem Fenster verschaffte ihm keine Ablenkung. Worte drangen an sein Ohr, ohne daß er sich dagegen hätte wehren können. Er wollte nicht mehr zuhören. Sein Herzflimmern machte sich schon wieder bemerkbar, und seine Hände wurden feucht. In seiner Kindheit hatte Herbert Böckelmann sehr oft den Wunsch verspürt, sich einfach in Luft auflösen zu können. Die Vorstellung, dann von irgendwoher das Erstaunen der Zurückgelassenen zu beobachten, hatte ihm immer ein wohliges Gefühl gegeben. Jetzt war er sich nicht einmal sicher, ob sein Verschwinden überhaupt bemerkt werden würde. Zum Glück mußte die S-Bahn gleich am Westbahnhof ankommen.
Er kannte mittlerweile den Pool der Ferienanlage und die kleinen Buchten so gut, als habe er selbst dort drei Wochen in der Sonne gelegen. Er hatte die unfreundliche Deutsche an der Rezeption, die einheimische Putzfrau, der das restliche Kleingeld zurückgelassen worden war, den an den ersten beiden Tagen verstopften Abfluß des Duschbeckens und den gemieteten Jeep deutlich vor Augen, ohne sie je selbst gesehen zu haben.
Das mußte man Tina lassen, erzählen konnte sie, als sähe man einen Film über die Arida-Beach-Ferienanlage. Das halbe Abteil schien zuzuhören, als jetzt vom Frühstücksbuffet, vom Empfangscocktail und verlorengegangenen Koffern die Rede war. Tina erzählte hemmungslos laut und ohne Atempause. Die Bemerkungen der ihr gegenübersitzenden Anne Lotz, Teilzeitkraft aus dem Versand, hatten eh mehr kommentierenden als nachfragenden Charakter.
Am Morgen war ihm Tina sofort aufgefallen, und er hätte sie doch beinahe nicht erkannt. Braungebrannt, in violetten Pumphosen, Sandalen und einer ärmellosen Bluse. Ihr schulterlanges glattes Haar war von der Sonne ausgebleicht, beinahe blond. Sie stand schon auf dem Bahnsteig, als er die Rolltreppe hochkam. Niemand sonst war noch so sommerlich gekleidet. Strickjacken, Blousons oder dünne Mäntel verrieten, daß die letzten Augusttage morgens schon frisch gewesen waren. Ab und zu hatte es auch genieselt. Nicht nur Herbert Böckelmann hatte seinen Regenschirm dabei. Der Sommer schien sich verabschiedet zu haben.
Er hatte genau gewußt, daß heute ihr erster Arbeitstag sein würde. Aber als sie ihn, kaum daß er den Bahnsteig betreten hatte, mit einem freudigen „Hallo“ begrüßte, auf ihn zuging und sich bei ihm, wenn auch nur für Sekunden, unterhakte, war er doch überrascht gewesen.
„Guten Morgen, Tina“.
Er hatte diese drei Worte kaum über die Lippen gebracht. Für einen Außenstehenden mußte sich die Begrüßung eher einstudiert als beiläufig dahingesagt anhören.
„Ich bin in Gedanken noch nicht wieder richtig da. Wie geht’s, wie steht’s? Ich bin immer noch kaputt, habe seit gestern nachmittag fast durchgeschlafen. Ein Scheißwetter habt ihr hier. Was macht die Firma? Und wie geht’s dir? Du sagst ja gar nichts. Vorsicht, die Bahn kommt!“
Sie hatten sich wie immer in den vorletzten Wagen gesetzt, der in Eschersheim direkt vor der Treppe zum Halten kam. Dort war ihm ein zweiter Satz gelungen.
„Da wird die Lotz aber heute Mittag staunen.“
Anne Lotz hatte natürlich nicht gestaunt, sondern die junge Angestellte gleich belehrt, man könne doch wohl überall nachlesen, wie schädlich zu viel Sonne sei, und außerdem, sie, als Frau und dann noch alleine, würde niemals dorthin fahren. Da ihre junge Kollegin nicht darauf eingegangen war, hatte sie in einem auffällig beiläufig gehaltenen Ton noch hinzugefügt, daß Wolfgang Becker, der Personalleiter und unmittelbare Vorgesetzte von Tina Berger, tagelang über irgendwelche verschwundenen Unterlagen geklagt habe. Mehr wisse sie nicht. Sie berichte nur, was man in der Kantine habe läuten hören.
Tina hatte davon selbst nichts gehört. Becker war heute außer Haus. Und außerdem würde sie ihm schon Bescheid stoßen. Er könne doch mal in seiner speziellen Ablage zwischen den Autozeitungen, Sportillustrierten und Playboy-Heften nachsehen. Sie habe nichts verschlampt. Aber wahrscheinlich hatte die Lotz sowieso gewaltig übertrieben.
Herbert Böckelmann hatte schweigend dabeigesessen, als sich Tina und die Dicke beim Mittagessen unterhielten. Er stocherte in seinem Hühnerfrikassee herum, ließ es dann doch stehen und beschränkte sich darauf, die Salatbeilage zu essen.
Die Bahn mußte, wie fast jeden Tag, kurz vor der Einfahrt in den Westbahnhof an einem Signal anhalten. Die Kleingartenanlage war schon nicht mehr zu sehen. Stattdessen blickte man auf die alte Ladestraße. Zwei große Güterhallen, die heute von einer Spedition und als Lager eines italienischen Lebensmittelgroßhändlers genutzt wurden, der vergessene und mittlerweile total verrostete Unterbau eines Krans, ein früherer Betriebshof der Stadtwerke, der jetzt einem Taxibetrieb als Garage und einer alternativen Schreinerei als Werkstatt diente, waren Überreste aus einer längst vergangenen Zeit, als am Westbahnhof noch umfangreicher Güter- und Reiseverkehr abgewickelt worden war.
Herbert Böckelmann drückte, wie ein staunendes Kind, sein Gesicht so nahe an die Fensterscheibe, als wolle er ganz genau jede Bewegung des Baggers beobachten, der gerade die letzten Mauerreste einer ehemaligen Brennstoff-Handlung beseitigte. Der Boden war schwarz und aufgeweicht, auf den Pfützen war ein Ölfilm zu sehen. Es wurde Zeit, daß dieser Schandfleck verschwand.
Wieder ließ man ihn nicht mit seinen Gedanken allein. Anne Lotz stieß ihn mit ihrem dicken Hinterteil leicht an, und als er sie verwundert anblickte, blinzelte sie ihm zu.
„Haben Sie das gehört, Herr Böckelmann? Die Tina hat sich vom Nachtportier persönlich abtrocknen lassen.“
„Er hatte uns beim Nacktbaden erwischt, erst mit der Polizei gedroht und dann doch frische Handtücher gebracht“, entgegnete Tina lachend.
Anne Lotz ignorierte die Richtigstellung, die in ihren Augen eigentlich keine war, und scherte sich auch nicht um das Gekicher zweier im Gang stehender Mädchen.
„Da wären Sie doch auch mal gerne Nachtportier gewesen. Nicht wahr, Herr Böckelmann? Schließlich ist unsere Tina nicht zu verachten.“
Herbert Böckelmann schwitzte und wußte, daß sich seine Wangen und sein Hals röteten.
„Vergessen Sie Ihren Schirm nicht, Frau Lotz.“
Tinas katzenartige Augen, die ihm so viel versprochen hatten, verrieten nicht, ob sie das Thema zufällig oder wegen ihm gewechselt hatte. Bemerkte sie, wie peinlich ihm das Ganze war?
„Keine Angst, junge Frau“, gab Anne Lotz zurück und griff demonstrativ nach ihrem Schirm. „Das solltest du besser Herrn Böckelmann sagen. Der macht heute einen noch verträumteren Eindruck als sonst. Auf geht’s.“
Die S-Bahn war endlich angekommen. Tinas Sitznachbar, ein Mann im Rentenalter, der die ganze Zeit aufmerksam zugehört hatte, wunderte sich noch lautstark, daß man da unten überhaupt Urlaub machen könne. Ihn brächten keine zehn Gäule in die Türkei. Seine Bemerkung ging im Trubel der Aussteigenden unter.
Im Gedränge sah Herbert Böckelmann noch, wie Tina ihm zuwinkte. Er hatte sich schon damit abgefunden, daß sie wie immer im Windschatten ihrer Kollegin in Richtung Sedanplatz verschwinden würde. Anne Lotz hatte aufgrund ihrer Körperfülle keine Schwierigkeiten, sich am Ausgang Platz zu verschaffen. Er atmete tief durch, vergewisserte sich, daß er seinen Schirm nicht in der Bahn stehengelassen hatte, und wollte sich auf den Heimweg machen.
Um so mehr erschrak Herbert Böckelmann, als Tina plötzlich wieder neben ihm auftauchte und ihn, wie am Morgen, kurz unterhakte.
„Ich muß mir noch eine Monatskarte kaufen. Bin heute schon zweimal schwarzgefahren“, sagte sie. „Wartest du einen Moment?“
Er nickte wortlos. Tina war schon durch die Glastür zu den Verkaufsschaltern gegangen.
Als sie dann wenige Minuten später auf den Sedanplatz zugingen, fummelte sie immer noch an ihrer Karte und der dazugehörenden Plastikhülle herum, packte schließlich beide getrennt in ihr Portemonnaie und nahm ihren Begleiter wieder kurz beim Arm.
„Setzen wir uns noch für ein paar Minuten auf eine Bank? Die Sonne scheint so schön.“
Tatsächlich war es an diesem dritten Septembertag wieder wärmer geworden. Sogar jetzt, am späten Nachmittag, lag der Sedanplatz noch in der Sonne. Sie waren nicht die Einzigen, die dies ausnutzen wollten. Doch ihnen blieb nur eine leere Bank im Schatten eines der großen Kastanienbäume.
Herbert Böckelmann hatte sich schon oft gefragt, ob all die vielen Männer jeden Alters, die hier tagtäglich um diese Zeit saßen, arbeitslos waren oder einen gelben Urlaubsschein in der Tasche hatten. Er hatte sich an einem Werktag noch nie auf eine der Bänke gesetzt. Zu dieser Stunde mußten normale Leute arbeiten, waren auf dem Heimweg oder unterwegs zu eiligen Einkäufen auf der nahen Leipziger Straße.
Aber vermutlich waren es nicht immer dieselben Männer. Er konnte sie nicht genau unterscheiden. Es waren fast ausschließlich Ausländer, das sah man. Wahrscheinlich Türken, Spanier oder Griechen. Zwei, drei Schwarze waren neuerdings auch dabei. Die wenigen Frauen waren durchweg schon älter, sicherlich Großmütter der im Sandkasten oder auf der Rutschbahn spielenden dunkelhaarigen kleinen Kinder. Sie strickten oder häkelten und unterhielten sich mit einer Banknachbarin.
Die wenigen Deutschen konnte man an einer Hand abzählen, und sie fielen auf. Da war die in ganz Bockenheim bekannte, ihre vollgepackten ALDI-Tüten immer in einem quietschenden Kindersportwagen transportierende Alte. In der einen Hand hielt sie eine mit Elfenbein besetzte Zigarettenspitze, an der sie paffend zog. Mit der anderen Hand fütterte sie Tauben, die sich auf die ausgestreuten Brotkrümel stürzten. Ein Mann schlief, einen zusammengerollten Mantel unter dem Kopf, seinen Rausch aus. Seine drei leeren Bierflaschen, die neben der noch halbvollen Flasche Fusel gestanden hatten, waren schon längst von einem Jungen stibitzt und am Wasserhäuschen gegen Pfandgeld eingetauscht worden. Zwei junge Frauen, jede ein aufgeschlagenes Buch auf dem Schoß, redeten ständig auf ihre kleinen Mädchen ein, die sich einen Spaß daraus machten, träge umher stolzierende Tauben zu jagen.
Als sie sich gesetzt hatten, konnte Herbert Böckelmann wieder kaum Tinas Redefluß folgen. Er fühlte sich beobachtet. Was sich wohl die beiden Männer auf der Bank nebenan dachten? Erst im Laufe der Zeit merkte er, daß Tina für die beiden von größerem Interesse war als der neben ihr sitzende, sich an seiner Aktentasche festhaltende Mann. Es waren Italiener. Einer hielt eine auffällig rosafarbene Sportzeitung in der Hand, die Herbert Böckelmann schon am Wasserhäuschen hatte aushängen sehen. Er versuchte, ihren Blicken auszuweichen und beobachtete drei mit ihren BMX-Rädern pausenlos den Brunnen umfahrende Jungen.
„Hörst du mir eigentlich zu?“
„Hmh, natürlich.“
„Also das Frühstück war wirklich super. Rührei, Toast, Wurst, Käse, Tee, Kaffee, Saft, Obst. Ich war schon morgens pappsatt.“
Einer der Jungen war bei einem Bremsversuch gestürzt. Obwohl er sich das Knie aufgeschlagen hatte, unterdrückte er seine Tränen.
„Abends konnten wir auch auswählen. Suppen, Salate, Lammfleisch, Pommes, Reis und Gemüse. Jeden Tag Auberginen und Bohnen war allerdings etwas langweilig.“
„Und abends?“
„Du hörst wirklich nicht zu.“
Er hörte zu. Sie hatte ihn wieder geduzt. Bis zum Betriebsfest war er immer nur Herr Böckelmann gewesen. Schließlich war er zwanzig Jahre älter als sie und genauso lange schon im Betrieb. Tina hatte erst im Herbst letzten Jahres bei HallCo angefangen. Und erst seit dem Frühjahr fuhr sie jeden Morgen und Nachmittag mit ihm in der S-Bahn. Sie hatten nie viel miteinander geredet. Im Betrieb sowieso nicht, man sah sich kaum. In der Bahn das Übliche. Mit Frau Lotz dagegen hatte sich Tina offenbar gleich angefreundet.
„Hättest du nicht auch mal Lust, drei Wochen in der Sonne zu liegen und Gott einen lieben Mann sein zu lassen?“
„Bei uns war auch ganz gutes Wetter.“
„Ich habe mich heute Morgen richtig gefreut, dich wiederzusehen. Die anderen können mir gestohlen bleiben. Na ja, die Lotz ist ganz witzig. Für ihr Alter.“
Der Junge mit der immer noch blutenden Schürfwunde am Knie fuhr wieder mit seinen Freunden um den Brunnen. Ein ziemlich großer Hund erledigte sein Geschäft auf dem Rasen. Er ließ sich auch nicht stören, als ihn ein kleines Mädchen mit Sand bewarf. Dunkle Wolken, die ein Gewitter ankündigten, verdeckten mehr und mehr die Sonne. Ein unrasierter Mann kam quer über den Platz, stellte sich auf die freigewordene Bank, auf der eben noch die beiden Italiener gesessen hatten, hantierte mit seinem Fotoapparat und verschiedenen Objektiven herum und machte dann Aufnahmen von den an einem der Steintische würfelnden Ausländern.
„Frau Lotz ist aber höchstens Mitte vierzig. Kaum älter als ich.“
Herbert Böckelmann wunderte sich selbst über seine Worte.
Wie waren sie auf die Lotz gekommen? Hatte Tina nicht gerade von einem Bunten Abend erzählt, der nicht bunter gewesen sein soll als die anderen Abende auch?
„Das nächste Mal wollen wir uns die Höhlen ansehen. Und mit einem Fischerboot würde ich auch mal gerne rausfahren. Muß romantisch sein.“
Tina Berger rieb sich mit den rosa lackierten Fingernägeln die nackten Arme. Sie schien zu frösteln. Ihre kleinen Brüste und Brustwarzen zeichneten sich unter der dünnen Bluse ab. Unterhalb des Halses bildete sich eine leichte Gänsehaut. Herbert Böckelmann erinnerte sich wieder an das Betriebsfest und drehte den Kopf in Richtung des Brunnens.
„Ich hätte doch besser einen Pulli mitnehmen sollen. Gib’s zu, du hast dich schon heute morgen über meine Aufmachung gewundert.“
„Ich? Nein, warum denn? Du gefällst mir so.“
Die Worte schienen sich in seinem Mund zu einem Knäuel zu verbinden. Warum konnte er gegenüber Tina weder Banales noch ihm Wichtiges so schwer aussprechen?
„Oh, ich muß jetzt los. Schon zwanzig nach fünf.“
„Was? Ach so. Ich auch.“
Er hatte wirklich nur eine knappe Dreiviertelstunde mit ihr zusammengesessen. Es kam ihm wie eine Ewigkeit vor. „Übrigens, ich bringe gleich die Urlaubsfilme zum Entwickeln auf die Leipziger. Da müssen auch noch ein paar Aufnahmen vom Betriebsfest drauf sein. Hoffentlich sind sie etwas geworden. Wir waren ja schon ganz schön angeheitert. So, jetzt muß ich aber wirklich los. Tschüß, bis Morgen, Mister Schweigsam.“
Tina Berger erhob sich und ging davon.
Er wollte ihr noch sagen, daß es schön war, sich mit ihr zu unterhalten. Daß er eigentlich nie an einem Werktag auf dem Sedanplatz saß. Daß er sich einfach freute. Aber er ärgerte sich auch ein wenig. Mister Schweigsam? Hatte er ihr nicht vom schönen Augustwetter in Frankfurt erzählt und von dem Tag, als er sich in Shorts und Polohemd zu den Halb- und Ganznackten im Grüneburgpark gelegt hatte? Der Sonnenbrand an seinen Beinen war noch Tage später zu spüren gewesen.
Seine Kollegin hatte schon das Wasserhäuschen am Ausgang des Platzes erreicht, wo sie noch eine Illustrierte kaufte, als er mit einem Papiertaschentuch seine verstaubten Schuhe abputzte, nach seinem Aktenkoffer und Schirm griff und aufstand.
Herbert Böckelmann zuckte zusammen. Hinter ihm hatte es im den nahen Herbst ankündigenden Laub geraschelt. Er drehte sich um. Ein Eichhörnchen schien zum Sprung angesetzt zu haben, verharrte nun am Fuße des Kastanienbaums, blickte ihn mit seinen dunklen Augen an, um Sekunden darauf im Geäst des mächtigen Baums zu verschwinden. Niemand sonst schien den nachdenklich und müde wirkenden Mann zu bemerken. Ihm waren die Jungen und die kleinen Kinder, die Italiener und der Fotograf, die Würfelspieler und die strickenden Frauen, das Bockenheimer Original und die Tauben aufgefallen. Ob irgend jemand auch ihn beobachtet hatte? Egal. Niemand aber würde wissen, daß die letzte Stunde für ihn etwas Besonderes gewesen war.
Er selbst ahnte nicht, daß er dabei war, einen Schlußstrich unter sein bisheriges Leben zu ziehen.
Erst als er den Schlüssel im Schloß der Wohnungstür umgedreht, seinen Aktenkoffer auf das Flurschränkchen gelegt, den Schirm an die Garderobe gehängt und seine Schuhe ausgezogen hatte, wurde dieser Tag wieder ein Tag wie jeder andere. Er war noch nicht in seinen zweiten Pantoffel geschlüpft, da entzog ihm eine aus dem Dunkel des Wohnzimmers kommende, näselnde Stimme die letzte Wärme, die die Nachmittagssonne auf seinen Wangen und seiner Stirn hinterlassen hatte.
„Herbert, bist du’s?“
2.
Während Herbert Böckelmann sein Jackett auszog, sich die Hände wusch und am Küchentisch Platz nahm, um sein frühes Abendessen zu sich zu nehmen, warf sich Oliver Dörnberg, kaum fünfhundert Meter von der Böckelmannschen Wohnung entfernt, in einen alten Ledersessel. Er ließ seine Kameratasche zu Boden fallen, schnaufte ein paarmal kräftig durch und streckte die Beine von sich.
„Das wäre geschafft. Die Story ist perfekt. Ich hätte nicht geglaubt, jetzt noch solche Fotos machen zu können.“
Die am anderen Ende des Zimmers, an einem dunkelbraunen schweren Schreibtisch sitzende Frau blickte nur kurz über ihre linke Schulter.
„Ich muß gleich los. Bin eh schon spät dran. Tim hast Du auch nicht abgeholt, Susanne hat ihn mitgebracht. Auf dich ist echt Verlaß.“
Alexandra Tuborg stand auf, packte Karteikarten, ein Buch und Filzstifte in einen Umhängekorb und verließ das Zimmer.
„Ach du Scheiße. Das habe ich ganz vergessen. Entschuldige.“
Er folgte ihr in den Flur, wo sie gerade ihre Schlüssel vom Brett nahm und diese zusammen mit einer Schachtel Zigaretten ebenfalls in ihrem Korb verschwinden ließ. Sie war dabei, wie sie zu sagen pflegte, alles auf die Reihe zu bekommen.
„Geschenkt. Ist ja nicht das erste Mal. Tim ist übrigens noch unten bei Sophia. Nach der Sesamstraße muß er aber hochkommen, er weiß Bescheid. Im Kühlschrank steht noch ein Rest Spaghetti Bolognese von gestern. Du brauchst sie nur aufzuwärmen. Tschüß, bis später.“
Er wollte ihr noch einen Abschiedskuß geben, aber Alex, seine Lebensgefährtin, war schon die Treppe hinuntergelaufen.
Oliver Dörnberg ging hinüber ins Wohnzimmer, von dessen Fenster aus man auf den Sedanplatz blicken konnte, und wollte seiner Liebsten noch eine Kußhand nachwerfen – als kleine Entschädigung für seine Vergeßlichkeit. Aber Alexandra Tuborg hatte schon mit eiligen Schritten ihr auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes geparktes Auto erreicht. Wieso nahm sie nicht wie üblich die U-Bahn?
Oliver Dörnberg sprach mit sich selbst. Er sah, wie Alex in den schwarzen Fiat Uno einstieg, und er schüttelte den Kopf, als sie, ohne das Stop-Schild zu beachten, am Postamt um die Ecke bog.
„Scheiße“, brummelte er vor sich hin, ging nach nebenan ins Arbeitszimmer, ließ sich in den Sessel fallen, stand wieder auf und entschied, Tim gleich abzuholen und zu einer Pizza einzuladen.
Im Parterre waren Handwerker immer noch dabei, den ehemaligen Laden der vor bald einem Vierteljahr verstorbenen Hausbesitzerin, ein Handarbeitsgeschäft, von Grund auf zu modernisieren. Lärm und Dreck seit Wochen. Es ging das Gerücht um, demnächst würden hier eine Videothek oder ein Nagelstudio eröffnen. Im Klatsch hatte er aber auch schon gehört, daß eine frühere Kommilitonin in der Nähe zum Sedanplatz attraktive Räumlichkeiten für ihre Psycho-Praxis gefunden habe.
Als Oliver Dörnberg die im ersten Stock liegende Wohnung von Susanne Kraatz betrat, hörte er schon das Lachen von Tim, Sophia und deren Mutter.
„Scheint ja besonders lustig zu sein.“
„Hallo Oliver“, entgegnete Susanne.
Die Kinder schienen ihn gar nicht gehört zu haben. Erst als er Tim den Kopf streichelte und sein Pizza-Angebot unterbreitete, reagierte der fünfjährige Sohn von Alex.
„Erst gucken wir die Sesamstraße zu Ende. Und Mama hat gesagt, wir sollen die Spaghetti von gestern essen.“
Damit war für Tim das Thema anscheinend erledigt.
„Von mir aus. War ja nur ein Angebot. Ich geh wieder hoch.
Du kommst aber dann gleich.“ Und um seine Aufforderung zu unterstreichen, fügte er hinzu, daß Alex das ausdrücklich gesagt habe.
„Ich bin nicht so vergeßlich wie du.“
Oliver Dörnberg warf Tim noch einen vielsagenden Blick zu. Dieser amüsierte sich aber schon längst wieder über Kermit den Frosch und das Krümelmonster.
„Tschüß, Sophia. Tschüß Susanne. Und danke für das Abholen. Ich hab’s echt verschwitzt.“
„Kein Problem. Komm’, ich bring dich noch raus.“
Oliver Dörnberg stutzte. Normalerweise gingen Alex und er in dieser Wohnung, wie Susanne im zweiten Stock, ein und aus. Sie hatten die Schlüssel der jeweils anderen Wohnung, saßen mehr als einmal die Woche nachmittags zusammen am Kaffeetisch oder beim Abendessen. Schon der Kinder wegen hatte sich diese enge Verbindung ergeben.
Im Flur kam Susanne zur Sache.
„Sag’ mal, Oliver, habt ihr ernsthafte Probleme?“
„Wer? Nö, wieso? Hat Alex etwas gesagt?“
„Das nicht.“
„Aber warum fragst du?“
„Na ja, ich habe den Eindruck, daß ihr in der letzten Zeit beide etwas nervig aufeinander reagiert.“
„Ich doch nicht.“
„Ist ja auch egal. Du solltest aber wirklich mal darauf achten. Auch auf Tim.“
„Halb so wild. Der Kleine macht derzeit einen auf cool und Macker. Und Alex hat viel Streß an der VHS.“
„Okay. Ich wollte es nur gesagt haben.“
„Keine Bange, es ist alles im Lot.“
„Wenn du dich da mal nicht täuschst.“
Anscheinend hatte er sich getäuscht. Als Alexandra Tuborg kurz vor neun zurückkam, ihren Korb neben den Schreibtisch stellte, sich eine Zigarette anzündete, ihn um ein Glas Sherry bat und dann für Minuten schwieg, ahnte er, daß etwas in der Luft lag.
„Du bist so still?“
Keine Reaktion.
Oliver nahm den Film aus dem Apparat und packte ihn in eine kleine etikettierte Dose.
„Wollten deine Ausländer wieder nicht so wie du?“
Alexandra Tuborg unterrichtete an drei Abenden und zwei Vormittagen Deutsch für Ausländer. Ab und zu gab sie auch privaten Nachhilfeunterricht. Seit kurzem war sie auch noch in einem Sprechergremium der Kursleiter und Kursleiterinnen engagiert. So hatte er sie zumindest verstanden. Langsam verlor er den Überblick.
„Liegt der Kleine im Bett?“
„Natürlich, wo sollte er sonst sein?“
„Ob er schläft, will ich wissen.“
„Du hast gefragt, ob er im Bett liegt, nicht ob er schläft. Aber auch das tut er.“
Alexandra Tuborg hasste diese Witzeleien.
Der ewige Streit um Worte. Sie setzte zu einer Bemerkung an, ließ es dann aber doch.
Oliver Dörnberg ging ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher ein. Er sah Bilder aus der fernen Wüste, rollende Panzerkolonnen und schreiende Frauen, die auf dem Gelände irgendeiner Botschaft interviewt wurden. Er schaffte seinem Unmut durch ein Kopfschütteln Luft. Als dann vom Moderator zum Thema Übersiedler und Aufnahmelager übergeleitet wurde, drückte er wieder auf den Knopf.
„Oder soll ich mal ins andere Programm umschalten?“ fragte er Alexandra, die ihm gefolgt war und sich auf die Couch gesetzt hatte.
„Ist mir egal. Gibst du mir noch ein Glas?“
„Schon in Arbeit.“
Er stellte das aufgefüllte Glas Sherry auf die große, als Plattenständer und Ablage dienende Holzkiste. Das einzige Mobiliar in dieser Wohnung, das noch an studentische Wohngemeinschaftszeiten erinnerte.
„Bist du muffig wegen heute Nachmittag? Ich hatte Tim wirklich vergessen. Die Fotos werden bestimmt spitze.“
Alexandra stand auf, griff sich eine Nannini-Platte aus der Kiste, legte sie auf und nahm wieder auf der Couch Platz.
„Willst du jetzt sagen, was los ist, oder ist der Abend für dich schon gelaufen?“
„Ich möchte jetzt Musik hören.“
Oliver, dem man eher Abgeklärtheit und ein ruhiges Gemüt denn Impulsivität und leichte Reizbarkeit zuschrieb, reagierte an diesem Abend wie in all den anderen ähnlichen Situationen.
„Ich setze mich noch an den Schreibtisch. Bis Freitag muß die Ausländerstory fertig sein. Wenn du was willst, ich bin ganz Ohr. Okay?“
Alexandra Tuborg schaltete die Boxen aus, nahm die Kopfhörer, nippte an ihrem Sherry, und Oliver Dörnberg hatte den Eindruck, daß seine Liebste im Moment überall sein wollte, nur nicht in dieser schönen, sehr geräumigen Fünf-Zimmer-Wohnung.
Natürlich hatte die Wohnung ihren Preis, fast tausend Mark kostete die Miete. Einige ihrer Bekannten, die derzeit nach einer ähnlich großen und gutgelegenen Wohnung in Bockenheim suchten, waren schon bereit, dafür zwölf- oder dreizehnhundert zu zahlen. Aber auch für den Preis hatten sie immer noch nichts Passendes gefunden. Für Alexandra Tuborg und Oliver Dörnberg war die Miete eine Luxusausgabe. Aber sie hatten es beide so gewollt.
In solchen Situationen wie der jetzigen, und diese gab es in letzter Zeit öfter, machten sich die vielen und großen Zimmer bezahlt. Man verzog sich nach nebenan, konnte sogar die Tür auflassen und saß sich trotzdem nicht auf der Pelle.
Oliver ging durch eine der großen Flügeltüren, die alle fünf Zimmer verbanden, wovon aber nur die beiden genutzt wurden, durch die man vom Wohnzimmer nach rechts ins Eßzimmer oder nach links ins Arbeitszimmer gelangen konnte. Dort setzte er sich an den gemeinsamen Schreibtisch, räumte Alex’ Unterlagen ins Regal und versuchte, seine Eindrücke vom Nachmittag zu sortieren.
Noch zwei Stunden später grübelte er über seinem Artikel zum Thema Multikulturelles Bockenheim. Er würde Fakten sprechen lassen, O-Ton präsentieren und versuchen, seine eigenen, subjektiven Eindrücke rüberzubringen. Die Ausländer waren eine Bereicherung. Eben etwas bunter, in vielem fremd, einfach anders. Man mußte einen Pflock gegen die wachsende Ausländerfeindlichkeit setzen. Das Getöse um die DDR und die bevorstehende, wie Oliver gern witzelte, Zwei-minus-eins-Vereinigung ging ihm auf den Geist. Alles wurde vom Trend der Internationalisierung erfaßt, die Kultur, die Politik, vor allem auch die Wirtschaft, von den globalen Problemen ganz zu schweigen. Und gleichzeitig diese neuerliche Deutschtümelei. Die einen flüchteten vor Bomben, Dürrekatastrophen und Pogromen. Die anderen gierten nach Bananen. Fürchterlich.
Schon als Kind hatte er sich lieber als Indianer denn als Cowboy verkleidet. Er hatte Atlanten gewälzt und von Kanada und Sibirien geträumt. Der algerische Befreiungskrieg und Lumumba im Kongo gehörten zu seinen ersten TV-Erlebnissen. In diesen Jahren begegnete Oliver dem ersten Italiener in seinem Leben. Auf dem Bahnhof des südhessischen Dorfs, in dem er aufgewachsen war. Wie bestaunten sie, er und seine Freunde, die auseinanderfaltbaren Minipostkarten, das Colosseum, die Via Appia, die Tiberbrücken, den Petersdom. Natürlich waren diese Mitbringsel schlicht und einfach Kitsch gewesen, eine verlogene Erinnerung an die Heimat. Ganz bestimmt waren der Italiener und seine Landsleute nicht aus Rom, sondern aus irgendeinem Kaff in den Abruzzen oder Süditalien gekommen.
Natürlich hatten Oliver und seine Schulkameraden die Späße der Erwachsenen nachgeplappert, als immer mehr Italiener, dann auch Portugiesen und Spanier sich abends an den Bahnhöfen trafen, auf denen sie einige Wochen oder Monate zuvor mit einem Koffer in der Hand angekommen waren. Sogar in diesem kleinen Kaff. Damals hieß es noch nicht, sie nähmen uns die Arbeitsplätze weg, schließlich waren sie von Opel, Merck, den Farbwerken und der Bahn angeworben worden. Das Objekt ihrer Begierde waren angeblich die deutschen Frauen und Mädchen. „Tricotraco, in Baracko, auf Matrazo, für fünf Marko.“ Aber „Itaker“ oder „Spaghettifresser“, wie damals viele Einheimische unterschiedslos alle Gastarbeiter nannten, hatte er sogar als unwissendes Kind nie gesagt.
Und er war dann als Kosmopolit und Internationalist erwachsen und das geworden, was politisch links sein hieß. Vor allem Vietnam. Vorher die afrikanischen Befreiungsbewegungen und die neuen Ländernamen. Er trug ihm bis dahin unbekannte Fahnen, die von Gott weiß wem beschafft worden waren. Die Teach-ins an der Uni mit Vertretern der Black Panther. Die geballten schwarzen Fäuste aus dem Militärgefängnis der Amis in Frankfurt. Die blanke Wut während des ersten Urlaubs an der Costa Brava, in einem Land, das damals für Linke als Reiseziel tabu gewesen war. Er hatte es des billigen Pauschalarrangements und der Clique zuliebe getan. Dort waren noch die Einschläge von Gewehrsalven aus dem Bürgerkrieg zu erkennen, aber keine einzige aktuelle Parole gegen die Franco-Diktatur. Und als sei dies für einen verkorksten Urlaub nicht schon genug: Bild-Schlagzeilen und FAZ-Kommentare, mit denen der Putsch in Chile gerechtfertigt und regelrecht gefeiert wurde. Im Jahr darauf Zuversicht nährender Kampf in den portugiesischen Kolonien und die Nelkenrevolution. Und dann sein ganz persönlicher Höhepunkt: Wie seine Onkel am über zwanzig Jahre zurückliegenden Berner Endspiel, so konnte er sich an den TV-Reportagen über die chaotische Flucht der Amis aus Saigon nicht satt sehen.
Er hatte immer auf der Seite der Schwarzen, Gelben und Roten gestanden. Nun ja, später war es ruhiger geworden. Die Themen, deretwegen man auf die Straße ging, änderten sich. Natürlich, der ANC konnte bis heute seiner Sympathie gewiß sein, und nicht selten hatte er auch mal einen Zwanziger in die verschiedenen bunten Fahnen geworfen, mit denen auf Friedensdemos, in Gorleben oder an der Startbahn West Spenden für die Befreiungsbewegungen gesammelt worden waren.
Mit seiner Reportage über die Ausländer in Bockenheim kam er an diesem Abend nicht mehr voran. Das Spätprogramm bot auch nur die Wahl zwischen einer Talkshow über den tropischen Regenwald und einem indischen Spielfilm. Ersteres würde ihm nichts Neues bieten, und Indien war für ihn noch nie von besonderem Interesse gewesen. Er hatte nie gekifft und fand Räucherstäbchen kindisch.
3.
Zu dieser Zeit lag Herbert Böckelmann schon seit einer Stunde im Bett, ohne einschlafen zu können.
Er hatte sich noch Harald & Eddi angesehen, dann aber doch nicht mehr zum Sportkalender im Dritten umgeschaltet. Selbst das Buch über hessische Bauern und Handwerker, die im vorigen Jahrhundert nach Amerika ausgewandert waren, hatte ihm keine Ruhe verschaffen können.
Schon ein paarmal hatte er die Nachttischlampe wieder eingeschaltet und nach dem Buch gegriffen. Aber wie am Nachmittag in der S-Bahn verschwammen die Buchstaben vor seinen Augen. Gedanken, von denen er nicht wußte, woher sie kamen, beschäftigten ihn.
Herbert Böckelmann war 40, genaugenommen 39 Jahre und neuneinhalb Monate alt. Nichts sprach dagegen, daß sein vierzigster Geburtstag genau so verlaufen würde wie all die vielen Jahre zuvor.
Auf dem Frühstückstisch würde er ein kleines, mit Schmuckband versehenes Päckchen finden. Eine warme, etwas rauhe Hand würde auf seiner Rechten liegen, während er – ganz ungewohnt und deshalb etwas unsicher – mit der linken Hand seine Kaffeetasse oder sein Marmeladenbrot und schließlich sein Geburtstagsgeschenk halten würde.
Auch dieses Jahr würden nach dem sorgfältigen Auspacken eine Krawatte oder eine Untergarnitur, vielleicht zusätzlich noch ein Schal oder ein Paar Handschuhe zum Vorschein kommen. Schließlich würde es schon November und ein runder Geburtstag sein. Er würde seine rechte Hand ein zweites Mal dem Tätscheln für ein paar Sekunden entziehen, aufstehen, der neben ihm sitzenden Frau einen Kuß auf die Wange geben, sich bedanken und wieder setzen. Er würde sich anhören, daß das Geschenk Markenqualität und trotzdem recht günstig im Preis sei, daß am Nachmittag seine Lieblingstorte auf ihn warten würde und er nicht zu viel Geld für den unnützen Umtrunk in der Abteilung ausgeben solle.
Er würde am Vormittag trotzdem drei Flaschen Henkell Trocken spendieren, ausnahmsweise schon die S-Bahn um halb vier nehmen, den Sekt immer noch spürend zuhause ankommen und ganz überrascht tun, wenn ihm die Geburtstagskarte von Onkel Fritz präsentiert und Frau Bachmann aus dem zweiten Stock schon auf der Couch sitzen würde.
„Herzlichen Glückwunsch, Herbert. Wie die Zeit vergeht.“
Frau Bachmann, die ihn schon von Kindesbeinen an kannte, würde wie jedes Jahr die Schwarzwälderkirschtorte oder den Frankfurter Kranz, vor allem aber die neue Häkelarbeit loben, die wie zufällig auf dem Beistelltischchen liegen würde. Ein weiteres Exemplar der Deckchen und Kissenbezüge, die die sowieso schon kleine Wohnung noch enger erscheinen ließen. Er wird erzählen, daß ihm die Kolleginnen und Kollegen wie im vergangenen Jahr eine dieser amerikanischen Glückwunschkarten, die beim Aufklappen eine Melodie hören lassen, überreicht haben, und er sich mit zwei Flaschen Sekt revanchiert hat. Herbert Böckelmann hatte sich nie ein anderes Leben vorstellen können. Vorstellen vielleicht, in Erwägung ziehen nicht. Nie hatte er überlegt, ob es anders sein könnte.
Natürlich wußte er von Kollegen und Nachbarn, daß diese abends in ihrer Stammkneipe Skat spielten, würfelten oder sich mit Freunden zum Doppelkopf trafen. Becker ging regelmäßig in die Sauna. Kohlmann, der im Parterre wohnte, war Angler. Peter Dötsch, einer der wenigen ehemaligen Schulkameraden, die noch in Bockenheim wohnten, fuhr zu allen Modellflugtagen, die im Umkreis von 200 Kilometern stattfanden. Die Jüngeren aus der Firma gingen zum Tennis oder Squash. Selbst den immer unausgeschlafen und hektisch wirkenden Bender bewunderte er manchmal, wenn er von Sitzungen seines Ortsvereinsvorstandes oder von seiner sonntäglichen Joggingtour entlang der Nidda erzählte.
Herbert Böckelmann rauchte nicht und trank nur selten. Seine Kneipenbesuche der letzten Jahre konnte man an zwei Händen abzählen. Theateraufführungen hatten ihn noch nie interessiert. Die letzten Kinovorstellungen – er erinnerte sich bis heute an Ben Hur, Der Koloß von Rhodos, Vom Winde verweht und Doktor Schiwago – lagen über zwanzig Jahre zurück. Ins Schwimmbad ging er nicht. Sein Körper war ihm immer eine Last gewesen, früher zu schmächtig, heute zu füllig. Und er war nie ein guter Schwimmer gewesen, vom Tauchen hatte er als Kind heftige Ohrenschmerzen bekommen.
Sogar seinen Jahresurlaub verbrachte Herbert Böckelmann seit Jahren in der Regel in Frankfurt. Manches Jahr hatte er sich aufgerafft und war zum Wandern in den Taunus oder zu einer Tagestour in den Rheingau aufgebrochen. In den Sekretariaten der Firma hingen Ansichtskarten aus aller Herren Länder. Er war mit seinen fast vierzig Jahren über den Vogelsberg im Norden und das Neckartal im Süden nicht hinausgekommen. Nur zweimal war er im Ausland gewesen, vor vielen Jahren, als Schüler in Frankreich und als zweiundzwanzigjähriger Begleiter der Fußballjugend in Holland. Ein Auto fuhr er nicht. Er las ganz gern, vor allem Bücher über die Geschichte Frankfurts und Hessens sowie Spezielleres über Bahnlinien, Viadukte und Tunnel. Aber dafür interessierte sich niemand in seinem Bekanntenkreis.
Sah man vom Wäldchestag und dem Fastnachtsdienstag in Heddernheim ab, die neben dem Betriebsfest zum festen Programm des gemeinsamen Vergnügens der HallCo-Angestellten gehörten, gab es nichts Außergewöhnliches in seinem Leben.
Im Juli hatte er für ein paar Tage mit dem Gedanken gespielt, seinen Geburtstag diesmal ganz anders als die vielen Jahre zuvor zu verbringen. Mit Tina, nachmittags in einem Café, abends vielleicht in einem guten, etwas teureren Lokal. Er kannte keins, hätte sich erkundigen müssen, aber bestimmt eins gefunden.
Das diesjährige Betriebsfest war anfangs wie üblich verlaufen. Es wurde getanzt, ab zehn Uhr standen Essensreste auf den Tischen, und an der Sektbar herrschte der größte Betrieb. Die wenigen ausländischen Kolleginnen, die gekommen waren, hatten sich schon auf den Heimweg gemacht. Auch die Herren aus der Geschäftsleitung waren bis auf eine Ausnahme schon gegangen. Nur Wolfgang Becker, die neue Marketing-Assistentin am Arm, schien, wie jedes Jahr, zu den letzten Gästen zählen zu wollen.
Rudi Bender erzählte gerade von seinem Vorhaben, im nächsten Jahr am Stadt-Marathon teilzunehmen, als Tina Berger an ihren Tisch trat und – „Damenwahl, Herr Böckelmann“ – ihn um einen Tanz bat.
So hatte es angefangen. Er erinnerte sich nur in Fetzen an die folgenden beiden Stunden. Manches sah er klar, manche Szene verschwand sofort im Trüben. Sie hatten wohl mehrmals getanzt. Das heißt, Tina hatte getanzt, und er hatte, schwitzend und auf die Pause hoffend, nur mit den Schultern gezuckt, auf den ledernen Minirock seiner Partnerin gestarrt und seine schwerer werdenden Beine zu kontrollieren versucht. Als Tina ihn unterhakte und vorschlug, doch etwas zu trinken, wollte er schon den Tisch ansteuern, an dem Bender nun auf Anne Lotz einredete.
Doch seine zierliche Tanzpartnerin zog ihn zur Bar und bestellte zwei Gläser Sekt. Becker, sich immer noch um die Neue bemühend, blinzelte und prostete ihm zu. Der offenbar schon leicht angetrunkene Personalchef ließ sich auch durch die Rippenstöße, die ihm die großgewachsene, ihr feuerrotes Haar immer wieder in den Nacken werfende Frau versetzte, nicht in seinen handgreiflichen Annäherungsversuchen beirren. Tina unterhielt sich mit zwei gleichaltrigen Kolleginnen. Während die eine ihr etwas ins Ohr flüsterte, lächelte die andere Herbert Böckelmann zu. Er fühlte sich unbehaglich. Nicht nur wegen der lauten Musik und dem Zigarettenqualm, der über der Theke hing. Es war kurz vor Mitternacht, als Tina ihn überredete, etwas frische Luft schnappen zu gehen. Die Hitze dieses Julitages schien sich über die Nacht retten zu wollen. Trotz der leichten Brise, die mit den Blättern der ausladenden Ahornbäume und Buchen spielte, war es immer noch warm und schwül.
Tina führte ihren Kollegen fast bis zum Ende des weitläufigen Areals. An den Samstag- oder Sonntagnachmittagen, die sie in diesem dann stark frequentierten Ausflugslokal schon verbracht hatte, war der jungen Frau das Gelände nie so groß vorgekommen. Und zum ersten Mal fielen ihr die drei verwitterten Grabsteine auf, die hinter dem alten Ziehbrunnen schief aus der Erde ragten.
Sie setzten sich auf eine der Holzbänke und genossen die Stille, in das sich das Kettengerassel aus dem nahen Kuhstall einfügte, als wolle es die angenehme Ruhe noch eindringlicher machen. Die Lampe über der Eingangstür des Gasthofs spendete wenig Licht. Hier, unter dem grenzenlosen Sternenhimmel, konnte man für ein paar Minuten dem Trubel entfliehen.
Dann mußte alles ganz schnell gegangen sein. Die wenigen Minuten erschienen Herbert Böckelmann in der Erinnerung wie eine Ewigkeit. Der Schatten auf dem Kiesweg zum Parkplatz. Instinktiv waren sie zusammengerückt. Das erschrocken wirkende schmale Gesicht und die plötzlich größer werdenden Augen seiner Kollegin. Sie lehnte ihren Kopf leicht zurück. Er berührte ihren Hals, fuhr mit seinen Fingern ungeübt zwischen die Knöpfe ihres Oberhemdes. Er fühlte ihre Haut, eine kleine Narbe, spürte den Schweiß auf seiner hohen Stirn und seinen härter werdenden Pimmel. Dann das plötzliche, nicht enden wollende und unglaublich laute Lachen seiner Kollegin, als er ihre kleine Brustwarze sanft zwischen Daumen und Zeigefinger rieb. Sie lachte ihn nicht aus, schien ihn vielmehr zum Mitlachen animieren zu wollen. Er hatte seine Hand ganz schnell wieder zurückgezogen, wollte im Erdboden versinken, spürte die Rötungen an Hals und Kopf.
Tina lachte immer noch, wenn auch nicht mehr so lauthals, als sie kurz danach wieder das Lokal betraten. Sie hatte ihn wieder untergehakt und bestellte an der Bar zwei weitere Sekt. Er bezahlte und trank sein Glas in einem Zug aus.
Er mußte in der nächsten Stunde noch einige Gläser getrunken haben. Später erzählte man, die tapsige graue Maus aus dem Einkauf, deren Namen viele gar nicht kannten, sei an diesem Abend ganz anders, aufgekratzt, lustig, einfach ganz normal gewesen. Ihm war damals, als sei er durch eine undurchdringliche Wand von dem ihn umgebenden Trubel abgeschnitten. Er überragte sie alle um Haupteslänge und fühlte sich doch wie ein Stift, den man zum ersten Mal mittrinken ließ. Die verbliebenen zehn oder fünfzehn Kollegen und Kolleginnen, die sich selbst immer wieder lauthals als den harten Kern bezeichneten und aus deren Mitte in regelmäßigen Abständen der eiserne Beschluß verkündet wurde, erst dann zu gehen, wenn auch die allerletzte Flasche Sekt geköpft worden sei, blieben Schemen. Nur als Tina und eine andere, ziemlich beschwipste Sekretärin aus der Geschäftsleitungsetage noch Fotos machten, Blitzlichter aufleuchteten und das Ganze von Gekicher und Gelächter begleitet wurde, war Herbert Böckelmann wieder etwas zu sich gekommen. Becker hatte ihn brüderlich umarmt, sich in Pose gestellt und Tina aufgefordert, doch noch ein Bild von den beiden „unwiderstehlichsten Männern in der Runde“ zu machen. „Gell, Böckelmann. Ein Gentleman genießt und schweigt.“ Herbert Böckelmann hatte geschwiegen und den Blick von Tina gesucht.
Kurz nach ein Uhr wollte er einen Kollegen fragen, ob dieser ihn mit nach Frankfurt nehmen könne. Doch Tina hatte darauf bestanden, daß er mit ihr fahre. Er erinnerte sich noch an Einzelheiten der bald zwanzig Kilometer langen Strecke vom Grumbacher Hof nach Frankfurt. An die Fahrt durch den Taunus, an das waghalsige Überholmanöver eines ihnen entgegenkommenden Motorradfahrers, an den kurzen Aufschrei, als in einer scharfen Kurve die offene Cola-Dose, die seine Kollegin sich zwischen die nackten Beine geklemmt hatte, überschwappte, an die ihm unbekannten Lieder, deren Melodie Tina mitsummte, und an die Lichterketten, die die autobahnähnliche Zufahrt in die westlichen Stadtteile Frankfurts säumen. Er hatte geschwiegen und Tina auch dann noch schweigend zugehört, als sie von ihrem bevorstehenden Urlaub sprach, den Krach mit ihrem Freund erwähnte und über die Anmacherei Beckers herzog.
Sie standen schon an der Bockenheimer Warte, als Tina ihm eine gute Nacht gewünscht und zum Abschied flüchtig seine ausgestreckte Hand gestreichelt hatte.
„War doch schön? Du solltest öfter aus dir herausgehen.“
Herbert Böckelmann hatte dem davonfahrenden Auto noch hinterher geschaut, als dieses schon lange nicht mehr zu sehen gewesene war.
Er war schweren Schrittes die Treppenstufen hinaufgegangen. Als er erst nach mehrmaligen Versuchen das Schlüsselloch gefunden hatte und ihm im Flur auch noch der Bügel mit seinem Jackett aus der Hand gefallen war, zitterte er am ganzen Leib. Er hatte sich dann in Unterwäsche aufs Bett gelegt und war sofort eingeschlafen.
Herbert Böckelmann drehte sich jetzt zum x-ten Mal auf die andere Seite. Wieder machte er die Lampe an, stand auf, um den Rolladen etwas hochzuziehen und das Fenster zu öffnen. Ein Feuerwehrauto, mit Blaulicht aber ohne Martinshorn, überquerte gerade die Kreuzung See-/Adalbertstraße. Ärgerlich, daß er nicht doch noch die Wetterkarte angesehen hatte. Hoffentlich würde es tagsüber wieder sonnig werden. Er würde sich gerne noch einmal nach der Arbeit auf den Sedanplatz setzen. Er schloß das Fenster und verkroch sich, zusammengekauert wie ein Embryo, unter seiner Bettdecke.
Bilder schossen ihm durch den Kopf.
Ein Junge fuhr mit seinem neuen Fahrrad immer größere Kreise, ein helles Lachen zog ihn unwiderstehlich an. Riesige Frauenbrüste lenkten seinen Blick ab. Er stürzte, spürte sein blutendes Knie und hatte Angst. Seine weißen Kniestrümpfe waren schmutzig und seine neuen Lackschuhe verkratzt. Grelles Sonnenlicht blendete ihn. Die Luft vibrierte. Der Junge bekam Atemnot, schnappte nach Luft. Wie eine Erlösung legte sich kühlender Schatten über den großen Platz. Es war seine Mutter, die eine riesige gehäkelte Decke vor die Sonne gespannt hatte.
Herbert Böckelmann war schweißgebadet, als ihn am nächsten Morgen seine Mutter weckte und mit tadelndem Blick fragte, wieso er den Rolladen nicht geschlossen und auch noch das Licht brennen gelassen habe. Er stand auf, ging wortlos ins Badezimmer, wusch sich kalt und setzte sich an den Frühstückstisch.
DIENSTAG SALI WTOREK
4.
An diesem Dienstagmorgen verließ Lydia Wybora, nach einem letzten Blick in den Spiegel, ihr kleines Zimmer. Auf dem Flur versicherte sie sich noch einmal, daß sie die Tür auch wirklich abgeschlossen hatte, grüßte ihren Nachbarn, einen Afrikaner, und ging die Treppe hinab.
Vor der Haustür stieg sie mit einem großen Schritt über den dort liegenden Schäferhund hinweg. Das Tier flößte ihr immer noch Angst ein, obwohl sie mittlerweile wußte, daß die Hündin harmlos und normalerweise durch nichts aus der Ruhe zu bringen war. Außer durch ihr Herrchen, den im Parterre zwei Zimmer mit Küche bewohnenden Hausmeister des zweistöckigen Wohngebäudes. Er hielt die Hündin wie einen scharfen Wachhund. Und tatsächlich reagierte Asta bei ihm nur auf kurze, scharf gezischte Anweisungen.
Lydia Wybora überlegte, ob sie die Hündin nicht zu streicheln versuchen sollte, als Helmut Lotz, die Bild und eine Tüte unter dem Arm, um die Hausecke bog und auf sie zukam.
„Vorsicht, Madame! Der Hund ist scharf! Gell, Asta.“
„Guten Morgen, Herr Lotz. Wird wieder ein schöner Tag heute.“
„Ja, Madame. Mir Frankfurter sind dieses Jahr von der Sonne verwöhnt. Das brauchen mir wie die Äpfel fürs Stöffche.“
Lydia Wybora, obwohl relativ gut deutsch sprechend, verstand nicht so recht, was Helmut Lotz ihr sagen wollte.
„Mir haben zu hause auch viel Sonne gehabt“, war das einzige, was sie in diesem Moment zu antworten wußte.
„Wir, Madame, nicht mir. Sie sind jetzt in Deutschland, nicht mehr in der Tschechei. Gell, Madame.“
Sie wollte ihm noch entgegnen, daß sie aus Swinoujscie, auf deutsch: Swinemünde, komme, und diese Stadt in Polen liege. Aber Helmut Lotz war schon im Hauseingang verschwunden, nicht ohne seiner Hündin ein kurzes unverständliches Kommando zuzuzischen.
Lydia Wybora ging Richtung Leipziger Straße, wo sie seit einem Monat in einem Supermarkt Regale einräumte und vielleicht auch bald an der Kasse sitzen würde. Unterwegs dachte sie nur für einen kurzen Moment an den Ostseestrand nahe ihrer Heimatstadt. Vielmehr beschäftigte sie die Frage, warum im Deutschen manchmal Wir durch Mir ersetzt wird. Sie nahm sich vor, heute abend Frau Tuborg zu fragen.
Während die Polin durch einen Nebeneingang den Supermarkt betrat und im Personalraum genannten Teil des Warenlagers ihren hellblauen Kittel überzog, erwachte Oliver Dörnberg. Er fühlte sich mürbe, hatte leichte Kopfschmerzen und einen üblen Geschmack im Mund. Er hätte sich gestern Abend doch noch einmal die Zähne putzen sollen. Die drei Gläser Wodka waren aber nötig gewesen. Anders hätte er den kleinen Streit mit Alex nicht so cool zu Ende gebracht. Obwohl, Streit konnte man den kurzen Wortwechsel eigentlich gar nicht nennen.
Sie hatten kurz vor Mitternacht noch in der Küche gesessen. Alex vor ihren aufgewärmten Spaghetti, er vor einem Glas Wodka.
Alex hatte auf seine Frage, ob sie sich endlich beruhigt habe, abwehrend und ohne Worte reagiert. Erst als er in der ihm lieben jovial-ernsthaften Art nachhakte, hatte sie sich zur Widerrede entschlossen. Dabei wollte er nur wissen, ob der Sherry den VHS-Streß vertrieben habe. Er verstehe ja, daß die Abendkurse nervten. Ob sie nicht doch tauschen wolle, um nur noch vormittags zu unterrichten. Ihre Antwort war schroff gewesen. Sie hatte nicht zum ersten Mal sein doch wohl deutlich geäußertes Interesse an ihrer Arbeit ignoriert.
„Hat Tim heute abend nichts gegessen?“
„Jetzt bleib doch mal beim Thema. Natürlich hat der Kleine etwas gegessen. In die Pizzeria wollte er nicht, bei Susanne gab es Pommes mit Würstchen. Und überhaupt, verhungert ist er noch nicht, oder? Also, ma chèrie, rede jetzt. Was war los in der VHS?“
Alexandra hatte ihren Teller in die Spülmaschine geräumt, eine Zigarette angezündet und sich kopfschüttelnd wieder auf ihren Stuhl gesetzt.
„Monsieur stellt sich wieder einmal blind und taub. Ganz einfach: Ich überlege, ob es nicht besser wäre, wenn du für eine bestimmte Zeit ausziehen würdest.“
Oliver Dörnberg hatte geglaubt, sich verhört zu haben. Mit Rausschmiß war ihm von Alex zuletzt vor drei Jahren gedroht worden, kurz nach seinem Einzug in ihre damalige Drei-Zimmer-Wohnung, kaum zwei Monate, nachdem sie sich kennengelernt hatten. Für ihn war bis heute der Grund des damaligen Krachs ganz eindeutig – das Loch, das sich für Alex nach ihrem zweiten Examen und vor der Arbeitslosigkeit stehend aufgetan hatte. Alexandra Tuborg sah das anscheinend immer noch ganz anders. Ausgesprochen hatten sie sich nie.
Machten Alex die unsicheren Arbeitsverhältnisse immer noch zu schaffen? Sie stand doch besser da als er. Binnen so kurzer Zeit hatte sich alles verkehrt. Heute verdiente sie das nötige Geld für die Miete, den Haushalt, das Auto. Und sie hatte ein kleines Polster, das ihr das Gesparte ihrer Oma verschafft hatte. Davon zehrten sie nun. Er selbst war nach dem Konkurs von Christians Kleinverlag, der legendären edition ultima ratio, auf freien Journalismus umgestiegen. Es war ihm jedoch in den vergangenen anderthalb Jahren nicht gelungen, wesentlich mehr als sein Taschengeld zusammenzuschreiben. Den kläglichen Überschuß konnte er gerade für den Sommerurlaub zur Seite legen.
„Wenn Du meinst. Wir können am Sonntag darüber reden, wenn ich die Geschichte für das stattblatt erledigt habe. Wir fahren in den Taunus und quatschen uns mal so richtig aus. Okay?“
Oliver Dörnberg hatte sofort gemerkt, daß diese Schlacht so gut wie gewonnen war. Seine Liebste schien zwar zum Gegenangriff ansetzen zu wollen, aber anscheinend hatte sie begriffen, daß Querelen wie die ihren keinen wirklichen Streit lohnten.
„Du begreifst aber auch rein gar nichts.“
Mehr hatte Alex an diesem Abend nicht mehr von sich gegeben.
Im Bett hatte er sie dann nochmals umarmen wollen, doch Alex war binnen weniger Minuten eingeschlafen. Im Schlaf sah sie besonders müde aus. Oliver hatte sich auf die andere Seite gedreht und darüber nachgedacht, was in ihrer Beziehung eigentlich schiefgelaufen war. Bevor ihm eine schlüssige Antwort einfallen konnte, war auch er eingeschlafen.
Nun, am Morgen, als er sich im Bett räkelte, langsam wach wurde und über den gestrigen Abend nachdachte, sah alles schon wieder anders aus. Verschlafene Zeit konnte wie eine Atempause oder wie Bedenkzeit wirken. Neuer Tag, neues Glück. Sein Kopf brummte zwar, aber das war normal. Gegen einen Wodka-Kater gab es kein Rezept.
Er ging ins Bad, überlegte, ob er duschen sollte, tat es dann doch nicht, sondern beließ es bei einer Katzenwäsche und langem Zähneputzen. Heute Abend, nach dem Volleyball, würde er die Dusche nachholen.
Er saß am Küchentisch, bestrich seinen zweiten Toast mit Orangenmarmelade und wollte gerade einen Blick in die TAZ werfen, als Alex die Treppe heraufkam. Er hörte es an den Schritten. Elefantenschritte nannte er sie manchmal spaßeshalber. Niemand, der es noch nicht selbst gehört hatte, hätte Alex, einer schlanken Frau von dreißig Jahren, diese Trampelei zugetraut.
„Hallo, ich bin in der Küche. Hast du Croissants mitgebracht?“
Alex zog mürrisch ihre Strickjacke aus, setzte sich an den Tisch und bat ihn um eine Tasse Kaffee.
Als er auf seine Frage nach den Croissants keine Antwort bekam, griff er noch einmal zum Marmeladenglas und fragte, ob sie auch einen Toast wolle.
„Nein. Ich habe heute Morgen keinen Appetit. Ich schmiere mir ein Wurstbrot für die Pause. Kannst du Susanne Bescheid sagen, daß sie, wenn sie Tim abholt, unbedingt darauf achten soll, ob er sein Mitgutsch-Buch wieder mit nach Hause nimmt? Er hat mir versprochen, daran zu denken.“
„Geht in Ordnung. Ist schon gespeichert.“
Er trank einen Schluck Saft, stocherte in seiner Joghurt-Müsli-Mischung herum und überlegte, ob es der Klimaverbesserung dienen würde, nochmals auf den gestrigen Abend zu sprechen zu kommen. Aber schlafende Hunde sollte man nicht wecken. Kurz bevor Alex sich wieder Richtung VHS aufmachte, mußte nicht unnötiger Streß provoziert werden. Ihr zuliebe.
„Soll ich irgend etwas einkaufen? Ich bin den ganzen Tag zuhause und muß erst so gegen fünf Uhr zum Volleyball.“ „Du kannst ja in den Kühlschrank schauen. Tim wird sowieso bei Susanne essen, und ich mache mir am Mittag einen Salat.“
Alex ging ins Bad, um ihr blondes Haar zu einem Zopf zu flechten. Nach einer Viertelstunde setzte sie sich mit ihren Schminkbeutel wieder an den Tisch.
Es war Oliver, der das Gespräch wiederaufnahm.
„Morgen Abend könnte ich etwas kochen. Hast du einen Vorschlag?“
„Laß dir selbst etwas einfallen“, antwortete sein Gegenüber schroff, fügte aber im gleichen Atemzug hinzu: „Wie wär’s mit Mailänder Makkaroni?“
„Schon wieder Nudeln? Vielleicht hole ich auch drei Pizzen und koche am Sonntag was Großes. Lammkeule mit Bohnen, und vorher irgend etwas Fischiges, Sardinen oder Coquilles.“
Er wußte, daß sie bei Jakobsmuscheln nicht nein sagen konnte. Und Lammfleisch gelang ihm in der Regel auch ganz gut.
„Wenn du am Samstag einkaufen gehst, von mir aus gerne. Ich muß schon morgens beim Aufbau für das Fest helfen.“
„Klar, wird gemacht. Und nach dem Einkaufen gehe ich mit Tim noch ein Eis essen. Das wird ihm Laune machen.“ Der gestrige Streit war damit praktisch schon für null und nichtig erklärt. Er würde am Sonntag, nach langem Ausschlafen, ab mittags in der Küche zu tun haben. Das eh sinnlose Beziehungsgespräch im Taunus würde ausfallen müssen, und das Essen, mit Aperitif und einer Flasche Bourgeuil, würde das Seine dazutun, damit die nächste Woche ungetrübter beginnen konnte als diese.
Oliver Dörnberg hatte keine Ahnung, daß diese erste Septemberwoche anders enden sollte, als er es sich vorstellte. Das verband ihn mit dem ihm unbekannten Herbert Böckelmann.
5.
Helmut Lotz hatte sein Frühstück beendet. Er räumte Kaffeetasse und Messer ins Spülbecken und brachte seiner Hündin zwei Scheiben Wurst vor die Haustür. Dort fiel ihm sofort auf, daß die Müllmänner die leeren Tonnen wieder nicht an ihren Platz zurückgestellt hatten. Er würde mit dem dicken Gerd und seinem muselmanischen Kompagnon doch noch mal ein ernstes Wort reden müssen.
Seit sechs Jahren war Helmut Lotz nun Hausmeister. Nach einem schweren Arbeitsunfall, dessen Folgen es ihm ein für allemal unmöglich machten, wieder in seinen alten Beruf als Gerüstbauer zurückzukehren, hatte er diese Stelle angenommen. Keine schlechte Arbeit. Er verdiente zwar nur knapp ein Drittel von dem, was er damals, vor allem wenn er auf Montage mußte, mit nach Hause gebracht hatte. Dafür lebte er nun alleine, Miete zahlte er nicht, und er hatte genug Zeit, sich ab und zu auch noch ein paar Mark nebenher zu verdienen. Seine Alte hatte geglaubt, er würde nach der Scheidung total versacken – arbeitslos, ohne eigene Wohnung und ohne Halt. Denkste. Er war sein eigener Halt. Wer arbeiten konnte, fand auch Arbeit. Beziehungen mußte man haben und den Riecher für einen guten Job. Er konnte sich die Zeit einteilen, keiner machte ihm Vorschriften, er war sein eigener Herr.
Helmut Lotz begann seinen allmorgendlichen Rundgang durch die beiden Stockwerke. Es gehörte zu seinen Aufgaben, darauf zu achten, daß sich keine Fremden im Haus aufhielten, außer Kaffee- oder Teewasser nichts gekocht wurde und bei Abwesenheit der Mieter die Zimmertüren abgeschlossen waren. Der Pakistani schien wieder zur Arbeit zu gehen, da er auf das Klopfen an der Tür nicht reagierte. Im oberen Stock brannte wieder das Licht in der Toilette und nebenan, in der Dusche, hatte jemand ein Handtuch liegenlassen. Auch im Parterre war alles in Ordnung. Schließlich wußte Helmut Lotz, wie man diese armen Hunde anpacken mußte. Freundlich, aber bestimmt. Zwei Vorwarnungen, dann wurde mit der Hausverwaltung gedroht. Bisher hatte jeder gespurt. Die Sache mit dem Iraner, der gemeint hatte, er könne hier den Scheich spielen, gehörte schon lange der Vergangenheit an. Seitdem hatte keiner mehr versucht, aus seiner Bude ein Versammlungslokal zu machen. Ordnung mußte sein. Und Helmut Lotz hatte dafür zu sorgen, das war sein Job.
Die meisten der Mieter sprachen kaum Deutsch. Nun, es gab auch wenig zu bereden. Alles war geregelt. Andererseits war es ihm ein Rätsel, wie sie sich untereinander verständigten, außer natürlich, sie kamen zufällig aus ein- und demselben Land. Aber die Verwaltung achtete schon darauf, daß nicht mehr als zwei Vertreter einer Völkerschaft gleichzeitig hier wohnten. Ihm war es nur recht. Ausschließlich Neger oder Mohamedaner, das wäre langweilig geworden und vielleicht auch brenzliger. Man wußte ja nie, welche Stämme und Sippen bei denen gerade im Kriegszustand lebten. Er war mit der Mischung ganz zufrieden. Selbst ein ganzer Sack Thai-Mädchen hätte ihn nicht umstimmen können. Zu klein, zu still und keine Titten. Da lobte er sich schon die Madame aus der Tschechei. Nicht zu verachten, wie seine Annemarie, aber eben gut zwanzig Jahre jünger.
Helmut Lotz hatte den Heißwasser-Boiler im Parterre repariert und eine Stunde lang vergeblich versucht, seinen Kumpel Freddie zu erreichen, der ihm für morgen Abend die Koteletts und Würstchen mitbringen wollte. Er legte den Telefonhörer wieder auf, griff sich eine Tüte mit leeren Bierflaschen und ging über die Straße zum Wasserhäuschen am Sedanplatz. Heute Nachmittag würde er noch die „Ausländer-raus“-Schmierereien an der Hauswand überstreichen müssen.
Oliver Dörnberg war fleißig gewesen. Er hatte heute Morgen schon zwei Stunden an seinem Artikel gefeilt, eine Ladung Klamotten in die Waschmaschine gesteckt und mit seiner Mutter telefoniert, die in einem fast schon auf dem Land gelegenen Stadtteil wohnte. Das tat er jeden Dienstagmorgen; es hatte sich irgendwann einmal so ergeben. Natürlich hatte sie sich wieder beschwert, daß Oliver und Alex sich so selten sehen ließen, als wohnten sie wer weiß wo. Und außerdem mußte sie ihm unbedingt erzählen, daß die Klinger-Hütte, eine abgelegene Pension unterhalb des Feldbergs und seit Jahren an jedem Mittwoch Wanderziel der Eisenbahner-Witwen, vom Landkreis gekauft worden sei und demnächst als Flüchtlingsheim genutzt werden solle. Oliver hatte für den spontanen Unmut seiner Mutter Verständnis geäußert. Und schließlich hatte er noch einen Brief an einen alten Schulfreund, der seit zehn Jahren in Saint-Brevin wohnte, geschrieben. Wenn sich doch nur die Gelegenheit ergäbe und das nötige Geld vorhanden wäre, ja, dann würde auch Oliver sich in Richtung Loire-Mündung davonmachen.