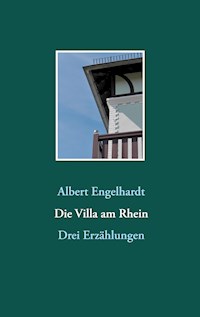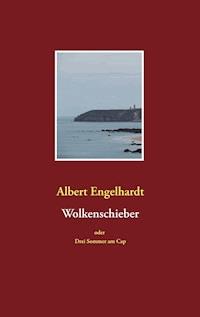5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zehn Geschichten über Momente voller Überraschungen. Über Augenblicke, die Wendepunkte markieren und Brüche mit sich bringen. In wenigen Minuten werden Jahre und Jahrzehnte bilanziert. Lebenslügen werden offenbar. Schweigen verdunkelt die Erinnerung. Neues Glück wird gefunden. Erzählt wird von unwiederholbaren Augenblicken, deren Einzigartigkeit verfliegt und die doch tiefe Spuren hinterlassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Aussortiert
Das Muschelessen
Zeit im Zug
Clara
Der Flötenspieler (Rue de Chabrol, 1970)
Das blaue Boot
Tränen des Glücks
Hau den Lukas!
Ein Abend am Margarethenufer
Linie 12
Editorische Notizen
Aussortiert
ICH BEMERKTE ES ERST NACH GUT ZWEI JAHREN. Und allein, dass diese sechsundzwanzig Monate vergangen waren, ohne dass ich es bemerkt hatte, gab mir zu denken. Die neue Zeit hatte ohne Aufheben begonnen. Zumindest in meinem Kleiderschrank.
Meine Wanderjacke musste ersetzt werden. Die Imprägnierung war dahin. Bereits im vergangenen Spätherbst und vor Ostern war ich bei Regen mit nassen Schultern von meinen Waldspaziergängen zurückgekommen. Auch waren die Ärmel abgestoßen, und der Reißverschluss kostete immer mal wieder Zeit und Nerven. Zwar hatte ich noch einen Anorak, den ich seit vielen Jahren ausschließlich im Dezember und Januar trug. Bei heftigem Schneefall, der in unserer Gegend selten vorkam, und immer wegen des starken Winds auf Langeoog, wo ich seit bald zwanzig Jahren zum Jahreswechsel zwei Wochen verbringe. Doch dieser Anorak taugte nicht für Temperaturen, die mit Mühe auf plus vier oder drei Grad fielen. Die Windjacke, ein dünner Blouson mit NYC-Initialen auf der Brust, hatte ich schon seit längerer Zeit nicht mehr getragen. Sie hatte in meinen Vierzigern gute Dienste geleistet. Das galt auch für den beim Kauf sehr teuren langen Mantel. Ein ausgesprochen schönes Stück. Vor zwanzig, ja noch vor zehn Jahren wärmte mich der Mantel, wenn ich als passionierter Bahnfahrer während einer Dienstreise auf zugigen Bahnsteigen auf und ab gehend den verspäteten Anschluss erwartete.
Ich räumte die Wanderjacke, die alle Hütten des Karwendelgebirges und der Ammergauer Alpen gesehen hatte, und den fadenscheinigen Blouson aus dem Schrank. Dazu den Anorak, den ich jedoch zur Seite legte. In einer Ecke kamen nun Kleidungsstücke zum Vorschein, deren Nochvorhandensein mich überraschte. An die ich mich jedoch schlagartig und mit Freude erinnerte. Die Jahre, in denen ich die völlig abgewetzte Lederjacke und den knielangen Trenchcoat (Kragen und Schulterstücke waren verschmutzt) fast täglich getragen hatte, lagen nun wirklich sehr lange zurück. Studentenkeller, Sit-ins, Demonstrationen tauchten vor meinen Augen auf. Am Revers der Jacke immer wieder ein neuer Button. Die Zeit der höheren Semester, des Examens und der ersten Anstellung war dann die Zeit des Trenchcoats gewesen – wie die Zeit des besseren Rotweins, der Rockjazz-Platten und der ersten Restaurantbesuche zu zweit oder viert.
Die Lederjacke passte mir noch in den Schultern, vor dem Bauch nicht. Der Trenchcoat war altmodisch weit, mit einem Gürtel, der geschnürt wurde. Im Ärmel steckten noch zwei Schals, damals sehr schick. In der Außentasche ein Feuerzeug. Lang lang ist’s her.
Das Ausräumen lag nahe. Sechs Anzüge (hellgrau bis dunkelgrau sowie ein sehr dunkles Blau), darunter zwei kaum getragene. Die Jacketts (zwei sandfarbene für den Sommer, eines davon ein sehr leichtes aus Leinen; die späten Achtziger ließen grüßen), ein dunkelblaues, eher festliches. Zwei Tweedjacken (eine uralte, eine nicht ganz so alte, beide in Glasgow erstanden). Dazu das Alle-Tage-Sakko, das ich gern im Büro trug, und das abgetragene aus Breitcord. Die in all den Jahren dazu gekauften Hosen – anthrazit, dunkelgrau, schwarz, zwei beige Brax – würde ich noch gebrauchen können. Die Levi‘s sowieso. Ich erinnerte mich und war froh, bereits vor mehr als fünfzehn Jahren die leichten und weiten Bundfaltenhosen (von bordeauxrot bis eigelbfarben) endlich in einem Kleidercontainer entsorgt zu haben.
Krawatten hatte ich in den letzten zwei Jahren meiner Berufstätigkeit nicht mehr getragen. Achtzehn Binder packte ich in eine Plastiktüte, dazu drei verbliebene Fliegen, die ich vor drei Jahrzehnten auf Bällen und zu anderen festlichen Anlässen trug. Der verstaubte Smoking hing in der äußersten Ecke des begehbaren Schranks.
ES WAR EIN LEICHTES. Sämtliche weißen, hellblauen, schwarzen (ja schwarzen!) und die dezent gestreiften Oberhemden, die als Anzug- oder zumindest Businesshemden getragen worden waren, wurden entsorgt. Der größte Teil landete bei Oxfam, wenige im Malteser-Container. Übrig blieben meine kleinkariert gemusterten (fast ein persönliches Markenzeichen) und die Flanellhemden, unzählige T-Shirts und ein Dutzend Piquéhemden. Mittlerweile bevorzugte ich im einen wie im anderen Fall die langärmligen.
Ich war auf dem Höhepunkt meiner beruflichen Karriere Divisionmanager und am Schluss, nun ja, fast zum Schluss Geschäftsleitungsmitglied gewesen. Die letzten drei Jahre überantwortete man mir Sonderaufgaben, deren Lösung Zeit hatte und die nicht weit oben auf der Agenda standen.
Ich ging zu den Standardveranstaltungen der Branche – Jahrestreffen, Messen, Verbandstage und so weiter – eigentlich nur noch, um meine Anwesenheit zu dokumentieren. Bei Vertragsverhandlungen, bei heiklen Absprachen der drei Branchengrößen, bei wichtigen Personalentscheidungen oder den Parlamentarischen Abenden (so nannten wir den offiziellen Teil der Lobbyarbeit) war ich nur noch der zweite Mann. Ich galt als kundig und umgänglich, und ich war mit meiner Rolle zufrieden.
Dies ging mir durch den Kopf, als ich meine diversen Aktentaschen, meine Stockschirme und mehr als einhundertdreißig USB-Sticks (meine ganz private Give-away-Sammlung) im Hausmüll verschwinden ließ. Die Badges von Konferenzen und Workshops, von Messen und Verbandstagen hatte ich bereits einem kleinen syrischen Jungen geschenkt. Er zeigte mir fast immer, wenn ich im Hinterhof zu tun hatte, die vielfarbige Sammlung der dazu gehörenden Schlüsselbänder. Ebenfalls mehr als einhundert. Ahmed sortierte sie mal nach den Anfangsbuchstaben der Unternehmen oder Veranstaltungen, ein anderes Mal nach Farben, nach der Länge der Bänder und manches Mal nach unergründlichen Regeln.
Hat jemand eine Vorstellung davon, wie viele Aktentaschen ein, sagen wir vereinfachend Managerleben begleiten? Bei mir waren es, nehmen wir die Stabsstelle und die folgende stellvertretende Niederlassungsleitung als Anfang der Karriere, immerhin neun. Beginnend mit dem damals so genannten Diplomatenkoffer in zweifacher Ausführung (schwarzes Kunstleder, angenehm weiches braunes Schweinsleder) über die voluminösen Pilotenkoffer (auch davon hatte ich zwei in Gebrauch), später die sandfarbene Bree-Tasche, in der man leicht zwei dicke Aktenordner unterbringen konnte oder notfalls den Kulturbeutel nebst frischer Unterhose, manchmal auch eine Flasche. In den letzten zehn Jahren dann die an Collegemappen erinnernden sehr teuren Stücke: The Bridge, Maxwell Scott, Buckle & Seam. Smartphone, Tablet, Pfefferminz, eine Kladde, Füllfederhalter. Business und Credit Cards.
Den Wagen hatte ich schon früher nicht oft benutzt. Morgens und abends, wenn ich den ganzen Tag im Büro zu tun hatte. Auch für Dienstfahrten in Orte, die abgelegen waren, was aber im Jahr selten, vielleicht drei oder vier Mal vorkam. Im Land war ich meistens mit der Bahn unterwegs, für Auslandsreisen nutzte ich das Flugzeug. Nur nach Genf und Mailand fuhr ich mit dem Audi A6, meine komplette Bergausrüstung im Kofferraum, da ich bei dieser Gelegenheit gern noch einige Tage in der Savoie bzw. an den norditalienischen Seen verbrachte.
ICH MUSSTE BALD EINGESTEHEN, dass die Trennung vom Büro auf der achtzehnten Etage, von zwei persönlichen Assistentinnen, von den Übernachtungen in exklusiven Hotels und den Dinnerpartys, von den President’s Cards der Fluggesellschaften leichter fiel als der Abschied von meiner Tätigkeit selbst, von strategischen Aufgaben und akutem Stress. Auch die Golf- oder Segelwochenenden mit wichtigen Kunden, die Festspiele in Bayreuth und Salzburg, sogar die verrückten Tage in Avignon und das anstrengende Berliner Theatertreffen hinterließen eine kleinere Lücke als der Trott des Geschäfts und die Ödnis der To-do-Listen.
Obwohl ich, Sie wissen es bereits, die letzten Jahre schon äußerster Verantwortung und großer Bedeutung entledigt war, war es schwer, die über Jahrzehnte angesammelte Kompetenz, das Fachwissen, die Führungserfahrung und meine Branchenkenntnis einfach abzugeben. Abzugeben ist der falsche Begriff. Nicht mehr nutzen zu können, nicht mehr zum Vorteil der Company einsetzen zu können. Brachliegen lassen zu müssen. Ungenutzt und, was mir bei einem einsamen Glas Bunnahabhain schlagartig klar wurde, offenbar sogar unbenötigt. Zuschauen zu müssen, wie das Gewicht jahrelanger Berufspraxis und zahlloser bewältigter Herausforderungen schwand. Und mit ihm die Bedeutung der Erfolge und Verdienste.
Meine Empfindung war für Außenstehende, namentlich für Freunde, verwunderlich. Hatte ich doch bereits einige Jahre vor der Übernahme der Sonderaufgaben (Group Z stand im internen Organigramm und an meiner Tür) bereits von nachlassendem Ehrgeiz gesprochen. So sehr ich in früheren Jahren für Veränderung, ambitionierte Ziele und Wagemut plädiert hatte – ich war zu einer Zeit Innovations- oder Changemanager, als diese Begriffe noch unbekannt waren –, so wenig reizten mich plötzlich ungewohnte Vorfälle und Abläufe, ungewöhnliche Ideen und Vorschläge. Die rapide technologische Entwicklung, die kaum noch überschaubaren Veränderungen der Märkte, dazu die unheilvollen innen- und weltpolitischen Erschütterungen, all dies ließ leise den Wunsch wachsen, nichts möge sich zu unverhofft, zu schnell, zu tiefgehend ändern. Modifikationen, Anpassungen, Weiterentwicklung ja, aber doch nicht so.
Ich ließ mir bald nach dem Ausscheiden einen Drei-Tage-Bart, nach einigen Monaten einen Zehn-Tage-Bart wachsen. Stand mir gut. Eine meiner Assistentinnen, meiner ehemaligen, erkannte mich erst auf den zweiten Blick. Wir waren uns in einem Coffee-Shop begegnet. Sie meinte, begleitet durch ein Zwinkern und Lachen, der Bart gefalle ihr. Ich sähe, wenn sie das so sagen dürfe, gut aus. Ich blieb also dabei. Nur in den zwei, drei Sommermonaten rasierte ich mich wieder jeden zweiten oder dritten Tag. In der Regel dann, wenn ich sowieso aus der Dusche kam und einige Minuten mehr vor dem Spiegel verbrachte.
Selbstverständlich ging ich weiterhin alle fünf oder sechs Wochen zum Friseur, doch in der Zeit dazwischen sah kein Kamm, kein Fön und kein Gel mein Haar. Eau de Toilette – Saphire war über zwanzig Jahre meine Duftmarke gewesen – trug ich nicht mehr auf. Nach der Rasur etwas Balsam für empfindliche und alternde Haut. Das musste reichen.
Ich trug jetzt außergewöhnliche Brillen, was ich früher nie getan hatte. Meine Sehstärke war schließlich okay. Ich hatte mir aus einer plötzlichen Laune heraus Cowboystiefel gekauft, Schlangenleder, in Tucson handgefertigt, und damit an einem Barbecue-Abend ehemaliger Kollegen für Aufsehen gesorgt. Ich trage sie jetzt fast jeden Tag.
Ich habe eine Geliebte, Jahrgang 1960, Silberschmiedin. Sie wohnt am anderen Ende der Stadt. Wir sehen uns oft, aber nicht regelmäßig. Wir lassen uns treiben, ohne Ziel, ohne Anker. Wir entdecken uns selbst und gegenseitig neu. Sie behauptet, man könne sich gänzlich neu erfinden. Das macht mich froh.
Und sie hat Recht. Denn ich habe auch eine junge Freundin, die ich finanziell etwas unterstütze, und deren kleine Zwillinge mit mir einmal in der Woche auf den nahen Spielplatz gehen, im Sommer manchmal auch an den Badesee. Die Kleinen vergöttern mich, ihre Mutter schätzt die Hilfe. Das Spider-Tattoo am Hals ist ein Geschenk von ihr. Ich machte ihr zu meinem Siebzigsten eine große Freude, als ich das Geschenk annahm. Die drei wohnen im Hinterhaus, manches Mal ist ein junger Mann zu Gast, auch über Nacht. Ich überlege, die kleine Beinahe-Familie im kommenden Mai oder Juni in mein Cottage an der schottischen Westküste einzuladen.
Mittlerweile sind es fast fünf Jahre, dass ich hier in der Innenstadt lebe und die ehemalige Beletage eines über hundertdreißig Jahre alten Hauses am Fürstenplatz bezogen habe. Mein Penthaus im Quartier Twenty-One habe ich verkauft. Ich spende zwei Mal im Jahr, im Sommer und vor Weihnachten, recht ansehnliche Beträge an Naturschutzinitiativen und humanitäre Hilfsorganisationen. Ich lese viel, koche gern und mag kleine Abendgesellschaften. Gern verbunden mit einer Lesung. Ich bin Mitglied in einem Schachclub und engagiere mich in einer Freiwilligen-Initiative im Stadtteil. Wir unterstützen Wohnsitzlose. Donnerstags finden Sie mich im Hallenbad, am Montag auf der Finnbahn am Spitzköppel.
Drei Badehosen, funktionale Laufbekleidung (für den Sommer, Übergangstemperaturen und kalte Winter) nebst zwei Paar Laufschuhen habe ich mir zugelegt. Auch drei Trekkinghosen und verschiedene Rollis. In meinem Kleiderschrank ist genügend Platz. Basecaps, wo früher die Krawatten hingen. Eine Lederjacke werde ich mir zu Weihnachten gönnen, bin aber noch unentschieden, ob es eine Moto Guzzi-Motorradjacke oder eine englische Vintage-Fliegerjacke sein soll. Ein schicker italienischer Straßenanzug würde mir sicher auch gutstehen, hat mich meine Silberschmiedin wissen lassen. Dass ich seit geraumer Zeit zuhause, auch bei kurzen Gängen zum Kiosk oder Briefkasten, und im Cottage sowieso nur noch einfache, ausgebeulte Jogginghosen trage, nimmt sie hin.
Ich überlege, mir einen Hund anzuschaffen.
Das Muschelessen
WÄHREND DER WEITE STRAND im aufkommenden Dunkel schon zu versinken scheint, die entfernten Felsen nur noch als Schattenriss erkennbar sind und die nicht besonders hohen Wellen sich in einem eher milchigen Grau brechen, liegt der ferne Horizont in einem leuchtenden Gelb und Rot. Wie ein klar konturierter Feuerball verlässt die Sonne allmählich ihren angestammten Platz am Himmel. Kaum Schattierungen, kein Ausfransen der Ränder, keine Übergänge. Sie scheint ihren festen Fahrplan zu haben. Langsam, in einem stufenlosen Zeittakt nähert sie sich der schnurgeraden Linie, die weit draußen auf dem Meer Himmel und Erde trennt.
Dann scheint es ihr nicht schnell genug gehen zu können. Minute für Minute, schneller und schneller rückt der Moment des Eintauchens heran. Man möchte sie anhalten, für einen Moment wenigstens. Ein Zischen, Fontänen, brodelndes Wasser, schlagartig abkühlendes Gestirn. Alles hält man in diesen Momenten für denkbar. Dann der grußlose Abschied. Binnen Sekunden versinkt die immer größer werdende Kugel am Horizont. Ein letztes Nachleuchten. Dunkelheit. Das Kreischen der Möwen, aufkommender Wind, das leise Klingeln der Takelage am Strand liegender Segelboote. Ein Tag geht zu Ende.
An einem solchen Abend endete die Geschichte zweier Menschen, die viele solcher Sonnenuntergänge erlebt hatten. Sie zahlten an diesem Abend mit keiner geringeren Währung als ihrem gemeinsamen Leben. Während das verunsicherte Lachen des einen in dem Moment erstarb, als sich die breite Klinge eines Muschelmessers fünf Zentimeter links von der Wirbelsäule, genau unterhalb des Schulterblatts in den Rücken bohrte, konnte sich das Gegenüber ein Lächeln nicht verkneifen, als seine zitternde Hand das Messer ins Ziel führte.
***
ZWANZIG JAHRE ZUVOR waren sich Camilla Schilling und Thomas Backes zum ersten Mal begegnet. Zufällig. Wenn es auch absehbar gewesen war, dass sie irgendwann in diesen Wochen aufeinander treffen würden.
Camilla Schilling schnitt Rosen, als Thomas Backes den Weg durch den vorderen Garten hochkam. Der Kies knirschte unter seinen Füßen. Die Hausherrin schaute auf und grüßte den jungen Mann. Der schrak auf, als die Frau aus dem üppig blühenden Strauch trat und ihn ansprach. Seine Gedanken waren noch bei der morgendlichen Abiturprüfung, die er gut überstanden hatte. Oder doch schon beim Tennisspiel am Nachmittag, auf das er sich freute.
„Guten Tag!“
„Hallo. Feodora und Britta sitzen auf der Terrasse und erwarten dich, Thomas. Du bist doch Thomas?“
„Ja, Entschuldigung, Thomas Backes. Ich bin ein Schulkamerad von Feo und Britta.“
„Ich weiß, ich weiß. Schön, dich mal zu Gesicht zu bekommen.“
Ein hübsches Gesicht. Mit ihrer linken Hand, die wie die andere in langen Handschuhen steckte, wies die Frau schräg hinter sich. „Du kannst hier entlang gehen.“
„Danke.“
Thomas Backes schulterte seine Tasche mit dem Tennisschläger, ging an Feodora Schillings Mutter vorbei und verschwand um die Ecke. Den Duft der Rosen und den der Frau nahm er mit. Und ihren eigenartig freundlichen Blick.
BRITTA LAABS HATTE VON ANFANG AN eine böse Ahnung gehabt. Schon als sie Ende Februar Feo erzählt hatte, am Abend zuvor mit Thomas einen Schmuseblues nach dem anderen getanzt zu haben, bereute sie ihre eigene Mitteilsamkeit, ja Geschwätzigkeit. Denn sie hatte übertrieben. Nicht nur hinsichtlich der Zahl der gemeinsamen Tänze. Auch dass zwischendurch immer mal wieder Rockiges und sogar Punkiges aufgelegt worden war, hatte sie einfach übergangen. Dass Thomas Britta Komplimente gemacht hatte, zu ihrer neuen Frisur und ihrem Mini, war dagegen absolut wahr. Dass er – das Licht war aus, es lief The Healer – in ihre Ohrmuschel gezüngelt und sie etwas fester gepackt hatte, verschwieg Britta ebenfalls nicht.
Seit diesem Tag hatte Britta den Eindruck und noch mehr die Befürchtung, Feo sei an nichts mehr interessiert als an genau solch einem Abend mit Thomas. Das Eingeständnis traf sie unerwartet hart. Das war also Eifersucht. Und nicht genug: Sie war eifersüchtig auf Feo, auf ihre beste Freundin, die an jenem Abend nur deshalb nicht dabei gewesen war, weil sie ihre Mutter zu einer Theaterpremiere in Heidelberg hatte begleiten müssen.
Das war nun drei Monate her.
SEIT OSTERN „GING“ BRITTA MIT THOMAS. Darin waren sich die beiden einig. Und jeder, der dies wissen wollte, sollte es wissen. Britta war über beide Ohren in ihren Thomas verliebt. Sie suchte ihn auf dem Pausenhof, schrieb Briefe, die sie ihm am nächsten Morgen im Bus zusteckte, drängte ihn zu Spaziergängen am Fluss oder zum Wildpark.
Doch je mehr Zeit sie mit ihm verbrachte, desto öfter sprachen sie auch über Feo. Thomas fragte nach Feos Lieblingslehrern und von ihr gehassten Fächern – die beiden Mädchen waren ein Jahr jünger als er und gingen in die 12c –, nach Studienabsichten, nach Lieblingssongs. Natürlich auch danach, wie ausführlich sich die beiden Freundinnen über Jungs und über ihre „Erfahrungen“ austauschten. Über Letzteres schwieg Britta, vor allem darüber, dass Feo „es“ nach eigenem Bekunden bereits getan hatte – während ihres Halbjahres in Des Moines, Iowa. Britta selbst fieberte dem ersten Mal noch entgegen, erwartungsvoll, oft begierig, meistens ängstlich. Sie würde ihre Jungfräulichkeit demjenigen schenken, der mit ihr immer durch dick und dünn gehen und mit ihr bald nach Paris fahren würde.
Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, den sie nur als Omas Geburtstag kannte und der alljährlich im großen Familienkreis im Spessart gefeiert wurde, war Britta dann kalt erwischt worden. Beziehungsweise in den Tagen danach, als Feo berichtete, sie sei mit Thomas und einigen seiner Kumpel zum Oberberg gewandert. Man habe einen Heidenspaß gehabt, sei unterwegs sogar kurz, ganz kurz ins eiskalte Wasser des Stausees gesprungen. Nur Wolfi Krämer, Thomas und sie selbst hätten es gewagt. Nackt. Manche aus der Clique waren am frühen Abend mit dem Zug von Holzbach wieder nach Hause gefahren. Acht Leute – drei Mädchen, fünf Jungs – hätten jedoch in der Höllentalhütte übernachtet. Britta fragte nicht weiter nach, hatte sich dann aber auch bei Thomas erkundigt. Doch da sie ihre Furcht nicht zeigen und ihren Freund nicht verärgern wollte, beließ sie es bei indirekten und immer von einem beschämten Lachen begleiteten Fragen. Thomas machte sich einen Spaß aus Brittas unübersehbarer Eifersucht. Er gab keine genauen Antworten, provozierte lieber mit Andeutungen oder einem zwinkernden Schweigen. Sogar das Prahlen mit dem Sprung ins kalte Wasser verkniff er sich.
Seitdem strengte Britta sich an, nahezu jede freie Minute mit Thomas zu verbringen, was jedoch an Grenzen stieß. Ihr Freund musste sich auf die mündlichen Abiturprüfungen vorbereiten. Also trachtete Britta danach, jede freie Minute, die sie nicht mit Thomas verbringen konnte, an der Seite ihrer Freundin zu sein. Im Dolomiti