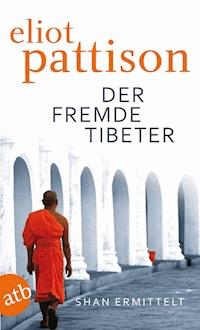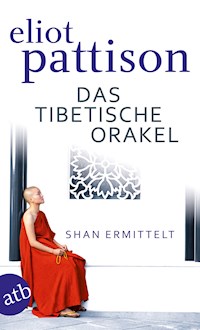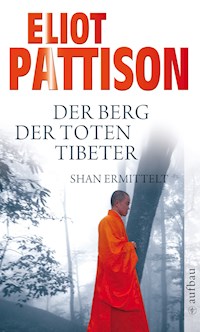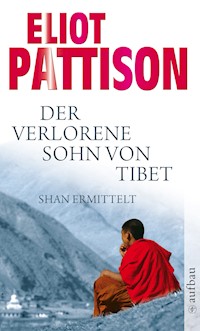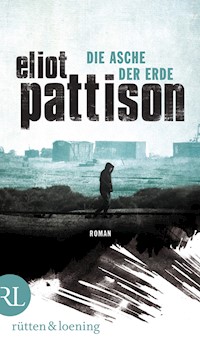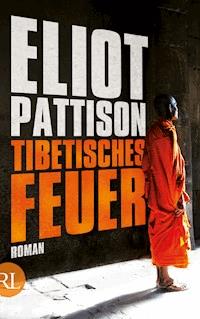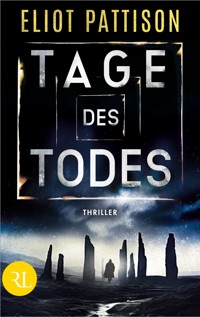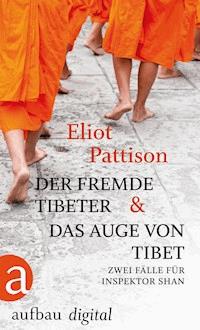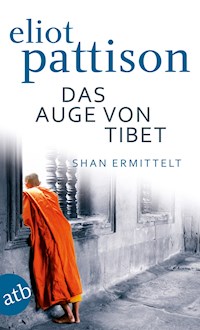
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspektor Shan ermittelt
- Sprache: Deutsch
Magisch und hochspannend - ein Roman, der die Seele Tibets einfängt.
Shan, ein ehemaliger Polizist, lebt ohne Papiere in einem geheimen Kloster in Tibet. Eigentlich wartet er darauf, das Land verlassen zu können, doch dann erhält er eine rätselhafte Botschaft: Eine Lehrerin sei getötet worden und ein Lama verschwunden. Zusammen mit einem alten Mönch macht Shan sich in den Norden auf. Er muß den Mörder der Lehrerin finden. Denn sollten die chinesischen Besatzer die Unruhe zu einer Polizeiaktion nutzen, wäre kein Kloster, kein Unterschlupf der Tibeter mehr sicher ...
"Mit diesem Buch hat sich Eliot Pattison in die erste Krimireihe geschrieben." Cosmopolitian.
"Der ideale Krimi für alle, die sich gern in exotische Welten entführen lassen." Brigitte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1060
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Eliot Pattison
DAS AUGEVON TIBET
Shan ermittelt
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Thomas Haufschild
Impressum
Titel der Originalausgabe
Water touching stone
ISBN 978-3-8412-0716-6
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Juli 2013
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die deutsche Erstausgabe erschien 2002 bei Rütten & Loening, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Copyright © 2001 by Eliot Pattison
Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Press, L. L. C. durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen, vermittelt
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Mediabureau Di Stefano, Berlin unter Verwendung eines Fotos von © Lorena Molinari/iStockphoto
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Für Barbara
Inhaltsübersicht
Cover
Impressum
Danksagung
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Anmerkung des Verfassers
Glossar der fremdsprachigen Begriffe
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne ...
Danksagung
Im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte haben zahlreiche Tibeter, Kasachen, Uiguren und Chinesen mich vertrauensvoll in ihre Geschichten eingeweiht und mir dadurch tiefe Einblicke in das Dasein der verschiedenen Völker gewährt, die auf dem Staatsgebiet des heutigen China leben. Ihnen allen bin ich für die vielen Informationen und Anregungen zu aufrichtigem Dank verpflichtet, doch aus naheliegenden Gründen müssen ihre Namen ungenannt bleiben.
Ferner bedanke ich mich bei Natasha Kern, Michael Denneny und Kate Parkin für die verläßliche Unterstützung und die weisen Ratschläge, mit denen sie mich sicher durch die Untiefen des Verlagswesens gelotst haben. Besonderer Dank gebührt auch Christina Prestia, Dr. Scott Pattison und Ed Stackler.
Am Ende dieses Buches findet sich ein Glossar der häufiger benutzten fremdsprachigen Begriffe.
Kapitel Eins
Alles in Tibet hängt mit dem Wind zusammen. Nur der Wind läßt die Gebetsfahnen und ihre Fürbitten gen Himmel flattern, nur der Wind bringt Kälte, Wärme und lebenspendendes Wasser über das Land, und nur der Wind versetzt sogar die Berge in Bewegung, indem er Wolken über die steilen Hänge treibt. Shan Tao Yun stand auf einem hohen Felsvorsprung, ließ den Blick in die Ferne schweifen und mußte an einen Lama denken, der einst zu ihm gesagt hatte, erst in Tibet werde die menschliche Seele sich ihrer selbst bewußt, denn hier wehe der Wind unaufhörlich über die Menschen hinweg und veranlasse sie, sich ihm und der Welt entgegenzustemmen, wodurch ihre Seelen definiert würden und an Konturen gewännen. Nach fast vier Jahren in Tibet glaubte Shan dem Lama. Es war, als würde hier, im höchstgelegenen aller Länder, der Planet unter Ächzen und Stöhnen seine Rotation beginnen, seine Bewegung erlernen und das Dasein der Menschen so schwierig wie nirgendwo sonst gestalten.
Die Lamas hatten Shan eine Übung gelehrt, die Windsuche hieß und der Erleuchtung diente. Erweitere dein Bewußtsein auf die Luft um dich herum, und lasse dich darin treiben. Vergegenwärtige dir die Welt, die sie mit sich trägt, und nimm ihre Botschaften in dich auf. Um die Reise sicher fortsetzen zu können, würden Shan und seine Begleiter noch mehrere Stunden bis zum Einbruch der Dunkelheit abwarten müssen, und so ließ er sich mit übergeschlagenen Beinen auf seinem Platz hoch über dem Tal nieder und begann mit der Meditation. Trocknendes Heidekraut, spürte Shan. Ein Falke, der weit über das Tal aufstieg. Der liebliche und zugleich scharfe Duft des Wacholders, verbunden mit einem Anflug von Schneekälte. Das ferne Geschnatter der Erdhörnchen auf den mit Felsen übersäten Hängen. Und plötzlich, im Norden, ein einzelner verzweifelter Reiter, der eine wallende Staubwolke hinter sich herzog.
Als Shan eine Hand an die Stirn hob, um das Licht abzuschirmen und die sich nähernde Gestalt besser beobachten zu können, ertönte hinter ihm ein kurzer Warnruf. Er drehte sich um und sah, daß Jowa, sein tibetischer Führer, auf einen alten Mann wies, der auf die Kante des Vorsprungs zuging und dabei unter der breiten Krempe seines braunen Huts hinaus ins Tal starrte.
»Lokesh!« rief Shan und sprang auf, um seinen alten Freund zu packen, der nicht einmal zu bemerken schien, daß Shan seinen Arm nahm. Der alte Tibeter blinzelte kopfschüttelnd und behielt den Blick unverwandt auf den Reiter gerichtet, der vom anderen Ende des Tals herannahte.
»Geschieht das wirklich?« fragte Lokesh zögernd, als würde er seinen Augen nicht trauen. Am Vortag hatten sie auf dem Kamm eines Hügels eine große Schildkröte erspäht, was als gutes Omen galt. Lokesh wollte ihr unbedingt ein Opfer darbringen und mußte sich später entschuldigen, denn als sie das vermeintliche Tier endlich erreichten, hatte es sich bereits wieder in einen Felsen verwandelt.
»Die Gestalt ist von dieser Welt«, bestätigte Shan und sah ebenfalls zum Horizont.
»Der Reiter hat Angst«, sagte Jowa hinter ihnen. »Er schaut immer wieder über die Schulter zurück.« Shan wandte den Kopf und sah, daß er ihr abgewetztes Fernglas hervorgeholt und auf den Fremden gerichtet hatte. »Wenn er so weitermacht, ist das Pferd bald tot.« Der Tibeter sah wieder seine Gefährten an und schüttelte den Kopf. »Jemand ist hinter ihm her«, sagte er beunruhigt und reichte das Fernglas an Shan weiter.
Shan erkannte, daß der Reiter eine dunkle chuba trug, den schweren Schaffellmantel der dropkas, der Nomaden, die das ausgedehnte Hochland im Nordwesten Tibets durchstreiften. Die Staubwolke hinter dem Pferd des Nomaden war so undurchdringlich, daß Shan keinen Hinweis auf einen Verfolger ausmachen konnte. Er suchte die Landschaft ab. In drei Richtungen ragten meilenweit nur schneebedeckte Gipfel in den klaren blauen Himmel empor und beschatteten die zerklüfteten grasbedeckten Hügel am gegenüberliegenden Ende des Tals. Weder auf der langgezogenen, vom trockenen Herbstgras braunen Ebene, die sich unterhalb von ihnen erstreckte, noch auf dem schmalen, ungepflasterten Pfad, den sie in der Morgendämmerung verlassen hatten, war außer dem einzelnen Reiter irgendein Lebenszeichen zu entdecken.
Shan blickte nach unten auf ihren verbeulten alten Lastwagen der Marke Jiefang, der etwa dreißig Meter abseits des Weges hinter einem großen Felsen versteckt stand, gab dann das Fernglas zurück und trat in den Schatten des Überhangs, unter dem sie nach ihrer nächtlichen Fahrt Zuflucht gesucht hatten.
Nach drei Metern, an der dunkelsten Stelle des Lagers, ließ Shan sich auf die Knie nieder. Neben der Asche des kleinen Feuers, in dem sie sich als einzige warme Mahlzeit des Tages Gerstenmehl geröstet hatten, steckte in einem winzigen Steinhaufen ein einsames Weihrauchstäbchen, und auf einer gefalteten Decke aus Yakfilz verharrte schweigend im Lotussitz ein Mann in einer kastanienbraunen Robe. Sein graues Haar war kurz geschoren, und sein schmales Gesicht wäre vielen Betrachtern vermutlich alt vorgekommen. Shan hingegen fiel beim Gedanken an Gendun niemals das Wort »alt« ein, so wie er auch nie auf die Idee gekommen wäre, die Berge als »alt« zu bezeichnen.
Der Lama hatte die Augen fast vollständig geschlossen und befand sich in einem Zustand, der für ihn dem Schlaf am nächsten kam. Während der Nacht, wenn sie in dem alten Lastwagen unterwegs waren, lehnte Gendun es rundheraus ab, sich zur Ruhe zu begeben, und auch bei Tag, wenn seine drei Begleiter rasteten, legte er sich nicht zum Schlafen nieder, sondern versank lediglich in tiefer Meditation.
»Rinpoche«, flüsterte Shan und sprach ihn damit als ehrwürdigen Lehrer an. »Wir müssen vielleicht vorzeitig aufbrechen. Es gibt Schwierigkeiten.«
Gendun ließ durch nichts erkennen, ob er ihn gehört hatte.
Shan schaute zu Jowa, der mit dem Fernglas abermals die Gegend hinter dem Reiter absuchte, und wandte sich dann wieder Gendun zu. Erst da bemerkte er, daß der Lama mit seinen Fingern ein mudra gebildet hatte, eines der Symbole zur Konzentration der inneren Kraft und gleichzeitig ein Ausdruck der Verehrung Buddhas. Die Handgelenke lagen über Kreuz, die Handteller wiesen nach außen, und die kleinen Finger waren verschränkt, um die Form einer Kette anzudeuten. Es war ein ungewöhnliches mudra, das Shan bei Gendun noch nie zuvor gesehen hatte. Der Name des Symbols lautete Seelenbezwinger. Shan erschauderte kurz und erhob sich dann, um wieder an Jowas Seite zu treten.
Der junge Tibeter blickte den Abhang hinauf, der hinter ihnen lag, als suche er nach einer Möglichkeit, den Berg hinaufzuklettern. Sie wußten beide, daß es für die Angst des Reiters wahrscheinlich eine ganz bestimmte Erklärung gab. Shan sah erneut zu ihrem Lastwagen. Sie konnten bloß hoffen, daß niemand das Fahrzeug bemerken würde. Es wäre wirklich mehr als ärgerlich, hier oben auf diesem abgelegenen Plateau erwischt zu werden, so kurz vor ihrem Ziel. Nicht nur wegen der Qualen, die ihnen beim Büro für Öffentliche Sicherheit drohten, sondern vor allem, weil sie damit Gendun und die anderen Lamas enttäuschen würden, von denen sie ausgesandt worden waren.
Lokesh seufzte. »Ich dachte, es würde länger dauern«, sagte er und berührte die Perlen, die an seinem Gürtel hingen. »Diese Frau«, fügte er geistesabwesend hinzu, »sie muß noch immer zur Ruhe gebracht werden.«
Zur Ruhe gebracht werden. Diese Worte führten Shan ein weiteres Mal vor Augen, wie verschieden sie alle waren und wie unterschiedlich sie die seltsame Aufgabe zu betrachten schienen, die man ihnen zugewiesen hatte. Shan war in ihrem gemeinsamen Bergrefugium von Gendun und einigen anderen Lamas aus seiner Meditationszelle gerufen worden. Die Männer hatten auf Kissen rund um ein knapp zweieinhalb Meter durchmessendes Mandala gesessen, das erst an jenem Nachmittag fertiggestellt worden war. Vier Mönche hatten sechs Monate an diesem detaillierten Lebenskreis gearbeitet, dessen Hunderte von komplizierten Figuren allesamt aus buntem Sand bestanden. In einer großen Kohlenpfanne hatte wohlriechender Wacholder gebrannt, und Dutzende von Butterlampen hatten die Kammer erhellt. Aus einem Raum unter ihnen war wie ferner Donner ein leises Grollen zu vernehmen gewesen. Es hatte von einer riesigen Gebetsmühle gestammt, die sich nur durch die vereinten Kräfte zweier starker Mönche in Drehung versetzen ließ. Eine Viertelstunde lang hatten sie sich in stummer Ehrerbietung auf das Mandala konzentriert, dann hatte Gendun, der dienstälteste Lama, das Wort ergriffen.
»Du wirst im Norden gebraucht«, hatte er Shan mitgeteilt. »Eine Frau namens Lau ist getötet worden. Eine Lehrerin. Und ein Lama wird vermißt.« Sonst nichts. Die Lamas interessierten sich kaum für den Rest der Welt und waren sehr zögerlich, etwas als Tatsache anzuerkennen. Gendun hatte ihm die grundlegende Wahrheit des Ereignisses verkündet; alles Weitere wäre den Lamas ohnehin nur als reines Gerücht erschienen. Gemeint hatten sie folgendes: Dieser Lama und die Tote mit dem chinesischen Namen waren für sie von entscheidender Bedeutung, und Shan sollte nun alle anderen Wahrheiten rund um diesen Mord herausfinden.
Shan hatte nicht gewußt, wie lange die Reise dauern würde. Als er weisungsgemäß an dem geheimen Durchgang erschienen war, der zurück in die Außenwelt führte, hatte er angenommen, er solle das der Einsiedelei am nächsten gelegene Dorf am nördlichen Ende des Tals von Lhadrung aufsuchen. Auch war ihm keinesfalls klar gewesen, daß Gendun beabsichtigte, ihn zu begleiten. Selbst als der Lama persönlich am Ausgang aufgetaucht war, hatte Shan zunächst geglaubt, sein Lehrer wolle ihn verabschieden. Dann jedoch hatte er Genduns Füße gesehen. Der Lama hatte unter seinem Gewand nicht etwa die üblichen Sandalen getragen, sondern schwere Schnürstiefel.
Sie waren bis zum Anbruch der Dämmerung gegangen und hatten Lokesh an der alten Hängebrücke getroffen, die das geheime Kloster mit dem Rest der Welt verband. Der alte Tibeter und Shan hatten sich herzlich umarmt. Während der gemeinsamen Haft im Arbeitslager von Lhadrung waren sie gute Freunde geworden. Dann waren sie zu dritt eine weitere Stunde gewandert, bis ein Lastwagen neben ihnen gehalten hatte. Shan hatte anfangs an einen reinen Zufall gedacht, an den Gefallen eines freundlichen Fahrers. Doch der Fahrer war Jowa gewesen. Gendun hatte sich zum erstenmal in der Nähe einer modernen Maschine befunden und das Fahrzeug mit großen Augen gemustert. Er hatte erst den Lastwagen gesegnet, danach Jowa und war eingestiegen. Jowa hatte Shan mit einem mißmutigen Blick bedacht, dann den Motor angelassen und war zwölf Stunden ohne Pause gefahren. Seitdem waren sechs Tage vergangen.
Shans Verwirrung hatte immer mehr zugenommen. Vergeblich rechnete er jeden Tag aufs neue mit ein paar klärenden Worten von Gendun. Lokesh dagegen schien nie am Zweck ihrer Reise zu zweifeln. Seiner Ansicht nach würden sie die tote Lehrerin zur Ruhe bringen, sich also an die Seele der Frau wenden und sicherstellen, daß sie ein Gleichgewicht erlangt hatte und zur Wiedergeburt bereit war. In seinen Augen mußte die Frau sich an ihren Tod gewöhnen, so wie auch die Lebenden sich nach einer folgenschweren Veränderung auf die neuen Umstände einstellen mußten. Genaugenommen war das eigentliche Problem nicht der Tod an sich, denn für Lokesh und Gendun stellten Tod und Geburt zwei Seiten ein und derselben Münze dar. Aber ein Tod, auf den man nicht angemessen vorbereitet war, konnte eine Wiedergeburt schwierig werden lassen. Als damals im Arbeitslager einer der Mönche durch einen Steinschlag ums Leben gekommen war, war Lokesh zehn Nächte hintereinander wach geblieben, um der unvorbereiteten Seele so lange beizustehen, bis sie erkannt hatte, daß sie sich um eine Wiedergeburt bemühen mußte.
Shan blickte ein weiteres Mal ins Tal hinunter. Der Reiter kam nach wie vor mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf sie zu und beugte sich nun weit nach vorn, als würde er den Boden absuchen.
»Womöglich ist es einer deiner Freunde«, sagte Shan zu Jowa, der früher selbst ein Mönch gewesen war, bis das Büro für Religiöse Angelegenheiten ihm die Lizenz zur weiteren Ausübung dieser Tätigkeit verweigert hatte. Jowa glaubte nicht, daß ihre Aufgabe darin bestand, eine Seele zur Ruhe zu bringen. Man hatte eine Lehrerin ermordet, und ein Lama war verschwunden; genau das wurde den Tibetern von den Chinesen ständig angetan. Nach Jowas Verständnis hatte man ihn und die anderen gegen einen Feind ausgesandt. Shan beobachtete, wie ihr Fahrer sich unbewußt über die tiefe Narbe strich, die von seinem linken Auge bis zum Unterkiefer verlief. Während der Jahre in Tibet hatte Shan zahlreiche solcher Männer kennengelernt. Er kannte ihre unerbittlich harten Blicke und die Art, wie sie sich umwandten, wenn ihnen auf der Straße ein Chinese begegnete. Er wußte, welche Narben die Truppen der Öffentlichen Sicherheit hinterließen, die verächtlich Kriecher genannt wurden und gerne mit Peitschen aus Stacheldraht auf unliebsame Demonstranten einprügelten. Zu den Häftlingen der Zwangsarbeitsbrigade, aus der Shan vier Monate zuvor entlassen worden war, hatten viele Männer wie Jowa gehört.
Allerdings war Shan bereits während des ersten Tages ihrer Reise klargeworden, daß sich mit Jowa noch eine weitere grundlegende Wahrheit verband. Als sie auf eine Gruppe von Reitern getroffen waren, denen der ehemalige Mönch verstohlen eine Parole zuraunte, woraufhin die Männer sie auf einen Pfad abseits der Straße nach Lhasa führten, hatte Shan begriffen, daß Jowa ein purba war, ein Angehöriger der geheimen tibetischen Widerstandsbewegung, die sich nach dem rituellen Dolch der buddhistischen Zeremonien benannt hatte. Statt dem Mönchsgelübde folgte Jowa inzwischen einem anderen Schwur, dem heiligen Versprechen, die verbleibende Zeit seiner gegenwärtigen Inkarnation dem Kampf zur Erhaltung Tibets zu widmen.
»Nein, das ist keiner von uns«, stellte Jowa fest. »So nicht«, fügte er rätselhaft hinzu. »Falls es Soldaten sind, gehe ich zu dem Lastwagen«, sagte er mit leiser, nachdrücklicher Stimme. »Ich werde die Flucht nach Süden ergreifen und die Verfolger auf mich ziehen. Gendun und Lokesh kommen nicht schnell genug voran. Ihr müßt weiter nach oben klettern und euch verstecken.«
»Nein«, sagte Shan und ließ dabei den Reiter nicht aus den Augen. »Wir bleiben zusammen.«
Lokesh setzte sich an den Rand des Vorsprungs und streckte die Beine aus, als würde die nahende Bedrohung entspannend auf ihn wirken. Er nahm seine mala, die Gebetskette, vom Gürtel und ließ die Perlen wie unbewußt durch die Finger gleiten. »Ihr zwei seid stark«, sagte der alte Mann. »Gendun braucht euch. Ich bleibe beim Lastwagen. Wenn die Soldaten kommen, ergebe ich mich und behaupte, ich sei ein Schmuggler.«
»Nein«, wiederholte Shan. »Wir bleiben zusammen.« Jowa war für ihn unverzichtbar, denn der Fahrer kannte sich in der realen Welt aus, der Welt der Kriecher, der Kontrollpunkte und Armeepatrouillen. Lokesh hingegen besaß unersetzliche Kenntnisse der anderen Welt, in der die Lamas lebten. Um an den Ort des Todes zu gelangen, mußten sie Jowas Welt durchqueren, doch dann, dessen war Shan sich sicher, würde er die Antworten in der Welt der Lamas suchen müssen. Lokesh wäre selbst ein Lama geworden, hätte sein Weg als Novize ihn nicht vor langer Zeit, noch vor der Invasion der Chinesen, aus seinem Kloster in den Dienst der Regierung des Dalai Lama geführt.
Shan sah, daß Jowa die Leinentasche abnahm, die über seiner Schulter und der dicken Wollweste hing, und dann die Hand um den Griff der kurzen Klinge an seiner Taille legte. Über den Priester in seinem Innern verlor Jowa kein Wort, doch am Lagerfeuer erzählte er bisweilen stolz von seiner Abstammung, die sich bis zu den khampas zurückverfolgen ließ, den nomadischen Hirtenstämmen des östlichen Tibet, die seit Jahrhunderten als furchtlose Krieger bekannt waren. Mittlerweile beobachtete Jowa nicht länger den Reiter, sondern die Staubwolke hinter dem Mann. Soldaten verfügten über Maschinengewehre, doch wie Tausende Tibeter vor ihm würde auch Jowa ihnen nur mit seinem Messer entgegenstürmen, falls das nötig war, um wahrhaftig zu bleiben.
»Aber der Weg«, sagte Shan auf einmal. »Wieso reitet er mitten auf dem Weg?«
Jowa trat an seine Seite und nickte langsam. »Du hast recht«, entgegnete er und klang dabei verwirrt. »Ein Nomade auf der Flucht würde als erstes die Straße verlassen.« Er vollführte eine ausholende Geste in Richtung der Wildnis, die jenseits des holprigen Pfades lag. Sie befanden sich auf der kargen, windumtosten Changtang, der riesigen leeren Hochebene, die sich über viele hundert Meilen quer durch Zentral- und Westtibet erstreckte und den Nomaden seit jeher als Versteck gedient hatte.
Lokesh neigte den Kopf und schaute nach Süden zum anderen Ende des Tals. »Er läuft nicht vor jemandem weg. Er läuft zu jemandem hin.«
Sie sahen den Reiter an dem Felsen vorbeigaloppieren, hinter dem ihr Lastwagen versteckt war. Der Mann kam wieder in Sicht und zügelte dann plötzlich sein Pferd. Während das Tier gemächlich einen Kreis abschritt, konzentrierte der Nomade seine Aufmerksamkeit auf den Weg.
»Ich dachte, du hättest die Reifenspuren verwischt«, sagte Shan zu Jowa.
»Das habe ich auch, zumindest für chinesische Augen.«
Der Fremde stieg ab und führte sein Pferd zu dem Felsen. Kurz darauf stand er neben dem leeren Fahrzeug. Nachdem er sein Reittier an der Stoßstange angebunden hatte, umkreiste er argwöhnisch den Wagen und stieg auf die hintere Kante der offenen Ladefläche, wobei er sich an einer der metallenen Streben festhielt, an denen bei Bedarf eine Plane verschnürt werden konnte. Er ging zu den Fässern, die dort standen, und hob die Deckel an. Dann sprang er wieder hinunter und musterte den oberhalb gelegenen Hang, der überwiegend mit losem Geröll bedeckt war. Zwischen den Felsen wand sich der einsame Ziegenpfad empor, den Shan und die anderen im Morgengrauen zu Fuß erklommen hatten.
»Manchmal haben die Soldaten tibetische Scouts«, sagte Jowa und berührte Shan an der Schulter, um ihn aufzufordern, sich in den Schatten des Felsüberhangs zu begeben.
Der dropka eilte nun mit schnellen Schritten den Pfad hinauf. Shan widerstand dem Impuls, Gendun auf die Füße zu zerren, um mit ihm den Bergkamm zu erklettern und zu verschwinden. Die beiden anderen konnten sich wenigstens irgendeine Rechtfertigung ausdenken, denn sie verfügten über gültige Papiere. Bei Shan und Gendun war die Angelegenheit komplizierter. Der Lama hatte sein ganzes Leben in völliger Abgeschiedenheit vom Rest der Welt verbracht und vor Shan noch nie einen Chinesen zu Gesicht bekommen. Für die Behörden existierte er überhaupt nicht. Shan dagegen wußte genau, was es bedeutete, ins Fadenkreuz der Funktionäre zu geraten. Er war ein ehemaliger Untersuchungsbeamter der Regierung, den man in ein tibetisches Arbeitslager verbannt hatte, und seine Freilassung war lediglich inoffiziell erfolgt. Falls man ihn außerhalb Lhadrungs ergriff, würde er als entwichener Strafgefangener gelten. Jowa stieß Shan zu Gendun in den dunkelsten Winkel des Verstecks und baute sich dann schützend vor ihnen auf. Seine Hand lag erneut auf dem Griff der Waffe.
Der Nomade erreichte den Vorsprung, auf dem sie sich verbargen, machte ein paar Schritte in die entgegengesetzte Richtung, drehte sich dann um und kam genau auf sie zu. Er gelangte zu dem Überhang, näherte sich dem Schatten und schirmte seine Augen vor dem Tageslicht ab, um einen Blick in die Höhle zu werfen. »Seid ihr da?« rief er laut und mit vor Angst bebender Stimme. Er war von schmächtiger Statur und trug auf seinem dichten schwarzen Schopf eine dreckige Fellmütze. Unter der chuba war ein verblichenes rotes Hemd zu sehen. Er legte den Kopf auf die Seite und kniff die Augen zusammen, als sei er sich noch immer unschlüssig, was dort vor ihm lauern mochte. Orte wie dieser dienten oft Raubtieren oder gar Bergdämonen als Behausung. Er blickte auf den nördlichen Teil des Weges zurück, als würde er dort nach etwas suchen. Dann legte er in einer demütigen Geste die Handflächen aneinander und tastete sich in die Dunkelheit voran.
»Wir beten für euch«, rief er laut und verängstigt und blieb dann mit erleichtertem Seufzen stehen, als Lokesh einen Schritt vortrat. Der Mund des Fremden verzog sich zu einem schiefen Lächeln, wie Shan zunächst meinte, bis er erkannte, daß der Mann ein Schluchzen unterdrückte. »Für eure sichere Reise.«
Lokesh war der bei weitem empfindsamste Tibeter, den Shan je kennengelernt hatte. Er trug seine Gefühle so mit sich herum wie andere Leute ihre Kleidung, völlig offen, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, etwas davon zu verbergen. Im Arbeitslager hatte einer der Mönche aus ihrer Baracke gesagt, Lokesh habe glühende Kohlen in sich, die immer wieder unvermutet aufloderten, sobald eine plötzliche Gemütsregung oder Erkenntnis sie anfachte. Wenn das geschah, stieß Lokesh unwillkürlich kleine Stöhnlaute aus oder kreischte sogar auf. Das Geräusch, das er nun von sich gab, glich einem langgezogenen hohen Wimmern, als habe er an dem Nomaden irgend etwas Furchterregendes erblickt. Gleichzeitig vollführte er mit der Hand eine abwehrende Bewegung vor der Brust, als wolle er etwas von sich weisen.
Jowa trat neben Lokesh. »Was willst du?« herrschte er den Fremden mit lauter Stimme an und versuchte gar nicht erst, sein Mißtrauen zu verbergen. Niemand hätte von ihrer Reise wissen dürfen.
Der Nomade sah den purba verunsichert an und machte dann einen weiteren Schritt auf sie zu. Im selben Moment wich Lokesh zur Seite, so daß der dropka sich auf einmal Auge in Auge mit Shan befand, hinter dem wiederum Gendun der Sicht des Fremden entzogen war.
»Ein Chinese!« stieß er erschrocken hervor.
»Was willst du?« wiederholte Jowa. Er trat hinaus in die Sonne und ließ den Blick über das ganze Tal schweifen.
Der dropka folgte Shan und Lokesh aus dem Schatten, lief einmal um Shan herum und wandte sich dann wieder an Jowa. »Du bringst einen Chinesen mit, um unserem Volk zu helfen?« fragte er in vorwurfsvollem Tonfall.
Lokesh legte Shan eine Hand auf die Schulter. »Shan Tao Yun war im Gefängnis«, sagte er strahlend, als wäre dies eine besondere Glanzleistung gewesen.
Die Wut in den Augen des Nomaden verwandelte sich in Verzweiflung. »Jemand würde kommen, hieß es.« Er flüsterte fast. »Jemand, der uns rettet.«
»Aber genau das macht unser Shan«, rief Lokesh aus. »Er rettet Menschen.«
Der Nomade zuckte enttäuscht die Achseln. Er schaute das Tal hinauf und schloß die rechte Hand um die Kette mit Plastikperlen, die an seiner roten Schärpe hing. »Früher, wenn Unheil drohte«, sagte er mit abwesender Stimme, als würde er nicht länger zu den drei Männern sprechen, »wußten wir, wie man einen Priester finden kann. Wir hatten sogar einmal einen echten Priester, aber die Chinesen haben ihn uns weggenommen.«
Der Ausdruck auf dem Gesicht des Nomaden war Shan in Tibet schon häufig begegnet. Es lag Trauer und Verwirrung darin. Außenseiter hatten der Welt dieser Menschen Schreckliches angetan, und der stolze, unabhängige tibetische Charakter konnte die daraus resultierende Hilflosigkeit nicht bewältigen. Shan folgte dem Blick des Fremden zurück zum oberen Ende des Tals.
Jemand tauchte zwischen den Staubschwaden auf, ein Reiter, dessen Pferd sich kurz vor dem Zusammenbruch zu befinden schien. Das Tier bewegte sich wankend und ungleichmäßig voran, als sei ihm vor Erschöpfung schwindlig.
»Als ich jung war«, wandte der Nomade sich nun in neuem, drängendem Tonfall an Lokesh, »gab es einen Schamanen, der die Lebenskraft eines Menschen zur Heilung eines anderen benutzen konnte. Manchmal opferten sich die Alten, um ein krankes Kind zu retten.« Er sah sich verzweifelt nach dem anderen Reiter um. »Ich würde meines mit Freuden geben, um ihn zu retten. Kannst du das tun?« fragte er und kam näher, um Lokesh ins Gesicht zu blicken. »Du hast die Augen eines Priesters.«
»Warum bist du hergekommen?« fragte Jowa erneut, allerdings nun weitaus freundlicher.
Der Mann griff unter sein Hemd und zog eine Schnur aus Yakhaar hervor, an der ein silbernes gau hing, eines jener kleinen Medaillons, in denen man ein Gebet nah am Herzen tragen konnte. Er legte beide Hände darum und sah wieder das Tal hinauf, nun jedoch nicht zu dem Reiter, sondern in Richtung der fernen schneebedeckten Gipfel. »Sie haben meinen Vater ins Gefängnis geworfen, und er ist gestorben. Sie haben meine Mutter in eine Stadt gesteckt, ohne ihr Lebensmittelmarken zu geben, und sie ist verhungert.« Er sprach ganz langsam, und sein Blick wanderte von den Bergen zu dem Boden unter seinen Füßen. »Sie haben gesagt, es würde für unsere Kinder nur in der Klinik ärztliche Versorgung geben. Also habe ich meine Tochter dorthin gebracht, als sie Fieber bekam, aber man sagte mir, die Medizin sei in erster Linie für die kranken chinesischen Kinder bestimmt, und so ist sie gestorben. Dann haben wir einen Jungen gefunden, und er hatte niemanden, und wir hatten niemanden, und so haben wir ihn als unseren Sohn aufgenommen.« Eine Träne glitt über seine Wange.
»Wir wollten mit unserem Sohn doch nur in Frieden leben«, sagte er, und seine Stimme erhob sich kaum über das Geräusch des Windes. »Aber unser alter Priester hat immer gesagt, es sei eine Sünde, etwas zu sehr zu wollen.« Er schaute mit leerer und trostloser Miene zu dem anderen Reiter. »Es hieß, ihr würdet kommen, um die Kinder zu retten.«
Bei diesen Worten lief ein Schauder über Shans Rücken. Er sah Lokesh an, der sogar noch tiefer ergriffen zu sein schien.
»Wir sind wegen einer Frau namens Lau hier«, erwiderte Shan sanft.
»Nein«, sagte der Nomade mit beunruhigender Gewißheit. »Es ist wegen der Kinder, damit sie nicht mehr alle sterben müssen.«
Auf dem Weg unter ihnen, etwa hundert Meter vor dem großen Felsen, stolperte das zweite Pferd heran und blieb dann stehen. Sein Reiter, der in eine dicke Filzdecke gewickelt war, sackte im Sattel zusammen und fiel wie in Zeitlupe zu Boden.
Der Reiter stieß ein Geräusch aus, das mehr als ein Stöhnen oder ein Angstschrei war. Es klang wie der Ausdruck tiefsten animalischen Leidens.
Shan lief los. Springend und strauchelnd eilte er den Hang hinab. Zweimal stürzte er dabei zwischen den Felsen schmerzhaft auf die Knie und landete schließlich auf allen vieren im dürren Gras. Als er aufstand, blickte er sich um. Keiner der anderen war ihm gefolgt.
Das erschöpfte Pferd stand zitternd da, seine mit blutigem Schaum verschmierte Nase berührte fast den Boden. Dicht neben ihm lag der in schwarzen Yakfilz gehüllte Reiter. Vorsichtig hob Shan einen Zipfel der Decke an und erblickte Dutzende von Zöpfen, in deren Enden jeweils eine Holzperle geflochten war. Bei gläubigen Frauen war dies eine althergebrachte Sitte: hundertacht Zöpfe und hundertacht Perlen, die gleiche Anzahl wie in einer mala. Die Frau atmete flach. Ihr Gesicht war mit Staub und Tränen befleckt. Ihr Blick zeugte von dermaßen großer Erschöpfung, daß sie Shan gar nicht wahrzunehmen schien. Unter der Decke, die sie wie einen Umhang trug, befand sich eine weitere Decke, in der ein längliches Bündel quer über ihren Beinen lag.
Shan drehte sich um. Jowa und Lokesh arbeiteten sich langsam den Pfad hinunter. Der Fahrer führte den Nomaden an einer Hand und Lokesh dreißig Schritte hinter ihm Gendun, als wären die beiden Männer blind.
Shan hob die zweite Decke und erstarrte. Darin lag ein Junge mit übel zugerichtetem Gesicht. Eines der Augen war komplett zugeschwollen. Langsam schlug Shan die Decke vollständig zurück. Ihm stockte der Atem. Überall war Blut, durchtränkte das Hemd und die Hose des Kindes.
Er wollte den Jungen samt Decke anheben, um die Frau von seinem Gewicht zu befreien, aber die Decke hatte sich in den Zügeln verfangen. Als Shan versuchte, das Durcheinander zu entwirren, stellte er fest, daß die Frau sich die Zügel um den Unterarm gewickelt hatte. Ihr Handgelenk war purpurrot angelaufen, und die Hand hing in unnatürlichem Winkel schlaff herab.
Also hob Shan den Jungen aus der Decke und legte ihn auf das trockene Gras. Der Mund des Kindes verzog sich, aber es blieb absolut stumm. Der Kleine war höchstens zehn Jahre alt und brutal mißhandelt worden. Quer über seinen Schultern hatte etwas das Hemd aufgeschlitzt. Er war bei Bewußtsein, und obwohl er starke Schmerzen verspüren mußte, lag er still und leise da und verfolgte mit seinem unverletzten Auge, wie Shan ihn untersuchte. Sein Blick verriet weder Angst noch Wut oder Schmerz. Er war bloß traurig und verwirrt.
Der Junge hatte sich gewehrt. Seine Handflächen waren von tiefen Schnitten durchzogen, also hatte er vermutlich die Waffe des Angreifers gepackt. Sein Hemd war am Hals aufgerissen, und einige Knöpfe fehlten. Auch die Brust des Jungen wies eine tiefe Wunde auf, die durch die Rippen gedrungen war und aus deren klaffender Öffnung dunkles Blut sickerte. Sein linkes Hosenbein war unterhalb des Knies zerrissen, und ihm fehlte ein Schuh.
Shan blickte erneut in das eine Auge, das ihn, ohne zu blinzeln, aus dem zerschmetterten Gesicht des Kindes anstarrte. Dann sah er auf seine Hände. Sie waren über und über mit dem Blut des Jungen bedeckt. Einen Moment lang wurde er von der eigenen Hilflosigkeit übermannt und beobachtete einfach nur, wie das Blut von seinen Fingerspitzen auf die braunen Grashalme tropfte.
Schließlich tauchte Lokesh neben ihm auf. Der alte Tibeter hatte einen der Schnürbeutel mitgebracht, in denen ihre Vorräte verstaut waren. Er holte daraus eine Plastikflasche mit Wasser hervor, hielt sie dem Jungen an den Mund und stimmte einen leisen, eintönigen Singsang an, dessen Silben Shan nicht vertraut waren. Bevor man ihn aus seinem gompa, seinem Kloster, in den Dienst des Dalai Lama nach Lhasa berufen hatte, war Lokesh bei einem Lama-Heiler in die Lehre gegangen. Während der Jahrzehnte im Straflager hatte er seine Ausbildung fortgesetzt, indem er andere Häftlinge behandelt und immer neue Kenntnisse von den alten Heilern erworben hatte, die gelegentlich hinter Gittern landeten, wenn sie andere Tibeter ermutigten, ihre Traditionen zu ehren.
Lokesh nickte der Frau zu, ohne die Litanei zu unterbrechen. Allmählich schienen seine Worte sie wieder ins Bewußtsein zurückzurufen. Als ihr Blick sich belebte und sie dem alten Tibeter ein gequältes Lächeln zuwarf, beugte Lokesh sich zu Shan herüber. »Ihr Handgelenk ist gebrochen«, sagte er leise. »Sie braucht Tee.«
Unterdessen hatte Jowa dafür gesorgt, daß Gendun neben dem Lastwagen im Gras Platz genommen hatte. Nun eilte er mit einem rußbeschmutzten Topf und einem in Leinen gewickelten Dungfladen herbei und entzündete daraus ein Feuer. Als der Topf auf den kleinen blauen Flammen stand, blickte Lokesh erwartungsvoll auf, und Jowa bedeutete Shan, ihm bei der größeren Decke zur Hand zu gehen. Vorsichtig befreiten sie die Frau aus ihrer mißlichen Lage. Dann folgte Shan dem Beispiel des Fahrers, stellte seinen Fuß auf eine der Kanten des langen Filzrechtecks und hob die gegenüberliegende Ecke an, so daß aus der Decke ein Windschutz entstand, wie Lokesh ihn benötigte, um das Kind genauer untersuchen zu können. Der alte Tibeter brach das heilende Mantra ab, nahm den linken Arm des Jungen, legte ihm die mittleren drei Finger seiner langen knochigen Hand auf das Handgelenk und schloß die Augen. So lauschte er mehr als eine Minute, ließ dann den Arm des Kindes sinken und wiederholte die Prozedur auf der rechten Seite. Sein Ziel war, die zwölf Pulse zu finden, auf denen in der tibetischen Medizin jede Diagnose basierte. Zum Abschluß betastete er zwischen Daumen und Zeigefinger das Ohrläppchen des Kleinen, schloß abermals die Augen und nickte langsam.
Der Junge sah ihm lediglich dabei zu, ohne zu blinzeln, ohne zu sprechen oder in irgendeiner Form den Schmerz auszudrücken, der ihn peinigte. Der Nomade kniete schweigend neben ihm; über sein dunkles, ledriges Gesicht rannen Tränen.
Lokesh beendete die Untersuchung und warf dem Jungen einen bekümmerten Blick zu. Als würde ihm nachträglich noch etwas einfallen, hob er langsam das zerrissene Hosenbein des Kindes an und betrachtete die Haut darunter. Der Hieb mit der Klinge hatte anscheinend nur den Stoff zerfetzt, aber das Bein nicht berührt.
»Wir dürfen nicht hier draußen bleiben«, warnte Jowa und sah sich nervös auf dem Pfad um.
»Es hätte uns alle das Leben kosten können«, sagte der Nomade mit hohler Stimme. »Es war der wandelnde Tod.«
»Du hast es gesehen?« fragte Shan.
»Ich habe die Schafe von der Weide geholt, und meine Frau hat das Lager aufgeschlagen. Als ich dort ankam, hörte ich auf einem unterhalb gelegenen Sims die Hunde bellen. Ich nahm eine Fackel und folgte dem Geräusch. Einer der Hunde war tot. Dann habe ich die beiden gefunden. Im ersten Moment dachte ich, sie wären ebenfalls tot.«
Jowa brachte der Frau einen Becher Tee. Sie schlug die Augen auf, hob die rechte Hand und verzog vor Schmerz das Gesicht. Jowa hielt ihr das Gefäß an den Mund und ließ sie trinken.
»Tujaychay«, sagte sie mit heiserer Stimme. Danke. Dann nahm sie den Becher mit ihrer unverletzten Hand und leerte ihn.
»Der Junge sollte von einer Quelle unten am Weg Wasser holen«, sagte sie, und ihre Stimme klang nun kräftiger. »Er hätte schon längst wieder da sein müssen. Ich konnte bereits die Schafe vom Berg kommen hören, und ich mußte doch unbedingt mit dem Kochen beginnen. Dann bellten plötzlich unsere Hunde, als würden sie einen Wolf verscheuchen wollen.« Jowa fing an, aus dem Leinenstoff eine Schlinge für ihren Arm zu fertigen. »Ich rannte los. Als ich auf einem Felsvorsprung ankam, sah ich zum erstenmal, wie das Ungeheuer Alta angriff. Es hatte sich auf seinen beiden Hinterbeinen aufgerichtet. Sein Fell sah aus wie das eines Leoparden. Ich lief schneller. Dann bin ich gestolpert und habe mir den Kopf gestoßen. Ich stand auf und rannte weiter. Als ich kam, drehte es sich um. Seine Vorderbeine hatten Klauen, die wie die Hände eines Menschen aussahen, und eine davon hielt ein Messer. Doch es ließ das Messer fallen und nahm einen glänzenden Stock, so lang wie der Arm eines Mannes. Es packte den Stock mit beiden Klauen und schlug mich, als ich die Hand hob. Ich stürzte, und meine Hand brannte wie Feuer. Dann kroch ich zu dem Jungen und warf mich über ihn. Das Ungeheuer kam auf uns zu und schwang den Stock, aber der Blitz hielt es zurück.«
»Der Blitz?«
»Im Norden. Ein einzelner Blitz. Eine Botschaft. Auf diese Weise sprechen die Dämonen miteinander«, sagte die Frau mit angsterfüllter Stimme. »Das Ungeheuer wich zurück. Dann wurde alles schwarz. Als ich wieder aufwachte, dachte ich zuerst, wir seien beide gestorben und in einer der dunklen Höllen gelandet, doch mein Mann war da und sagte, es sei inzwischen Nacht.«
»Haben Sie das Gesicht dieses Wesens gesehen?« fragte Shan.
Der Blick der Frau war unverwandt auf den Jungen gerichtet, der offenbar Alta hieß. Sie schüttelte den Kopf. »Das Ungeheuer hatte kein Gesicht.«
Diese Worte ließen Lokesh leise aufstöhnen. Shan drehte sich um. Der alte Tibeter hielt das Handgelenk des Jungen, starrte jedoch besorgt den Weg hinauf, als rechne er jeden Moment mit dem Auftauchen des gesichtslosen Dämons.
Shan beugte sich über das Kind. »Alta, hat es etwas zu dir gesagt? Wußtest du, wer das war? Es war ein Mensch. Es muß ein Mensch gewesen sein.«
Der Junge blickte ihn reglos an, und sein Auge wirkte wie ein harter schwarzer Kiesel. Er ließ durch nichts erkennen, ob er Shan gehört hatte.
»Es hatte die Gestalt eines Leoparden angenommen«, sagte die Frau. »Falls es wie ein Mensch aussehen will«, fügte sie unheilvoll hinzu, »verwandelt es sich eben in einen Menschen.«
»Es gibt eine alte Dämonin«, warf der Nomade beinahe geistesabwesend ein. »Hariti die Kinderfresserin. Manchmal wird sie sehr hungrig. Sobald sie erst mal getötet hat, kann sie nicht mehr aufhören.« Hariti war eine Dämonin des alten Tibet, wußte Shan. Früher hatten die Mönche ihr jeden Tag einen kleinen Anteil der Nahrung geopfert, um so ihre Gier auf Kinder zu besänftigen.
Shan betrachtete Lokesh, der wiederum den Jungen ansah. Der alte Mann legte dem Kind kurz eine Hand auf den Kopf, griff dann in seinen Beutel und holte einen Ledersack daraus hervor, in dem mehrere kleinere Behälter verstaut waren. Er öffnete drei dieser Säckchen, entnahm jedem eine Prise Pulver und gab dieses dann in den dampfenden Topf. »Gegen die Schmerzen«, sagte Lokesh. »Er hat sehr starke Schmerzen.«
»Was können wir tun?« fragte die Frau.
Lokesh warf Shan einen traurigen Blick zu und wandte sich dann zögernd wieder an die Frau. »Es gibt Worte, die gesprochen werden müssen.«
Der Satz schien die beiden dropkas wie ein Hieb zu treffen. Die Frau stöhnte auf und krümmte sich. Der Mann vergrub das Gesicht in den Händen. Es gibt Worte, die gesprochen werden müssen. Lokesh meinte die Riten zum Übergang einer Seele. Der verwirrte matte Blick des Jungen lag immer noch auf Shan.
Plötzlich keuchte die Frau erschrocken auf. Shan hob den Kopf und sah, daß sie über seine Schulter starrte. Dort stand Gendun und stellte in seinem Lächeln Buddhas umfassende Gleichmut zur Schau. Der Nomade stieß einen überraschten Schrei aus und verneigte sich, so daß seine Stirn das Gras zu Genduns Füßen berührte.
Shan begriff, daß weder der dropka noch seine Frau Gendun bislang bemerkt hatten. Vielleicht hielten sie ihn für eine Erscheinung oder glaubten, Lokesh habe ihn herbeigezaubert. Der Lama legte dem Nomaden eine Hand auf den Kopf und richtete ein kurzes Gebet an den Mitfühlenden Buddha. Dann wiederholte er das Ganze bei der Frau, die daraufhin etwas ruhiger wurde. Wir hatten sogar einmal einen echten Priester, hatte der Mann gesagt. Aber die Chinesen haben ihn uns weggenommen.
Gendun kniete sich neben den Jungen und nahm seine Hand. Dann kam Lokesh an seine Seite, und Gendun legte ihm die andere Hand auf den Kopf und segnete den Heiler. Schweigend musterte der Lama das Kind eine geraume Weile, derweil Shan begann, die Wunden zu waschen.
»Ich habe keine Gebete für den Gott dieses Jungen«, sagte Gendun schließlich mild und entschuldigend zu der Frau.
Sie warf ihrem Mann einen ängstlichen Blick zu. »Wir lehren ihn unsere Überzeugungen. Er hat eine mala.« Mit großer Anstrengung und unter offensichtlichen Schmerzen beugte sie sich vor und schob den Ärmel des Jungen nach oben. Verwirrt starrte sie auf sein nacktes Handgelenk. »Sie ist weg. Das Ungeheuer hat seine Gebetskette genommen.« Beschämt wich sie den Augen des Lama aus. »Es war sein Wunsch, nach den Lehren Buddhas zu leben.«
»Aber betet er noch in Richtung Sonnenuntergang?« fragte Gendun.
Die Frau sah zu Boden, als erfülle das Gespräch sie mit Furcht. Dann schüttelte sie langsam den Kopf. »Er hat gesagt, jener Gott habe den Tod seines Clans zugelassen.«
Shan war verblüfft. Der Junge war ein Moslem. Aber woran hatte Gendun das erkannt?
Anstatt den Kopf des Kindes zu berühren, hob Gendun nun sanft dessen Handrücken an seine eigene Wange. »Welcher Gott auch immer im Herzen dieses Jungen wohnt, ich werde dafür beten, er möge ihm Kraft geben, um den Schmerz der Gegenwart und Vergangenheit zu bewältigen, und Weisheit, um den vor ihm liegenden Pfad zu erkennen.«
Die folgende Stille wurde durch das Krächzen eines Raben unterbrochen. Als sie sich umwandten, sahen sie ihn oben auf dem Felsen sitzen. Der Vogel ließ die Menschen nicht aus den Augen. Der Nomade trat einen Schritt vor, als wolle er etwas zu dem Tier sagen, schaute dann jedoch zurück zu Gendun und blieb stumm, als könne der Lama damit nicht einverstanden sein.
»Wir müssen aufbrechen«, sagte Jowa stockend und mit einem unschlüssigen Blick auf den Nomaden. »Nach Norden. Ins Kunlun-Gebirge.«
»Diese Leute brauchen Hilfe«, protestierte Shan.
»Ja, geht nach Norden«, sagte der dropka und nickte energisch. »Wir haben von den Morden gehört. Deshalb sind wir ja über die Berge geflohen. Es hieß, ihr würdet dorthin reisen, um die Kinder zu retten.«
Jowa war die Ungeduld deutlich anzumerken. Shan begriff, was in ihm vorging. Der Fahrer wußte, daß die dropkas in diesem entlegenen Winkel Tibets in einer Welt des Aberglaubens lebten, die sich nur wenig von der Zeit vor dem Buddhismus unterschied, als noch Schamanen das Land regiert hatten. Dem Jungen war etwas Schreckliches zugestoßen, aber solche Leute würden sogar hinter einem Steinschlag einen wütenden Dämon vermuten, und eine menschenähnliche Gestalt mit Fell konnte sich leicht als Wolf oder Leopard herausstellen. »Wir müssen uns um die getötete Lehrerin kümmern«, sagte Jowa.
Der Nomade nickte erneut. »Um Lau«, sagte er. »Unser Alta ist einer ihrer Schüler.«
Lokesh zuckte zusammen und sah Gendun an. »Lau war die Lehrerin dieses Jungen?« fragte der Lama.
»Er gehörte zur zheli.« Der Mann nickte. »Lau hat uns mit ihm bekannt gemacht, als wir sagten, wir wollten den Kindern helfen.« Bei diesen Worten sah der Nomade den Jungen an.
»Die zheli?« fragte Shan. Es war kein tibetisches Wort, obwohl der Nomade ansonsten tibetisch sprach.
Doch der Mann schien ihn nicht gehört zu haben. Lokesh seufzte und flößte dem Jungen mehr Tee ein. Dann trug er das Kind an einen windgeschützten Fleck bei den Felsen, der von der Sonne beschienen wurde. Dort lauschte der alte Tibeter abermals dem Herzen, der Schulter und dem Hals des Kleinen und schüttelte zuletzt den Kopf. In seinen Augen standen Tränen.
Wortlos und hilflos saßen sie da, während das Licht im Auge des Jungen immer schwächer wurde. Einen schrecklichen Moment lang lag furchtbare Angst in seinem Blick, als sei ihm plötzlich sein Schicksal doch noch bewußt geworden. Er stieß ein Geräusch aus, eine einzige Silbe und dann nichts mehr. Es war womöglich der Anfang einer Frage oder eines Gebets. Vielleicht war es auch nur ein Ausdruck seiner Schmerzen. Aber es kam nichts hinterher, als habe die Anstrengung den letzten Rest seiner Kräfte aufgezehrt. Weinend drückte die Frau die Hand des Kleinen an ihre Wange.
Shan kniete neben Alta nieder und beugte sich vor, um irgendwie Trost zu spenden. Doch kurz darauf wich er wieder zurück. Er bekam kein Wort über die Lippen und war wie betäubt angesichts der eigenen Hilflosigkeit und der grausamen Mißhandlung, die der Junge erlitten hatte.
Auch über den Nomaden senkte sich ein hartes düsteres Schweigen. Immer wieder öffnete und schloß er den Mund, als wolle er etwas sagen, doch der überwältigende Schmerz hatte sich seiner Zunge bemächtigt. Endlich, als der Blick des Jungen sich auf den dropka richtete, fand dieser seine Stimme wieder und begann zärtlich von Frühlingsweiden zu erzählen, von bunten Blumen und jungen Vögeln auf den Südhängen. Es war eigentlich nichts Konkretes, nur schöne Erinnerungen aus ihrem gemeinsamen Leben. Das Antlitz des Kindes wurde ganz friedlich.
Jowa, dessen Gesicht ebenfalls von Kummer gezeichnet war, verließ sie und stieg auf die Felsen, um Wache zu halten. Gendun und Lokesh beteten. Der Nomade saß, über den Kleinen gebeugt, da und redete immer weiter, nahezu flüsternd. Und nach einer Stunde gab der Junge namens Alta ein langgezogenes leises Stöhnen von sich und starb.
Lange Zeit sprach niemand ein Wort. Schließlich wischte die Frau das Gesicht des Jungen ab und verbarg es unter der Decke.
»Nach dem Brauch seines Volkes«, sagte Shan langsam, weil er nicht sicher war, wie die Eltern reagieren würden, »sollte er vor Einbruch der Dunkelheit beerdigt werden.«
Der Nomade nickte, und Shan holte eine Schaufel aus dem Lastwagen. Während er das Grab aushob, sammelte die Frau Steine, um die Stelle durch einen kleinen Felshaufen zu markieren. Als der Junge dann in seiner Decke beigesetzt wurde, sprach Gendun mit sanfter Stimme ein buddhistisches Totengebet.
Der dropka harrte lediglich fünf Minuten an der Grabstätte aus, seufzte tief und ging dann, um die Pferde zu holen.
Shan half der Frau, die Steine am oberen Ende des kleinen Hügels aufzuschichten. »Es ist ein kasachisches Wort«, sagte sie und bezog sich dabei auf die Sprache eines der moslemischen Völker, die nördlich des Kunlun-Gebirges lebten. »Eine zheli ist ein Seil, das man zwischen zwei Bäume oder Pflöcke spannt, um daran die Stricke der Jungtiere anzubinden. So lernen die Kleinen einander kennen und gewinnen erste Eindrücke ihrer Welt. Lau hat mit diesem Wort ihren Unterricht für die Waisen bezeichnet, ihre ganz besonderen Kinder, denen sie Halt zu geben versuchte.«
»Ihr Mann sagte, wir seien gekommen, um die Kinder zu retten. Hat er damit die zheli gemeint?«
Die Frau nickte. »Als dieser andere Junge starb, wurde uns klar, daß wir fliehen mußten. Aber wir waren nicht schnell genug.«
Neben Shan stöhnte Lokesh auf und beugte sich vor. »Noch ein toter Junge?« fragte er bestürzt. »Noch einer von Laus Schülern?«
»Zuerst Lau«, sagte sie. »Dann ein kasachischer Junge in der Nähe von Yutian.«
»Kannst du dich an seinen Namen erinnern?« fragte Lokesh drängend. Shan sah seinen Freund verwirrt an. Es klang, als würde Lokesh an einen ganz bestimmten Jungen denken.
Die Frau schüttelte den Kopf. »Zur zheli gehören zwanzig, vielleicht fünfundzwanzig Kinder. Kasachen, Tibeter. Und Uiguren«, fügte sie hinzu und benannte damit die größte von Chinas moslemischen Minderheiten. Dann drehte sie sich um und nickte ihrem Mann zu, der die beiden Pferde brachte. Er hatte den Tieren die Sättel abgenommen und schaute nach Norden auf die schneebedeckten Gipfel des Kunlun. »Unser Alta war ein Kasache«, sagte sie leise
»Ein Lama«, richtete Shan sich an den Mann. »Haben Sie von einem vermißten Lama gehört?«
Der Nomade schüttelte den Kopf. »Es gibt hier schon seit vielen Jahren keine Lamas mehr. Alle vermissen sie«, sagte er. Anscheinend hatte er die Frage falsch verstanden. Sein Blick blieb auf die Berge gerichtet. »Ihr müßt euch beeilen«, fügte er auf einmal schroff, beinahe unfreundlich hinzu. »Der Tod geht weiter um. Eine Dämonin hat die zheli gefunden und wird nicht mit dem Morden aufhören.«
Shan starrte ihn schweigend an.
»Altas Seele ist in Gefahr«, fuhr der dropka fort und klang wieder so elend und verzweifelt wie zuvor. »Ein kleiner Junge wie er und dann so unvorbereitet.« Ein Windstoß fegte über sie hinweg und schien dem Mann die Worte von den Lippen zu reißen. Er hielt inne und sah Gendun an. Der Nomade befürchtete, die Seele des Kindes würde hilflos umherstreifen, da ihr jeglicher Halt durch Glaube oder Familie fehlte. Auf diese Weise wäre sie leichte Beute für alle Wesenheiten, die ihr hier draußen auflauern mochten.
Gendun erwiderte den Blick des Mannes einen Moment lang und sprach dann mit Jowa, der ihm ein Stück Leinwand und einen Bleistiftstummel brachte, dessen Ende er zuvor im Feuer geschwärzt hatte. Der Lama zog sich hinter einen abseits gelegenen Felsvorsprung zurück und begann unter Rezitation eines Mantras mit der Arbeit. Jowa hörte zu und beobachtete ihn eine Weile, holte dann einen alten Besen von der Ladefläche des Lastwagens, klemmte ein Ende unter eines der Räder und brach den Stiel ab.
Als Gendun zurückkehrte, legte er das Stück Stoff vor den Nomaden auf den Boden. Der Mann stieß einen Laut der Überraschung aus und hob den Kopf seiner Frau an, damit auch sie sah, was der Lama ihnen dort gebracht hatte. Unterdessen band Jowa die Leinwand an den Besenstiel. Es handelte sich um einen sehr alten und selten angewandten Zauber. Er bestand aus der Zeichnung eines Skorpions, in dessen Maul Flammen loderten. Aus den Schultern des Tiers ragten Dämonenköpfe hervor, zu deren beiden Seiten etwas geschrieben stand. Eine Bannformel gegen Dämonen, der durch die Worte eines Lamas Macht verliehen worden war.
Der Mann erhob sich und nickte feierlich. »Wir werden eine Ziege freikaufen, Rinpoche«, sagte er. »Unser alter Priester hätte uns bestimmt dazu geraten.« Durch den Freikauf eines zur Schlachtung vorgesehenen Tiers, das daraufhin zumeist mit einem Band am Ohr gekennzeichnet wurde, beschwichtigte man die Gottheiten, die vor den Buddhisten in Tibet geherrscht hatten.
»Dann solltet ihr das auch tun«, entgegnete Gendun ernst.
Jowa ließ den altersschwachen Motor des Lastwagens an und bog auf den Pfad ein. Shan beobachtete indessen, daß Gendun sich wieder hinter den Felsvorsprung zurückzog. Er folgte ihm und fand den Lama im Gras sitzend vor, die Augen nach Süden, in Richtung der Einsiedelei gewandt, in der er fast sein gesamtes Leben verbracht hatte.
»Ich fürchte, es hat bereits angefangen«, sagte der Lama und bedeutete Shan, neben ihm Platz zu nehmen. »Wir haben es betreten, aber wir kommen zu spät.«
»Was haben wir betreten, Rinpoche?« fragte Shan.
Gendun ließ den Blick über die Berge schweifen und seufzte. »Es hat keinen Namen«, sagte er. »Es ist die Heimat der Dämonen, die Kindern nach dem Leben trachten.«
Shan wußte, daß Gendun mit dieser Beschreibung keinen konkreten Ort meinte, sondern vielmehr von einer Geisteshaltung sprach, vom Bestandteil einer haßerfüllten Seele, der sich seinem Verständnis auf ewig entziehen würde.
»Es ist ein einsames Land.« Gendun betrachtete das windumtoste Plateau. »Hier wurde ich geboren.«
»Hier?« fragte Shan und folgte dem Blick des Lama. »Auf der Changtang?«
Unter allen verlassenen und abgeschiedenen Regionen Tibets war die Changtang-Hochebene die verlassenste und abgeschiedenste.
Gendun nickte. »Im Schatten des Kunlun-Gebirges. Aber als ich jung war, Xiao Shan, gaben meine Eltern mich zu den Mönchen, denn der Krieg brach über das Land herein, und die Mönche nahmen mich mit nach Lhadrung.« Xiao Shan. Gendun benutzte die alte chinesische Anrede für eine jüngere Person, wie es sonst vielleicht sein Vater oder Onkel getan haben würde. Kleiner Shan. Der Lama sah zu einer schwarzen Wolke, die über die Berghänge glitt und vermutlich einen Schneesturm mit sich brachte. »In meiner Erinnerung war dies eine glücklichere Gegend. Jetzt jedoch …« Der Lama wies auf den Pfad und seufzte. »Jetzt jedoch glaube ich, daß diese Straße uns an einen Ort führen wird, an dem du nicht sein solltest, Xiao Shan.« Es klang wie eine Entschuldigung. Gendun wollte damit andeuten, daß dermaßen viele Morde zwangsläufig das Interesse der Behörden wecken mußten. »Ich weiß, wie es um die Sache zwischen dir und den anderen Chinesen steht.«
Drei Tage zuvor hatte Shan Brennmaterial für ihr Lagerfeuer gesammelt und bei seiner Rückkehr gerade noch mitbekommen, daß Jowa dafür plädierte, ihn zurückzuschicken. »Er wurde nie offiziell entlassen, sondern hat lediglich die Erlaubnis erhalten, sich frei im Bezirk Lhadrung zu bewegen«, hatte der purba dem Lama erklärt. »Außerhalb von Lhadrung gilt er nach wie vor als Krimineller, als entflohener Strafgefangener. Die Soldaten können das überprüfen.« Als Gendun nichts darauf erwiderte, hatte Jowa die Stimme erhoben. »Man wird ihn hinter das Gefängnis führen und ihm dort eine Kugel in den Kopf schießen. Und wir anderen werden uns wegen der Beherbergung eines flüchtigen Verbrechers verantworten müssen.«
»Sollten wir alle uns demnach lieber von der Furcht gefangennehmen lassen?« hatte Gendun ihn ruhig gefragt und dann Shan zugenickt, der sich mit einem Arm voller Dungfladen genähert hatte.
»Das ist bloß die Art der Regierung, mir ihre Wertschätzung zu bezeugen«, hatte Shan mit gezwungenem Lächeln festgestellt und dabei an die Mönche und Lamas im Arbeitslager gedacht, die sich bisweilen bei ihren Aufsehern dafür bedankten, daß man sie einem so unerbittlichen Test ihres Glaubens unterzog. Damit hatte das Gespräch geendet, und Shan hatte den Gedanken verworfen, seinerseits Jowa darum zu bitten, Gendun nach Hause zu bringen. Ihm war bewußt, welches Schicksal ihm selbst drohte, falls er in die Fänge der Behörden geriet. Aber er wußte auch, was in einem solchen Fall mit Gendun geschehen würde, der nicht nur keine offizielle Identität besaß, sondern zudem gesetzeswidrig ein Priester war. Es gab spezielle Orte für Leute wie Gendun, Orte ohne Licht und Wärme, Orte, an denen manchmal medizinische Experimente vorgenommen wurden oder Psychiater im Auftrag der Partei bestimmte Techniken ausprobierten, um reaktionäre Priester in dankbare neue Proletarier zu verwandeln.
Ich weiß, wie es um die Sache zwischen dir und den anderen Chinesen steht. Gendun bezog sich nicht nur auf die physische Gefahr. Shan erinnerte sich an ihre letzte gemeinsame Lehrstunde, während der sie auf einem Felsen außerhalb der Einsiedelei gesessen hatten. Vier Monate lang hatte Gendun ihm erzählt, daß die Entlassung aus einem Gefängnis nicht automatisch die Freiheit bedeutete, denn schließlich hätten drei Jahre Sklavenarbeit seelische Narben hinterlassen, die nie mehr ganz heilen würden. Die größte Gefahr für Shan bestünde darin, sich wie ein Flüchtling zu verhalten, denn ein Flüchtling war nur ein Häftling ohne Zelle. Als der Lama dann vorsichtig durchblicken ließ, Shans größte Chance auf Heilung läge vermutlich außerhalb Chinas in irgendeinem anderen Land, hatte Shan ihm den zwei Monate alten Brief eines Beauftragten der Vereinten Nationen gezeigt, in dem man ihm politisches Asyl im Westen in Aussicht stellte, sofern er bereit sein würde, öffentlich über die Arbeitslager und Pekings systematische Vernichtung der Kulturgüter auszusagen. Vorausgesetzt, ihm gelang die Flucht aus China. Aber da ließe sich bestimmt etwas machen, hatte der purba gesagt, der den Brief zu ihm geschmuggelt hatte.
Nun streckte Shan die Hand aus, an der noch immer Altas Blut klebte. So sprachen sie oft miteinander, nicht mit Worten, sondern durch Gebärden und Symbole. Es sterben hier Kinder, sagte diese Geste, und Gendun nickte bekümmert. Falls Shan nun floh, würde es ihm niemals gelingen, den furchtbaren Anblick des sterbenden Jungen zu vergessen, der ihn stumm, verängstigt und verwirrt angestarrt hatte.
»Das einzig Konstante ist die Veränderung«, sagte Gendun. Dieser Satz war eine Art persönliches Mantra zwischen ihnen geworden, seit sie ganz am Anfang ihrer gemeinsamen Tage festgestellt hatten, daß diese Lehre nicht nur in Genduns buddhistisch geprägtem Leben eine Rolle spielte, sondern auch in den taoistischen Lektionen aus Shans Jugend auftauchte. Zusammen hatten sie erkannt, daß Shans Weg alles andere als gleichbleibend verlief und daß der verdorrte Geist, mit dem er aus China eingetroffen war, vorerst neue Wurzeln in Tibet geschlagen hatte, obwohl unter dem toten Holz noch so manche der alten Schößlinge verborgen lagen und sich mit den neuen Trieben verbanden.
Jowa drückte auf die Hupe des Lasters, doch Gendun schien es nicht zu hören. Shan sah, daß er die Hände fest verschränkt hatte, als würde er etwas in ihnen bergen.
Der Lama streckte die Arme aus, und als Shan ihm die eigene Hand entgegenhielt, ließ Gendun etwas hineinfallen. Eine Feder. Eine fünf Zentimeter lange Feder, die am unteren Ende ein zartes schwarzbraunes Muster aufwies, dann schneeweiß wurde und an der Spitze mit winzigen schwarzen Punkten übersät war, als hätte jemand sie flüchtig mit Tinte bestäubt. Fasziniert beobachtete Gendun, wie sie auf Shans Handfläche sank. Dann stand er auf und ging zum Wagen.
Jowa gab schonungslos Gas, als wäre ihnen jemand dicht auf den Fersen. Der uralte Lastwagen polterte durch Schlaglöcher, rutschte immer wieder in die tief ausgefahrenen Furchen des Weges oder mußte unter heftigem Rütteln plötzlich zum Stehen gebracht werden, wenn im Schein des Standlichts die Überreste eines Steinschlags vor ihnen auftauchten. Jowa weigerte sich, die Scheinwerfer einzuschalten, denn die Gebirgspatrouillen der Soldaten waren gelegentlich auch nachts unterwegs.
Shan hatte die Feder in dem gau verstaut, das er um den Hals trug. Während der Wagen sich weiter durch die Finsternis vorantastete, schloß Shan die Hand um das Medaillon und begann nachzudenken. Stellte die Feder einen Hinweis dar? Oder gar ein gutes Omen? Dann jedoch sah er wieder den sterbenden Jungen vor sich und verneinte die Frage. Wahrscheinlich sollte dieses Zeichen der Schönheit ihm lediglich etwas Halt geben, je näher er sich mit der Scheußlichkeit der Morde auseinandersetzen mußte.
Stunden später, nachdem Shan und Lokesh abermals einen Felsbrocken von der Straße gerollt hatten und wieder auf die Ladefläche des Lastwagens kletterten, gesellte Jowa sich zu ihnen und überprüfte die Fässer, die mit Seilen an dem metallenen Fahrzeugrahmen festgezurrt waren. Die meisten der Behälter enthielten Salz, das in den Lagerstätten des Zentralplateaus gewonnen wurde und in dieser Region schon seit Jahrhunderten zu den wichtigsten Handelsgütern zählte. Direkt hinter dem Führerhaus standen jedoch unter einer ölbefleckten Plane zwei leere Fässer verborgen, die Shan und Gendun als Versteck dienen sollten, falls sie auf eine Patrouille stießen. Dies war bereits ihr dritter Wagen, denn schon zweimal hatten sie ihren Weg durch das Gebirge nur auf dem Pferderücken fortsetzen können, jeweils geführt von Männern, die allein mit Jowa sprachen. Jeder der Wagen hatte ähnliche Salzfässer geladen, einschließlich zweier Attrappen mit sorgfältig präparierten, knapp zehn Zentimeter hohen und mit Salz gefüllten Einsätzen, die den Hohlraum vollständig tarnten. Lokesh und Jowa würden mit ihren Papieren vermutlich als Salzhändler durchgehen können, aber Shan und Gendun blieb nur die Möglichkeit, sich zu verstecken.
Jowa half, Lokesh in eine Decke zu wickeln. Obwohl auf den vorderen Sitzen genug Platz war, hatte der alte Tibeter sich im Verlauf der Reise fast jedesmal dafür entschieden, lieber hinten bei Shan zu bleiben. Während er sich mit dem Rücken an das Führerhaus lehnte, kehrte Jowa zum hinteren Ende des Fahrzeugs zurück. Dort hielt er einen Moment inne und stützte sich gegen eine der metallenen Streben.
»Kurz vor Sonnenaufgang werden wir jemanden treffen«, verkündete er durch die Dunkelheit.
»Wen?« fragte Shan.
»Jemanden, der uns dorthin bringen wird«, erwiderte Jowa in dem distanzierten, beinahe ablehnenden Tonfall, den er Shan gegenüber stets an den Tag legte.
»Wohin?«
»An den Ort, an den wir uns begeben müssen.«
Shan seufzte. »Du glaubst noch immer, ich würde nicht hierhergehören.«
»Man hat mir gesagt, ich solle dich herbringen, also bringe ich dich her.«
»Warum?«
Jowa stieß ein hohles, bitteres Lachen aus. »Für die alten Lamas gibt es kein Warum. Der Frau war bestimmt, ermordet zu werden. Dir war bestimmt, an diesen Ort zu kommen.«
»Nein, ich meine, warum du? Du hättest dich weigern können.«
»Ich kenne diese Gegend. Vor einigen Jahren habe ich hier oben dabei geholfen, die Armee zu beobachten.«
»Du hättest dich weigern können«, wiederholte Shan.
Diesmal dauerte es etwas länger, bis Jowa antwortete. Als er dann das Wort ergriff, klang seine Stimme sanfter. Nicht unbedingt freundlich, aber auch nicht abweisend. »Die Lamas werden alt. Ich weiß nicht, was ohne sie aus Tibet werden soll. In zwanzig, dreißig Jahren – wer wird dann in die Einsiedlerklausen steigen? Wer wird dann im Innern eines Berges leben, weil die Seele des Landes Hilfe braucht?«
»Du womöglich.«
»Nein. Ich nicht. Niemand wie ich. Die Chinesen haben mich auf einen anderen Weg geführt. Ich bin vom Haß vergiftet«, stellte er sachlich fest, als spräche er von einer körperlichen Beeinträchtigung. »Ich habe eine Waffe abgefeuert.« Er blickte zum Mond empor, und zum erstenmal glaubte Shan Traurigkeit auf dem Gesicht des purba zu entdecken. »Wie könnte ich je hergehen und mich in einen Berg setzen, wo ich doch eine Waffe abgefeuert habe?« Jowa hatte sich diese Frage offenbar schon viele Male gestellt. »Und wer bleibt sonst noch übrig?« Er sprang von der Ladefläche und verharrte im Mondschein. »Als man mir die Mönchslizenz entzogen hat und ich in den Untergrund ging«, sagte er, an den Mond gewandt, »war ich noch fest davon überzeugt, Tibets größtes Problem sei der mangelnde Widerstand. Es kam mir so vor, als würden wir uns jedem Konflikt dermaßen wortreich entziehen, daß wir am Ende für gar nichts mehr eintraten.« Er schüttelte den Kopf und schaute weg, in Richtung der dunklen Gipfel. »Heute …« Er zuckte die Achseln. »Im Gefängnis beschloß ich, wir seien wohl zu wenige, um offenen Widerstand zu leisten, und müßten uns daher auf den Schutz der Lamas beschränken und so unsere Traditionen dem Zugriff Pekings entziehen. Aber die Sache ließ mir keine Ruhe. Unsere Traditionen sind die Lamas, und die Lamas sind genauso sterblich wie wir anderen auch. Wir können versuchen, Peking aufzuhalten, aber die Zeit werden wir nicht besiegen. Falls die Lamas nicht überleben, falls das, wofür sie stehen, nicht weitergegeben wird, was für einen Sinn hat dann alles noch?«
Shan erkannte, daß Jowa ihm tatsächlich in gewisser Weise erklärte, weshalb er das ungleiche Trio auf dieser rätselhaften Mission begleitete. Im Mondlicht sah Shan ihn erneut die Achseln zucken. »Sie bitten uns so gut wie nie um etwas. Es ist unmöglich, einfach nein zu sagen.«
Doch Shan wußte, daß Jowa auch die tieferen Zusammenhänge durchaus begriff. Die Lamas taten nichts aus reinem Zufall. Sie hatten sich nicht an Jowa gewandt, weil er einen Lastwagen fahren konnte oder als Widerstandskämpfer mit dieser Region vertraut war. Sie hatten sich an ihn gewandt, weil er Jowa war.
»Dieser Nomade und seine Frau«, sagte Shan, als Jowa sich anschickte zu gehen. »Wie konnten sie über uns Bescheid wissen? Das alles hätte doch geheim bleiben müssen. Ich dachte, die Nachricht wäre durch die purbas nach Lhadrung gelangt, und niemand sonst hätte von unserer Reise erfahren.«