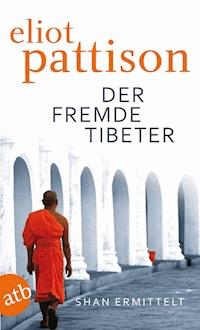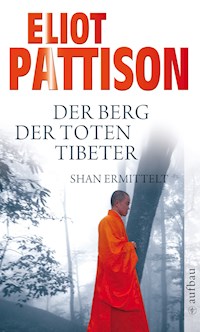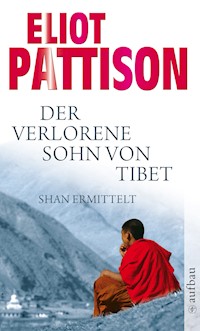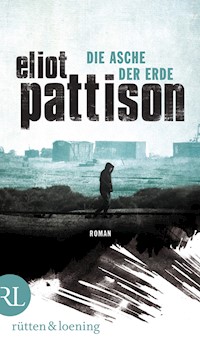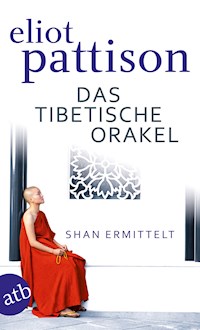
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspektor Shan ermittelt
- Sprache: Deutsch
Tief im Herzen Tibets geschieht ein ungewöhnliches Verbrechen.
Shan, ein ehemaliger chinesischer Polizist, muß den Mord an einem Mönch aufklären - und dafür sorgen, daß eine alte tibetische Prophezeiung sich erfüllt. Er soll einen heiligen Stein in den Norden bringen, doch plötzlich ist ihm die halbe Armee auf den Fersen - und eine geisterhafte Mönchsgestalt, die angeblich aus Indien zurückgekehrt ist, um den Widerstand der Tibeter gegen ihre Besatzer anzuführen ...
Eliot Pattison gelingt es, Grenzen zu überwinden - und seine Leser in ein Land voll rätselhafter Schönheit zu entführen, in dem die Menschen jeden Tag für die Hoffnung und gegen die Lüge und das Verbrechen kämpfen.
"Ein spirituelles Abenteuer, großartig erzählt. Ultimativer Mix aus Krimi und Kultur." Cosmopolitan.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1004
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Eliot Pattison
DASTIBETISCHEORAKEL
Shan ermittelt
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Thomas Haufschild
Impressum
Titel der Originalausgabe
Bone Mountain
ISBN 978-3-8412-0717-3
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Juli 2013
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die deutsche Erstausgabe erschien 2003 bei Rütten & Loening, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Copyright © 2002 by Eliot Pattison
Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Press, L. L. C. durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen, vermittelt
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Mediabureau Di Stefano, Berlin unter Verwendung eines Fotos von © Digital Vision/F1 Online
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Für meine Mutter
Inhaltsübersicht
Cover
Impressum
Karten
Danksagung
Erster Teil: Salz
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Zweiter Teil: Asche
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Dritter Teil: Stein
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Vierter Teil: Knochen
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Anmerkung des Verfassers
Glossar der fremdsprachigen Begriffe
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne ...
Danksagung
Viele der Informationen und Anregungen, die diesem Buch zugrunde liegen, verdanke ich den stillen, vertraulichen Gesprächen, die ich im Laufe der letzten zwanzig Jahre mit zahlreichen Tibetern und Chinesen führen durfte. Manche dieser Leute sind dafür ein beträchtliches Risiko eingegangen, und ich werde ihnen immer zu Dank verpflichtet sein. Für ihren weisen Rat und unerschütterlichen Rückhalt bedanke ich mich von ganzem Herzen bei Natasha Kern, Michael Denneny und Kate Parkin. Ein besonderer Dank gebührt außerdem Ed Stackler und Lesley Kellas Payne.
ERSTER TEILSalz
Kapitel Eins
»Siebe den Sand, um die Saat des Universums zu finden.«
Die Stimme, die durch die Nacht an Shan Tao Yuns Ohren drang, glich dem Wind, der über das Gras strich. »Laß sie den Ursprungsort erreichen, und pflanze sie ein«, sagte der Lama, während Shans Blick sich von dem weißen Sand in seiner hohlen Hand zu dem leuchtenden Halbmond hob. Er wußte, daß Gendun, sein Lehrer, Shans eigenen Ursprungsort meinte, das Brachfeld seiner Seele, das der Lama auch als Shans Ausgangspunkt bezeichnete. Doch in einer solchen Nacht konnte Shan sich einfach nicht des Eindrucks erwehren, daß Tibet selbst der wahre Ursprungsort war, daß das weite, entlegene Land den Anfang der Welt darstellte, wo der Planet – und die Menschen – niemals aufhörten, Gestalt anzunehmen, und wo die höchsten Berge, die stärksten Winde und die zerklüftetsten aller Seelen sich stets gemeinsam entwickelt hatten.
Drei Meter von ihnen entfernt saß Shans alter Freund und früherer Mithäftling Lokesh am Flußufer, ließ die Perlen der Gebetskette durch die Finger gleiten und sagte leise ein Mantra auf, das sich kaum vom Rauschen des Wassers abhob. Shan atmete den duftenden Rauch der Wacholderzweige ein, die sie mitgebracht und entzündet hatten, und sah eine Sternschnuppe über den fernen niedrigen Schimmer am Himmel fliegen, der als einziges Anzeichen darauf hindeutete, daß der Horizont von schneebedeckten Berggipfeln gesäumt wurde. Es schien, als könnte man mit ausgestreckter Hand den Mond berühren. Falls es auf der Erde einen Ort und eine Zeit gab, um Seelen wachsen zu lassen, dann gewiß das Hier und Jetzt: eine eiskalte mondhelle Frühlingsnacht im wilden tibetischen Hochland.
Wie aus einigem Abstand verfolgte Shan, daß Gendun sanft Shans Finger öffnete und seine Hand zum Mond emporhob, dann wieder senkte und schließlich umdrehte, so daß der Sand in das kleine Tongefäß fiel, das sie aus ihrer Klause mitgenommen hatten, die fünfzehn Kilometer entfernt lag.
»Lha gyal lo«, flüsterte eine Stimme auf Shans anderer Seite. Sie gehörte Shopo, dem Herrn der Einsiedelei, und zitterte vor Inbrunst. »Den Göttern der Sieg.« Sie waren bei Einbruch der Dunkelheit am Fluß eingetroffen, und erst jetzt, nachdem die Lamas und Lokesh zwei Stunden lang mit den nagas, den Wassergottheiten, gesprochen hatten, war Gendun zu dem Schluß gelangt, Shan solle anfangen, den besonderen weißen Sand einzusammeln.
»Lha gyal lo!« antwortete eine aufgeregte Stimme auf halber Höhe des Abhangs in ihrem Rücken. Es war einer der vier dropkas, der tibetischen Nomaden, die sie zum Fluß begleitet hatten und nun Wache standen und nervös die dunkle Landschaft beobachteten. Gendun und Shopo waren rechtlose Mönche bei einem verbotenen Ritual, und die Zahl der Patrouillen hatte in letzter Zeit deutlich zugenommen.
Ohne die Bewegung auch nur vorausgeahnt zu haben, tauchte Shan die Hand erneut ins Wasser, und als er sie herauszog, war sie abermals mit dem weißen Sand gefüllt. Im Halbdunkel sah er, daß Lokeshs Augen sich weiteten und erwartungsvoll funkelten, während Shan langsam die Bewegungen wiederholte, die Gendun ihm gezeigt hatte. Er wusch den Sand im Mondlicht und leerte dann seine Hand in das Gefäß.
Genduns Gesicht legte sich lächelnd in kleine Falten. »Jedes der Körner ist die Essenz eines Berges«, sagte der Lama, als er Shans Hand ein weiteres Mal ins Wasser tauchte. »Mehr bleibt nicht übrig, wenn der Berg seine Hülle abgelegt hat.« Shan hatte diese Worte im Verlauf der letzten beiden Monate bestimmt ein dutzendmal gehört. Immer wieder waren er und seine Gefährten in die Nacht aufgebrochen, um an Orten, die nur Shopo und die Hirten kannten, Sand einzusammeln. Jeder der hohen Gipfel am Horizont würde zu solch einem Korn reduziert werden, wenn der Zeitpunkt dafür komme, erläuterte Gendun, und genauso würde es allen Bergen, allen Kontinenten und allen Planeten ergehen. Alles würde enden, wie es einst begonnen hatte: als winziger Same, und das Menschengeschlecht in all seiner Herrlichkeit könne sich niemals mit der Macht vergleichen, die sich in einem einzigen Sandkorn spiegele. Die Worte sollten ihn das Wesen der Vergänglichkeit lehren, wußte Shan, und den nagas Respekt bezeugen, von denen sie den Sand entliehen.
Er vernahm ein fernes Trommeln, und der Mond schien sogar noch näher zu rücken, während Shan die nächste Handvoll Sand aus dem Fluß holte. Er streckte den Arm nach dem Gefäß aus, erstarrte aber mitten in der Bewegung, weil ein hektischer Aufschrei die Stille durchbrach.
»Mik iada! Vorsicht! Lauft!« Es war einer der dropka-Wächter auf dem Grat über ihnen. »Das Feuer! Löscht das Feuer!«
Shan hörte hastige Schritte auf dem Geröllhang und sah dort im Mondschein die Silhouetten zweier Männer, während er im selben Moment begriff, daß das Trommeln nicht nur in seinem Kopf existierte. Es war das Geräusch eines schnellen Helikopters im Tiefflug, wie es meistens dann erklang, wenn die Öffentliche Sicherheit tibetische Lagerplätze stürmte.
Einer der Posten, der eine schwarze Wollmütze trug, rannte zum Ufer, rüttelte vergeblich an Lokeshs Schulter, lief weiter zu Shan und zerrte ihn am Kragen. »Ihr müßt diesen Gott erneuern!« rief der Mann. »Laßt uns fliehen!«
Shan ließ sich auf die Beine ziehen, warf einen Blick in Richtung des Hubschrauberlärms und erschrak, denn die Lamas lächelten nur und bezeugten dem Fluß weiterhin ihre Ehrerbietung. Gendun und Shopo waren daran gewöhnt, für die Ausübung ihres Glaubens eine Verhaftung zu riskieren. Und obwohl Shan und der dropka wegen der immer häufigeren Spähtrupps beunruhigt sein mochten, war für Gendun nur ein einziges Mysterium von Belang: das Rätsel um die Formung und Stärkung der Seele.
»Falls das die Öffentliche Sicherheit ist, wird man Soldaten auf der Kammlinie absetzen und uns umzingeln!« stöhnte der Wächter und trat das kleine Feuer aus. »Sie werden Maschinengewehre haben und außerdem Geräte, mit denen sie in der Nacht sehen können.«
Shan nahm den Posten mit der schwarzen Mütze argwöhnisch in Augenschein, denn diese Bemerkungen über chinesische Waffen und Taktiken klangen nicht nach einem gewöhnlichen Hirten. Dann erkannte Shan auf einmal, daß er den Mann noch nie gesehen hatte und der Fremde gar nicht zu ihrer Eskorte gehörte.
Gendun hob einen Finger an die Lippen und deutete auf das Wasser. »Da sind nagas«, stellte er ruhig fest.
»Der Sand wird nichts nutzen, falls man euch verhaftet«, flüsterte Shan und legte Gendun die Hand auf die Schulter.
»Da sind nagas«, wiederholte der Lama.
»Es ist doch nur Sand«, widersprach der Fremde und schaute gequält in Richtung des Helikopters, der sich näherte. Die Öffentliche Sicherheit verfügte über ganz eigene Methoden, jemanden das Wesen der Vergänglichkeit zu lehren.
Während Gendun sich wieder dem Wasser zuwandte, stand Lokesh plötzlich an der Seite des Fremden und zog ihn von dem Lama weg. »Wir erschaffen mit diesem Sand etwas Wunderbares«, flüsterte der Alte, dessen weiße Bartstoppeln im Mondlicht glitzerten. Er legte dem Mann beide Hände auf die Schultern, um sicherzugehen, daß der junge Tibeter ihm zuhörte und ihn ansah. »Wenn wir fertig sind, wird es die Welt verändern.«
Der Mann mit der schwarzen Mütze schaltete eine Taschenlampe ein und richtete den Strahl auf Lokeshs Gesicht, als bezweifle er, den alten Tibeter richtig verstanden zu haben. Dann wurde der Rotorenlärm übermächtig laut. Der Fremde schaltete das Licht aus und warf sich zu Boden. Kurz darauf war die Maschine vorbeigeflogen. Sie hatte den Berggrat überquert, war aber zu schnell gewesen, um Soldaten absetzen zu können.
Der Mann mit der Mütze schaltete die Lampe wieder ein, murmelte etwas vor sich hin und warf einen anklagenden Blick auf die anderen Wachen, die sich mit einfältigen, beinahe peinlich berührten Mienen hinter Lokesh versammelt hatten. Nacheinander leuchtete er alle Gesichter ab und hielt schließlich bei Shan inne, um ihn stirnrunzelnd zu mustern. »Ihr sollt ein Artefakt abliefern«, sagte er zu Lokesh und klang dabei sehr ungeduldig. Die Lampe blieb auf Shan gerichtet.
»Das stimmt«, bestätigte Lokesh. »Wir treffen Vorbereitungen für die Reise.« Er wies auf die beiden Lamas, die immer noch zu dem dunklen Fluß sprachen.
»Vorbereitungen?« spottete der Mann. »Was habt ihr denn während der letzten beiden Monate getrieben? Ihr trefft keine Vorbereitungen, ihr schlagt Wurzeln! Ihr werdet noch alles zunichte machen!«
Shan trat neben Lokesh und drückte die Lampe des Mannes nach unten. »Die Überbringer des Artefakts waren einverstanden, daß die Lamas über die angemessene Art der Rückführung entscheiden würden.« Er wußte nun, daß der Fremde, genau wie diejenigen, die das heilige Artefakt in Shopos Einsiedelei gebracht hatten, ein purba war, ein Angehöriger der geheimen tibetischen Widerstandsbewegung.
»Du willst sagen, Drakte war einverstanden.«
»Drakte ist einer von euch«, stellte Shan fest. Er und Lokesh kannten Drakte seit fast einem Jahr. Damals hatte der Tibeter den Gefangenen des Arbeitslagers geholfen, in dem zu jener Zeit auch Shan und sein Freund ihre Strafe verbüßten. Vor zwei Monaten hatte Drakte sie unterwegs abgefangen und zu Shopos versteckter Klause geführt. »Wir werden aufbrechen, wenn die Lamas und Drakte dazu bereit sind. Er kommt, um uns den Weg zu zeigen. Höchstens noch ein paar Tage.«
»Wir haben keine paar Tage mehr«, klagte der purba. »Und rechnet nicht mit Drakte. Er hält seine Verabredungen nicht ein.«
»Wird er vermißt?« Shan registrierte auf Höhe der Taille eine Ausbuchtung unter der Jacke des Mannes und drehte sich zu Gendun um. Falls die Lamas glaubten, der Fremde trage eine Waffe, würden sie darauf bestehen, daß er seiner Wege ging.
Der purba zuckte die Achseln. »Er war nicht da, wo er sein sollte.«
»Und statt seiner bist du gekommen?«
»Nein. Aber ich habe gehofft, ihn in dieser Einsiedelei zu finden. Es gibt Neuigkeiten. Und ich habe etwas mitgebracht, worum er gebeten hatte. Er sagte, die Lamas würden es benötigen. Er sagte, falls wir nicht einwilligen würden, es zu holen, würde er eben selbst gehen, notfalls den ganzen Weg bis nach Indien.« Der purba ließ einen langen schmalen Sack von seiner Schulter gleiten und holte daraus eine knapp fünfzig Zentimeter lange Bambusröhre hervor, die Lokesh begierig in Empfang nahm.
»Was für Neuigkeiten?« fragte Shan.
Bevor der Mann antwortete, deutete er auf einen der Hirten und dann auf die Hügelkuppe, von wo aus die Wächter die jenseits gelegene Straße beobachtet hatten. Der dropka lief den Hang hinauf. »Ein Mann wurde getötet. Ein Beamter, in Amdo«, sagte er und bezog sich damit auf die einzige Ansiedlung dieser Region. Bis nach Amdo waren es ungefähr hundertfünfzig Kilometer. »Die Öffentliche Sicherheit wird das gesamte Umland absuchen und Leute in Gewahrsam nehmen. Im Zuge der Verhöre wird man von der Einsiedelei erfahren.« Er schaute, wiederum stirnrunzelnd, zu den Lamas. »Ihr nennt das, was ihr da tut, vielleicht heilig, aber die werden es ein Verbrechen gegen den Staat nennen.« Er machte einen Schritt auf Gendun zu, als wolle er noch einmal versuchen, ihn wegzuziehen, doch ein Nomade mit Schaffellweste trat vor und hob warnend eine Hand.
»Habt ihr auch nur die geringste Vorstellung davon, wie gefährlich das ist?« Der purba ballte und öffnete fortwährend die Fäuste. Er schien es mit ihnen allen gleichzeitig aufnehmen zu wollen. »Niemand hat uns davor gewarnt, daß ihr so leichtsinnig durch die Berge laufen würdet. Ihr könntet alle im Gefängnis landen. Und wofür? Man kann die Chinesen nicht mit Sand und Gebeten bekämpfen.«
Lokesh stieß ein heiseres Lachen aus. »Ich kenne die chinesischen Gefängnisse«, sagte der alte Tibeter. »Manchmal sind Sand und Gebete der einzige Weg.«
Der purba musterte Shan mit wütendem Blick. »Du bist der berühmte Chinese, der Tibetern aus der Klemme hilft. Du weißt es besser und läßt es dennoch zu.«
Shan sah zu Gendun und Shopo hinüber. »Falls diese Lamas darum bitten würden, daß ich mir Steine in die Taschen stopfe und mich in den Fluß stürze«, sagte er dann leise, »würde ich mich bei ihnen bedanken und hineinspringen.«
»Lha gyal lo«, flüsterte der dropka mit der Weste, als wolle er Shan anspornen.
Lokesh berührte den Krieger am Arm. »Wenn man noch so jung ist, fällt es schwer, diese Dinge zu verstehen. Du solltest mit uns zu der Einsiedelei zurückkehren und es mit eigenen Augen sehen.«
»Im Gegensatz zu Drakte befolge ich meine Befehle«, herrschte der Mann ihn an. »Ich werde anderswo gebraucht.«
Lokesh hielt die Bambusröhre hoch. »Dann sieh es dir jetzt an«, sagte er und zog eine aufgewickelte Stoffbahn aus dem Behälter. Als Lokesh sie entrollte, erkannte Shan, daß es sich um ein altes thangka handelte, eines der Stoffgemälde mit Motiven des tibetischen Buddhismus.
Der purba richtete die Lampe auf das Gemälde, verzog das Gesicht und wich einen Schritt zurück. Einer der dropka-Wächter stöhnte laut auf. Es war das von Schwertern, Speeren und Pfeilen umrankte Abbild eines grimmigen Dämons, um dessen Stierkopf eine Kette aus menschlichen Schädeln hing und der einen Kelch voller Blut hielt. Die abgezogenen Häute der Opfer lagen zu seinen Füßen. Lokesh betrachtete die Darstellung mit zufriedenem Lächeln und winkte den purba näher heran.
»Sieh genau hin«, sagte der alte Tibeter und wies auf den Kopf der furchteinflößenden Gestalt. »Das ist es, was wir tun. Auf diese Weise gewinnen wir, ohne Gewalt anzuwenden. So wird das Artefakt zurückgebracht, und so wird diese Gottheit erneuert. Denn dies ist es, was aus ihm wird.«
»Aus wem?« fragte der purba, dessen zornige Stimme inzwischen auch leicht verwirrt klang.
Shan glaubte im trüben Licht so etwas wie Überraschung auf Lokeshs Antlitz wahrzunehmen, als wäre die Erklärung ganz offensichtlich. Dann deutete der alte Tibeter von dem schädelbekränzten Dämon auf Shan. »Aus unserem Freund. Unserem Shan.«
Der Bann dieser Worte ließ den purba und die dropkas verstummen, und sie alle starrten Shan verunsichert an. Shan hingegen suchte in Lokeshs Miene nach einer Antwort, aber sein Freund lächelte lediglich erwartungsvoll zurück, als habe er Shan ein großes Geschenk gemacht.
Plötzlich zerriß ein weiterer verzweifelter Schrei die Stille. Der Posten kam hektisch den Abhang heruntergerannt. »Eine Patrouille! Kriecher!« rief er. Damit waren die Soldaten des Büros für Öffentliche Sicherheit gemeint. Der purba und Shan liefen zur Kammlinie hinauf und erspähten von dort aus einen Mannschaftswagen, der sich noch einen knappen Kilometer entfernt befand und langsam in ihre Richtung kam.
»Dieser Hubschrauber hat uns entdeckt«, sagte der purba. »Letzten Monat haben sie Infrarotgeräte benutzt, um einen alten Eremiten aufzuspüren, der nur nachts seinen Unterschlupf verließ, um zu beten.«
Unten am Fluß hatten drei der dropkas sich im Halbkreis vor den Lamas aufgestellt, als wollten sie den Kriechern mit ihren Knüppeln entgegentreten. Der vierte, der Mann mit der Schaffellweste, stand ein Stück abseits und starrte in das schwarze Wasser. Als der purba zielstrebig auf die Lamas zuging, fuhr der Hirte herum, stürzte sich auf ihn und stieß ihn zu Boden. Dann sprang er genauso abrupt wieder zurück. In seiner Hand lag eine große Automatikpistole.
»Du Narr!« zischte der purba. »Wir müssen sie wegbringen! Wir können uns nicht auf einen Kampf mit den Kriechern einlassen!«
Beschämt blickte der Nomade auf die Pistole. Er hielt sie sehr unbeholfen und hatte die Finger nur um den Griff gelegt, ohne den Abzug zu berühren. »Siehst du den Mann da drüben?« fragte er und nickte in Richtung Gendun, der immer noch mit dem Fluß sprach. »Meine Mutter lebt in dem Zelt bei der Einsiedelei. Sie nennt ihn den Lama des Reinen Wassers. Weißt du, warum? Nicht nur, weil die Mistkerle vom Büro für Religiöse Angelegenheiten ihm niemals etwas anhaben konnten, sondern weil er seine Gelübde schon vor mehr als fünfzig Jahren abgelegt hat, noch vor der Invasion. Bevor die Chinesen unser Land überfallen und für immer verändert haben. Er ist nie ins Exil gegangen, wurde nie gefangen. Seine Worte sind nicht vergiftet, sagt meine Mutter, denn sie entspringen einer Quelle, die die Chinesen nie entdeckt haben.« Der Mann sprach langsam und in ehrfürchtigem Ton, als habe er die Patrouille der Kriecher wieder vergessen. Hinter ihm knieten zwei der Hirten sich ans Flußufer und fingen an, Kieselsteine einzusammeln.
»Ich brauche meine Waffe«, knurrte der purba, der immer noch ausgestreckt am Boden lag. Shan sah, daß er Angst hatte. Traditionell denkende Tibeter haßten die purbas bisweilen ebensosehr wie die Chinesen. »Wir müssen die Lamas von hier wegschaffen.«
Der dropka schüttelte den Kopf. »Ich konnte nie etwas aus meinem Leben machen«, sagte er mit dumpfer Stimme. »Die Chinesen haben mich nicht zur Schule gehen lassen. Ich durfte nicht reisen. Ich konnte nie einen Beruf erlernen oder mir eine Anstellung suchen. Ich bin wie ein kleiner verkümmerter Baum, der nie wachsen wird, und er dort, der Lama des Reinen Wassers, er ist wie der hoch aufragende Überlebende eines Waldes, in dem alles andere dem Erdboden gleichgemacht wurde.«
Er schaute lächelnd zu Gendun und wandte sich dann wieder dem purba zu. Seine Miene verhärtete sich. »Ich will dir verraten, wie wir Männer wie ihn beschützen«, sagte er und warf die Pistole ins schwarze Wasser. Die beiden Hirten am Ufer standen auf, traten an seine Seite und zogen Schleudern aus ihren Taschen. »Wir haben von anderen gehört, wie man das macht. Wir werden ihre Suchscheinwerfer zerschießen und einen Steinhagel auf sie niedergehen lassen. Mit etwas Glück werden sie uns gar nicht sehen. Chinesische Soldaten sind nachts ziemlich schreckhaft. Sie haben Geschichten über Dämonen gehört.« Er warf einen Blick auf das thangka, das Lokesh immer noch in der Hand hielt, und dann auf Shan. »Die Lamas müssen das Gefäß füllen«, sagte er zu dem purba, »und danach begleitest du sie zurück. Mein jüngerer Bruder kennt den Weg.« Er deutete auf den vierten Nomaden. »Falls wir die Patrouille nicht aufhalten können, weißt du bestimmt am besten, wie man den Soldaten entkommt.«
Als der Mann die Schleuder hob, zitterte seine Hand. »Erneuert den Gott«, flüsterte er Shan zu. Dann verschmolzen er und seine Begleiter mit den Schatten.
Während Shan dem purba auf die Beine half, blickte dieser den Nomaden in die Dunkelheit hinterher, und auf seinem Gesicht spiegelte sich eine Mischung aus Wut und Respekt. »Dieses Artefakt«, sagte er tonlos. »Ich habe gehört, es handelt sich bloß um ein kleines Stück Stein.«
Die Ereignisse dieser Nacht gingen Shan während des langen Rückwegs zur Einsiedelei nicht mehr aus dem Kopf und beschäftigten ihn auch noch, als er sich ruhelos auf seinem Strohlager umherwälzte und vergeblich auf Schlaf hoffte. Kurz vor Tagesanbruch suchte er die lhakang auf, die heilige Stätte der Klause, und ließ sich mit übergeschlagenen Beinen vor dem Altar nieder. Darauf stand, flankiert von Butterlampen, ein rissiger hölzerner Buddha, vor dem ein gezacktes Stück Stein lag. Es war fünfzehn Zentimeter lang und besaß eine gekrümmte Oberfläche, in deren Mitte man einen verblaßten roten Kreis erkennen konnte, letztes Überbleibsel des dort einst aufgemalten Auges. Nur ein Stück Stein. Doch genau dafür hatten die dropkas letzte Nacht ihr Leben riskiert. Genau deswegen wurde laut Lokesh aus Shan ein Dämon, genau deswegen waren die purbas so verärgert, daß Shan und seine Freunde noch in der Einsiedelei verweilten, und genau deswegen hatten sie überhaupt erst solche Anstrengungen auf sich genommen, um Shan dorthin zu bringen.
Er und Lokesh hatten sich auf dem Rückweg von einer Pilgerreise zum südwestlich gelegenen Berg Kailas befunden, waren dabei abgeschiedenen Pfaden gefolgt und hatten manchmal sogar gewagt, sich für ein oder zwei Stunden von einem Lastwagen in Richtung Zentraltibet mitnehmen zu lassen. Eines Abends wurde der Laster, in dem sie saßen, plötzlich durch einen Pferdewagen gestoppt, den man quer auf die Straße gestellt hatte. Mehrere junge Männer sprangen zwischen den umliegenden Felsen hervor und rannten nicht etwa auf den Fahrer, sondern auf die Ladefläche zu und umringten Shan und Lokesh, bevor die beiden auch nur an eine Flucht denken konnten. Shan erkannte Drakte sofort wieder, einen hochgewachsenen schlanken Tibeter mit einer doppelt geschwungenen Narbe auf der Stirn. Die Verletzung stammte von einem Überfallkommando der Kriecher, das sich die Schlagstöcke mit Stacheldraht umwickelt hatte.
»Wir haben nach euch gesucht.« Drakte bedachte die beiden Männer mit einem verdrießlichen Blick, als wären sie ihm absichtlich aus dem Weg gegangen.
»Wir waren auf einer Pilgerfahrt«, erklärte Lokesh fröhlich. »Und nun kehren wir nach Hause zurück, nach Lhadrung.«
»Nein, das werdet ihr nicht«, widersprach der purba. Dann redete er kurz mit dem Fahrer und gab ihm eine khata, einen Gebetsschal. Der Mann fuhr weiter, und Drakte bedeutete ihnen, in einen kleineren Lastwagen einzusteigen, der hinter einem großen Felsen zum Vorschein kam.
Drei Tage lang rollten sie durch die zerklüfteten Berge und Täler nordwestlich von Lhasa, umgingen auf Straßen, die kaum mehr als ausgetretene Wildwechsel waren, die Stadt Shigatse, fuhren dann nordwärts durch kleine öde Dörfer und weiter auf die Changtang-Hochebene, bevor sie sich bei der Bergbaustadt Doba nach Osten wandten. Abends am Lagerfeuer sprach Drakte über seine geliebte Changtang und viele andere Dinge, aber niemals über den Anlaß oder das Ziel dieser Reise. Am vierten Tag wurden sie in einer Schlucht bereits von einem berittenen dropka mit zwei weiteren Pferden erwartet. Drakte sah Shan mit seltsam sehnsüchtigem Blick hinterher.
»Ihr tut dies für uns alle«, sagte der junge purba zum Abschied. »Wenn es soweit ist, werde ich kommen, um euch den Weg zu zeigen«, versprach er, und Shan glaubte, in seinen Augen so etwas wie Freundschaft aufflackern zu sehen.
Der Ritt dauerte zwei Tage. Auch der dropka verlor kein einziges Wort über ihren Bestimmungsort, bis sie schließlich einen hohen windumtosten Bergrücken erklommen und in einer kleinen Senke einige halbzerfallene Gebäude aus festgestampfter Erde und Steinen sahen. Drei der größten Bauten hatte man mit Sperrholz, Blechen und Pappe provisorisch wieder instand gesetzt. Im Innern des gedrungenen Steinhauses, das die lhakang beherbergte, stießen sie auf Gendun. Zusammen mit einem Lama mittleren Alters und einer Frau saß er am Altar vor dem gezackten Auge und las in langen schmalen Textblättern, den losen Seiten eines traditionellen Lehrbuchs. Gendun, den Shan zuletzt vor mehr als vier Monaten gesehen hatte, Hunderte von Kilometern entfernt im westlichen Kunlun-Gebirge, begrüßte ihn mit einem heiteren Lächeln und bedeutete den beiden Neuankömmlingen, sich auf die freien Plätze neben ihm zu setzen, als hätte man ihre Ankunft erwartet. Erst mehr als zwei Stunden später, während man ein Mahl aus gerösteter Gerste und Buttertee zubereitete, stellte Gendun ihnen Shopo und Nyma vor, eine stämmige Frau von etwa dreißig Jahren.
Nyma platzte sogleich mit einer aufgeregten Begrüßung heraus. »Wir haben so lange gewartet«, rief sie, »und nun seid ihr endlich gekommen. All diese Jahre.« Sie seufzte laut auf.
»Jahre?« fragte Shan verwirrt und musterte das ledrige Gesicht und die breiten Schultern der jungen Frau. In anderer Kleidung hätte er sie für eine dropka gehalten. »Die purbas haben uns erst letzte Woche gefunden.«
Die Nonne lachte und deutete auf die lhakang. »Es ist vor vielen Jahrzehnten verlorengegangen – es wurde gestohlen und als Trophäe außer Landes geschafft.«
»Das Auge?« fragte Shan, dem einfiel, was er auf dem Altar gesehen hatte. »Dieses abgebrochene Stück Stein?«
Nyma nickte begeistert und schaffte es kaum, ihre Gefühle zu bändigen. »Es stammt von der Gottheit, die unser Tal beschützt. Erst vor fünf Jahren ist es nach Tibet zurückgekehrt, und erst vor ein paar Wochen wurde es aus Lhasa befreit«, sagte sie, als habe der Stein sich im Gefängnis befunden. »Wir haben gewußt, daß er sein Auge zurückbekommen muß, und wir waren ganz sicher, daß es irgendwann heimkehren würde. Bislang konnte niemand ihm den Weg weisen. Jetzt haben wir euch. Was er alles sehen wird«, fügte sie unheilvoll hinzu. »Und was er dann tun wird!«
Nach dem Essen an jenem ersten Abend erklärte Shopo, daß drei Monate zuvor ein Orakel im Tal von Yapchi, wohin das Artefakt gehörte und wo bis zu diesem Zeitpunkt noch niemand von seiner Entdeckung wußte, verkündet hatte, das Auge könne nur von einem tugendhaften Chinesen zurückgebracht werden, einem ganz bestimmten Chinesen mit reinem Herzen. Als Gendun davon erfuhr, befand er sich auf dem Weg nach Lhadrung. Er änderte sofort die Richtung und machte sich auf die Suche nach den Deutern des Orakelspruchs, denn ihm war klar, welcher Chinese damit gemeint sein mußte.
Shan bedrängte die Lamas nicht mit Fragen. Die Geschichte von dem Stein mußte auf eigene Weise zum Vorschein kommen. Er hatte schon vor langer Zeit gelernt, daß es für die Dinge, die Tibetern am wichtigsten waren, meistens keine Worte gab, und selbst wenn sie Worte fanden, scheuten sie sich davor, diese auszusprechen. Für Leute wie Gendun und Lokesh stellten Worte tückische, unzulängliche Dinge dar, mit deren Hilfe die Menschen nur sehr dürftige Verbindungen knüpfen konnten. Falls das Auge tatsächlich eine große Bedeutung besaß, würde man Shan nicht über das eigentliche Artefakt belehren, sondern darüber, wie man es gedanklich erfassen sollte, wie sich das Auge in sein ganz persönliches Bewußtsein eingliedern ließ.
Seitdem waren viele Wochen vergangen, und Shan wünschte sich immer noch, er könnte es besser verstehen. Das Steinauge schien ihn zu verspotten und sprach auch weiterhin den Teil des alten Shan an, der einfach nicht sterben wollte, den Ermittler, der andauernd Fragen stellen mußte. Wieso waren die Tibeter gewillt, für diesen Stein zu sterben?
Draußen erklang eine aufgeregte Stimme, gefolgt von einer weiteren. Shan eilte sofort zur Tür. Die Frau, die sich mit ihrem Bruder um die Einsiedelei kümmerte, eine dropka mittleren Alters, stand oben auf dem Kamm und wies über die Gebäude hinweg zum gegenüberliegenden Hang. Einige der Nomaden, die in zweihundert Metern Entfernung ein Zelt aufgeschlagen hatten, waren in ihre Rufe eingefallen. Shan lief zur Rückseite des Hauses und entdeckte zu seiner Erleichterung eine vertraute Gestalt in einem langen braunen Gewand.
Es war Nyma. Sie hatte die Klause letzte Woche verlassen, um den besonderen zinnoberroten Sand zu holen, den man nur an einer bestimmten Quelle unweit der hohen Gletscher finden konnte. Auf ihrem Weg den Pfad hinunter drehte und wiegte Nyma sich die ganze Zeit. Sie glaubte sich unbeobachtet und tanzte. Sie tanzte vor lauter Freude, spürte Shan, weil sie den letzten Sand brachte.
Als die Bewohner der Einsiedelei sich wenig später im Kreis mit ihr niedersetzten und den Beutel Sand betrachteten, den sie vom Gletscher geholt hatte, konnte Nyma gar nicht mehr aufhören zu lächeln. »Der Bach war gefroren«, sagte sie, um zu erklären, weshalb die Reise einige Tage länger als erhofft gedauert hatte. »Also habe ich mich hingesetzt und gewartet.« Langsam und feierlich nahm sie mit beiden Händen den Hut ab, unter dem sie ihre Zöpfe auf dem Scheitel festgesteckt hatte, legte ihn zu Boden und verschränkte die Hände im Schoß. »Am zweiten Tag kam ein warmer Wind auf, und das Eis fing an zu schmelzen. Am dritten Tag öffnete sich genau vor mir ein Loch, gerade groß genug, daß meine Hand hindurchpaßte.«
Shan ließ den Blick über die drei Männer schweifen, die mit ihm hier saßen. Auf Lokeshs Gesicht lag das für ihn typische schiefe Grinsen, das nur deswegen schief war, weil der Stiefel eines Kriechers ihm vor vielen Jahren den Kiefer gebrochen hatte. Gendun lächelte und nickte erst Nyma, dann Shan würdig zu, als wolle er bestätigen, daß nun endlich die entscheidende Nacht bevorstand und daß ungeachtet aller Qualen im restlichen Tibet ihr kleiner entlegener Außenposten sich im Einklang mit dem Universum befand.
Neben ihnen saß Shopo in einer verschlissenen kastanienbraunen Robe, der hier in dieser illegalen Einsiedelei lebte, seit man ihn vor zwanzig Jahren aus seinem Kloster vertrieben hatte. »Alles hat sich gut gefügt«, stellte er heiter und gelassen fest. Nymas Sand war der perfekte Beitrag zur Vervollständigung der Arbeit und fiel dank der Achtung, die sie dem Berg erwiesen hatte, nur um so machtvoller aus. Sie hatte sich den roten Sand nicht einfach genommen, sondern abgewartet, bis das Eis geschmolzen war und der Berg ihr von sich aus den Zugang ermöglicht hatte.
Shopo nahm den Beutel und schüttete dessen Inhalt respektvoll in ein Tongefäß. Als er dieses emporhob, kam ein hochgewachsener Mann mit schmalem traurigem Gesicht um die Ecke des nächstgelegenen Gebäudes. Er trug einen großen Ledersack über der Schulter, in dem sich Yakdung befand, den er heute gesammelt hatte und der ihnen als Brennstoff diente. Sein Name lautete Tenzin; er war schon bei Shans und Lokeshs Ankunft in der Einsiedelei gewesen. Ausdruckslos starrte Tenzin das Tongefäß an, legte eine Hand an sein gau, das silberne Gebetsamulett, das um seinen Hals hing, nickte dann und ging weiter auf die Hütte zu, in der er das Brennmaterial lagerte.
»Lha gyal lo!« rief Shopo freudig gen Himmel. »Den Göttern der Sieg!« Er stand von der Decke auf, hielt das Gefäß sorgsam mit beiden Händen und brachte es in das niedrige Steinhaus, das ein halbes Dutzend Meditationszellen und die lhakang der Klause beherbergte. Shan und die anderen folgten ihm. Mit einer stummen Verneigung vor dem Buddha auf dem Altar an der Rückwand stellte Shopo das Gefäß auf ein Brett aus Zedernholz neben zehn gleichartige Tiegel und mehrere lange schmale Bronzetrichter. Dann wandte er sich mit ehrfürchtiger Miene dem vielfarbigen, mehr als zwei Meter durchmessenden Kreis in der Mitte des Steinbodens zu.
Man nannte es den Vajrabhairava, den Diamantenen Schrecken; es stellte eines der seltensten aller Mandalas dar, jener komplizierten Sandbilder, die seit Jahrhunderten Bestandteil tibetischer Rituale waren. Es hatte Shan zunächst eingeschüchtert, als Gendun erklärte, daß sie ein Wesen anrufen würden, das zu den wildesten aller tibetischen Gottheiten zählte. Nun beobachtete er, wie die dropka innehielt und das Gesicht verzog, als sie das alte thangka des Diamantenen Schreckens sah, das Lokesh in der lhakang aufgehängt hatte. Manch einer wäre wohl auf den Gedanken gekommen, Shan und seine Freunde hätten einen Pfad der Dämonen und der Zerstörung eingeschlagen, aber Shan hatte gelernt, daß grausige Bilder wie dieses von den Lamas als Symbole höherer Wahrheiten genutzt wurden, und verstand es inzwischen, in der Darstellung nicht etwa Gewalt, sondern Hoffnung zu erkennen. Der Diamantene Schrecken war eine Inkarnation der Weisheit, die letztere annahm, um den Herrn des Todes herauszufordern, wenn dieser einen Menschen zu sich holen wollte, der noch keine Erleuchtung gefunden hatte.
Anfangs hatten Shan und Nyma jeden Tag stundenlang zugehört, wie Gendun das komplexe Mandala Zentimeter für Zentimeter aus dem Gedächtnis beschrieb und gleichsam mit dem Mund nachmalte. Vor einem Monat hatten Shopo und Gendun dann schließlich mit Kreide ein verflochtenes Muster auf den Steinboden gezeichnet und damit die Grundlage für die weitere Arbeit geschaffen. Es war drei Jahrzehnte her, daß Gendun unter Anleitung eines neunzigjährigen Lama geholfen hatte, dieses besondere Bild anzufertigen, doch er konnte sich noch ganz genau an alle Einzelheiten erinnern. Das Mandala umfaßte Dutzende von Symbolen, die jeweils entstanden, indem man Sandkorn um Sandkorn langsam durch den chakpa rieseln ließ, den dünnen, knapp dreizehn Zentimeter langen Trichter. Jedes Bild, ja sogar jede Farbe war ein eigenes Symbol, und mit jedem Symbol war eine Lehre verknüpft. Shan betrachtete den sinnbildlichen Palast im Zentrum, der in vier kunstvolle Quadranten aufgeteilt war. Der weiße Osten enthielt das Rad des Dharma, der gelbe Süden wunscherfüllende Edelsteine, der rote Westen den Lotus der Reinheit und der grüne Norden ein brennendes Schwert.
Die Freude der Tibeter verlieh Shan neuen Auftrieb. Nach einer Viertelstunde ging er zu dem Kreis aus Erde auf einem Felsvorsprung oberhalb der Gebäude, in dem er während der vergangenen Wochen viele Stunden in Meditation zugebracht hatte. Gendun würde wollen, daß er an diesem letzten Tag über die Lehre des Sandes nachsann, aber Shan fühlte sich auf einmal viel zu lebendig, viel zu froh über die Gewißheit, daß er nach einem Leben voller Zerreißproben endlich seinen Platz auf dieser Welt gefunden hatte.
Er schaute den Wolken hinterher und ließ seine Zufriedenheit die Furcht zurückdrängen, die er im Angesicht des Steins verspürt hatte. Dann stellte er an sich eine ungewohnte Nervosität fest, weil heute abend nicht etwa er Genduns chakpa füllen würde, während der Lama das Mandala malte, sondern Gendun vielmehr den chakpa für ihn, damit Shan die Abbilder der Wolken und Berge am Rand des Kreises erschaffen konnte.
Stundenlang hatten die Lamas ihn gelehrt, wie er beim Auftragen des Sandes die Hände halten und seinen Geist konzentrieren mußte, bis Shan spürte, daß es weniger darum ging, ein Werkzeug zu benutzen, als vielmehr ein Gebet darzubringen. Danach hatten sie gemeinsam das Muster geübt, das Shan mit weißem Sand entlang des äußeren Kreisrands erschaffen würde.
»Folge dem Bogen, den eine Lerche im Flug beschreibt«, hatte Gendun erklärt und dabei den langen anmutigen Gleitflug zwischen zwei Flügelschlägen des Vogels gemeint. Als Shan daraufhin auf seltsame Weise aufgeregt und traurig zugleich wirkte, hatte der Lama seine Verwunderung zum Ausdruck gebracht.
»Es ist nichts«, hatte Shan geflüstert und die plötzlichen Erinnerungen wieder verdrängt. Sein Vater hatte einst fast die gleichen Worte benutzt, in nahezu identischem Tonfall von Vögeln, Weiden und dem Wind gesprochen und dabei mit seinem Pinsel Muster in die Luft gemalt, um Shan die ersten chinesischen Ideogramme beizubringen.
Unvermittelt begriff Shan, daß jemand neben ihm saß. Er wandte den Blick von den Wolken ab und schaute in Genduns gütiges Gesicht.
»Wir werden auf Berge steigen müssen«, stellte der Lama lakonisch fest. Er saß mit übergeschlagenen Beinen im Lotussitz, als wäre er aus einer Meditationszelle herbeigezaubert worden. Seine Worte stellten eigentlich eine Frage dar: ob Shan bereit sei, nicht etwa für das Mandala, sondern für die Reise, zu der sie im Anschluß aufbrechen würden und die überhaupt erst der Anlaß für das Mandala gewesen war. So wie andere Leute zur Vorbereitung einer beschwerlichen Fahrt Vorräte zusammenstellen und Landkarten studieren würden, hatten die Lamas Shan, Lokesh und Nyma systematisch mit Bildern des Diamantenen Schreckens gestärkt. Oder sogar, wenn man Lokeshs beklemmender Andeutung glauben durfte, Shan darauf vorbereitet, das Werk des Diamantenen Schreckens zu verrichten.
»Ich bin bereit für die Berge, Rinpoche«, sagte Shan und sprach ihn damit als ehrwürdigen Lehrer an.
Gendun musterte ihn mit funkelndem Blick. Meistens benötigten die beiden keine Worte, um sich zu verständigen. »Und du wirst nicht nur auf Dungfladen achtgeben müssen«, fügte der alte Lama hinzu.
Shan sah seinen Lehrer verwirrt an. »Ich dachte, Tenzin würde hierbleiben, Rinpoche«, sagte er. Tenzin hatte während der letzten zwei Monate kein einziges Wort gesprochen, doch sein bekümmertes, seelisch gebrochenes Gemüt kam Shan bekannt vor; ihm war nicht entgangen, daß die dropkas dem Mann geraten hatten, sich von den Straßen fernzuhalten. Er war aus dem Gulag geflohen, hatte Shan erkannt. Noch ein Flüchtling, der versuchte, wieder zum Leben zu erwachen und den Funken im Innern zu finden, den so viele so lange hatten auslöschen wollen.
»Er geht nach Norden. Jemand ist gestorben.«
Shans Lächeln verschwand vollends.
»Nein«, fügte Gendun schnell hinzu. »Nicht auf diese Weise«, sagte er und meinte damit, daß es sich nicht um eines jener geheimnisvollen Gewaltverbrechen handelte, von deren Aufklärung der alte Shan, der Ermittler aus Peking, regelrecht besessen gewesen war. »Es hat nichts mit dem Stein oder einem von uns zu tun. Er geht einfach nur nach Norden, und ich mache mir Sorgen um ihn.«
Wenngleich Tenzin für gewöhnlich mit ihnen aß und einen Anteil der Hausarbeit übernahm, hatte er sich von Shan ferngehalten und ihm keine Gelegenheit gegeben, ihn näher kennenzulernen. Zunächst war Shan sein Verhalten wie Reserviertheit vorgekommen, denn Tenzin besaß eine merkwürdig aristokratische Ausstrahlung, sogar wenn er seinen Dungsack trug. Mehr als einmal hatte Shan sich zudem gefragt, ob dem Mann durch Gendun oder Shopo als Bestrafung für irgendein Vergehen eine Buße auferlegt worden war. Männer wie er begingen auf der Flucht manchmal Gewalttaten, um nicht gefaßt zu werden. Gendun mochte ihn für den Mord an einem Wärter nicht verdammen, aber er würde sich sorgen, welchen Schaden eine solche Tat seinem inneren Gott zufügen könnte. Der hochgewachsene schweigsame Tibeter machte sich mit seinem Ledersack jeden Morgen bei Tagesanbruch auf den Weg und kehrte erst in der Abenddämmerung mit einer Ladung Yakdung wieder zurück, was für einen ganzen Tag Arbeit einen kargen Erlös bedeutete. Doch auch mit nur einem einzigen Sack pro Tag hatte er eine der kleineren Hütten bis zur Decke mit Brennstoff für die Einsiedelei gefüllt.
»Ich möchte ihm ja helfen, Rinpoche, aber ich weiß noch nicht, wie.«
Gendun nickte. »Mitunter fürchte ich, daß er den Weg aus den Augen verliert.« Der Lama meinte damit nicht, daß Tenzin sich verirren könnte, sondern bezog sich auf die Gefahr, während einer Wanderung durch die gefährliche Landschaft in tiefe Meditation zu versinken und sich der unmittelbaren Umgebung nicht mehr bewußt zu sein. Mönche, die allein in den Bergen unterwegs waren, brachen sich auf diese Weise bisweilen ein Bein oder gar den Hals.
Shan sah seinen Lehrer nachdenklich an. Gendun wußte etwas über den melancholischen Mann, das ihm verborgen geblieben war, oder spürte zumindest etwas, das Shan nicht registriert hatte. Tenzin war ihnen bei dem Mandala nie zur Hand gegangen, hatte dessen Erschaffung aber voll kindlicher Faszination verfolgt, Gendun und Shopo unentwegt mit Tee versorgt und alle Lampen nachgefüllt, sobald die dropkas Häute voller Butter brachten. Obwohl Shan nie gesehen hatte, daß er meditierte oder sich für das interessierte, was die Tibeter den Buddha in ihm nennen würden, mußte er nun an den täglichen Sack Dung denken. Den Sack zu füllen nahm zwei oder drei Stunden in Anspruch. Verbrachte Tenzin den Rest des Tages auf einem hohen Grat und meditierte? Einmal, erinnerte Shan sich, nachdem Shopo genau beschrieben hatte, wie man mit den Fluß-nagas sprach, war Tenzin mit schwarzem Sand für das Mandala zurückgekehrt und hatte diesen ehrfürchtig Gendun übergeben. Bei einer anderen Gelegenheit hatte Shan ihn mitten in der Nacht allein am Rand des Mandalas vorgefunden, die hohle Hand über das Abbild eines Einsiedlermönchs ausgestreckt, die Augen voller Tränen.
»Wenn ihm eine Zunge wächst, wird es besser«, sagte der Lama. »Vielleicht noch ein paar Monate.«
So beschrieb Gendun das Schweigen solcher gebrochenen Männer, und so hatte er in den ersten Wochen nach dessen Zeit im Gulag auch Shans dunkle Stille bezeichnet. Wenn der Mann irgendwann den Funken fand, der vor der Gefangenschaft und der Marter des Arbeitslagers einmal Tenzin gewesen war, würde diese Lebenskraft auch seine Zunge erreichen, und er wäre bereit, mit der Welt zu sprechen. Eventuell, dachte Shan, war das der Grund, aus dem Gendun ihn bat, sich um Tenzin zu kümmern: weil einst auch Shan, bevor er die Lamas traf, nur aus stummen, verwirrten Fragmenten bestanden hatte.
Siebe den Sand, um die Saat des Universums zu finden. Die Worte hallten in Shans Gedächtnis wider, als er vier Stunden später neben dem Mandala saß, mit dem Gefäß voll weißem Sand zu seinen Füßen. Die Sonne war untergegangen, und die letzte Nacht der Arbeit an dem Mandala hatte begonnen. Eine Fingerspitze berührte seinen Arm, leicht wie eine Feder.
»Es ist soweit«, sagte Gendun, zog einen chakpa aus dem Ärmel seines roten Gewands und streckte ihn Shan entgegen.
Shan zögerte. Aus dem dunklen Korridor, der zu der Kammer führte, drang ein Stöhnen. Es war der Wind, der mit dem bröckelnden Mauerwerk der Einsiedelei spielte und einen schaurigen Gleichklang mit dem Mantra erzeugte, das leise über Lokeshs Lippen drang. Der alte Tibeter saß neben Tenzin hinter ihnen an der Wand. Shan hob langsam die Hand und nahm den schmalen chakpa, der bereits mit dem weißen Sand gefüllt war. Dann reichte Gendun ihm noch einen zweiten, leeren Trichter, mit dessen Hilfe der Sand aus dem ersten chakpa herausgeklopft wurde. Shans Blick schweifte zu dem kleinen Holzaltar und dem gezackten Auge ab, dann wieder zurück zu dem Lama, verbunden mit einem Anflug von Schuldgefühl. Das Auge war da, allzeit wachsam. Doch Shan hatte von Gendun Disziplin gelernt, und das beinhaltete, daß er nicht an das geheimnisvolle Auge denken, sondern sich statt dessen in das Mandala vertiefen sollte. Seit jenem ersten Tag in der Einsiedelei hatte niemand mehr über das Auge gesprochen, abgesehen von Lokesh, der Shan eines Nachts unauffällig zugeflüstert hatte, er brauche sich keine Sorgen zu machen, denn wohin auch immer Gendun und der Stein sich begeben mochten, es würde sich um eine heilige Stätte handeln. Lokesh schien die bevorstehende Reise als eine Pilgerfahrt zu betrachten, in deren Verlauf heilige Männer einen heiligen Stein zurückbringen würden. Seiner Überzeugung nach würde die Welt sich notfalls teilen, um solchen Pilgern einen friedvollen Pfad zu bereiten.
Shan sah, daß Nyma soeben eine Flammenspur entlang des äußeren Rings abschloß, und beugte sich vor, um mit einer hauchdünnen Linie aus weißem Sand den Umriß einer Wolke zu beginnen. Er ließ zunächst den sandgefüllten chakpa und dann den leeren Trichter sinken, zog sie jedoch gleich wieder weg. Seine Hände zitterten. Niemand sagte ein Wort. Shan sammelte sich einen Moment lang, indem er den Palast im Zentrum des Kreises anstarrte, wo Weisheit und Mitleid herrschten. Mit ruhigeren Händen klopfte er behutsam gegen den Sand-chakpa und ließ einen weißen Faden auf den äußeren Rand des Mandalas herabrieseln. Das Klopfen seiner Metalltrichter verwandelte sich in eine winzige gedämpfte Glocke, ein Geräusch, das untrennbarer Bestandteil des allnächtlichen Rituals geworden war, und jeder Schlag kündete von einigen weiteren Samenkörnern, die in das von den Lamas geschaffene kleine Universum gepflanzt wurden.
Sobald Shan seine Aufgabe beendet hatte, nickte er Nyma zu, die nun das Muster fortführen und zinnoberroten Sand in Form eines Baumes hinzufügen würde. Dann stand er auf und trat von dem Kreis zurück, immer darauf bedacht, über den zarten Sandbildern nicht zu heftig zu atmen. Als er sich umdrehte, sah er, daß neben Lokesh ein Fremder hockte und leise auf ihn einredete. Der Mann trug eine auffallend fleckige Schaffellmütze und eine chuba, den dicken Schaffellmantel, der typisch für die Nomaden dieser kargen Landschaft war, aber er gehörte nicht zu den dropkas, die ihr Lager oberhalb der Klause aufgeschlagen hatten.
Plötzlich weiteten sich die Augen des Fremden. Er stand auf und deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger anklagend auf Shan. Bei dieser Bewegung öffnete sich die chuba, und an seinem Gürtel war ein langes Messer zu sehen. Lokesh packte die Gebetskette fest zwischen zwei Fingern, um die gegenwärtige Stelle nicht zu verlieren, sprang auf und drückte mit seiner freien Hand den Arm des Mannes herunter, während Shan näher kam.
»Ihr seid verrückt«, murmelte der Fremde. Als er sich von Lokesh losreißen wollte, fiel die Fellmütze herunter. Sein Kopf war vollständig kahlgeschoren. Shan musterte das markante, grobknochige Gesicht des Fremden, die glatte Kopfhaut und den langen dünnen Schnurrbart. Dieser Mann war keiner der Hirten, sondern ein golok aus dem fernen Nordosten Tibets und somit Angehöriger des wahrscheinlich wildesten aller tibetischen Völker. »Er ist Chinese!« schimpfte der golok laut.
Shan drehte sich besorgt zu dem Mandala um. Nyma und die Lamas ignorierten den Mann.
»Das ist Shan«, widersprach Lokesh und hielt den Arm des Mannes weiterhin fest, als fürchte er, der golok würde Shan angreifen. »Er ist der Auserwählte.«
Der Eindringling sah kurz den alten Tibeter an und nahm Shan dann genauer in Augenschein. Sein Zorn wich offener Verachtung. »Der Auserwählte, der den Gott erneuern wird? Er ist ein Krimineller. Ein unbarmherziger Kerl, wie es heißt. All die anderen Chinesen hassen ihn.«
Lokesh warf Shan einen entschuldigenden Blick zu. »Kein Krimineller, sondern ein Häftling. Vier Jahre lao gai«, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die Zwangsarbeitslager Pekings. Bis letztes Jahr hatten Shan und Lokesh beide in der 404. Baubrigade des Volkes arbeiten müssen, einer der berüchtigtsten Strafkolonnen Chinas.
»Der Chinese«, sagte der golok und ließ seine Augen über Shans vielfach geflickten Mantel wandern, über die ausgetretenen Arbeitsstiefel und das ausgefranste Ende des Vinylgürtels, das an seiner Taille hervorragte, »sieht aus wie ein Krämer. Ein verkrachter Krämer«, fügte er mit einem Hohnlächeln hinzu und betrachtete dann stirnrunzelnd die anderen Anwesenden in der Kammer. »Es sollten purbas sein, echte Krieger. So werdet ihr es niemals schaffen. Ihr habt ja keine Ahnung!« sagte er überheblich und wandte sich wieder Shan zu. »Du könntest auf hunderterlei Weise sterben. Bessere als du haben es versucht und ihr Leben verloren.«
Shan hielt dem Blick des golok ruhig stand. Falls dieser Mann, der mit Sicherheit kein purba war, von ihren geheimen Absichten erfahren hatte, wie vielen anderen mochte dann wohl noch bekannt sein, daß sie das gezackte Auge zurückbringen würden? Wieso schien er mehr zu wissen als Shan? Und warum hatten die dropkas, die die Gebäude bewachten, ihn durchgelassen?
Lokesh seufzte. »Ja«, sagte er, als habe er derartige Warnungen zuvor schon gehört. Er nahm den Mann bei der Hand und zog ihn mit sich. »Du solltest den heiligen Kreis studieren«, forderte er ihn mit nachsichtiger Stimme auf. Die Worte klangen wie der Ratschlag eines Heilers, und Shan gelangte zu dem Schluß, daß es sich bei dem Mann um einen jener verbitterten, wütenden Tibeter handeln mußte, die von den älteren Nomaden zu der Klause gebracht wurden, um das Mandala zu erfahren und darüber nachzusinnen, wieviel stärker als Haß und Angst doch das Mitleid sein konnte.
Der golok legte den Kopf merkwürdig schräg und beäugte das Mandala, als würden die Lamas und der Kreis aus Sand ihm erst jetzt auffallen. Er runzelte die Stirn, ließ sich auf die Knie nieder und verneigte sich einmal kurz bis zum Boden, um widerwillig seinen Respekt zu bezeugen. Als er wieder aufstand, murmelte er überrascht etwas vor sich hin, denn sein Blick war auf den Altar gefallen. Mit schnellen Schritten ging er an dem Mandala vorbei, kauerte sich vor das gezackte Auge und starrte es an. Der Stein interessierte ihn mehr als alles andere.
Shan hatte während seiner Haftjahre mehrere goloks kennengelernt. Nein, kennengelernt hatte er sie genaugenommen nicht, denn sie hatten sich stets geweigert, mit ihm zu reden, und ihn immer nur mit der stummen Abneigung angestarrt, die für ihre Feinde reserviert war. Sogar viele der anderen Tibeter gingen ihnen aus dem Weg, denn die golok-Stämme galten seit Jahrhunderten als besonders wilde und brutale Banditenhorden. Hätte Shan nicht unter dem Schutz der Mönche aus seiner lao-gai-Baracke gestanden, würden die goloks versucht haben, ihn zu ermorden. Er wußte von zwei chinesischen Gefangenen, denen es nicht anders ergangen war: Einer wurde auf seiner Pritsche gefunden; in seinem Hirn steckte ein Schraubenzieher. Den anderen hatte man mit einem angeschliffenen Löffel kastriert. Während der ersten Zeit im Arbeitslager wäre Shan der Tod durch die Hand dieser Männer regelrecht gelegen gekommen. Aber das damals war ein anderer Shan gewesen, eine andere Inkarnation – nach den wochenlangen Verhören durch die Öffentliche Sicherheit wollte der Peking-Shan, der ins Lager kam, nur noch von dem ständigen Schmerz und der Angst erlöst werden.
Gendun drehte sich um und sah Shan erwartungsvoll an. Nyma hatte ihren Baum in dem Sandrad vollendet. Shan kehrte an die Seite des Lama zurück und nahm den chakpa voll weißem Sand entgegen. Er schloß kurz die Augen, beugte sich vor und klopfte erneut gegen den Trichter, um diesmal drei geschwungene Berge zu erschaffen. Shan arbeitete schweigend, während Nyma und die Lamas das nahezu vollständige Mandala betrachteten, der Wind heulend über das Dach strich, die Butterlampen flackerten und Lokeshs geflüstertes Mantra im Rhythmus der Brise an- und abschwoll. Shan konzentrierte sich mit Leib und Seele auf die Sandkörner, die aus dem chakpa rieselten. Sie schienen zu leuchten; weiß wie frischer Schnee, weiß wie die Gottheiten, die in den Wolken lebten. Als die Berge schließlich fertig waren, wich Shan zurück und nahm neben Lokesh und Tenzin Platz, während Shopo einen chakpa mit blauem Sand hob, um einen Mönch zu malen, der inmitten von Shans Bergen saß.
Shan bemühte sich, in Gedanken nicht von dem Mandala abzuschweifen, doch der golok schritt mittlerweile rastlos im Hintergrund der Kammer auf und ab, sah im einen Moment das gezackte Auge an und beugte sich gleich darauf vor, um Shan anzustarren. Shan wußte, was der Mann dachte, denn er selbst stellte sich diese Frage schon seit Wochen. Wieso Shan? »Weil du die Schliche der Dämonen kennst, die nicht wollen, daß die Gottheit wieder sieht«, hatte Nyma auf die Frage geantwortet und damit gemeint, daß er die Schliche der chinesischen Regierung kannte. »Es ist deine Belohnung«, hatte sie hinzugefügt. »Die Menschen wissen, wie du das Gleichgewicht wiederhergestellt hast, nachdem es gewaltsam gestört worden war. Du findest, was verloren wurde.«
Aber die Leute hier mußten doch eigentlich selbst wissen, wohin das Auge gehörte, hatte Shan eines Morgens zu der Nonne gesagt, als sie gemeinsam Wasser holen gingen. Nein, hatte Nyma mit runden traurigen Augen erwidert. Nachdem die Gottheit geblendet worden war, hatte sie sich tief ins Gebirge zurückgezogen. Das Tal von Yapchi, das ihr jahrhundertelang als Aufenthaltsort gedient hatte, war mehr als drei Kilometer lang, ungefähr halb so breit und auf drei Seiten von hohen Bergen umgeben, Bergen voller Spalten und Höhlen. Die Gottheit konnte überall stecken.
Noch vier weitere Male nahm Shan den chakpa mit weißem Sand, um Bilder von Wolken und Bergen zu erschaffen und dann den anderen bei der Arbeit an dem Rad zuzusehen. Jegliches Zeitgefühl löste sich auf. Tenzin entzündete schweigend neue Weihrauchstäbchen. Einen Moment lang prasselte Hagel auf das Blechdach. Lokesh sagte unentwegt das Mantra auf, bis es nicht mehr zu sein schien als lediglich eine weitere Klangfarbe des Windes. Der golok ließ sich mit übergeschlagenen Beinen vor dem Altar nieder und neigte und drehte fortwährend den Kopf, als wolle er einen besseren Blick auf das Auge erhaschen.
Shan ließ sich durch das seltsame Verhalten des golok nicht aus der Ruhe bringen. Er verspürte eine unvermutete Wärme und versuchte sich zu entsinnen, wann er zum letztenmal eine solche Zufriedenheit empfunden hatte. Das mußte Jahre vor seiner lao-gai-Haft gewesen sein, vor seiner Beförderung zum Generalinspekteur des Wirtschaftsministeriums, vor seiner Heirat mit einer leitenden Parteifunktionärin und der Arbeit für die Regierenden in Peking. Dies war eine wichtige Nacht, begriff er, eine Art Initiation, eine Nacht der Erkenntnis. Eine Nacht, so würde Lokesh es ausdrücken, in der sie alle sich ihren inneren Göttern nahe fühlten. Eine Nacht, in der er voller Überzeugung zu sich selbst sagen konnte, daß von allen Orten des Universums genau dieser hier für ihn bestimmt war, hier zwischen den Lamas, die vergessen konnten, daß seine chinesischen Landsleute eine Million Tibeter ermordet hatten, daß sie nach fünfzig Jahren noch immer in einem besetzten Land lebten; die all das Leid vergessen konnten, weil hier in dieser abgeschiedenen, vergessenen, windgepeitschten Einsiedelei ein paar ehrerbietige Seelen geduldig an der Vollendung eines Mandalas arbeiteten, das dem Mitleid und der Weisheit gewidmet war. Und nun, als sie mit dem letzten Durchgang der chakpa-Malerei begannen, brach für sie die perfekte Stunde dieser perfekten Nacht an.
Als Shan aufblickte und in Genduns Augen sah, stahl sich ein Lächeln auf sein Gesicht. Vielleicht hatte er zuviel in diese merkwürdige Rückgabe des Auges hineingedeutet, vielleicht ging es nur darum, Momente wie diesen zu bewahren, die Lamas und ihre Traditionen zu schützen, die Saat zu erhalten. Auf einmal konnte er sich nichts Wichtigeres auf der Welt vorstellen, als der Gottheit das Auge zurückzubringen.
Gendun neigte den Kopf in Richtung der Außenwand und lauschte. Der Wind wehte nun heftiger und rief einen langgezogenen dumpfen Ton von eigenartig metallischer Beschaffenheit hervor. Shan spürte eine hastige Bewegung, wandte den Blick von dem Mandala ab und sah, daß der golok sich aufrichtete und wachsam zur Tür schaute. Dann ertönte wieder der lange dumpfe Ton, diesmal etwas tiefer. Aus dem Korridor hörte Shan eilige Schritte. Der alte Nomade, der die lhakang bewachte, lief nach draußen.
Der Hirte und seine Schwester wechselten sich ab: Einer von ihnen befand sich stets in der Einsiedelei, der andere auf dem Berggrat im Westen, oberhalb des Tals, bewaffnet nicht etwa mit einem Gewehr, sondern einem alten verbeulten dungchen, einem der langen, spitz zulaufenden Hörner, wie sie in Tempeln gebräuchlich waren. Der golok stand auf und rannte zur Tür hinaus. Seine Hand lag auf dem Griff des langen Messers. Shan erhob sich und machte einen zögernden Schritt in die gleiche Richtung. Lokesh hielt mit dem Mantra inne und neigte lauschend den Kopf. Dann warf er Shan einen matten Blick zu und fuhr mit dem Gebet fort, allerdings ein wenig schneller als zuvor. Das Horn ertönte aufs neue, diesmal noch drängender, aber die Lamas ließen durch nichts erkennen, ob sie es gehört hatten. Womöglich waren die Kriecher hierher unterwegs. Sie könnten Maschinengewehre mitbringen. Sie würden ihre Schlagstöcke und Handschellen dabeihaben, um Verdächtige in ein lao-gai-Lager zu verfrachten, wo Gendun und Shopo als Mönchen ohne staatliche Lizenz eine Mindeststrafe von fünf Jahren gewiß war. Nichts davon konnte die Lamas ihres freudigen Moments berauben. Ihr Mandala war beinahe vollendet.
Der golok kehrte zurück. Er atmete schwer, packte Shopo an der Schulter und wollte ihn wegziehen, doch der Lama schien sich keinen Millimeter von der Stelle zu rühren, so als hätte er in den steinernen Bodenplatten der lhakang Wurzeln geschlagen. Der golok murmelte wütend etwas vor sich hin und versuchte es bei Gendun, wiederum ohne Erfolg. Shan ging bis zur Tür und horchte auf das metallische Rattern eines Helikopters oder das Hämmern von Kriecherstiefeln. Ihn würde man nicht als illegalen Mönch verhaften, sondern als lao-gai-Flüchtling, denn seine Freilassung aus dem Lager von Lhadrung war inoffiziell erfolgt, als dankbare Geste des Ortskommandanten. Die Kriecher müßten nur die eintätowierte Nummer auf seinem Arm überprüfen und würden herausfinden, daß Peking ihn zwar ins lao gai gesteckt, aber niemals seine Haftentlassung verfügt hatte.
Als das Hornsignal erstarb, wandte Shan sich zu dem beunruhigten golok um, der inzwischen laut fluchte. In seinem Blick lag Verwirrung und Angst, und seine Hand ruhte nach wie vor auf dem Messer. Shan fragte sich für einen Moment, warum der golok nicht einfach die Flucht ergriff. Dann trat er neben Lokesh und ließ sich langsam mit übergeschlagenen Beinen nieder, die Augen starr auf das Gemälde gerichtet. Die Lamas arbeiteten unbeirrt an dem Mandala weiter. Bald würde es wieder an der Zeit für Shans weißen Sand sein.
Plötzlich tauchte auch der Hirte wieder auf, der im Korridor gewacht hatte. Er rang nach Luft, aber seine Miene wirkte zufrieden. Der golok verstummte und wich in den Schatten der Wand zurück, die Hand weiterhin am Messer. Die stämmige Frau hatte den Posten auf dem Kamm verlassen und trat hinter ihrem Bruder ein, gefolgt von einem hochgewachsenen schlanken Mann, der sich am Türrahmen festhielt.
Mit verzerrtem Gesicht sah der Neuankömmling sich in der Kammer um. Shan erkannte die entstellte Stirn wieder, das geschwungene Narbengewebe über den Augen. Es war Drakte, der purba, der Lokesh und Shan bei dem dropka abgeliefert und versprochen hatte, er würde zurückkehren. Der vermißte Drakte. Doch es war ein bleicher, erschöpfter Drakte, ohne das harte stolze Funkeln in den Augen, das Shan sonst immer an ihm bemerkt hatte.
»Er kommt«, stieß Drakte heiser und gequält hervor. »Es bleibt keine Zeit.« Der junge Tibeter schien völlig ausgelaugt. Er hielt sich die rechte Hand an den Bauch und ging auf den Kreis am Boden zu, wobei sein Kopf unaufhörlich hin- und herschwang, als suche er etwas ganz Bestimmtes. Als er Tenzin im Schatten sitzen sah, hielt er kurz inne; dann richtete sein Blick sich auf Shan. »Nimm das Auge«, keuchte er. »Nimm das Auge und lauf.«
Nyma seufzte und fuhr mit der Arbeit fort, umriß mit ihrem chakpa einen Berg aus blauem Sand. Shan hingegen registrierte, daß Gendun den purba mit leicht geneigtem Kopf und verkniffenem Blick in Augenschein nahm, als habe Drakte etwas an sich, das der Lama nicht verstehen konnte.
Lokesh erhob sich und ging einen Schritt auf Drakte zu, der ihn mit ausgestrecktem Arm auf Abstand hielt.
»Es kümmert ihn nicht, wer sterben muß«, stöhnte der purba. »Er will den Stein finden. Er tötet, wofür er steht. Er tötet Gebete. Ich habe ihn töten gesehen. Man kann ihn nicht aufhalten. Lauft weg«, wiederholte er, und es klang wie ein Schluchzen. »Ihr könnt nur noch weglaufen. Rettet das Auge. Rettet euch selbst.« Bei diesen Worten sah er traurig Shan an. »Es tut mir leid«, klagte er, als sei er Shan etwas schuldig geblieben.
Shan wußte nicht, was er tun sollte, und trat an den Rand des heiligen Kreises. Er wollte die Hand ausstrecken und den purba stützen, wollte anbieten, im Nebengebäude gemeinsam eine Schale Tee zu trinken und in Ruhe Draktes Befürchtungen zu erörtern, als die dropka aufkeuchte, auf die Knie fiel und sich tief in Richtung der Tür verneigte. Der golok ächzte und rannte hinter den Kreis, auf den Altar zu. Nyma blickte auf, stieß einen gedämpften Schrei aus und vergaß ihren chakpa, so daß der blaue Sand sich auf dem Mandala zu einem kleinen Haufen türmte.
In der Türöffnung stand eine groteske zweibeinige Gestalt, deren enorme Statur den gesamten Rahmen ausfüllte. Ihr wilder, zorniger Blick hatte sich auf den purba gerichtet. Das ist ein Mann, dachte Shan, oder zumindest ist es mal einer gewesen. Er hatte sich so sehr an die tibetischen Geschichten über Dämonen gewöhnt, war so vertraut mit den Bemühungen der Lamas, sich ein Bild von den Gottheiten zu machen, daß er einen Moment lang bezweifelte, ob dieser Anblick real war. Der zweite dropka rief den Namen der heiligen Tara, der Beschützerin der Gläubigen, und warf sich zu Boden.
Der Kopf des Eindringlings besaß menschliche Form, wirkte mit den geschwärzten Wangen und dem schmierigen festen Haarknoten auf dem Scheitel aber irgendwie tierisch. Sein Kreuz war breiter als die Türöffnung, und so mußte er sich drehen und vorbeugen, um den Raum zu betreten. Ein Arm, der aus dem ärmellosen braunen Gewand ragte, war oberhalb des Ellbogens mit einer roten Schnur umwickelt und hielt einen mehr als schulterhohen Stab, der fast so dick wie Shans Bizeps war und in einem knorrigen Holzknoten endete.
Shopo stand auf und hielt dem Fremden wie zur Begrüßung die offene Handfläche entgegen, doch noch bevor der Lama das Wort ergreifen konnte, schlug der Mann Drakte mit seinem Stab in den Bauch und brüllte den purba an. Er sprach schnell und dermaßen laut, daß seine Stimme den Wind übertönte. Die dropkas hielten sich die Ohren zu. Die alten Schulen des tibetischen Buddhismus lehrten, daß es böse Mystiker gab, deren Machtworte einen zufälligen Lauscher versklaven konnten.
Der riesige schwarzgesichtige Eindringling schien jedoch weder die dropkas noch die Lamas zur Kenntnis zu nehmen. Er schrie mit seiner tiefen dämonischen Stimme weiterhin auf Drakte ein, stach mit dem Stab nach ihm und traf den jungen Tibeter an Bauch, Armen und Oberschenkeln. Shan bemühte sich vergeblich, die Worte zu verstehen. Sie waren tibetisch, aber ihre Bedeutung blieb ihm verborgen. Es konnte sich um Alttibetisch handeln wie in den uralten Lehren oder um einen der vielen Dialekte aus Tibets entlegenen Regionen. Lediglich einen Namen vermochte er herauszuhören: den von Yamantaka, dem Herrn der Toten.
Draktes Gesicht verlor das letzte bißchen Farbe. Die Wut, die kurz in seinen Augen aufgeblitzt war, wich gleich darauf der Angst. Er hob die Hand vor die Brust und trat zurück, um aus der Reichweite des Stabs zu gelangen, bis er plötzlich im Zentrum des zerbrechlichen Mandalas stand. Hektisch hielt Shan nach irgendeiner Waffe Ausschau, um den purba damit zu verteidigen. Drakte konnte unterdessen den Blick nicht von dem Dämon abwenden und fing an, mit bebenden Lippen das mani-Mantra zu rezitieren, die Anrufung des Mitfühlenden Buddhas.
Der Eindringling verstummte unversehens, starrte feindselig Drakte an und schüttelte mit kurzen abgehackten Bewegungen den Stab. Das einzige Geräusch im Raum war das Mantra des purba