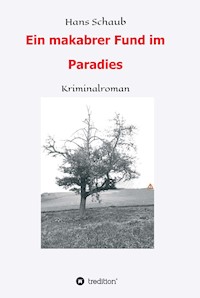Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
In seinem zweiten Roman erzählt Hans Schaub die Geschichte zweier Liebender, die auch ihrer verschiedener Herkunft wegen ins Verderben führt. Schaub berichtet aber auch über die besondere Lebensweise der Roma – im positiven wie auch im negativen Sinn. Der Roman ist frei erfunden, trotzdem weiss der Autor, worüber er schreibt, denn er hat sich – auch vor Ort – eingehend mit dieser Ethnie befasst. Im blutjungen Alter von achtzehn Jahren lernt Erika an einem Hafenfest in Husum, einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein, den jungen Roma Elös kennen, der sie mit seinem virtuosen Geigenspiel verzaubert. Ihre Eltern sind für einige Tage verreist, und so nimmt sie ihn mit zu sich nach Hause, wo die beiden eine Liebesnacht verbringen. Anderntags ist der Standplatz der Fahrenden geräumt, Elös verschwunden. Zurück in Husum überrascht ihn Erika mit der Nachricht, dass er der Vater ihres werdenden Kindes sei. Ihre Liebe ist so stark, dass sie gegen den Widerstand der Familien zusammenbleiben. Eine Odyssee durch Europa, ins Heimatdorf der Familie im Osten Ungarns, strapaziert die Liebe des ungleichen Paares, zumal Elös' Mutter mit ihnen reist. Elös, von seiner Grossfamilie mit einem Bann bestraft, darf vorerst nicht ins Dorf. Erika ist allein auf sich gestellt, leidet unter den für ihr Verständnis archaischen Bräuchen und Regeln der Roma. Sie gebärt ihr Kind in Abwesenheit des Vaters. Dies gibt dem Clan-Führer die Gelegenheit, Erika eine Totgeburt vorzugaukeln. Die Geschichte nimmt einen dramatischen Verlauf, sowohl, was Erika und Elös anbelangt, als auch das Schicksal des Kindes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Das blonde Zigeunermädchen
Hans Schaub
Published by: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
E-Book-Produktion: Bernd Flossmann
www.bookcoach.info
Copyright © 2014 Hans Schaub
ISBN 978-3-7375-1136-0
Für Antoinette
Das Süßeste Glück für die trauernde Brust,
Nach der schönen Liebe verschwundener Lust,
Sind der Liebe Schmerzen und Klagen.
Friedrich Schiller, aus «Des Mädchens Klage»
Mein Dank gilt meinen kritischen Erstlesern Antoinette und Josef Erni. Ihre konstruktiven Kritiken gaben Anlass, meine Geschichte zu ergänzen, zu verfizieren und zu zusätzlichen Recherchen im Umfeld der Roma.
Monika Popp hat meine Texte korrigiert und mit sprachlicher Vielfalt leserfreundlich gemacht.
Und nicht zuletzt Adi Suter, dem gestrengen Lektor und Herausgeber meiner neuen Geschichte.
Vorwort
In der Schweiz leben schätzungsweise siebzigtausend Roma und Sinti. Viele sind seit Generationen in allen Berufen tätig. Dabei ist der Anteil an Künstlern, Akademikern und Berufsleuten unter diesen Volksgruppen vergleichbar mit dem Rest der Bevölkerung.
In Westeuropa litten diese Ethnien unter den grausamen Verfolgungen und Vernichtungsprogrammen während der Nazizeit. Im Osten Europas blieb auch nach der Öffnung ein tiefer Hass und diskriminierende Behandlung sowohl von Staates wegen wie auch von der Gesellschaft. Ungarn, Rumänien, beides EU-Staaten, verhindern eine Verbesserung der Lebensumstände dieser sesshaften Volksgruppen.
Schwere Armut und Lebensumstände, oft unter Drittweltstandard, sind Brutplätze für Unterdrückung und Kriminalität. Frauen werden von ihren Vätern, Brüdern und Ehemännern zur Prostitution gezwungen. Mit eigenen Augen habe ich im Sommer 2013 in Ungarn, nahe der rumänischen Grenze, junge Romafrauen gesehen, die schon um zehn Uhr morgens an der Hauptstrasse ihren Körper anboten.
Wen wundert’s, wenn in diesem Umfeld Frauen von Kriminellen mit leeren Versprechungen nach Westeuropa gelockt und dort ausgebeutet werden.
Roma anerkennen die Gesetze der Staaten, in denen sie leben. Daneben haben sie eigene Gerichtsbarkeiten. Für uns archaisch wirkende Gebräuche werden gepflegt, der Zusammenhang innerhalb der Familien ist gross.
Wie in anderen Zivilgesellschaften auch, nutzen kriminell veranlagte Individuen die Schwächsten skrupellos aus, stehlen und betrügen.
Damit werden sie Wahrnehmung und Sinnbild für ein Volk. Ein Volk, dem es heute kaum mehr gelingt, Sanktionen und Urteile ihrer eigenen Gerichte durchzusetzen.
In meinem Roman sind die Lebensumstände von Fahrenden sowie von Sesshaften gezeichnet. Auch wie einzelne Kriminelle die Schwächen ihrer eigenen Leute erbarmungslos ausnützen.Dass diese mit ihrem Handeln ihre eigenen Leute in Verruf bringen, ist ihnen egal.
Husum, Hafenfest 1984
Wie bestellt waren nach einem nasskalten Vorsommer Anfang August die Aussichten für die kommenden Tage passend zum Hafenfest: Es sollte warm werden, vielleicht ein leichter Wind vom Land her, auch die Nächte sollten angenehm werden und zum Verweilen am Fest ermuntern. Stände von fliegenden Händlern reihten sich aneinander, am Binnenhafen luden Tische und Bänke zum Bleiben ein. Auf einer mobilen Bühne würde die angekündigte Band «Die fünf Jungs» erstmals vor einheimischem Publikum auftreten. Für die älteren Festbesucher würde es eine Tanzkapelle geben, die nostalgische Stimmung mit deutschen Schlagern verbreiten sollte. Am Samstag- und Sonntagabend sollte als Höhepunkt des diesjährigen Festes eine Zigeunerkapelle aufspielen.
Erikas Eltern waren mit dem alten Volvo eines Lehrerkollegen für einige Tage nach Oldenburg gefahren. Dort war die Mutter aufgewachsen und lebte da, bis sie an einem Lehrgang über die offene, antiautoritäre Schule Erikas Vater kennen und lieben gelernt hatte. Als Schulleiter der örtlichen Grundschule hatte er als einer der Ersten Kenntnis über frei werdende Stellen im Schulbetrieb. Kaum vier Monate war es gegangen, bis Helga eine Stelle in der Kleinstadt antreten und zu ihrem Klaus nach Husum ziehen konnte.
Und jetzt, fast zwanzig Jahre später, konnte sich Erikas Oma nicht mehr selbst versorgen. Zur Einsamkeit – viele ihrer alten Freunde lagen auf dem Friedhof, Helgas Vater war vom Krieg nicht zurückgekehrt und verschollen – kam der ständige Schmerz, der den Verfall ihres Körpers begleitete. Oma musste ihre kleine Wohnung aufgeben und ins Altenheim umziehen. Nur Weniges aus der Wohnung durfte sie mitnehmen. Anderes wurde zerschlagen und zum Müll gebracht. Kaum ein Andenken würde im Volvo den Weg nach Husum finden.
«Drei, höchstens vier Tage bleiben wir», rief die Mutter ihrer Tochter beim Wegfahren noch zu.
Drei Tage sturmfrei.
«Was soll’s», dachte Erika.
Sie wollte diese Tage des Alleinseins geniessen. Lernen fürs Abitur, lesen und Musik hören. Sie liebte die Stunden ohne andere Menschen um sich, nie fühlte sie sich dabei einsam. Erika nahm ihre Geige, stimmte sie und begann zu üben. Es musste sein, waren ihre Noten in Musik doch die schlechtesten aller Fächer. Das Talent fehle ihr, davon war sie überzeugt. Ihr Vater hatte jedoch darauf bestanden, dass Erika das Violinspielen lerne und damit zur Abiturprüfung antrete. Weshalb Vater so streng darauf beharrte, wusste Erika nicht. Nie hatte er sich über seine Gründe geäussert. Es war sonst nicht seine Art, zu befehlen und seine Tochter zu etwas, das sie nicht wollte, zu zwingen. Vater hatte sie schon von klein an überall mitgeschleppt, wo er und Mutter hingegangen waren. Noch im Kinderwagen war Erika an jeder nur möglichen Demo dabei. Schon als Dreijährige machte sie auf dem Rücken ihres Vaters bei der Demo gegen den Schah-Besuch in Berlin zum ersten Mal Bekanntschaft mit Tränengas. Die Freiheiten, die ihr die Eltern zugestanden, genoss sie, nützte sie aber kaum. Sie rauchte nicht, obwohl im Umfeld von Vaters Mitstreitern sogar das Kiffen zum ungezwungenen, freiheitlichen Lebensstil gehörte. Es sagte ihr nicht zu.
Noch kannte sie nicht die Komposition, die sie an der Abi-Prüfung spielen sollte. Vom Musiklehrer hatte sie die Stücke, die in den vergangenen fünf Jahren geprüft worden waren, erhalten. Diese übte Erika diszipliniert. Technisch die Noten spielen, den Bogen führen, wie es die Notenblätter vorsahen, das konnte sie. Doch hatte sie selbst die Empfindung, dass es klang, als ob ein Roboter spielen würde, unmotiviert und gefühllos. Aber es musste sein und Erika arbeitete daran.
Am Samstagmorgen gönnte sich Erika den Luxus eines frischen Croissants, eine kleine Sünde, die im ökologischen Haushalt tabu war. Auf dem Weg zum Bäcker kam ihr Jenny, ihre Schulkollegin, entgegen.
«Hallo Erika, ich dachte, du seist mit deinen Eltern weggefahren. Als dein Vater unseren Volvo holte, sagte er nicht, dass du zu Hause bleibst.»
«Nee, ich wollte nicht mit. Ich brauche diese Tage zum Lernen», entgegnete Erika.
«Okay», lachte Jenny, «die Tage sind ja gut zum Lernen, doch heute ist Hafenfest. Komm, wir gehen am Abend zusammen hin. Sicher sind auch andere aus der Klasse dort. Gegen acht bin ich bei dir.»
Erika wollte protestieren, im Moment war sie nicht in Simmung dazu und bei bierseligen Festivitäten fühlte sie sich nicht wohl. Aber dann dachte sie: «Der Hafen ist nur wenige Minuten von unserem Haus entfernt, ich kann, wenn es mir nicht mehr gefällt, nach Hause gehen. Also sagte sie zu Jenny: «Ja, komm bei mir vorbei, ich werde um acht bereit sein.»
Mit einem «Tschüss bis zum Abend» gingen sie auseinander.
Nach dem Frühstück setzte sich Erika wieder in ihr Zimmer. Aus dem Fenster ging ihr Blick auf den kleinen Hinterhof zu den von der Mutter angelegten Gartenbeeten.
«Man müsste dort wieder einmal Unkraut jäten», dachte sie. «Es ist ja kaum zu erkennen, was eigentlich wachsen soll, vermutlich wird es wieder, wie schon das Jahr zuvor, keine Ernte aus dem Garten geben, Schnecken und Mäuse werden sich an Rüben und Kohl laben.»
Konzentriert und ohne Hintergrundmusik arbeitete sich Erika erst durch die Matheaufgaben und später durch ihr Lieblingsfach Französisch. Sie legte sich aufs Bett und las ein Buch zur Französischen Revolution. Nur selten benötigte sie das Wörterbuch, wenn ihr eine Redewendung nicht geläufig war.
Der Tag ging dahin, irgendwann übermannte sie der Schlaf, aus dem sie kurz nach sieben Uhr erwachte.
Rasch unter die Dusche, ihre halblangen, blonden Haare musste sie nicht föhnen, die Natur hatte ihr problemlose Haare geschenkt, waschen und trocknen lassen genügte. Ein dezenter Lippenstrich, mehr brauchte und wollte sie nicht. Um acht wartete sie im kurzen Sommerrock und Bluse auf Jenny.
«Nimm doch eine leichte Jacke mit. Sobald die Sonne weg ist, wird es kühl», sagte Jenny, als sie kurz darauf eintraf. Arm in Arm und gut gelaunt gingen die beiden jungen Frauen durch die engen Gassen zum Binnenhafen. Selbst ein Fremder hätte diesen Platz gefunden. Von weit her waren «Die fünf Jungs» zu hören.
Ganz nahe der Bühne besetzten einige Mitschüler einen Tisch. Vor den einen stand bereits ein grosses Bier, andere hatten eine Cola vor sich. Laut johlend begrüssten sie die beiden Mädchen und riefen sie zu sich.
Dafür, dass es der erste öffentliche Auftritt der «fünf Jungs» war, klang das, was sie spielten, gar nicht schlecht, halt eben laut. Ein Gespräch am Tisch war kaum möglich. Ein Grund, weshalb die Organisatoren des Hafenfestes die Jungs schon früh am Abend auftreten liessen. Ab neun, nach einem kurzen Unterbruch, begann die Tanzkapelle ihre eingängigen Schlager zu spielen. Diese «Grufti-Musik» war das Zeichen zum Aufbruch. Auch diejenigen, die an alten deutschen Schlagern Gefallen fanden, gingen mit. Keiner wollte zu den Alten gehören, keiner stand zu seiner Vorliebe.
«Wir gehen zum Damm und feiern dort weiter.»
Mit Bier- und Coladosen ausgerüstet zog die Truppe laut und lachend zum Damm, der die Stadt vor dem Meer schützt.
Wie üblich blieben die Mädchen in der Minderheit. Zu Erika und Jenny hatten sich im Laufe des Abends drei weitere Schülerinnen der Klasse gesellt. Der Alkohol tat seine Wirkung, Hemmungen begannen zu fallen. Die Mutigsten – nein, diejenigen, die am besoffensten waren – rannten in die auflaufende See, grölten und forderten die Mädchen auf, es ihnen gleichzutun. Keine war dazu bereit. Die nassen Kleider wurden abgelegt, nackt rannten die Jungs den Strand entlang, nur die Bierdosen mittragend. Irgendeiner fand, dass nicht nur die Jungs nackt sein sollten, und begann, die Mädchen zu bedrängen, sich auch auszuziehen.
«Da mach ich nicht mit», sagte Erika zu Jenny, «ich gehe zurück zum Fest oder nach Hause.»
«Ich komme mit», erwiderte Jenny beinahe erleichtert.
Unter lauten Buhrufen entfernten sich die beiden und schlenderten zurück zum Fest.
«An sich stören mich die Nacktbadenden nicht, nur traue ich den schon angetrunkenen Jungs nicht. Wenn die übermütig werden und ihre Hemmungen verlieren, könnten wir zum Ziel ihrer Gelüste werden. Im Sommercamp, zu dem mich meine Eltern seit jeher mitnehmen, gehören Nacktpartys dazu. Manch ein Paar verschwindet dann in die Büsche, Paare, die sonst nicht zusammengehören. Freie Liebe gehört zur Lebenseinstellung meiner Eltern und ihrer Freunde. Doch die gelobte Freiheit, ohne Eifersucht zu lieben, hat schon manche Paare für immer getrennt. Einige der Leute sah man nie wieder in der Szene. Ich konnte mich bisher der Anmache von Jungs oder auch älteren Männern und, auch das gibt’s, von Frauen, entziehen», erzählte Erika.
Jenny hörte aufmerksam zu. In ihrem Elternhaus herrschten traditionelle Werte, Lebensformen wie sie jetzt von ihrer Freundin beschrieben bekam, wurden verabscheut. Derart ungezügelt und unmoralisch zu leben konnte im Verständnis ihrer Eltern kaum zum Lebensglück führen.
Am Hafen spielte immer noch die Tanzkapelle. Kaum hatten sie sich an einen Tisch nahe der Bühne gesetzt, kündigte der Sänger der Kapelle eine längere Pause an, während der eine Gruppe der Roma, die derzeit auf dem kürzlich von der Gemeinde neu erstellten Standplatz ihr Lager aufgestellt hatten, die Festbesucher mit Zigeunermusik unterhalten werde. An einigen Tischen wurde diese Ankündigung mit Applaus honoriert, an anderen herrschte Schweigen. Auch verliessen einige mit einem «das fehlte uns gerade noch» oder «jetzt haben wir die Zigeuner» das Fest.
Fünf Roma, der Jüngste kaum zehn, der Älteste mit Schnurrbart und langen grauen Haaren und sicher über siebzig, begannen mit ihrer Darbietung. Zuerst ganz leise, dann immer lauter und schneller, spielten sie auf. Der Knabe spielte Geige wie der junge Frontmann, die anderen Cymbal, Holz- und Blechblasinstrumente. Der Geiger, ein junger Mann mit ungezähmtem, schwarzen Haar und dunklen Augen, stand bald im Vordergrund, alle anderen Musiker hielten sich an seine stummen Weisungen.
«Wie leicht der den Bogen führt», dachte Erika, wie virtuos er mit seinem Instrument umgeht, mal klagend, dann Begeisterung und Lebensfreude ausdrückend, die Violine lebt mit dem Streicher. Sie tanzt mit ihm, oder ist er es, der die Geige in Ekstase bringt?
Mal schien der Bogen ein Körperteil des Spielers, mal wie ein sich verselbstständigender, schwebender Zauberstab zu sein. Sie kam aus dem Staunen nicht heraus. Dass jemand einem, wie sie bis dahin dachte, dermassen langweiligen «Seitenkasten» Leben einhauchen konnte, liess ihren Mund offen stehen. Sie starrte zum Geiger und konnte ihren Blick nicht von ihm abwenden. Ein Stups von Jenny brachte sie aus ihrer Verzückung zurück.
«Was schaust du zu diesem Zigeuner, du hängst mit deinem Blick an ihm und vergisst, wo du bist.»
Erika wollte und konnte ihrer Freundin, die vom Geigenspielen keine Ahnung hatte, ihre Faszination nicht erklären. Unmöglich!
Bald begannen einige zu tanzen. Ein Junge forderte auch Erika dazu auf. Schroff wies sie ihn ab. Sie wolle die Musik geniessen, nur die Musik, sich durch nichts davon ablenken lassen, sagte sie ihrer Freundin, als ihr diese ihre Ruppigkeit gegenüber dem Jungen vorhielt. Wieder wandte sich Erika dem Geiger zu, vergass alles um sich herum und genoss das Spiel. So auffallend, dass auch der Geiger auf sie aufmerksam wurde. Er las aus der Mimik der jungen Frau die Begeisterung, mit der sie seine mitreissende Darbietung verfolgte.
Es war gegen Mitternacht, als Jenny abzog. Mit einem «du beachtest mich nicht mehr, ich langweile mich und geh jetzt nach Hause», liess sie Erika allein am Tisch zurück.
Die Pause der Tanzkapelle ging zu Ende, die Roma packten ihre Instrumente zusammen und verliessen unter frenetischem Applaus die Bühne. Jetzt war Schmusekurs angesagt, Englischwalzer, Foxtrott, Musik zum eng aneinandergeschmiegt Tanzen, oder so tun, als ob.
Erika wollte gerade gehen, als sich ihr der Geiger näherte und höflich fragte, ob er sich zu ihr setzen dürfe. Stotternd bejahte sie und rutsche etwas zur Seite.
«Dir gefällt unsere Musik?», fragte er.
«Wie du mit deiner Geige eins wirst, das ist unglaublich. Ich kam die ganze Zeit nicht aus dem Staunen heraus. Wo hast du das Spielen gelernt? Übrigens, ich bin die Erika», erwiderte sie.
«Und ich bin Elös. Das Geigenspiel hat in meiner Familie grosse Tradition, von klein auf lehren es uns die Älteren und vermitteln uns das Spielgefühl, das es braucht, damit das Instrument ein Teil von uns wird. Seit Jahrhunderten lebt unsere Familie vom Aufspielen vor Publikum, früher sogar vor Fürsten und Adligen.»
Dabei schaute er Erika direkt in die Augen und liess nicht davon ab. Erika errötete, ihr Gesicht hatte die Farbe einer reifen Tomate. Ein noch nie da gewesenes Gefühl machte sich im ganzen Körper breit. Dieser Mann, diese Augen, seine ungezwungene Annäherung. Nicht die plumpe Anmache wie von Schulfreunden, nein, einfach Freundlichkeit, Interesse an ihrer Person.
«Elös, ich mühe mich seit Jahren mit meiner Violine ab und finde nicht den Zugang zur Seele meines Instruments. Ehrlich gesagt, ich hasse sie und ich denke nicht, dass ich das Ding nach der Abi-Prüfung nochmals zur Hand nehmen werde.»
Elös lachte. In seinem sonnengebräunten Gesicht liess er die makellos weissen Zähne blitzen.
«Nur wenn du deine Geige liebst, gibt sie dir, was du von ihr erwartest. Es ist wie zwischen zwei Menschen, oft dauert es, bis sie einander näherkommen, andere verlieben sich schon bei ihrer ersten Begegnung.»
«Wie recht er hat», dachte Erika, «ich bin verliebt, bevor ich mein Gegenüber richtig kenne. Mich hat’s erwischt, was soll ich tun?»
Ein lauter werdendes Gegröle kam vom Damm her. Den am Strand Gebliebenen war das Bier ausgegangen, weshalb sie sich auf den Weg zurück zum Hafenfest machten. Nur kurz war die Aufmerksamkeit der Festbesucher auf die laute Gruppe gerichtet. Die Musiker der Tanzkapelle hatten rasch reagiert und begonnen, ein Potpourri mit eingängigen Liedern zu spielen. Der Lärm der Jungs ging im lauten Gesang der schunkelnden Festteilnehmer unter. Etwas frustriert, weil niemand ihr Kommen beachtete, setzten sie sich an den Tisch, an dem Erika und Elös sassen.
«Aha, da ist sie, unsere Mitschülerin! Es scheint, dass wir ihr zu gewöhnlich sind. Sie braucht das Exotische», stichelte einer der Betrunkenen.
Erika blieb ruhig, sie kannte die Wortführer der Bande und wusste, dass sie deren Verbalstärke unterlegen war. Nur ein «ach, lass mich in Ruhe» gab sie zurück.
Doch das war bereits zu viel, der Gröbste und Betrunkenste hatte auch ohne Alkohol nie ein Blatt vor den Mund genommen, jetzt war er hemmungslos und fiel unter dem Jubel seiner Kumpanen lautstark über Erika her.
«Das war es also, was dein Vater wollte, als er sich als Sprecher der Bürgerbewegung für den Stellplatz der Zigeuner starkmachte. Als er an allen Versammlungen immer wieder betonte, in unserer kleinbürgerlichen Stadt solle ein neuer multikultureller Geist einkehren und uns Kleinbürger aus der Lethargie aufwecken. Jetzt haben wir sie, die Fahrenden, die Zigeuner. Und seine Tochter hat ihren Roma-Freund. Wir sind ihr zu wenig, zu hinterwäldlerisch, sie gibt sich lieber mit einem dahergelaufenen Tunichtgut ab. So weit ist es gekommen, dass uns dieses Gesindel unsere Mädchen ausspannt und verführt.»
Erika stand auf, stillschweigend zog sie Elös an der Hand mit sich und verliess unter lautem Gejohle den Festplatz. Sie führte ihn durch die engen Gassen zum alten Schloss.
«Dort ist es ruhig, dort können wir uns auf eine Bank setzen und uns unterhalten», sagte sie leise und blieb dann stumm bis zum Schlosspark.
Unter den riesigen Bäumen, etwas abseits der beleuchteten Wege, fanden sie eine Bank. Seit dem fluchtartigen Abgang vom Hafengelände hatte Erika krampfhaft Elös’ Arm festgehalten. Erst jetzt, als sie auf der Bank sassen, wurde sie sich dessen bewusst.
«Ich hatte Angst, dass die Kerle handgreiflich werden, ich kenne sie. Wenn ihnen die Argumente ausgehen, werden sie grob und tätlich», erklärte sie und suchte in der Dunkelheit den Augenkontakt zu ihrem Begleiter. Sie forderte ihn auf, von sich zu erzählen, sie wollte mehr wissen über diesen Mann, der sie derart begeisterte und ihre Gefühlswelt durcheinanderbrachte. Noch bevor Elös antworten konnte, brach hinter den Büschen ein Gebrüll los. Wie bei einem Indianerüberfall im Wilden Westen umtanzten die Mitschüler die Bank, laute Drohungen ausstossend, dem fremden Mann Prügel androhend.
«Lasst uns in Ruhe», rief Erika, «hört auf, uns zu belästigen.» Auf den Lärm, den die Jugendlichen machten, wurde eine Polizeistreife aufmerksam. Die Beamten stiegen aus ihrem Fahrzeug und folgten dem ungewöhnlichen Geschrei.
«Was ist hier los?», rief der ältere der Beamten, als sie sich der Bank und dem Radau genähert hatten.
Ohne ihr Treiben zu unterbrechen, rief der Anführer der Gruppe dem Beamten zu: «Das Zigeunerschwein will eines unserer Mädchen verführen. Wir haben ihn durchschaut und versuchen, ihn zu vertreiben.»
«Das ist nicht wahr», rief Erika, «es ist mein Wunsch, mich mit diesem Mann zu unterhalten, es geht niemanden etwas an, was wir tun. Ich bin achtzehn und keiner kann mir befehlen, was ich tun oder lassen soll.»
Derweil drängte der jüngere Beamte die lärmenden Jungs etwas weg von der Bank und drohte ihnen eine Anzeige wegen Ruhestörung an.
«Wer sind Sie?», wollte der ältere Beamte von Elös wissen.
«Ich heisse Elös und habe heute Abend mit meinen Familienangehörigen am Hafenfest aufgespielt. Ich wohne derzeit auf dem neuen Standplatz für Fahrende.»
«Ich denke, es wäre das Beste, wenn Sie zu Ihrem Standplatz gehen würden, wir sehen es nicht gerne, wenn Leute wie Sie sich während der Nachtstunden im Ort aufhalten», empfahl ihm der Beamte.
«Komm, wir gehen.» Erika nahm Elös wieder am Arm und verliess den Park, während die Polizisten die Heranwachsenden nochmals ermahnten, Ruhe zu geben und niemanden zu belästigen. Es sei auch für sie an der Zeit, sich auf den Heimweg zu machen.
«Wenn wir uns im Park nicht ungestört unterhalten können, gehen wir zu mir. Meine Eltern sind weg, niemand wird uns nerven», flüsterte Erika.
«Findest du es gut, mich, den du erst seit wenigen Stunden kennst, in dein Haus einzuladen? Ist dir nicht bekannt, dass wir Roma stehlen und alles, was nicht niet- und nagelfest ist, mitlaufen lassen?», spottete ihr Begleiter.
«Hör auf damit, ich will dich näher kennenlernen und dazu lade ich dich in mein Heim ein», erwiderte die etwas verwirrte Erika.
Zu Hause angelangt, setzten sie sich an den Tisch in der Küche. Erika erhitzte Wasser und goss Tee auf.
«Sag mir jetzt, woher du kommst und wie du lebst», bat sie ihren Besucher.
«Meine Familie kommt aus dem Osten Ungarns, doch dort leben wir nur über die Winterzeit. Sonst sind wir ‹auf Reise›. So nennen wir die Zeit, während der wir mit unseren Wohnwagen in Westeuropa unterwegs sind. Am Dienstag geht es weiter nach Dänemark zum jährlichen Treffen mit anderen Familien unserer Sippe. Auf dem Weg zurück nach Ungarn werden wir uns in etwa zwei Monaten nochmals hier auf dem neuen Stellplatz niederlassen. Meine Familie hat ihr Auskommen seit eh und je von Spiel, Musik und Gauklerei. Täglich üben wir unsere Kunststücke, Musik und Tanz. Unsere Frauen sind die beliebtesten Tänzerinnen unserer Sippe», erzählte Elös.
«Wie kommt es, dass du deutsch sprichst, mit einem mir unbekannten Akzent?», wunderte sich Erika.
«Nun, in der Siedlung, in der wir in Ungarn überwintern, gibt es auch deutschstämmige Leute, die seit Generationen dort ansässig sind. Wie wir werden auch sie von der Regierung vernachlässigt und oft von Staatsstellen diskriminiert. Das hat dazu geführt, dass wir uns oft zusammentun, um uns zu wehren. Von denen lernte ich deren Deutsch, auch auf unseren Reisen durch Europa sind wir vorwiegend in deutschsprachigen Ländern unterwegs», antwortete Elös. «Doch jetzt bist du dran, erzähle von dir.»
Erika legte ihre Hand in die von Elös. Dieser ergriff die Gelegenheit und rutsche näher zu ihr. «Ich lebe mit meinen Eltern, die beide an hiesigen Schulen unterrichten. Leider habe ich keine Geschwister und nur wenige Freundinnen. Noch ein knappes Jahr, dann habe ich mein Abitur, das ich schon schaffen werde. Ausser im Fach Musik sind meine Noten gut bis ausgezeichnet. Aber eben die Violine …», seufze sie.
«Dann spiel mir doch etwas vor», bat Elös und schaute in ihr jetzt eher blasses Gesicht.
«So wie ich dich heute Abend spielen sah und hörte, schäme ich mich. Das ist kein Spiel, das ich mit meiner Violine mache, es ist Missbrauch an einem Instrument, das zu anderem fähig ist.»
Elös insistierte: «Bitte spiele, vielleicht kann ich dir einige Tricks zeigen, die dein Verhältnis zur Geige lockern.»
Erika rang mit sich, es ging ihr gar nicht mehr ums Musizieren. Sie wollte die Nähe dieses Mannes, es war Verliebtheit, und auf keinen Fall sollte er jetzt weggehen.
«Also gut, ich spiele dir etwas vor, komm, wir gehen in mein Zimmer, das ist gegen den Hof gerichtet, sodass sich keiner an meinem Gekratze stören wird.»
Sie nahm ihn bei der Hand und zog ihn die Treppe hoch in ihr Zimmer. Die Blätter, nach denen sie am Vormittag geübt hatte, lagen noch auf dem Notenständer. Sie entnahm ihre Geige dem Kasten und forderte Elös auf, sich auf ihr Bett zu setzen. So wie sie es im Unterricht gelernt hatte, nahm sie die Geige und den Bogen und begann, die vor ihr liegenden Noten zu spielen. Sie fühlte es gleich; das war Welten entfernt von dem, wie Elös am gleichen Abend gespielt hatte. Schon nach einer knappen Minute hörte sie auf, schaute zu ihrem Besucher. Dieser lächelte und sagte: «Du triffst die Töne, aber du bist verklemmt, du musst lockerer mit deinem Instrument umgehen. Vergiss, was dein Musiklehrer mit dir übt, als Anfängerin solltest du leichte Melodien spielen. Melodien, die so eingängig sind, dass du ohne Noten spielen kannst. Brahms zu spielen ist eine Herausforderung, an die du dich wagen kannst, wenn sich bei dir die Freude am Violinspielen eingestellt hat. Weiche auch mal vom Notenblatt ab und gib den Tönen deine momentane Empfindung, deine Stimmung.»
Er stand auf, trat neben Erika, umfasste ihre Hand, in der der Bogen lag, und sagte, dass sie sich lockern und von ihm führen lassen solle. Nach einigen Takten fand Erika, dass das Vibrieren der Saiten in ihren Fingern anders, freudiger wurde. Später nahm Elös seine Hand weg und überliess Erika ihrem Spiel, das von Takt zu Takt gelöster den Noten folgte. Die Freude am eigenen Spiel liess Erikas Gesicht von der aus ihrem Inneren kommenden Wärme erröten. Abrupt legte sie die Geige zur Seite und umarmte Elös. Sie küsste ihn stürmisch. Obwohl ihn ein warnendes Gefühl zur Zurückhaltung ermahnte, begann auch er, das in seinen Armen liegende Mädchen zu küssen. Erika zog ihm sein Hemd über den Kopf und schmiegte sich an seine behaarte Brust. Dann begann auch sie, sich auszuziehen. Bald lagen beide nackt im Bett und Erika schenkte dem Mann, den sie nur kurz kannte, ihre Jungfräulichkeit.
Er blieb, bis es draussen dämmerte. Dann zog er sich an und ging, ohne dass Erika dies bemerkte. Leise verliess er das Haus und kehrte leichten Schrittes aus der Stadt zum Standplatz zurück. Das wie jeden Abend entzündete Feuer mitten im Rondell der aufgestellten Wagen war erloschen. Kurz bevor er sich in seinen Camper schleichen konnte, trat ihm sein Onkel in den Weg.
«Woher kommst du? Wo hast du dich herumgetrieben? Es war vereinbart, dass du mit den anderen nach dem Auftritt zurückkommst. Du weisst, warum. Erstens will ich keinen Ärger mit den Bewohnern der Stadt und zweitens gehe ich davon aus, dass du es wieder mit einem Weib getrieben hast», schnaubte er. «Und vergiss nicht, in zwei Wochen wirst du in Dänemark mit der dreizehnjährigen Tochter unserer Freunde verlobt, das hatte ich vor einem Jahr bei dem Treffen mit ihrem Vater besiegelt. Nochmals, wo warst du?»
Elös hatte die Strafpredigt erwartet. All das, was sein nur wenig älterer Onkel, der seit dem Tod seines Vaters das Oberhaupt der Grossfamilie geworden war, sagte, war ihm bekannt. Es gab diese Verpflichtung, die sein Onkel ohne Rücksprache mit ihm eingegangen war. Eine Cousine dritten Grades aus der Familie seiner Mutter war für ihn bestimmt, ob er wollte oder nicht. Ungewöhnlich, wurde diese Regel doch kaum noch angewandt. In der heutigen Zeit war es gang und gäbe, auf die Wünsche und Gefühle der Brautleute Rücksicht zu nehmen.
«Ich war mit Jungs von der Stadt zusammen, wir haben uns amüsiert, waren am Strand und haben uns Geschichten erzählt. Ja, es waren Mädchen dabei, doch es gab nichts, was nicht sein darf», log Elös.
Sein Onkel glaubte ihm nicht, denn die Musikanten hatten gesehen, wie Elös zusammen mit einem Mädchen vom Binnenhafen weggegangen war.
«Wir haben uns gestern Abend beraten und entschieden, heute früh von hier wegzufahren und direkt bis Dänemark zu reisen. Wir tun das, obwohl wir zugesagt hatten, heute Abend am Hafenfest noch einmal aufzutreten. Lieber verzichte ich auf die Gage, als dass wir von weiblichen Stadtbewohnern belästigt werden. Schau, dass du deinen Wagen zum Aufbruch rüstest, gegen acht Uhr fahren wir los.» Er drehte sich um, ging den Wagen entlang und weckte die Schlafenden.
Emsiges Treiben begann, jeder und jede hatte seine Aufgabe. Das Reisen von einem Standplatz zum nächsten lag den Leuten im Blut, Aufbruch und Ankunft waren Routine. Elös schalt sich selbst, er hatte sich vorgenommen, die Finger von jungen Frauen zu lassen. Keine Flirts, keine Zärtlichkeiten, und doch hatte er es in der vergangenen Nacht nicht lassen können. Zugegeben, auch für ihn war das Erlebnis mit Erika kein flüchtiger, oberflächlicher Flirt gewesen. Er empfand Zuneigung, Gefühle, die weiter gingen als eine gemeinsame Nacht. Doch schon als Jugendlicher hatte man ihm beigebracht, dass Techtelmechtel mit sesshaften Frauen gefährlich seien. Dass er sich fernhalten solle von jungen Frauen. Ein kurzer Bettbesuch bei einer einsamen reifen Frau durfte sein. Und daran hatte er sich bisher auch gehalten.
Erika erwachte vom Schrillen des Telefons. Noch bevor sie den Hörer abhob, bemerkte sie: Elös war weg.
«Hallo Erika, wir haben alles mit Oma erledigt und kommen noch heute zurück. Wir denken, dass wir am frühen Nachmittag zurück sein werden. Tschüss.»
Ohne Erika zu Wort kommen lassen, beendete ihre Mutter den Anruf. Schlaftrunken tappte Erika durchs Haus. Keine Nachricht vom nächtlichen Besucher, kein Zeichen vom Geliebten. Traurig setzte sie sich an den Küchentisch und starrte aus dem Fenster, das langsam von der aufsteigenden Sonne erhellt wurde.
«Warum nur ist er gegangen, ohne mich zu wecken? Weshalb keine Nachricht, wann wir uns wieder sehen werden? Und am Nachmittag kommen die Eltern zurück. Sicher kommen die schon heute, weil sie zum Hafenfest gehen wollen. Sie haben Oma so schnell wie möglich abgefertigt, um hier ja nichts zu verpassen.»
Erika beschloss, Elös in seinem Wohnwagen aufzusuchen. Sie wollte sehen, wie er lebte, seine Familie – das, was sie unter Familie verstand – kennenlernen. Sie räumte die Küche auf und verwischte die wenigen Spuren, die er hinterlassen hatte, nahm eine Dusche und frühstückte. Gegen zehn Uhr verliess sie das Haus und fuhr mit dem Fahrrad direkt zum Standplatz.
Sie traute ihren Augen nicht: kein Wohnwagen, kein Auto, nichts ausser Abfall, der überall herumlag. Von der Feuerstelle im Zentrum des Platzes stieg leichter Rauch aus der Asche. Erika stieg vom Rad und setzte sich auf einen der steinernen Bänke.
Verzweifelt rief sie nach Elös: «Wo bist du, warum hast du mich heute früh wortlos verlassen? Warum hast du mich belogen? Nicht im Laufe der kommenden Woche, schon heute seid ihr weitergefahren! Ich liebe dich und du enttäuschst mich derart. Alles habe ich dir gegeben, du hast mich heute Nacht zur Frau gemacht, und jetzt bist du wie ein räudiger Hund fortgeschlichen. Gemein und niederträchtig bist du. Es ist so, wie alle sagen: Trau keinem Zigeuner.»
Niemand hörte ihr Schreien, allein und verlassen sass sie auf der Bank, die Sitzengelassene, die Benutzte, die Gekränkte. Ihre Tränen flossen. Kein Gedanke der Selbstkritik, vergessen war, dass sie es gewesen war, die die Initiative ergriffen hatte. Die ihre Gefühle nicht im Zaum gehalten hatte. Die den Mann, den sie nur wenige Stunden gekannt hatte, zu sich eingeladen und mit ihm Liebe gemacht hatte.
Erika nahm ihr Rad und schob es zurück in die Stadt. Sie ging zum Hafen, wo zwei Arbeiter den Festplatz säuberten und für den Nachmittag vorbereiteten. Sie setzte sich auf die Hafenmauer, beobachtete einen älteren Mann, wie er den Rumpf seines Bootes, das jetzt bei Niedrigwasser auf Grund lag, überprüfte und von Algen und Schlamm befreite. In seinen hohen Stiefeln sank er tief in den angeschwemmten Schlick.
«Das soll mir eine Lehre sein, trau keinem. Nicht, wie mir meine Eltern seit Kindheit weismachen, dass man immer als Erstes an das Gute in einem Menschen glauben soll. Dem ist nicht so, ich wurde belogen und betrogen, diesen Mann muss ich vergessen.»
Sie stand auf und fuhr auf dem Damm zum Sandstrand und von dort weiter. Die frische Brise tat ihr gut. Sie versuchte, sich abzulenken, beobachtete die Wasservögel und Strandläufer, die mit ihren langen Schnäbeln im Sand lebende Nahrung suchten. Gegen Mittag fuhr sie nach Hause zurück, wo sie sich hinlegte und bald einschlief.
Ein Ruf weckte sie. Die Eltern waren zurück.
«Du schläfst mitten am Tag?», fragte die Mutter.
«Ja, ich war gestern Abend mit Jenny am Hafenfest, es wurde spät», antwortete die noch schlaftrunkene Erika.
Die Mutter bat sie, ihr und dem Vater beim Entladen des Volvos zu helfen. Die aus Omas Wohnung mitgebrachten Sachen mussten verstaut werden. Einen alten kleinen Schminktisch, an dem Erika schon immer Gefallen gefunden hatte, durfte sie in ihr Zimmer nehmen. Die Frage, ob sie Papa, der den Volvo seinem Freund zurückbringen wollte, begleiten würde, verneinte sie. Sie wolle mit Mutter plaudern und von ihr hören, wie es Oma gehe und was es sonst noch zu berichten gebe. Keine halbe Stunde konnten die beiden ihren Tee trinken und schwatzen, als der Vater wieder zurück war. Er setzte sich zu ihnen und schlürfte seinen Tee.
«Wir sind so früh zurück, weil wir heute Abend noch zum Fest gehen wollen. Ich freue mich auf die Musik der Roma-Truppe. Kommst du auch mit?», frage der Vater.
Das Blut schoss Erika in den Kopf. Was sollte sie sagen? Die Roma waren abgereist. Vermutlich war sie die Einzige, die das wusste. Sie hielt ihr Wissen zurück, wollte sich nicht blossstellen und den unweigerlich gestellten Fragen, woher sie die Information habe, entgehen.
«Nein, ich habe am Montag früh eine schwere Prüfung und will ausgeruht zur Schule gehen. Ich bleibe lieber zu Hause, schaue noch einmal in die Bücher und lege mich früh schlafen.»
«Nun, dann gehen wir eben allein», erwiderte die Mutter achselzuckend.