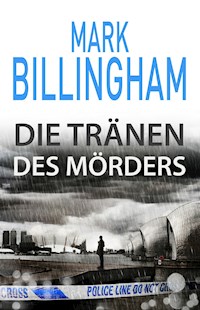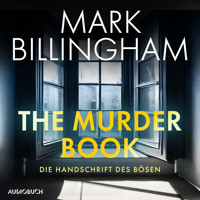2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspector Tom Thorne
- Sprache: Deutsch
Sie hat ihren Mann ermordet und dafür gebüßt, aber Rache währt länger als der Tod ...
Alan Langford ist seit zehn Jahren tot. Damals fand man seine Leiche in einem ausgebrannten Auto. Es war Mord, und seine Ehefrau Donna wurde verdächtigt, am Tod ihres Mannes beteiligt gewesen zu sein. Viele Jahre hat sie dafür im Gefängnis verbracht. Doch kurz vor ihrer Entlassung erhält sie einen anonymen Brief mit einem aktuellen Foto von Alan. Sollte dieser Mann, den sie aus tiefstem Herzen hasst, noch leben? Bei dem Versuch, genau das herauszufinden, gerät DI Tom Thorne an einen unberechenbaren Killer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
Als Donna Langford einen anonymen Brief erhält und ihn öffnet, ist sie geschockt. Sie hält ein ganz aktuelles Foto in den Händen, auf dem ihr Ehemann zu sehen ist – der Mann, der seit zehn Jahren tot ist. Damals fand man nur noch seine verbrannten Überreste im Wrack eines Autos, und Donna wurde verdächtigt, schuld an seinem Tod zu sein. Ihre Strafe dafür hat sie fast abgesessen, als sie das eindeutig erst vor kurzem gemachte Foto ihres eigentlich toten Mannes in Händen hält, auf dem er aussieht, als würde er kein schlechtes Leben führen. Wer hat dieses Foto geschickt, und warum? Und was sie unbedingt herausfinden muss: Lebt ihr Mann tatsächlich noch? Dieser Mensch, den sie mehr als alles andere in ihrem Leben gehasst und für dessen Tod sie einen hohen Preis bezahlt hat? Und falls er noch lebt, wer war dann der Tote in Alans Wagen?
Autor
Mark Billingham, geboren in Birmingham, ist als Autor von Drehbüchern und TV-Serien äußerst erfolgreich und wurde bereits mit dem »Royal Television Award« ausgezeichnet. Die Krimi-Serie um den eigenwilligen Detective Inspector Tom Thorne ist international ein großer Erfolg. Neben dem BCA-Award, dem Theakston’s Award für den besten Krimi des Jahres und Nominierungen für den Gold Dagger wurde die Serie um Tom Thorne mit dem Sherlock Award für die beste Detektivfigur im britischen Kriminalroman ausgezeichnet. Sie wird außerdem derzeit von der BBC für das englische Fernsehen verfilmt. Mark Billingham lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in London. Weitere Informationen zum Autor unter: www.markbillingham.com.
Von Mark Billingham außerdem bei Goldmann erschienen:
Das Geständnis des Toten. Roman (47020)
Aus der Reihe mit Detective Inspector Tom Thorne:
Der Kuss des Sandmanns (45227) · Die Tränen des Mörders (45537) · Die Blumen des Todes (45730) · Blutzeichen (45913) · In der Stunde des Todes (46095) · Die Geliebte des Mörders (46306) · Das Blut der Opfer (46675) · Die Schuld des Blutes (47327)
Mark Billingham
Tödlicher Verdacht
Thriller
Aus dem Englischen von Thomas Bauer
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »From the Dead« bei Little, Brown, London.
Dieses Buch ist ein Werk der Fiktion. Die Personen, Ereignisse und Dialoge entstammen der Phantasie des Autors. Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen, lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2012
Copyright © der Originalausgabe 2010 by Mark Billingham Ltd
All rights reserved.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagfoto: plainpicture/Arcangel
Redaktion: Ilse Wagner
NG · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN 978-3-641-07626-9V002
www.goldmann-verlag.de
Für Peter Cooks.
Mijas wird uns immer bleiben …
Prolog
Als der Tank explodiert, verfällt der Wald für ein paar Sekunden in Schockstarre.
Zumindest hat es den Anschein, als bedürfe es dieser Momente der Stille und Regungslosigkeit nach dem Knall der Explosion, damit alle Vögel und Insekten und kleinen Säugetiere wieder ausatmen können, nachdem sie die Luft angehalten haben. Damit der Wind wieder durch die Bäume streichen kann, obwohl er auch jetzt nicht mehr als ein Flüstern wagt. Selbstverständlich könnte es auch sein, dass es so lange dauert, bis der Nachhall in den Ohren der beiden Männer verklingt, die das brennende Auto betrachten.
Außerdem hat der Mann im Wagen endlich aufgehört zu schreien.
Als sie ihn zehn Minuten zuvor zu dem Jaguar gezerrt hatten, hatte der jüngere der beiden Männer dem armen Kerl ein paar Mal ins Gesicht schlagen müssen, um ihn zum Schweigen zu bringen. Nachdem sie ihn auf dem Beifahrersitz verfrachtet hatten, war er jedoch nicht mehr ruhigzustellen gewesen. Nachdem er die Handschellen und den Benzinkanister gesehen hatte, die im Kofferraum verstaut gewesen waren.
Nachdem ihm bewusst geworden war, was sie vorhatten.
»Ich hätte nicht gedacht, dass er so ein Theater machen würde«, sagte der ältere Mann.
»Sie machen immer ein Theater.« Der jüngere Mann schniefte und lächelte. »Bei diesem Teil bist du normalerweise nicht dabei, oder?«
»Wenn es sich vermeiden lässt, nicht.« Der ältere Mann vergrub die Hände tief in den Taschen seiner Barbour-Jacke und blickte nach oben zu den Kronen der Bäume, die sich um die kleine Lichtung drängten. Das Tageslicht begann bereits zu schwinden, und es wurde merklich kälter.
Der jüngere Mann grinste. »Keine Sorge, gleich wird’s wärmer.« Er öffnete eine Fondtür und verschüttete Benzin im Wagen.
Der Mann auf dem Vordersitz, der mit Handschellen ans Lenkrad gefesselt war, warf sich vor und zurück. Dabei rasselten die Handschellen an dem Lenkrad aus Walnussholz, und Speichel spritzte auf das Armaturenbrett und an die Windschutzscheibe. Er fing an zu schreien, flehte den Mann mit dem Benzinkanister an aufzuhören. Er sagte ihm, er habe eine Familie, nannte ihm Namen. Er sagte: »Das muss doch nicht sein.« Dann: »Um Himmels willen!«, und: »Bitte …«
Der ältere Mann zuckte zusammen, als habe er starke Kopfschmerzen, und forderte seinen Komplizen auf, die Tür zuzumachen. Um den verdammten Lärm ein wenig zu dämpfen. Der jüngere Mann kam seiner Aufforderung nach und warf den leeren Benzinkanister wieder in den Kofferraum. Dann ging er zu seinem Auftraggeber und bot ihm eine Zigarette an, die dieser jedoch ablehnte. Er holte ein Zippo-Feuerzeug hervor und zündete sich selbst eine an.
»Zufrieden?«
Der Mann in der Barbour-Jacke nickte. »Die Details mussten stimmen. Die Klamotten, weißt du? Der Schmuck und so.«
Der jüngere Mann nickte in Richtung Auto. »Schade um deine Uhr.«
Der ältere Mann warf einen Blick nach unten auf die Umrisse einer Armbanduhr, die sich blass auf seiner Barbados-Bräune abzeichneten. »Das sind doch alles nur … Sachen.« Er zuckte mit den Schultern. »Uhren, Autos, was weiß ich. Letzten Endes ist das alles bedeutungslos. Was zählt, ist leben, oder etwa nicht?«
Der jüngere Mann inhalierte tief und stieß den Rauch anschließend zwischen den Zähnen aus. Er nahm noch zwei weitere schnelle Züge, dann schnippte er den Zigarettenstummel zwischen die Bäume. Sagte: »Und, soll ich die Sache jetzt erledigen?«Er holte noch einmal das Feuerzeug hervor und zog aus seiner anderen Tasche einen Lumpen, den er zusammendrehte, als er zum Wagen zurückging.
Inzwischen weinte der Mann im Jaguar und schlug mit dem Kopf gegen das Seitenfenster. Seine Stimme klang rau und heiser und war nur so lange zu hören, wie es dauerte, die Tür zu öffnen, das Feuerzeug zu betätigen und den brennenden Lumpen auf die Rückbank zu werfen. Nicht länger als ein paar Sekunden, doch es war deutlich zu verstehen, was er sagte.
Wieder dieselben Namen. Seine Frau und sein Sohn.
Dieses Mal an niemand anderen gerichtet als an sich selbst, und er wiederholte sie mit geschlossenen Augen, bis der Rauch sie in seinem Hals erstickte.
Die beiden Männer wichen zu den Bäumen zurück und beobachteten aus sicherer Entfernung, wie sich das Feuer ausbreitete. Binnen anderthalb Minuten waren die Scheiben geplatzt, und die Gestalt auf dem Vordersitz war nur noch ein schwarzer Schemen.
»Wo soll’s denn hingehen?«
Der ältere Mann pflügte mit der Schuhspitze durch den Waldboden. »Wie kommst du darauf, dass dich das was angeht?«
»Ich frage ja nur.«
»Ja, ja. Denk lieber an den wertlosen Müll, für den du deine Kohle verprassen wirst.«
»Deine Kohle, meinst du.«
»Stimmt. So was kommt nicht alle Tage, was? Wie oft bist du schon zweimal für einen Job bezahlt worden?«
»Ich hatte noch nie einen Job, der auch nur annähernd so war wie …«
Genau in diesem Moment fing der Benzintank Feuer und explodierte …
Eine halbe Minute später drehen sich die beiden um und gehen dorthin zurück, wo das zweite Auto geparkt ist – weg von den Geräuschen, die nach jenen wenigen leblosen Sekunden in der Lichtung ertönen und widerhallen. Der Wind und die Blätter und das Knarren von Ästen. Das Prasseln und Zischen, mit dem die Flammen Fleisch und Leder verschlingen.
Etwa hundert Meter vor der Straße bleibt der ältere Mann stehen und blickt auf. »Hör mal …«
»Was ist?«
Er wartet, dann deutet er in die Richtung, aus der das Geräusch abermals zu hören ist. »Ein Specht. Hörst du ihn?«
Der jüngere Mann schüttelt den Kopf.
»Ein Buntspecht, nehme ich an. Die sind am häufigsten.«
Die beiden gehen weiter, während der Wald mit jeder Minute dunkler wird.
»Woher weißt du solches Zeug?«
»Ich lese«, erwidert der ältere Mann. »Bücher, Zeitschriften, alles Mögliche. Solltest du auch mal versuchen.«
»Tja, dafür hast du jetzt ja jede Menge Zeit, stimmt’s?« Der jüngere Mann macht eine Kopfbewegung in Richtung des lichterloh brennenden Autos, das durch das dunkle Gewirr von riesigen Eichen und Buchen auch aus einer Entfernung von mehr als einer Meile noch deutlich zu erkennen ist. »Du kannst bis zum Abwinken über beschissene Spechte lesen. Jetzt, wo du tot bist …«
Erster Teil
Ein raffinierter Trick
Erstes Kapitel
Anna Carpenter hatte bislang nur ein Mal Sushi gegessen, als irgend so ein Typ, den sie gerade erst kennengelernt hatte, bei ihr Eindruck schinden wollte, doch das war ihr erstes Mal in einem von diesen Förderband-Restaurants. Sie hielt das für eine gute Idee. So hatte man wenigstens die Chance, einen Blick auf das Essen zu werfen, bevor man den Sprung ins kalte Wasser wagte, und es spielte keine Rolle, wenn man es ein halbes Dutzend Mal vorbeifahren ließ, bis man sich entschied, da es ohnehin kalt war.
Teuflisch clever, diese Japaner …
Sie nahm einen Teller mit Nigiri-Lachs vom Band und bat den Mann, der neben ihr saß, ihr die Sojasoße zu reichen. Er schob die Flasche mit einem Lächeln zu ihr hinüber und bot ihr dann eine Schale Wasabi an.
»Oh, Gott, nein, das ist doch superscharf, oder?«
Der Mann erklärte ihr, es käme nur darauf an, es nicht zu übertreiben, doch sie erwiderte, dass sie es lieber nicht riskieren wolle, da sie noch eine ziemliche Anfängerin sei, was den Verzehr von rohem Fisch anging.
»Haben Sie gerade Mittagspause?«, fragte der Mann.
»Ja. Sie auch?«
»Na ja, ich bin mein eigener Boss, also kann ich meistens selber entscheiden, wann ich Pause mache.« Er pflückte fachmännisch etwas von seinem Teller, das aussah wie eine kleine Pastete, und tunkte es in irgendeine Soße. »Arbeiten Sie hier in der Gegend?«
Anna nickte, den Mund voller Reis, und grummelte ein »Ja«.
»Was machen Sie denn?«
Sie schluckte. »Nur Zeitarbeit«, sagte sie. »Um nicht an Langeweile zu sterben.«
Ein Kellner erschien mit einer Flasche Mineralwasser neben ihr, die sie bestellt hatte, und nachdem er gegangen war, saßen sie und der Mann fast wieder wie Fremde nebeneinander. Anna war es ebenso unangenehm, die Unterhaltung fortzusetzen, wie es ihm zu sein schien, und keiner von beiden brauchte eine Würzsoße vom anderen.
Sie aßen und tauschten hier und da ein Lächeln. Warfen sich Blicke zu und sahen wieder weg. Ein Nicken von ihr oder von ihm, wenn etwas besonders gut schmeckte.
Der Mann war Mitte bis Ende dreißig – etwa zehn Jahre älter als sie – und sah gut aus in seinem glänzend blauen Anzug, der vermutlich genauso viel gekostet hatte wie ihr Auto. Er hatte ein strahlendes Lächeln und hatte bei der letzten Rasur unmittelbar unter seinem Adamsapfel eine Stelle übersehen. Er sah aus, als würde er ins Fitnessstudio gehen, aber nicht zu oft, und sie hielt ihn nicht für einen von den Typen, die häufiger Feuchtigkeitscreme verwendeten als sie selbst.
Als sie mit dem Essen fertig war, saß er noch immer neben ihr.
»Vielleicht bin ich nächstes Mal tapfer und probiere das Wasabi«, sagte sie.
»Wie bitte?« Er drehte sich mit gespielter Überraschung zu ihr, als habe er völlig vergessen, dass sie da war.
Anna ließ sich nicht zum Narren halten. Ihr war bewusst, dass er seit zehn Minuten mit dem Essen fertig war. Sie hatte den Stapel leerer Teller neben ihm gesehen, hatte beobachtet, wie viel Zeit er sich mit seiner Tasse grünem Tee ließ, und wusste ganz genau, er wartete darauf, dass sie fertig wurde.
Sie beugte sich zu ihm hinüber. »Wir könnten uns ein Hotel suchen.«
Jetzt war seine Überraschung echt. Er hatte nicht damit gerechnet, dass sie den ersten Schritt machen würde. Sein Mund ging auf und wieder zu.
»Da Sie Ihr eigener Boss sind …«
Er nickte, brachte es jedoch nicht fertig, ihr in die Augen zu sehen.
»Warum finden wir nicht heraus, ob Sie tatsächlich so ein Leckermaul sind?« Das war bewusst vulgär, und sie spürte, dass sie errötete, als sie es sagte, aber es war sofort ersichtlich, dass es seinen Zweck erfüllte.
Er murmelte: »Donnerwetter!«, und sein strahlendes Lächeln verwandelte sich in ein dümmliches Grinsen. Dann winkte er den Kellner herbei und deutete sowohl auf Annas leere Teller als auch auf seine, um ihm zu verstehen zu geben, dass er für sie beide zahlen wolle.
Das Hotel war fünf Gehminuten entfernt. Versteckt hinter dem Kingsway und in unmittelbarer Nähe der U-Bahn-Station Holborn und einer gut sortierten Drogerie. Eine oder zwei Kategorien über der Travelodge-Hotelkette, ohne absurd teuer zu sein.
Als sie zur Rezeption gingen, zückte er sein Portemonnaie.
»Ich bin keine Nutte«, sagte Anna.
»Das weiß ich schon.«
»Ich habe kein Problem damit, wenn wir uns die Kosten für das Zimmer teilen.«
»Schon in Ordnung«, erwiderte er. »Du hast doch gesagt, du machst Zeitarbeit, also …«
»Gut, meinetwegen.« Ihr Blick traf sich mit dem des jungen Mannes hinter dem Empfangstresen. Er nickte höflich, dann sah er weg, da er zu spüren schien, dass er sich nicht anmerken lassen durfte, dass er sie schon einmal gesehen hatte. »Wenn du unbedingt protzen möchtest, kannst du uns irgendeine Flasche bestellen«, sagte Anna, drehte sich um und ging durch die Lobby.
Im Aufzug fragte er sie schließlich nach ihrem Namen.
Sie schüttelte den Kopf. »Ingrid … Angelina … Michelle. Was dich am meisten antörnt. Das macht die Sache spannender.« Sie schloss die Augen und stöhnte leise, als er die Hand über ihren Po wandern ließ.
Als der Aufzug in der ersten Etage mit einem Ruck zum Stehen kam, sagte er: »Ich bin Kevin.«
Das Zimmer war größer, als sie erwartet hatte – ein ziemlich geräumiges Doppelzimmer –, und sie vermutete, dass er sich nicht hatte lumpen lassen, wofür er ihr seltsamerweise leidtat.
»Nicht übel«, stellte er fest und zog sein Jackett aus.
Sie steuerte schnurstracks ins Badezimmer. »Bin gleich wieder da.«
Die Mitteilung schrieb sie, während sie die Toilette benutzte. Dann trat sie vor den Spiegel und wischte sich das überschüssige Make-up aus dem Gesicht. Sie hörte ihn auf der anderen Seite der Tür hin und her gehen, hörte die Bettfedern quietschen und stellte sich vor, wie er auf die Matratze drückte, um sie wie ein Sitcom-Gigolo zu testen, während er noch immer dasselbe Grinsen im Gesicht hatte.
Als sie wieder ins Zimmer trat, saß er in Boxershorts auf der Bettkante, die Hände im Schoß.
»Also, wo ist jetzt der Leckerbissen?«, fragte er.
»Wollen wir nicht erst mal was trinken?«
Wie auf Kommando klopfte es. Er nickte in Richtung Tür. »Champagner hatten sie keinen«, sagte er. »Ich habe stattdessen Sekt bestellt. Der kostet mehr oder weniger dasselbe …«
Anna ging schnell zur Tür und öffnete sie, dann drehte sie sich um und sah, wie Kevin blass im Gesicht wurde, als seine Frau das Zimmer betrat.
»Oh, Scheiße«, sagte er. Während er mit einer Hand seine rasch schwindende Erektion verbarg, tastete er mit der anderen nach Hemd und Hose.
Die Frau beobachtete ihn von der Türöffnung aus und presste sich ihre Handtasche gegen den Bauch. Sagte: »Du armseliger Wichser.«
»Sie hat mich abgeschleppt, verdammt noch mal.« Er zeigte mit dem Finger auf Anna. »Ich war nur beim Mittagessen, und dieses … Flittchen …«
»Ich weiß«, entgegnete seine Frau. »Und sie musste dich hierherzerren, weil du dich mit Händen und Füßen gewehrt hast, stimmt’s?«
»Ich glaub’s einfach nicht, dass du das getan hast. Dass du das arrangiert hast.«
»Was, du glaubst nicht, dass ich dir nicht traue?«
Anna versuchte, sich an der Ehefrau vorbei zur Tür zu schieben. »Ich stehe Ihnen besser nicht im Weg.«
Die Frau nickte kurz und trat zur Seite. »Das Geld habe ich bereits auf das Konto Ihrer Agentur überwiesen«, sagte sie.
»Gut, danke …«
»Du Miststück!«, schrie Kevin. Er kämpfte noch immer damit, in seine Hose zu schlüpfen, und wäre dabei fast hingefallen, wenn er sich nicht an einer Kommode abgestützt hätte.
Anna öffnete die Tür.
»Und bilde dir bloß nichts drauf ein, Schätzchen. Das habe ich nur gemacht, weil du so leicht zu haben warst.«
Die Frau hatte Tränen in den Augen, brachte aber trotzdem einen Blick zustande, der irgendwo zwischen Mitleid und Wut lag. Anna kam es so vor, als sei beides ebenso sehr für sie wie für den Ehemann bestimmt gewesen.
»Ich lasse Sie jetzt allein«, sagte Anna.
Sie trat hastig in den Flur hinaus, da Kevin wieder anfing herumzuschreien, und zuckte zusammen, als die Tür hinter ihr zuschlug. Dann eilte sie am Aufzug vorbei und lief die Treppe zur Lobby hinunter, wobei sie immer zwei Stufen auf einmal nahm.
Sie bemühte sich, nicht an sein Gesicht und an seinen blassen, unbehaarten Körper zu denken und an die Dinge, von denen er geglaubt haben musste, sie würden sie miteinander tun.
An die Worte, die er ihr nachgerufen hatte.
»Du machst dir was vor, Schätzchen«, hatte er gesagt, »wenn du denkst, du wärst keine Nutte.«
In der U-Bahn zurück zur Victoria Station hob Anna eine zerfledderte Ausgabe der Metro auf und versuchte zu lesen. Gab sich größte Mühe, nicht über ihre Arbeit an diesem Nachmittag nachzudenken.
Du machst dir was vor …
Sie wusste, dass der Mann, dessen Ehe sie vermutlich zerstört hatte, den Nagel in mehr als einer Hinsicht auf den Kopf getroffen hatte; dass fast alles an dem, was sie tat, verkehrt war. Sie hatte einige der protzigeren Websites gesehen und wusste, wie die größeren und besseren Agenturen die radikalere Variante »spezialisierter ehelicher Nachforschungen« handhabten. Bei deren Sexfallen waren immer mindestens zwei Ermittler involviert. Das Wohl und die Sicherheit des Lockvogels standen stets an erster Stelle. Es gab versteckte Kameras und zuvor vereinbarte Geheimsignale.
Pustekuchen.
Sie konnte sich das höhnische Grinsen in Franks Gesicht genau vorstellen, konnte den Sarkasmus seiner barschen Stimme deutlich hören.
»Und, warum hauen Sie dann nicht ab und arbeiten für eine der größeren und besseren Agenturen?«
Sie stellte sich vor, wie sie in aller Ruhe konterte. Wie sie, ohne mit der Wimper zu zucken, verkündete, dass sie genau das womöglich eines Tages tun werde. In Wahrheit hätte sie sich allerdings auch dann kein bisschen besser gefühlt bei dem, was sie tat, wenn sie das Sushi-Restaurant mit bewaffneter Verstärkung, einem verborgenen Tonbandgerät und einem Kugelschreiber im Schlüpfer, der Säure verspritzt, betreten hätte.
Wäre nicht glücklicher gewesen mit der Richtung, die ihr Leben einschlug.
Geld hätte vielleicht ein wenig geholfen, hätte ihr Unbehagen möglicherweise gelindert, doch auch davon sprang bei dem Job nicht viel heraus. In einem jener seltenen Momente, in denen Frank Anderson nicht wütend oder betrunken oder grundlos sarkastisch gewesen war, hatte er Anna Platz nehmen lassen und versucht, ihr die finanzielle Situation zu erklären.
»Ich würde Sie liebend gern ein bisschen besser bezahlen«, hatte er gesagt und dabei beinahe, nur für ein oder zwei Sekunden, so geklungen, als meine er es ernst. »Liebend gern, aber sehen Sie sich doch mal um. Unsere spezialisierte Branche geht den Bach runter, und diese Finanzkrise beißt uns alle in den Hintern. Verstehen Sie?«
Anna hatte es in Erwägung gezogen, Frank daran zu erinnern, dass sie einen guten Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaft hatte, konnte sich allerdings vorstellen, wohin das Gespräch dann geführt hätte.
»Also, warum hauen Sie dann nicht ab und gehen zurück in Ihre schicke Bank?«
Das war eine knifflige Frage, die sich nicht so leicht beantworten ließ.
Weil Sie mir alles Mögliche versprochen haben. Weil ich dachte, das sei eine Herausforderung. Weil ich es stinklangweilig fand, mit dem Geld anderer Leute zu hantieren, und weil Sie mir sagten: Wenn es einen Job gibt, der nie vorhersehbar ist, der immer interessant ist, dann ist es dieser.
Weil Zurückgehen einer Kapitulation gleichkäme.
Anna erinnerte sich an den Tag, an dem sie die Anzeige in der Lokalzeitung gelesen und voller Enthusiasmus bei F. A. Investigations angerufen hatte. Feuer und Flamme war sie gewesen und grün hinter den Ohren. Vor achtzehn Monaten, in einem anderen Leben. Was, zum Teufel, hatte sie sich dabei gedacht, als sie aus einem gut bezahlten Job ausgestiegen war, Freunden und Kollegen den Rücken gekehrt hatte, für … das?
Zehn Pfund die Stunde, um Tee zu kochen und sich um Franks Buchhaltung zu kümmern. Um Anrufe entgegenzunehmen und sich an Männer ranzumachen, die ihr bestes Stück nicht in der Hose behalten konnten.
Und dennoch, obwohl sich die Dinge so entwickelt hatten, wusste Anna, dass sie den richtigen Instinkt gehabt hatte, dass an ihrem Ehrgeiz nichts verkehrt gewesen war. Wie viele Leute waren in ihrer Situation gefangen, hatten zu viel Angst, um eine Veränderung herbeizuführen, wie sehr sie sich auch danach sehnten?
Wie viele fanden sich mit ihrem Job, ihrem Partner, ihrem Leben ab?
Sie hatte sich etwas anderes gewünscht, das war alles. Sie hatte geglaubt, sie würde sich selbst helfen, indem sie anderen half. Dass sie das zumindest davor bewahren würde, sich in eine jener verbissenen Großstadt-Amazonen zu verwandeln, die den lieben langen Tag in ihren Jimmy-Choo-High-Heels an ihr vorbeistöckelten. Und, ja, sie hatte geglaubt, es sei womöglich ein bisschen spannender als Termingeschäfte und verdammte Hedge-Fonds.
Hatte sich etwas vorgemacht.
Genauso wie damals, als sie ein Flugblatt zum Beitritt zur Armee aufgehoben hatte oder als sie ganze fünf Minuten lang über eine Laufbahn bei der Polizei nachgedacht hatte. Vor anderthalb Jahren hatten einige ihrer Freunde ihren radikalen Berufswechsel von der Bankerin zur Privatdetektivin als »mutig« bezeichnet. »Mutiger als ich«, hatte Angie, eine Triage-Krankenschwester, gesagt. Rob, der Lehrer an einer Schule im Norden von London war, wo raue Sitten herrschten, hatte zustimmend genickt. Anna hatte den Verdacht gehabt, dass sie eigentlich »dumm« meinten, das Kompliment jedoch trotzdem genossen.
Aber Soldatin? Polizistin? Dafür war sie ganz bestimmt nicht mutig genug …
Anna stand auf, als die U-Bahn in die Victoria Station einfuhr, und ihr Blick traf sich mit dem der Frau, die ihr gegenübergesessen hatte. Sie versuchte, ein Lächeln zustande zu bringen, musste sich jedoch abwenden, da sie plötzlich und ohne jeden Grund davon überzeugt war, dass die Frau sie durchschaut hatte. Dass sie sehen konnte, was sie war.
Sie fühlte sich überdreht und benommen, als die Rolltreppe sie nach oben zur Straße beförderte, und konnte es kaum erwarten, wieder ins Büro zu kommen und sich umzuziehen. Wollte die bescheuerten High Heels loswerden, in denen sie herumstöckelte, und wieder in ihre Turnschuhe schlüpfen. Sie sehnte sich danach, dass der Tag endete und die Dunkelheit sie umhüllte. Wollte etwas trinken und schlafen. Erst als sie an der Sperre zur Fahrscheinkontrolle ankam und nach ihrer Oyster-Card kramte, fiel ihr auf, dass sie eine herausgerissene Seite der Metro in der geballten Faust hielt.
Die Detektei befand sich zwischen einer Reinigung und einem Wettbüro: eine ramponierte braune Tür mit schmutziger Glasscheibe. Als Anna in ihre Handtasche griff, um die Schlüssel herauszuholen, kam eine Frau auf sie zu, die am Randstein gestanden hatte. Sie war zwischen vierzig und fünfzig Jahre alt, und in ihrem Blick lag etwas Aggressives.
Anne wich einen halben Schritt zurück. Bereitete sich darauf vor, »nein« zu sagen. Die typische Londoner Reaktion.
»Sind Sie Detektivin?«, fragte die Frau.
Anna starrte sie nur an. Nein, nicht aggressiv, dachte sie. Verzweifelt.
»Ich habe Ihre Anzeige gesehen, und ich brauche ein wenig Hilfe bei etwas, also …«
Hinter der Glasscheibe war kein Licht zu erkennen, und Anna vermutete, dass aus Franks Mittagsdrink mehrere geworden waren. Höchstwahrscheinlich ließ er etwaige Anrufe bei F. A. Investigations auf sein Handy umleiten und würde sich den ganzen Nachmittag nicht mehr blicken lassen.
»Ja«, sagte Anna, »das bin ich.« Sie holte ihre Schlüssel hervor und trat zur Tür. »Kommen Sie herein.«
Zweites Kapitel
Hätten die beiden Männer nebeneinandergesessen oder sich in einem Vernehmungsraum über den Tisch hinweg angestarrt, wäre der entscheidende Unterschied zwischen ihnen womöglich gar nicht aufgefallen. Zumindest nicht dem oberflächlichen Betrachter. Hätte sich nicht einer der beiden auf der Anklagebank befunden und der andere im Zeugenstand, wäre es schwierig gewesen, den Polizisten vom Mörder zu unterscheiden.
Beide trugen einen Anzug und schienen sich darin unwohl zu fühlen. Beide hielten sich einigermaßen still und starrten die meiste Zeit geradeaus. Beide wirkten ziemlich gefasst, und obwohl nur einer von ihnen sprach, vermittelten beide den Eindruck, wenn man ihren Gesichtsausdruck länger als nur ein paar Augenblicke forschend betrachtete, dass hinter der Fassade unerschütterlicher Gelassenheit eine Menge vor sich ging.
Beide wirkten gefährlich.
Der Mann im Zeugenstand war deutlich jenseits der vierzig: stämmig und rundschultrig, mit dunklem Haar, das auf einer Seite etwas stärker ergraut war als auf der anderen. Er sprach langsam und achtete darauf, bei seiner Aussage nicht mehr als nötig zu sagen, wobei er seine Worte sorgfältig wählte, ohne diese Sorgfalt wie Unsicherheit oder Zögern aussehen zu lassen.
»Und für Sie bestand kein Zweifel daran, dass Sie es mit einem Mord zu tun hatten?«
»Nicht der geringste Zweifel.«
»Sie haben ausgesagt, der Angeklagte habe ›entspannt‹ gewirkt, als er erstmals befragt wurde. Veränderte sich sein Verhalten, als Sie ihn nach seiner Verhaftung verhörten?«
Während Detective Inspector Tom Thorne die fünf verschiedenen Befragungen beschrieb, die er bei dem Beschuldigten durchgeführt hatte, gab er sich alle Mühe, seinen Blick unablässig auf den Anklagevertreter zu richten. Das gelang ihm jedoch nicht ganz. Zwei- oder dreimal sah er kurz zur Anklagebank hinüber und bemerkte, dass Adam Chambers ihn fixierte – mit ausdruckslosen Augen und unverwandtem Blick. Einmal sah er für ein paar Sekunden zu den Besucherplätzen hinauf, wo die Angehörigen der jungen Frau saßen, die Chambers ermordet hatte. Er sah die Hoffnung und die Wut in den Gesichtern von Andrea Keanes Eltern. Die Hände, die Hände anderer umklammerten oder zitternd in Schößen lagen und zusammengeknüllte feuchte Taschentücher umschlossen.
Thorne sah eine Gruppe von Menschen, die in ihrer Trauer und in ihrem Zorn vereint waren und für die Gerechtigkeit – sollte sie zu ihrer Genugtuung geübt werden – echt und unverfälscht sein würde. Gerechtigkeit für ein achtzehnjähriges Mädchen, an dessen Tod für Thorne nicht der geringste Zweifel bestand.
Obwohl seine Leiche nie gefunden wurde.
»Inspector Thorne?«
Seine Stimme blieb ruhig, als er seine Zeugenaussage beendete, indem er Daten und Uhrzeiten, Namen und Orte wiederholte: jene Details, von denen er hoffte, dass sie in der Erinnerung der Geschworenen nachklingen würden; dass sie sich als ebenso wirksam erweisen würden wie jene kostbaren und belastenden blonden Haare, wie die Lügen, bloßgelegt von einer Mobiltelefon-Verbindungsübersicht, und wie das lächelnde Gesicht eines Mädchens auf einem Foto, das wenige Tage vor seiner Ermordung aufgenommen worden war.
»Vielen Dank, Inspector. Sie dürfen den Zeugenstand verlassen.«
Thorne steckte sein Notizbuch wieder in die Tasche seines Jacketts und trat aus dem Zeugenstand. Er ging langsam zur Hintertür des Gerichtssaals und ließ dabei eine Fingerspitze über die kleine gerade Narbe an seinem Kinn wandern. Sein Blick wanderte ebenfalls, als er sich der Gestalt auf der Anklagebank näherte.
Er dachte:
Ich will dich nie mehr sehen …
Ich meine nicht in Person, das sowieso nicht, weil du Gott sei Dank hinter Gittern sitzen wirst, bis du alt und grau bist. Wo du dich ständig umsehen und das Gefühl haben wirst, dass sich dein schlaues Hirn in Brei verwandelt. Wo du dich von Männern fernhalten wirst, die dich, ohne lange zu fackeln, aufschlitzen würden, weil du sie schief angeschaut hast. Weil du bist, wie du bist. Ich will dich nachts nicht sehen müssen. Will nicht, dass du rumhängst, wo du nicht erwünscht bist, und mich belästigst. Will nicht, dass sich deine arrogante Fresse und dein heiseres »kein Kommentar« in meine Träume drängen …
Als Thorne an der Anklagebank vorbeiging, wandte er Adam Chambers das Gesicht zu. Er blieb für ein oder zwei Sekunden stehen. Suchte Chambers’ Blick und hielt ihm stand.
Dann blinzelte er.
Thorne fuhr mit Detective Sergeant Samir Karim zurück nach Hendon. Karim war bei diesem Fall für die Beweiskette und für die Sicherung der Hauptbeweisstücke verantwortlich.
Eine Haarbürste. Ein Mobiltelefon. Ein Glas mit Andrea Keanes Fingerabdrücken.
Es war ein typischer Februartag, der für Thorne damit begonnen hatte, dass er seine reifbedeckte Windschutzscheibe mit einer CD-Hülle freikratzen musste, doch er ließ trotzdem die Seitenscheibe herunter und beugte sich zur Fensteröffnung, als der Wagen im dichten Verkehr langsam aus dem Zentrum von London rollte. Über das Rauschen kalter Luft hinweg hörte er, wie Karim ihm sagte, dass er sich gut geschlagen habe. Dass es nichts gab, was er noch hätte tun können. Dass die Sache so gut wie unter Dach und Fach sei.
Thorne hoffte, dass der Sergeant recht hatte. Ohne das überzeugendste Beweisstück musste der Crown Prosecution Service schon ziemlich zuversichtlich sein, eine Verurteilung zu erreichen, ehe er vor Gericht zog. Darüber hinaus hatten Thorne und der Rest des Teams alles getan, was von ihnen verlangt worden war. Thorne konnte sich nicht erinnern, dass sie jemals härter dafür gearbeitet hatten, jene drei Beweise zu erbringen, die unerlässlich waren, um in einem »leichenlosen« Mordfall eine Verurteilung zu erreichen:
Dass Andrea Keane tot war.
Dass sie ermordet worden war.
Dass sie von Adam Chambers ermordet worden war.
Andrea Keane war acht Monate zuvor verschwunden, nach einer Judo-Trainingsstunde in einem Sportzentrum in Cricklewood. Adam Chambers, der sich bereits zuvor gewaltsamer sexueller Nötigung schuldig gemacht hatte, war ihr Trainer gewesen. Bei der ersten Befragung leugnete er, Andrea nach Ende der Trainingsstunde gesehen zu haben, als später jedoch forensische Beweise in seiner Wohnung gefunden wurden, gab er zu, dass sie in der Vergangenheit mehrmals bei ihm gewesen war. Als Thorne und sein Team begannen, belastendes Beweismaterial gegen Chambers zusammenzutragen, blieb dieser bei seiner Aussage, er sei an dem Abend, an dem Andrea verschwunden war, nicht mit ihr zusammen gewesen, und behauptete, nach dem Training direkt zu seiner Freundin gefahren zu sein. Dieses Alibi wurde von der Freundin gestützt, bis durch Daten des Mobilfunknetzbetreibers nachgewiesen werden konnte, dass er sie an jenem Abend von seiner eigenen Wohnung aus angerufen hatte. Danach hatte er seine Geschichte geändert. Andrea sei nach ihrem Judo-Training doch zu ihm gekommen, aber nur für einen Drink geblieben, bis er sie aufgefordert habe zu gehen. Sie sei ein wenig emotional gewesen, hatte Chambers berichtet, und habe über seine Freundin geschimpft.
Er hatte sich in einem Vernehmungsraum im Polizeirevier von Colindale über den Tisch gebeugt, mit einem anzüglichen Grinsen, an das Thorne sich noch lange erinnern würde.
Hatte getönt: »Sie stand auf mich. Was soll ich sagen?«
Nachdem Chambers und seine Freundin angeklagt und die Anwälte bestellt worden waren, änderte er seine Taktik. Die überschwängliche Angeberei wich einer missmutigen Weigerung zu kooperieren – dem Ganovenspruch aus zwei Wörtern.
Kein Kommentar.
Thorne zuckte ein wenig zusammen, als Karim hupte und über einen Radfahrer fluchte, der vor ihm bei Rot über die Ampel gefahren war. Karim sah zu Thorne hinüber. »Ja, unter Dach und Fach«, sagte er noch einmal. »Ich sag’s Ihnen.«
»Und, wie sind die Quoten?«, wollte Thorne wissen.
Karim schüttelte den Kopf.
»Kommen Sie schon, erzählen Sie mir nicht, Sie hätten sie nicht ausgerechnet.«
Karim war ein Spielertyp und nahm häufig Wetteinsätze entgegen, was den Ausgang wichtiger Prozesse betraf. Offiziell war das verpönt, doch die meisten ranghöheren Polizisten drückten ein Auge zu und versuchten gelegentlich sogar selbst ihr Glück.
»Überflüssig«, erwiderte Karim. »Die Quoten sind viel zu hoch. Außerdem, wer würde schon dagegenwetten?«
Thorne wusste, was sein Kollege meinte. Bei einem Fall wie diesem, mit einem Angeklagten wie Adam Chambers, würde niemand auf einen Freispruch wetten oder dabei gesehen werden wollen, wenn er darauf wettete.
Niemand würde das Schicksal herausfordern wollen.
Karim schlug einen Trommelwirbel auf dem Lenkrad. »Die Sache ist gebongt. Definitiv gebongt.«
Nachdem die Ermittlungen in Fahrt gekommen waren und sich immer mehr Indizien angehäuft hatten, hatte Thorne sich darangemacht zu beweisen, dass Andrea Keane tot war. Bei sämtlichen medizinischen Einrichtungen in der Stadt wurden Erkundigungen eingeholt. Unidentifizierte Leichen wurden erneut untersucht und für die Ermittlung ausgeschlossen. Telefon- und Bankdaten wurden analysiert, Bildmaterial aus Überwachungskameras wurde gesichtet, und sämtliche Reiseveranstalter vor Ort lieferten die Belege dafür, dass Andrea die Gegend nicht freiwillig verlassen hatte. Während die groß angelegte, landesweite Suchaktion andauerte und alle größeren sozialen Online-Netzwerke rund um die Uhr überwacht wurden, entwarf ein Kriminalpsychologe das detaillierte und glaubhafte Profil einer jungen Frau mit echtem Ehrgeiz.
Einer jungen Frau, die Pläne für ihre Zukunft geschmiedet hatte.
Einer jungen Frau, die keinen Grund gehabt hatte, davonzulaufen oder sich das Leben zu nehmen.
Selbstverständlich war ausgiebig von den Medien Gebrauch gemacht worden, doch wie so oft hatte das mehr Probleme verursacht, als es genutzt hatte. Es war eine Menge Zeit und Mühe dafür verschwendet worden, Dutzenden von »Sichtungen« nachzugehen, die jede Woche nach Aufrufen im Fernsehen oder in den Zeitungen telefonisch in der Einsatzzentrale eingingen. Jede einzelne von ihnen, einschließlich derer aus dem Ausland, musste gründlich überprüft und widerlegt werden, doch das hatte Chambers’ Verteidigungsteam nicht davon abgehalten, sie begierig aufzugreifen. Hatte seine selbstsichere Anwältin nicht daran gehindert, vor Gericht zu behaupten, dass es schlichtweg absurd sei, irgendjemanden wegen Mordes an Andrea Keane zu verurteilen, solange diese regelmäßig gesichtet werde.
Thorne hatte sich nicht unterkriegen lassen und die Aufmerksamkeit der Geschworenen auf die sogenannte »Todeserklärung« gelenkt – ein vierzehnseitiges Dokument, das sämtliche Ermittlungen zusammenfasste, die durchgeführt worden waren, um die Behauptung zu stützen, dass Andrea Keane nicht mehr am Leben war. Er hatte sein eigenes Exemplar geschwenkt, Chambers’ Anwältin fest angesehen und ihr gesagt, dass es schlichtweg absurd sei zu glauben, Andrea Keane sei nicht ermordet worden.
Dann hatte er das Dokument so besonnen wie möglich wieder weggelegt, ohne dass ihm dabei die Bewegung und das gedämpfte Schluchzen und Aufstöhnen von den Besucherplätzen entgangen wäre. Er hatte den Blick weiterhin auf die Erklärung gerichtet und tief Luft geholt, als er an einem farblich hervorgehobenen Absatz hängen blieb:
Hoffnungen und Sehnsüchte
Die vermisste junge Frau wurde von verschiedenen Freunden als »glücklich«, »voller Tatendrang« etc. bezeichnet.Sie war auf der Suche nach einer Mietwohnung.Sie machte eine Ausbildung zur Krankenschwester.»Machen Sie mal Musik an, Sam.«
Karim beugte sich hinüber und schaltete das Radio ein. Der eingestellte Sender war Capital FM, und Karim fing sofort an, zu irgendeinem eintönigen Remix mit dem Kopf zu nicken. Thorne spielte mit dem Gedanken, seine Autorität einzusetzen, kam dann jedoch zu dem Entschluss, dass er keine Lust dazu hatte. Stattdessen schloss er die Augen und hielt sie für den Rest der Fahrt nach Norden geschlossen, um die Musik auszublenden, um alles andere auszublenden.
Als sie endlich auf den Parkplatz beim Peel Centre einbogen, war es beinahe Mittag. Während Thorne auf dem Weg zum Becke House versuchte sich zu entscheiden, ob er eine Kantinenmahlzeit über sich ergehen lassen oder sich ein Pub-Mittagessen im Oak genehmigen solle, sagte ihm ein Polizist, der das Gebäude gerade verließ, dass jemand auf ihn warte.
»Ein Privatdetektiv.«
»Was?«
»Viel Glück.«
Der Polizist fand das offenbar äußerst witzig, und Thornes Reaktion – er seufzte und ließ die Schultern hängen, als er die Treppe hinauf und ins Foyer von Becke House ging – schien die Sache noch amüsanter für ihn zu machen.
Thorne entdeckte seinen Besucher sofort und steuerte schnurstracks auf ihn zu. Um die fünfzig und ungepflegt, eine Symphonie in Braun und Beige mit ungewaschenem Haar und Hush Puppies. Er bestätigte so ungefähr jedes Vorurteil, das Thorne gegen armselige kleine Männer hatte, die Chevrolet Cavalier fuhren und sich ihr Brot damit verdienten, dass sie ihre Nase in die Angelegenheiten anderer Leute steckten.
»Ich bin Detective Inspector Thorne«, sagte er.
Der Mann sah verwirrt zu ihm auf. »Und?«
»Mit Ihrem Spürsinn ist es nicht weit her, was?«
Thorne drehte sich zu der Stimme um, die von der anderen Seite des Foyers kam, und sah, wie eine junge Frau auf ihn zuging und dabei errötete.
»Ich glaube, Sie suchen nach mir.«
Thorne griff sich instinktiv an die Krawatte, um sie zu lockern. »Entschuldigung.« Er spürte, wie der Mann, den er angesprochen hatte, hinter ihm grinste. »Ich war den ganzen Vormittag bei Gericht, deshalb …«
»Sind Sie davongekommen?«
Thorne starrte die Frau nur an, während sie noch stärker errötete.
Sie murmelte: »Tut mir leid, blöder Scherz« und reichte ihm eine Visitenkarte. »Ich bin Anna Carpenter, und …«
Thorne nahm die Karte entgegen, ohne einen Blick darauf zu werfen, und deutete auf die Sicherheitstür. »Gehen wir rauf in mein Büro.« Er zog seinen Ausweis durch das Kartenlesegerät und zeigte dem Polizisten am Empfang den Mittelfinger, der noch immer vor sich hinkicherte, als er Anna durch die Tür bugsierte.
Drittes Kapitel
Thorne starrte auf die Visitenkarte und das Foto vor ihm auf dem Schreibtisch. Er tippte mit dem Finger auf die verknitterte Karte. »F. A. Investigations«. Darunter der Name »Frank Anderson« und eine Adresse in Victoria. Sie sah aus wie eine von denjenigen, die man sich im Fünfzigerpack von Do-it-yourself-Maschinen an Bahnhöfen ausdrucken lassen konnte. Dünner Karton und ein Schrifttyp, der die Buchstaben aussehen ließ, als stammten sie aus einer kaputten Schreibmaschine. Ein kitschiges Bild von einem Schnüffler mit Lupe.
»Bekommen Sie keine eigene Visitenkarte?«, fragte Thorne.
Die Frau, die ihm gegenübersaß, fummelte an ihrem Daumennagel herum. »Mr Anderson sagt immer, er kümmert sich schon noch darum«, entgegnete sie. »Und er trifft sämtliche Verwaltungsentscheidungen. Ich glaube, momentan muss er sein Geld für wichtigere Dinge verwenden.«
Thorne nickte verständnisvoll. Wie zum Beispiel für Reparaturen an seinem Cavalier, dachte er.
»Das ist allerdings mein Fall.« Sie wartete, bis Thorne aufblickte und sie ansah. »Ich meine, Donna ist meine Klientin.«
Thorne konnte Anna Carpenters Entschlossenheit deutlich in ihrem Gesicht lesen und aus ihrer Stimme heraushören. Ihr Bedürfnis, Eindruck zu machen, sich selbst zu imponieren, auch wenn sie in ihrer Jeans und ihrer schwarzen Cordjacke nicht ganz glaubwürdig wirkte. Eher wie eine zu alt geratene Studentin, hätte Thornes Vater gesagt. Thorne schätzte sie auf Ende zwanzig. Sie hatte ein rundes, hübsches Gesicht. Wenn sie gerade nicht an ihren Fingernägeln herumfummelte, zog sie an einer Strähne langen, schmutzigblonden Haars und rutschte auf ihrem Stuhl hin und her, als habe sie Schwierigkeiten, länger als ein paar Sekunden am Stück still zu sitzen.
»Das habe ich nie infrage gestellt«, sagte Thorne. Er senkte abermals den Blick und widmete seine Aufmerksamkeit dem Foto. Es zeigte einen Mann, der mit zusammengekniffenen Augen in der Sonne saß, in die Kamera grinste und ein Glas Bier hochhielt. Er war schätzungsweise Mitte fünfzig, wobei die Haare auf seinem Kopf im Vergleich zu dem grauen Gewirr auf seiner schlaffen, nussbraunen Brust unnatürlich dunkel wirkten. Der Himmel war wolkenlos, im Hintergrund fiel die gezackte Kontur eines Berges schräg zu einem dunkelblauen Streifen Meer ab, und in der Ferne war ein kleines Segelboot zu erkennen. Möglicherweise saß er selbst auf einem Boot oder am Ende eines Piers. Vielleicht auch in einem Restaurant in Ufernähe.
»Griechenland? Spanien? Südfrankreich?« Thorne schüttelte den Kopf. »Florida vielleicht? Ich habe genauso wenig Ahnung wie Sie.«
»Birmingham ist es jedenfalls nicht«, erwiderte Anna. »Weiter bin ich allerdings auch nicht gekommen.«
Der Mann hatte die Augen fast ganz geschlossen, um sich gegen das grelle Licht zu schützen, doch sein Grinsen wirkte ungezwungen, mühelos. »Er macht einen glücklichen Eindruck.«
»Dazu hat er auch jeden Grund«, sagte Anna. »Eigentlich dachte ich, Sie würden ihn erkennen.«
Thorne sah ihn sich genauer an. In seiner Erinnerung regte sich etwas, aber nur ganz vage. »Wie heißt Ihre Klientin?«
Eine Pause, die Spur eines zufriedenen Lächelns. »Sie hat dieses Foto im Dezember zugeschickt bekommen.« Anna rutschte mit ihrem Stuhl nach vorn, bis sie dicht am Schreibtisch saß. »Zwei Monate vor ihrer Entlassung aus dem Gefängnis.«
»Was hat sie denn ausgefressen?«
»Verabredung zum Mord an ihrem Ehemann.«
»Wie lang?«
»Zwölf Jahre. Sie hat zehn abgesessen.«
»Langford?« Thorne starrte sie an. Der Groschen war gefallen, doch das Ganze ergab keinen Sinn. »Ihre Klientin ist Donna Langford?«
Anna nickte. »Sie benutzt jetzt ihren Mädchennamen, aber, ja, so hieß sie.«
»Jemand nimmt Sie auf den Arm, meine Liebe.«
»Das glaube ich nicht.«
»Sie wissen, was sie getan hat?« Thorne tippte mit dem Finger auf das Foto. »Warum dieser Mann unmöglich derjenige sein kann, für den sie ihn hält?«
»Sie hat mir einen Teil der Geschichte erzählt.«
»Ich werde Ihnen die ganze Geschichte erzählen«, sagte Thorne. »Dann können wir beide aufhören, unsere Zeit zu verschwenden.«
Thorne hatte in den letzten sechs Monaten an Fällen gearbeitet, an die er sich weniger deutlich erinnern konnte als an diesen, obwohl seit dem Mord an Alan Langford mehr als ein Jahrzehnt vergangen war.
Im Büro hatten sie ihn das »Epping-Forest-Barbecue« genannt.
Langford war immer ein Mann gewesen, der für Schlagzeilen sorgte. Im Lauf der Jahre hatte er etliche Journalisten auf Trab gehalten, sowohl Kriminalberichterstatter als auch Wirtschaftskorrespondenten; sein Immobilienimperium wuchs ebenso schnell an, wie seine Konkurrenten sich plötzlich zur Ruhe setzten, verschwanden oder tragische Unfälle hatten. Als seine verkohlten Überreste im Epping Forest in seinem ausgebrannten Jaguar entdeckt wurden, schaffte er es endgültig auf die Titelseiten. Nachdem dann auch noch ans Tageslicht kam, dass seine Frau seine Ermordung arrangiert hatte, wurden aus wenigen Absätzen ganze Spalten oder sogar Seiten.
Donna Langford, die makellos gekleidete Gattin eines Geschäftsmanns, Schirmherrin mehrerer örtlicher Wohltätigkeitsorganisationen und Dame der Gesellschaft, hatte jemanden dafür bezahlt, ihren Ehemann zu töten.
»Sie hat sich der Kontakte ihres Mackers bedient«, sagte Thorne. »Vielleicht stand der Typ, den sie engagiert hat, sogar in Langfords Adressbuch … unter ›K‹ für ›Killer‹.«
»Sehen Sie sich das Foto noch mal an«, forderte Anna ihn auf. »Das ist er. Sie müssen sich in Erinnerung rufen, wie er damals ausgesehen hat. Sie sehen doch, dass er gealtert ist, oder?«
Thorne warf abermals einen Blick auf das Foto. »Na ja, er sieht auf jeden Fall viel besser aus als beim letzten Mal, als ich ihn gesehen habe.«
»Wenn Sie von der Leiche im Auto sprechen, das war nicht er.«
»Donna hat ihn identifiziert.« Thorne bemühte sich, nicht herablassend zu klingen, was ihn jedoch einige Anstrengung kostete. »Es war sein Wagen und sein Schmuck. Recht viel mehr ist nämlich nicht von ihm übrig geblieben …«
»Sie hat nicht gewusst, dass er es auf die Art und Weise erledigen würde«, sagte Anna. »Der Mann, den sie engagiert hat.«
»Sie hat nie nachgefragt.« Thorne lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Sie hat in aller Ruhe einem Iren namens Paul Monahan fünfundzwanzigtausend Pfund bezahlt, der dann ein paar Scheine davon benutzt hat, um etwas Benzin und ein Paar Handschellen zu kaufen.«
»Wann wurde Ihnen klar, dass sie beteiligt war?«
»Ungefähr dreißig Sekunden, nachdem ich sie kennengelernt hatte«, sagte Thorne. »Als sie kam, um den Leichnam zu identifizieren. Ich habe Hinterbliebene auf unterschiedlichste Weise reagieren sehen, aber sie stand einfach nur da und … zitterte. Ich habe sie gefragt, ob alles in Ordnung ist, und sie hat mehr oder weniger an Ort und Stelle ein Geständnis abgelegt, während ihr Macker in der Ecke wie verkochtes Fleisch gestunken hat.«
»Wie haben Sie Monahan geschnappt?«
»Donna gab uns seinen Namen, und wir haben seine DNA einer Zigarettenkippe zugeordnet, die am Tatort gefunden wurde. Alles in allem hätte es nicht unkomplizierter sein können.« Thorne schob Anna das Foto auf dem Tisch hinüber. »Glauben Sie mir, so kinderleichte Fälle wie diesen hat man nicht alle Tage.«
Anna nickte und räusperte sich. »Donna saß zehn Jahre im Gefängnis, Inspector.«
Thorne schwieg für ein paar Sekunden und sammelte einige Unterlagen auf seinem Schreibtisch zusammen. Er setzte dabei dieselbe gelassene Miene auf, hinter der er sich den ganzen Vormittag bei Gericht verschanzt hatte, doch er konnte sich noch immer an den Geruch des Jaguar erinnern, an den Geschmack des Rauchs und der Asche, die nicht nur Asche war, und an die blassen Fetttropfen, die an den Sitzen klebten.
»Wenn Sie mich fragen, ist sie ziemlich glimpflich davongekommen«, sagte er. »Sie hat sich schuldig bekannt, womit man sich immer einen Gefallen tut, und es hat ihr sicher nicht geschadet, dass ihr Macker ein Mistkerl war, der sie vermutlich verprügelt hat, wenn er gerade nicht damit beschäftigt war, anderen Leuten die Beine brechen zu lassen. Ja, irgendwann musste es mit Alan Langford so enden, aber es war trotzdem ein verdammt scheußlicher Abgang.«
»Sehen Sie sich das Datum an«, sagte Anna. Sie schob Thorne das Foto wieder hinüber. »Unten rechts …«
Thorne nahm das Foto in die Hand. Das Datum war von der Kamera automatisch ins Bild eingeblendet worden: etwas mehr als drei Monate zuvor. »So was lässt sich mit Photoshop machen«, sagte er. »Außerdem könnte das ein Foto von irgendjemandem sein.«
»Donna sagt, dass es ihr Mann ist«, erwiderte Anna. Sie schüttelte den Kopf, überlegte, was sie noch sagen könnte, doch am Ende zuckte sie nur mit den Schultern und wiederholte es. »Sie schwört, dass das Alan ist.«
»Dann lügt sie.«
»Warum?«
»Weil … Na ja, vielleicht ist sie hinter Gittern ein bisschen komisch geworden. Da wäre sie nicht die Erste. Vielleicht will sie Geld. Vielleicht versucht sie, irgendeine große ›Justizirrtum‹-Geschichte loszutreten.«
»Sie weiß nicht mal, dass ich hier bin«, erklärte Anna. »Sie ist zu mir gekommen, weil sie nicht möchte, dass die Polizei involviert ist.«
Thorne war erstaunt. »Okay, und wie wollen Sie dann dieses Gespräch Ihrer Klientin erklären?« Er konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen und fühlte sich mehr als nur ein bisschen schuldig, als er beobachtete, wie sie wieder anfing herumzuzappeln und zu erröten.
»Ich werde einfach ehrlich sein und ihr sagen, dass ich nicht weitergekommen bin«, erwiderte Anna. »Dass ich nicht wusste, was ich sonst hätte tun sollen. Ich werde ihr sagen, dass ich zwei Wochen lang dieses beschissene Foto angeglotzt habe und genauso schlau bin wie vorher.«
»Warum sind Sie denn zu mir gekommen?«, wollte Thorne wissen.
»Ich dachte, Sie könnten womöglich ein bisschen mehr Informationen aus dem Foto herauslesen.« Sie sah Thorne an, wartete jedoch vergeblich auf eine Reaktion. »Haben Sie nicht Möglichkeiten, um … Bilder zu vergrößern oder was auch immer? Ich meine, man muss doch irgendwie herausfinden können, wo dieses Foto gemacht wurde. Haben Sie denn kein Computerprogramm, mit dem sich ein geografisches Profil erstellen lässt, oder so was?«
»Wir sind hier nicht bei CSI«, sagte Thorne. »Wir haben nicht mal einen Kopierer, der richtig funktioniert.«
»Außerdem dachte ich, es würde Sie vielleicht interessieren.« Anna beugte sich plötzlich zu ihm vor. »Dumm von mir, das sehe ich, aber es schien mir eigentlich eine gute Idee zu sein. Schließlich war es Ihr Fall, also hatte ich gehofft, wenn Sie das Foto sehen, würden Sie zumindest denken, dass er vielleicht doch noch nicht … abgeschlossen ist.« Sie starrte Thorne noch ein paar Sekunden lang an, dann lehnte sie sich zurück, griff nach einer Haarsträhne und zog an ihr.
»Das ist Zeitverschwendung«, sagte Thorne. »Tut mir leid, aber ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Genau genommen fällt mir nichts ein, was nicht wichtiger wäre.« Er schob seinen Stuhl zurück, und nach ein oder zwei Sekunden verstand Anna die Botschaft und tat dasselbe.
»Dann halte ich Sie nicht länger auf«, sagte sie.
Sie ging einen Schritt auf die Tür zu.
Thorne fand, dass sie aussah, als sei sie ungefähr vierzehn Jahre alt. »Hören Sie … ich werde das meinem Boss mal vorlegen, in Ordnung?« Er sah, wie sich ihr Gesichtsausdruck veränderte, und hob die Hand. »Er wird allerdings dasselbe sagen wie ich, also erwarten Sie sich nicht zu viel.« Dann nahm er das Foto noch einmal in die Hand und nickte. »Davon könnte ich auch ein bisschen was vertragen«, sagte er. »Sonne und Strand.«
»Tom?«
Thorne blickte auf und sah Detective Inspector Yvonne Kitson in der Türöffnung stehen. Sie teilten sich das Büro, und die meiste Zeit war Thorne mit dieser Regelung durchaus glücklich. Sie war ihm inzwischen wesentlich sympathischer als zu ihren Überflieger-Zeiten, und er vermutete, dass es ihr selbst ebenso ging. Genau wie Thorne hatte sie noch immer ein Händchen dafür, andere vor den Kopf zu stoßen, doch es war schwer, ihr keine Bewunderung dafür zu zollen, wie sie ihre Karriere, die nach einer außerehelichen Affäre mit einem Vorgesetzten katastrophal entgleist war, wieder in die richtigen Bahnen gelenkt hatte.
»Wie bei einem Schrank zum selber Zusammenbauen«, hatte sie einmal zu Thorne gesagt. »Eine lose Schraube, und das Ganze fällt in sich zusammen.«
Jetzt warf sie einen Blick auf Thornes Besucherin. Er deutete auf Anna, während er mit dem Foto wedelte, und stellte sie vor.
Kitson nickte eine flüchtige Begrüßung und wandte sich wieder Thorne zu. »Ich dachte nur, es interessiert dich vielleicht, dass die Geschworenen noch nicht entschieden haben.«
»Ja.« Thorne stand auf und ging um den Schreibtisch herum.
Anna knöpfte ihre Jacke zu. »In dem Fall, wegen dem Sie vor Gericht aussagten?«
Thorne nickte und musste daran denken, dass er Adam Chambers' Blick nicht standgehalten hatte. »Der nicht ganz so … kinderleicht ist«, sagte er.
Detective Chief Inspector Russell Brigstockes Büro befand sich auf demselben Flur, ein paar Schritte von dem Zimmer entfernt, das Thorne sich mit Yvonne Kitson teilte. Als Thorne es betrat, war Brigstocke gerade am Telefon, deshalb ließ er sich auf einen Stuhl fallen und wartete. Er dachte an ein achtzehnjähriges Mädchen, dessen Leiche noch immer irgendwo herumlag und auf einen neugierigen Hund wartete, und an einen Mann, der mitten im Nirgendwo schreiend gestorben war, mit Handschellen an das Lenkrad eines Autos gefesselt.
Er versuchte, die beiden Morde, zwischen denen so viele Jahre vergangen waren, voneinander zu trennen. Das Durcheinander von realen und imaginären Bildern zu entwirren.
Er wollte sich über das Richtige Gedanken machen …
Brigstocke legte den Hörer auf und griff nach einem Kaffeebecher. Er trank einen Schluck, zog eine Grimasse.
»Sie wissen, dass die Geschworenen noch nicht entschieden haben?«, erkundigte sich Thorne.
Brigstocke nickte. »Hat keinen Sinn, sich den Kopf zu zerbrechen«, sagte er. »Ich habe gehört, es ist heute Vormittag richtig gut gelaufen.«
»Sam hat Ihnen gesagt, die Sache wäre unter Dach und Fach, oder?«
»Ich sage nur, dass wir alles getan haben, was wir konnten.«
»Alles, außer sie zu finden«, entgegnete Thorne.
Mit einem Mal fröstelte ihn. Ihm wurde bewusst, wie dünn und leicht sein Anzug war, und er vermisste das vertraute Gewicht seiner Lederjacke. Genau genommen waren die meisten Nicht-Uniformierten so gekleidet wie er gerade. Es hatte den Anschein, als würden sich alle, die in eine zivile Einheit befördert wurden, sofort den Modegeschmack eines zweitklassigen Immobilienmaklers aneignen, doch Thorne hatte immer dem Reiz des Marks-&-Spencer-Zweiteilers von der Stange, des bügelfreien Hemds und der schimmernden Krawatte widerstanden.
»Hier drin ist es verdammt kalt«, stellte er fest.
Brigstocke nickte. »Im Heizkörper ist Luft, und keiner hat einen Schlüssel.«
Thorne erhob sich und ging zum Heizkörper hinüber, bückte sich und legte die Hand ans Metall, das bestenfalls lauwarm war. Dann stand er wieder auf und presste die Waden dagegen. Als er das Geräusch hörte, das er kennen und fürchten gelernt hatte, drehte er den Kopf und sah Brigstocke einen Stapel Spielkarten mischen.
»Ich habe einen neuen Trick für Sie.«
»Muss das sein?«
Aus Gründen, die sich keiner so recht erklären konnte, hatte Brigstocke in den vergangenen Monaten ein starkes Interesse für Zauberei entwickelt. Er besuchte einen Kurs in einem Club in Watford und hatte damit begonnen, bei diversen Partys und Konferenzen der Metropolitan Police gegen Biergeld Zaubertricks vorzuführen. Außerdem bestand er darauf, an jedem, der nicht schnell genug flüchten konnte, neue Tricks auszuprobieren.
»Denken Sie einfach an eine beliebige Karte«, sagte Brigstocke und wechselte in den Zauberer-Jargon. »Verraten Sie mir aber nicht, an welche. Ich meine, was für ein Trick wäre das denn?«
Der Trick war ziemlich gut, und Thorne gab sich alle Mühe, ermutigend zu klingen, doch er hatte noch nie wirklich verstanden, was die Faszination an Zauberei war. Er hatte kein echtes Interesse daran, es sei denn, der Zauberer erklärte, wie der Trick funktionierte. Russell Brigstocke war kein schlechter Polizist, aber er war ganz bestimmt kein Magier.
»Wer war die junge Frau in Ihrem Büro?«, erkundigte sich Brigstocke und legte die Karten beiseite.
Thorne berichtete ihm von Anna Carpenter und dem »seltsamen Fall der sonnengebräunten Leiche«. Brigstocke hatte nicht an der Langford-Untersuchung mitgearbeitet, erinnerte sich aber trotzdem recht gut an die Ermittlungen.
»Von den Toten auferstanden«, sagte er. »Das nenne ich einen raffinierten Trick.«
»Wäre schon beeindruckend.«
»Irgendwas dran?«
Thorne nahm das Foto aus der Tasche und reichte es ihm. »Weiß Gott, was Donna Langford im Schilde führt«, sagte er. »Ich hoffe nur, dieses Detektivbüro knöpft ihr ordentlich Kohle ab.«
»Sieht er ihm überhaupt ähnlich?«
Thorne stand neben Brigstocke und betrachtete nochmals das Foto. Das gefärbte Haar, das Blinzeln, das Grinsen. Die vage Erinnerung wurde etwas deutlicher, doch das lag sicher nur daran, dass Anna Carpenter ihm gesagt hatte, um wen es sich angeblich handelte. »Er sieht aus wie viele«, sagte er. »Er sieht aus wie ein schlechter Schauspieler, der einen Gangster im Urlaub spielt.«
»Was haben Sie ihr gesagt?«
»Dass sie ihre Zeit verschwendet und dass wir es uns nicht leisten können, unsere Zeit zu verschwenden.«
»Stimmt genau«, erwiderte Brigstocke. »Nicht, wenn wir die neuesten ›Police Performance Assessment‹-Richtlinien lesen und bis heute Abend einen zwölfseitigen Bericht über standardisierte Arbeitsabläufe fertigstellen müssen.«
Thorne lachte und spürte, wie das das Kältegefühl linderte.
Sie unterhielten sich ein paar Minuten lang über Fußball, dann über Privates. Thorne erkundigte sich nach Brigstockes drei Kindern. Der Detective Chief Inspector fragte Thorne, wie, in aller Welt, seine Freundin es verkrafte, bei der Kidnapping-Einheit zu arbeiten und sich gleichzeitig mit jemandem die Wohnung zu teilen, der Tottenham-Spurs-Fan war und Countrymusic hörte.
»Wie wird sie nur tagein, tagaus mit all dem Schmerz und Stress fertig?«, fragte Brigstocke.
Thorne schüttelte den Kopf und wartete auf die Pointe.
»Und die Entführungen sind bestimmt noch schlimmer …«
Sie plauderten und scherzten. Nahmen sich auf den Arm und redeten Blödsinn. Schlugen Zeit tot und taten so, als verschwendeten sie keinen Gedanken an die zwölf Fremden, die in einem Raum am anderen Ende der Stadt diskutierten.
Viertes Kapitel
Anna schlang ihr Abendessen hinunter.
Es war immer ziemlich komisch, wenn sie mit Megan und Megans neuestem Freund allein war – in diesem Fall der zugegebenermaßen hinreißende, aber augenscheinlich hirntote Daniel –, und es half nicht, dass diesmal Megan gekocht hatte. Annas Mitbewohnerin brachte eigentlich nur Pasta halbwegs zustande und verwendete gewöhnlich das als Zutaten, was gerade im Kühlschrank herumlag. Ihre neueste Kreation enthielt Karotten, Erbsen aus der Dose und hart gekochte Eier, und Daniel dabei zuzusehen, wie er alles mit einer braunen Soße übergoss, war für Annas Appetit nicht gerade förderlich. Ein halber Teller genügte ihr letztendlich, um satt zu werden.
Trotzdem schmeckte es besser als Sushi …
Nach zehn Minuten Small Talk, bei dem niemand fragte, wie ihr Tag gewesen sei, und weiteren zehn Minuten, in denen Anna immer gereizter wurde, als Daniel es sich auf dem Sofa bequem machte, rauchte und sich vor dem Abwasch drückte, ging sie nach oben in ihr Zimmer, legte sich aufs Bett und sah fern. Sie zappte sich durch die Lokalnachrichten, eine Quizshow, aus der sie sich überhaupt keinen Reim machen konnte, und das sinnlose Remake einer Sitcom, die bereits in der Originalfassung sinnlos gewesen war.
Vermutlich war das ein Anzeichen dafür, dass man alt wurde, dachte Anna: Wenn im Fernsehen ein Remake von etwas lief, mit dem man aufgewachsen war. Es musste ein schlechtes Zeichen sein. Objektiv betrachtet ließ es ihre momentane Situation für Außenstehende – wie zum Beispiel für ihre Eltern – noch trauriger erscheinen.
Für ein Butterbrot zu arbeiten und wie ein Student zu leben.
Das Haus war nur ein paar Gehminuten vom Büro entfernt, was Anna neben der unterdurchschnittlichen Miete darüber hinwegtröstete, dass sie die Gegend hasste. Es half ihr dabei, zumindest manchmal zu vergessen, dass sie mit ihrer neunzehnjährigen Mitbewohnerin nichts gemein hatte und dass sie viel schöner gewohnt hatte, als sie tatsächlich noch Studentin gewesen war.
Damals waren ihre Eltern natürlich gerne bereit gewesen, ein bisschen etwas beizusteuern und ihr bei der Renovierung zu helfen. Sie waren unangekündigt aufgetaucht und hatten strahlend vor der Tür gestanden, mit dem Radio, das sie sich zu Hause immer ausgeliehen hatte, und einer brandneuen Mikrowelle. Außerdem hatten sie ihr witzige Briefe und Esspakete geschickt. Später hatte sich jedoch alles geändert.
»Was, zum Teufel, hast du dir denn dabei gedacht?«
Ihr Vater verlor nicht oft die Beherrschung, und ihn so fassungslos, so aufrichtig bestürzt zu sehen, als Anna verkündete, dass sie ihren Job bei der Bank gekündigt habe, war äußerst verstörend gewesen. Sie schämte sich schon beim Gedanken daran, brach in kalten Schweiß aus und war den Tränen genauso nahe wie damals, als sie es ihm erzählt hatte.
»Was sollen wir denn davon halten, deine Mum und ich?«
Als Anna damit begonnen hatte, ihre Entscheidung kundzutun, hatte sich ihre Mutter langsam von ihrem Stuhl erhoben, ohne irgendetwas zu erwidern. Sie hatte sie nur angestarrt, mit gerötetem Gesicht und schwer atmend, als kostete es sie große Überwindung, nicht zu ihrer Tochter zu gehen und ihr eine Ohrfeige zu verpassen.
»Es tut mir wirklich leid, dass ihr verärgert seid«, hatte Anna gesagt. Sie hatte im überheizten Wohnzimmer ihrer Eltern gestanden und die Stimme ihrer Mutter in ihrer eigenen Stimme gehört. Den Tonfall, der jenen Gelegenheiten vorbehalten gewesen war, wenn Anna oder ihre Schwester irgendetwas besonders Dummes angestellt hatten. »Aber ich glaube, ich bin alt und hässlich genug, um selbst Entscheidungen zu treffen, meint ihr nicht?«
Ihr Vater hatte den Mund auf- und zugemacht. Ihre Mutter hatte sich nur wieder hingesetzt.
Um selbst völlig bescheuerte Entscheidungen zu treffen …
Detective Inspector Tom Thorne wusste nichts über Annas Vergangenheit und ihre fragwürdigen Lebensentscheidungen, doch er hatte es offensichtlich für dumm von ihr gehalten, sich von Donna Langford engagieren zu lassen. Als sie ihre Unterhaltung auf dem Rückweg auf die Südseite des Flusses hatte Revue passieren lassen, war sie zu dem Entschluss gelangt, dass er eigentlich recht freundlich gewesen war, wenn auch ein wenig herablassend. Nein, sogar mehr als freundlich, da er jedoch mit seiner Skepsis und seinem Widerwillen nicht hinterm Berg gehalten hatte, machte sie sich keine großen Hoffnungen.
Als sie die Victoria-U-Bahn-Station verließ, wartete eine SMS auf sie: »Wie vermutet. Wir können in dieser Sache nicht viel tun. Viel Glück mit Donna.«
Sie hatte bereits die Hälfte einer Antwort getippt und versucht, eine witzige Bemerkung über Thornes kaputten Fotokopierer zu formulieren, als sie es sich anders überlegte und löschte, was sie geschrieben hatte.
Auf einen glücklichen Zufall brauchte sie nicht zu hoffen, beschloss Anna. Sie konnte sich nicht vorstellen, woher dieser hätte kommen sollen und wie er eine Wende herbeiführen könnte. Er würde sie nicht davor bewahren, den Anruf tätigen zu müssen, vor dem ihr graute; das Geld zurückgeben zu müssen, das sie im Voraus erhalten hatte, und ihrer Klientin – ihrer einzigen Klientin –gegenüber zuzugeben, dass ihr die Ideen ausgegangen waren.
Im Erdgeschoss hatten ihre Mitbewohnerin und der bescheuerte Freund ihrer Mitbewohnerin Musik aufgelegt. Anna stellte den Fernseher lauter. Sie ließ sich wieder aufs Bett fallen, murmelte eine Schimpftirade und schlug mehrmals mit den Händen auf die weiche Bettdecke.
Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern, hatte Thorne gesagt. Tja, sie musste das nicht. Sie brauchte das Geld, und sie brauchte etwas, das ihr Blut ein wenig in Wallung brachte. Was auch immer Tom Thorne von Donna Langford halten mochte, sie hatte niemanden, an den sie sich wenden konnte, und war sogar noch verzweifelter, als Anna bei ihrem ersten Treffen vermutet hatte.
Außerdem hatte Thorne etwas an sich. Etwas, das ihr sagte, dass sie ihn nicht völlig abschreiben durfte. Sie hatte es in seinem Gesicht gesehen, als sie ihn provoziert hatte, als sie ihm gesagt hatte, sie habe geglaubt, er sei womöglich interessiert. Als sie sich ungeniert alle Mühe gegeben hatte, enttäuscht zu klingen.
Sie setzte sich auf und griff nach der Fernbedienung. Dachte lächelnd an ihren armen, gekränkten Vater. Er war jemand, auf den man sich immer verlassen konnte, wenn es um eine ordentliche Moralpredigt ging, ob diese nötig war oder nicht.
Selbst ist der Mann, geschenkte Gäule und höflich zu sein, kostet nichts. Trag immer frische Unterwäsche, denn du könntest einen Unfall haben, und so weiter.
Jeder ist seines Glückes Schmied …
»Er hat nicht ganz unrecht«, sagte Louise Porter.
»Ja, genau.« Thorne hatte ihr von Russell Brigstockes Scherz erzählt: von den Entführungen und der Countrymusic.