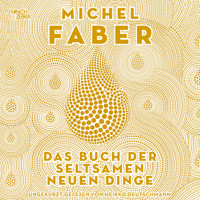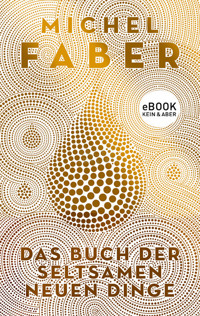
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge Pastor Peter Leigh wird auf die Reise seines Lebens geschickt: Er soll den Einwohnern eines fernen Planeten seinen Glauben näherbringen. Die Mission verlangt von Peter ein enormes Opfer, denn seine Frau Bea muss auf der Erde zurückbleiben und durchlebt dort eine schwierige Zeit. Noch nie in der Geschichte der Menschheit musste eine Liebe eine derart große Distanz überbrücken. Wird es gelingen?
»Das Buch der seltsamen neuen Dinge« ist eine unvergessliche Liebesgeschichte mit einem einzigartigen Setting und einer emotionalen Präzision, die direkt ins Herz fährt. Dieser Roman ist ein monumentales Meisterwerk, das sich über alle Genregrenzen hinwegsetzt.
»Der bewegendste Abschiedsroman, den ich je gelesen habe.« Clemens J. Setz
»Furios. Lesend bei sich sein und doch nicht von dieser Welt - das ging lang nicht so gut wie mit diesem Roman.« Die Zeit
»Ein berührendes Buch über große Liebe, Sehnsucht und Verlust.« Brigitte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 823
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Michel Faber ist 1960 in den Niederlanden geboren und lebt heute in England. Er ist Autor von neun Romanen, darunter Die Weltenwanderin (verfilmt als Under the Skin) sowie Das karmesinrote Blütenblatt. Sein neuester Roman Das Buch der seltsamen neuen Dinge wurde vom New Yorker als eines der besten Bücher des Jahres bezeichnet, wurde in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt und ist ein internationaler Bestseller.
ÜBER DAS BUCH
ICH BIN BEI DIR ALLE TAGE BIS ANS ENDE DER WELT.
Der junge Pastor Peter Leigh wird auf die Reise seines Lebens geschickt – nur darf seine Frau Bea ihn nicht begleiten. Um in Kontakt zu bleiben, schicken sie sich Briefe. Doch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit musste eine Liebe eine derart große Distanz überbrücken.
»Der bewegendste Abschiedsroman, den ich in meinem Leben gelesen habe. Das Buch lässt den Leser mit zerzauster Seele zurück, doch zugleich beglückt und verzaubert.«
Clemens J. Setz
»Im Kern dieses Romans steckt die Frage, was man für die Liebe zu opfern bereit ist. Er ist ein einziges Wunder, mit dem erzählerischen Motor einer Lokomotive.«
Yann Martel
»Das Porträt einer von der Distanz bedrohten Liebe. Ein Meisterwerk – wahnsinnig fesselnd.«
David Mitchell
»Noch nie wurde ich von einem Buch dermaßen überrascht. Unwiderstehlich und glaubwürdig und Objekt meiner absoluten Bewunderung.«
Philip Pullman
»Merkwürdig und verstörend, das Werk eines Genies. Das Buch ist verzweifelnd schön, traurig und unvergesslich.«
David Benioff (Produzent von Game of Thrones)
»Michel Fabers überwältigender Roman ist manchmal kaum auszuhalten – und ein selten intensives Leseerlebnis.«
Benjamin Maack, Spiegel online
Für Eva, immer
IDEIN WILLE GESCHEHE
1 Vierzig Minuten später war er in den Wolken
»Ich wollte noch was sagen«, sagte er.
»Dann sag es«, erwiderte sie.
Er schwieg und behielt die Straße im Blick. In der Dunkelheit am Stadtrand war nichts zu sehen außer den Rücklichtern anderer Wagen in der Ferne, dem endlos abrollenden Asphaltstreifen, dem riesigen, zweckbestimmten Zubehör einer Autobahn.
»Gott ist vielleicht enttäuscht, dass ich das überhaupt denke«, sagte er.
»Er weiß es so oder so schon«, seufzte sie. »Da kannst du es mir ruhig sagen.«
Er schaute ihr ins Gesicht, um zu sehen, aus welcher Stimmung heraus sie das gesagt hatte, doch die obere Hälfte ihres Kopfs einschließlich der Augen lag im Schatten des getönten Rands der Windschutzscheibe. Die untere Hälfte ihres Gesichts war mondhell. Der Anblick ihrer Wange, ihrer Lippen, ihres Kinns – so vertraut, so sehr Teil des Lebens, wie er es kannte – versetzte ihm bei dem Gedanken, sie entbehren zu müssen, einen scharfen Stich.
»Mit künstlicher Beleuchtung sieht die Welt netter aus«, sagte er.
Sie fuhren schweigend weiter. Radiogeschnatter oder Berieselung durch Musik vom Band ertrugen sie beide nicht. Auch darin passten sie zueinander.
»Wars das?«, fragte sie.
»Ja. Was ich damit sagen will … die unberührte Natur gilt doch als das Nonplusultra und alles vom Menschen Geschaffene als Schande, weil er alles nur zumüllt. Aber wir hätten nicht halb so viel Spaß an der Welt, wenn wir – wenn der Mensch … die Menschheit, meine ich …«
(Mach schon, besagte ihr Brummen.)
»… wenn wir nicht alles mit künstlichem Licht versehen hätten. Elektrisches Licht ist wirklich ein Gewinn. Es macht Nachtfahrten wie diese erträglich. Schön sogar. Stell dir doch mal vor, wir müssten hier im Stockdunkeln fahren. Denn das ist ja der natürliche Zustand der Welt bei Nacht, oder? Völlige Dunkelheit. Stell es dir nur mal vor. Du hättest keine Ahnung, wo es langgeht, könntest höchstens ein paar Meter weit sehen. Ganz schön stressig. Und wolltest du zu einer Stadt – na, in einer nichttechnisierten Welt gäbe es wohl keine Städte –, aber wolltest du irgendwohin, wo andere Menschen leben, naturnah leben, vielleicht um ein paar Lagerfeuer herum … die würdest du erst sehen, wenn du wirklich da bist. Nichts wärs mit dem zauberhaften Anblick, den dir eine Stadt aus ein paar Kilometern Entfernung bietet mit ihrem Lichtergefunkel, wie Sterne über den Bergen.«
»Mhm.«
»Und im Auto selbst … oder in der Pferdekutsche, falls es in dieser natürlichen Welt keine Autos gäbe, wäre es auch stockdunkel. Und in einer Winternacht sehr kalt. Was aber haben wir hier?« Er nahm eine Hand vom Steuer (beim Fahren hielt er beide Hände immer symmetrisch am Lenkrad) und wies auf das Armaturenbrett. Die üblichen Lämpchen strahlten sie an. Temperatur. Uhrzeit. Kühlwasser. Öl. Tempo. Tankanzeige.
»Peter …«
»Schau mal da!« Mehrere Hundert Meter voraus stand eine kleine überladene Gestalt im Schein einer Laterne. »Ein Anhalter. Den nehmen wir mit, ja?«
»Nein.«
Ihr Tonfall hielt ihn davon ab, ihr zu widersprechen, so selten sie auch eine Gelegenheit ausließen, sich Fremden gegenüber freundlich zu zeigen.
Der Anhalter hob hoffnungsvoll den Kopf. Als ihn die Scheinwerfer erfassten, wurde aus der schemenhaften menschlichen Erscheinung sekundenlang eine erkennbare Person. Er hielt ein Schild mit der Aufschrift hethrow hoch.
»Seltsam«, meinte Peter im Vorbeirauschen. »Er könnte doch einfach die U-Bahn nehmen.«
»Letzter Tag auf der Insel«, sagte Beatrice. »Letzte Gelegenheit, was zu erleben. Wahrscheinlich hat er sein britisches Geld in einer Kneipe aufgebraucht und gedacht, ich brauch ja bloß noch genug für die Bahn. Sechs Gläser später steht er im Freien und stellt ernüchtert fest, dass er nur noch sein Flugticket und ein Pfund siebzig hat.«
Es klang plausibel. Warum dann aber so ein verlorenes Schaf in der Patsche sitzen lassen? Das sah Bea nicht ähnlich.
Er wandte sich wieder ihrem halb im Dunkeln liegenden Gesicht zu und sah zu seiner Bestürzung, dass an ihrem Kinn und ihren Mundwinkeln Tränen glitzerten.
»Peter …«, sagte sie.
Wieder nahm er eine Hand vom Steuer, diesmal, um ihr die Schulter zu drücken. Weiter vorn hing ein Schild mit einem Flugzeugsymbol über der Fahrbahn.
»Das ist unsere letzte Gelegenheit, Peter.«
»Die letzte Gelegenheit?«
»Uns zu lieben.«
Die Kontrolllichter blinkten sanft und machten tick-tick-tick, als Peter auf die Fahrspur Richtung Flughafen lenkte. Die Worte »uns lieben« schmissen sich an sein Gehirn und wollten hinein, obwohl da kein Platz war. »Das ist nicht dein Ernst«, hätte er beinahe gesagt. Aber auch wenn sie einen feinen Humor hatte und gern lachte, in wichtigen Dingen scherzte sie nie.
Im Weiterfahren machte sich das Gefühl, dass sie nicht auf einer Wellenlänge waren, dass sie in diesem kritischen Augenblick unterschiedliche Bedürfnisse hatten, wie ein unangenehmer Gast im Wagen breit. Seiner Meinung, seinem Gefühl nach hatten sie sich gestern Morgen richtig verabschiedet, und die Fahrt zum Flughafen war jetzt nur … eine Art Nachtrag. Gestern Morgen hatte alles so gestimmt. Sie waren endlich durch mit ihrer To-do-Liste. Seine Tasche war schon gepackt. Bea hatte den Tag frei, sie hatten tief und fest geschlafen, waren bei strahlendem Sonnenschein unter der warmen gelben Bettdecke aufgewacht. Sie hatten Joshua, den Kater, der sich auf fast komische Weise zu ihren Füßen zusammengerollt hatte, weggeschubst und sich wortlos, langsam und mit großer Zärtlichkeit geliebt. Hinterher war Joshua wieder aufs Bett gesprungen und hatte Peter vorsichtig eine Pfote aufs Schienbein gelegt, als wollte er sagen: Geh nicht weg, ich behalt dich hier. Es war ein ergreifender Augenblick gewesen, der die Lage besser zum Ausdruck gebracht hatte, als Sprache es gekonnt hätte; vielleicht hatte die Katze mit ihrer fremdartigen Niedlichkeit auch nur einen Schutzpelz um den blanken menschlichen Schmerz gelegt. Wie auch immer. Es war perfekt gewesen. Sie hatten einander in den Armen gelegen und Joshuas kehligem Schnurren gelauscht, während ihr Schweiß in der Sonne verdunstete und ihr Puls sich langsam wieder beruhigte.
»Einmal noch«, sagte sie jetzt zu ihm durch den Lärm des Motors auf der dunklen Autobahn, unterwegs zu dem Flugzeug, das ihn nach Amerika und noch weiter weg bringen würde.
Er sah auf die Funkuhr am Armaturenbrett. In zwei Stunden sollte er am Check-in-Schalter sein; zum Flughafen waren es noch rund fünfzehn Minuten.
»Du bist wunderbar«, sagte er. Wenn er den Wörtern genau die richtige Betonung gab, würde sie vielleicht einsehen, dass sie das von gestern nicht übertreffen könnten.
»Ich will nicht wunderbar sein«, sagte sie. »Ich will dich in mir.«
Er schwieg für ein paar Sekunden. Auch die Kunst, sich veränderten Gegebenheiten schnell anzupassen, hatten sie gemein.
»Direkt am Flughafen gibt es diese grässlichen Tagungshotels«, sagte er. »Wir könnten uns für eine Stunde ein Zimmer nehmen.« Das »grässlich« bedauerte er, es hörte sich an, als wollte er sie davon abbringen, ohne es zuzugeben. Dabei sollte es nur heißen, dass es Hotels waren, die sie nach Möglichkeit sonst mieden.
»Such uns eine ruhige Parkbucht«, sagte sie. »Wir können es im Auto machen.«
»Verdampft!«, rief er, und beide lachten.
»Verdampft!« statt »Verdammt!« zu sagen hatte er sich antrainiert, als er Christ geworden war. So konnte er den Fluch noch abfangen, wenn er schon halb heraus war.
»Ich meine es ernst«, sagte sie. »Halte irgendwo – vielleicht nur nicht da, wo uns jemand hinten drauffahren kann.«
Im Weiterfahren wirkte die Straße plötzlich anders auf Peter. Theoretisch war es noch derselbe Asphaltstreifen, begrenzt vom selben Zubehör und denselben dünnen Metallzäunchen, doch ihr neuer Plan hatte die Straße verändert. Es war jetzt keine gerade Linie zu einem Flughafen mehr, sondern ein geheimnisvolles Hinterland der dunklen Umwege und Schlupflöcher. Wieder ein Beweis dafür, dass die Wirklichkeit nichts Objektives war, sondern ständig von uns umgeformt wurde.
Natürlich war jeder imstande, die Wirklichkeit umzugestalten. Darüber unterhielten sich Peter und Beatrice oft. Über die Schwierigkeit, den Leuten klarzumachen, dass das Leben nur so trostlos und einengend war, wie man es wahrnahm. Die Schwierigkeit, den Leuten zu vermitteln, dass die Unabänderlichkeiten des Daseins gar nicht so unabänderlich waren. Die Schwierigkeit, ein einfacheres Wort für »unabänderlich« zu finden.
»Hier vielleicht?«
Statt zu antworten legte Beatrice ihm nur die Hand auf den Oberschenkel. Er lenkte den Wagen elegant auf einen Lkw-Parkplatz. Sie würden darauf vertrauen müssen, dass es nicht zu Gottes Plan gehörte, sie von einem Vierzigtonner plattfahren zu lassen.
»Ich habe das noch nie gemacht«, sagte er, als er die Zündung ausgeschaltet hatte.
»Meinst du, ich?«, sagte sie. »Wir kriegen das schon hin. Komm mit nach hinten.«
Sie stiegen auf beiden Seiten aus und waren Sekunden später auf der Rückbank wieder vereint. Wie Fahrgäste saßen sie da, Schulter an Schulter. Die Sitzpolster rochen nach anderen Leuten – Freunden, Nachbarn, Mitgliedern ihrer Kirchengemeinde, Anhaltern. Umso mehr zweifelte Peter daran, ob er hier und jetzt lieben könnte, lieben sollte. Obwohl … es hatte auch etwas Aufregendes. Sie griffen nacheinander, suchten die geschmeidige Umarmung, doch im Dunkeln waren ihre Hände ungeschickt.
»Was meinst du, wie schnell die Innenbeleuchtung die Batterie verbraucht?«, fragte sie.
»Keine Ahnung«, sagte er. »Wir sollten es nicht drauf ankommen lassen. Wir wollen ja auch den Vorbeifahrenden keine Show bieten.«
»Die vergiss ruhig«, sagte sie, den vorbeiwischenden Scheinwerfern zugewandt. »Ich habe mal einen Artikel über ein entführtes kleines Mädchen gelesen. Sie konnte aus dem Auto springen, als es auf der Autobahn abbremste. Der Entführer packte sie, sie wehrte sich nach Kräften und schrie um Hilfe. Autos rauschten vorbei. Niemand hielt an. Ein Fahrer wurde später befragt. ›Ich bin so schnell gefahren‹, sagte er, ›da hab ich nicht geglaubt, was ich sehe.‹«
Er rutschte unbehaglich auf dem Sitz. »Schreckliche Geschichte. Und vielleicht kein ganz günstiger Zeitpunkt, um sie zu erzählen.«
»Ich weiß, ich weiß, entschuldige. Ich bin gerade etwas durch den Wind.« Sie lachte nervös. »Es ist einfach so schlimm … dich zu verlieren.«
»Du verlierst mich ja nicht. Ich fahre nur für einige Zeit weg. Dann komme ich …«
»Bitte, Peter. Jetzt nicht. Damit sind wir doch durch. Da haben wir getan, was wir können.«
Sie beugte sich vor, und er dachte, sie würde anfangen zu weinen. Doch sie angelte etwas aus dem Spalt zwischen den Vordersitzen. Eine kleine Taschenlampe. Die knipste sie an und legte sie auf die Kopfstütze des Beifahrersitzes; sie fiel runter. Dann klemmte sie die Lampe so in den schmalen Spalt zwischen Sitz und Tür, dass ihr Strahl auf den Boden schien.
»Schön gedämpft«, sagte sie wieder ruhig. »Gerade so hell, dass wir uns sehen können.«
»Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme«, sagte er.
»Schauen wir doch mal«, sagte sie und knöpfte ihre Hemdbluse auf, sodass ihr weißer BH und die Rundung ihres Busens zum Vorschein kamen. Sie ließ die Bluse an ihren Armen runtergleiten und streifte den seidigen Stoff über ihre Handgelenke. Dann schob sie die kräftigen Daumen unter ihren Rockbund und zog Rock, Strumpfhose und Slip mit einer einzigen eleganten Bewegung aus.
»Jetzt du.«
Er machte seine Hose auf, und Bea half ihm, sie auszuziehen. Dann legte sie sich auf den Rücken, verdrehte die Arme, um ihren BH aufzuhaken, und er versuchte sich in Stellung zu bringen, ohne sich mit den Knien auf ihr abzustützen. Er knallte mit dem Kopf an die Decke.
»Wie zwei Teenager sind wir hier«, seufzte er. »Mir ist das …«
Sie legte ihm die Hand aufs Gesicht, hielt ihm den Mund zu.
»Wir sind du und ich«, sagte sie. »Du und ich. Mann und Frau. Alles ist gut.«
Sie war jetzt nackt bis auf die Uhr an ihrem schmalen Handgelenk und die Perlenkette um ihren Hals. Im Schein der Taschenlampe war die Kette kein erlesenes Geschenk zum Hochzeitstag mehr, sondern wurde zu einem archaischen erotischen Schmuckstück. Ihre Brüste bebten unter der Wucht ihres Herzschlags.
»Komm«, sagte sie. »Mach.«
Und so fingen sie an. Eng aneinandergedrückt konnten sie sich nicht mehr sehen; die Taschenlampe hatte ausgedient. Ihre Münder waren vereint, ihre Augen fest geschlossen, ihre Körper hätten die Körper eines jeden sein können seit der Erschaffung der Welt.
»Fester«, keuchte Bea nach einiger Zeit. Ihre Stimme hatte einen barschen Unterton, eine brutale Härte, die er noch nie bei ihr gehört hatte. Ihr Sex war immer sehr rücksichtsvoll gewesen. Mal heiter, mal ungestüm, manchmal auch körperlich richtig anstrengend – aber nie verzweifelt. »Fester!«
Mit ans Fenster stoßenden Zehen und auf dem pelzigen Sitzbezug scheuernden Knien gab er sein Bestes, aber es war zu eng und unbequem, Rhythmus und Winkel stimmten nicht, und er verschätzte sich darin, wie weit sie schon war und wie lange er noch konnte.
»Nicht aufhören! Weiter! Weiter!«
Doch es war vorbei.
»Schon okay«, sagte sie schließlich und wand sich schweißnass unter ihm hervor. »Schon okay.«
Sie waren viel zu früh in Heathrow. Die Frau am Check-in-Schalter prüfte kurz seinen Pass. »Einfacher Flug nach Orlando, Florida, ja?«, fragte sie. »Ja«, sagte er. Sie fragte nach seinem Gepäck. Er schwang eine Sporttasche und einen Rucksack aufs Band. Ihm war bewusst, dass es irgendwie zwielichtig wirken musste. Seine Reise aber war zu kompliziert und ungewiss, um im Vorhinein einen Rückflug zu buchen. Er wünschte, Beatrice würde nicht neben ihm stehen und diese Bestätigung seines bevorstehenden Verschwindens mitanhören müssen, wünschte, das Wort »einfach« wäre ihr erspart geblieben.
Nachdem er seine Bordkarte erhalten hatte, war weitere qualvolle Wartezeit auszufüllen, bis er tatsächlich an Bord durfte. Seite an Seite schlenderten er und Beatrice von den Check-in-Schaltern weg, ein wenig benommen von den monströsen Ausmaßen des Terminals. Lag es am grellen Neonlicht, dass Beas Gesicht so abgehärmt und ängstlich wirkte? Peter legte ihr den Arm um die Taille. Sie lächelte ihn beruhigend an, aber er war nicht beruhigt. beginnen sie ihre ferien gleich hier!, lockten die Werbetafeln. bei unseren grenzenlosen shopping-angeboten wollen sie vielleicht gar nicht weg!
Zu dieser späten Stunde war der Flughafen zwar nicht überfüllt, und doch schoben eine Menge Leute ihr Gepäck umher oder stöberten in den Läden. Peter und Beatrice setzten sich in die Nähe einer Infotafel, um auf die Nummer seines Abfluggates zu warten. Sie hielten sich bei der Hand, ohne sich anzusehen, und beobachteten die passierenden Fluggäste. Eine Schar hübscher junger Mädchen, die aussahen wie Pole-Tänzerinnen bei Schichtbeginn, kam mit Tragetaschen beladen aus einem der vielen Läden. Auf hohen Absätzen stöckelten sie an ihnen vorbei und brachen unter ihrer Beute fast zusammen. Peter beugte sich zu Beatrice und sagte leise: »Was wollen die bloß mit dem ganzen Zeug im Flugzeug? Und wenn sie dann ankommen, kaufen sie gleich weiter. Dabei können sie kaum noch laufen.«
»Mhm.«
»Aber darum gehts vielleicht gerade. Sie spielen uns hier was vor. Wie unpraktisch das alles ist – bis hin zu den absurden Schuhen. Jeder soll sehen, sie sind so reich, dass sie sich um die Wirklichkeit nicht kümmern brauchen. Ihr Wohlstand macht sie zu anders gearteten Wesen, zu etwas Exotischem, das nicht wie ein Mensch funktionieren muss.«
Bea schüttelte den Kopf. »Die Mädchen sind nicht reich. Reiche reisen nicht in Gruppen. Und reiche Frauen haben keine Probleme, in High Heels zu laufen. Das sind einfach junge Mädchen, die Spaß am Shoppen haben. Für die ist das ein Abenteuer. Sie ziehen die Show für sich ab, nicht für uns. Wir sind für sie unsichtbar.«
Peter sah die Mädchen Richtung Starbucks stolpern. Ihre Pobacken zitterten unter den zerknitterten Röcken, und in ihren lauten Stimmen schlug der Dialekt durch. Bea hatte recht.
Seufzend drückte er ihr die Hand. Wie sollte er da draußen bloß ohne sie bestehen? Wie würde er zurechtkommen, wenn er sich nicht mit ihr austauschen konnte? Sie war es, die ihn bremste, wenn er Unsinn redete oder zu seinen großen, allumfassenden Theorien ansetzte. Sie holte ihn auf die Erde zurück. Sie bei dieser Mission an seiner Seite zu haben wäre eine Million Dollar wert gewesen.
Doch ihn allein loszuschicken, kostete weit mehr als eine Million, und USIC zahlte.
»Hast du Hunger? Kann ich dir was holen?«
»Wir haben doch zu Hause gegessen.«
»Ein Schokoriegel oder so was?«
Sie lächelte müde. »Mir gehts gut. Ehrlich.«
»Es tut mir so leid, dass ich dich enttäuscht habe.«
»Enttäuscht?«
»Na ja … vorhin im Auto. Es kommt mir ungerecht vor, unerledigt, und das ausgerechnet heute … Ich lasse dich ungern so zurück.«
»Das alles wird furchtbar«, sagte sie. »Aber nicht aus diesem Grund.«
»Der Winkel, der ungewohnte Winkel hat mich …«
»Bitte, Peter, das musst du nicht. Ich führe doch keine Strichliste. Wir haben uns geliebt. Das genügt mir.«
»Ich komme mir vor wie …«
Sie legte ihm einen Finger auf den Mund, dann küsste sie ihn. »Du bist der beste Mann der Welt.« Sie gab ihm noch einen Kuss, auf die Stirn. »Für Postmortems ergeben sich auf deiner Mission bestimmt bessere Anlässe.«
Unter ihren Lippen runzelte sich seine Stirn. Was meinte sie mit »Postmortems«? Wollte sie andeuten, dass Rückschläge und Hindernisse unvermeidbar waren? Oder war sie überzeugt, die Mission würde scheitern? Tödlich ausgehen?
Er stand auf ; sie stand mit ihm auf. Sie hielten sich eng umschlungen. Eine große Touristengruppe ergoss sich aus einem Bus direkt in die Halle, begierig auf den Flug in die Sonne. Auf dem Weg zu den Gates teilte sich der plappernde Schwarm und strömte zu beiden Seiten an Peter und Bea vorbei. Als alle fort waren und die Halle wieder relativ ruhig, sagte eine Stimme aus den Lautsprechern: »Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Herrenlose Gepäckstücke werden entfernt und möglicherweise vernichtet.«
»Hast du irgendwie … das Gefühl, die Mission wird scheitern?«, fragte er.
Sie schüttelte den Kopf und stieß mit der Schädeldecke an sein Kinn.
»Meinst du nicht, es liegt in Gottes Hand?«, setzte er nach.
Sie nickte.
»Denkst du, er würde mich so weit weg schicken, um –«
»Bitte, Peter.« Ihre Stimme war belegt. »Wir haben das alles doch so oft besprochen. Jetzt ist es sinnlos. Unser Glaube ist gefragt.«
Sie ließen sich wieder in den Sesseln nieder und versuchten, es sich möglichst bequem zu machen. Bea legte den Kopf an seine Schulter. Peter dachte über den Lauf der Geschichte nach, über die menschlichen Ängste, die hinter jedem bedeutenden Ereignis lagen. Die kleinen Banalitäten, mit denen sich Einstein, Darwin oder Newton wahrscheinlich herumzuschlagen hatten, während sie ihre Theorien aufstellten: Knatsch mit der Vermieterin etwa oder Sorge wegen eines verstopften Kamins. Die Piloten, die Dresden bombardierten, verärgert über einen Satz in einem Brief aus der Heimat: Wie meint sie das bloß? Oder Kolumbus auf der Fahrt in die Neue Welt … wer wusste schon, was ihm durch den Kopf ging? Vielleicht die Abschiedsworte eines alten Freunds, eines Manns, der in keinem Geschichtsbuch Erwähnung fand …
»Weißt du schon«, fragte Bea, »was du als Erstes sagen wirst?«
»Als Erstes sagen?«
»Zu ihnen. Wenn ihr euch trefft.«
Er überlegte. »Das kommt drauf an …«, sagte er zögernd. »Ich habe ja keine Ahnung, was mich erwartet. Gott wird mich leiten. Er wird mir die richtigen Worte eingeben.«
»Aber wenn du es dir vorstellst … das Zusammentreffen … was für ein Bild hast du dann vor Augen?«
Er schaute geradeaus. Ein Flughafenangestellter in einem Overall mit gelben Leuchtschärpen schloss gerade eine Tür mit der Aufschrift tür bitte geschlossen halten auf. »Ich stelle es mir nicht vor«, sagte er. »Du kennst mich doch. Ich kann erst etwas durchleben, wenn es passiert. Und in Wirklichkeit kommt es doch sowieso immer anders, als man es erwartet.«
Sie seufzte. »Ich habe ein Bild vor Augen.«
»Erzähl.«
»Versprich mir, dass du dich nicht über mich lustig machst.«
»Versprochen.«
Sie sprach in seinen Brustkorb. »Du stehst am Ufer eines großen Sees. Es ist Nacht, und der Himmel ist voller Sterne. Auf dem Wasser dümpeln Hunderte kleine Fischerboote. In jedem Boot sitzt mindestens eine Person, in manchen auch drei oder vier, aber ich kann sie nicht richtig sehen, dafür ist es zu dunkel. Die Boote fahren nirgendwo hin, alle haben den Anker geworfen, die Leute hören zu. Die Luft ist so still, dass du nicht mal laut sprechen musst. Deine Stimme trägt auch so übers Wasser.«
Er streichelte ihre Schulter. »Wie hübsch …« Er wollte sagen: »Der Traum«, aber das wäre abwertend gewesen. »Die Vision.«
Sie gab einen Laut von sich, der verhaltene Zustimmung, aber auch ein unterdrückter Schmerzensschrei sein konnte. Ihr an ihn gelehnter Körper wurde ihm schwer, doch er ließ sie gewähren und hielt still.
Schräg gegenüber von Peter und Beatrice befand sich ein Süßwarenladen. Dort herrschte trotz der späten Stunde reger Betrieb; fünf Kunden standen an der Kasse an, etliche andere schauten sich um. Peter sah einer gut gekleideten jungen Frau zu, die sich mit Unmengen von Waren belud. Riesige Pralinenschachteln, lange, schmale Kartons mit Shortbread, eine knüppellange Toblerone. Das alles an die Brust gedrückt spazierte sie an der Säule am Eingang vorbei, als wollte sie auch das Angebot vor dem Laden prüfen. Dann ging sie einfach davon und verzog sich durch das Gewühl der Fluggäste in Richtung Damentoilette.
»Ich war gerade Zeuge einer Straftat«, sagte Peter leise in Beas Haar. »Du auch?«
»Ja.«
»Ich dachte, du seist vielleicht eingenickt.«
»Nein, ich hab sie auch gesehen.«
»Hätten wir sie uns schnappen sollen?«
»Schnappen? Als Selbstjustiz, meinst du?«
»Oder wenigstens das Ladenpersonal verständigen.«
Beatrice drückte den Kopf fester an seine Schulter, während sie zusahen, wie die Frau auf der Toilette verschwand. »Würde das jemandem helfen?«
»Es würde ihr vielleicht in Erinnerung rufen, dass Stehlen unrecht ist.«
»Das bezweifle ich. Sie würde nur die Leute hassen, die sie erwischt haben.«
»Als Christen sollten wir sie also einfach weiterstehlen lassen?«
»Als Christen sollten wir die Liebe Jesu verbreiten. Wenn wir unserer Aufgabe gerecht werden, schaffen wir Menschen, die nichts Unrechtes tun wollen.«
»Wir schaffen sie?«
»Du weißt, was ich meine. Anregen. Anleiten. Wir zeigen ihnen den Weg.« Sie hob den Kopf und küsste ihn auf die Stirn. »Genau das, was du jetzt vorhast. Auf dieser Mission. Mein tapferer Mann.«
Er wurde rot und schluckte das Kompliment dankbar wie ein durstiges Kind. Er hatte nicht geahnt, wie sehr er das gerade jetzt brauchte. Es erfüllte ihn derart, dass er dachte, sein Brustkorb würde platzen.
»Ich gehe in den Gebetsraum«, sagte er. »Kommst du mit?«
»Gleich. Geh schon mal vor.«
Er erhob sich und ging auf direktem Weg zur Flughafenkapelle. Ob in Heathrow oder in Gatwick, Edinburgh, Dublin oder Manchester, die Kapelle fand er immer mühelos. Es war überall der hässlichste, schäbigste Raum auf dem ganzen Flughafengelände, weit weg vom glitzernden Kommerz. Dafür war es stets ein Raum mit Seele.
Dort angekommen, sah er auf dem Zeitplan an der Tür nach, ob vielleicht gerade eins der seltenen Abendmahle anstand. Das nächste war jedoch erst für Dienstagnachmittag um drei vorgesehen – da würde er schon unvorstellbar weit weg sein, und Beatrice würde die nächsten langen Monate allein schlafen, nur mit Joshua.
Die drei im Innern knienden Muslime beachteten ihn nicht, als er sanft die Tür aufstieß und eintrat. Sie waren einem Blatt Papier zugewandt, das an der Wand klebte und mit einem großen Pfeil bedruckt war. Er wies nach Mekka, wie ein Verkehrszeichen. Die Muslime verneigten sich, reckten ihre Hintern in die Luft und küssten den Stoff der bereitgestellten farbenfrohen Matten. Es waren makellos gekleidete Männer mit teuren Armbanduhren und Maßanzügen. Die blanken Lacklederschuhe hatten sie abgelegt. Ihre Fußballen krümmten sich im Eifer ihrer Ehrerbietung.
Peter warf kurz einen Blick hinter den Vorhang, der den Raum in der Mitte teilte. Wie vermutet vollzog da eine Muslimin, grau verschleiert, gerade das gleiche stumme Ritual. Sie hatte ein Kind bei sich, einen Jungen, der unglaublich brav dasaß und angezogen war wie der kleine Lord Fountleroy. Zu den Füßen seiner Mutter las er einen Comic, ohne sich um ihre Niederwerfungen zu kümmern. Spider-Man.
Peter ging zu dem Schrank, in dem die Heiligen Schriften und Broschüren lagen. Die Bibel (Gideon-Ausgabe), ein Neues Testament und die Psalmen separat, ein Koran, ein zerfleddertes Buch auf Indonesisch, das ebenfalls nach Neuem Testament aussah. Im Fach darunter stapelte sich neben dem Wachtturm und den Zeitungen der Heilsarmee ein optimistisch großer Haufen Prospekte. Da ihm das Logo darauf bekannt vorkam, sah er sie sich näher an. Sie stammten von einer bekannten evangelikalen US-Sekte, deren Londoner Pastor ebenfalls für die Mission in Betracht gezogen worden war. Peter hatte ihn sogar im USIC-Foyer getroffen, als er gerade eingeschnappt von dannen zog. »Reine Zeitverschwendung«, hatte der Mann auf dem Weg zum Ausgang geschimpft. Peter hatte erwartet, ebenso durchzufallen, aber siehe da … ihn hatten sie genommen. Wieso ihn statt jemanden von einer Kirche mit jeder Menge Geld und politischem Einfluss? Er wusste es immer noch nicht genau. Er schlug einen Prospekt auf und sah die altbekannten Theorien über die geheime Bedeutung der Zahl 666, über Barcodes und die Hure Babylon. Da lag vielleicht schon das Problem: Fanatismus war nicht das, was USIC suchte.
Eine Ansage aus einem kleinen Lautsprecher, der wie ein Blutegel an der Decke hing, unterbrach die Stille im Raum.
»Aufgrund einer technischen Störung verspätet sich der Allied Airlines Flug AB31 nach Alicante weiterhin. Die nächste Ansage erfolgt um 22:30 Uhr. Passagiere, die ihre Essensmarken noch nicht abgeholt haben, werden gebeten, dies jetzt zu tun. Allied Airlines bittet für eventuelle Unannehmlichkeiten noch einmal um Entschuldigung.«
Peter meinte, von draußen ein kollektives Aufstöhnen zu hören, aber das bildete er sich wahrscheinlich ein.
Er schlug das Gästebuch auf, blätterte in den großformatigen Seiten und las einige der Einträge von Reisenden aus aller Welt. Sie enttäuschten ihn nicht; das taten sie nie. Allein die Einträge von heute füllten drei Seiten. Ein paar waren in chinesischer und in arabischer Schrift verfasst, die meisten aber auf Englisch, ob fließend oder holprig. Gott war hier, er durchwirkte dieses Allerlei aus Kuli- und Filzstiftgeschriebenem.
Auf Flughäfen hatte er immer den Eindruck, die ganze Anlage präsentiere sich als mehrgeschossiger Tummelplatz weltlicher Gelüste, eine Konsumgalaxie, in der Religiosität einfach nicht vorkam. Jeder Laden, jede Reklame, jeder Zentimeter des Gebäudes bis hin zu den Nieten und WC-Abflüssen suggerierte, dass für Gott hier niemand Verwendung hatte. Die Leute, die für Snacks und Plunder Schlange standen, und der fortwährende Strom videoüberwachter Fluggäste waren ein erstaunlicher Beweis für die Vielfalt der menschlichen Spezies, nur dass sie einheitlich als glaubenslos erachtet wurden, duty-free in jeder Hinsicht. Und doch kamen diese Schnäppchenjäger, Flitterwöchner, Sonnenbader, umtriebigen Geschäftsleute und hochmodischen Fashionistas hierher. Niemand hätte geahnt, wie viele von ihnen sich in dieses Kabuff drängten und innige Botschaften an den Allmächtigen und ihre Glaubensgeschwister schrieben.
Lieber Gott, bitte nimm alles Böse aus der Welt – Jonathan.
Ein Kind, nahm er an.
Yuko Oyama, Hyoyo, Japan. Ich bete für die Kinder der Krankheit und Frieden der Erde. Und ich bete, einen guten Lebensgefährten zu finden.
Wo ist das KREUZ CHRISTI, unseres AUFERSTANDENEN HERRN? ERWACHET!
Charlotte Hogg, Birmingham. Beten Sie bitte, dass meine geliebte Tochter und mein Enkelsohn meine Krankheit annehmen können. Und beten Sie für alle, die Leid erfahren.
Marijn Tegelaars, London/Belgien. Meiner liebsten Freundin G., dass sie den Mut findet, zu sein, wer sie ist.
Jill, England. Betet bitte, dass die Seele meiner verstorbenen Mutter Ruhe und Frieden findet, und betet für meine Familie, die nicht vereint ist und sich hasst.
Allah ist der Beste! Gott regiert!
Der nächste Eintrag war bis zur Unleserlichkeit durchgestrichen. Höchstwahrscheinlich ein böser, intoleranter Kommentar auf den Eintrag darüber, getilgt von einem anderen Muslimen oder dem Betreuer des Gebetsraums.
Coralie Sidebottom, Slough, Berks. Danke für Gottes wunderbare Schöpfung.
Pat & Ray Murchiston, Langton, Kent. Für unseren lieben Sohn Dave, der gestern tödlich mit dem Auto verunglückt ist. Er bleibt für immer in unserem Herzen.
Thorne, Frederick, Co. Armagh, Irland. Ich bete für die Heilung des Planeten und die Erweckung ALL seiner Völker.
Eine Mutter. Mein Herz ist gebrochen, weil mein Sohn seit meiner Wiederheirat vor 7 Jahren nicht mehr mit mir spricht. Bitte um Versöhnung beten.
Riecht furchtbar nach billigem Raumspray das könnt ihr besser.
Moira Venger, Südafrika. Gott hat alles unter Kontrolle.
Michael Lupin, Hummock Cottages, Chiswick. Mal ein anderer Geruch als nach Desinfektionsmitteln.
Jamie Shapcott, 27 Pinley Grove, Yeovil, Somerset. Lass meinen BA-Flug nach Newcastle bitte nicht abstürzen. Vielen Dank.
Victoria Sams, Tamworth, Staffs. Hübsches Dekor, aber das Licht flackert.
Lucy, Lossiemouth. Bring mir meinen Mann heil zurück.
Er klappte das Buch zu. Seine Hände zitterten. Es war sehr gut möglich, dass er innerhalb der nächsten dreißig Tage starb, oder, falls er die Reise überstand, dass er niemals zurückkehrte. Dies war sein Gethsemane. Er kniff die Augen zusammen und betete zu Gott. Wäre ihm, dem Herrn, besser gedient, wenn Peter seine Frau bei der Hand nahm, mit ihr zum Ausgang und zum Parkplatz lief und schnurstracks nach Hause fuhr, ehe Joshua überhaupt mitbekommen hatte, dass er weg war?
Als Antwort brachte Gott ihm das hysterische Gebrabbel seiner inneren Stimme zu Gehör und ließ es in seinem Schädel widerhallen. Dann hörte er das Klimpern von Münzen hinter sich, als sich einer der Muslime erhob, um seine Schuhe wieder anzuziehen. Peter drehte sich um. Der Muslim nickte ihm im Hinausgehen höflich zu. Die Frau hinter dem Vorhang zog ihren Lippenstift nach, korrigierte mit dem kleinen Finger ihre Wimpern und strich eine Haarsträhne unter den Rand ihres Hidschabs. Der Pfeil an der Wand flatterte auf, als der Mann die Tür öffnete.
Peters Hände zitterten nicht mehr. Sein Blick war zurechtgerückt worden. Kein Gethsemane – er war nicht auf dem Weg nach Golgatha, sondern brach zu einem großen Abenteuer auf. Aus Tausenden hatte man ihn ausgewählt für die wichtigste Mission, seit die Apostel sich aufgemacht hatten, Rom mit der Macht der Liebe zu erobern, und er würde sein Bestes geben.
Beatrice saß nicht mehr dort, wo er sie zurückgelassen hatte. Für ein paar Sekunden dachte er, sie habe die Nerven verloren und sei aus dem Terminal geflohen. Der Kummer gab ihm einen Stich. Doch dann erblickte er sie ein paar Sitzreihen weiter in Richtung des kleinen Cafés. Sie kauerte auf allen vieren am Boden, ihre Haare waren vors Gesicht gefallen. Ihr gegenüber hockte, ebenfalls auf allen vieren, ein Kind – ein dickes Kleinkind in einer ausgebeulten Gummizughose, aus der die Windel hervorschaute.
»Guck mal! Ich hab … zehn Finger!«, erzählte sie gerade dem Kind. »Hast du auch zehn Finger?«
Das Kind streckte die Hände fast bis zu Bea aus. Sie zählte mit viel Getue seine Finger, dann sagte sie: »Hundert! Nein, zehn!« Der Junge lachte. Ein älteres Kind, ein Mädchen, stand scheu daneben und saugte an ihren Fingerknöcheln. Sie drehte sich immer wieder nach ihrer Mutter um, doch die hatte weder Augen für die Kinder noch für Beatrice; sie konzentrierte sich auf ein Gerät in ihrer Hand.
»Ach, hallo«, sagte Beatrice, als sie Peter kommen sah. Sie strich sich die Haare aus dem Gesicht und schob sie sich hinter die Ohren. »Das sind Jason und Gemma. Sie fliegen nach Alicante.«
»Wir hoffen drauf«, sagte die Mutter müde. Das Gerät gab einen kurzen Piepton von sich, nachdem es den Zuckerspiegel der Frau bestimmt hatte.
»Die Leute sind schon seit zwei Uhr hier«, erklärte Beatrice leise. »Sie sind total gestresst.«
»Nie wieder«, murmelte die Frau, während sie in einer Umhängetasche nach ihren Insulinspritzen kramte. »Ich schwörs. Die kassieren ab, und man ist ihnen scheißegal.«
»Joanne, das ist mein Mann, Peter. Peter, das ist Joanne.«
Joanne nickte ihm zu, war aber zu sehr in ihr Unglück vertieft, um zu plaudern. »Im Prospekt sieht das alles superpreiswert aus«, schimpfte sie, »aber man leidet dafür.«
»Ach, Joanne, nicht doch«, sagte Beatrice. »Es wird bestimmt sehr schön. Eigentlich ist doch gar nichts Schlimmes passiert. Überlegen Sie mal: Wäre der geplante Abflug acht Stunden später gewesen, würden Sie dasselbe machen wie jetzt – warten, nur zu Hause.«
»Die beiden gehören ins Bett«, sagte die Frau, entblößte eine Bauchfalte und steckte die Nadel hinein.
Jason und Gemma, zu Recht beleidigt darüber, dass sie als müde statt als schlecht behandelt bezeichnet wurden, schienen dem nächsten Koller nahe zu sein. Beatrice ging wieder auf alle viere. »Ich glaub, ich hab meine Füße verloren«, sagte sie und tastete den Boden ab. »Wo sind die denn hin?« »Da!«, rief der kleine Jason, als sie sich von ihm wegdrehte. »Wo?«, fragte sie und drehte sich wieder andersherum.
»Gott sei Dank«, sagte Joanne. »Da kommt Freddie mit dem Essen.«
Ein gehetzt aussehender Mann mit fliehendem Kinn und einer haferbreifarbenen Windjacke stiefelte heran, in jeder Hand mehrere Papiertüten.
»Die größte Abzocke der Welt«, verkündete er. »Da kannst du dir mit deiner Essensmarke für zwei Pfund oder was die Beine in den Bauch stehen. Wie beim Arbeitsamt ist das. Ich sag euch, wenns hier in einer halben Stunde nicht endlich –«
»Freddie«, sagte Beatrice strahlend, »das ist Peter, mein Mann.«
Der Familienvater stellte seine Tüten ab und gab Peter die Hand.
»Ihre Frau ist ein richtiger Engel, Pete. Erbarmt sie sich immer der heimatlosen Kinder?«
»Wir … wir glauben beide ans Freundlichsein«, sagte Peter. »Es kostet nichts und macht das Leben interessanter.«
»Wann sehen wir das Meer?«, fragte Gemma und gähnte.
»Morgen früh, wenn du aufwachst«, sagte die Mutter.
»Ist die nette Frau dann auch da?«
»Nein, sie fliegt nach Amerika.«
Beatrice bedeutete dem Mädchen, sich zu ihr zu setzen und an ihre Hüfte zu lehnen.
Der dicke Knirps war schon eingeschlafen und lag ausgestreckt vor einem zum Bersten vollgepackten Segeltuchrucksack. »Kleines Missverständnis«, sagte Beatrice. »Mein Mann verreist, nicht ich.«
»Sie bleiben zu Hause bei den Kindern, hm?«
»Wir haben keine«, sagte Beatrice. »Noch nicht.«
»Tun Sie sich einen Gefallen«, seufzte der Mann. »Lassen Sie’s. Verzichten Sie drauf.«
»Ach, das meinen Sie nicht ernst«, sagte Beatrice, und Peter, der sah, dass der Mann eine flotte Erwiderung auf der Zunge hatte, sagte: »Zumindest nicht richtig.«
Und so ging die Unterhaltung weiter. Beatrice und Peter fanden ihren Rhythmus und zogen perfekt am selben Strang. Sie hatten das schon viele Hundert Mal gemacht. Unterhaltung, echte, zwanglose Unterhaltung, aber mit dem Potenzial, zu etwas viel Bedeutsamerem zu werden, falls man auf Jesus zu sprechen kommen konnte. Vielleicht ergab sich dieser Augenblick, vielleicht auch nicht. Vielleicht würden sie auch nur zum Abschied »Gott segne Sie« sagen, und damit hätte es sich. Nicht jede Begegnung konnte einschneidend sein. Manche Unterhaltungen waren schlicht ein Austausch von freundlichen Atemzügen.
Im Laufe dieses fast aufgezwungenen Austauschs entspannten sich die beiden Fremden unwillkürlich. Nach wenigen Minuten lachten sie sogar. Sie waren aus Merton, er litt an Depressionen, sie an Diabetes, beide arbeiteten in einem großen Geschäft für Haushaltswaren, für diesen Urlaub hatten sie ein Jahr lang gespart. Sie schienen nicht allzu intelligent und nicht sonderlich spannend. Die Frau hatte ein unschön prustendes Lachen, und das Aftershave des Manns stank fürchterlich nach Moschus. Sie waren Menschen und kostbar in den Augen Gottes.
»Ich muss langsam zum Boarding«, sagte Peter schließlich.
Beatrice kauerte noch am Boden, der Kopf des fremden Kindes ruhte auf ihrem Oberschenkel. Tränen standen ihr in den Augen.
»Wenn ich mit zur Sicherheitskontrolle komme«, sagte sie, »und wir uns da umarmen, ehe du durchgehst, Ehrenwort, dann pack ich das nicht. Ich raste aus und mache eine Szene. Bitte, wir sollten uns hier verabschieden.«
Peter zerriss es das Herz. Was im Gebetsraum als großes Abenteuer erschienen war, wurde jetzt zum schweren Opfer. Er klammerte sich an die Worte des Apostels: Verrichte dein Werk als Verkünder des Evangeliums, erfülle treu deinen Dienst! Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe.
Er bückte sich, und Beatrice umfasste mit einer Hand sein Genick und gab ihm einen kurzen, derben Kuss auf die Lippen. Benommen richtete er sich auf. Das ganze Drumherum mit den Fremden – jetzt wurde ihm klar, dass sie es eigens so eingerichtet hatte.
»Ich schreib dir«, versprach er.
Sie nickte – eine Bewegung, die ihr die Tränen auf die Wangen rollen ließ.
Mit schnellen Schritten ging er zum Abflug. Vierzig Minuten später war er in den Wolken.
2 Er würde andere Menschen nie mehr mit denselben Augen sehen
Der USIC-Fahrer kam mit einer Flasche Instant-Orangensaft und einer makellosen, übernatürlich gelben Banane aus der Tankstelle. Mit blinzelnden Augen suchte er im grellen Tageslicht den Parkplatz nach seiner vollgetankten Limousine und ihrer kostbaren Fracht aus dem Ausland ab. Diese Fracht war Peter, der die Tankpause nutzte, um sich die Beine zu vertreten und einen letzten Anruf zu versuchen.
»Entschuldigen Sie«, sagte Peter. »Können Sie mir mit dem Telefon mal helfen?«
Der Mann schien verblüfft über die Bitte und bedeutete, dass er keine Hand freihatte. Mit seinem blauen Anzug samt Schlips war er für die Hitze Floridas zu warm angezogen und hatte auch die verspätete Ankunft des Flugzeugs noch nicht ganz verwunden. Es war beinahe so, als machte er Peter persönlich für die turbulenten Witterungsverhältnisse über dem Nordatlantik verantwortlich.
»Was ist denn damit?«, sagte er, als er das Getränk und die Banane auf dem glühend heißen Wagendach deponierte.
»Wahrscheinlich gar nichts.« Peter sah mit zusammengekniffenen Augen auf das Gerät in seiner Hand. »Ich weiß wohl nur nicht, wie man es richtig bedient.«
Das stimmte. Er hatte keine Ahnung von dem Zeug und benutzte sein Handy nur, wenn die Umstände ihn dazu zwangen; ansonsten hielt es in seiner Kleidung Winterschlaf, bis es irgendwann veraltet war. Etwa einmal im Jahr teilte ihm Beatrice seine oder ihre neue Nummer mit, wenn wieder mal ein Telefondienst zu umständlich geworden oder bankrottgegangen war. Unternehmen gingen neuerdings mit alarmierender Häufigkeit bankrott; Bea hielt sich da auf dem Laufenden, Peter nicht. Er wusste nur, dass es ihm nicht leichtfiel, sich jedes Jahr zwei neue Telefonnummern einzuprägen, obwohl er sich lange Bibelpassagen merken konnte. Und er stand mit der Technik so sehr auf Kriegsfuß, dass er beim besten Willen nicht weiterwusste, wenn er die Ruftaste des Handys drückte und sich nichts tat, wie es ihm hier in der Flimmerhölle Floridas gerade passiert war.
Der Fahrer wollte schnell wieder ans Steuer, sie hatten noch einen weiten Weg vor sich. Er biss ein Stück Banane ab, schnappte sich Peters Handy und inspizierte es misstrauisch.
»Steckt denn da die richtige Karte drin?«, sagte er mit vollem Mund. »Fürn Anruf … äh … nach England?«
»Ich glaub schon«, sagte Peter.
Der Fahrer gab es ihm unverbindlich zurück. »Sieht mir okay aus.«
Peter trat in den Schatten des Metalldachs über den Zapfsäulen. Noch einmal versuchte er, die korrekte Zeichenfolge einzutippen. Diesmal wurde er mit einer Stakkato-Melodie belohnt: der internationalen Vorwahl und Beas Rufnummer. Er hielt sich das metallene Gerät ans Ohr und schaute hinaus in den ungewohnt blauen Himmel und auf die kunstvoll gestutzten Bäume rings um den Lkw-Parkplatz.
»Hallo?«
»Ich bins«, sagte er.
»… allo?«
»Kannst du mich hören?«, fragte er.
»… hör dich …«, sagte Bea. Ihre Stimme war in weißes Rauschgestöber eingehüllt. Einzelne Wörter sprangen wie verirrte Funken aus dem kleinen Verstärker des Telefons.
»Ich bin in Florida«, sagte er.
»… mitten … Nacht …«, antwortete sie.
»Tut mir leid. Hab ich dich geweckt?«
»… liebe dich … gehts dir … weißt du schon …?«
»Ich bin gesund und munter«, sagte er. Das Telefon war glitschig von seinen verschwitzten Fingern. »Sorry, dass ich dich jetzt anrufe, aber sonst komme ich vielleicht nicht mehr dazu. Die Maschine hatte Verspätung, und jetzt sind wir schwer in Eile.«
»… e … o … in der … mir … weiß der Mann irgend …?«
Er ging weiter vom Wagen weg, raus aus dem Schatten des Metalldachs. »Der Mann weiß überhaupt nichts«, sagte er leise und vertraute darauf, dass seine Worte ihr klarer übertragen wurden als umgekehrt. »Ich kann nicht mal genau sagen, ob er für USIC arbeitet.«
»… denn nicht gefrag …?«
»Noch nicht. Mach ich noch.« Es war ihm ein bisschen peinlich. Schon zwanzig Minuten oder eine halbe Stunde hatte er mit dem Fahrer im Wagen gesessen und noch nicht geklärt, ob er ein USIC-Angestellter oder nur von ihnen beauftragt war. Er hatte lediglich in Erfahrung gebracht, dass das kleine Mädchen auf dem Foto am Armaturenbrett die Tochter des Fahrers war, dass der Fahrer von der Mutter des Mädchens frisch geschieden war und dass die Mutter der Mutter als Anwältin alles daransetzte, den Fahrer bedauern zu lassen, dass er jemals geboren war. »Im Moment gehts … sehr hektisch zu. Und auf dem Flug habe ich nicht geschlafen. Ich schreib dir, wenn ich … na ja, wenn ich angekommen bin. Dann hab ich reichlich Zeit und setz dich ins Bild. Dann ist es, als ob wir zusammen reisen.«
Das Rauschen nahm wieder zu, und er wusste nicht, ob sie schwieg oder ihre Worte verschluckt wurden. Er sprach lauter: »Wie gehts Joshua?«
»… die ersten … er bloß … o … int … Seite …«
»Es tut mir leid, ich verstehe kein Wort. Und der Mann will, dass ich Schluss mache. Lass uns auflegen. Ich liebe dich. Ich wünsche dir … ich liebe dich.«
»… dich auch …«
Und weg war sie.
»Ihre Frau?«, fragte der Fahrer, als Peter wieder im Wagen saß und sie vom Parkplatz herunterfuhren.
Genau genommen nicht, hätte Peter am liebsten gesagt, das war nicht meine Frau, sondern ein Schwall unzusammenhängender elektronischer Geräusche aus einem kleinen Metallding. »Ja«, sagte er. Einem Fremden seine fast zwanghafte Vorliebe für persönliche Kommunikation, von Angesicht zu Angesicht, zu erklären, war zu schwierig. Selbst Beatrice ging das manchmal zu weit.
»Und Ihr Kind heißt Joshua?« Dass Mithören allgemein verpönt war, schien den Fahrer nicht zu kümmern.
»Joshua ist unsere Katze«, sagte Peter. »Wir haben keine Kinder.«
»Erspart Ihnen viele Scherereien«, meinte der Fahrer.
»Sie sind schon der Zweite, der mir das heute sagt. Dabei lieben Sie doch sicher Ihre Tochter.«
»Zwangsläufig!« Der Fahrer winkte mit der Hand zur Windschutzscheibe, hinaus in die weite Welt der Erfahrung, des Schicksals und so weiter. »Was macht denn Ihre Frau?«
»Sie ist Krankenschwester.«
»Das ist ein guter Beruf. Jedenfalls besser als Anwältin. Verbessert das Leben der Leute, statt es ihnen zu vermiesen.«
»Na, ich hoffe, das gilt auch für Geistliche.«
»Klar«, sagte der Fahrer leichthin. Er hörte sich keineswegs überzeugt an.
»Und Sie?«, fragte Peter. »Sind Sie bei USIC … äh … angestellt, oder werden Sie nur von ihnen beauftragt?«
»Ich fahre seit neun oder zehn Jahren für USIC«, sagte der Fahrer. »Hauptsächlich Güter. Manchmal auch Akademiker. USIC hält eine Menge Konferenzen ab. Und hin und wieder kommt dann auch ein Astronaut.«
Peter nickte. Er stellte sich vor, wie der Fahrer am Flughafen Orlando einen Astronauten abholte, einen Hünen mit kantigem Kinn, der im bauchigen Raumanzug durch die Abflughalle auf den Plakat schwenkenden Fahrer zustapfte. Dann begriff er.
»Als Astronaut habe ich mich gar nicht gesehen«, sagte er.
»Das Wort ist altmodisch«, räumte der Fahrer ein. »Ich verwende es wohl der Tradition zu Ehren. Die Welt ändert sich zu schnell. Man lässt etwas, das immer da war, aus den Augen, und schon ist es nur noch eine Erinnerung.«
Peter schaute aus dem Fenster. Die Autobahn sah fast genauso aus wie eine englische Autobahn, aber riesige Metallschilder wiesen ihn darauf hin, dass es in der Nähe herrliche Sehenswürdigkeiten wie den Econlockhatchee River und den Hal Scott Regional Naturpark gab, versteckt hinter den Windschutzwänden. Stilisierte Illustrationen auf Werbetafeln beschworen die Freuden des Campings und Reitens.
»Eins muss man USIC lassen«, sagte der Fahrer, »sie achten die Tradition. Vielleicht schnallen sie auch nur, was ein Markenname wert ist. Die haben Cape Canaveral gekauft, wussten Sie das? Das ganze Ding gehört ihnen. Muss ein Vermögen gekostet haben, und sie hätten ihre Abschussbasis auch woanders bauen können, überall kriegt man heute Land nachgeschmissen, aber sie wollten Cape Canaveral. Das nenne ich Klasse.«
Peter brummte zustimmend. Die Klasse – oder fehlende Klasse – von multinationalen Konzernen war kein Thema, zu dem er feste Ansichten hatte. Immerhin wusste er, dass USIC viele ehemalige Fabriken in ehemals armen Städten der ehemaligen Sowjetunion besaß. Irgendwie schien ihm fraglich, ob das Wort »Klasse« auch auf die Vorgänge dort anwendbar war. Was Cape Canaveral anging, so hatte ihn die Geschichte der Raumfahrt noch nie interessiert, auch als Kind nicht. Er hatte noch nicht mal mitbekommen, dass es die NASA nicht mehr gab. Solche nutzlosen Informationsbröckchen schnappte eher Bea auf, wenn sie die Zeitungen las, die später unter Joshuas Futternapf gelegt wurden.
Joshua fehlte ihm schon. Wenn Beatrice bei Tagesanbruch zur Arbeit fuhr, lag Joshua oft noch auf dem Bett und schlief fest. Aber auch, wenn er schon wach war und miaute, eilte sie mit einem »Herrchen füttert dich« davon. Und eine oder zwei Stunden später saß Peter dann auch in der Küche und aß Müsli, während Joshua sich am Boden sein eigenes, herzhafteres Müsli schmecken ließ. Anschließend sprang Joshua auf den Esstisch und schleckte die Milchreste aus Peters Schüssel. Wenn Frauchen da war, durfte er das nicht.
»Die Ausbildung ist bestimmt hart, oder?«, fragte der Fahrer.
Peter ahnte, dass jetzt Anekdoten über quasimilitärischen Drill und olympische Ausdauertests von ihm erwartet wurden. So etwas konnte er nicht bieten. »Man wird ärztlich untersucht«, räumte er ein. »Aber hauptsächlich besteht das Screening aus … Fragen.«
»So?«, sagte der Fahrer. Sekunden später schaltete er das Autoradio ein. »… in Pakistan anhält«, begann eine ernste Stimme, »da regierungsfeindliche Kräfte …« Der Fahrer wechselte zu einem Musiksender, und der altbekannte Trällersound der Band A Flock of Seagulls ertönte.
Peter lehnte sich zurück und rief sich einige Fragen aus seinen Eignungsgesprächen in Erinnerung. Diese im Sitzungssaal im zehnten Stock eines protzigen Londoner Hotels abgehaltenen Fragerunden hatten jeweils stundenlang gedauert. Eine bestimmte Amerikanerin war immer dabei gewesen: eine elegante, etwas magersüchtig wirkende Frau. Mit strahlenden Augen, Näselstimme und dem Gestus einer berühmten Choreografin oder ehemaligen Balletttänzerin tat sie ihre Arbeit, gestärkt von entkoffeiniertem Kaffee aus gläsernen Tassen und unterstützt von einem wechselnden Team anderer Vernehmer. Vernehmer war vielleicht das falsche Wort, denn alle waren freundlich, und er hatte das merkwürdige Gefühl, sie drückten ihm die Daumen, dass er durchkam.
»Wie lange kommen Sie ohne Ihr Lieblingseis aus?«
»Ich habe kein Lieblingseis.«
»Welcher Geruch erinnert Sie am meisten an Ihre Kindheit?«
»Ich weiß nicht. Vanillesoße vielleicht.«
»Mögen Sie Vanillesoße?«
»Es geht. Heute esse ich sie vor allem zum Weihnachtspudding.«
»Woran denken Sie, wenn Sie an Weihnachten denken?«
»Die Christmesse, Feier der Geburt Jesu, abgehalten zur Zeit der römischen Wintersonnenwende. Johannes Chrysostomos.
Synkretismus. Den Weihnachtsmann. Schnee.»
»Feiern Sie’s auch?«
»In unserer Gemeinde machen wir eine große Sache daraus. Wir organisieren Geschenke für benachteiligte Kinder, geben ein Weihnachtsessen in unserer Anlaufstelle … Viele Leute fühlen sich allein an diesen Tagen und sind deprimiert. Wir möchten ihnen helfen.«
»Wie gut schlafen Sie in fremden Betten?«
Darüber musste er nachdenken. Sich zurückbesinnen auf die billigen Hotels, in denen er und Bea abgestiegen waren, wenn sie zu evangelistischen Kundgebungen gereist waren. Die Sofas der Freunde, die zu Liegestätten umfunktioniert worden waren. Oder, noch früher im Leben, die schwierige Entscheidung, den Mantel anzubehalten, um weniger zu frieren, oder ihn als Kopfkissen zu benutzen, damit der Beton nicht so gegen den Schädel drückte. »Ich bin wahrscheinlich … Durchschnitt«, sagte er. »Solange es ein Bett ist und ich drin liegen kann, komme ich zurecht.«
»Sind Sie morgens vor dem ersten Kaffee reizbar?«
»Ich trinke keinen Kaffee.«
»Tee?«
»Manchmal.«
»Manchmal sind Sie reizbar?«
»Mich ärgert so leicht nichts.« Das stimmte, und diese merkwürdigen Befragungen bewiesen es. Ihm gefiel das Duell. Er hatte eher das Gefühl, auf die Probe gestellt als beurteilt zu werden. Diese Schnellfeuerfragen waren mal etwas erfrischend anderes als die Gottesdienste, bei denen er stundenlang am Stück zu reden hatte, während die anderen schwiegen. Er wollte den Auftrag, wollte ihn unbedingt, aber wie es ausging, lag in Gottes Hand, und nervös zu werden, unehrliche Antworten zu geben oder zu gefallen zu versuchen brachte überhaupt nichts. Er war er selbst und hoffte, das genügte.
»Wie fänden Sie es, Sandalen zu tragen?«
»Muss ich das denn?«
»Vielleicht.« Das kam von einem Mann in teuren schwarzen Lederschuhen, die so blitzten, dass sich Peters Gesicht in ihnen spiegelte.
»Wie fühlen Sie sich, wenn Sie einen Tag lang nicht auf die sozialen Medien zugegriffen haben?«
»Darauf greife ich nicht zu. Glaube ich wenigstens. Was meinen Sie genau mit ›sozialen Medien‹?«
»Schon gut.« Wenn eine Frage kompliziert wurde, schlugen sie oft einen anderen Kurs ein. »Welcher Politiker ist Ihnen am meisten verhasst?«
»Ich hasse niemanden. Und über Politik bin ich nicht so informiert.«
»Es ist neun Uhr abends, und der Strom fällt aus. Was machen Sie?«
»Ich repariere das, wenns geht.«
»Aber was fangen Sie mit Ihrer Zeit an, wenn es nicht geht?«
»Ich würde mich mit meiner Frau unterhalten, wenn sie dann zu Hause wäre.«
»Was glauben Sie, wie sie zurechtkommt, wenn Sie eine Zeit lang nicht zu Hause sind?«
»Sie ist sehr selbstständig und kompetent.«
»Würden Sie sagen, Sie sind ein selbstständiger und kompetenter Mann?«
»Ich hoffe es.«
»Wann haben Sie sich zum letzten Mal betrunken?«
»Vor etwa sieben, acht Jahren.«
»Würden Sie jetzt gern was trinken?«
»Noch etwas von dem Pfirsichsaft fände ich nicht schlecht.«
»Mit Eis?«
»Ja, danke.«
»Stellen Sie sich Folgendes vor«, sagte die Frau. »Sie besuchen eine Stadt im Ausland, und Ihre Gastgeber laden Sie zum Essen ein. Das Restaurant, in das sie mit Ihnen gehen, ist ansprechend und gut besucht. Es gibt ein großes, durchsichtiges Gehege, in dem süße weiße Entenküken hinter ihrer Mutter herrennen. Alle paar Minuten schnappt sich der Koch ein Küken und wirft es in einen Bottich mit siedendem Öl. Dann wird es den Gästen serviert, und alle sind froh und guter Dinge. Ihre Gastgeber bestellen Küken und sagen, Sie sollten das auch mal probieren, es sei fabelhaft. Was tun Sie?«
»Steht noch etwas anderes auf der Speisekarte?«
»Klar, jede Menge.«
»Dann würde ich etwas anderes bestellen.«
»Sie könnten da noch sitzen und essen?«
»Es käme darauf an, wieso ich überhaupt in Gesellschaft dieser Leute bin.«
»Und wenn Sie nichts von ihnen hielten?«
»Dann würde ich die Punkte ansprechen, mit denen ich nicht einverstanden bin, und ehrlich sagen, was ich daran verkehrt finde.«
»Mit der Kükengeschichte an sich hätten Sie kein Problem?«
»Die Menschen essen alle möglichen Tiere. Sie schlachten Schweine, die viel intelligenter sind als Vögel.«
»Wenn ein Tier dumm ist, darf man es also töten?«
»Ich bin kein Metzger. Auch kein Koch. Ich habe mich entschieden, etwas anderes mit meinem Leben anzufangen. Das ist eine Entscheidung gegen das Töten, wenn Sie so wollen.«
»Und die Küken?«
»Was ist denn mit den Küken?«
»Würden Sie sich nicht veranlasst sehen, die zu retten? Indem Sie zum Beispiel das Glasgehege zertrümmern, damit sie entkommen können?«
»Den Drang hätte ich vielleicht. Es würde den Küken aber wahrscheinlich nichts nützen. Wenn es mir wirklich nachgehen würde, was ich in dem Restaurant gesehen habe, könnte ich mein Leben ja der Aufgabe widmen, die Menschen in dieser Gesellschaft dahin zu erziehen, dass sie Enten menschlicher töten. Aber lieber würde ich mein Leben einer Sache widmen, die die Menschen dazu bringen könnte, miteinander menschlicher umzugehen. Denn Menschen leiden ungleich stärker als Enten.«
»Das dächten Sie vielleicht nicht, wenn Sie eine Ente wären.«
»Ich glaube, wenn ich eine Ente wäre, würde ich über gar nichts groß nachdenken. Das höhere Bewusstsein sorgt doch für unseren ganzen Kummer und unsere Qualen, oder nicht?«
»Würden Sie eine Grille zertreten?«, warf ein anderer Befragender ein.
»Nein.«
»Eine Kakerlake?«
»Vielleicht.«
»Sie sind also kein Buddhist?«
»Ich habe nie behauptet, ein Buddhist zu sein.«
»Sie würden nicht sagen, dass alles Leben heilig ist?«
»Das ist ein schönes Konzept, aber jedes Mal, wenn ich mich wasche, töte ich mikroskopisch kleine Lebewesen, die gehofft haben, sich von mir ernähren zu können.«
»Wo ziehen Sie die Grenze?«, erwiderte die Frau. »Bei Hunden? Pferden? Und wenn das Restaurant lebende Kätzchen briete?«
»Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen«, sagte er. »Wollen Sie mich irgendwohin schicken, wo man schreckliche, grausame Dinge mit anderen Lebewesen anstellt?«
»Natürlich nicht.«
»Warum stellen Sie mir dann solche Fragen?«
»Okay, wie wärs hiermit: Ihr Kreuzfahrtschiff ist gesunken, und Sie teilen sich das Rettungsfloß mit einem extrem lästigen Mann, der zufällig auch noch homosexuell ist …«
Und so ging es weiter. Tagelang. So lange, dass es Bea zu bunt wurde und sie schon überlegte, ob er USIC nicht sagen sollte, seine Zeit sei zu kostbar für dieses Affentheater.
»Nein, die wollen mich«, hatte er sie beschwichtigt. »Das merke ich.«
Mit der Zusage des Konzerns im Rücken wandte sich Peter nun an diesem milden Morgen in Florida dem Fahrer zu und stellte die Frage, auf die er in all den Monaten keine direkte Antwort erhalten hatte.
»Was ist USIC eigentlich?«
Der Fahrer hob die Schultern. »Je größer ein Unternehmen heutzutage ist, desto schwerer lässt sich sagen, was es macht. Früher hat ein Autobauer Autos gebaut und ein Bergbauunternehmen Bergbau betrieben. Die Zeiten sind vorbei. Wenn man USIC fragt, worauf sie spezialisiert sind, bekommt man Sachen zu hören wie … Logistik. Humanressourcen. Entwicklung von Großprojekten.« Mit einem hässlichen Schlürfgeräusch sog der Fahrer per Strohhalm die letzten Tropfen aus der Flasche.
»Aber wo kommt das ganze Geld her?«, fragte Peter. »Sie werden nicht vom Staat finanziert.«
Der Fahrer, abgelenkt, runzelte die Stirn. Er betätigte den Blinker, um sich in die richtige Spur einzuordnen. »Investitionen.«
»Investitionen in was?«
»In vieles.«
Peter beschirmte mit einer Hand seine Augen, das grelle Licht bereitete ihm Kopfschmerzen. Er erinnerte sich, dass er seine USIC-Befrager bei einem der frühen Gespräche, als Beatrice noch dabei war, das auch schon gefragt hatte.
»Wir investieren in Menschen«, hatte die elegante Frau erwidert, ihre kunstvoll gestutzte graue Mähne geschüttelt und die schlanken, feingliedrigen Hände auf den Tisch gelegt.
»Das sagen alle Unternehmen«, bemerkte Beatrice, ein wenig unhöflich, wie er fand.
»Nun, uns ist es ernst damit«, sagte die ältere Frau. Ihre grauen Augen waren aufrichtig und sprühten vor Intelligenz. »Ohne Menschen erreicht man nichts. Ungewöhnliche Menschen mit ganz besonderen Fähigkeiten.« Sie wandte sich Peter zu. »Deswegen unterhalten wir uns mit Ihnen.«
Die kluge Formulierung hatte ihn zum Schmunzeln gebracht: Sie funktionierte als Schmeichelei – man unterhielt sich mit ihm, weil er eben einer dieser ungewöhnlichen Menschen war –, konnte aber auch eine Absage einleiten – man unterhielt sich mit ihm der hohen Ansprüche wegen, denen er letztlich nicht genügte. Eines war sicher: Seine und Beas Anspielungen darauf, was für ein hervorragendes Team sie abgeben würden, wenn sie den Auftrag gemeinsam übernehmen könnten, fielen wie Krümel vom Tisch und verschwanden im Teppich.
»Einer muss ja sowieso dableiben und sich um Joshua kümmern«, meinte Bea, als sie hinterher darüber sprachen. »Es wäre grausam, ihn so lange allein zu lassen. Dazu kommt die Kirche. Und das Haus, die Unkosten; ich muss weiterarbeiten.« Durchaus berechtigte Überlegungen, wenn auch ein Vorschuss von USIC, und sei es nur ein Bruchteil des vollen Betrags, für jede Menge Katzenfutter, Nachbarbesuche und Heizungsrechnungen gereicht hätte. »Eine Zusage wäre einfach nett gewesen, das ist alles.«
Ja, es wäre nett gewesen. Aber sie waren auch nicht blind gegenüber dem Glück, wenn es sich einstellte. Peter war ausgewählt worden und viele andere nicht.
»Wie sind Sie denn an USIC geraten?«, fragte er den Fahrer.
»Die Bank hat uns das Haus weggenommen.«
»Tut mir leid, das zu hören.«
»Die Bank hat praktisch jedes einzelne Haus in Gary kassiert. Jedes Haus: an sich gerissen, nicht verkaufen können und vergammeln und verfallen lassen. Aber USIC hat uns ein Angebot gemacht. Sie haben die Schulden übernommen, wir konnten das Haus behalten und mussten im Gegenzug für ein Handgeld für sie arbeiten. Ein paar alte Kumpels von mir haben es Sklaverei genannt. Ich nenne es … humanitär. Und die alten Kumpels, die leben jetzt in Wohnwagensiedlungen. Und ich fahre hier eine Limousine.«
Peter nickte. Den Namen des Ortes, wo der Mann herkam, hatte er schon vergessen, und vom gegenwärtigen Zustand der amerikanischen Wirtschaft hatte er kaum eine Ahnung, aber was es hieß, einen Rettungsring zugeworfen zu bekommen, wusste er sehr gut.
Die Limousine zog sanft nach rechts und wurde vom kühlen Schatten der Kiefern am Straßenrand eingehüllt. Ein Holzschild, wie es normalerweise Campingplätze, Grillplätze oder mietbare Blockhäuser ankündigte, wies auf eine nahe Abzweigung zu USIC hin.
»Nehmen Sie irgendeine untergehende Stadt im Land«, redete der Fahrer weiter, »und Sie werden feststellen, dass da viele Leute im selben Boot sitzen. Die erzählen Ihnen, sie arbeiten für diese oder jene Firma, aber wenn man ein bisschen kratzt, stellt sich raus, sie arbeiten für USIC.«
»Ich weiß nicht mal, was ›USIC‹ bedeutet«, sagte Peter.
»Fragen Sie mich nicht«, sagte der Fahrer. »Heutzutage haben viele Unternehmen sinnlose Namen. Die sinnvollen sind alle vergeben. Das ist typisch.«
»Das US am Anfang steht wohl für die Vereinigten Staaten.«
»Wahrscheinlich. Sie sind aber multinational. Mir hat sogar jemand erzählt, sie hätten in Afrika angefangen. Ich weiß nur, dass man gut für sie arbeiten kann. Haben mich nie gelinkt. Sie sind in guten Händen.«
In deine Hände lege ich meinen Geist, dachte Peter unwillkürlich. Lukas 23, 46, in Erfüllung der Prophezeiung von Psalm 31, 6. Nur, dass im Fall von USIC nicht klar war, in wessen Hände er sich genau legte.
»Das brennt jetzt ein bisschen«, sagte die Schwarze in dem weißen Laborkittel. »Es wird sogar richtig unangenehm. Als ob Ihnen ein halber Liter kalter Joghurt durch die Adern strömt.«
»Bah, danke, ich kanns kaum erwarten.« Er legte den Kopf unbehaglich in die gepolsterte Mulde seines sargähnlichen Behälters und bemühte sich, an der Nadel vorbeizusehen, die sich seinem abgebundenen Arm näherte.
»Wir möchten nur nicht, dass Sie denken, es liefe etwas schief.«
»Wenn ich sterbe, richten Sie bitte meiner Frau aus …«
»Sie sterben nicht. Nicht mit diesem Zeug in Ihren Adern. Entspannen Sie sich einfach, und denken Sie an was Schönes.«
Die Kanüle steckte in seiner Vene, und das durchsichtige Präparat floss in ihn hinein. Das allein war so grausig, dass er dachte, er müsste sich übergeben. Sie hätten ihm ein Beruhigungsmittel geben sollen oder so etwas. Ob seine drei Mitreisenden tapferer waren? Sie lagen in den gleichen Behältern irgendwo in diesem Gebäude. Er würde sie in einem Monat kennenlernen, wenn er aufwachte.
Die Frau, die ihm die Infusion verabreichte, stand vor ihm und beobachtete ihn ruhig. Ohne Vorwarnung – aber wie hätte es die auch geben sollen? – schwebte ihr Lippenstiftmund nach links, trieben die Lippen wie ein kleines rotes Kanu über ihre Wangenhaut. Der Mund hielt erst an, als er ihre Stirn erreichte; über ihren Augenbrauen blieb er stehen. Dann wanderten ihre Augen samt Lidern und Wimpern zum Kinn hin, wobei sie normal blinzelten.
»Wehren Sie sich nicht dagegen, gehen Sie einfach mit«, empfahl der Mund auf der Stirn. »Das gibt sich.«
Er brachte vor Angst kein Wort heraus. Das war keine Halluzination. Das passierte mit dem Universum, wenn man es nicht mehr zusammenhalten konnte. Atombüschel und Lichtstrahlen bildeten flüchtige Formen, ehe sie weiterreisten. Während er sich in der Dunkelheit auflöste, war seine größte Angst, er würde andere Menschen nie mehr mit denselben Augen sehen.
3 Das große Abenteuer konnte ja wohl noch warten
»Mann, Mann, Mann.« Eine tiefe, klagende Stimme aus der formlosen Leere. »Das Scheißzeug haut echt rein.«
»Hüten Sie Ihre Zunge, BG. Wir haben einen Geistlichen bei uns.«
»Ja, leck mich fett! Helfen Sie mir mal aus dem Sarg, Mann.«
Eine dritte Stimme: »Mir auch. Mir zuerst.«
»Das wird euch leidtun, Kinder.« (Herablassend verkündet.) »Aber okay.« Es folgte das Rascheln, Knurren, Keuchen und Brummen schwerer körperlicher Anstrengung.
Peter schlug die Augen auf, aber ihm war zu übel, um sich den Stimmen zuzuwenden. Die Decken und Wände schienen sich zusammenzuziehen, das Licht schwankte hin und her. Als wäre das Gefüge des Raums dehnbar geworden, wogende Wände, schlingernde Decke. Er verschloss die Augen vor dem Delirium, aber das machte es nur schlimmer: Die Konvulsionen gingen in seinem Schädel weiter, als wollten seine Augäpfel sich wie Ballons aufblähen, als könnte das weiche Innere seines Gesichts jeden Augenblick durch die Nasenlöcher rausspritzen. Er stellte sich vor, sein Gehirn würde mit einer widerlichen, ätzenden Flüssigkeit vollgepumpt oder davon entleert.
Woanders in der Kabine ging das Knurren und Knuffen weiter, begleitet von irrem Gelächter.