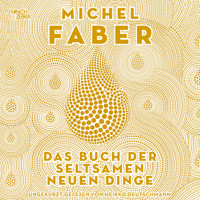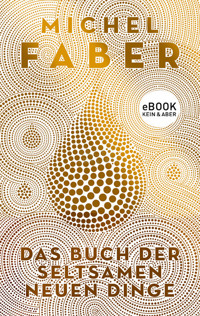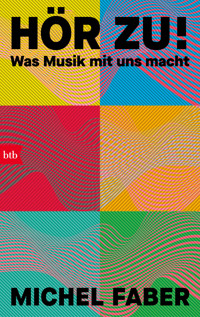
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine aufschlussreiche und wunderbar humorvolle Erkundung darüber, wie und warum wir Musik hören, vom preisgekrönten britischen Bestsellerautor Michel Faber
»Dieses Buch will dir nicht das vermitteln, was dir andere Musikbücher vermitteln. Es wird dir nicht dabei helfen, mit deinen Lieblingskünstler*innen und -genres eine noch tiefere Beziehung einzugehen […] Dafür wirst du aber vielleicht besser verstehen, warum du liebst, was du liebst – und eine plausible Erklärung dafür bekommen, dass du andere Musik aus ganzem Herzen hasst.«
Es gibt unzählige Bücher uber Musik, in denen Musiker*innen, Bands, Epochen und Genres ausfuhrlich analysiert werden. Aber selten beschaftigt sich ein Buch damit, was in uns vorgeht, wenn wir Musik hören. Michel Faber erforscht zwei große Fragen: wie wir Musik hören und warum wir Musik hören. Um diese Fragen zu erörtern, berücksichtigt er Themen wie Biologie, Alter, Krankheiten, »Coolness«, kommerzielle Hintergrunde, die Dichotomie zwischen »gutem« und »schlechtem« Geschmack und findet durch Interviews mit Musikerinnen und Musikern allerhand überraschende Antworten.
Dieses erhellende Buch des preisgekrönten Romanautors spiegelt Michel Fabers lebenslange Besessenheit für Musik jeglicher Art wider. Hör zu! wird Ihre Beziehung zur gehörten Welt verändern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 763
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
»Dieses Buch will dir nicht das vermitteln, was dir andere Musikbücher vermitteln. Es wird dir nicht dabei helfen, mit deinen Lieblingskünstler*innen und -genres eine noch tiefere Beziehung einzugehen […] Dafür wirst du aber vielleicht besser verstehen, warum du liebst, was du liebst – und eine plausible Erklärung dafür bekommen, dass du andere Musik aus ganzem Herzen hasst.«
Es gibt unzählige Bücher über Musik, in denen Musiker*innen, Bands, Epochen und Genres ausführlich analysiert werden. Aber selten beschäftigt sich ein Buch damit, was in uns vorgeht, wenn wir Musik hören. Michel Faber erforscht zwei große Fragen: wie wir Musik hören und warum wir Musik hören. Um diese Fragen zu erörtern, berücksichtigt er Themen wie Biologie, Alter, Krankheiten, »Coolness«, kommerzielle Hintergründe, die Dichotomie zwischen »gutem« und »schlechtem« Geschmack und findet durch Interviews mit Musikerinnen und Musikern allerhand überraschende Antworten.
Dieses erhellende Buch des preisgekrönten Romanautors spiegelt Michel Fabers lebenslange Besessenheit für Musik jeglicher Art wider. Hör zu! wird Ihre Beziehung zur gehörten Welt verändern.
Zum Autor
MICHEL FABER wurde 1960 in den Niederlanden geboren, wuchs in Australien auf und lebt heute in England. Er ist Autor von sieben Romanen, drei Novellen und einem Poesieband, darunter Die Weltenwanderin (verfilmt als Under the Skin mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle) sowie Das karmesinrote Blütenblatt. Sein Roman Das Buch der seltsamen neuen Dinge wurde vom New Yorker als eines der besten Bücher des Jahres bezeichnet, in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt und war ein internationaler Bestseller.
MICHEL FABER
HÖR ZU!
Was Musik mit uns macht
Aus dem Englischenvon Bernd Gockel
Die Originalausgabe LISTEN erschien 2023 bei Canongate Books Ltd., EdinburghDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 by Michel Faber
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
[email protected](Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlaggestaltung: semper smile, München unter Verwendung des Entwurfs von Rafaela Romaya
Umschlagmotiv: Shutterstock
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-32584-8V002
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Inhalt
Für wen ist das Buch gedacht?
Hörst du, was ich höre?
Gibt’s tatsächlich Leute, die keine Musik mögen?
Die Ohren eines Kindes 1: Hipness in der Muttermilch
Die Ohren eines Kindes 2: Dad-Rock stinkt
Die Suche nach der verlorenen Erinnerung
Schwarze Schafe, weiße Westen
Die Verlockung des grässlichen Dröhnens
Mit der Nadel durch die Augenbraue
Vom Echo verweht
Prügel auf die Ohren
Von der Freude, eine Stimme zu haben
Zarte Exoten
Die angelsächsische Hegemonie und der Rest der Welt
Ambient I: Musik für Private-Banking-Kunden
Noch einmal: Ludwig lebe hoch!
Coda
Wo ich meinen Parka kaufte
Der Geist der Begeisterung
Im Land der Geschmacklosen
Glück gehabt! Meine Meinung ist cool!
Behauptet wer?
Ein Besuch im Zoo
Gute Kunst von schlechten Menschen (über Rolf Harris, R. Kelly und Morrissey)
Der warme Klang von Mahagoni
Girl you know it’s true
Die Ladenhüter aus der Grabbelkiste
The Tracks of My Tears
Dinge, die nur Platz wegnehmen und Staub ansetzen
Geh zurück auf Start
Danksagungen
Songcredits
Anmerkungen
Register
Für Louisa
Für wen ist das Buch gedacht?
Dies ist ein Buch über Musik und die Leute, die sie hören – Ihre Freunde, Nachbarn, Sie selbst.
Ich habe nicht die Absicht, Ihre Einstellung zu Dusty Springfield, Schostakowitsch, Tupac Shakur oder Synthpop zu revidieren. Meine Absicht ist es, Ihre Einstellung zum Hören zu verändern.
○ ○ ○
Über Musik wurden bereits Abertausende Bücher geschrieben – und ungeachtet des geflügelten Wortes, »dass über Musik zu schreiben so unsinnig ist, wie zu Architektur zu tanzen«1, werden es immer mehr. Wenn aber das Schreiben über Musik so hirnrissig und absurd ist: Warum in Gottes Namen werden dann immer noch neue Bücher produziert? Die Antwort liegt auf der Hand: Weil wir als soziale Wesen fasziniert sind von uns selbst und der Beziehung zu unserer Peergroup. Und nichts ist so selbstreferenziell und verbindend wie Musik.
Moment mal! Sind Egozentrik und Tribalismus nicht völlig gegensätzliche Konzepte? Keineswegs. Deine Peergroup ist nur eine Akkumulation der Person, die du zu sein glaubst. Du fühlst eine innere Verbundenheit zu der Musik, die dich an dich erinnert – und suchst nach gleichgesinnten Seelen, die sich ein Biotop mit dir teilen. Dein ideales Refugium ist eine homogene Gruppe von Individuen, die genauso denken und fühlen wie du. Sie wissen sofort, auf welche Songzeile du mit einer beiläufigen Bemerkung anspielst oder welche Stimmung du mit einer Nummer des BWV2 assoziierst. Ob du dich nun unter Folkies wohlfühlst, unter Metalheads, Raver*innen, Gruftis, Deadheads oder Beliebern: Es sind im wahrsten Sinne des Wortes deine homies.
Die Kunst hält nicht »der Natur einen Spiegel vor«, wie es so schön heißt, sondern lässt dich selbst in den Spiegel schauen.
○ ○ ○
Die meisten Musikbücher suggerieren – mehr oder minder erfolgreich – die Hypothese, dass Musik quasi außerhalb der menschlichen Natur existiert und immanente Qualitäten besitzt, die mit der musikalischen Sozialisierung der Hörer*innen in keinem Zusammenhang stehen. Beinharte Idealisten sprechen über ihre Lieblingsmusik – die Goldberg Variationen von J.S. Bach, Pet Sounds von den Beach Boys, What’s Going On von Marvin Gaye oder Untrue von Burial –, als sei sie ein geheimnisvolles Naturschauspiel oder ein historisches Wahrzeichen wie der Grand Canyon oder die Pyramiden: Man kann sich letztlich nur dem Pilgerzug anschließen, um diesem Meisterwerk ehrfürchtig Tribut zu zollen.
Ich mag diese Art der Erzählung. Es ist eine anrührende Geschichte. Und ich kann durchaus nachvollziehen, warum Musikfreunde sie mit Begeisterung immer weitererzählen.
Aber um es ganz direkt zu formulieren: In der modernen, mega-kapitalistischen Gesellschaft ist Musik nichts anderes als eine Ware. Wir benutzen sie ständig und in rauen Mengen. Wir treiben Fitness mit Musik, wir meditieren mit Musik, wir dämpfen die alltägliche Lärmkulisse mit Musik, wir shoppen mit Musik, beeindrucken unsere Freund*innen mit Musik, wenn sie uns besuchen, bewerben Fastfood und Zinsdarlehen mit Musik, wir benutzen Musik, um uns morgens aus dem Tiefschlaf zu reißen und abends einzulullen, vielleicht auch, um uns zu sportlichen oder sexuellen Höchstleistungen zu steigern, wir unterlegen Filme mit Musik, um spezielle Handlungsstränge herauszuarbeiten, oder benutzen sie, um ein peinliches Schweigen zu überspielen. Gestresste Konsumenten, die sich nach der Stille unserer Vorfahren sehnen, hören CDs oder Streams wie Zen-Meditationen oder Entspannungsmusik mit Naturgeräuschen – nur um absolut sicherzustellen, dass sie nie mit der »falschen« Form von Stille konfrontiert werden.
Musik ist ein Rohstoff. Wir bekommen raue Mengen frei Haus – meist in der Kombi mit anderen Konsumgütern und integriert in unsere alltägliche Routine. Aber wir kaufen auch eine Menge. Wir horten sie geradezu. Rezensenten wie Künstlerinnen versprechen uns schließlich, tiefgreifende Erfahrungen zu durchlaufen, wenn wir uns nur intensiv mit einem spezifischen Album beschäftigen. Dummerweise wird unsere Aufmerksamkeit aber so oft abgelenkt, dass wir die existenziellen Erfahrungen immer auf später verschieben.
Am Ende des Tages, nachdem sie den unterschiedlichsten Funktionen Rechnung getragen hat, löst sich die Musik in Luft auf. Sind die Klangwellen verklungen, verschwindet auch die Musik im Nichts.
Vorausgesetzt natürlich, sie wird überhaupt gehört. Ein Großteil der existenten Aufnahmen schlummert in Telefonspeichern, verstaubt auf überfüllten Regalen oder wird in Kisten gestopft, die in Gästezimmern und Garagen ihr Dasein fristen. Millionen CDs landen jedes Jahr im Abfall und wandern von dort umgehend auf die Deponie.3
Und doch schwärmen wir noch immer davon, wie sehr wir die Musik lieben. Was nicht einmal gelogen ist: Wenn wir uns im Überschwang der Gefühle zum Kauf einer CD entschließen, kann man tatsächlich für einen kurzen Augenblick von Liebe sprechen.
Dieses Buch will dir nicht das vermitteln, was dir andere Musikbücher vermitteln. Es wird dir nicht dabei helfen, mit deinen Lieblingskünstler*innen und -genres eine noch tiefere Beziehung einzugehen und so eine Intimität zu stiften, die dich für den kleinen Kreis der Erleuchteten qualifiziert. Es wird dir nicht zu deinem guten Geschmack gratulieren, nur weil du Perfume Genius oder Prince schätzt, Mozart oder Cabaret Voltaire (aber nur die Cabs bis 1982, als Chris Watson ausstieg und die Band einen Vertrag bei Virgin unterschrieb!). Wenn du dich mit mir auf diese Reise begeben willst, bekommst du eine Menge Fakten, aber es sind nicht die Informationen, die dir übliche Musikbücher versprechen.
Dafür wirst du aber vielleicht besser verstehen, warum du liebst, was du liebst – und eine plausible Erklärung dafür bekommen, dass du andere Musik aus ganzem Herzen hasst.
○ ○ ○
In meinem Haus ist ein Zimmer ausschließlich der Musik gewidmet: Tausende von CDs, Vinyl-Alben und Singles, Tausende von selbst kompilierten Kassetten und CD-Rs, dazu ein Computer, der bis zum Rand mit MP3s gefüllt ist. Und doch wirst du im Folgenden nur wenig über meine Sammlung erfahren. Meine All-Time-Favourites werden für dich ein Geheimnis bleiben. Es gibt für mich keinen Grund, darüber zu sprechen – so wie es für dich keinen Grund gibt, mich danach zu fragen.
Viele Bücher über Musik sind der intellektuelle Überbau der Sammlung, die der Autor sein Eigen nennt – und von der er natürlich fest überzeugt ist (es ist meistens ein Er), dass auch du sie besitzen solltest.4 Es ist nicht das Ziel dieses Buches, deine Sammlung noch weiter anschwellen zu lassen. Es will dir vielmehr dabei helfen, deine Vorlieben und Abneigungen in einem neuen Licht erscheinen zu lassen.
Musikschreiber*innen erinnern uns oft an Missionare, die neue Schäfchen bekehren – oder zumindest Gläubige in ihrem Glauben bestärken wollen. Sie appellieren an dich, dass »jeder echte Musik-Lover, jeder Mensch mit Geschmack« diesen oder jenen Künstler*innen die Füße küssen müsse. Sich der Magie dieser musikalischen Gottheit zu entziehen, grenze schon an Frevel. Vielleicht kapierst du heute Charlie Parker noch nicht (oder Sufjan Stevens oder Schönberg), aber der Tag wird kommen, an dem sich der Himmel auftut und dir die längst überfällige Erleuchtung schenkt.
Das Evangelium macht dich nicht nur auf Dinge aufmerksam, die du ins Herz schließen solltest; ausgesprochen oder unausgesprochen hält es dich auch von schlechter Musik fern – Musik, die von den falschen Leuten gemacht wird, in falschen Sprachen gesungen und falschen Stilen gespielt wird, die zum falschen Zeitpunkt kommt oder die falschen inhaltlichen Signale setzt.
Im Folgenden werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie dieser bemerkenswerte Psychoterror im Detail funktioniert.
○ ○ ○
In einem weiteren Schritt werden wir auch das Rätsel zu lösen versuchen, was eigentlich beim Hören passiert und wie wir das Gehörte verarbeiten. Es passiert eine Menge in dieser noch jungen Disziplin, und die Forschungen beschäftigen sich nicht etwa mit der Frage, ob Van Morrisons Stimme noch immer die hohen Töne trifft oder Beethovens Œuvre die pan-germanische Nostalgie nach dem mittelalterlichen Christentum verkörpert – wie das zu Beginn des 20. Jahrhunderts von dem preußischen Philosophen Carl Schmitt postuliert wurde.
Nein, die Antwort auf diese Fragen finden wir schlicht und ergreifend in der Biologie – in dem Hirn, das in deinem Schädel schwimmt, wie ein Blumenkohl aussieht, aber so matschig ist wie Marmelade und auf absolut jeden Stimulus reagiert.
Es hat aber auch mit deiner spezifischen Biografie zu tun – mit den Umständen deiner Erziehung, mit Faktoren wie Zuspruch oder Abweisung, die du in deiner Kindheit erfahren hast, mit den Leuten, deren Nähe du gesucht oder gemieden hast, mit dem Grad der Unbeschwertheit, die du im Umgang mit Sexualität, Hautfarbe, Nationalität oder gesellschaftlicher Stellung entwickelt hast. Das Leben hat dir einen spezifischen Platz zugewiesen. Du bist ein kulturelles Artefakt, das Urteile fällt über die anderen kulturellen Artefakte, die deinen Weg kreuzen.
Unsere Reaktion auf Musik scheint so instinktiv zu sein, so spontan und unmittelbar, dass wir uns einreden, es handele sich dabei tatsächlich um einen Instinkt. Wenn wir den ersten Ton von Billie Holiday oder Umm Kulthum hören, das Eröffnungs-Riff von Led Zeppelins »Whole Lotta Love« oder die Fanfare von Richard Strauss’Also sprach Zarathustra, erleben wir eine physische Sensation, die das kognitive Urteil über den Wert dieser Musik völlig überflüssig macht. Diese Musik bringt unser Blut in Wallung, erzeugt innerhalb von Sekunden eine Gänsehaut und fühlt sich so stimmig an, als stamme sie direkt aus dem platonischen Reich der puren, ungefilterten Ideen. So geht es uns doch allen, oder etwa nicht?
Nein.
Du wurdest nicht mit dem Wissen geboren, dass Barockmusik nie mit Vibrato gespielt werden darf, oder dass The Clash relevanter waren als Siouxsie and The Banshees, oder dass Cliff Richard ein laues Lüftchen und Disco für’n Arsch war, oder dass an einem guten Abend die Rolling Stones noch immer die greatest rock’n’roll band in the world sind, oder dass ihnen U2 diese Krone schon vor vielen Jahren abnahmen, oder dass U2 mit Rock ’n’ Roll überhaupt nichts zu tun haben und nur Blinde und Taube das Gegenteil behaupten können, oder dass Alice Coltrane die Musik ihres Mannes bastardiert hat (sorry, wenn das unhöflich ist, aber es musste schließlich mal gesagt werden), oder dass Alice Coltranes Kritiker allesamt verkorkste Misogynisten sind, oder dass all diese gehypten Pop-Diven unserer Aretha, der wahren Queen of Soul, nicht mal die Füße küssen können, oder dass es nie ein Jahrzehnt gab, das musikalisch so relevant war wie die Sechziger (oder wahlweise die Siebziger, Achtziger, Neunziger oder Nullerjahre).
Was wusstest du von dieser Musik, als du geboren wurdest? Schließlich waren die einzigen Klänge, die du kanntest, die gurgelnden Geräusche im Bauch deiner Mutter.
○ ○ ○
Doch kommen wir noch einmal auf die Überschrift dieses Kapitels zurück: Für wen ist dieses Buch gedacht? Natürlich für dich. Du hältst es in der Hand, weil du es gekauft oder anderweitig bekommen hast. Also: Wer bist du?
Du bist wahrscheinlich zwischen 25 und 65 Jahre alt. Du könntest auch jünger oder älter sein, aber statistisch gesehen lesen Jüngere kaum noch Bücher, weil sie lieber Charts-Futter auf ihrem Smartphone streamen, während die Älteren kein Buch mehr brauchen, um sie an ihr Faible für die liebgewonnenen Oldies zu erinnern.
Du hingegen setzt dich als souveräne*r Leser*in auf Augenhöhe mit einem seriösen Buch auseinander, das sich offen dazu bekennt, die vermeintlichen Wahrheiten nicht noch einmal recyceln zu wollen. Was dich zu einem Mitglied einer ziemlich elitären Minderheit macht. Die meisten Leute halten das Lesen grundsätzlich für mühsam und bevorzugen die reduzierte Prosa von Klatschpresse und Programmzeitschrift. In Großbritannien etwa haben rund ein Viertel der Menschen »ungenügende Lese- und Schreibkenntnisse«.5 Die Prozentzahl derer, die sich gelegentlich einen actionlastigen Thriller oder eine Promi-Bio gönnen, aber um Bücher wie Hör zu! einen weiten Bogen schlagen, dürfte noch weitaus höher liegen. Wenn du es also bis hierhin geschafft hast, umweht dich bereits die Aura des Außerordentlichen.
Was dir aber nicht zu Kopf steigen sollte. Außergewöhnlich zu sein ist noch keine Auszeichnung, sondern nur die Abweichung von der Norm. Intellektuelle – ob es nun Bücherwürmer sind, tiefsinnige Denker*innen, empfindsame Seelen oder wie immer man seine eigene Nische definieren möchte – sind eine Minorität wie alle anderen auch. Sie suchen ihre Bestätigung in der Spezialisierung, sind aber unfähig, im Kontakt mit anderen Menschen einen gemeinsamen Nenner zu finden. Sie trösten sich gegenseitig und legen Wert auf die Feststellung, nicht kauzig oder gekünstelt zu sein – was sie statistisch betrachtet aber eindeutig sind.
Zum Glück hat der durchschnittliche Nichtintellektuelle Besseres zu tun, als mit seinem Hirnschmalz das Mysterium der Kunst zu bedenken. Alles, was du und ich zum Leben benötigen, alles, was uns mit den Annehmlichkeiten der menschlichen Existenz versorgt, wird uns von Leuten angeliefert, die vermutlich nie zu einem Buch wie diesem greifen würden. Du hast den Luxus, über elegante Klanglandschaften zu meditieren und an deiner finalen Meinung zu MozartsRequiem oder Joni MitchellsMingus zu feilen, während der Müllmann deinen Unrat wegkarrt, Bäuerinnen deine Lebensmittel produzieren, Kuriere die Apotheken mit deinen Pillen beliefern oder unterbezahlte Verkäuferinnen die Regale mit T-Shirts bestücken, die in Bangladesch am Fließband produziert wurden. Willst du Wasser, brauchst du in der Küche nur den Hahn aufzudrehen.
Auch wenn dir all diese Dinge vermutlich wichtiger sind als das Tröten einer Klarinette oder ein Bass-Riff von 1969, wehrst du dich doch mit Händen und Füßen, wenn man dich aus deinem idyllischen Paradies vertreiben will. Dickköpfig hältst du an deiner Meinung fest, dass Musik essenzieller ist als alles andere auf der Welt.
Mach dir nichts draus. Mir geht’s genauso.
○ ○ ○
Was aber nicht bedeutet, dass wir alle die gleiche Ausgangsposition haben. Wir nähern uns der Musik mit einem Vorverständnis dessen, was für uns gute oder schlechte Musik ist. Hör zu! wird diese Vorurteile infrage stellen – was aber voraussetzt, dass du mit dieser Herausforderung umgehen kannst und nicht eine dieser Personen bist, die gleich auf die Palme geht. Du hältst dich für einen aufgeschlossenen Menschen? Gut. Hoffen wir das Beste, liebe Leserin und lieber Leser! Unsere gemeinsame Reise hat schließlich gerade erst begonnen.
Möglicherweise kommst du aus einem Kulturkreis, der eine nicht-englische Sprache spricht und »fremde« Traditionen pflegt. Sollte das der Fall sein, wirst du vielleicht überrascht sein, nun ein Buch zu lesen, das nicht nur die Anglophilen unter uns anspricht. Und sollte dich diese Drohung aus dem Gleichgewicht bringen, setz dich besser hin und atme ein paar Mal tief durch.
Möglicherweise hast du sogar eine dunklere Hautfarbe. Sollte dies der Fall sein, fällst du aus dem Rahmen jedweder Wahrscheinlichkeit. Die meisten seriösen Bücher über Musik wenden sich an Leser*innen mit einer weißen Hautfarbe. Das mag nicht einmal Absicht sein, ist aber der Lauf der Dinge. Selbst Bücher über Musik, die vorwiegend von nicht-weißen Menschen gemacht wurden – Blues, Funk, Soul und so weiter –, werden primär von Weißen gelesen und, bis vor Kurzem jedenfalls, auch von Weißen geschrieben. Selbst heute könnte man noch problemlos einen Stapel mit Büchern kaufen, die Titel tragen wie Harlem in Montmartre: A Paris Jazz Story Between the Great Wars (Music of the African Diaspora); Theory of African Music, Volume II; The Original Blues: The Emergence of the Blues in African American Vaudeville oder Brick City Vanguard: Amiri Baraka, Black Music, Black Modernity (African American Intellectual History), ohne dabei einem Schwarzen Autor zu begegnen. Warum das so ist? Vielleicht liegt es daran, dass sich die Musikforschung jahrhundertelang nur mit klassischer Musik beschäftigt hat – und klassische Musikkritik in ihrer arroganten Selbstgefälligkeit immer immanent rassistisch war. Ich weiß auch nicht, wie man diesen Tatbestand ändern könnte – außer vielleicht zu sagen: »Hey, komm rein und mach’s dir bequem. Lass uns doch einfach mal gemeinsam über ein paar Dinge nachdenken.«
Ich würde mich auch freuen, wenn meine Leser*innen zu gleichen Teilen männlich wie weiblich wären. Meine Romane haben in dieser Beziehung eine überraschend ausgeglichene Leserschaft, während Musikbücher zumeist eher ein männliches Publikum finden. Die intensive Beschäftigung mit Musik und ihren Macher*innen geht oft Hand in Hand mit einer Neigung zu kumpelhaften Sammler-Exzessen. Frauen sind weit weniger begeistert, wenn sie mit der kompletten Phil-Spector-Diskografie konfrontiert werden oder den sexuellen Großtaten eines misogynen Gitarristen. Anders gesagt: Frauen reagieren oft auf Musik in einer Art und Weise, die männliche Kritiker gerne als irrational abtun. All denjenigen, die den kalten Hauch dieser Verachtung bereits am eigenen Leib erfahren haben, kann ich nur versprechen, dass es in diesem Buch etwas ziviler zugeht.
Du hast in deinem Leben vielleicht einen Punkt erreicht, an dem du noch immer gerne Musik hörst und auch darüber diskutierst, aber keinen Bock mehr hast auf die Art von Diskussionen, die du in deinem früheren Leben geführt hast. Sollte das der Fall sein, könnte dieses Buch vielleicht der Wegweiser sein, auf den du schon lange gewartet hast.
Was aber noch immer nicht bedeutet, dass du das Buch auch magst. Die meisten von uns sind in ihren Überzeugungen so verwurzelt, so wehrhaft in ihren Reflexen und so wohlig integriert in ihren Stammesnischen, dass wir zwar nach Alternativen suchen, aber umgehend zusammenzucken, wenn diese Alternativen einschneidende Veränderungen von uns verlangen. Vielleicht kommst du – in ein paar Minuten oder erst nach längerer Lektüre – zu dem Entschluss, mich nicht auf meinem Weg begleiten zu wollen. Sollte das so sein, kann ich mich für deine verlorene Zeit nur entschuldigen.
○ ○ ○
Einen letzten Grund gibt es, der dich möglicherweise zu diesem Buch greifen ließ: Du hast Das karmesinrote Blütenblatt oder Die Weltenwanderin oder Das Buch der seltsamen neuen Dinge mit Gewinn gelesen und willst in Ermangelung weiterer Michel-Faber-Romane nun auch seinem ersten Sachbuch eine Chance geben.
In diesem Fall bin ich zuversichtlich, dass der literarische Ansatz meiner Romane – ein Outsider, der staunend Insider studiert, dabei immer etwas unangepasst, aber nicht abgehoben ist, unsentimental, aber nicht abgestumpft – auch in diesem Buch seinen Niederschlag findet.
○ ○ ○
Und bei dieser Gelegenheit sollte ich besser reinen Tisch machen und zugeben, dass ich dieses Buch letztlich nur für mich geschrieben habe. Musik ist meine älteste Liebe – und Hör zu! das Buch, das ich mein ganzes Leben lang schreiben wollte.
Hörst du, was ich höre?
Ein Tusch! Ich habe Tinnitus.
Er stellte sich 2017 ein, als ich dieses Buch zu schreiben begann. Jahrzehnte waren vergangen, seit ich die lautesten Konzerte meines Lebens besucht hatte: The Birthday Party 1983 in Melbournes Seaview Ballroom, nach dem meine Ohren noch tagelang dröhnten, oder The Young Gods 1992 im Sarah Sands Hotel, das die Fenster klirren, die Wände beben und das Dach fast abheben ließ.
Mein Tinnitus klopfte aber plötzlich an der Tür, als ich allein zu Hause saß. Die Vorstellung, eine CD einzulegen und Musik zu hören, war mir der reinste Horror. Selbst wenn ich die Lautstärke auf ein Säuseln reduziert hätte, empfand ich den Akt des Hörens zu diesem Zeitpunkt als pure Vergewaltigung.
Leute, die mich gut kennen, werden einstimmig bestätigen: Wenn ich freiwillig auf Musik verzichte, muss ich irgendwie krank sein. Doch keine*r meiner Freund*innen war in der Lage, den Staub zu entdecken, der sich damals auf meiner Stereoanlage bildete. Ich war allein in der Wohnung – nur ich und mein Tinnitus.
Die Ursache? Möglicherweise der Nervenzusammenbruch, den ich gerade überstanden hatte. Vielleicht waren es aber auch die scharfen Gegenstände, die ich in meine Gehörgänge steckte, um sie vom Schmalz und dem damit verbundenen Juckreiz zu befreien. Wie dem auch sei: In einem Monat war ich ein menschliches Wesen, in dessen Kopf friedvolle Stille herrschte (vorausgesetzt, er wurde nicht gerade von externen Reizen beansprucht), um im nächsten Monat zu einer gemarterten Kreatur zu mutieren, die konstant einen schrillen Ton zu hören glaubt, der für andere Personen unhörbar bleibt.6
Sechs Jahre später ist der Ton noch immer mein ständiger Begleiter. Wenn du willst, kannst du dich gerne neben mich setzen und dein Ohr an meinen Kopf drücken. Vielleicht hörst du, wie meine Lungen die Luft durch meine Nase einsaugen – vorausgesetzt, du wirst nicht durch deinen eigenen Atem abgelenkt. Was du aber nicht hören wirst, ist dieses eigentümliche metallische Kreischen. Es erinnert mich an die Bremsen eines Zuges, der langsam das Tempo drosselt, aber nie zum Halt kommt. Dieser Sound gehört mir ganz allein.
Ich kann das Klingeln in meinen Ohren noch verstärken, indem ich meinen Unterkiefer nach vorne schiebe. Diese Beobachtung erinnert mich daran, dass meine Ohren aus Knochen, Muskelfleisch, Haaren und Membranen bestehen und ihre Struktur verändern, sobald ich eine Grimasse schneide.
In vorwissenschaftlichen Zeiten galt das Ohr als ein magischer Empfänger, der externe Geräusche registriert und irgendwie weiter ins Hirn leitet. Wir gingen davon aus, dass diese Klänge bereits in der Welt existieren und dann, wenn sie durch die seitlichen Schlitze unseren Schädel passieren, in der Zentrale sachgerecht identifiziert und interpretiert werden.
Die Realität sieht ein wenig anders aus. Die Welt ist von Natur aus lautlos und stumm. Wenn ein Baum umfällt, eine Bombe explodiert oder eine Violinistin pizzicato zupft, wird die Luft in unterschiedlicher Weise in Schwingungen versetzt. Die atmosphärische Ausgangsposition wird durcheinandergewirbelt und erreicht in einem veränderten Zustand dein Ohr. Wir erledigen dann den Rest. Unser Gehör ist nichts anderes als ein musikalisches Instrument. Genau genommen ist unsere Ohrtrommel genauso aufgebaut wie die Trommel, die ein Schlagzeuger spielt.
Die Welt spielt uns.
○ ○ ○
Das wiederum hat enorme Konsequenzen für die Art und Weise, wie wir Musik wahrnehmen. Schieb deinen Unterkiefer nach vorne. Hörst du ein Klingeln in deinem Hirn? Wenn nicht, ist dein Hirn ein anderes Instrument als meins.
Es gibt in der Bevölkerung nicht nur die unterschiedlichsten Kopfformen, sondern auch verschieden gestaltete Ohren und endlose Variationen eines Hirns, das in der Zerebrospinal-Flüssigkeit schwimmt, die der Volksmund auch als Hirnwasser kennt. Man kann mit einigem Fug und Recht vermuten, dass alle Musikrezeptoren leicht unterschiedliche Geräusche generieren, wenn sie von der Welt gespielt werden. Aber du wirst diese Frage nie mit endgültiger Sicherheit klären können, weil du immer von der Annahme ausgehst, dass du das Gleiche hörst wie die Person neben dir.
Natürlich könnte man vermuten, dass es ein grundlegendes Design geben muss, nach dem alle Hirne funktionieren. Wir sind schließlich eine spezifische Gattung der Primaten – und nicht die direkten Nachkommen von Insekten oder Schalentieren.
Der Standardisierung sind aber auch natürliche Grenzen gesetzt. Einige unserer Ahnen kamen von Produktionsstätten in Asien, andere aus Afrika oder Skandinavien. Wir sind alle handgemacht und organisch einwandfrei. Vorgefertigte Einzelteile oder artifizielle Substanzen sind tabu. Man stelle sich acht Milliarden Gitarren vor, die händisch hergestellt wurden, allerdings in 195 verschiedenen Produktionsstätten, die alle auf ihre lokalen Materialien zurückgegriffen haben. Ein identisches Endprodukt ist illusorisch.
Du solltest also mit der Tatsache leben lernen, dass du eine andere Gitarre bist.
Möglicherweise eine gänzlich andere Gitarre.
○ ○ ○
Mein Gehör war einmal ausgezeichnet.
Womit ich nicht behaupten will, brillantere Ohren gehabt zu haben als Brian Wilson, der nur ein funktionierendes Ohr besaß, als er »God Only Knows« aufnahm. Auch mit der überragenden Perkussionistin Evelyn Glennie möchte ich nicht konkurrieren, zudem Glennie im Lauf ihrer ganzen Karriere hochgradig schwerhörig war.7 Ich wollte damit nur festgehalten wissen, dass zu der Zeit, als ich vom Fließband lief, noch alles in Ordnung war und die elementaren Einzelteile an ihrem richtigen Platz saßen.
Wenn wir älter werden, gehen uns für gewöhnlich zunächst die oberen Teile des Spektrums verloren. Schrille Töne im Hochfrequenz-Bereich werden schlicht und einfach nicht mehr registriert. Seit ich in meinen Fünfzigern bin, drehe ich den Höhenregler meines Verstärkers immer voll auf – eine Unsitte, die mir in früheren Jahren hochgradig suspekt gewesen wäre. Aber was will man machen? Das jüngere Ich hat sich nun einmal frühzeitig verabschiedet.8
Ich bin, ich gebe es zu, inzwischen schon ganz schön alt – sieben Jahre älter als Beethoven, der 56 war, als er starb. Im gleichen Alter verließen uns Rick James, Ranking Roger, Warren Zevon, Denise Johnson von Primal Scream, Grant Hart von Hüsker Dü sowie David R. Edwards, der Kopf von Datblygu, meiner liebsten Band aus Wales. Noch früher dran waren Tschaikowsky (53), Mahler (50) oder Robert Johnson (29). Niemand von ihnen starb an einer Überdosis oder wurde ermordet. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass einige dieser Milliarden Gitarren, die vom Fließband kommen, unbemerkt durch die Qualitätskontrolle schlüpften.
Positiv lässt sich festhalten, dass keine*r dieser Musiker*innen – Beethoven ausgenommen – frühzeitig mit einem partiellen Hörverlust leben musste.
Und – Tusch! – mit keinem Tinnitus.
○ ○ ○
Ist Tinnitus unerträglich? In einigen Fällen trifft das vermutlich zu. Die Worte, die Patient*innen beim Beschreiben ihres Leidens wählen, sprechen eine deutliche Sprache: »Verzweiflung«, »Qual«, »Invalidität«, »Lähmung« und »Selbstmordgedanken« können einem schon Angst machen.
Die Belege für eine Verbindung zwischen Tinnitus und Selbstmord sind indes dürftig. Die Geschichte des Mannes, der gleich vom Hochhaus sprang, nachdem ihm ein Arzt keine Hoffnung auf Heilung machte, gehört wohl eher ins Reich der urbanen Mythen. In den meisten Fällen lernen wir mit wachsendem Alter, eine größere Toleranz für die deprimierenden Defizite unserer Ohren (und Augen, Gelenke, Zähne oder Genitalien) zu entwickeln. Alternativen gibt’s eh nicht.
Und trotzdem häufen sich die Tage, an denen mir der Wunsch, den Lärm in meinen Ohren einfach abzuschalten, schmerzhaft bewusst ist. Es ist letztlich eine Frage des gegenseitigen Einvernehmens: Ich höre durchaus gerne Musik – von Pan Sonic etwa oder den Einstürzenden Neubauten –, die mit Geräuschen arbeitet, die meinem Tinnitus nicht unähnlich sind. Aber es ist meine Entscheidung, diese Musik zu einem bestimmten Zeitpunkt zu hören. Während mich der Tinnitus nie um Erlaubnis fragt, ob er mich mit seiner schrillen Sirene belästigen darf. Er folgt mir sogar aufs Klo. Und kriecht abends zu mir ins Bett.
○ ○ ○
Ein überraschender Aspekt der Krankheit ist der, dass es andere Geräusche sind, die eine Linderung versprechen. Eine populäre Behandlungsmethode ist der »Tinnitus Masker« – eine Form der Audio-Berieselung, die Patient*innen als »Wind in den Bäumen« oder »Wasserfall« beschreiben. Da ich persönlich keinen Wasserfall hören mag, wenn ich nicht gleich neben einem stehe, bevorzuge ich lieber Musik.
Einige Künstler und Künstlerinnen – wie die bereits erwähnten Pan Sonic – benutzen Frequenzen, die denen des Tinnitus nicht unähnlich sind. Andere – wie in der akustischen Folkmusik oder manche Solopianist*innen – tun das genaue Gegenteil. Für mich macht das kaum einen Unterschied. Was mir hilft, ist nicht ein spezifischer Stil oder eine spezifische Frequenz, sondern die Konzentration, mit der ich Musik höre. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade mit neuen, faszinierenden Hörerlebnissen konfrontiert werde, vielleicht fehlt mir auch einfach nur die Gabe, einen schrillen Ton zu registrieren, wenn ich mich gerade auf fünf andere Klänge konzentriere.
Ich sprach einmal mit einem Mann, dessen Augenlicht so geschädigt war, dass er große dunkle Zylinder sah, die quer durch sein Blickfeld schwebten. Er bemerkte aber auch, dass diese Fremdkörper mit der Zeit ihre Intensität verloren – ohne dass seine Augen in irgendeiner Form behandelt worden wären. Sie existierten also noch, wurden durch die tägliche Routine aber in den Hintergrund gedrängt. In gleicher Weise möchte ich auch mit meinem Tinnitus umgehen.
Manchmal funktioniert das, manchmal nicht.
○ ○ ○
Mein Tinnitus war auch der Auslöser, der mich an die organische Natur meiner Existenz erinnerte. Mein Bewusstsein ist eben nicht eine autarke Software, die in eine menschliche Konsole installiert ist. Ich bin kein ghost in the machine. Ich bin Fleisch und Knorpel und Knochengewebe. Ich gehöre in die gleiche organische Kategorie wie das überfahrene Tier auf der Straße, die einst lebende Materie, die heute in meiner Spaghetti Marinara ihr Dasein fristet, der filetierte Fisch, den ich in Alufolie wickle und in den Ofen schiebe. Als ich zum ersten und einzigen Mal einen Fasan zubereitete, war ich überrascht von der Vielzahl mysteriöser Knöchelchen – weit mehr, als man in einem Hühnchen findet. Wofür zum Teufel werden die alle gebraucht?
Mit dem menschlichen Körper kann der Fasan erwartungsgemäß nicht mithalten. Sicher, einige Körperteile haben offensichtliche Funktionen wie Fortpflanzung oder Verdauung, während andere für wirklich rätselhafte Verrichtungen gebraucht werden – wie etwa die Beurteilung der Frage, ob das 2017 veröffentlichte Decca-Remaster von Georg SoltisAida-Interpretation, bereits 1962 eingespielt, wirklich die zusätzlichen Nuancen liefert, um Soltis Faible für Wagnerianischen Pomp zu konterkarieren. Oder ob der Mono-Mix von Aretha Franklins »(You Make Me Feel Like) A Natural Woman« nicht einen Tick intensiver ist als die Stereo-Version. Oder ob die spektral zerfasernden Klänge in Björks »Unravel« vielleicht von einem rückwärts eingespielten Clavichord stammen.
Man mag nicht glauben, dass wir etwas so unglaublich Subtiles wie Musik mit diesen absolut lächerlichen Low-Tech-Werkzeugen verarbeiten – denn anders kann man die krummen Knöchelchen, die Innenohrhärchen oder den lymphatischen Schmalz beim besten Willen nicht bezeichnen.
Es ist fast so, als wolle man ein Raumschiff mit einem Triebwerk ausrüsten, das aus Stöckchen, Gummibändern und Käse besteht.
Und doch: Es fliegt.
Gibt’s tatsächlich Leute, die keine Musik mögen?
In seinen Memoiren Erinnerung, sprich! schreibt Vladimir Nabokov: »Ich muss gestehen, dass ich Musik vor allem als willkürliche Folge von mehr oder weniger irritierenden Geräuschen empfinde. Unter besonders emotionalen Umständen kann ich mit den mäandernden Wallungen einer voluminösen Geige vielleicht noch leben, doch ein Konzertflügel und ausnahmslos alle Blasinstrumente empfinde ich in kleinen Dosen als langweilig, in höherer Dosierung sogar als absolut tödlich.«
Das Bohei um Lolita mag längst verklungen sein, doch seine Meinung zur Musik kann noch immer schockieren. Hat der Mann wirklich gerade gesagt, dass er Musik nicht mag ? Das ist schließlich keine Frage nach der Vorliebe, die man für eine Sportart oder eine Hunderasse hat, sondern ein ernst zu nehmender pathologischer Befund.
Konsequenterweise hat man dieser Krankheit eine medizinische Bezeichnung gegeben, die bereits mit ihrer altgriechischen Herkunft signalisiert, dass es sich hier um ein wissenschaftliches Faktum handelt und nicht um ein säkulares Hirngespinst: musikalische Anhedonie.
Und es kommt sogar noch dicker. Möglicherweise bist du von einer »angeborenen Amusie« befallen, die das Oxford Handbook of Music and the Brain wie folgt definiert: »Der Universalität von Musik zum Trotz, zählt der Patient zu einer Minorität, deren musikalischen Defizite sich weder auf auditive Funktionsstörungen zurückführen lassen noch auf intellektuelle Defizite oder den Mangel an Gelegenheiten, Musik überhaupt kennenzulernen.« Mit anderen Worten: Es gibt tatsächlich Menschen, die weder taub, stumpfsinnig noch ignorant sind – und trotzdem keinen Bezug zu Musik haben.
Es heißt, dass bis zu fünf Prozent der Weltbevölkerung von musikalischer Amusie befallen sind – wobei man sich natürlich fragt, wie Neurowissenschaftler*innen das überhaupt messen können. Falls zutreffend, wären das immerhin 400 Millionen Menschen!
Das Syndrom wird oft in den gleichen Zirkeln diskutiert, die auch den Geheimnissen des Autismus auf die Spur kommen wollen. Vereinfacht ausgedrückt, ist die Ausgangsposition die: Normale Menschen reagieren in einer vorhersehbaren Art und Weise. Man lacht an den »richtigen« Stellen oder bekommt eine Gänsehaut, wenn man imposante, aufwühlende Musik hört. Bei abnormalen Leuten mit Autismus oder Anhedonie wartet man vergeblich auf eine Reaktion.
Als jemand, der selbst eine »Autismus-Spektrum-Störung« hat, kann ich nachvollziehen, was es bedeutet, wenn dein Hirn anders funktioniert. Doch bedeutet das auch, dass bei mir etwas schiefgelaufen ist? Respekt für die sogenannte Neurodivergenz ist gut und schön, doch schließlich sind nicht alle Divergenzen per se wünschenswert. Das biologische Fließband hat durchaus seine Aussetzer, die zu ernsthaften Problemen führen können: Blindheit, Paralyse, fehlende Glieder, intellektuelle Defizite.
Doch gleichzeitig ist mir auch bewusst, dass »Normalität« in der Regel von gesellschaftlichen Gruppen missbraucht wird, um ein System zu konstruieren und zu verteidigen, das auf ihre speziellen Interessen zugeschnitten ist. Der Tag, an dem man Homosexualität als Krankheit definierte oder Feminismus als Störung (die gegebenenfalls operativ zu korrigieren sei), ist uns noch in erschreckend frischer Erinnerung. Wie viel normative Voreingenommenheit ist notwendig, um ein »normales« Verhältnis zur Musik zu entwickeln?
Ein Proband mit musikalischer Anhedonie, der sich Bostons Northeastern University zur Verfügung stellte, erzählte einem Professor, dass ihm das Eingeständnis seiner musikalischen Abnormalität ebenso schwergefallen sei wie das Outing als Schwuler. Das »Problem« war nicht unbedingt sein Verhältnis zur Musik, sondern seine Beziehung zu normalen Menschen, die seine Divergenz nicht tolerieren konnten. Die Wissenschaftler*innen schenkten dem sozialen Aspekt allerdings keine Beachtung, sondern konzentrierten sich darauf, mit biomedizinischem Imaging den auditiven Cortex seines Hirns zu durchleuchten.9
Ein anderes Forschungsobjekt ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind die feinen Härchen auf den Armen der Probanden. Zeigen diese dermalen Glühfäden nicht die erwartete Reaktion, muss es sich offensichtlich um Anhedonie handeln. Wobei ich mich frage, was wohl passiert, wenn ein Proband einfach noch nicht die Musik gefunden hat, die seine Gefühle in Wallung bringt. Was passiert, wenn deine Seele nach subsaharischer Gnawa-Musik lechzt oder alten toskanischen Tänzen, die aber noch nicht zu dir gedrungen sind, weil man dir immer nur Bach oder die Beatles vorspielt, U2, Charlie Parker, Van Halen und zu guter Letzt Whitney Houston – um dich dann als Niete einzustufen, weil dir bei »I Will Always Love You« nicht die Härchen zu Berge stehen?
Was mich aber am meisten an der musikalischen Anhedonie fasziniert – und den fünf Prozent, die angeblich an dieser Krankheit leiden –, ist die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, dass die fünf Prozent sogar noch untertrieben sind. Ich habe den starken Verdacht, dass es weit mehr als 400 Millionen Menschen gibt, die sich beim Thema Musik einfach ausklinken.
Die Parallele zum Outing eines Homosexuellen ist indes sehr hilfreich. Wir wissen von der Existenz zahlloser Homosexueller nur dadurch, dass sie langfristig nicht in der Lage waren, ihre wahre Sexualität zu unterdrücken. Schwule, die krampfhaft den Hetero mimen, kommen sich früher oder später selbst in die Quere – und diese Kollisionen können dramatische Folgen haben. Die fehlende Liebe zur Musik hingegen lässt sich weit leichter überspielen. Musikfans gehen stets davon aus, dass du genauso tickst wie sie selbst – und um nicht als Banause geoutet zu werden, spielst du das Spiel einfach mit. Du lernst die Sprache, in der Musikfans miteinander kommunizieren.
Privat kannst du dir die Posse natürlich schenken – und du tust es, ohne dabei einen Verlust von Lebensqualität zu empfinden. Im öffentlichen Leben hingegen werden dir die ungeliebten Klänge nicht erspart bleiben, doch wie es ein Anhedonist so treffend beschrieb: »Musik löst bei mir eine undefinierbare Reaktion aus, die irgendwo zwischen gelangweilt und genervt liegt.«10 Langeweile und eine moderate Gereiztheit sind aber nicht unbedingt der Stoff, den man mit einer höllischen Qual assoziiert. Man kann sein Leben lang damit umgehen, ohne eine Träne zu verdrücken oder hysterische Anfälle zu haben.
○ ○ ○
Das wahre Problem sind die anderen Leute.
In unserer Gesellschaft gilt es als beschämend, Musik nicht angemessen zu würdigen. Mit »unsere Gesellschaft« meine ich diejenigen, die in irgendeiner Form Teil des »Kulturbetriebes« sind – eine amorphe Elite, der im Prinzip jedermann beitreten kann. In ShakespearesDer Kaufmann von Venedig bekennt der noble Lorenzo, dass »er einem Mann, der keine Musik in sich hat, der nicht bewegt wird von der Harmonie süßer Klänge«, nicht vertrauen könne.11 Friedrich Nietzsche glaubte, dass »das Leben ohne Musik ein Irrtum« sei12, während ein jüngerer Zeuge namens Billy Joel keine Zweifel hegt, dass »es die Menschlichkeit ist, die in der Musik explosionsartig ihren Ausdruck findet. Es ist etwas, das uns alle berührt. Egal, in welcher Kultur man aufwuchs: Alle lieben Musik.«13
Das Problem mit der universellen Kraft der Kunst besteht darin, dass all diese Zeugnisse von Künstler*innen stammen – und dass sie offene Ohren primär bei denen finden, die den Künsten bereits aufgeschlossen sind. Oder die Billy Joel blind vertrauen, wenn er einen explosionsartigen Ausbruch von Menschlichkeit zu erleben glaubt. Die selbst ernannte Elite meint für uns alle zu sprechen, hört aber nie das Schweigen derer, die ihren Wertekodex nicht teilen.
Wie viele Menschen gibt es, die ein Leben ohne Musik für einen Irrtum halten? Mit Sicherheit nicht so viele, wie es sich Friedrich, Will und Billy wünschen. Ein Melody Maker-Schreiber konstatierte einmal, dass die Musik von Björk »so essenziell wie das Atmen« sei,14 doch biologische und historische Hinweise deuten eher darauf hin, dass zwar das Atmen unverzichtbar ist, aber Essen, Trinken und Schlafen keine Konkurrenz durch die Musik zu befürchten haben.
○ ○ ○
Ich habe keine Zweifel daran, dass Musik für einige von uns profunde oder gar transzendentale Erfahrungen liefert. Für mich tut sie es jedenfalls – und für dich vermutlich auch. Gleichzeitig wird Musik aber auch hemmungslos hochgejubelt. Tag für Tag überschüttet man sie mit Superlativen, die meist eigentümlich hohl klingen. Es sind Worte von Schreiber*innen, die selbst nicht zu fühlen scheinen, was ihre Worte versprechen. Sie hören eine Platte oder besuchen ein Konzert – und haben dabei vielleicht auch eine gute Zeit –, wollen uns nun aber weismachen, dass ihr Kopf explodiert sei und Millionen funkelnder Fragmente freigesetzt wurden, die auf Wogen ungezügelter Energie durch den Kosmos schießen. Oder sie beteuern, sich lieber den eigenen Arm abhacken zu lassen, als einen verhassten Song noch einmal hören zu müssen. Wirklich? Den eigenen Arm? Anders als in der Literatur oder den visuellen Künsten ist es anscheinend der Musik vorbehalten, die schlimmsten Marktschreier auf den Plan zu rufen.
Solltest du dich als Fan von Modelleisenbahnen, T.S. Eliot, Jogging oder Star Wars outen, würde niemand sich erdreisten, dich als hirntot zu bezeichnen. Sie hingegen erlauben sich diese Kommentare, weil du die Frechheit besitzt, nicht in das Loblied auf ihre Held*innen einzustimmen.
○ ○ ○
Dieses Buch soll nicht dazu beitragen, mit Hypes noch weitere Mülldeponien zu füllen. Werfen wir deshalb zunächst einmal einen nüchternen Blick auf den Status quo. Keine Frage: Musik hat ihren Platz in dieser Welt, doch für viele Leute ist dieser Platz recht überschaubar. Und ich rede hier nicht von den fünf Prozent (oder wie viele es auch sein mögen), die keine Gänsehaut bekommen, wenn man die Intensität ihrer Anhedonie zu messen versucht.
Nein, ich rede hier von stinknormalen Menschen, die keinen Wert darauf legen, im Restaurant mit Musik berieselt zu werden; von der jungen Frau, die zunehmend gereizter wird, wenn sich ihre Mitbewohnerin mit lauter Musik wecken lässt; von dem Typen, der mit gespielter Zustimmung nickt, wenn seine Kumpel von dem anstehenden Konzert schwärmen, auf das er liebend gerne verzichten könnte; von den Tourist*innen, die von einem exotischen Übersee-Trip heimkehren und sich an keine der dort gehörten Klänge erinnern; von dem Taxifahrer, der im Auto lieber Talkshows oder News hört; von den Wandervögeln, die den ganzen Tag durch die Wälder laufen und dabei keinen Wert auf musikalische Untermalung legen.
Ich rede auch von den armen Seelen, die sich in Online-Foren wie Mumsnet oder Quora zu Wort melden und dort vorsichtig durchblicken lassen, dass ihnen Musik nicht viel bedeutet – nur um augenblicklich von einem Chor musikliebender Lorenzos niedergeknüppelt zu werden.
○ ○ ○
Wenn mich meine lebenslange Beschäftigung mit diesem Thema eines gelehrt hat, ist es dies: Echte Liebe für Musik ist durchaus vergleichbar mit der Liebe zum Kochen, zum Gärtnern, für antike Möbel, Tiere, Poesie und so weiter. Einige Leute verspüren diese Art von Liebe, andere nicht.
Was aber nicht bedeutet, dass die Miesmacher zum Jubeln gezwungen werden sollten. Die akustische Übersättigung unserer Gesellschaft ist ein verhältnismäßig junges Phänomen und wird sich möglicherweise als ein Holzweg der menschlichen Evolution erweisen. Unsere Spezies hat Millionen von Jahren überlebt, ohne auf multinationale Entertainment-Konzerne wie YouTube oder Spotify angewiesen zu sein. In der Vergangenheit gab es weit weniger Musik als heute. Musik hatte ihren angestammten Platz in Ritualen und Zeremonien. Sie war ein sporadischer Leckerbissen oder eine etablierte Tradition, aber sie war immer eher ein seltenes Festmahl als eine regelmäßige Kost. Keine Frage: Einige Leute sangen auch bei der Arbeit, während andere mit den rhythmischen Geräuschen ihres Zimmermannhandwerks zufrieden waren. Einige gingen stumm den Weg zum Brunnen, während andere dem Klatschen der Füße lauschten oder dem Rhythmus des schwappenden Wassers. Ungestörte Stille war die Normalität.
Der Kapitalismus hat diese Landschaft grundlegend verändert. Was einmal als Luxus galt, ist heute eine Selbstverständlichkeit; was einmal ein mitmenschlicher Austausch war, ist heute eine hochgradig individualisierte Erfahrung; was früher eine existenzielle Dringlichkeit besaß, ist heute ein überflüssiges Add-on; was einst mit echter Hingabe erfahren wurde, ist heute eine Schwemme von Banalitäten, die durch alle nur erdenklichen Kanäle in unser Leben gepumpt werden. Wir werden mit vermeintlich künstlerischen Produkten derart zugemüllt, dass uns die unverdauten Früchte der Zivilisation bereits aus den Ohren raushängen. Es geht auch nicht mehr darum, sich auf die Suche nach kreativen Perlen zu begeben oder die guten Sachen zu bunkern. Kunst liegt in der Luft und ist so omnipräsent wie Sauerstoff. Wir werden geradezu genötigt, die kunsthaltige Luft so tief wie möglich einzuatmen.
○ ○ ○
Doch nur weil es eine Kunstschwemme gibt, heißt das noch lange nicht, dass alle sie lieben müssen.
Ein paar Leute lieben Musik, keine Frage.
Andere hören sie gerne, je nach Laune.
Wieder anderen ist sie gehüpft wie gesprungen.
Und eine letzte Gruppe könnte auf Musik gut und gerne komplett verzichten.
Und doch wollen alle als Mitglieder dieser Gesellschaft akzeptiert werden. Zu dumm, dass unsere Gesellschaft gerade beschlossen hat, das Desinteresse an Musik kollektiv zu ächten.
Was tun?
○ ○ ○
»Ich habe gerade diese erschreckende Statistik aus den USA gelesen«, sagte Peter Gabriel dem Rolling Stone 1987, kurz nachdem er mit seinem Album So einen Volltreffer gelandet hatte. »Ein Album wird dort durchschnittlich 1,2-mal gespielt. Man kauft ein Album aus einem spontanen Impuls – vielleicht, weil man damit seiner Freundin imponieren will. In jedem Fall gehört der Impuls zu dem emotionalen Arsenal, mit dem du dich der Welt präsentierst.«15
Für einen geborenen Künstler wie Gabriel muss diese Statistik in der Tat erschreckend gewesen sein. Und doch kommt sie der Realität vermutlich sehr nah. Die Mehrheit der Käufer*innen wird am rein ästhetischen Wert des Albums wenig Gefallen finden. Was ihnen aber am Herzen liegt, ist die Anerkennung durch ihr soziales Umfeld und alle anderen, die gerne beeindruckt werden wollen.
Praktisch jedes Produkt auf dem kapitalistischen Markt wird mit der gleichen Methode beworben: Man überzeugt potenzielle Käufer*innen davon, dass sich ihr Status in den Augen der Mitmenschen – und damit auch in den eigenen – substanziell verbessern wird. Ob es sich nun um Kleidung, Gadgets, Einrichtungsgegenstände, Bücher oder die Frisur handelt: Musik spielt in diesem Chor der Identitätsstifter eine entscheidende Rolle.
Im Fall von Peter Gabriel, der mit seinem damals neuen Album endlich den amerikanischen Markt knackte, bedeutete es, dass So von der damals relevanten Kulturelite zu dem Objekt gekürt wurde, das alle coolen Leute einfach besitzen mussten. Und prompt ging So millionenfach über den Ladentisch.
Nehmen wir an, ich würde diesen Millionen heute das Album noch einmal vorspielen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Mehrzahl von ihnen die ersten 30 Sekunden von »Red Rain«, dem Opener des Albums, nicht erkennen würde. Sie hätten keine Ahnung, von welchem Album der Track stammt, ja würden sich sogar fragen, ob sie ihn jemals gehört haben. Mit Sicherheit würden sie Sledgehammer wiedererkennen, weil die Nummer für die radio rotation programmiert war und noch heute von Classic-Rock-Stationen gespielt wird. Selbst wenn sie ihr eigenes Exemplar seit Jahren nicht mehr auflegen (was höchstwahrscheinlich der Fall ist), werden sie die Nummer gelegentlich noch irgendwo hören – im Supermarkt, im Auto oder auf der Toilette des Restaurants.
○ ○ ○
Es gibt eine spezifische Art von CDs, die dir in Secondhand-Läden geradezu nachgeschmissen werden. Sie kosten fast nichts, weil sie von deiner gesamten Nachbarschaft aussortiert wurden. Die Auswahl verändert sich mit dem Alter der Bevölkerung, doch zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Buchs würde ich in jedem Fall auf folgende Namen tippen, wenn du in Großbritannien lebst: The Streets, Moby, Westlife, David Gray, Madonna, Robbie Williams, Ocean Colour Scene, Duffy, Paul Weller, Blur und Oasis.
Durchaus möglich, dass die früheren Besitzer diese Alben einmal glühend liebten. Wahrscheinlicher aber ist, dass sie das Album nur deswegen kauften, weil es die anderen Mitglieder ihrer Peergroup für unverzichtbar hielten. Aber wenn niemand mehr über Original Pirate Material von The Streets spricht – und du es nur 1,2-mal gehört hast –, gibt es eigentlich keinen Grund, sich nicht von dem Album zu trennen.
○ ○ ○
Im Unterschied dazu gibt es Alben, die selten entsorgt werden, weil ihr sozialer Status nie infrage gestellt wird. Miles Davis’ Kind Of Blue beispielsweise ist das bestverkaufte Jazz-Album aller Zeiten. Noch immer werden wöchentlich Tausende Exemplare davon verkauft – und nur selten findet eins den Weg zum Trödler.
Natürlich wäre es wunderbar, wenn jede Woche Tausende von Hörer*innen Jimmy Cobbs meisterlich reduzierte Arbeit an den Cymbals entdecken würden – oder sie Davis’ Begeisterung nachvollziehen könnten, als ihm der Schritt zur modalen Musik völlig neue improvisatorische Möglichkeiten eröffnete. Doch die Realität sieht erwartungsgemäß anders aus: Viele Konsumenten beugen sich der Erwartungshaltung, zumindest ein Jazz-Album besitzen zu müssen – und Kind of Blue macht in dieser Kategorie noch immer das Rennen.
Sozialer Dünkel hat hier seine Hand im Spiel. Eine Person aus der Unterschicht kann sich noch ungeniert dazu bekennen, auf Jazz liebend gerne zu verzichten; jemand aus der unteren Mittelschicht kauft sich vielleicht eine Billig-Compilation namens The Best Jazz Album Ever, während Angehörige der Mittelklasse ebenfalls mit der Compilation leben könnten, gleichzeitig aber auch wissen, dass echte Musikliebhaber*innen propere Alben wie Kind Of Blue besitzen. Ein Mitglied der gehobenen Mittelklasse zeigt seinen Dinner-Gästen gerne die expanded Doppel-CDKind Of Blue (50th Anniversary Collector’s Edition), während der arrivierte Mann von Welt strahlend gesteht, dass ihm Jazz überhaupt nichts bedeutet.
○ ○ ○
In dem halben Jahrhundert, in dem ich selbst auf der Jagd nach Musik war, habe ich das Allerheiligste vieler Sammler*innen besucht. Ich bin einer dieser Schnüffler, die sich gleich vors Regal hocken und deine Bestände inspizieren. Die überwiegende Mehrheit der Sammlungen war bescheiden – jedenfalls nicht groß genug, um die Baby-Fotos und anderen Schnickschnack von den Regalen zu verbannen. Ein bisschen Staub war die Regel – und auch die LP-Rücken verrieten, dass sie seit Jahren vom immergleichen Sonneneinfall gebleicht wurden.
Die Anzahl der LPs (und/oder CDs) war gewöhnlich weniger als einhundert, wobei »die üblichen Verdächtigen« meist zu einer Zeit gekauft wurden, als sie noch weit jünger waren. Verheiratete Paare hatten oft Duplikate von den Dire Straits, Badly Drawn Boy oder Nina Simone, die allgegenwärtig waren, bevor sich das Paar kennenlernte. Wenn es einmal ein obskures oder exotisches Fundstück gab, war es oft ein Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk, das man von einem Dritten erhalten hatte.
Im Jahr 2005 – zwei Jahre vor dem iPhone und drastisch fallenden CD-Umsätzen – veröffentlichte die englische Barclays Insurance eine Umfrage, mit der man Kund*innen zu einer Versicherung ihrer Audio-Sammlungen animieren wollte. Angeblich seien Umfang und Wert dieser Sammlungen nämlich »sprunghaft gestiegen«. Was konkret bedeutete, dass Männer nun durchschnittlich 178 Alben besaßen, während es Frauen auf immerhin 135 schafften.16
Ihr einst überschaubares Hobby war inzwischen nicht nur zu groß für die Art-déco-CD-Spiralen aus Edelstahl geworden, die »bis zu 40 Alben« aufnahmen, sondern stieß bereits an die Grenzen des IKEA-Billy-Regals. Keine Frage: Es wurde inzwischen ernsthaft gesammelt.
Ein paar Jahre später war die nun nicht mehr so wertvolle Sammlung verstaubter denn je. Die gesammelten Musikschätze wanderten platzsparend aufs Smartphone, wo sie nicht mehr sortiert, entstaubt und womöglich gehört werden mussten.
○ ○ ○
Es ist nicht meine Absicht, mit diesem Buch eine künstliche Polemik zu konstruieren. Ich registriere nur, was mir in meiner Umwelt auffällt. Die meisten Leute beschäftigen sich mit kulturellen Phänomenen, von denen ihre Peergroup spricht – und sie tun es, weil sie von ihrer Sippe nicht isoliert werden möchten. Das eigentliche Objekt – die TV-Show, das Gadget, die Nagelpolitur, das Fitness-Spielzeug, die CD, der Download – bedeutet ihnen herzlich wenig. Sobald die Karawane weiterzieht, wird es vergessen oder entsorgt.
Eine Statistik, die 2014 zum »Welttag des Buchs« veröffentlicht wurde, kam zu dem Resultat, dass ein britischer Haushalt 138 Bücher beherbergt, von denen mehr als die Hälfte nie gelesen wurden.17 Eine andere Umfrage besagte, dass sich 15 Prozent der gekauften DVDs noch immer in ihrem jungfräulichen Cellophan befanden.18 Bereits 2011 erfuhren wir, dass mehr als drei Viertel aller iTunes-Tracks, die in individuelle Bibliotheken heruntergeladen wurden, nie abgespielt wurden.19
Vinyl-LPs waren in den Neunzigern fast völlig von der Landkarte verschwunden, erlebten dann aber unter Millennials einen überschaubaren Boom, der voreilig als Renaissance des Vinyls gefeiert wurde. Die Research-Experten*innen von ICM Unlimited fanden allerdings erst unlängst heraus, dass 48 Prozent aller Käufer*innen, die einen Monat zuvor eine Vinyl-LP gekauft hatten, nämliches Album noch nicht gehört hatten. Sieben Prozent gestanden, nicht einmal einen Plattenspieler zu besitzen. »Ich habe Vinyl-Platten zu Hause«, sagte ein Student in Manchester der BBC, »aber ich nutze sie eigentlich mehr als Wandschmuck. Es ist der Old-School-Vibe, den ich an den Platten so schätze.«20
Zwei separate Research-Teams – eins von der Guildhall School of Music und der Simon Fraser University, das andere von der Keele University und der University of Leeds – kamen im Prinzip zu der gleichen Erkenntnis, als sie – im Abstand von zehn Jahren – die Hörgewohnheiten der Bevölkerung untersuchten. Das engagierte Hören, bei dem man sich ausschließlich auf die Musik konzentriert – im Gegensatz zur Background-Berieselung bei anderen Aktivitäten –, ließ sich nur in zwei Prozent aller Fälle feststellen.21 Und dabei sind Pseudohörer*innen – also die Leute, die sie primär als Statussymbol kaufen – nicht einmal mitgezählt.
Man kann diese Zwei-Prozent-Statistik aber auch noch anders lesen: 98 Prozent aller Leute, die dir erzählen, sie hätten Musik gehört, haben sich tatsächlich mit etwas anderem beschäftigt.
Das trifft vor allem auf die Millennials zu, die Musik oft genug als Teil eines atmosphärischen Grundrauschens wahrnehmen, das von der Umgebung willkürlich freigesetzt wird. Die British Phonographic Industry (BPI) gab eine Untersuchung in Auftrag, mit der sie das Kaufverhalten ihrer wichtigsten Zielgruppe analysieren wollte, und stellte dabei fest, dass »Musik für junge Leute zunehmend eine Sturzflut von ständig aktualisiertem und letztlich austauschbarem Content ist, der die Feeds ihrer Social Media füllt«.22
○ ○ ○
Spätere Kapitel in diesem Buch werden sich mit den vielfältigen Funktionen beschäftigen, die Musik in unserer gegenwärtigen Gesellschaft zu erfüllen hat. Einige der modernen Applikationen scheinen dem künstlerischen Wert von Klängen durchaus Respekt zu zollen (ob ernsthaft oder nur fingiert, steht auf einem anderen Blatt), andere weniger.
Wenn dir die Warteschleife einer Behörde oder Klinik einen Loop von VivaldisVier Jahreszeiten vorspielt, wissen beide Parteien, dass niemand diese Musik wirklich registriert. Ihre einzige Funktion besteht darin, dich wissen zu lassen, dass du auf deinen Gesprächspartner noch warten musst.
Ähnliches gilt für den Fall, dass ein muskelbepackter, Lycra tragender Fitness-Enthusiast das Angebot von Samsung annimmt und seine Spotify-Playlists direkt auf die neue Galaxy Active2-Watch streamen lässt. Beide Parteien wissen, dass Musik nicht im Zentrum des Deals steht. Die gleichen Spotify-Tracks, die andere Leute möglicherweise als Kunst bezeichnen, dienen hier nur dazu, die Bauch- und Deltamuskeln zu stählen. »Ich hab massig AC/DC gehört«, wird ein Bodybuilder vielleicht zu seinen musik- und muskelliebenden Freund*innen sagen. »Absolut cool.«
Man wird dieses Verhalten kaum als anrüchig oder unmoralisch bezeichnen können. Schon in der Vergangenheit erfüllte Musik einen konkreten Zweck. Die Gottheiten mussten beschwichtigt werden, Krankheiten wollten geheilt werden, Botschaften mussten ans andere Flussufer getrommelt werden, Babys mussten in den Schlaf gesungen werden, Armeen mussten marschieren. Wenn eine Person aus prähistorischen Zeiten in unsere Gegenwart gebeamt würde, um sich mit unserem Musikangebot vertraut zu machen, hätte sie wohl keine Probleme, den praktischen Wert von CDs oder Streams wie Jogging with Mozart, Erotic Chill, The Ultimate R&B Fitness Album oder That’s What I Call Running zu verstehen – zielorientierter Stoff, den Kritikerinnen und Connaisseurs natürlich nicht einmal mit spitzen Fingern anfassen würden. Unsere zeitreisende Person hätte hingegen vermutlich weitaus größere Schwierigkeiten, die Komplexität von Radiohead, John Coltrane oder Max Richter zu verstehen. Was zum Teufel soll ein Mensch mit diesem Lärm anfangen?
○ ○ ○
Für Leute, die zu Musik keinen Draht haben, gibt es eine Möglichkeit, dieses Manko vor der Welt – und sich selbst – zu verstecken. Die Menschheit wird auch ohne Klarinetten und Clavinets überleben, kann aber auf einen verbalen Austausch nicht verzichten. Die Menschen lieben den Klatsch – egal, ob man nun Fremde niedermacht oder vehement Gesinnungsgenossen verteidigt, die man persönlich nicht einmal kennt, ob man die Beziehungsprobleme und moralischen Defizite der Nachbar*innen diskutiert oder die neuesten Kosmetik- und Körperpflegetipps.
Anders gesagt: Es ist problemlos möglich, »mit dem Ohr am Ball zu bleiben« und dezidierte scharfsinnige Meinungen über Musik zu vertreten, ohne sich mit der Materie intensiv beschäftigen zu müssen.
Courtney Love: War sie nun Cobains beste Freundin oder ein Vampir, der seinen Tod auf dem Gewissen hat? Cardi B sollte nicht über ihre feuchte Muschi singen, weil sich das einfach nicht gehört. Kann sich Dave Mustaine nicht endlich damit abfinden, von Metallica gefeuert worden zu sein? Das liegt vierzig Jahre zurück, Alter. Warum ist Lars noch immer ein rotes Tuch für dich? Adele war für ihre Fans ein besseres Vorbild, als sie noch ein paar Pfunde mehr auf den Rippen hatte. Gibt es wirklich jemanden auf diesem Planeten, der Yoko Ono mag? Ernsthaft? Können frühe Alben von Can, Tangerine Dream oder Amon Düül II Krautrock sein, obwohl der Terminus erst Jahre später geprägt wurde? Wagner war der Proto-Nazi, oder etwa nicht? Dann sollten wir erst einmal darüber diskutieren, was Proto-Nazi eigentlich bedeutet. Sting ist der Pharisäer par excellence! Fliegt im Privatjet zum Amazonas, um dort die Umweltsünden der Zivilisation anzuprangern. Und dann dieser Schmu mit dem tantrischen Sex. Was für ein Arschgesicht. Die postume Glorifizierung von Jacqueline du Pré ist völlig fehl am Platz; sie war eine widerliche Person. Paul Simon: unterbewertetes Genie oder arroganter Ausbeuter afrikanischer Traditionen? Neue Beweise von den ungehaltenen Los Lobos! Beyoncé eine Feministin? Dass ich nicht lache. War Axl Rose völlig von Sinnen, als er diese lächerliche Zöpfchen-Bandana-Kombi aus dem Zylinder zog? Lady Gaga hätte nie sagen sollen, was sie gesagt hat! Wurde Michael Jacksons Doktor ermordet? Nichts gegen Jazz im Radio, aber der neue Sendeplatz ist völlig daneben. Im Vergleich zu Jerry Lee Lewis sind die ganzen Punks und Bad-Boy-Rapper die reinsten Milchbubis. Janis Joplin war heimlich eine Lesbe – was nachträglich vieles erklärt. Roger Waters sollte endlich mal aufhören, die Trommel für Palästina zu rühren. Keith Richards mimt den bösen Buben besser als jeder andere. Und hier ist meine beste Keef-Anekdote …
Unabhängig davon, welche Sounds gerade angesagt sind oder nicht: Der Nachschub für den Smalltalk wird nie versiegen.
○ ○ ○
Wann immer ich jemanden frage, wann er zum letzten Mal den Song oder den Künstler gehört habe, über den er sich gerade leidenschaftlich geäußert hatte, ist die kleinlaute Antwort: Ist schon ’ne Weile her. Eine lange Weile. Oder um ganz ehrlich zu sein: eine sehr, sehr lange Weile. Wir wollten über Musik reden, doch worüber wir tatsächlich sprechen, ist nicht Musik, ist nicht mal das Gefühl, das wir mit dieser Musik einmal verbanden, sondern nur noch eine vage Erinnerung an das Gefühl.
Vor langer, langer Zeit hörten die Gelegenheits-Fans eine Musik, die sie glücklich machte – oder vielleicht lag die Musik auch nur in der Luft, als sie aus anderen Gründen glücklich waren. Vielleicht war es ein Tag, an dem sie unter allen Umständen glücklich sein wollten – und sie erinnern sich an dieses Gefühl noch immer, ohne deshalb gezwungen zu sein, sich durch Kisten alter LPs oder CDs zu wühlen (die obendrein irgendwo auf dem Speicher stehen).
Vielleicht gehören sie auch zu den Menschen, die einmal im Jahr ein Festival oder eine namhafte Konzertreihe besuchen. Dass sie im letzten Jahr nicht mehr hingingen, lag an der Badrenovierung, die sich nicht länger aufschieben ließ, im Jahr davor natürlich an Covid und davor an der Ferienvertretung, die sie nicht ablehnen konnten, ohne ihren Job zu gefährden. Um ehrlich zu sein, waren sie schon seit geraumer Zeit nicht mehr unterwegs. Die Gruppe, mit der sie immer loszogen, ist inzwischen schon etwas älter. Die Staus bei Ab- und Abreise waren eigentlich jedes Jahr katastrophal. Und obendrein: Das Line-up war nie wieder so gut wie 2009 oder 1998 oder 1976.
Ich will damit nicht behaupten, dass ich die Leute beim Lügen ertappe. Ich beobachte nur, dass das Leben irgendwie weitergeht. Die Tage und Jahre fliegen vorbei, die Leute haben mit ihren täglichen Sorgen schon genug an der Backe – und kaum hat man sich’s versehen, spielt die Musik nicht mehr die gleiche Rolle, wie’s früher der Fall war.
○ ○ ○
Du befindest dich noch immer am Anfang unserer gemeinsamen Reise. Du bist dir vielleicht unsicher, wohin die Reise gehen wird – und ob die Reise überhaupt nach deinem Geschmack ist. Es ist eine Frage, die ich beim besten Willen nicht beantworten kann. Ich kenne dich nicht.
Nur so viel: Ich werde nicht die Härchen auf deinem Arm zählen, um darin deine Reaktion auf meine Lieblingsmusik abzulesen. Dies ist keine Prüfung. Ich liebe Musik, empfinde diese Liebe aber nicht als verpflichtend. Sie ist nicht der Gradmesser, um deine Qualitäten als menschliches Wesen zu testen. Die Tatsache, dass du das Buch immer noch liest, scheint indes ein Indiz zu sein, dass dich das Thema irgendwie interessiert. Mehr kann ich nicht verlangen.
○ ○ ○
Vor tausend Jahren hatten unsere Vorfahren noch die Wahl, sich für ein Leben mit oder ohne Musik zu entscheiden. Wer auf Musik verzichtete, wurde deswegen nicht gleich in den Kerker geworfen. Inzwischen wirst du zu einer Beziehung mit Musik gezwungen. Es ist fast schon so etwas wie eine arrangierte Ehe: Niemand hat dich gefragt, ob du den Schritt machen wolltest oder nicht. Seit deiner Geburt hast du zu bestimmten Arten von Musik eine positive Beziehung aufgebaut, während du zu anderen eine Aversion entwickelt hast. Die gesellschaftlichen Kräfte, die deine Vorlieben und Abneigungen formen, haben ganze Arbeit geleistet. Wann immer du heute Musik hörst, erinnerst du dich an die Musik, die dich einst wohlig umarmt oder instinktiv genervt hat.
Gibt es ein Du, das unabhängig von diesen externen Einflüssen existiert? Gibt es Vorlieben und Abneigungen, die allein dir gehören? Und wenn nicht: Könntest du einen Schritt in deiner Entwicklung zurückgehen und dein wahres, unabhängiges Ich finden?
Machen wir einen Versuch, das Rätsel zu lösen.