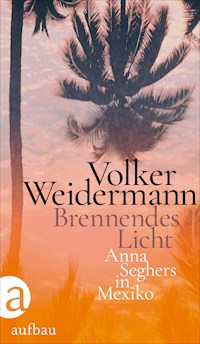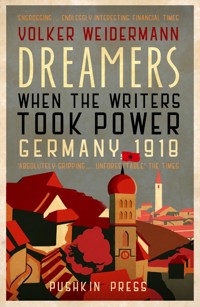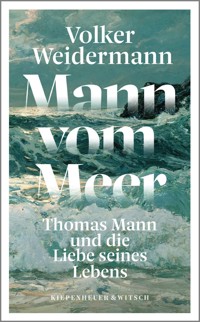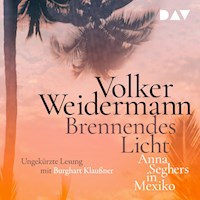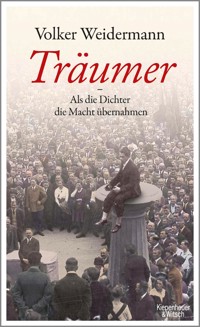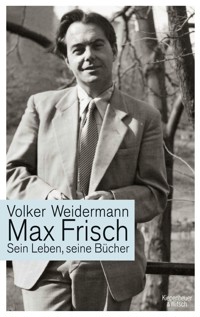9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933: Wie es dazu kam, welche Bücher verbrannt wurden und was mit den Autoren geschahNach dem überwältigenden Erfolg von Lichtjahre, seiner kurzen Geschichte der deutschen Literatur nach 1945, wendet Volker Weidermann den Blick zurück auf den Tag, an dem in Deutschland die Bücher brannten. Seine Mission: diese Bücher, diese Autoren dem Vergessen entreißen! Es wurde angekündigt als »Aktion wider den undeutschen Geist«: Die akribische landesweite Vorbereitung gipfelte am 10. Mai 1933 in der Errichtung von Scheiterhaufen in vielen deutschen Städten, auf die dann Studenten, Bibliothekare, Professoren und SA-Leute in einer gespenstischen Feierstunde die Bücher warfen, die nicht mit ihrer menschenverachtenden Ideologie vereinbar waren. Unvergessen die Tonbandmitschnitte, die dokumentieren, wie Joseph Goebbels auf dem Platz neben der Berliner Staatsoper mit den Worten »Und wir übergeben den Flammen die Werke von …« die einzelnen Autoren aufrief, von denen einige sogar anwesend waren. Volker Weidermann erzählt, wie dieser Tag verlief, an dem es trotzig regnete, er erzählt von dem Bibliothekar Herrmann, der die Urliste aller Listen erstellte, nach denen dann die Scheiterhaufen bedient wurden, und er erzählt von den Werken und ihren Autoren – und davon, wie willfährige Buchhändler und Bibliothekare die Bücher aus ihren Regalen entfernten, so gründlich, dass viele Werke und Autoren danach nicht wieder zum Vorschein kamen. Das Ergebnis sind über 100 Lebens- und Werkgeschichten von Schriftstellern, darunter neben Klassikern wie Kästner, Tucholsky, Zweig, Brecht und Remarque auch völlig vergessene wie Rudolf Braune, ausländische Autoren wie Ernest Hemingway, und sehr viele, wie z.B. Hermann Essig, die unbedingt wiedergelesen werden sollten. Ein Buch über Bücher, Schicksale und ein Land, in dem zuerst Bücher verbrannt wurden und dann Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Volker Weidermann
Das Buch der verbrannten Bücher
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Volker Weidermann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Volker Weidermann
Volker Weidermann bei Kiepenheuer & Witsch: http://bit.ly/1AOOpaq
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Es wurde angekündigt als »Aktion wider den undeutschen Geist«: Die akribische landesweite Vorbereitung gipfelte am 10. Mai 1933 in der Errichtung von Scheiterhaufen in vielen deutschen Städten, auf die dann Studenten, Bibliothekare, Professoren und SA-Leute in einer gespenstischen Feierstunde die Bücher warfen, die nicht mit ihrer menschenverachtenden Ideologie vereinbar waren. Unvergessen die Tonbandmitschnitte, die dokumentieren, wie Joseph Goebbels auf dem Platz neben der Berliner Staatsoper mit den Worten »Und wir übergeben den Flammen die Werke von …« die einzelnen Autoren aufrief, von denen einige sogar anwesend waren.
Volker Weidermann erzählt, wie dieser Tag verlief, an dem es trotzig regnete, er erzählt von dem Bibliothekar Herrmann, der die Urliste aller Listen erstellte, nach denen dann die Scheiterhaufen bedient wurden, und er erzählt von den Werken und ihren Autoren – und davon, wie willfährige Buchhändler und Bibliothekare die Bücher aus ihren Regalen entfernten, so gründlich, dass viele Werke und Autoren danach nicht wieder zum Vorschein kamen.
Nach dem überwältigenden Erfolg von Lichtjahre, seiner kurzen Geschichte der deutschen Literatur nach 1945, wendet Volker Weidermann den Blick zurück auf den Tag, an dem in Deutschland die Bücher brannten. Seine Mission: diese Bücher, diese Autoren dem Vergessen entreißen!
Das Ergebnis sind über 100 Lebens- und Werkgeschichten von Schriftstellern, darunter neben Klassikern wie Kästner, Tucholsky, Zweig, Brecht und Remarque auch völlig vergessene wie Rudolf Braune, ausländische Autoren wie Ernest Hemingway, und sehr viele, wie z.B. Hermann Essig, die unbedingt wiedergelesen werden sollten. Ein Buch über Bücher, Schicksale und ein Land, in dem zuerst Bücher verbrannt wurden und dann Menschen.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2008, 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
ISBN978-3-462-30963-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1 - Die fantastischen 3
2 - Einsame Kämpfer
3 - Fünf Männer im Krieg – und eine Frau
4 - Emigration kennt keine Kompromisse
5 - Vor dem Yoghi kommt der Tod
6 - Das Café Central auf der Flucht
7 - Wirklichkeit von sensationellem Rang
8 - Maikäfer in der Tinte
9 - Weltabschied
10 - Heran alle, die Glauben haben!
11 - Dies da wird ein heißes Buch!
12 - Eure vergessenen Bücher
13 - Mit Kafka nackt im Gras
14 - Du brauchst weiß Gott kein Kommunist zu sein!
15 - Es war ein bisschen laut
16 - Alles Gold zerrann zu Freibier
17 - Wir haben unsere Pflicht versäumt
18 - Wo ist Ihre Pfeife, Herr Stalin?
19 - Gottfried Benn und andere Drogen
20 - Sterben oder angreifen
21 - Brennende Schmetterlinge
22 - Fliegen mit Bilsenkraut
23 - Die Hölle regiert!
Nachwort
Die Autoren und ihre Werke
Textnachweise
Dank
Vorwort
Was sind das alles für Leute? Was sind das für sonderbare, nie gehörte Namen? Hans Sochaczewer, Otto Linck, Hermann Essig, Maria Leitner, Alfred Schirokauer, Ernst Johannsen, Albert Hotopp, Rudolf Geist, Alex Wedding und viele, viele mehr? Sie alle sind heute vergessen. Sie alle haben Bücher geschrieben, die den nationalsozialistischen Machthabern und ihren Helfershelfern in Deutschland vor fünfundsiebzig Jahren so gefährlich erschienen, dass man sie öffentlich verbrannte. Dass man ihre Werke aus den Büchereien verbannte, aus den Buchhandlungen und den Antiquariaten. Ihre Namen sollten ausgelöscht werden aus den Geschichtsbüchern, ausgelöscht aus dem Gedächtnis des Landes, ihre Bücher sollten spurlos verschwinden – für immer.
Es ist beinahe gelungen. Lange hat es gedauert, bis sich Deutschland nach dem Krieg an seine emigrierten, seine verbrannten Autoren erinnerte. Der Reporter Jürgen Serke hat 1976 einige der Überlebenden besucht und in seinem Buch Die verbrannten Dichter (1977) porträtiert. Es war ein großer Erfolg damals und auch so etwas wie ein Schock für ein Land, das fünfundvierzig Jahre nach der Bücherverbrennung erkennen musste, dass die mörderische Strategie der Nazis bis weit in die Nachkriegszeit hinein wirkte. Dass einige jener »verbrannten Dichter« noch lebten, im Verborgenen lebten, in einem Schattenreich des Vergessens, ohne dass sich irgendjemand für sie und ihre Bücher interessierte. Serkes Buch hat einigen, wie etwa der Schriftstellerin Irmgard Keun, sonderbar umjubelte letzte Lebensjahre beschert und die Werke einiger Autoren den Menschen und Lesern wieder in Erinnerung gerufen. Doch die meisten blieben im Schatten. Und Serke hatte nur einen kleinen Ausschnitt gewählt.
Das vorliegende Buch beschreibt keinen Ausschnitt. Ich habe die Spuren ausnahmslos aller Autoren verfolgt, die damals auf der ersten schwarzen Liste der »Schönen Literatur« standen, die als Grundlage für die Verbrennung diente. Vierundneunzig deutschsprachige Autoren stehen darauf und siebenunddreißig fremdsprachige. Nicht jedes Leben konnte zweifelsfrei von der Geburt bis zum Tode rekonstruiert, nicht jedes Werk gefunden werden. Doch es sind nur wenige Lücken, die bleiben, wenige letzte Zweifel über die Identität von Autoren, die ganz und gar aus den Annalen verschwunden sind. Und immer wieder enden Biographien in diesem Buch mit »spurlos verschwunden« oder »der genaue Todestag ist unbekannt«. Es sind die Jahre, in denen Menschen einfach verlorengehen. Ohne Hinweise, ohne letzte Spur. Der Schwerpunkt dieses Buches liegt auf den deutschen Autoren. Für sie war die Verbrennung ihrer Werke existenzbedrohend. Für sie ging es um alles. Die meisten von ihnen verloren ihr Publikum, verloren ihre Heimat und oft genug ihr Leben.
Ich habe bei der Recherche für dieses Buch oft und immer wieder atemlos gelesen. Gelesen in den Lebensgeschichten der Autoren, gelesen in ihren Büchern. Viele dieser Werke sind tatsächlich aus den Bibliotheken verschwunden, und ohne die Such- und Bestellmöglichkeiten im Internet und das wunderbare Riesenreich des Antiquariats Tode in der Berliner Dudenstraße hätte ich dieses Buch in der vorliegenden Form nicht schreiben können. Eine Weile lang klingelte fast täglich am Vormittag der Postbote an meiner Tür, um mir wieder ein besonders vergessenes, seltenes Buch ins Haus zu liefern, das in keiner Bibliothek zu finden war. Und jedes dieser Bücher ist ein Helden-Exemplar, ist ein kleiner Triumph und Beleg eines Widerstandes. Ein Buch, das geblieben ist, obwohl es verschwinden sollte.
Und ich las und las und las. Es gab unendlich viel zu entdecken für mich, eine Vielzahl von Autoren, deren Namen ich noch nie gehört hatte und deren Bücher ich jetzt mit Interesse und oft auch mit Begeisterung las. Natürlich sind einige uninteressante Bücher darunter gewesen. Auch schlecht geschriebene, kitschige, gut gemeinte, schlecht gemachte. Klar – nicht jedes verbrannte Buch war ein Meisterwerk. Und einige der Autoren wären heute sicher auch ohne das Autodafé von 1933 so gut wie vergessen. Aber auch diese Geschichten, auch ihre Lebensgeschichten und Bücher haben mich interessiert. »Ich schätze alle Schriftsteller, die vom III. Reich verbrannt worden sind«, hat Joseph Roth, selbst einer der verbrannten Autoren, 1935 geschrieben, »selbst jene, die mir vorher fremd waren. Denn das Feuer hat sie geläutert, veredelt und mir nahegebracht.«
Das ist das Ziel dieses Buches. Die Vergessenen dem Vergessen zu entreißen, ihr Leben und ihre Bücher Ihnen, den Lesern von heute, wieder nahezubringen. Den Sieg der Bücherverbrenner in eine Niederlage zu verwandeln, die Bücher von damals in einem neuen Licht leuchten zu lassen und die dramatischen Geschichten zahlreicher Schriftstellerleben neu zu schreiben, Leben in der Entscheidung, Leben auf der Flucht, Leben, durch die jene Nacht im Mai wie ein Riss hindurchging. Ein Riss, der niemals ganz zu heilen war.
Mein Buch unternimmt keine literaturwissenschaftlichen Werkanalysen, sondern vermittelt Leseeindrücke, versucht die verbrannten Werke so plastisch wie möglich vor Ihren Augen entstehen zu lassen. Und es erzählt Lebensgeschichten, die allesamt dramatisch waren. Die Kapitel zu den kanonisierten Autoren wie Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger oder Heinrich Mann sind oft kürzer als die Abschnitte über die eher unbekannten Autoren – das liegt daran, dass vieles schon bekannt ist und es hier um Neues geht. Anhand der Seitenzahlen ist nicht die Wertschätzung oder Bedeutung der einzelnen Autoren ablesbar, sondern nur die Menge an neuen, mir interessant erscheinenden Details aus ihrem Leben und Schreiben.
Mir selbst hat die Arbeit an diesem Buch einen neuen Blick auf eine scheinbar abgeschlossene Epoche des Lebens und Schreibens in diesem Land ermöglicht. Ich hoffe, etwas davon findet sich auf den folgenden Seiten.
Einleitung
Ein Abend im Mai – und wie es dazu kam
Da steht eine dicke Frau mit gerötetem Gesicht am Rande der Flammen, blickt einer halb verbrannten Buchseite nach, die der Wind in die Luft gehoben hat, drückt die Hand ihres Mannes im braunen Hemd ganz fest und ruft immer wieder »Schöne Zeit! Schöne Zeit!« in die Menge hinein. Sie steht gleich neben dem Reporter der Prawda, der seinen Bericht am nächsten Tag nach Moskau schicken wird. Es ist der 10. Mai 1933, kurz nach Mitternacht. Auf dem Berliner Opernplatz tobt ein Spektakel. Man sieht den Feuerschein schon von weitem. Zehn, zwölf Meter hoch schlagen die Flammen, die Organisatoren haben eine pyrotechnische Firma mit den Vorbereitungen beauftragt. Acht große Stapel wurden aus meterlangen Holzscheiten errichtet, vorher hat man Sand ausgestreut, damit das Pflaster keinen Schaden nimmt. Um 21.30 Uhr beginnt es zu regnen, was unter den Zeremonienmeistern des Feuers zu leichter Panik führt. Immer wieder müssen sie die Holzscheite mühsam trocken reiben, die das Feuer am Brennen halten sollen, solange die Gegenstände, die heute vor allem verbrannt werden sollen, noch nicht zur Verfügung stehen. Trotz des Regens sind viele tausend Menschen gekommen. Die Zeitungen haben in den Tagen zuvor immer wieder auf das Ereignis hingewiesen. Man wusste nicht genau, was das werden würde. Aber die Möglichkeit bestand, dass es so ein erhebendes Großereignis werden könnte wie zehn Tage zuvor, am Tag der Arbeit, als Hitler auf dem Tempelhofer Feld vor einer Million Zuhörer mit spektakulären Lichtarrangements den neuen Zusammenhalt des deutschen Volkes beschworen hatte und selbst der französische Botschafter danach ergriffen berichtete: »Alles atmet gute, frohe Stimmung, allgemeine Freude. Nichts erinnert an Zwang.«
Das neue Regime ist gerade einmal drei Monate an der Macht. Es nutzt alle Mittel des Staates, um seine Macht zu festigen – und die Parteiorganisationen sowie die Einschüchterungstaktiken der SA und SS. Die Deutschen stürmen geradezu in die NSDAP, über anderthalb Millionen Neuzugänge hat die Partei in den letzten drei Monaten zu verzeichnen, die treuen 850000 Altmitglieder waren in Windeseile in die Minderheit geraten, man fürchtete eine rasante Verbürgerlichung der Partei, sodass am 1. Mai 1933 ein vorläufiger Aufnahmestopp verhängt wird.
Aber es hat auch Misserfolge gegeben. Der erste Judenboykott vom 1. April war gescheitert. Der Umsatz der jüdischen Geschäfte ging kaum zurück, die Bevölkerung verhielt sich passiv, und man beschloss, solche Aktionen vorerst nicht zu wiederholen und die Juden eher unauffällig, durch bürokratische Maßnahmen, aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen. Ansonsten setzte man auf positive Gemeinschaftserlebnisse, Reden, Lichter, Fackelzüge.
Es scheint deshalb plausibel und ist in der Forschung inzwischen fast einhellige Meinung, dass die Bücherverbrennung, die am 10. Mai nicht nur in Berlin, sondern in beinahe jeder deutschen Universitätsstadt stattfand, nicht auf die Initiative des Propagandaministers Joseph Goebbels oder gar Adolf Hitlers oder eines anderen Regierungsmitglieds zurückging. Die Idee stammte von der organisierten »Deutschen Studentenschaft« (DSt) und wurde mit großem Aufwand und Elan ausgeführt. In den Universitäten herrschte schon während der Jahre der Weimarer Republik ein ausgesprochen reaktionärer, chauvinistischer, nationalistischer Geist. Und seit dem Sommer 1931 wurde die Deutsche Studentenschaft ganz offiziell und nach demokratischer Wahl von einem Vertreter des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes (NSDSTB) geführt. Es bedurfte nach dem 30. Januar 1933 nicht viel, um die »studentische Selbstgleichschaltung« zu vollenden. Und als die deutsche Regierung im März die Errichtung eines »Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda« beschloss, dauerte es nur wenige Tage, bis auch die Studenten sich ein eigenes »Hauptamt für Presse und Propaganda der Deutschen Studentenschaft« genehmigten. Und gleich in seinem »Rundschreiben No. 1« vom 6. April 1933 kündet der Leiter des Amtes, nachdem er unter Punkt 1 die Gründung des Amtes bekanntgegeben hat, unter Punkt 2 Folgendes an: »Die erste Maßnahme des Propagandaamtes, die die gesamte Studentenschaft und die gesamte deutsche Öffentlichkeit erfassen soll, findet als vierwöchige Gesamtaktion, beginnend am 12. April, endigend am 10. Mai 1933, statt. Näheres über den Inhalt wird noch bekanntgegeben.«
Zwei Tage später wird man in einem zweiten Rundschreiben konkret. Die erste Maßnahme des neuen Amtes wird sein: »Öffentliche Verbrennung jüdischen zersetzenden Schrifttums durch die Studentenschaften der Hochschulen aus Anlaß der schamlosen Hetze des Weltjudentums gegen Deutschland.« In dem Schreiben werden die Studenten erstens dazu aufgefordert, die eigenen Buchbestände »von derartigen durch eigene Gedankenlosigkeit oder Nichtwissen hineingelangten Schriften« zu »säubern«. Zweitens habe jeder Student die Regale seiner Bekannten zu säubern. Drittens sollen die Studentenschaften dafür sorgen, dass öffentliche Büchereien »von derartigem Material befreit« werden. Viertens habe jeder innerhalb seines Einflussbereichs »großzügige Aufklärungsaktion« zu übernehmen.
Und alles sollte schnell gehen. Sehr schnell. In Windeseile wollten die Studenten einen so genannten Artikel-Dienst organisieren. Sie forderten in einem Schreiben Autoren, die ihnen und dem neuen Regime gefällig waren, auf, Propagandatexte als Vorbereitung auf die Aktion »gegen den jüdischen Zersetzungsgeist und für volksbewußtes Denken und Fühlen im deutschen Schrifttum« zu schreiben. Am 10. April kam die Aufforderung bei den Autoren an, bis zum 12. April sollten sie liefern. Das war selbst den eifrigsten unter den neuen Nationaldichtern zu überstürzt. E.G. Kolbenheyer schrieb barsch: »Das geht natürlich nicht«, und bot den Nachdruck zweier Aufsätze an, »die in Ihre Kampfrichtung wirken«. Und ein durch den Aufbruchswirbel der neuen Zeit ebenso euphorisierter wie erschöpfter Will Vesper teilte den Studenten mit, dass seine »ganze Arbeit ja von jeher diesem Ziel gilt«, doch »leider habe ich mich so überarbeitet, daß mir der Arzt für einige Wochen unbedingte Ruhe verordnet hat«. Das Echo war also dürftig. Doch von Schriftstellern aus der dritten und vierten Reihe und einigen, die gar nicht gefragt worden waren, erhielten die Studenten wenigstens etwas, was sie an die Redaktionen verschicken konnten.
Und die Maschine lief weiter. Am 12. und 13. April wurden an den deutschen Universitäten die so genannten »12 Thesen wider den undeutschen Geist« der Deutschen Studentenschaft ausgehängt. Als These 5 gab man bekannt: »Schreibt der Jude deutsch, dann lügt er.« Und These 7 lautete: »Wir wollen den Juden als Fremdling achten, und wir wollen das Volkstum ernst nehmen. Wir fordern deshalb von der Zensur: Jüdische Werke erscheinen in hebräischer Sprache. Erscheinen sie in Deutsch, sind sie als Übersetzung zu kennzeichnen. […] Deutsche Schrift steht nur Deutschen zur Verfügung. Der undeutsche Geist wird aus öffentlichen Büchereien ausgemerzt.«
Gegen diesen Wahnwitz, der so absurd klingt, dass er beinahe lustig ist, regte sich praktisch kein Protest. Der Rektor der Berliner Universität, Professor Kohlrausch, gab zu bedenken, die Sätze seien »Übertreibungen, die nur geeignet sind, den Kampf gegen den undeutschen Geist zu diskreditieren«. Und er erklärte, dass er zu der – von ihm selbst gestellten – Frage, ob die Thesen womöglich wieder zu entfernen seien, »die Entscheidung des Herrn Ministers einholen werde«. Er wird wohl nicht im Ernst erwartet haben, dass Minister Goebbels diese Thesen entfernen lassen würde. Und an der Universität in Köln erreichte der Rektor auf Bitten eines Professors beim verantwortlichen Propagandaleiter des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes »schriftlich die Zusicherung, daß bei der Verbrennung der zersetzenden jüdischen Bücher am Mittwoch, den 10. Mai die Thesen in den Reden nicht erwähnt werden, in Sonderheit auch die These nicht ›Der Jude lügt, wenn er deutsch schreibt‹.« So war das damals, in den ersten Monaten der neuen Herrschaft. Der Rektor der Universität muss bei Studenten darum bitten, dass eine absurde, verbrecherische, lächerliche These bei der anstehenden Bücherverbrennung doch möglichst nicht verlesen werden möge. Der Student gibt sich großzügig. Und der Senat der Universität Köln gibt bekannt: »Der Senat beschließt, mit dem Rektor geschlossen an der Veranstaltung (d. i. die Bücherverbrennung) teilzunehmen. Anzug: Schwarzer Rock, evtl. Uniform. Rektor ohne Kette.«
Es gab keinen Protest an den deutschen Hochschulen. Nicht von den Studenten und so gut wie keinen von den Professoren. Die Thesen wider den undeutschen Geist, die Vorbereitungen zur Verbrennung der Bücher, all das lief reibungslos und in aller Regel unwidersprochen. Nur in wenigen Städten sorgten sich Professoren um den Bestand der Universitätsbibliothek. Da einigte man sich dann meist so, dass auch das undeutsche Buch »zu Forschungszwecken« in der Bibliothek verbleiben durfte.
Doch es waren nicht nur die Studenten, die die Gunst der Stunde nutzen wollten, um die deutsche Literatur ein für alle Mal von den Büchern zu »befreien«, die sie für undeutsch hielten. Auch der im »Börsenverein« organisierte deutsche Buchhandel hatte früh die Zeichen der Zeit erkannt und am 12. April 1933 ein »Sofortprogramm des deutschen Buchhandels« beschlossen, in dem es heißt: »Der deutsche Buchhandel begrüßt die nationale Erhebung. Er hat seine Bereitwilligkeit zur Mitarbeit an ihren Zielen alsbald zum Ausdruck gebracht.« Was das für Ziele waren, an denen man bereitwillig mitarbeiten wollte, machte man später durch den Abdruck von Listen der unerwünschten Schriftsteller deutlich. Zunächst, am 13. Mai, druckte man im Börsenblatt die Namen der Autoren, die am bedrohlichsten und undeutschesten – so es da eine Steigerung gibt – erschienen: Lion Feuchtwanger, Ernst Glaeser, Arthur Holitscher, Alfred Kerr, Egon Erwin Kisch, Emil Ludwig, Heinrich Mann, Ernst Ottwalt, Theodor Plievier, Erich Maria Remarque, Kurt Tucholsky und Arnold Zweig. Und drei Tage später, am 16. Mai, druckte man die ganze lange Liste, die Liste der 131 Namen, die Liste des Bibliothekars Wolfgang Herrmann. Sie war die Grundlage für die Bücherverbrennung und blieb ein Leitfaden für alle späteren Verbotslisten im nationalsozialistischen Deutschland.
In Berlin hatte sich kurz nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten ein Ausschuss des Verbandes Deutscher Volksbibliothekare gebildet, der so genannte »Ausschuß zur Neuordnung der Berliner Stadt- und Volksbüchereien«. Sein Ziel: Kampf gegen den »Kulturbolschewismus« und »Ausleihverbot« für »bolschewistische, marxistische und jüdische Literatur« in deutschen Büchereien. An der Spitze standen der Leiter der Spandauer Stadtbücherei, Dr. Max Wieser, sowie Dr. Wolfgang Herrmann, der seit kurzem die Berliner Geschäftsstelle einer »deutschen Zentralstelle für Volkstümliches Büchereiwesen« des Volksbibliothekar-Verbandes leitete. Dieser Wolfgang Herrmann hatte schon früh für die »nationale Wehrhaftmachung« der deutschen Literatur geworben und 1932 ein erstes Auswahlverzeichnis für Volksbüchereien unter der Überschrift »Der neue Nationalismus und seine Literatur« in einer Bibliothekars-Zeitschrift veröffentlicht.
Und jetzt war sein Moment gekommen, der große Moment im Leben des Wolfgang Herrmann, in dem ihm die Entscheidungsmacht darüber zufiel, welche Bücher in Gegenwart und Zukunft als deutsch zu gelten hätten und welche nicht. Und Herrmann nutzte die Gelegenheit, prompt und gründlich. Vielleicht ahnte er damals schon, dass er ebenso schnell aus dem Machtzentrum wieder vertrieben werden würde, wie er hineingeraten war.
Wer war dieser Mann, der diese Liste erstellte? Wer war Wolfgang Herrmann? Siegfried Schliebs hat für den Ausstellungskatalog zur Bücherverbrennung in der Berliner Akademie der Künste 1983 das Leben dieses Mannes nachgezeichnet. Er wurde 1904 in Alsleben an der Saale geboren, war schon als Schüler Mitglied des Deutschvölkischen Jugendbundes, studierte in München Neuere Geschichte und begann 1929 in Breslau seine Arbeit als Bibliothekar in der städtischen Volksbibliothek. Er hielt schon damals Vorträge über eine Büchereipolitik im nationalsozialistischen Sinne, beklagte sich bitter über die »liberal und kommunistisch verseuchte« Bibliothek und setzte »gegen den jüdischen Dezernenten die Anschaffung und Auslage der ›N.S. Briefe‹ in den städtischen Lesesälen« durch. 1931 wechselte er in die Stadtbücherei nach Stettin, wo er jedoch noch im Oktober desselben Jahres wieder entlassen wurde. Herrmann war erwerbslos, im Dezember beantragte er die Aufnahme in die NSDAP. Er schrieb Artikel für Zeitschriften aus dem nationalsozialistischen Diktatur-Verlag, lag aber, wie er selber sagte, »krank und unterernährt mit 29 Jahren« seinen Eltern »auf der Tasche«. Das war die Zeit, in der er seine ersten Listen erstellte. Und diese allerersten Listen sollten sich später als verhängnisvoll für den Bibliothekar erweisen. Denn Herrmann war damals nicht nur beruflich, sondern offenbar auch ideologisch in einer Krise. Er gehörte den Strasser-Sympathisanten in der NSDAP an und empfahl auf seiner frühen Liste nicht nur die Schmähschriften Hitler – ein deutsches Verhängnis von Ernst Niekisch und Adolf Hitler, Wilhelm der Dritte von Weigand von Miltenberg, sondern er bemerkte auch über Adolf Hitlers Mein Kampf: »Hitlers Selbstbiographie ist die wichtigste autoritative Quelle der Bewegung. Sie enthält keine geistig originellen und ›theoretisch‹ durchdachten Gedanken.« Wie dieser Mann trotz dieser Bemerkungen auf seinen frühesten Listen vom Regime auf seinen späteren Posten gesetzt werden konnte, wird wohl immer ein Rätsel bleiben. Klar ist, dass auch die spätere, im Jahr 1933 von ihm verantwortete Liste eigentlich nur für die Leihbüchereien gelten sollte. Von einer Bücherverbrennung im großen Stil war da am Anfang noch nicht die Rede. Doch die Studenten, die sich die Bücherverbrennung zum Ziel gesetzt hatten, verfolgten einen extrem knappen Zeitplan, und so kam es, dass die Deutsche Studentenschaft mit Herrmann Kontakt aufnahm und dieser ihnen seine Liste bereitwillig zur Verfügung stellte. Währenddessen hatte auch der nationalsozialistische »Kampfbund für deutsche Kultur« unter der Führung Alfred Rosenbergs begonnen, an Listen des undeutschen Schrifttums zu arbeiten. Seit 1929 schon stellte man im Mitteilungsblatt des Kampfbundes in einer gesonderten Rubrik besondere »Feinde« des wahren Deutschland ausführlich vor. Doch in der Arbeit an einer grundlegenden Liste hatte Wolfgang Herrmann einen Vorsprung. Und für die Sammelaktionen der Studenten, die im April begannen, war die Herrmann-Liste die einzige greifbare.
Am 19. Mai, knapp anderthalb Wochen nach der Bücherverbrennung, veröffentlichte der Großdeutsche Pressedienst unter der Überschrift »Eine Fehlbesetzung?« eine Polemik gegen Herrmann, in der auch dessen frühe Einschätzung von Hitlers Mein Kampf zitiert wurde. Was für eine Blamage! Und was für ein Ärgernis, dass das Material gerade jetzt bekanntgemacht wurde. Herrmann ahnte, woher der Angriff kam. An einen Freund schrieb er am 24. Mai, er wisse schon länger, »daß das Material gegen mich schon vor einigen Wochen von Stettin […] aus dem Berliner Kampfbund für Deutsche Kultur zur Verwertung übergeben worden ist«. Und es scheint tatsächlich so gewesen zu sein, dass jener Kampfbund unter Alfred Rosenberg, der im Wettlauf der Listen ins Hintertreffen geraten war, auf diese Weise Herrmann diskreditieren wollte. Am 26. Mai schrieb Herrmann an den Kampfbund und belegte mit einer Fülle von Material seine Hitler-Treue. Doch Wolfgang Herrmanns große Stunde war vorbei. An den nun folgenden Listen-Ausarbeitungen für den Buchhandel, die Verlage, die Sortimenter, die zwar seine Liste zur Grundlage hatten, aber im Einzelnen ganz erheblich von ihr abwichen, war er nicht mehr beteiligt. Es blieb ihm ein Parteiverfahren erspart, und 1934 wurde er aufgefordert, sich um die Stelle des Direktors der Stadtbibliothek Königsberg zu bewerben, was er tat und die Stelle auch erhielt. Dort holte ihn die Vergangenheit wieder ein. Als er im Herbst 1936 zum politischen Leiter ernannt werden sollte, wurde der Druck zu groß: »Ich bitte, zur parteiamtlichen Klärung der von mir im Jahre 1932 geübten unsachlichen Kritik am Führer das Parteigerichtsverfahren einzuleiten«, musste er am 12. Dezember 1936 an den Ortsgruppenleiter der NSDAP Königsberg schreiben. Lange zog sich das Verfahren hin, sehr lange, die Stadt Königsberg mahnte das Oberste Parteigericht in München mehrfach, das Verfahren zu beschleunigen, da man bis zu einer Entscheidung nicht gegen Herrmann vorgehen könne. Schließlich, nach beinahe anderthalb Jahren, hieß es mit der Macht der allerletzten Instanz: »Das Verfahren wird auf Grund der Verfügung des Führers vom 27. April 1938 eingestellt.« Von jetzt an blieb er unbehelligt, gab für den Verlag Korn in Breslau unter dem Titel »Kornkammer« mehrere Bände einer »Sammlung der Unvergessenen«, darin unter anderem Johann Peter Hebels Rheinischen Hausfreund, heraus und wurde im Weltkrieg Soldat. 1945 ist Wolfgang Herrmann gefallen.
Aber damals, im April und im Mai 1933, der Mann war noch keine 30 Jahre alt, da war seine große Stunde. Er verschickte Liste um Liste, aktualisierte weiter, fügte neben der großen, 131 Autoren umfassenden Liste der »Schönen Literatur« schwarze Listen für die Gebiete »Allgemeines«, »Kunst« und »Geschichte« hinzu und veröffentlichte Grundsatzschriften »zur Anfertigung von Schwarzen Listen« und »Prinzipielles zur Säuberung der öffentlichen Büchereien«. Er gab sich beinahe moderat und erklärte in der Vorrede zu seiner Liste: »Die vorliegende Liste nennt alle Bücher und alle Autoren, die bei der Säuberung der Volksbüchereien entfernt werden können. Ob sie alle ausgemerzt werden müssen, hängt davon ab, wie weit die Lücken durch gute Neuanschaffungen aufgefüllt werden.«
Herrmann ging es also mit seiner Liste eher um einen Austausch der Bestände der Volksbibliotheken. Doch die Studenten hatten mit seiner Liste anderes vor. Die Tatsache, dass sich das neue Regime mit der Organisation der Verbrennung anfangs eher zurückhielt, bedeutet natürlich keinesfalls, dass die Aktion nicht in seinem Sinne gewesen wäre. Die »Säuberung« des deutschen Buchbestandes, die Vertreibung der verhassten Autoren stand ganz oben auf der Agenda. Man hatte nach den schlechten Erfahrungen mit dem Judenboykott vom 1. April nur Sorge, dass man sich mit einem erneuten Misserfolg vor dem Ausland und der Bevölkerung im eigenen Land schrecklich blamieren könnte. So ist bekannt – und der damalige Vorsitzende der Deutschen Studentenschaft, Gerhard Krüger, hat es noch 1983 in einem Schreiben bestätigt –, dass das Propagandaministerium massiv auf die Studenten einwirkte, um aus der geplanten »begrenzten symbolischen Verbrennungsaktion« eine »übergreifende Säuberungsaktion« zu machen. Doch Goebbels selbst, den die Studenten schon im ersten Entwurf ihres Rundschreibens von Anfang April als Festredner genannt hatten, ließ erst am 9. Mai, als sich ein offenbar selbst von ihm nicht für möglich gehaltener Erfolg der Aktion abzeichnete, verlautbaren: »Wie Ihnen auf Ihr Schreiben vom 3. Mai heute bereits telefonisch mitgeteilt wurde, ist der Herr Minister bereit, am 10. Mai um 24 Uhr, auf dem Opernplatz Unter den Linden, die Feuerrede zu halten.«
Die Vorbereitungen waren einfach zu gut gelaufen. Die meisten deutschen Universitätsstädte bereiteten tatsächlich eine öffentliche Verbrennung vor und ließen eifrig undeutsche Bücher sammeln. Nur von kleineren Universitäten kamen Absagen. Etwas reserviert zum Beispiel aus Eichstätt, wo man anmerkte, »eine förmliche Aktion wider den undeutschen Geist« habe noch nicht bewerkstelligt werden können. Doch »mehr vielleicht noch als anderswo« sei dieser Kampf vor Ort schon lange eine Selbstverständlichkeit. Barscher reagierte man in Regensburg: Eine solche Veranstaltung komme gar nicht in Frage, zu verbrennen habe man selbstverständlich nichts Undeutsches, »da sich in unseren Büchereien solches nicht befindet. Unsere Hochschule ist immer schon frei von jüdischem Geist gewesen und wird es auch in Zukunft sein, was man anscheinend von den Universitäten nicht immer sagen kann«. In Köln musste die Aktion kurzfristig wegen starken Regens verschoben werden, und nur aus Stuttgart kam ein klarer Widerspruch. Der Kommissar für die württembergische Studentenschaft, Gerhard Schumann, untersagte ohne nähere Begründung die Errichtung von Schandpfählen, die von den Berliner Studenten für alle Universitätsstädte angeregt worden war, sowie eine organisierte Sammelaktion und Bücherverbrennung. Man habe den Fackelzug verboten, »da Stuttgart, eine Stadt, die sowieso nicht der geeignete Boden für Fackelzüge ist, in der letzten Zeit mit Fackelzügen überhäuft wurde.« Man werde sich aber umso mehr im Alltag der Bekämpfung von Schmutz- und Schundliteratur widmen.
Das war es schon an Widerspruch. In den anderen Städten wurden Sammelstellen eingerichtet, an denen Büchereien und die Studenten die Bücher abliefern konnten. Die Studenten zogen, in einigen Städten in Begleitung der SA oder der Polizei, in die örtlichen Leihbüchereien, um die Bücher, die auf Herrmanns Liste standen, einzusammeln. Herrmann mahnte zur Wachsamkeit. Man möge nicht nur das beachten, »was an Büchern vorn im Laden und in der Auslage vorhanden ist, sondern was in den hinteren Regalen und Räumen steht. Heute haben die Leihbüchereien natürlich durchweg nationale Literatur vorn. Vor wenigen Wochen waren sie fast durchweg noch literarische Bordelle«. Da durch eine Indiskretion seine Liste vor Beginn der Sammelaktion in einer Bibliotheks-Zeitschrift veröffentlicht worden war, rechnete Herrmann damit, dass die Bibliothekare die beanstandeten Bücher verstecken und die Herausgabe verweigern könnten. Umso mehr überrascht es, dass Anselm Faust in seinem hervorragenden Grundlagentext über die Vorgeschichte der Bücherverbrennung aus dem Jahr 1983 feststellen muss: »Die Berichte der Studenten enthalten keinen einzigen Fall von Verweigerung seitens der Büchereibesitzer.« Die Einschüchterung war offenbar nahezu vollkommen. Selbst wenn viele Büchereibesitzer mit dem Geist des neuen Regimes und den Auswahlkriterien einverstanden gewesen wären, bedeutete die Konfiszierung für sie einen erheblichen Verlust, da ein finanzieller Ausgleich für die eingezogenen Bücher selbstverständlich nicht zu erwarten war. Buchhandlungen waren bei diesen ersten Sammelaktionen in der Regel noch nicht das Ziel. Aber private Leihbüchereien spielten in den Jahren der Weimarer Republik beim Lesepublikum eine außerordentlich große Rolle. Viele Inhaber kleiner Geschäfte betrieben noch nebenher eine Leihbücherei.
Buchhändler und vor allem Antiquare waren von Durchsuchungen und Beschlagnahmen erst später betroffen. Es gibt zahlreiche Dokumente der Empörung ermittelnder Polizeibeamter über renitente Buchhändler, die im Verborgenen verbotene Bücher horteten. So zum Beispiel über die Buchhandlung Hans Dallmayer in Greifswald: »Der Inhaber Krause begleitete die Durchsuchung mit hämischen Bemerkungen. Nachdem er anfangs auf eine Bestätigung über die 82 beschlagnahmten Schriften verzichtet hatte, erklärte er schließlich, er wolle die Liste doch als Kulturdokument zu den Akten nehmen.«
Offizielle Beschwerden gab es auch in den Jahren nach der Bücherverbrennung kaum. Sie hätten sicherlich keine Aussicht auf Erfolg gehabt. Vom Berliner »Kaufhaus des Westens« stammt eines der wenigen Dokumente, das auch eine Beschwerde zwischen den Zeilen enthält. In dem Schreiben an die Fachschaft Leihbücherei in der Reichsschrifttumskammer »teilen wir Ihnen mit, daß wir am 3. Januar ds. Js. (1935) 8 Kisten und 1 Ballen, enthaltend insgesamt 1329 Bände lt. anliegenden Listen an die Ablieferungsstelle Westen […] abliefern werden. Wir bemerken höfl., daß die Bände sämtlich wie auch auf anliegenden Listen ausdrücklich vermerkt, das Eigentum unserer Firma sind. Mit deutschem Gruß.« Die Antwort der Fachschaft, so eine erging, ist nicht bekannt. Es ist aber nicht zu erwarten, dass die Feststellung des Eigentums irgendwelche Konsequenzen hätte haben können. Die beschlagnahmten Bücher wurden in der Regel von beaufsichtigten Firmen eingestampft oder – gerade in den ersten Monaten – in Antiquariate im Ausland verkauft. Das brachte erstens Geld, und zweitens schadete es natürlich den Emigranten, indem man den ohnehin geringen Markt für ihre Werke im Ausland auch noch mit billigen Gebrauchtbüchern, an denen sie nichts mehr verdienten, verstopfte.
Neben dem Unmut über die ersatzlos konfiszierte Ware war der größte Beschwerdegrund die totale Unsicherheit über die Unterscheidung von verbotenen und nicht verbotenen Büchern, wie sie im Gefolge der Bücherverbrennung von offiziellen Stellen fortgesetzt wurden. Im Dezember klagte der Buchhändler Willem Jaspert: »Welche Unruhe durch die oben dargelegten Ausführungen in das Bücher kaufende Publikum, vor allem aber in das Sortiment und den Verlag hineingetragen wird, liegt auf der Hand. Über 1000 Bücher sind von 21 Stellen im neuen Staate verboten worden! Es wäre meines Erachtens unbedingt an der Zeit, entweder mit den Verboten grundsätzlich aufzuhören, oder eine Zentralstelle zu schaffen, an die man sich entweder bei Drucklegung eines Manuskriptes vorher wenden kann, oder die nachträglich bereits erschienene Bücher als einzige offizielle Stelle verbieten kann.«
Das Chaos war gewollt. Chaos, Uneindeutigkeit und Verunsicherung gehörten in den ersten Monaten des neuen Regimes in allen Gesellschaftsbereichen zum System. Im Bereich der Indizierung von Schriften wie im ganzen Bereich der Kulturpolitik kam es darüber hinaus zu erheblichen Machtkämpfen in der NSDAP. Nicht nur Alfred Rosenberg und Joseph Goebbels probten so lange die Erweiterung ihres Machtbereichs, bis Goebbels 1937 auf ganzer Linie gesiegt hatte und die »Schrifttumspolitik« des Reiches allein bestimmte. Am 16. Dezember 1938 hielt er schließlich schriftlich fest: »Ich mache erneut darauf aufmerksam, daß ich mir alle Verbotsentscheidungen ausnahmslos persönlich vorbehalten habe.«
Damals, in jener Nacht im Regen auf dem Opernplatz in Berlin, hatte er noch kein Verbot ausgesprochen. Da stand er auf einem kleinen Podest im hellen Mantel unter Scheinwerfern mit Blick auf die Flammen, auf die Studenten, die SA-Männer, das erwartungsvolle Publikum, und verkündete das Ende des »Zeitalters eines überspitzten jüdischen Intellektualismus« und den »Durchbruch der deutschen Revolution«, die dem deutschen Weg die Gassen frei gemacht habe. Er rief: »Als am 30. Januar dieses Jahres die nationalsozialistische Bewegung die Macht eroberte, da konnten wir noch nicht wissen, daß so schnell und so radikal in Deutschland aufgeräumt werden könnte.«
Diesen Satz konnte man ihm sogar abnehmen. Er hatte es selbst nicht glauben können, noch bis zum Vortag der Verbrennung, dass die Deutschen schon so weit waren. Dass sie bereitwillig zusehen würden, wie die Bücher ihrer besten Autoren den Flammen übergeben wurden.
Die Nacht, in der die deutsche Literatur für alle Welt sichtbar vertrieben und aus dem Gedächtnis des Landes, aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausgelöscht werden sollte. Diese Nacht ging wie ein Riss durch das Leben der 131 Autoren, die auf der Liste des undeutschen Geistes standen. Ein Riss durch ihr Leben, durch ihr Werk. Ein Riss auch durch die Geschichte dieses Landes.
Der elsässische Autor René Schickele, dessen Bücher auf der Liste dieses Abends gar nicht standen und erst später aus den Bibliotheken des Landes entfernt werden sollten, hat im Exil geschrieben: »Wenn es Goebbels gelingt, unsere Namen von den deutschen Tafeln zu löschen, sind wir tot. Gespenster in der Diaspora, in der wasserarmen Provinz. Schon die nächste Generation wird nichts mehr von uns wissen.« Es war dessen Ziel. Es war das Ziel dieses Feuers in jener Nacht im Mai, das Ziel all derer, die damals die Bücher in die Flammen warfen. Sie haben es nicht erreicht.
1Die fantastischen 3
Hermann Essig – schwäbische Existenzialfantasien und eine endgültige Abrechnung mit der Berliner Kunstszene. Gustav Meyrink – Prager Bankiers-Exzentrik und der Blick durch das Loch im Himmel. Alexander Moritz Frey – das Pech, mit Hitler im Graben zu liegen
Am Ende hatte er alles verspielt. Seine Stücke wurden nicht mehr aufgeführt, seine letzten Unterstützer wandten sich von ihm ab, der Erste Weltkrieg ging zu Ende, und der schwäbische Dichter Hermann Essig (1878–1918) aus Truchtelfingen auf der Alb starb an den Folgen einer Lungenerkrankung in Berlin. Ein allerletzter großer Freund seiner Kunst hielt eine bewegende Trauerrede. Herwarth Walden, der Gründer der Zeitschrift Der Sturm, der Essigs Werke in den letzten Jahren verlegt hatte, sprach davon, dass einzig Hermann Essig es wert sei, neben dem großen Heinrich von Kleist als »Dichter der Wirklichkeit« genannt zu werden, er schwärmte von seinem Genie und klagte die Welt an, dies nicht erkannt zu haben. Er schloss dramatisch: »Wir glauben an dich, Hermann Essig. Wir lieben dich, da du uns lebtest. Du lebst uns. Du lebst der Erde. Deine Kunst ist in der Welt.« Nur ein Jahr später waren auch von Herwarth Walden nur noch böse und verachtungsvolle Worte über den schwäbischen Theaterkönig zu hören. Denn gerade, postum, war Essigs erster und einziger Roman erschienen: Der Taifun (1919). Und dieser Taifun war nichts anderes als eine nur wenig verschlüsselte Abrechnung mit dem »Sturm« und seinem Leiter – Herwarth Walden. Dieser erklärte tief verletzt: »Essig hat mich bis wenige Stunden vor seinem Tod seinen Freund genannt. Nach seinem Tode ist ein Roman veröffentlicht worden. Ein mißglückter Versuch, aus naturalistischer Darstellung zu künstlerischer Gestaltung zu gelangen, die Tragödie einer unfertigen Künstlerschaft mit der Wirkung übermenschlicher Gemeinheit.«
Gemein – oh ja, aber mit seiner künstlerischen Wertung hatte Walden in diesem Falle gar nicht recht. Denn wenn etwas von Hermann Essig bleiben muss, dann ist es dieser Roman, der eine Kunstbewegung zeigt, entschlossen, sich die ganze, große, kunstverrückte Hauptstadt untertan zu machen. Eine Bewegung, die durch Scharlatanerie, unendliches Selbstbewusstsein und ein wenig künstlerisches Können eine Stadt im Kunsttaumel verzaubert, keine Moralvorstellungen zu akzeptieren scheint und in Wahrheit doch nur einer kleinen Spießermoral verpflichtet ist. Es ist eine Freude, dem fabulierenden Essig dabei zu folgen, wie er die kaum verschlüsselten Protagonisten der Gruppe, Franz Marc, Marc Chagall, Else Lasker-Schüler, auch den dichtenden Arzt Alfred Döblin und vor allem natürlich Herwarth Walden bei ihren Geschäften, ihren Selbstüberhebungen und ihren sexuellen Sonderbarkeiten beobachtet. Ein Kunstexzess, der sich immer weiter steigert, alle wissen, dass die große Kunstblase bald, sehr bald schon platzen wird. Und am Ende des immer weiter gesteigerten Abstraktionsideals verkaufen die Künstler vom Taifun unsichtbare Bilder. Ein Scherz, mit dem Yasmina Reza noch achtzig Jahre später die Theatersäle der Welt füllte. Und auch sonst liest sich das Buch über all die grotesken Auswüchse eines überhitzten Kunstmarktes erstaunlich gegenwartsnah.
Ganz anders Essigs Theaterstücke, die zunächst gar nicht gespielt, später dann bei der Bühneninszenierung entweder von der Zensur verboten oder von einem aufgebrachten Publikum niedergeschrien wurden. Nicht wenige Aufführungen endeten in Saalschlachten. Es sind groteske Volksstücke, Horrormärchen, die vor allem an Drastik nichts aussparen. Was an sexuellen Möglichkeiten denkbar war – Essig brachte es auf die Bühne, Gruppensex, Sodomie, Fernsex, Sadismus. Essig kannte es und ließ es spielen. Aber die Stücke waren dabei so unstrukturiert, ausladend, chaotisch, stilunsicher und wunderlich, dass sie auch das avancierteste Publikum eher verschreckten.
Dazu kam Essigs schwieriger Charakter. Von Paul Cassirer, der seine ersten Stücke druckte und die erste Inszenierung des Stücks Glückskuh (1911) erfolglos auf die Bühne brachte, distanzierte er sich. Jener sei schuld an seinem Misserfolg, und Essig brachte die Stücke lieber im Selbstverlag heraus. Er hatte auf dem Gipfel seiner Karriere mächtige Fürsprecher – Alfred Kerr, Arthur Eloesser und Franz Blei lobten seine Stücke und erreichten, dass Essig als einziger Künstler zweimal in Folge den renommierten Kleist-Preis erhielt. Doch die ausbleibende künstlerische Entwicklung und eine scheinbar grenzenlose Selbstüberschätzung brachten auch seine letzten Unterstützer von ihm ab. Essig, der im Herzen konservative, heimatverbundene Schwabe von der Alb, las erklärtermaßen keine zeitgenössische Literatur, ging nicht ins Theater, verweigerte sich dem ganzen Betrieb, und als er zum ersten Mal einen Blick in die Werke Nietzsches warf, soll er erklärt haben, all das selbst schon viel besser und schärfer gedacht zu haben, heute aber sei dieses Denken längst obsolet. Eloesser schrieb in seiner Literaturgeschichte über Essig: »Es fehlte ihm an Urteil, an Geschmack, und er verzerrte seine Anekdoten, über die er selbst gewiß am meisten gelacht hat, in eine Skurrilität, die schließlich keine Lustigkeit mehr abgab.« Und Franz Blei hielt in seinem Bestiarium der modernen Literatur fest: »ESSIG. Das wurde am Ende aus einem gut duftenden kleinen schwäbischen Landwein, als die Flasche ungetrunken, aber offen, zu lange auf einem Berliner Schanktisch der Kaschemme ›Zum Sturm‹ stand.«
Seinen größten Erfolg hat er nicht mehr erlebt. Der Taifun war einer der ersten Bestseller der neuen Republik. Er hat ihn seinen letzten Freund gekostet. Essig und sein Werk waren eigentlich schon fast vergessen, als die Nazis es im Mai, fünfzehn Jahre nach seinem Tod, in Flammen aufgehen ließen.
Als Bankier begann er sein Berufsleben. Als Bankier in Prag, mit eigener Bank und – einem sehr eigenen Stil. Gustav Meyrink (1868–1932), der eigentlich Gustav Meyer hieß und als uneheliches Kind der Hofschauspielerin Maria Meyer und des Staatsministers Karl von Varnbüler in Wien geboren wurde. Der Makel der illegitimen Abstammung hat ihn lange Zeit geschmerzt. Er sollte später der Auslöser dafür werden, dass er sein bürgerliches Leben gegen das des fantastischen Schriftstellers, Zeichensuchers, Drogenfreundes und Neue-Welten-Suchers eintauschte. Doch antibürgerlich, bohemienhaft und äußerst sonderbar war er schon früh. Er war das Glanzstück unter den Prager Bankiers, der Wundermann, der Spötter und Geschichtenerzähler, König des Nachtlebens. Karl Wolfskehl schrieb über ihn: »Er war eine völlig neuzeitliche Erscheinung, ein soignierter Yogi, ein Eremit mit guten Manieren.« Seine Wohnung war voll mit den absonderlichsten Möbelstücken, Max Brod, der ihn bewunderte, kam bei seinem ersten Besuch in dessen Wohnung aus dem Staunen nicht mehr heraus. Meyrink trug grelle Krawatten, ausgefallene Anzüge, hypermodernes Schuhwerk, er hielt sich überzüchtete Hunde, einen ganzen Zwinger weißer Mäuse und jede Menge exotische Haustiere. Die andere Seite der Welt hat er schon früh entdeckt, hatte den Blick durch »das Loch im Himmel«, wie er es nannte, gewagt, in eine Welt jenseits unserer Begriffe. Es war 1893, aus Liebeskummer wollte er sich töten, »die Fahrt über den Styx antreten«, wie er schreibt. Der Abschiedsbrief an die Mutter ist geschrieben, da raschelt es an der Tür, und es erscheint ihm der Mann, den er seitdem »den Lotsen mit der Tarnkappe nennt«, und schiebt ein Buch mit dem Titel »Über das Leben nach dem Tode« unter der Tür hindurch. Meyrink legt den Revolver für immer beiseite und beschließt, ab sofort nicht mehr an Zufälle zu glauben. Er sucht das Leben jenseits des Lebens, wendet den Blick nach innen, versucht alle bekannten Drogen in zum Teil unglaublichen Mengen, setzt sich stundenlang in bitterer Kälte auf eine Bank an der Moldau und wartet, bis die erhoffte Vision endlich kommt. Er unternimmt alles, um Neues zu erleben, zu einer tieferen Wahrheit vorzudringen. »Dann führte ich durch drei Monate das Leben eines beinahe Wahnsinnigen, aß nur Vegetabilien, schlief nicht länger als drei Stunden in der Nacht, genoß zweimal täglich einen in Wassersuppe aufgelösten Eßlöffel voll Gummi Arabicum (dies sollte besonders wirksam sein zur Entwicklung des Hellsehens!), machte um Mitternacht schmerzhafte Asana-Stellungen mit verschränkten Beinen, dabei den Atem anhaltend, bis schaumiger Schweiß meinen Körper bedeckte und der Tod des Erstickens mich durchrüttelte.«
Ein Bankier, dem die Menschen vertrauen. Selbst seine Schriftstellerkollegen wie etwa Roda Roda werden später über ihn sagen, er sei in Geldangelegenheiten von grenzenloser Naivität gewesen. Trotzdem wäre das mit seinem bunten Bankiersleben in Prag wohl noch eine Weile so weitergegangen, wenn nicht eines Tages ein junger Offizier der Reserve auf offener Straße Meyrinks Frau den Gruß verweigert hätte. Meyrink war außer sich, forderte den Offizier zum Duell, was dieser mit dem Hinweis auf Meyrinks unstandesgemäße Geburt zurückwies. »Nicht satisfaktionsfähig« – was für ein Schlag. In Wahrheit hatte der junge Offizier natürlich nur furchtbare Angst vor diesem Duell, denn Meyrink duellierte sich gern und oft und auch wegen Kleinigkeiten. Einmal soll Meyrink sogar die mit ihm verbündeten höheren Mächte zu Hilfe gerufen haben. Er vergrub am vereinbarten Platz ein Hühnerei unter einem Holunderbusch, um auf die Dämonenwelt vor Ort einzuwirken. Noch bevor das Duell dort stattfinden konnte, kam der Kontrahent bei einem anderen Duell ums Leben. Meyrink grub dankbar das Ei wieder aus – der Inhalt war verschwunden, berichtete er.
Jener Offizier also verweigerte das Duell, es kam zu immer neuen Prozessen wegen Beleidigungen und so weiter, bis man Meyrink schließlich des Betrugs bezichtigte und er fluchtartig Stadt und Bank verließ, um in München als Schriftsteller zu leben. Der Simplicissimus hatte erste Geschichten von ihm angenommen, fantastische Geschichten voller übersinnlicher Welten und Begebenheiten, voller Verachtung für die Spießbürger und deren Moral, böse, welterforschend, fantasiereich, mit kaltem Lachen gegen diese Welt, Geschichten, die später unter dem Titel Des deutschen Spießers Wunderhorn (1913) mit riesigem Erfolg als Buch erschienen und von Kurt Tucholsky begeistert als »Teufelsbibel« und »neuer Klassiker« begrüßt wurden. Die letzte Geschichte des Bandes heißt »G.M.«. Der verhasste Deutschamerikaner George Macintosh kehrt nach Jahren der Abwesenheit in seine alte Heimatstadt Prag zurück. Er kauft einige Häuser, lässt sie abreißen und gibt an, mit Hilfe modernster Methoden darunter Gold gefunden zu haben. Er enthüllt einen Plan, an welchen Stellen der Stadt ebenfalls welches zu finden sein würde, die Einwohner geraten außer sich vor Glück, reißen ihre Häuser begeistert ein und finden – nichts. G.M. hat inzwischen die Stadt verlassen. Er habe eine Visitenkarte zurückgelassen, erklärt er. Die Bewohner besteigen den von ihm zurückgelassenen Heißluftballon, steigen hoch über ihre Stadt hinaus und sehen: »Mitten aus dem dunklen Häusermeer leuchteten die leeren Grundflächen der zerstörten Bauten in weißem Schutt und bildeten ein zackiges Geschnörkel: G.M.« Ein kleiner Gruß des Dichters Meyrink hinüber in die alte Stadt, die ihn verstoßen hatte. Sein Lebensprogramm hat er einmal so beschrieben: »Wer geistig (Pardon!) emporkommen will, der muß gehaßt werden; das schien der Wüstenhund irgendwie unbewußt erfaßt zu haben, denn er ließ das erhabene Ziel, Feinde zu erwerben, keine Minute der 38 Stunden, die für ihn den Tag ausfüllten, aus den veilchenblauen Augen.«
Auch sein großer Erfolgsroman, der früheste und größte Fantasy-Erfolg eines deutschen Schriftstellers, spielt zum großen Teil in Prag. Der Golem (1915), ein Roman auf der Grundlage der alten jüdischen Golem-Sage, nach der sich einst ein Rabbiner nach den Anweisungen der Kabbala aus Lehm einen künstlichen Menschen als Diener schuf. In Meyrinks Roman ist jener Golem eine zweite Ich-Figur des Protagonisten, der eine andere, hellere Welt als die dunkle Welt der Prager Ghetto-Bezirke zu schauen vermag. Das Buch wurde – auch dank eines nie zuvor betriebenen Werbeaufwandes durch den Kurt Wolff Verlag, mit riesigen, knallbunten Plakaten auf Litfasssäulen und großen Anzeigen in fast allen Zeitungen – ein großer Erfolg. Außerdem wurden den Soldaten günstige Feldpostausgaben in die Schützengräben geschickt. Der Golem war eines der populärsten Bücher während des Ersten Weltkriegs, der Blick in eine andere Welt, jenseits der hiesigen, sehr willkommen. Über 200000 Bücher wurden verkauft. Doch schon damals gab es Anfeindungen der Deutschnationalen, die Meyrink für einen Juden hielten. Das war er jedoch nicht, hatte nur ein großes Interesse an der Kabbala und größte Sympathie für die jüdische Kultur. Noch nach dem Ersten Weltkrieg wurden zahlreiche seiner Bücher beschlagnahmt, und bis zu seinem Tod war der Nicht-Jude Meyrink immer wieder Ziel antisemitischer Hetze.
Es erschienen in rascher Folge weitere Romane. Doch mit keinem konnte er mehr an den früheren Erfolg anknüpfen. Er zog sich an den Starnberger See zurück, trieb Yoga, segelte, widmete sich der Familie und der Schau nach innen, träumte von einer »Blauen Internationale«, einer romantischen Revolution, aus der eine Bruderschaft der wahrhaft selbstbewussten Menschen hervorgehen sollte, und wurde von seinem Publikum rasch vergessen.
Sein Sohn Harro, der sich bei einem Skiunfall schwerste Verletzungen am Rückenmark zugezogen hatte, brachte sich 1932 um, und Gustav Meyrink verließ aller Lebensmut. Er starb im Dezember desselben Jahres in seinem Haus in Starnberg. Einer Freundin hatte er kurz vorher gesagt: »Es ist der Anfang einer anderen Weltperiode. Kein guter Anfang. Aber wer kann es ändern? … Ich sterbe rechtzeitig. Und ich weiß, daß es eine Gnade ist.«
Auf seinem Grabstein auf dem Starnberger Friedhof steht nur ein einziges Wort: »Vivo«. Ich lebe.
Vielleicht wäre sein Leben ganz anders verlaufen, wenn er nicht mit diesem übereifrigen Gefreiten im Ersten Weltkrieg zusammen im Graben gelegen hätte. Diesem so übermäßig an der eigenen Sicherheit interessierten, Karl May lesenden, ständig rot anlaufenden Meldegänger aus seiner Kompanie. Diesem Schnauzbartträger, der jeden Angriff der Engländer als einen ganz persönlichen Angriff auf sich selbst zu betrachten schien und wegen des kleinsten Halskratzens ins Sanitätszelt gelaufen kam, um danach zu verkünden: Der Mann tut Dienst trotz einer ganz gewaltigen Halsentzündung. Ja, höchstwahrscheinlich wäre das Leben des Schriftstellers Alexander Moritz Frey (1881–1957) anders verlaufen, wenn er nicht mit Adolf Hitler im selben Regiment gewesen wäre und wenn nicht Hitler an dem Autor, der soeben mit dem Roman Solneman der Unsichtbare (1914) seinen ersten großen Bucherfolg gefeiert hatte, ein so auffälliges Interesse gezeigt hätte. Immer wieder suchte Hitler den Kontakt zu ihm, weil dieser etwas von Kunst verstand. Doch Frey wehrte ab. Hitler galt in der Kompanie als Spinner und leicht erregbarer Außenseiter. Außer Max Amann, der später Hitlers Buch Mein Kampf herausgeben und das Hetzblatt Völkischer Beobachter leiten sollte, war keiner ihm damals dauerhaft nahe. Und dieser Amann, Feldwebel und Vorgesetzter Freys, ließ den jungen Schriftsteller in seiner freien Zeit regelmäßig zu sich kommen, um sich von ihm, der schon lange für die Zeitungen des Kaiserreichs schrieb, über das Pressewesen unterrichten zu lassen. Frey kam widerwillig, und bald schon nach dem Krieg erhielt er von Amann offiziell das Angebot, das Feuilleton des Völkischen Beobachters