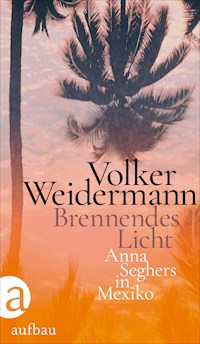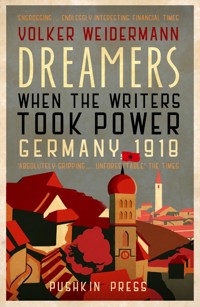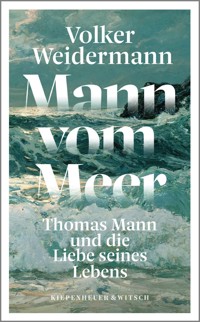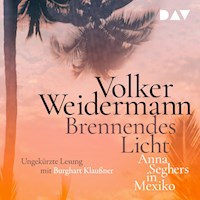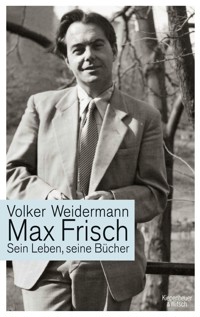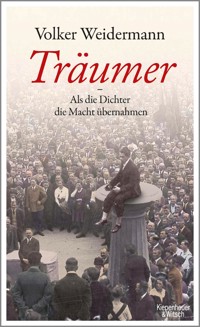
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
1919, Revolution in München – und alle sind vor Ort: Ernst Toller, Thomas Mann, Erich Mühsam, Rainer Maria Rilke, Gustav Landauer, Oskar Maria Graf, Viktor Klemperer, Klaus Mann ... Wann gab es das schon einmal – eine Revolution, durch die die Dichter an die Macht gelangten? Doch es gibt sie, die kurzen Momente in der Geschichte, in denen alles möglich erscheint ...Von einem solchen Ereignis, der Münchner Räterepublik zwischen November 1918 und April 1919 erzählt Volker Weidermann im Stil einer mitreißenden Reportage, bei der der Leser zum Augenzeugen der turbulenten, komischen und tragischen Wochen wird, die München, Bayern und Deutschland erschütterten.Nach der Vorgeschichte, dem Ende des 1. Weltkriegs und der Absetzung des bayrischen Königs, beginnt der magische Moment, in dem alles möglich erscheint: radikaler Pazifismus, direkte Demokratie, soziale Gerechtigkeit, die Herrschaft der Phantasie. An der Spitze der Rätebewegung stehen die Schriftsteller Ernst Toller, Gustav Landauer und Erich Mühsam, auf die nach den Tagen der Euphorie und der schnellen Ernüchterung lange Haftstrafen oder der Tod warten. In rasantem Tempo und aus der Perspektive von Beteiligten und Beobachtern vor Ort wie Thomas Mann, Klaus Mann, Rainer Maria Rilke, Adolf Hitler, Viktor Klemperer oder Oskar Maria Graf entsteht so ein historischer Thriller über ein einzigartiges Ereignis der deutschen Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Volker Weidermann
Träumer
Als die Dichter die Macht übernahmen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Volker Weidermann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Volker Weidermann
Volker Weidermann, geboren 1969 in Darmstadt, Studium der Politikwissenschaft und Germanistik in Heidelberg und Berlin. Autor beim SPIEGEL und Leiter des »Literarischen Quartetts« im ZDF. Bisherige Buchveröffentlichungen bei Kiepenheuer & Witsch: »Lichtjahre. Eine kurze Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis heute« (2006), »Das Buch der verbrannten Bücher« (2008), »Max Frisch. Sein Leben, seine Bücher« (2010), »Ostende, 1936« (2014), »Dichtertreffen. Begegnungen mit Autoren« (2016).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
1919, Revolution in München – und alle sind vor Ort: Ernst Toller, Thomas Mann, Erich Mühsam, Rainer Maria Rilke, Gustav Landauer, Oskar Maria Graf, Viktor Klemperer, Klaus Mann… Wann gab es das schon einmal – eine Revolution, durch die die Dichter an die Macht gelangten? Doch es gibt sie, die kurzen Momente in der Geschichte, in denen alles möglich erscheint.
Von einem solchen Ereignis, der Münchner Räterepublik zwischen November 1918 und April 1919 erzählt Volker Weidermann im Stil einer mitreißenden Reportage, bei der der Leser zum Augenzeugen der turbulenten, komischen und tragischen Wochen wird, die München, Bayern und Deutschland erschütterten.
Nach der Vorgeschichte, dem Ende des 1. Weltkriegs und der Absetzung des bayerischen Königs, beginnt der magische Moment, in dem alles möglich erscheint: radikaler Pazifismus, direkte Demokratie, soziale Gerechtigkeit, die Herrschaft der Phantasie. An der Spitze der Rätebewegung stehen die Schriftsteller Ernst Toller, Gustav Landauer und Erich Mühsam, auf die nach den Tagen der Euphorie und der schnellen Ernüchterung lange Haftstrafen oder der Tod warten. In rasantem Tempo und aus der Perspektive von Beteiligten und Beobachtern vor Ort wie Thomas Mann, Klaus Mann, Rainer Maria Rilke, Adolf Hitler, Viktor Klemperer oder Oskar Maria Graf entsteht so ein historischer Thriller über ein einzigartiges Ereignis der deutschen Geschichte.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Bayerische Staatsbibliothek München/Bildarchiv
ISBN978-3-462-31788-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Der Schuss
München der Möglichkeiten
Gegenschuss
Am Strand Ein Nachwort
Bücherliste
Der Schuss
Natürlich war es ein Märchen gewesen, nichts als ein Märchen, das für ein paar Wochen Wirklichkeit geworden war. Und jetzt war es eben vorbei. Es wäre lächerlich, sich noch weiter an die Macht zu klammern. Die Wahlergebnisse im Januar waren einfach zu niederschmetternd gewesen. Zweieinhalb Prozent, das war ja ein Witz, ein grauenvoller, schlechter Witz. Seitdem war er in der Presse nicht nur diesem wahnsinnigen Hass, sondern auch Hohn und Spott ausgeliefert. Ein Volkskönig ohne Volk, ein Narr auf dem Königsthron, unbayerischer Spinner, Jude von irgendwo.
Kurt Eisner hatte aufgegeben. Noch bis tief in die Nacht hatte er mit seinem Erzfeind Erhard Auer, dem Führer der Sozialdemokraten, verhandelt. Ach, was heißt verhandelt. Es gab ja nichts, was er ihm noch hätte entgegenhalten können. Den Posten des Botschafters in Prag hatte Auer ihm angeboten, er hätte auch Konsulatssekretär in Australien sagen können. Es war vorbei. Er hatte seine Weltsekunden gehabt und er hatte getan, was er konnte, um das Königreich Bayern in eine Volksrepublik umzuwandeln, in ein Land der Solidarität und Menschenfreundlichkeit.
Ein Traum, wie er da plötzlich in der Nacht vom 7. auf den 8. November auf dem Stuhl des Ministerpräsidenten gesessen hatte. Manchmal musste man einfach schlau sein und den Moment erkennen, wenn er da war. Und am 7. November 1918 war er da.
Es war ein sonniger Nachmittag, Zehntausende Soldaten, Gewerkschafter, Arbeiter und Matrosen hatten sich am westlichen Hang der Theresienwiese versammelt. Die Stimmung war angespannt, Innenminister Friedrich von Brettreich hatte in der ganzen Stadt die Mitteilung plakatieren lassen, die Ordnung sei gesichert. SPD-Mann Erhard Auer persönlich hatte ihm das am Tag zuvor versichert. Es werde keine Revolution ausbrechen, Kurt Eisner, Reichstagskandidat der Unabhängigen Sozialdemokraten, der seit Tagen die kommende Revolution beschwöre, werde »an die Wand gedrückt«, so hatte Auer sich ausgedrückt. Er habe die Lage im Griff.
Nichts hatte er im Griff. Es war ein gigantisches Durcheinander an diesem Nachmittag, es kamen immer mehr Zuhörer, immer mehr Soldaten aus den Kasernen, die meisten hatten ihre Rangabzeichen abgerissen. Die Männer – und einige wenige Frauen – standen in einzelnen Gruppen herum, versammelten sich mal um den einen, mal um den anderen Redner. Auer hatte sich den besten Platz gesichert, direkt auf der großen Freitreppe vor der Bavaria. Aber als die Massen merkten, dass er sie nur beschwichtigen wollte, sie auf eine ferne Zukunft vertrösten wollte, zogen sie weiter zu den anderen Rednern weiter unten am Hang.
Ganz unten stand Kurt Eisner. Er schrie beinahe, warf die Arme in die Luft. Immer mehr Menschen sammelten sich um den Mann mit den langen grauen Haaren, dem Zwicker, dem wilden Bart und dem großen Hut. Er hatte unter denen, die auf die Revolution hofften, einen guten Ruf, hatte im Januar den Streik der Munitionsarbeiter organisiert, war dafür ein halbes Jahr ins Gefängnis gekommen.
Er redete nicht besonders mitreißend, seine Stimme war kratzig, hell. Es kostete ihn einige Mühe, die anderen Redner zu übertönen. Aber die Zuhörer spürten: Der ist heute unser Mann. Der schickt uns nicht wieder nach Hause. Der spürt die Energie des Tages, die Wut, den Willen, dass endlich etwas Entscheidendes geschehen muss. Den König hatte man am Vormittag noch durch den Englischen Garten spazieren sehen. Ja, wie lange wollte der denn noch spazieren? Wie lange noch regieren?
Ein junger, radikaler Kriegsgegner im schwarzen Mantel und mit derben Gesichtszügen, ein Bäckerssohn aus Berg am Starnberger See, Arbeiter in einer Münchner Keksfabrik, seit einigen Wochen erfolgreicher Schwarzhändler, der Gedichte schrieb und Literaturkritiken für die »Münchner Neuesten Nachrichten«, steht jetzt auch gebannt vor Eisner und hört ihm zu. Es ist Oskar Maria Graf. Er ist mit seinem Freund da, dem Maler Georg Schrimpf, der das Titelbild zu Grafs erstem Gedichtband »Die Revolutionäre« gemacht hat. »Spruch« heißt ein kurzer Text darin:
»Manchmal kommt es, daß wir Mörder sein müssen,
denn Demut hat uns alle nur geschändet
und Zeit zerfloß uns, von zu vieler Müdigkeit umwölbt.
Qualhart und fronüberbürdet
Knirscht der Söldling des Geschicks
Und wirft sich blind in die strömende Flut
läuternden Triebs
um als wachwunder Büßer wieder aufzustehn,
wissend um seine endliche Sendung …«
Die beiden waren fast zwei Jahre lang bei den vorrevolutionären Montagstreffen im Gasthaus »Zum goldenen Anker« in der Ludwigvorstadt gewesen, wo Kurt Eisner regelmäßig gesprochen hatte. Daher kennen sie ihn, aus halber Ferne immerhin. »Herrgott, heut ist ja ganz München da«, sagt Graf, »da wär doch was zu machen! Hoffentlich gehen sie heut nicht wieder heim und tun nichts.« Ein bärtiger Hüne in Uniform hat das gehört, lächelt überlegen und sagt: »Nana, heut gehen wir net hoam … Heut geht’s ganz woandershin … Gleich wird’s losgehn.«
In diesem Moment schreien die Leute ringsumher »Frieden!«. Und »Hoch die Weltrevolution!«. Und »Hoch Eisner!«. Dann ist es für eine Minute still und von weiter oben, von der Bavaria, wo der beschwichtigende Auer spricht, dringt Beifall herüber. Eisners Vertrauter Felix Fechenbach, ein fünfundzwanzigjähriger Dichter mit weichem Gesicht und zartem Bart, ruft in die Menge: »Genossen! Unser Führer Kurt Eisner hat gesprochen. Es hat keinen Zweck mehr, viele Worte zu verlieren! Wer für die Revolution ist, uns nach! Mir nach! Marsch!«
Mit einem Schlag drängt die Masse voran, den Hang hinauf Richtung Westend. Weiter geht es, an Geschäften mit heruntergezogenen Läden vorbei, in Richtung Kasernen. Graf und sein Freund Georg, den alle Schorsch nennen, marschieren beinahe an der Spitze des Zuges, nur fünf Schritte von Eisner entfernt. Graf wird ihren plötzlichen Anführer später so beschreiben: »Er war blaß und schaute todernst drein; nichts redete er. Fast sah es aus, als hätte ihn das jähe Ereignis selbst überfallen. Ab und zu starrte er gerade vor sich hin, halb ängstlich und halb verstört. Arm in Arm mit dem breitschultrigen, wuchtig ausschreitenden blinden Bauernführer Gandorfer ging er. Diese Gestalt bewegte sich viel freier, derb auftretend, fest, und so eben, wie ein bayrischer Bauer dahingeht. Um die beiden herum war der Stoßtrupp der Getreuesten.«
Sie werden immer mehr. Die Schutzleute haben sich zurückgezogen, Fenster gehen auf, Menschen schauen heraus, stumm, neugierig. Die ersten Bewaffneten schließen sich an, die Stimmung ist munter, es ist, als gingen sie zu einem Fest. Einer erzählt, die Matrosen hätten die Residenz eingenommen, aufbrausender Jubel, die Stimmung steigt.
Wohin marschieren sie? Es scheint, der bleiche, entschlossene Führer folgt einem Plan. Zielstrebig geht es weiter stadtauswärts. Irgendwann steckt die Menge in einem dunklen Gang. Halt!, schreit es von vorn. Wo sind sie hier? Eine Schule?
Es ist die Guldeinschule, die in den letzten Jahren als Kriegskaserne genutzt wurde. Ein erster Schuss fällt, es droht Panik, einige stürmen in die Schule hinein, die meisten drängen wieder heraus. Einige Zeit später wird ein Fenster oben im Schulgebäude aufgerissen, einer schwenkt eine rote Fahne und schreit: »Die Mannschaft hat sich für die Revolution erklärt! Alles ist übergegangen! Weitergehen, marsch, marsch! Weiter!«
Das ist der Moment. Von jetzt geht alles wie von selbst. Immer mehr Soldaten schließen sich an, die Epauletten haben sie sich von den Schultern gerissen, rote Tücher umgebunden, eine neue Gemeinschaft formiert sich. Kinder begleiten johlend die Gruppe. Einmal kommt ihnen ein Soldat entgegen, der sein Rangabzeichen noch auf den Schultern trägt, ein Zahlmeister. Sie reißen ihm die Epauletten ab, schubsen ihn hin und her, ein Hüne will ihn sich greifen. Der Mann fängt an zu heulen und der bullige Oskar Maria Graf greift ein: »Laß ihn laufen! Der kann auch nichts dafür!« Der Hüne lässt sich mühsam beruhigen, gibt Graf murmelnd recht, aber sagt dann auch: »Aba, woaßt ös, gor a so menschli derf ma net sei!«
Es geht weiter von Kaserne zu Kaserne. Das Vorgehen ist immer gleich. Einige Männer gehen hinein, draußen warten Eisner und die anderen, irgendwann öffnet sich ein Fenster und eine rote Fahne weht heraus. Jubel auf der Straße, Warten auf die eigenen Leute und die, die sie mitbringen aus der Kaserne, und weiter geht es.
Nach einer Weile teilt sich die Gruppe. Es heißt, die Maximilian-II.-Kaserne an der Dachauer Straße werde Schwierigkeiten machen. Dort werde geschossen. Das treibt die Truppe um Oskar Maria Graf richtig an, sie eilen weiter. Als der Posten am Eingang die Männer erblickt, wirft er sein Gewehr weg und läuft davon. Die Revolutionäre gehen hinein, auf dem Kasernenhof hat ein Offizier eine kleine Truppe vor sich Aufstellung nehmen lassen und kommandiert Übungen, er steht mit dem Rücken zum Eingangstor. Er kommt nicht mal dazu, sich umzudrehen, einer schlägt ihm mit aller Gewalt auf den Kopf und treibt ihm den Helm bis tief unter die Ohren. Im selben Moment lassen die Soldaten ihre Waffen fallen und laufen zu den Revolutionären über. »Aus ist’s! Revolution! Marsch!«, rufen sie.
Es war turbulent, schnell, in all der Erschöpfung der Menschen eine plötzliche Energie. Mehr als vier Jahre hatte der verdammte Krieg gedauert. Er durfte nicht einfach nur vorbeigehen und die Menschen in dieser Dämmerung zurücklassen. Es musste, es musste aus dieser Dunkelheit etwas Helles, Neues entstehen.
Ein Älpler juchzte wie beim Schuhplatteln, ein Soldat am Rande der Menge rief in einer spontanen Rede zur Bildung von Soldatenräten auf. Die Menge eilte weiter, zum Militärgefängnis, Soldaten schlugen mit Beilen und Gewehren auf das verschlossene Tor ein, das schließlich wie von allein aufsprang. Graf erinnerte sich später: »Noch heute sehe ich, wie sich die Zellentüren öffnen und die Häftlinge herauskommen. Einer schaute uns groß und fremd an, zuckte und fing plötzlich herzzerreißend zu schluchzen an. Dann fiel er matt einem kleinen Mann an die Brust und klammerte sich an ihn. In einem fort heulte er: ›Da – ankschön! Dankschön! … Vergelt’s Gott, vergelt’s Gott!‹«
Zelle auf Zelle wird geöffnet. Die Gefangenen strömen heraus, schließen sich an, jetzt geht es endlich Richtung Innenstadt. Am Isartorplatz stürmt Graf in einen Friseursalon, wo Nanndl, seine Schwester, arbeitet, er ruft ihr zu: »Revolution! Revolution! Wir sind Sieger!« Sie strahlt, lässt die Brennschere fallen, da ist Graf schon wieder weg.
Die Gruppen teilen sich, am Rande des Weges werden immer wieder Reden gehalten, die Straßen der Münchner Altstadt werden zu eng. Wohin weiter? Wo wird die Republik ausgerufen?
Graf und Schorsch haben den Anschluss verloren. Sie gehen über die Isar, zum Franziskaner in der Au. Es heißt, Eisner werde hier später sprechen. Sie bestellen Wurst und Bier, bereit für Eisners revolutionäre Rede. Aber hier herrscht nur Gemütlichkeit. »Wally, an Schweinshaxn!«, ruft einer. Von Politik, von Räten, vom König, vom Krieg redet hier keiner. Nur Bier und Wurst und Tabak. Lässt sich hier niemand aus der Ruhe bringen? Was sind die Bayern doch für ein gemütliches Volk!
Als die zwei Revolutionäre satt und froh den Franziskaner verlassen und zurück Richtung Altstadt gehen, herrscht reges Treiben auf den Straßen. Jeder weiß ein Gerücht. Vor der Residenz spazieren Spaziergänger umher. Ist der König noch da? Werden sie ihn ein letztes Mal sehen? Werden sie dabei sein, wenn der letzte Wittelsbacher sein Stadtschloss verlässt, in dem die Familie 900 Jahre ununterbrochen regiert hat? Oskar Maria Graf genießt die neue Luft und die Möglichkeiten, die über der Stadt liegen, und vor allem das nahe Ende dieses langen, langen Krieges.
Währenddessen ist der große Trupp ins Mathäserbräu zwischen Hauptbahnhof und Stachus weitergezogen. Neun Uhr abends, auch hier Wurst und Bier und Schweinshaxn, aber keine Gemütlichkeit, sondern laute Emsigkeit, freudige Konzentration, Unglaube und Entschlossenheit. Ein Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat wird gewählt, Organe der Selbstverwaltung nach Vorbild der russischen »Sowjets«.
Der blinde Bauernführer Ludwig Gandorfer ist immer an Kurt Eisners Seite. Eisner will die Bauern unbedingt an der neuen Regierung beteiligen. Die Versorgungslage in München ist schon lange schwierig. Wenn die Bauern nicht auf der Seite der Revolution sind und die Menschen hungern, dann ist die Revolution schon nach wenigen Tagen am Ende.
Draußen vor dem Mathäserbräu fahren Laster mit Gewehren und Munition an und ab. Soldaten und Arbeiter kommen hinzu, werden bewaffnet und vom Revolutionsrat in kleinen Gruppen zu den öffentlichen Gebäuden der Stadt geschickt, um sie zu besetzen.
Ministerien, Hauptbahnhof, Generalkommando, ein Ort nach dem anderen fällt in die Hand der Revolutionäre. Männer mit roten Binden eilen durch die Stadt. München soll rot werden, rot und neu und friedlich und frei.
Im Palais der Wittelsbacher, dem Wohnsitz von Ludwig III. und seiner Familie, herrscht Chaos, Auflösung, Entsetzen, Fassungslosigkeit. Wo ist die Residenzwache? Aufgelöst. Wo sind die königlichen Truppen, die den Spuk da draußen beenden? Ministerpräsident von Dandl und Innenminister von Brettreich erstatten dem König Bericht. Nein, das sei nicht vorherzusehen gewesen. Ja, der Führer der Sozialdemokraten, der Auer, habe ihnen versichert, dass es zu keiner Revolution kommen würde. Nein, da sei jetzt nichts mehr zu machen und das Beste werde sein, der König und seine Familie verlassen sofort die Stadt.
Es geht jetzt rasend schnell. Die Königin ist krank, Fieber, eben noch war der Leibarzt bei ihr. Hilft ja alles nichts. Wohin sollen sie fliehen? Die Wahl fällt auf Schloss Wildenwart in der Nähe des Chiemsees. Aber wie dahin gelangen? Der erste Chauffeur ist zu den Revolutionären übergelaufen. Der zweite ist bei seiner kranken Frau. Er wird herbeigerufen. Die kranke Königin erfährt am Toilettentisch von der bevorstehenden Flucht. Der König lässt sich von einem alten Garderobier in seinen grauen, mit Opossumfell gefütterten Jägermantel helfen, nimmt eine Schachtel Zigarren unter den Arm und ist reisefertig. Dazu kommen die Prinzessinnen Helmtrud, Hildegard, Gundelinde und Wiltrud, die Königin, zwei Hofchargen, eine Baronin und die Kammerfrau. Im Schutz der Dunkelheit verlässt die kleine königliche Gruppe heimlich die Stadt.
Kurt Eisner und seine Getreuen haben das Mathäserbräu inzwischen verlassen und machen sich auf den Weg in Richtung Landtag in der Prannerstraße. Der Nachtportier des verwinkelten Gebäudes stellt sich ihnen mit einem großen Schlüsselbund in der Hand in den Weg. Nein, er lasse hier jetzt niemanden rein, mitten in der Nacht, und die Schlüssel behalte er selbst. Da tritt ein Arbeiter vor und klopft ihm auf die Schulter: »Mensch, mach doch kein Theater! Weißt du denn noch nicht, wie viel die Uhr geschlagen hat?« Der verwirrte Portier blickt auf seine Uhr, um nachzuschauen, da wird der Arbeiter ungeduldig, sagt, nein, er wolle nicht die Uhrzeit wissen, er sei ja ganz schön vertrottelt, der Herr Portier, und nimmt ihm den Schlüsselbund aus der Hand.
Der Schlüsselwächter bleibt konsterniert zurück, die kleine revolutionäre Truppe macht sich auf in Richtung Sitzungssaal, der Arbeiter probiert ein paar Schlüssel, findet endlich den richtigen und sie gehen hinein, Eisner direkt und zielstrebig und mit völliger Selbstverständlichkeit auf die Präsidententribüne hinauf. Neben ihm Felix Fechenbach und der Dramatiker und Journalist Wilhelm Herzog, Ehemann der gefeierten Filmdiva Erna Morena und vor wenigen Momenten von Eisner als Pressereferent der neuen Regierung eingesetzt.
Eisner lässt sich auf den Präsidentenstuhl fallen, Fechenbach und Herzog direkt neben ihn auf die Stühle der Schriftführer. Arbeiter und Arbeiterinnen strömen in den Saal, einige Frauen mit roten Schirmen. »Es war ein pittoreskes Bild«, wird sich Herzog später erinnern. Der Lärm, die Aufregung, das Tuscheln, das Rufen, die Erwartung, der Unglaube, die Freude, das bayerische Parlament mitten in der Nacht.
Kurt Eisner blickt hinab auf all die Menschen. Er streicht sich die langen Haare zurück. Er ist aufgestanden, gleich wird er reden, wird sich zum provisorischen Ministerpräsidenten ausrufen und Bayern zum Freistaat erklären.
Aber einen Moment lang schaut er nur. Denkt er zurück? An seine Anfänge als Schriftsteller, sein erstes Buch über Friedrich Nietzsche, 1892, als erst wenige über diesen Mann und seine Philosophie geschrieben hatten? An seine Auseinandersetzung mit Nietzsches »Religion der Härte«, wie er es genannt hatte, der »aus Menschenhass Antisozialist« gewesen sei? Für ihn, Eisner, war dagegen damals schon der Sozialismus »ein klares, erreichbares Ziel«.
Er hatte beim Depeschenbüro Herold als Journalist gearbeitet, dann bei der »Frankfurter Zeitung« als Hilfskorrektor, damals aber schon vom Ehrgeiz nach Höherem getrieben. Er wollte Bücher rezensieren, Leitartikel schreiben, er bat um ein Gespräch bei Leopold Sonnemann, dem Gründer des renommierten Blattes. Ohne Erfolg.
Eisner ging zur »Hessischen Landeszeitung« nach Marburg, schrieb dort landesweit beachtete Texte, in denen er leichthändig über die wilhelminische Politik, das Junkertum und das Feudalsystem spottete. Als er Anfang 1897 einmal zu leichthändig gespottet hatte, kam er wegen Majestätsbeleidigung für neun Monate ins Gefängnis Plötzensee. In seinem Text hatte er geschrieben: »Mit einem Volk von freien, strengen und anspruchsvollen Richtern werden wir vielleicht selbst Könige werden.«
Dachte er jetzt an diese Zeilen, als er sich plötzlich auf dem Thron wiederfand? Oder an die Zeit nach seiner Haft? Er war direkt danach vom »Vorwärts« engagiert worden, der mächtigen sozialdemokratischen Parteizeitung. Er verantwortete die Sonntagsbeilage, schrieb Texte, die er selber »Sonntagsplaudereien« nannte. Privates und Politisches, über Familie und Partei.
Aber er hatte viele Feinde in der Parteizeitung, vor allem unter den Mächtigen und Funktionären. Rosa Luxemburg, Victor Adler, Karl Kautsky, Franz Mehring, sie nannten ihn einen Schwärmer, einen Verrückten, einen Fantasten, einen schöngeistigen Literaten. Als er einmal eine Rede August Bebels überschwänglich gelobt hatte, schrieb ihm Bebel, dass er sein Lob für übertrieben halte und ihn sein Enthusiasmus peinlich berühre. 1905 flog er beim »Vorwärts« raus.
Er schrieb dann für die »Fränkische Tagespost« und die »Münchner Post« und zog mit seiner Familie nach München. In den letzten Jahren war er immer öfter als öffentlicher Redner gegen den Krieg aufgetreten. Seine eigene Partei, die SPD, war Kriegspartei, sie hatte die Kriegskredite im Parlament bewilligt und Opposition dagegen galt auch in ihren Reihen als Vaterlandsverrat.
Dann, im April 1917, kam es zum Bruch. In Gotha gründete sich die neue Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, USPD. Hauptziele der neuen Partei: Beendigung des Krieges und Wiedergewinnung des Vertrauens der Internationalen. Kurt Eisner war auf dem Gründungsparteitag dabei gewesen, hatte immer wieder das Wort ergriffen und war eine der führenden Persönlichkeiten der neuen Antikriegspartei geworden.
Und jetzt war der Krieg tatsächlich vorbei! Endlich vorbei! War jetzt alles plötzlich Wirklichkeit geworden? War die Kunst Wirklichkeit geworden? Seine Träume von der Kunst, über die er in all seinen Theaterkritiken geschrieben hatte? Seine Rede damals in Berlin, als er über Beethovens neunte Symphonie sprach und sich erinnerte: »Am 18. März 1905 wurde zum Gedächtnis der Märzrevolution und Friedrich Schillers in einem Berliner Brauereisaal, mitten im Arbeiterviertel, Beethovens neunte Symphonie vor Proletariern aufgeführt. Zum ersten Mal wohl in der Geschichte. An die 3000 Menschen saßen dichtgedrängt im überfüllten, heißen Saal, lautlos, in tiefster Andacht, um Verständnis sich mühend.« Das Proletariat, so fuhr er fort, sei zu reif und stark geworden, als dass es sich in den großen künstlerischen Dingen weiter bevormunden ließe. »Überall strebt es nach dem Höchsten und greift nach den Sternen.« Und: »Aus dem Tiefsten quoll das erlöste Gefühl. Freude!«
Damals hatte er all seine Träume und Überzeugungen in diesen Text über Beethoven hineingelegt. Alles, wofür er kämpfen wollte. »Die Kunst ist nicht mehr Flucht aus und vor dem Leben, sondern das Leben selbst«, hatte er gerufen. Und am Ende seine Vision: »Wenn die Menschheit, durch den Kampf des proletarischen Sozialismus befreit und gereift, dereinst an dem Welthymnus der Neunten erzogen wird, wenn sie zum Katechismus ihrer Seele wird, dann erst ist Beethovens Kunst zur Heimat zurückgekehrt, aus der sie floh: zum Leben.«
Sein neues Buch, das er in der Zeit der Haft nach dem Streik in den Munitionsfabriken fertiggestellt und zum Druck vorbereitet hat, soll den Titel »Die Träume des Propheten« tragen. Ja, Kurt Eisner ist ein Träumer und ein Prophet. Und er hat auf diesen Moment im bayerischen Landtag ein Leben lang hingeschrieben und gekämpft.
Er muss sich sammeln. Er muss jetzt seine Rede halten. Fechenbach neben ihm ist etwas nervös. Eisner ist kein guter Redner. Er denkt zu viel nach und ist zu unstrukturiert, er verhaspelt sich zu oft, überrascht vom eigenen Pathos.
Aber dann fängt Kurt Eisner an zu reden, sicher, klar, deutlich, »mit einem so feurigem Temperament, daß die Wirkung seiner Worte auf allen Gesichtern zu lesen war«. Zwanzig Minuten redet er völlig frei. Auch die beiden Männer neben ihm auf den Schreibführer-Stühlen sind so gebannt vom Augenblick, dass sie nicht mitschreiben. Keiner schreibt mit. Die revolutionäre Rede Kurt Eisners, in der er Bayern zum Freistaat und sich selbst zum Regierungschef erklärte, ist nicht dokumentiert.
An einige Sätze erinnert sich Herzog später. So fing Eisner an: »Die Bayrische Revolution hat gesiegt. Sie hat den alten Plunder der Wittelsbacher Könige hinweggefegt.« Und dann übergibt er sich selbst die Macht: »Der, der in diesem Augenblick zu Ihnen spricht, setzt Ihr Einverständnis voraus, daß er als provisorischer Ministerpräsident fungiert.« Unten in den Bänken bricht Jubel aus. Eisner nimmt das als Bestätigung, er ist jetzt Ministerpräsident, er redet weiter, fordert alle zu Einigkeit und Friedlichkeit auf.
Als er geendet hat, lässt er sich auf den Präsidentenstuhl fallen. Dann winkt er Herzog heran und flüstert ihm ins Ohr: »Wir haben ja das Wichtigste vergessen. Die Proklamation. Entwerfen Sie bitte den Text. Aber schnell. Wir gehen dann in ein Nebenzimmer und sehen ihn zusammen durch.«
Während Wilhelm Herzog die Proklamation entwirft und Eisner versonnen auf sein Volk blickt, fährt weit draußen auf der Truderinger Landstraße die königliche Familie langsam in Richtung Rosenheim. Es ist nebelig, der Fahrer kann kaum die Straße erkennen, als der Wagen plötzlich vom Wege abkommt und in einem Kartoffelacker stecken bleibt. Alle Bemühungen, den Wagen wieder flottzukriegen, scheitern. Der König mit seinen Zigarren, seiner Frau und seinen Töchtern kommt nicht weiter. Der Fahrer macht sich zu Fuß auf den Weg, um Hilfe zu holen. Die königliche Familie bleibt allein in völliger Finsternis auf dem Acker zurück. Irgendwann kommt der Chauffeur mit einigen Soldaten, die in einem nahe gelegenen Bauernhof übernachtet hatten, und einigen Pferden zurück. Auch eine Petroleumlampe hat er dabei. Die kranke Bäuerin, die er auf dem Hof antraf, wollte sie ihm nicht geben, für zwanzig Mark konnte er sie ihr schließlich abkaufen. Die Pferde ziehen den Wagen aus dem Acker, er droht zunächst auf der anderen Straßenseite gleich wieder zu versinken, aber schließlich gelingt es doch. Vorsichtig und leise geht es weiter durch die Nacht.
Um vier Uhr am nächsten Morgen trifft die Familie in Wildenwart ein. Als Königsfamilie waren sie losgefahren, als Teil des Volkes kommen sie an.
»Die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt«, heißt es am Ende der Proklamation, die Wilhelm Herzog in einem Nebenzimmer des Sitzungssaals aufgesetzt hatte. Er war damit kurz vor Mitternacht zu Kurt Eisner geeilt, der hatte sie gelesen und, zur Überraschung Herzogs, weitgehend gut gefunden. Nur zwei, drei Sätze hatte er ändern wollen. Nun hieß es: hinaus damit, an die Telegrafenämter, in die Zeitungsredaktionen. Handschriftlich fügte Eisner noch hinzu: »Auf der 1. Seite (Titelseite) zu veröffentlichen.«
»Volksgenossen!«, so stand es in Riesenbuchstaben oben auf der Seite. »Um nach jahrelanger Vernichtung aufzubauen, hat das Volk die Macht der Zivil- und Militärbehörden gestürzt und die Regierung selbst in die Hand genommen. Die Bayerische Republik wird hierdurch proklamiert.«
Ob Eisner beim Blick auf das Grüppchen, das noch im Sitzungssaal ausharrte, selbst kurz Zweifel kamen, ob es sich hierbei nun wirklich um »das Volk« handelte? Vielleicht nicht. Das Glück war zu groß, die Möglichkeiten der Traumverwirklichung waren zu plötzlich und zu leicht zu ihm gelangt. Und es gab jetzt auch viel zu viel zu tun, um lange nachzudenken.
Da stürmt zum Beispiel der verantwortliche Hauptschriftleiter der »Münchner Neuesten Nachrichten«, der großen Münchner Tageszeitung, in den Landtag. Er wird nicht vorgelassen, ein Arbeiter bringt Eisner die Visitenkarte des aufgebrachten Mannes. »Reden Sie mit ihm«, sagt Eisner zu Wilhelm Herzog. »Und übrigens, wir haben ja noch gar keinen Mann für die Pressezensur. Das machen Sie natürlich auch ab sofort.« Und er schreibt auf ein Zettelchen den neuen Posten, den er sich für Herzog ausgedacht hat. Spontaner Dienstausweis für den Oberzensor der neuen Volksrepublik.
Gut, ja, Herzog ist einverstanden, er eilt zu dem tobenden Chefredakteur hinaus, der sprudelt hervor, der ganze Verlag und die Druckerei seien besetzt, es sei eine Katastrophe, wenn das so bliebe, könne das Blatt am nächsten Tag nicht oder nicht pünktlich erscheinen und das wäre das erste Mal seit der Gründung im Jahr 1848.
»Na ja«, sagt Herzog, »es hat seitdem ja auch keine Revolution gegeben in Bayern.« Außerdem sei das jetzt wirklich nicht so eine schreckliche Katastrophe, wenn die Leser einmal in ihrem Leben die Zeitung erst um neun oder zehn statt um sechs Uhr im Kasten hätten: »Dann merken die Leute immerhin, daß sich was geändert hat.«
Der Oberzensor bekommt Kopien der Proklamation ausgehändigt. Er reicht ein Exemplar an Hauptschriftleiter Müller weiter, trägt ihm auf, dies zu drucken, und sagt, sein Blatt könne wie gewohnt erscheinen.
Aber wie? Es ist doch immer noch alles von diesen ungehobelten Leuten mit den roten Binden besetzt. Als Müller in die Redaktionsräume und die Druckerei zurückkehrt, stellt er allerdings fest, dass schon wieder alles in geordneten Bahnen verläuft. Die Revolutionäre lassen das nächtliche Handwerk geschehen.
Doch wohin jetzt noch mit der Proklamation? Der diensthabende Redakteur an den Maschinen hat eine Idee. Auf der zweiten Seite ist doch bisher eine ganzseitige Anzeige. Er stoppt die Maschinen, setzt die bisherige Seite eins auf Seite zwei und auf Seite eins kommt, wie von der neuen Regierung befohlen, die Nachricht des Tages: »An die Bevölkerung Münchens!«, so fängt es an, schildert kurz die Ereignisse der Nacht aus der Sicht der Revolutionäre, dann steht da: »Bayern ist fortan ein Freistaat. Eine Volksregierung, die von dem Vertrauen der Massen getragen wird, soll unverzüglich eingesetzt werden.« Und weiter: »Eine neue Zeit hebt an! Bayern will Deutschland für den Völkerbund rüsten. Die demokratische und soziale Republik Bayern hat die moralische Kraft, für Deutschland einen Frieden zu erwirken, der es vor dem Schlimmsten bewahrt.«
Auch beschwichtigend und beruhigend soll dieser Text an die Bevölkerung wirken, man versichert, dass »strengste Ordnung« durch den Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat gesichert werde. »Die Sicherheit der Personen und des Eigentums wird verbürgt.« Es ist ein Aufruf an alle, an alle Menschen von München: »Arbeiter, Bürger Münchens! Vertraut dem Großen und Gewaltigen, das in diesen schicksalsschweren Tagen sich vorbereitet! Helft alle mit, daß sich die unvermeidliche Umwandlung rasch, leicht und friedlich vollzieht … Jedes Menschenleben soll heilig sein. Bewahrt die Ruhe und wirkt mit an dem Aufbau der neuen Welt!« Unterzeichnet von Kurt Eisner, in der Nacht zum 8. November 1918, im bayerischen Landtag.
Kurz zuvor, gegen Mitternacht, war der Führer der Sozialdemokraten Auer in Begleitung des Gewerkschaftssekretärs Schiefer bei Innenminister Brettreich erschienen. Der Minister hatte Auer zu sich gebeten. Hatte er von diesem nicht sein Wort bekommen, dass an diesem Tag keine revolutionäre Erhebung zu befürchten sei? Dass alles ruhig bleiben würde? Eine Kundgebung, eine Musik, und dann gehen alle schön und friedlich nach Hause? Hatte er ihn hintergangen? Hatte er seine Leute nicht im Griff?
Brettreich weiß eigentlich längst Bescheid. Auer hatte sein ruhiges, diszipliniertes Grüppchen ja in der Tat am Nachmittag zurück in die Stadt geführt und die Leute nach Hause geschickt. Kaum jemand an diesem Nachmittag hasste es so sehr, dass die Unabhängigen und die Kommunisten mit Eisner zu den Kasernen gezogen waren und sich dann wie in einer Bierhauskomödie im Mathäserbräu von einigen Kampf- und Trinkgenossen per Gebrüll und erhobenen Bierkrügen zu Regierungsverantwortlichen hatten wählen lassen.
Nun also: Drei hilflose Männer sehen sich an. Auer sagt, die Regierung hätte im Laufe des Tages Ordnung schaffen müssen. Brettreich sagt, er habe keinerlei Macht mehr über seine Leute. Auer sagt, eine Niederschlagung der Erhebung durch die Regierung müsse noch in dieser Nacht erfolgen. Am nächsten Tage werde die Arbeiterschaft selbst für Ordnung sorgen. Die Männer trennen sich. Es gibt nichts für sie zu tun. Die Ereignisse ereignen sich. Ohne sie.
Für die Revolutionäre bleibt noch viel zu tun in dieser Nacht.
Die Polizeidirektion zum Beispiel ist noch gar nicht in den Händen der Aufständischen. Eisner schickt Fechenbach los, der solle das regeln. Fechenbach regelt, er eilt zum Präsidium, es ist voller Polizisten, die in kleinen Gruppen herumstehen und die Ereignisse des letzten Tages und der Nacht besprechen. Seine rote Armbinde öffnet ihm alle Türen. Er geht von Büro zu Büro, bis er schließlich im Zimmer des Polizeipräsidenten Rudolf von Beckh angekommen ist. Der hat leitende Referenten seines Hauses zur Besprechung bei sich versammelt. Fechenbach erklärt, die Räte hätten soeben die provisorische Regierungsgewalt übernommen und würden ihn, den Polizeipräsidenten, beauftragen, bis zur Neuregelung den Sicherheitsdienst weiter zu leiten. Im Laufe der Nacht werde ihm ein Kontrollorgan beigegeben. Und jetzt sofort müsse er ihm, Fechenbach, eine Erklärung unterschreiben, dass er allen Anweisungen der Räte Folge leiste. Der Polizeipräsident bittet sich Bedenkzeit aus, völlige Stille im Raum, die Referenten sehen sich betreten an, dann ist er entschlossen, schreibt eine Verpflichtungserklärung auf einen Zettel und fügt hinzu: »Sofern ich dieser Verpflichtung nicht nachkommen kann, muß ich mir das Recht des Rücktritts vorbehalten. München, 8. November 1918, morgens 1 Uhr. K. Polizeipräsident von Beckh.«
Noch in derselben Nacht wird ihm der frühere Lagerarbeiter und Gewerkschaftssekretär und jetzige Soldatenrat Josef Staimer zur Kontrolle zur Seite gestellt, am nächsten Morgen wird dieser selbst zum Polizeipräsidenten ernannt werden.
In dieser sonderbaren Nacht geht scheinbar alles wie von selbst. Die Macht über das Land fällt Kurt Eisner und seinen Leuten einfach zu.
Wer ist das denn jetzt noch, der sich um zwei Uhr nachts im Landtag meldet und bis zum Ministerpräsidenten vordringt? Ein junger Artillerieoffizier, außer Atem, roter Kopf, bleibt vor Eisner stehen und sagt: »Stehe mit 800 Mann, 20 MG und ein paar Haubitzen in Schleißheim. Alles zu Ihrer Verfügung!« Darauf Eisner: »Flink! Schaffen Sie alles her und postieren Sie Ihre Leute mit den Geschützen vor dem Landtag.«
Auch dieses vergessene Problem also löst sich erst einmal wie von selbst. Die Truppen der Stadt waren ja seit den Mittagsstunden in kompletter Auflösung. Und auch wenn viele der Soldaten aufseiten der Revolutionäre standen oder zumindest keinesfalls aufseiten des alten Königs, so gab es doch keinen funktionierenden Truppenteil, über den die neue Regierung hätte bestimmen können. Die liefen oder saßen einfach alle irgendwo herum. In Bierkellern oder zu Hause. Für die ersten Tage hatte man jetzt also mit den Schleißheimern einen minimalen Schutz.
Und jetzt ist es drei Uhr in der Nacht. Der neue Herrscher von Bayern, der Theaterkritiker mit den wirren Haaren, der seine Weltsekunde so schnell erkannt und entschlossen ergriffen hatte, Kurt Eisner ist müde. Sein Freund Fechenbach hat in einem Fraktionszimmer im Landtag ein Sofa entdeckt. Er und Wilhelm Herzog raten dem Ministerpräsidenten ein wenig zu schlafen.
»Wo?«, fragt Eisner. »Wo früher die Herren Abgeordneten zu schlafen pflegten? Auf ihren Bänken?«
»Nein«, sagt Fechenbach. »Wir haben ein feines Hotelzimmer mit Ruhesofa für Sie. Dort legen Sie sich eine Stunde nieder.«
Er geleitet Eisner in das Fraktionszimmer hinüber. Während der Volkskönig sich erschöpft aufs Sofa fallen lässt, sagt er: »Ist es nicht etwas Wunderbares? Wir haben eine Revolution gemacht, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen! So etwas gab es noch nicht in der Geschichte.«
Draußen auf den Straßen Münchens war es längst still geworden. Vereinzelte Schüsse in der Nacht. Sternenhimmel. Ein Betrunkener torkelt allein durch die Straßen Schwabings. »Bewegung! Krach! Krach! Krach!«, kräht er im dunklen Mantel in die Nacht. »Be – wee – e-gung!« Hört ihn jemand?
Es ist Oskar Maria Graf, der da die Nacht beschallt. Er hatte am Abend den Anschluss an das Geschehen verloren, zum Mathäserbräu war er zu spät gekommen, dann war er zur Residenz weitergeeilt, ungefähr zu der Zeit, als der König das Schloss durch einen anderen Ausgang verließ.
Graf trifft dort auf den besten Kunden seines Schwarzmarktgeschäfts, Anthony van Hoboken, ein märchenhaft reicher Holländer, dem Graf in den letzten Wochen Rinderzunge, Wein, Butter und andere seltene Herrlichkeiten verkauft hatte, die er selbst von einem dubiosen Großhändler bezog. Hoboken – Graf nennt ihn nur den schafsgesichtigen Holländer – stammt aus einer Rotterdamer Bankiersfamilie, liebt die Literatur und noch mehr die Musik und am meisten liebt er private Feiern mit Künstlerinnen, Malern, trinkfreudigen, lebensfreudigen, originellen Dichtern. Nach erledigten Geschäften hatte er Graf mehrmals schon zum Bleiben und Trinken aufgefordert. Und Graf hatte getrunken. Immer.
Nun sehen sie sich aus der Ferne, grüßen sich, Graf ruft ihm zu: »Jetzt ist’s aus mit dieser schönen Herrlichkeit!« Er meint eigentlich den Holländer und dessen Geld und Pracht und schönes Leben. Der scheint aber selbst in bester Stimmung, scheint von der revolutionären Laune der Stadt aufs Prächtigste unterhalten, seine Geliebte, die ihn begleitet, ruft mit Jungmädchenstimme: »Ja, fabelhaft!«
Sie ist eine strahlende Person und nennt sich Marietta von Monaco. Eigentlich heißt sie Maria Kirndörfer, 25 Jahre alt, klein, zierlich, war in München bei Pflegeeltern aufgewachsen, hatte eine Klosterschule besucht, war als Vagabundin umhergewandert und 1913 durch Zufall im Schwabinger Kleinkunstlokal Simplicissimus als Vortragskünstlerin entdeckt worden. Im Krieg ging sie in die Schweiz, nach Zürich, gehörte zu den Gründern des Cabaret Voltaire. Damals stellte sie sich mit einem kleinen Text vor. »Wer bin ich?« nannte sie ihn:
»Ich bin ein bunter Spielball.
Feine Knaben lassen mich über seidne Teppiche tanzen.
Kinder bestaunen mich kosend.
Ich gleite durch die eleganten Finger wertvoller Menschen.
Manchmal aber kommen rohe Buben und stoßen Fußball.
Dann gleite ich unter ihren Schuhen in die Kristallschale der
Vornehmsten Königin.«
Seit einiger Zeit ist sie wieder in München, singt, deklamiert in Schwabings Künstlerlokalen, die nun alle Revolutionslokale sind, und gleitet jetzt durch die eleganten Finger dieses wertvollen Holländers. »Muse Schwabylons« nennen die Leute sie. Wer sie sieht, ist verzaubert.
Marietta und der Holländer also sind begeistert von den Geschehnissen der Nacht und Graf, der eben noch dachte, dass diese Revolution sich ja vor allem auch gegen Bonzen, Schmarotzer und Millionäre wenden würde, ist kurz überrascht. Wie sehr hatte er unter seiner Armut gelitten! Seit Juni war er auch Vater einer Tochter, unglücklich verheiratet mit Karoline Bretting, sehr unglücklich verheiratet, vom ersten Tag an. Vor allem aber hatte er unter der ständigen Abwesenheit von Geld gelitten, bis er diese Schwarzmarktidee gehabt hatte: »Geld war wirklich mit der Zeit für mich etwas geworden wie ein Dämon, der das Leben beherrschte. Es war ja alles Unsinn, was die Dichter und Philosophen daherredeten von Moral, von Ethik und Charakterfestigkeit, von Idealismus und weiß Gott was für guten Eigenschaften. Diese Eigenschaften waren letzten Endes alle untergeordnet – das Geld machte sie oder löschte sie aus. Der Mensch hatte da etwas erfunden, dem er sich mit der Zeit unweigerlich mit Haut und Haaren auslieferte«, schrieb er später.
Könnte diese Revolution nun diese teuflische Erfindung nicht einfach – abschaffen? Müsste das nicht unweigerlich geschehen? Warum aber war das Schafsgesicht mit seiner Muse Schwabylons so freudig erregt?
Doch Graf war es jetzt egal. Die Welt war ins Rutschen gekommen, endlich, eine neue Welt erschien, und er wollte jetzt einfach feiern. Er ging mit dem Holländer und Marietta nach Hause, sie tranken und tranken die ganze Nacht, in den Morgenstunden torkelte Graf nach Hause, die Straßen Schwabings waren leer und still, immer mal knallte ein Schuss durch die Nacht. Die Revolution schlief.
Als Graf zu Hause ist, schreibt er einen Brief an seine Frau: »Ich mag Dich nicht mehr! Ich hab’ Dich nie mögen! Es war alles bloß gelogenes Mitleid! Laß mich allein! Geht jeder seinen eigenen Weg!« Es war alles aufgebrochen, in der Stadt und in ihm, draußen war alles anders geworden, nun musste auch in ihm alles anders werden. Er liebt eine andere, »das Fräulein«, manchmal nennt er sie auch »das schwarze Fräulein«: Mirjam Sachs, schwarze Augen, weiches Gesicht, studiert in München, kam aus Berlin, eine Freundin des Dichters Rainer Maria Rilke. Mit ihr, mit dem schwarzen Fräulein, will Graf zusammenleben. Schluss mit Lügen, mit Mitleid, mit Kompromissen. Der Brief ist fertig, da schnellt er vom Tisch empor, es ist ja Wahnsinn, was er da schreibt. Er zerreißt das Papier, legt sich ins Bett und schläft ein, der letzte Revolutionär dieser Nacht. Betrunken. Verheiratet. Bereit für das neue Land. Das neue Leben.
Ein schmaler, zarter Mann mit großen Augen und großen Lippen hatte den Abend ganz anders verbracht. Mit einer jungen Frau, die sich Elya nannte, Elya wie die Königstochter aus dem alten Augsburger Georgsspiel, als die sie vor einigen Wochen auf der Bühne gestanden hatte. Er hatte sie dort gesehen. »Rilke ist da«, hatte ihr Partner ihr noch auf der Bühne zugeflüstert. Und am nächsten Tag: »Rilke ist wieder da.« Und am Tag der letzten Vorstellung: »Rilke will nach der Vorstellung auf die Bühne kommen. Er möchte Sie kennenlernen.«
Er war dann aber doch nicht gekommen und sie hatte ihm einen Brief geschrieben, ihm, dessen Gedichte sie auswendig wusste, die ihr ein Leben gewesen waren. Sie kannte ihn lange schon in seinen Texten, war ihm vertraut, ohne ihm je begegnet zu sein: »Rainer Maria«, schrieb sie, »einmal liebte ich Deine Seele, fast so wie man Gott liebt. Das war, als ich das Stundenbuch zum ersten Mal erlebte.« Und sie schloss: »Kann es nicht einmal eine Seele größer leben, dieses alltägliche, niederziehende Leben – größer und innerlicher.«
Rilke antwortete sogleich, lud sie in seine Wohnung im vierten Stock in der Ainmillerstraße in Schwabing, las ihr vor, schwieg mit ihr. In ihren Briefen redete sie ihn, seine Gedichte zitierend, mit »Gott, Du bist groß« und »Du Unsterblicher« an. Er wünschte sich: »Wenn ich an Dich denke, seh ich uns, wie in einem Traume nebeneinander knien, und das wird wohl auch unsere Haltung sein zueinander. Wann kommst Du wieder zu mir?«
Rilke kniete gern mit seinen Verehrerinnen, seinen Freundinnen, seinen Geliebten. Voller Bewunderung vor einem Kunstwerk, einem Altar, bis beiden die Tränen kamen.
Der Dichter Rainer Maria Rilke war im Krieg beinahe verstummt. Spätestens nachdem er Anfang 1916 selbst zum Militärdienst nach Wien eingezogen worden war, hatte er fast nicht mehr gedichtet. Obwohl er durch die Intervention einflussreicher Freunde schon nach einem halben Jahr wieder freigestellt worden war, hatte der militärische Drill diesen schmalen, beinahe durchsichtigen Mann tief erschüttert.
Er lebte danach als Gast reicher Freunde auf der Herreninsel im Chiemsee, dann auch einige Monate in Berlin, er war finanziell abhängig von adeligen Damen und Industriellen-Gattinnen. Wenn er in Berlin war, trafen sich auch die Ehemänner dieser Damen mit ihm: Detlev Graf von Moltke, Flügeladjutant des Kaisers, Richard von Kühlmann, Staatssekretär des Äußeren, der kurz darauf, Anfang 1918, mit dem revolutionären Russland den Frieden von Brest-Litowsk verhandeln wird, AEG-Chef Walther Rathenau, später Außenminister der Weimarer Republik. Das Establishment des Kaiserreichs traf sich mit dem Autor des »Stundenbuchs«, der »Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge«, weil seine Frauen ihn liebten, weil er ein wahrhaft Unabhängiger war, ein Zuhörer, ein Schweiger, ein integrer Mann, dem die Herren der Macht vertrauten.