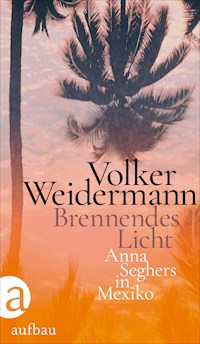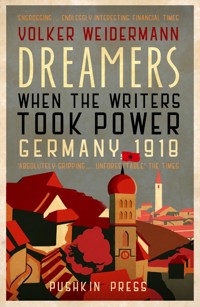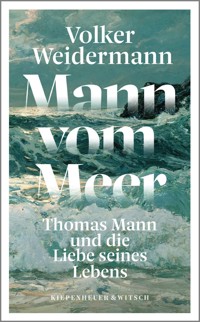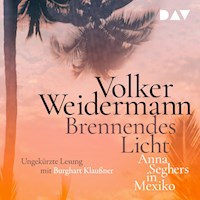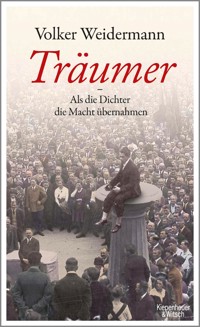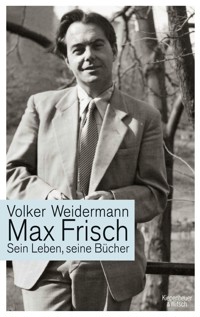18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Dichter und sein Kritiker – eine wechselvolle Fehde und ein großes Stück deutscher Geschichte. Die »Zwangsehe«, wie Günter Grass sie einmal nannte, wurde offiziell am 1. Januar 1960 geschlossen: An diesem Tag besprach der damals 39-jährige Kritiker Marcel Reich-Ranicki »Die Blechtrommel« des gerade 32-jährigen Autors. Er verriss den Roman. Und so begann das wechselhafte, von Rivalität wie Respekt getragene Verhältnis der beiden herausragenden Protagonisten der deutschen Nachkriegsliteratur. 1958 waren sie sich schon einmal im Warschauer Hotel Bristol begegnet – und hatten beide bereits ein Leben hinter sich: Der eine war bei der Waffen-SS gewesen, der andere Überlebender des Warschauer Ghettos. Doch beide einte ihre große Liebe zur deutschen Literatur und ihr unbedingter Wille, ihr weiteres Leben dieser Literatur zu widmen. Und so lagen über ein halbes Jahrhundert der Auseinandersetzungen, zahlreiche Romane und Verrisse, Liebeserklärungen und Wut vor ihnen. Volker Weidermann erzählt so farbig wie schillernd von der wechselseitigen Abhängigkeit von »MRR« und »GG«, von Streit und Nähe, Empörung und Entspannung. Davon, wie auf den großen Eklat 1995, als Reich-Ranicki auf dem berühmt gewordenen Titelbild des Spiegels »Das weite Feld« von Grass buchstäblich zerreißt, 2003 ein versöhnliches Treffen folgt. Zugleich aber weitet Weidermann seine fulminante Doppelbiografie der beiden Könige der deutschen Nachkriegsliteratur zu einem grandiosen Panorama, in dem sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts spiegelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Volker Weidermann
Das Duell
Die Geschichte von Günter Grass und Marcel Reich-Ranicki
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Volker Weidermann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Volker Weidermann
Volker Weidermann, geboren 1969 in Darmstadt, studierte Politikwissenschaft und Germanistik in Heidelberg und Berlin. Er war Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, ist seit 2015 Autor beim SPIEGEL und Gastgeber des »Literarischen Quartetts« im ZDF. Zuletzt erschien von ihm »Ostende. 1936, Sommer der Freundschaft« und »Träumer. Als die Dichter die Macht übernahmen« über die Münchner Räterepublik.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die »Zwangsehe«, wie Günter Grass sie einmal nannte, wurde offiziell am 1. Januar 1960 geschlossen: An diesem Tag besprach der damals 39-jährige Kritiker Marcel Reich-Ranicki »Die Blechtrommel« des gerade 32-jährigen Autors. Er verriss den Roman. Und so begann das wechselhafte, von Rivalität wie Respekt getragene Verhältnis der beiden herausragenden Protagonisten der deutschen Nachkriegsliteratur.
1958 waren sie sich schon einmal im Warschauer Hotel Bristol begegnet – und hatten beide bereits ein Leben hinter sich: Der eine war bei der Waffen-SS gewesen, der andere Überlebender des Warschauer Ghettos. Doch beide einte ihre große Liebe zur deutschen Literatur und ihr unbedingter Wille, ihr weiteres Leben dieser Literatur zu widmen. Und so lagen über ein halbes Jahrhundert der Auseinandersetzungen, zahlreiche Romane und Verrisse, Liebeserklärungen und Wut vor ihnen.
Volker Weidermann erzählt so farbig wie schillernd von der wechselseitigen Abhängigkeit von »MRR« und »GG«, von Streit und Nähe, Empörung und Entspannung. Davon, wie auf den großen Eklat 1995, als Reich-Ranicki auf dem berühmt gewordenen Titelbild des Spiegels »Das weite Feld« von Grass buchstäblich zerreißt, 2003 ein versöhnliches Treffen folgt. Zugleich aber weitet Weidermann seine fulminante Doppelbiografie der beiden Könige der deutschen Nachkriegsliteratur zu einem grandiosen Panorama, in dem sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts spiegelt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2019, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Givaga / stock.adobe.com; © picture alliance / dpa / Frank Kleefeld
ISBN978-3-462-31768-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Peer Gynt in Włocławek
Peer Gynt in Danzig
Im Traumland
Hoffentlich dauert es lange
Der Übersetzer
Das doppelte S
Im Keller
Frei wozu? Frei wohin?
Die Freiheit heißt Paris
Die Freiheit heißt London
Hotel Bristol
Wiedersehen in Deutschland
Blitzruhm für beide
Die Blutsbrüder von der Weichsel
Kämpfen für Willy
Zwei Boxer im Ring
Die geliehene Geschichte
»Mein Freund Zweifel«
Von der Einsamkeit
Vom langsamen Wachsen einer Feindschaft
Selbstmord oder Gegenschlag
Nobelpreise
Zwei Buchen
Nachwort
Danke
Bibliografie
Günter Grass
Marcel Reich-Ranicki
Zwei lachende alte Herren in Lübeck unter einer niedrigen Holzbalkendecke. »Welch Glanz in meiner Hütte«, hatte der Mann mit dem vollen Haar und der Pfeife in der Hand zur Begrüßung gesagt. Es hatte etwas ironisch geklungen, aber auch herzlich, etwas distanziert und doch melancholisch und bewegt. Der andere, mit der großen Brille und dem Haarkranz um die Glatze, hatte gelacht und »Mein Lieber« gesagt.
Es ist der Sommer des Jahres 2003. Sie kennen sich schon lange, beinahe fünfzig Jahre lang. Als sie sich das erste Mal trafen, 1958 im Grandhotel Bristol in Warschau, hatten sie schon ein ganzes Leben hinter sich. Aber ihre gemeinsame Geschichte, ihr Ruhm, die Romane, die Verrisse, die Liebeserklärungen, die Tränen und die Wut, ihr Leben als untrennbares Paar der deutschen Literatur – das lag alles noch vor ihnen. Der SS-Mann und der Jude. Der Dichter und sein Kritiker. Die beiden Deutschen aus Polen. Verstrickt in eine lebenslange Liebesgeschichte mit der Literatur.
Neun Jahre hatten sie sich jetzt wieder nicht gesehen. Der letzte Angriff des Kritikers war zu viel für den Dichter gewesen. Aber es half ja nichts. »Es gibt Ehen, die werden auf keinem Standesamt besiegelt und auch von keinem Scheidungsrichter getrennt«, hatte der Schriftsteller geschrieben. »Ich werde ihn nicht los, er wird mich nicht los.«
So ist es. Sie wissen es beide. Jetzt stehen sie sich hier in Lübeck gegenüber. Der Schriftsteller Günter Grass und der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. »So hängen wir aneinander und tragen uns unsere Zerwürfnisse nach«, wird Grass später über dieses Treffen schreiben. Und bedauernd hinzufügen: »Ich hätte ihn umarmen sollen.« Als Marcel Reich-Ranicki das später liest, wird er ausrufen: »Wissen Sie was? Grass hat recht. Wir hätten einander wirklich umarmen sollen.«
Doch es ist zu spät. Es wird ihr letztes Treffen bleiben.
Peer Gynt in Włocławek
Marcel Reich. 1920–1929
Ein kleiner Junge lehnt im weißen, kurzen Hosenanzug mit Frotteegürtel, in weißer Strumpfhose und schwarzen Schnallenschühchen an der Rückenlehne eines Jugendstil-Sofas. Die linke Hand auf die goldenen Holzblümchen neben sich gestützt. Etwas pausbäckig, leicht schiefer Pony. Er schaut fragend. Nicht streng, eher ein wenig verwundert. Es ist das Jahr 1922 oder 1923, wir sind in einem Fotoatelier in Włocławek an der Weichsel.
Der andere ist noch viel kleiner. Er liegt auf einem Schafsfell nackt auf dem Bauch, vor sich ein weißes Kätzchen drapiert, das ihn aber nicht zu interessieren scheint. Er wirkt ein wenig beleidigt. Als wenn er gleich weinen möchte. Auf jeden Fall will er wohl nicht auf diesem Fell liegen. Im Hintergrund verschwommene Blumen auf einer Fototapete, sie sehen aus wie Palmen am Strand. Das Bild ist in Danzig-Langfuhr aufgenommen worden, gut 220 Kilometer nördlich von Włocławek und gut vier Jahre nach der Aufnahme des staunenden Jungen mit dem Frotteegürtel.
Bleiben wir also erst einmal bei dem Älteren, dem Frotteeknaben. Er ist ein Muttersöhnchen und ein Nachzügler. Seine beiden Geschwister sind viel größer als er, die Schwester Gerda ist dreizehn, der Bruder Herbert neun Jahre älter. Er heißt Marcel und ist am 2. Juni 1920 auf die Welt gekommen. Seinen Namen hat wahrscheinlich das katholische Dienstmädchen vorgeschlagen, denn der katholische Heiligenkalender gedenkt an jedem 2. Juni des heiligen Marcellus, einem Märtyrer aus der Zeit des römischen Kaisers Diokletian. Dem kleinen Jungen war der Name recht, denn während seine Schwester Gerda aufgrund ihres deutsch klingenden Namens die ganze Schulzeit über gehänselt wurde, kam er mit Marcel eigentlich ganz gut durch.
Włocławek gehörte bis 1918 zu Russland. Inzwischen liegt das Städtchen im Herzen der Zweiten Polnischen Republik. Doch 1920, im Sommer von Marcels Geburt, droht es mit dieser schon wieder zu Ende zu gehen. Sowjetische Armeen sind nach Polen eingedrungen, stehen wenige Kilometer vor Warschau und auch hier, in Włocławek. Marcel Reich ist wenige Monate alt, als er mit seiner Familie zum ersten Mal flieht. Sie fahren mit dem Dampfer die Weichsel hinauf, bis nach Płock, der Geburtsstadt von Marcels Vater.
Hier warten sie ab. Hier hören sie vom »Wunder an der Weichsel«: Die polnische Armee hat die Russen zurückgeschlagen. Im Spätsommer 1920 kehren sie zurück in ihre Stadt an der Weichsel. Die eindrucksvolle Brücke von Włocławek war von der polnischen Armee gesprengt worden und lag nun wie ein riesiges Eisenkrokodil im Wasser.
Eine umkämpfte Stadt. Seit Napoleons Zeiten hatte sie zum russischen Zarenreich gehört, im November 1914 geriet sie nach der Schlacht von Włocławek unter deutsche Besatzung. Alle Verbindungen nach Russland wurden gekappt. Marcels Vater David Reich, Teilhaber einer Firma, die für die Straßenbeleuchtung der Stadt verantwortlich war, stand kurz vor dem Bankrott, weil keiner für die Beleuchtung zahlen wollte. Die Russen nicht, die Deutschen nicht. Nach langem Prozess kam schließlich die deutsche Stadtverwaltung für die Beleuchtung auf.
Aber das Geschäftsglück des Mannes war nur von kurzer Dauer. Nach dem Krieg gründete er eine Baufirma. Leider baute beinahe niemand, und das Geschäft lief schlecht. David Reich, randlose Brille, schmaler Schnurrbart, Rundglatze, war ein musikalischer Mann ohne Geschäftssinn und ohne Durchsetzungskraft. Sein Vater war ein erfolgreicher Kaufmann gewesen, er besaß ein großes Mietshaus und ein kleines Vermögen. Der Sohn durfte in der Schweiz studieren, um auch Kaufmann zu werden, doch er brach sein Studium ab und kehrte zurück nach Hause. 1906 heiratete er Helene Auerbach, Tochter eines armen Rabbiners, die im Grenzgebiet zwischen Schlesien und der Provinz Posen in Deutschland aufgewachsen war und die nichts so sehr liebte wie die deutsche Kultur und Literatur. Hier in Polen, in Włocławek, wohin ihr Mann sie geführt hatte, fühlte sie sich wie in der Verbannung. Sie sprach schlecht Polnisch, stattdessen ein schönes, melodisches Deutsch. Sie war verträumt und entschlossen zugleich. Und sie verachtete ihren Mann. Wenn er Särge produzieren würde, würden die Menschen aufhören zu sterben, klagte sie.
Ihr Geburtstag war der 28. August. Und wann immer in seinem späteren Leben ihr Sohn Marcel ihr gratulierte, fragte sie ihn, wer heute noch Geburtstag habe. Es war ein festes Ritual zwischen den beiden. Für sie war dieses Datum Symbol ihrer Sehnsucht und ihres verfehlten Lebens. Die erwünschte Antwort lautete: »Goethe«. Die Mutter und Goethe. Geburtstagszwillinge.
Włocławek war eine freundliche, etwas verschlafene Stadt. Knapp 40000 Einwohner, die meisten polnische Katholiken, 9000 Juden und 800 Deutsche. Die Reichs lebten in einer Wohnung in der Piekarska-Straße 4.
Einmal wollte auch der Vater in die Erziehung des kleinen Sohnes eingreifen. Er hatte einen Mann mit langen Schläfenlocken und Kaftan ins Haus geholt, einen orthodoxen Juden, der Marcel Hebräisch beibringen sollte. Die Mutter warf ihn raus. Der Junge sei noch zu klein dafür, behauptete sie. Es blieb David Reichs einziger Versuch, die Erziehung des Sohnes in eine von ihm gewünschte Richtung zu lenken.
Dabei stammte ja eigentlich die Mutter aus einem religiösen Elternhaus. Nicht nur ihr Vater, auch ihr Großvater und die Väter vieler Generationen zuvor waren Rabbiner gewesen. Aber Helene Reich wollte hinaus aus dieser Welt. Sie wollte von Religion grundsätzlich nichts wissen. Es war ihr Protest gegen das rückständige, provinzielle Elternhaus.
Also raus mit dem Rabbiner! Hinein mit dem Jungen in die deutschsprachige evangelische Grundschule. Zu Hause wurde meist polnisch gesprochen. Nur wenn die Eltern wollten, dass die Kinder sie nicht verstehen, sprachen sie deutsch miteinander. Marcels Muttersprache war also Polnisch. Aber er lernte auch das Deutsche schnell. Ein Kinderfräulein brachte ihm das Lesen bei, das Lesen deutscher Bücher. Und als die Mutter mit dem Sohn zur Einschulung ging, durfte sie sich aussuchen, ob sie den Sohn gleich in die zweite Klasse schicken wollte. Das wollte die ehrgeizige Mutter unbedingt. Und so fühlte sich Marcel Reich sogleich als Außenseiter, weil er auch in der zweiten Klasse der Einzige war, der schon Bücher las und davon gern und stolz berichtete.
Marcel Reich war zu Hause umgeben von Kultur, umgeben vor allem von Musik. Er liebte das Grammofon, liebte die Platten seines Vaters, er hörte Edvard Griegs »Peer Gynt«, Rimksij-Korsakows »Scheherazade«, Opern wie »Aida«, »Tosca«, »Madame Butterfly« von Verdi und Puccini und »Lohengrin« von Richard Wagner. Er lebte in diesen Jahren vor allem in der Musik. Das war die Vater-Welt. David Reich liebte Musik, liebte die Opern, träumte sich fort aus der Geschäftswelt.
Die Mutter lebte in Büchern. Sie bekam regelmäßig deutsche Neuerscheinungen aus Berlin zugeschickt, las sie sofort und stellte sie anschließend in ihren Bücherschrank. Marcel las »Oliver Twist« und »Robinson Crusoe« und versenkte sich mit Leidenschaft in ein mehrbändiges deutsches Konversationslexikon. Regelmäßig kam seine Deutschlehrerin zu Besuch, eine junge Frau aus Deutschland, Laura, die sich die neuesten deutschen Bücher lieh, wenn die Mutter sie ausgelesen hatte. Marcel fiel an der Besucherin vor allem ihr großer Busen auf – und dass sie um die Zeit des Jahreswechsels 1928/29 besonders häufig zu ihnen nach Hause kam, weil sie auf einen neuen Roman mit besonders großer Ungeduld wartete, der in Deutschland Furore machte und umkämpft war wie kaum ein Buch zuvor: Erich Maria Remarques »Im Westen nichts Neues«.
Die Mutter hatte währenddessen andere Sorgen. Die Firma ihres Mannes war bankrott. Da ließ sich nichts mehr beschönigen, nichts mit Musik übertönen, mit Literatur wegfantasieren. An viele Tränen wird sich der Sohn später erinnern – und daran, dass sich die Mutter nicht mehr auf die Straße traute. In der abgeschiedenen polnischen Provinz, unter Menschen, denen sie sich fremd und überlegen fühlte – und jetzt diese Schande. Kein Geld, kein Geschäft und ein jämmerlicher Mann, der keine Kraft, keine Lust, keine Möglichkeiten zu haben schien, sich dem Untergang zu widersetzen.
Helene Reich allerdings auch nicht. Sie war nicht geschäftstüchtiger als ihr Mann. Aber sie hatte Brüder mit Geld und übernahm die Initiative. Es war demütigend, peinlich und unangenehm, aber es musste sein. Vier ihrer fünf Brüder waren Anwälte in Berlin, der Älteste war, wie die Vorväter, Rabbiner geworden. Den Reichsten von allen, Bruder Jacob, bat sie telegrafisch um Geld. Er schickte die gewünschte Summe sofort.
Aber Geld allein würde die Familie Reich in Włocławek an der Weichsel auf Dauer nicht retten. Und Helene erkannte ihre Chance, das Familienunglück in eine Art Glück zu verwandeln. In Polen war für sie alles verloren. Es war Zeit für ihr Traumland, für ihre Traumstadt. Zeit für Deutschland, Zeit für Berlin. Der neunjährige Sohn wurde vorausgeschickt, ganz allein im Zug in das fremde Land. Ein kleiner Peer Gynt, dessen Vater alles verloren hatte und dessen Mutter in Fantasievorstellungen einer besseren Welt lebte. Die Fantasien der Mutter waren auch die Fantasien des Sohnes. Laura mit dem großen Busen und der Liebe zu den deutschen Büchern sagte ihm zum Abschied: »Du fährst, mein Sohn, in das Land der Kultur.«
Marcel wusste, dass sie recht hatte. Und Marcel fuhr.
Peer Gynt in Danzig
Günter Grass. 1927–1939
Inzwischen hatte man dem nackten Bürschchen auf dem Schafsfell in Danzig-Langfuhr längst etwas angezogen. Am 16. Oktober 1927 war Günter Grass in Danzig auf die Welt gekommen. Im Frühjahr 1929, als der neunjährige Marcel Reich im Zug nach Deutschland sitzt, ist er also anderthalb.
Auch seine Mutter heißt Helene, liebt Bücher und nennt ihren Sohn »meinen kleinen Peer Gynt«. Ihre Familie sind Kaschuben, ein »Dazwischenvolk«, nie polnisch genug, nie deutsch genug, ursprünglich aus dem Umland von Danzig, der Kaschubei. Sie sprechen Kaschubisch, ein breites, warmes, baltisch gefärbtes Plattdeutsch. Aber schon die Vorfahren von Helene Grass waren Stadtkaschuben, angepasst an die deutsche Bevölkerung von Danzig. Vater Willy Grass ist Deutscher, Danziger, seit Generationen.
Seit 1920 ist Danzig eine Freie Stadt. Nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg wurde die alte Hafenstadt mit den vielen Giebelhäusern, die seit 1815 zu Preußen gehört hatte, aus dem Deutschen Reich herausgetrennt und in die Freiheit entlassen. Freie Stadt, umgeben von Polen, dem nach wie vor zu Deutschland gehörenden Ostpreußen und der Ostsee. Der Widerstand der zum großen Teil deutschen Bevölkerung gegen den Beschluss des Völkerbundes war enorm gewesen. Frankreich hatte in den Friedensverhandlungen eigentlich durchsetzen wollen, dass Danzig an Polen fiel, um der neuen polnischen Republik den versprochenen freien Zugang zum Meer zu gewährleisten, doch schließlich setzte sich der britische Premierminister David Lloyd George mit seinem Vorschlag durch, Danzig zu einem kleinen übernationalen Modellstaat zwischen ehemals verfeindeten Völkern zu machen.
Die Familie Grass betreibt einen kleinen Kolonialwarenladen in Langfuhr, einem Vorort von Danzig mit kleinen Gassen und spitzgiebeligen Häusern. Willys Vater Friedrich hat eine Tischlerei ein paar Straßen weiter, die Wohnung der Familie Grass, die wie das Geschäft im Erdgeschoss liegt, ist winzig: zwei Zimmer, Außenklo, Außenbad. Günter Grass wird sich zeitlebens vor allem an den »Mief« erinnern, den »Mief« der Kleinbürger, den »Mief« der Enge. Als Helene mit ihm schwanger war, hat ihr ein Freund der Familie, den er Onkel Max nennt, stets von Berlin vorgeschwärmt, den Tiller-Girls, dem Wintergarten, dem Admiralspalast, der großen Welt: »Unbedingt müsst ihr mal in Berlin vorbeischauen. Da ist immer was los!«
Mal vorbeischauen – Berlin ist mehr als 500 Kilometer entfernt. Die Ausflüge der Familie gingen natürlich an die Ostsee, nach Zoppot oder ins Strandbad Brösen gegenüber der Westerplatte. Da sitzt der kleine Günter im Frühjahr 1928 mit der Familie im Sand, prüft mit beiden Händen seine Strandschühchen, hockt zwischen den Beinen der Mutter Helene, gemusterter Strandpulli, Rock, nackte Beine; daneben ihr Mann Willy, mit Fliege, weißem Hemd, Weste, Strümpfen, Schuhen, Zigarette in der rechten Hand, Haar an der Seite rasiert. Neben ihm Günters Großvater Friedrich, der Tischler, großer Schnurrbart, Weste, selbstbewusst im Mittelpunkt, daneben seine Frau Mathilde, die kleine Enkelin im Arm, Tochter der Schwester von Willy; vorne ihr Mann, dunkle Weste, Uhrenkette über die Brust, und eine weitere kleine Tochter, die im Sand buddelt.
Familie Grass an der Ostsee: jovial die Männer, neugierig die Frauen, die kleinen Leute mit sich selbst und dem Sand beschäftigt.
Wie klingt die Welt? Wie macht die Ostsee?
Günter Grass wird später in seinem Gedicht »Kleckerburg« schreiben:
Wer fragt noch wo? Mein Zungenschlag
Ist baltisch tückisch stubenwarm.
Wie macht die Ostsee? – Blubb, pifff, pschsch …
Auf deutsch, auf polnisch: Blubb, pifff, pschsch …
Immer wieder ist er als Kind an der Ostsee, Kleckerburgen bauen, Bernstein suchen, aufs Meer schauen:
hier, wo ich meine ersten Schuhe
zerlief, und als ich sprechen konnte,
das Stottern lernte: Sand, klatschnaß,
zum Kleckern, bis mein Kinder-Gral
sich gotisch türmte und zerfiel.
In der kleinen Wohnung in der Langfuhrer Labesgasse hat er seinen Platz unter einer Fensterbank, wo er seine Kinderschätze hortet. Das ist sein Kinderzimmer, vielleicht zwei Quadratmeter Freiheit. Ihm gehört die rechte Fensternische, seiner Schwester Waltraut, die drei Jahre nach ihm auf die Welt kommt, die linke.
Er ist verliebt in seine Mutter. Sie ist zärtlich, warmherzig, leicht zu Tränen gerührt, sie träumt, raucht, spielt Klavier, liest und liest. Sie ist Mitglied in einer Buchgemeinschaft. Ständig kommen neue Bücher ins Haus, die sie in ihren Bücherschrank stellt. Sie sieht ein wenig bäuerisch aus auf den Fotos, die es von ihr gibt: derb, offen, selbstbewusst. Sie hatte einst drei Brüder, alle hatten Künstler-Träume. Zwei blieben im Krieg, der Jüngste, Alfons, starb 1918 an der Spanischen Grippe, bevor er einrücken konnte. Er wollte Koch werden, hatte seine Ausbildung schon hinter sich, träumte, so schrieb er in seinen Briefen, von einer Koch-Karriere in den Grandhotels der Welt. Der Mittlere, Paul, wollte Maler werden, hatte schon Bühnenbilder entworfen für den »Freischütz«, für »Lohengrin« und den »Fliegenden Holländer«. Der Älteste schließlich, Arthur, Helenes Lieblingsbruder, wollte Dichter werden, Schriftsteller, hatte während seiner Lehrzeit in einer Filiale der Reichsbank schon Gedichte geschrieben, von denen die Danziger Lokalzeitung einige gedruckt hatte. Dann ein Bauchschuss im Krieg und auch seine Träume wurden nicht wahr.
Auf dem Dachboden wird der junge Günter Grass später einen Koffer mit Briefen, Zeichnungen und Gedichten finden. Geschriebene und gemalte Hoffnungen der drei früh gestorbenen Onkel. Für seine Mutter waren die drei nicht wirklich tot. Ihre Träume lebten in ihr fort, und sie hat sie in ihren kleinen Peer Gynt jeden Tag hineingeträufelt.
Helene Grass war, anders als Helene Reich, geschäftstüchtig und lebenspraktisch. Sie war es, die das Geschäft führte, auch offiziell: Geschäftsführung Helene Grass, so stand es im Handelsregister. Ihr Mann Willy dekorierte das Schaufenster, kümmerte sich um Einkäufe beim Grossisten, beschriftete Preisschilder. Günter hasste ihn früh, den Weichling, den Schilderbeschrifter, das Würstchen mit dem Schnurrbart. Dann hasste er ihn nicht mal mehr. Er nahm ihn einfach nicht mehr ernst. Er und seine Mutter – das war ihm die Welt.
Abends rauchte sie Orient-Zigaretten mit Gold-Mundstück, trank Cointreau und spielte Klavier. In den Zigarettenpackungen steckten Gutscheine, die man einschicken und gegen Reproduktionen von Kunstwerken aller Epochen eintauschen konnte. Günter war ein besessener Sammler. Alle Verwandten sammelten Gutscheine für ihn. Die Kunst-Alben, in die man die Werke einkleben konnte, besaß er alle drei. Blau für die Malerei der Gotik und Frührenaissance, rot für die Renaissance, goldgelb für Barock. »Ich lebte in Bildern«, erinnert er sich. Und in den Vorstellungen seines kommenden Ruhms. Er will selbst Künstler werden – und berühmt. Für seine Mutter und für sich.
Der Laden läuft schlecht. Er ist klein, es gibt viel und große Konkurrenz, das neu eröffnete Kaisers-Kaffeegeschäft am anderen Ende der Straße, dazu die hohen Zollgebühren, die man für Einfuhren in die Freie Stadt entrichten muss. Die Sorgen sind groß, die Mutter trägt sie fast allein. Den meisten Danzigern geht es nicht besser. So schreiben viele Kunden ihre Schulden beim Kolonialwarenladen Grass an. Und zahlen sie nicht oder spät zurück. Irgendwann kommt Helene Grass die Idee, das wäre doch eine Aufgabe für ihren Sohn. Sie schickt ihn los, mit einer Liste der Schuldner und geschuldeten Beträge. Einen Lohn verspricht sie auch: Fünf Prozent der eingetriebenen Summe gehe an ihn.
Und Günter quasselt den Leuten das Geld aus der Tasche. Lässt sich nicht abwimmeln, kommt vorzugsweise freitags, wenn die Leute ihren Lohn bekommen haben, stellt den Fuß in die Tür, wenn sie ihm diese vor der Nase zuschlagen wollen, lässt keine Ausreden gelten. Das läuft so gut, dass die Mutter schon bald Günters Gewinnanteil von fünf auf drei Prozent herabsetzt.
Dennoch hat der Junge mit zehn oder elf mehr Geld in der Tasche als seine Klassenkameraden, die in großen, repräsentativen Wohnungen oder Häusern leben. Er kauft sich Zeichenblöcke, Farbstifte, Bücher, »Brehms Tierleben« zum Beispiel, und geht ins Kino.
Und er liest und liest und liest. Er ist ein komplett in Büchern versunkener Junge. Seine Mutter macht sich eines Tages einen Spaß, indem sie das Marmeladenbrot des lesenden Günter gegen ein Stück Palmolive-Seife austauscht. Vor Publikum. Angeblich, so wird er sich später erinnern, fällt es ihm erst nach einer drei viertel Buchseite auf, in was er da gebissen hat.
Er liest »Oliver Twist«. Er findet Karl May langweilig. Er liest »Onkel Toms Hütte«. »Das Bildnis des Dorian Gray«. »David Copperfield«. »Die drei Musketiere«. »August Weltumsegler«. Mereschkowskis »Leonoardo da Vinci«. Der Vater sagt, in einem matten Versuch, den Buch-Abhängigen zu tadeln: »Vom Lesen ist noch keiner satt geworden.« Hilft nichts. Günter liest Storms »Schimmelreiter«, Falladas »Kleiner Mann, was nun?«, er versinkt vollkommen zwischen den Seiten. Er habe immer schon weranders woanders sein wollen, wird er später schreiben.
Und er erfindet Geschichten, schneidet auf, vor allem der Mutter verspricht er das Blaue vom Himmel. Über ihre und seine Zukunft, seinen kommenden Ruhm, sein Leben als Künstler. Sie hört ihm gerne zu und lässt sich in seine Traumwelt entführen.
In der Schule ist er eher mittel. In Deutsch sehr gut, und in Kunst natürlich, aber in Mathe, Chemie, allen technischen Fächern katastrophal. Er kommt zwar aufs Gymnasium, trägt mit Stolz die Gymnasiastenmütze, aber er ist widerborstig, lässt sich nichts gefallen, auch nicht von den Lehrern. Vom Conradinum, seinem ersten Gymnasium in Langfuhr, fliegt er, weil er sich einem prügelnden Turnlehrer gegenüber »aufsässig und unverschämt frech« gezeigt habe, wie die Eltern schriftlich erfahren. In der nächsten Schule, der Petri-Oberschule in der Danziger Altstadt, trifft er auf einen Musiklehrer mit Fistelstimme, dessen gesungenes »Heideröschen« die Schüler mit jazzartigen Rhythmus-Geräuschen begleiten. Was der nicht komisch findet und den Schüler Günter kräftig schüttelt. Doch da hat er den Falschen geschüttelt: Günter packt den Fistelsänger an seiner Papierkrawatte und zieht so lange daran, bis sie abreißt. Klingt nach Glück für den Musiklehrer. Was wäre wohl passiert, wenn die Krawatte aus widerständigerem Material gewesen wäre?
Der Schüler Günter Grass muss jedenfalls die nächste Schule verlassen. Aber Danzig ist groß, es gibt viele Schulen. Er kommt aufs Gymnasium St. Johann, so lange, bis ihn größere, patriotische Aufgaben von allen Schulpflichten entbinden.
Die Freie Stadt Danzig hat die Möglichkeiten, die in ihrem übernationalen Modellcharakter lagen, nie wirklich für sich nutzen können. Sie war ein Kampfplatz nationaler Interessen, nationalen Misstrauens, und eine Mehrheit der deutschsprachigen Bevölkerung – 95 Prozent der knapp 400000 Einwohner sprachen deutsch – wartete darauf, dass man sich irgendwann dem großen Heimatland wieder würde anschließen können. Als Joseph Goebbels 1930 zum ersten Mal in seinem Leben in Danzig war, schrieb er überwältigt in sein Tagebuch: »Abends rede ich. Durch Lautsprecher zu 6000 Menschen in den überfüllten Sälen. Es ist am Ende eine unendliche Begeisterung. Man trägt mich durch die Säle. ›Wiederkommen!‹ schreien die Menschen. Ein explosiver Ausbruch von Volksführerschaft. Welch herrliche Bewegung! Sie wird einmal ganz Deutschland mit sich reißen.«
Nach der »Machtübernahme« der Nationalsozialisten in Deutschland entfielen im Juni 1933 bei den Volkstagswahlen in der Freien Stadt Danzig 50,03 Prozent der abgegebenen Stimmen auf die NSDAP. Am 20. Juni wählte der Volkstag daraufhin einen von der NSDAP geführten Senat ins Amt, dem anfangs noch das bürgerliche »Zentrum« angehörte. In der Debatte vor der Wahl hatte der NS-Abgeordnete Hans-Albert Hohnfeld den Abgeordneten der SPD gedroht: »Sie werden die letzten Erklärungen abgegeben haben, verlassen Sie sich darauf!«
Danzig blieb pro forma »frei«, das heißt unabhängig von Deutschland und von Polen. Aber faktisch gab es nun eine enge politische Kooperation zwischen der neuen Regierung in Berlin und der Danziger Stadtregierung. Der Schrecken, den SA und SS unter dem oppositionellen Teil der Bevölkerung und vor allem unter den Juden verbreitete, war hier und dort der gleiche. Vielleicht wollte man es in Danzig sogar noch ein klein wenig besser, deutscher, nationalsozialistischer machen. Man gehörte ja noch nicht wieder ganz dazu.
Günter Grass machte mit bei allem, wo man als kleiner Junge so mitmachen konnte. Im Sommer 1933 war er ja erst fünf Jahre alt. Aber in den Jahren darauf fieberte er mit der »Legion Condor« im Spanischen Bürgerkrieg mit, bejubelte Max Schmeling, den deutschen Medaillensegen bei den Olympischen Spielen in Berlin, später den deutschen Wunderläufer Rudolf Harbig, den Rennfahrer Bernd Rosemeyer. Vater Willy trat 1936 in die NSDAP ein, wohl nicht so sehr aus fanatischer Überzeugung, sondern weil er glaubte, es sei gut fürs Geschäft. Die Mutter wurde stiller, spielte kaum noch Klavier, ihre kaschubischen Verwandten vom Land kamen seltener zu Besuch.
Aber sie, die Familie Grass, fuhr immer mal wieder hinaus zu den halb polnischen, halb deutschen Verwandten aufs Land, Richtung Kokoschken, bei Goldkrug über die Freistaatsgrenze zur Großtante Anna.
Ihr ältester Sohn Joseph holte sie an der Grenze ab. Im Winter mit Pferd und Schlitten. Beschimpft wurde er von den deutschen wie den polnischen Grenzbeamten, die er jeweils in ihrer Landessprache begrüßte. Die Kaschuben – das waren die jeweils anderen. Dabei war Joseph eigentlich der perfekte Repräsentant der übernationalen, freien Stadt Danzig. Vor dem Krieg soll er zwei Fahnen, die polnische und die mit dem Hakenkreuz, aus dem Schrank geholt und gerufen haben: »Wenn Krieg jeht los, staig ich auf Baum und guck, wer kommt zuerst. Und denn hiß ich Fahne, die da oder die …«
Aber noch war es nicht so weit. Noch hissten die Kaschuben gar keine Fahnen. Der Besuch aus Danzig war da, und es wurde gefeiert und gelacht, getrunken, geschlemmt und geweint. Es gab Süßes und Saures, Pilze, Senfgurken, Käsekuchen, Hühnerklein mit Magen, Herz und Leber und dazu Kartoffelschnaps.
Günter schreibt in diesen Jahren seine erste lange Geschichte. Er nennt sie »Die Kaschuben« und lässt sie im 13. Jahrhundert spielen. Von der Geschichte ist nichts geblieben. Der alte Grass wird sich nur erinnern, dass nach dem ersten Kapitel alle Helden tot waren: geköpft, erdrosselt, gepfählt, verkohlt oder gevierteilt. Und niemand mehr da, die toten Helden zu rächen. Er sei ganz froh, dass davon nichts geblieben sei. Wer wisse schon, wie viel von deutscher Blut-und-Boden-Ideologie, wie viel deutscher Rassismus sich in dem Text gefunden hätte.
Mit zehn Jahren wurde er Mitglied beim sogenannten Jungvolk, der Aufbauorganisation der Hitlerjugend. Weihnachten 1937 wünschte er sich die Uniform mit Käppi, Halstuch, Koppel und Schulterriemen. Er war enthusiastisch dabei, selbst wenn ihn die ewige Singerei und das Getrommel anödeten: Zeltlager, Geländespiele in Strandwäldern, Sonnenwend- und Morgenfeiern. Es war ein Hinaus aus der Enge der Wohnung, die er hasste, weg vom Laden und dem Kundengeschwätz, weg vor allem vom Vater und den familiären Zwängen.
Im November 1938 – Günter Grass war gerade elf geworden – schaute er neugierig zu, als auch in Danzig-Langfuhr, in der Michaelistaße, nicht weit vom Labesweg, die Synagoge von einer Bande von SA-Männern geplündert, verwüstet, angezündet wurde. Und er sah der Polizei beim Zuschauen zu.
Mitleid, Ärger, Empörung gar – an nichts davon kann er sich später erinnern: »Kein Zweifel hat meine Kinderjahre getrübt.«
Und dann endlich: das große Neue. Das Ende der Kindheit. Ende des Friedens.
Der erste Septembertag 1939. Günter ist beinahe zwölf. Er hört in Danzig-Langfuhr die Breitseiten eines Linienschiffes und den Anflug von Sturzkampfflugzeugen über dem Hafenvorort Neufahrwasser, dem der polnische Militärstützpunkt Westerplatte gegenüber liegt. Er steigt auf den Dachboden, zu seinen Büchern, dem Koffer der toten Onkel. Aus der Dachluke schauend, sieht er schwarzen Rauch über dem Freihafen. Zwei Panzerspähwagen fahren zur Polnischen Post, der kleinen Enklave des polnischen Staates am Heveliusplatz. Ein Onkel von Günter – Cousin seiner Mutter, Franz für die Deutschen, Franciszek für die Polen, mit Nachnamen Krause – ist im roten Backsteingebäude und verteidigt die Polnische Post vor den deutschen Angreifern. Hier, in der Freien Stadt Danzig, an der Westerplatte und auf dem Heveliusplatz, beginnt der größte Krieg der Menschengeschichte.
Die Post kann sich nur sehr kurz halten. Die Verteidiger, die noch am Leben sind, werden verhaftet und kurz darauf erschossen. Frantisek Krause ist eines der ersten Opfer des Zweiten Weltkriegs. Eine Gedenktafel an der Backsteinfassade erinnert noch heute an ihn.
Sein Name durfte in der Familie Grass von nun an nicht mehr erwähnt werden.
Im Traumland
Marcel Reich. 1929–1939
Neun Jahre alt, allein im Zug in ein fremdes Land – und keine Angst dabei. Marcel war imprägniert mit den Traumvorstellungen seiner Mutter und seiner eigenen Fantasie. Er hatte so viel gehört. Nicht nur von der Kultur. Auch von den Zügen, die unter der Erde fuhren, und von den Treppen, die sich von selbst bewegten, und von Bussen mit Sitzen auf dem Dach. Er konnte das Ende der langen Bahnfahrt kaum erwarten. »So dachte ich, vor Erregung fiebernd, an das Wunder, das ich zu erleben hoffte – das Wunder Berlin.«
Es ist spät, als er schließlich am Bahnhof Zoo ankommt. Eine elegante Dame von vierzig Jahren erwartet ihn. Tante Else, die Frau des Bruders seiner Mutter, Onkel Jacob.
Sie nimmt den Knaben in Empfang, und dann geht es in die prunkvolle Wohnung der Familie in der Roonstraße, in unmittelbarer Nähe des Reichstags. Eine Wohnung von kalter Pracht, Marmorsäulen, ein plätschernder Springbrunnen in einem Zimmer, das man den Wintergarten nennt. Die zwei Cousins und die Cousine schlafen schon, Onkel Jacob ist nicht da.
Also sitzt er allein mit der Tante an einem Tisch, der ihm riesig vorkommt; eine junge Frau mit Schürze und Glacéhandschuhen serviert das Abendessen. Der eingeschüchterte Junge antwortet auf die ihm von Tante Else gestellten Fragen kurz und einsilbig. Die Frau mit der Schürze hat dem kleinen Gast ein weiches Ei serviert. Als er fertig gegessen hat, nimmt die Tante die Eierschale, blickt hinein und sagt: »So isst man Eier in Deutschland nicht.«
Willkommen im Traumland. Im Bett, allein, weint Marcel Reich bitterlich. Ist er hier willkommen? Hat ihn seine Mutter angelogen? Hat er etwas falsch verstanden? Zu allem Überfluss hängt über seinem Bett ein Gemälde, das ihm fürchterliche Angst einjagt. Ein bärtiges Wesen mit behaartem Rücken, halb Mensch, halb Fisch, auf einem Felsen inmitten des aufgewühlten, dunklen Meeres. Mit dem Muschelhorn scheint es die Bewohner der bedrohlichen Wasserwelt zu locken, von tief unten herauf zu ihm, zu uns. Vor ihm eine nackte Frau, lasziv auf dem Rücken, dem dunklen Wesen dargeboten, ihre linke Hand liegt am Nacken einer mächtigen Meeresschlange. Arnold Böcklins »Triton und Nereide«. Ein Albtraumbild. Unter ihm: Marcel Reich in seiner ersten Nacht in Deutschland.
Zum Glück fahren sie dann alle erst mal für den Sommer auf die Insel Sylt. Standesgemäß mit vielen Schrankkoffern, sogar die zwei Reitpferde der Familie kommen mit. Auf Sylt lernt Marcel im Spiel mit seinen Cousins dann so flüssig und gut Deutsch, dass er, als ihn nach den Ferien seine inzwischen nach Berlin nachgekommene Mutter auf Polnisch begrüßt, ihr auf Deutsch antwortet.
Er ist angekommen im neuen Land, in der neuen Sprache. Mit der kalten Prachtwohnung allerdings ist es nun, da die Eltern und seine Geschwister da sind, vorbei. Bruder Jacob hat entschieden, dass sie zu ihrem Vater, dem alten Rabbiner Mannheim Auerbach, in seine armselige Wohnung in Charlottenburg ziehen sollen. Sie haben keine Wahl, also ziehen sie zu ihm.
Der Vater hat in Berlin noch weniger Aussicht auf irgendeine Anstellung als in Polen, die Mutter ist zum Geldverdienen nicht geboren. Also sind sie vollkommen abhängig von Helenes Brüdern. Dieses demütigende Gefühl der Abhängigkeit hat Marcel tief geprägt. Niemals in eine solche Abhängigkeit zu geraten, von niemandem, das hat er sich früh als Lebensziel vorgenommen. Und als Zweites: niemals so werden wie sein Vater. So weich, untüchtig, zu schwach, dem Leben zu begegnen.
David Reich geht in Berlin öfter in die Synagoge als in Włocławek. Hier fühlt er sich offenbar ein wenig aufgehoben und zu Hause. Er wünscht sich, dass der Sohn ihn begleitet. Der kommt widerstrebend mit und langweilt sich schrecklich während der Gottesdienste: »Ich konnte nicht begreifen, daß erwachsene Menschen mehr oder weniger stumpfsinnige Texte murmelten und dies auch noch für ein persönliches Gespräch mit Gott hielten.«
Der Respekt für seinen Vater wird durch die gemeinsamen Besuche der Synagoge jedenfalls nicht größer. Es gibt viele Sätze in dem Buch, das Marcel Reich-Ranicki später über sein Leben schrieb, die den Leser schockieren. Ein Satz über seinen Vater ist einer der schockierendsten: »Auch später, als wir im Warschauer Getto lebten, blieb mein gutmütiger, mein gütiger Vater ein Versager.«
Jetzt, hier in Berlin, lebt Marcel mit dem verachteten Vater, der geliebten Mutter, seinen Geschwistern und dem Großvater in der engen Wohnung. Nach den Sommerferien kommt er in die Schule, eine Volksschule in der Witzlebenstraße. Er ist überrascht, was er hier gleich am ersten Schultag erlebt. Ähnlich überrascht wie am ersten Berliner Abend in der Säulenwohnung mit dem deutschen Ei. Ein Mitschüler hat irgendetwas angestellt, der Lehrer, ein Herr Wolf, ruft ihn nach vorne, sagt »Bück dich!«, holt den für solche Fälle in der Ecke lehnenden Rohrstock herbei und versetzt dem Schüler einige kräftige Hiebe.
Marcel ist erschrocken. Über den Vorfall und beinahe noch mehr darüber, dass niemand sonst in der Klasse irgendwie überrascht oder berührt zu sein scheint. Das ist hier offenbar ganz normal. In Polen hat Marcel so etwas nie erlebt.
Auch sonst ist die Volksschule kein Spaß. Er ist ein Ausländer, ein Fremder, trägt andere Kleidung als die Berliner Jungs, versteht ihre Scherze nicht. Er gehört nicht dazu.
Er selbst hat aus seinem frühen Fremdheitsgefühl die Verpflichtung abgeleitet, durch starke Schulleistungen seinen Platz in der Klassengemeinschaft zu erkämpfen. Das klappt auch. Nicht nur in Deutsch, auch in Rechnen ist er der Beste der Klasse. Und schafft schon im nächsten Jahr locker den Sprung aufs Gymnasium. Seine stolze Mutter spendiert ihm zur Belohnung einen Besuch beim Zirkus Sarrasani auf dem Tempelhofer Feld.
Aber auch auf dem Gymnasium bleibt er ein Außenseiter. Woher er denn komme, fragt der Lehrer den Jungen mit dem komischen Akzent. Marcel nennt den Namen seines Geburtsortes, der Lehrer findet ihn lächerlich und bemüht sich, zur großen Heiterkeit aller Mitschüler, den unaussprechlichen Namen aus unaussprechlicher Ferne so witzig wie möglich auszusprechen. »Lutzlawiek«? »Wutzlawazek«? Wahnsinnig komische Scherze auf Kosten eines Außenseiters. Marcel Reich erwidert etwas Freches und bekommt daraufhin vom Lehrer eine Ohrfeige.
Wer weiß, was geschehen wäre, wenn der Lehrer eine Papierkrawatte getragen hätte? Nein, zum Gegenangriff war Marcel Reich nicht der Richtige. Als mittelloses Ausländerkind wohl auch einfach nicht in einer Position der Stärke.
Die wollte er sich weiterhin durch Fleiß erarbeiten. Und jetzt fing die Sache mit dem Lesen so richtig an. Marcel Reich las und las und war, trotz der Fremdheit und den Demütigungen in diesen Jahren, zum ersten Mal in seinem Leben glücklich. Denn er war verliebt. Verliebt in die Literatur.
Er las und las. Edgar Wallace und »Ben Hur«, »Quo Vadis« und »Lederstrumpf«, nur die Bücher von Karl May, die seine Mitschüler lasen, konnte er nicht leiden. Er fand Old Shatterhand einen unerträglichen Angeber. Sein absolutes Lieblingsbuch damals: Erich Kästners »Emil und die Detektive«. Später las er alles, was der Bücherschrank seiner Mutter hergab, Dostojewskis »Dämonen«, Schillers Balladen, Balzac, Hamsun, Stendhal, Flaubert, Shakespeares Dramen. Als er zwölf war, ging er zum ersten Mal ins Deutsche Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Er sah Schillers »Wilhelm Tell« und war nun für die Welt da draußen endgültig verloren. Und für die Welt des Theaters gewonnen. Was immer er sehen konnte, wofür immer er Karten bekam – er sah es sich an.
Und er hatte bald schon das Glück, im Gymnasium auf einen Deutschlehrer zu treffen, der sich seinen Enthusiasmus für die Literatur bewahrt hatte. Er hieß Reinhold Knick, war Marcels Klassenlehrer am Werner-von-Siemens-Gymnasium in Schöneberg und einer »vom Geschlecht jener, die glauben, ohne Literatur und Musik, ohne Kunst und Theater habe das Leben keinen Sinn«, so wird sich Marcel Reich-Ranicki später dankbar an ihn erinnern. Keinem seiner Lehrer verdankte der junge Schüler mehr als diesem.
Vielleicht hat zu der großen Bewunderung, die der junge Schüler für seinen enthusiastischen Lehrer empfand, auch diese kleine Episode beigetragen: Irgendwann nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 kam es auf dem Schulhof »in der Hitze des Gefechts«, wie sich der jüdische Schüler Marcel später erinnert, beim Handballspiel zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Schulführer der Hitlerjugend und einem Juden, den der HJler mit »Du Drecksjude!« beschimpfte. Daraufhin hielt Lehrer Knick in der Klasse mit zitternder Stimme eine feierliche Ansprache, in der er seine Schüler darauf hinwies, dass auch Jesus Jude gewesen sei und dass er als Christ solche Vorfälle nicht billigen könne. Knick wurde daraufhin von der HJ-Gebietsführung vorgeladen und von der Gestapo vernommen. Ende des Schuljahres wurde er an eine andere Schule versetzt.
Der Schüler Marcel ließ den Kontakt aber lange nicht abreißen. Lehrer Knick war für ihn die deutsche Klassik, der deutsche Idealismus, die verwirklichte, ideale deutsche Literatur. Knick ermutigte ihn, ihn in seiner Wohnung in Steglitz zu besuchen. Marcel nahm das Angebot gerne an und kam regelmäßig um siebzehn Uhr – stets gut vorbereitet mit einem Zettel, auf dem er Autorennamen und Buchtitel notiert hatte – und berichtete dem Lehrer von seinen Leseeindrücken und Urteilen. Die Zeit war kostbar. Um achtzehn Uhr klopfte Knicks Frau an der Zimmertür, das Zeichen, dass die Besuchszeit vorüber war.
Es wurde einsam um Marcel Reich. Das alte Gymnasium war geschlossen worden, er vermutete, weil hier besonders viele jüdische Schüler zusammengekommen waren, er wechselte auf das Fichte-Gymnasium in Wilmersdorf. Bei der Anmeldung fragte die Mutter den Direktor ängstlich, ihr Sohn sei Pole und Jude: »Wie wird er an der Schule behandelt werden?« Der Direktor wies die Frage brüsk von sich. Die Befürchtungen seien ihm unbegreiflich, Gerechtigkeit und Gleichheit sei an seiner Schule oberstes Prinzip. Auch Marcel hörte die Ängste der Mutter mit leichter Verwunderung, denn, so hat er es später beschrieben, er hielt sich keinesfalls mehr für einen Polen, »eher für einen Berliner«.
Die Einsamkeit des Schülers kam vor allem daher, dass Juden nunmehr von Schulfeiern, Ausflügen und Sportwettkämpfen ausgeschlossen waren und dass fast alle nichtjüdischen Altersgenossen in dieser Zeit in die HJ eintraten und dort die wesentlichen außerschulischen Erlebnisse sammelten. Da konnte Marcel Reich nicht mitreden, nichts miterleben. Die HJ war für Juden selbstverständlich tabu.
Immerhin, es gibt den Jüdischen Pfadfinderbund. Er tritt bei, dort singen sie die gleichen Lieder wie die Altersgenossen in der HJ – »Görg von Frundsberg führt uns an«, »Wildgänse rauschen durch die Nacht« und »Jenseits des Tales standen ihre Zelte« –, sie machen Fahrten in die Mark Brandenburg, übernachten in Zelten, manchmal gibt es Themenabende, bei denen auch die große Leidenschaft unseres jungen Pfadfinders befriedigt wird: die Literatur. An einem dieser Abende sprechen sie über Theodor Herzl, diesen jüdisch-österreichischen Literaten und Propheten, dessen utopischer Roman »Altneuland« von 1902 mit der Gründung des Staates Israel im Mai 1948 Wirklichkeit werden sollte. Die kühne Fantasie des assimilierten Juden Herzl imponiert Marcel Reich. Und später wird er über die Folgen dieses Buches staunen: »Der neuzeitliche Staat der Juden – das war erst einmal ein Stück deutscher Literatur.«
Einen Abend des Jüdischen Pfadfinderbunds hat er besonders eindrucksvoll in Erinnerung behalten. Ihr Führer hatte den Versammlungsraum abgedunkelt, hatte sich in den Nebenraum zurückgezogen und kehrte in einem langen Militärmantel aus dem Ersten Weltkrieg zurück, in der Hand eine Taschenlampe und ein dünnes grünweißes Buch. Er las: »Reiten, reiten, reiten, durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag. Reiten, reiten, reiten. Und der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so groß. Es gibt keine Berge mehr, kaum einen Baum. Nichts wagt aufzustehen. Fremde Hütten hocken durstig an versumpften Brunnen. Nirgends ein Turm. Und immer das gleiche Bild. Man hat zwei Augen zuviel.«
Sie hat Marcel Reich tief beeindruckt und bewegt, diese melodramatische Lesung aus Rainer Maria Rilkes »Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke«. Kurz danach beschloss er, mit fünf Gleichgesinnten einen Literaturzirkel zu gründen. Sie lasen Theaterstücke in verteilten Rollen, Goethes »Iphigenie auf Tauris«, aber letztlich waren Marcel die Pfadfinder, die Natur, die Zelte, die Lieder egal. Er verließ die Pfadfinder und seinen kleinen Rilke-Kreis. Er las für sich. Und versank immer tiefer in seiner Gegenwelt der Bücher.
Das Buch, das Marcel Reich in diesen Jahren zu seinem Lebensbuch erwählt, ist »Tonio Kröger« von Thomas Mann. Er, der in der Schule in Polen nicht recht dazugehört hatte, in der Grundschule in Berlin nicht, in der Familie, die ihn aufnahm, nicht, im ersten Gymnasium nicht und im zweiten auch nicht, sieht sich in dem einsamen, sehnsüchtigen Kaufmannssohn gespiegelt. Tonio Kröger, der Hans Hansen liebt und später die blonde Inge, der die Sorglosen liebt, die blonden Blauäugigen, die Pferdebücher lesen, Sport treiben, eine unproblematische Familiengeschichte haben, kontinuierlich, stabil, gesund, selbstsicher. Während er, Tonio, »Don Carlos« liest, eine problematische Herkunft hat, eine verträumte Mutter von irgendwo. Zigeunerherkunft, liederlich. Der beim Tanzunterricht versehentlich in die Mädchen-Quadrille gerät, weil er wieder mal geträumt hat, und zum Gespött seiner Mitschüler wird. Der fortgeht, allein, und hofft, dass die aus der Ferne Geliebte, dass Inge einfach von selbst zu ihm kommt und sagt: »Komm herein zu uns, sei froh, ich liebe dich.«
Aber sie kommt nicht. Wird niemals kommen. Tonio Kröger bleibt allein, liebt das Leben aus der Ferne und erinnert sich später dennoch voller Wehmut: »Damals lebte sein Herz.« Und noch am Ende wird er seine Liebe zu den Gewöhnlichen, zum Leben, zu den anderen da draußen, gegenüber der klugen, spöttischen Künstlerin Lisaweta verteidigen: »Schelten Sie diese Liebe nicht, Lisaweta, sie ist gut und fruchtbar. Sehnsucht ist darin und schwermütiger Neid und ein klein wenig Verachtung und eine ganze keusche Seligkeit.«
Das war Marcel Reichs Buch. Er verfolgte ängstlich den Lebenslauf des Autors dieses Buches. Er wusste natürlich, dass Thomas Mann mit seiner Familie seit 1933 bei Zürich lebte, kannte die Angriffe der »Wagnerstadt« München und anderer, die in der Folge der »Machtergreifung« der Nazis gegen den Autor der »Buddenbrooks« und »Tonio Krögers« erfolgt waren. Marcel Reich wusste aber auch, dass sich Thomas Mann, im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Autoren jener Jahre, bislang nicht eindeutig zu den neuen Machthabern in Deutschland geäußert hatte.