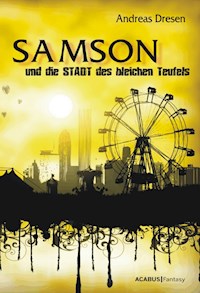Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Kommando 9. August. Wir befreien Sie vom Diktat des Stroms und der Herrschaft des Computers. Leben Sie natürlich." Diese Sätze leiten das Ende der uns bekannten Welt ein: Als radikale Umweltschützer die gesamte Stromversorgung zum Erliegen bringen, bedeutet dies eine Katastrophe für die Menschheit: Atomkraftwerke explodieren, Tiere beginnen sich gegen die Menschen zu richten und die Natur erobert die Erde zurück. Hundert Jahre später fristen die Bewohner des industriellen Nordens ihr Leben in einer grauen Stadt voller Maschinen und Fabriken, während in der mittelalterlichen Gesellschaft von Panäa, dem verfeindeten Süden des Landes, alle technologischen Neuerungen verboten sind. In dieser Welt bekommt Pejo, ein junger Mann aus dem Norden, auf einer Expedition in den Süden ein geheimnisvolles Buch von einem sterbenden Mädchen anvertraut. Schnell stellt Pejo fest, dass die Mächtigen sowohl im Norden als auch im Süden des Landes alles daran setzen würden, in den Besitz dieses Schriftstückes zu gelangen, und dass er zwischen die Fronten eines alten Krieges geraten ist. Auf seinem Weg durch den Süden, auf dem er Heilerinnen, Mutanten und gefährlichen "Viechern" begegnet, muss er nicht nur Gefahren trotzen, sondern sich auch der Vergangenheit seines Landes und seinen eigenen Gefühlen stellen - denn nur so kann er am Ende die richtige Entscheidung treffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Dresen
Das Buch des Hüters
Dresen, Andreas: Das Buch des Hüters, Hamburg, ACABUS Verlag 2011
Originalausgabe
PDF-ebook: ISBN 978-3-86282-054-2
ePub-ebook: ISBN 978-3-86282-131-0
Print (Paperback): ISBN 978-3-86282-053-5
Lektorat: Christina Schmidt-Hoberg, ACABUS Verlag
Umschlaggestaltung: ds, ACABUS Verlag
Covermotiv: © archibald - Fotolia.com, © K.-U. Häßler - Fotolia.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der ACABUS Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
© ACABUS Verlag, Hamburg 2011
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Prolog
„Wir hätten sie ausrotten sollen, als wir noch Zeit dazu hatten!“
Der junge Mann zog seinen verschlissenen Mantel enger um den dürren Körper. Seine Jeans war ausgewaschen und bereits an mehreren Stellen mit andersfarbigen Flicken ausgebessert. Die braunen Stiefel waren staubig und fleckig. Ein dichter, buschiger Bart bedeckte sein Gesicht. Die Nacht war kalt geworden, doch die beiden Wächter trauten sich nicht, ein Feuer zu entfachen, um ihren Standort nicht zu verraten.
„Sie mussten ja unbedingt Naturschutzreservate einrichten. Tierschutz. Pah, dass ich nicht lache. Und wer schützt jetzt uns Menschen?“
Er spuckte in die Dunkelheit. Die Männer saßen zusammengekauert auf den Resten des alten Stadttores und starrten in die Nacht. Außerhalb der Stadtmauer standen nur noch die Ruinen der verlassenen Häuser. Erste Bäume und Sträucher hatten sich in den Mauerritzen breitgemacht. Salweiden und Sandbirken hatten begonnen, die Gebäude langsam auseinanderzureißen und den Asphalt der Straßen zu sprengen. Nachtkerze, Wilde Kamille, Brennnessel und Rauke wuchsen in dichten Teppichen auf den Plätzen, die früher einmal Gärten, Parkanlagen oder Verkehrsinseln gewesen waren. Kleine Tiere huschten raschelnd und jaulend durch die Dunkelheit. Irgendwo in dem nahegelegenen Dickicht fauchte etwas. Der junge Mann sprang auf und horchte.
Sie hatten in dieser Woche die Nachtwache hier am nördlichen Ende der Stadt zugeteilt bekommen. Der Ältere der beiden hatte sich den Monolog des Jungen schweigend angehört. Er war glatt rasiert, doch seine Kleidung war ebenso alt wie die des Jungen. Sein Leinenhemd war fadenscheinig aber sauber, seine Wollhose von geschickter Hand immer wieder hergerichtet worden. Nur die Brille, deren beide Gläser gesprungen waren, zeugte davon, dass in diesem Zeitalter nicht mehr jeder Schaden behoben werden konnte. Nun holte er tief Luft.
„Das ist die Rache der Natur!“, widersprach er dem jungen Mann. „Das haben wir verdient!“
Der Junge wandte sich wieder dem Alten zu und lachte spöttisch.
„Dass ich nicht lache. Wir haben es also verdient, wieder im Dreck zu leben? Wieder ohne Schutz dazustehen? Und als ob das alles noch nicht genug wäre, müssen wir uns auch noch mit diesen Viechern rumschlagen. Weißt du was? Wenn unsere Vorfahren nicht so viele von den Tieren ausgerottet hätten, dann wären jetzt noch mehr Viecher hier, die uns an den Kragen wollten.“
Der Alte streckte sich. Die Wache machte ihm langsam zu schaffen. Er wurde alt und hatte schon so viele Nächte über die Geschichte der Welt nachgedacht.
„Nein, nein, hätten wir früher mit der Natur im Einklang gelebt, anstatt sie auszubeuten und Raubbau an ihr zu betreiben, dann hätten wir länger überlebt, und die Katastrophe wäre ausgeblieben.“
Der junge Wächter wurde laut. Er hatte seine eigentliche Aufgabe nun fast vollständig vergessen und sagte wütend:
„Du redest wirres Zeug. Wir hätten die Kontrolle behalten, wenn diese Irren, diese verdammten Irren nicht den Stecker gezogen hätten! Back to nature! Wenn ich nur daran denke, läuft es mir kalt den Rücken runter. Das haben wir jetzt davon. Nur gut, dass auch diese Verrückten jetzt von den Viechern gefressen werden.“
Es herrschte Stille. Der Alte konnte die Wut des Jungen in der Dunkelheit förmlich spüren. Er sah zwar nur seine Silhouette in der Nacht, doch seine Körperhaltung drückte die ganze Wut einer Generation aus, die das Gefühl hatte, um ihre Zukunft betrogen worden zu sein. Trotzdem, der Alte seufzte, irgendwann musste er es mal jemandem sagen.
„Ich fand die immer gut. Ich habe sie sogar ein wenig bewundert damals. Gut, man nannte sie Ökofaschisten. Aber endlich hat sich mal jemand gewehrt! Du bist vielleicht noch ein wenig zu jung, aber die Zeiten waren nicht mehr schön damals. Umweltverschmutzung, Ausbeutung von Mensch und Natur – an jeder Ecke konnte man es sehen, und immer hieß es nur: ,Zum Schutz der Arbeitsplätze!‘, ,Zum Schutz der Wirtschaftskraft!‘, ,Zum Schutz des Einkommens!‘.“
Er spürte, wie der Junge neben ihm bebte. Trotzdem sprach er weiter.
„Die Zukunft der Welt zerrann unter unseren Fingern. Und trotzdem machten sie immer weiter! Sie saugten sie und uns bis aufs Blut aus! Weißt du, auch damals starben Menschen! Nur, es scheint mir, als stürben sie heute ehrlicher.“
Er hielt kurz inne, bevor er seinen Monolog beendete.
„Niemand konnte ahnen, dass es so enden würde. Auch ich habe sie damals unterstützt! Das war das erste Mal, dass ich mich etwas getraut habe. Sie hätten es auch ohne mich geschafft, aber darum ging es gar nicht. Ich war dabei! Es war eine große, eine sehr große, gut koordinierte Aktion. Alle Computer fielen aus. Das Stromnetz auf der ganzen Welt kollabierte. Es ist nicht unsere Schuld, dass danach die Katastrophe ausbrach. Es ist vielleicht einfach nur die Rache der Natur, dass wir nun hier sitzen und uns mit Speeren und langen Messern gegen die mutierten Viecher wehren müssen.“
Er sah den Jungen an, der gegen Ende des Vortrags aufgestanden war. Dieser griff mit einer Hand unter seine Jacke und holte einen metallenen Gegenstand hervor. Das Licht der Sterne spiegelte sich darin.
„Ich habe noch eine Pistole“, sprach er und zielte auf den Alten.
Als der Knall des Schusses verhallt war, ließ sich der Junge schnaufend wieder auf seinen Platz fallen.
Dann waren die Viecher plötzlich über ihm.
1
Fast hundert Jahre später
Walther schlich leise durch die finsteren Gassen Waldfurths. Der lange Ritt durch die Wildnis hatte ihm zugesetzt und er war froh, wieder in der Nähe von Menschen zu sein. Sein Auftrag war klar gewesen. „Finde das Buch. Und wenn du den Jungen findest, bring ihn auch mit. Aber das Buch ist wichtiger.“
Walther wusste nichts über die Hintergründe seiner Mission, sie waren ihm auch gleichgültig und hatten keinerlei Bedeutung für sein Leben. Er würde tun, was getan werden musste, um das zu retten, was für ihn am meisten zählte: Das Leben seiner Frau. Und das hing davon ab, wie erfolgreich er hier war. So einfach war das.
Sein Pferd hatte ihn bis hierher getragen, bis nach Waldfurth, der Stadt, die dem letzten bekannten Aufenthaltsort des Buches am nächsten lag.
Die Gassen waren nicht beleuchtet, so dass Walther bereits ein paar Mal beinahe gestolpert wäre. Hier war alles so anders als im Norden, dachte er. Dort war das Leben auch nicht schön, aber es gab wenigstens Strom. Ohne Elektrizität wäre Maya schon längst tot. Aber hier … er rümpfte die Nase. Wie im finsteren Mittelalter würden die Menschen im Süden leben, sagte man im Norden. So Unrecht hatten sie nicht, dachte er sich. Der Sieker hatte das Gefühl, die Menschen würden ihren Müll einfach auf die Straße werfen. Er zog seinen Mantel enger um sich und prüfte den Sitz seiner Handschuhe. Plötzlich blieb er mit seinem Stiefel in etwas Matschigem stecken. Er fluchte leise und zog den Fuß langsam wieder heraus. Es zischte und schmatzte und ein fauliger Geruch breitete sich aus. Der Sieker verzog angeekelt das Gesicht. Jetzt wusste er wieder, warum er die Menschen normalerweise mied.
Die alten, heruntergekommenen Häuser dieser Straße standen schief gegeneinander gelehnt wie schlafende Riesen in dieser mondlosen Nacht. Nur vereinzelt waren noch Fenster erleuchtet. Walther stellte sich in einen schmalen Hauseingang und wartete leise, ob ihm jemand folgte. Vorsichtig suchte er mit den Augen die gesamte Umgebung ab. Niemand schien ihn zu beobachten, die meisten Fenster waren dunkel, fast alles war ruhig und schlief. Nach ein paar Minuten, als er sicher war, alleine zu sein, regte er sich wieder. Der Sieker stellte sich auf die Zehenspitzen, um besser in eines der hell erleuchteten, einsamen Fenster sehen zu können.
Eine junge Frau stand mit dem Rücken zum Fenster und kämmte sich langsam und gedankenverloren die Haare. Offensichtlich war sie kurz davor, zu Bett zu gehen.
„Du solltest besser die Vorhänge zuziehen“, sagte der Sieker leise. „Sonst kann dich jeder beobachten.“ Aber er wandte den Blick nicht ab, im Gegenteil, er lehnte sich an die Wand und starrte hinüber. Er sah das Licht der flackernden Kerzen, dass sich in ihren dunklen Haaren schimmernd widerspiegelte. Immer und immer wieder strich sie sich durch die Haare, langsam, geduldig und mit einer gewissen Zärtlichkeit, bei der sich Walthers Magen verkrampfte. Wie lange war es her, seitdem Maya ihn gestreichelt hatte? Wie lange war es her, dass er ihr Haar gebürstet und den Duft ihrer Strähnen gerochen hatte? Er seufzte tief. Schäbig kam er sich vor, weil er wie ein Voyeur auf der Straße lungerte und in fremde Wohnungen starrte. Doch wurden dadurch die Erinnerungen wieder lebendig, die Bilder vor seinem inneren Auge befreiten sich von der Fessel der Trauer und ließen ihn weitermachen.
Plötzlich öffnete sich eine Tür in dem Zimmer. Der Sieker erkannte, wie die junge Frau sich versteifte. Sie hielt die Bürste in der rechten Hand, wie eine Waffe, die linke hatte sie schützend vor ihren Oberkörper gelegt.
Der Mann, der hereingekommen war, trug eine Uniform. Ein Wächter, dachte der Sieker. Diese Handlanger Lord Hansens, die ihm halfen, seine sogenannte Ökodiktatur durchzusetzen. Gewissenlose Söldner, die das Volk knechteten und in Armut hielten. Doch dagegen konnte er nichts tun. Das war nicht seine Aufgabe. Sein Ziel lag woanders.
Der Wächter ging auf seine Frau zu, er wollte sie umarmen, doch sie wich zurück. Sie schienen zu streiten. Doch anstatt auf die Abwehr der Frau einzugehen, wurde der Mann ungeduldig. Er riss an ihrem Arm, zog sie zu sich. Die Frau schrie, doch der Wächter wurde nur noch gröber. Mit der rechten Hand hielt er sie am Oberkörper fest, mit der linken schlug er ihr ins Gesicht.
Die Frau zuckte zusammen, doch dann bäumte sie sich wütend auf. Mit einem zornigen Schrei zog sie ihm die Bürste über das Gesicht. Der Mann schrie nun seinerseits und hielt sich die Wange. Er blickte auf seine Hand, und was er sah, schien ihn nicht zu beruhigen. Sein Gesicht wurde hart, dann nahm er die Frau mit beiden Händen, warf sie auf das Bett und legte sich auf sie, wodurch beide aus dem Sichtfeld des Siekers verschwanden.
Walther war aufgewühlt. So ein Schwein, dachte er zornig. Er mochte sich gar nicht vorstellen, was nun in diesem Zimmer geschah. Er versuchte sich zurückzuhalten. Maya, dachte er, ich muss an Maya und an meinen Auftrag denken. Kein Aufsehen, das Buch ist das Wichtigste, ich darf es nicht gefährden. Ich muss es finden. Aber Walther glaubte an Vorsehung und das nichts ohne Grund geschah. Hier hatte er keine Wahl, er musste nichts entscheiden. Der Weg war eindeutig. Also hob er einen Stein vom Boden und schleuderte ihn durch das Fenster. Klirrend zersprang die über hundert Jahre alte Fensterscheibe.
Das Gesicht des Wächters erschien sofort danach im nun glaslosen Rahmen. Er starrte wutverzerrt auf die Straße, schien aber durch das Licht im Zimmer in der dunklen Gasse nichts sehen zu können. Walther lief die Straße entlang und versuchte dabei, soviel Krach wie möglich zu machen. Er hörte den Wächter hinter sich her brüllen und versteckte sich in einem schmalen Seitenpfad, der nicht mehr war als eine Lücke zwischen zwei Häusern.
Der Sieker beruhigte seinen Atem, zog seine Pistole. Der Wächter kam über die Straße gelaufen. „Wo bist du, du Verlierer. Zeig dich, und ich mache dich fertig!“
Der ist sauer, dachte Walther grimmig. Genau die richtige Stimmung, um ihn auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen.
Als der Wächter an ihm vorbeilief, zuckte Walthers Arm, und er zog seinen Gegner in einen festen Würgegriff. Der Wächter wehrte sich, doch der Sieker warf sich auf ihn und schleuderte ihn, mit dem Gesicht voran, auf den Boden. Dann hielt er ihm die Pistole an die Wange.
„Das ist eine Waffe aus der Zeit vor dem Ende. Sechs Schuss Munition, täglich gereinigt. Der Abzug ist so leichtgängig, dass ein Stück warme Butter dem Messer mehr Widerstand leistet, als dieser Hebel meinem Finger. Also sei vorsichtig.“
„Wer bist du?“, keuchte der Wächter wütend.
„Ich bin der Beschützer der Frauen in dieser Stadt.“ Walther wusste nicht, woher er das Selbstbewusstsein nahm, solche Töne zu spucken. Aber er ahnte, dass es nur diesen einen Weg gab, um diesem Kerl Einhalt zu gebieten. „Und ich habe dich auf dem Kieker“, vollendete er seine Drohung.
„Das ist meine Frau!“, sagte der Wächter. „Ich kann mit ihr machen, was ich will.“
„Da irrst du dich. Diese Zeiten sind vorbei“, zischte Walther. Ihm wurde ganz übel bei dem Gedanken, wie sich der Wächter in der Stadt aufführte. Die Macht, die ihm Lord Hansen verliehen hatte, nutzte dieses Schwein ohne Zweifel gnadenlos aus. Wahrscheinlich gab es in der ganzen Stadt niemanden, der den Wächter zur Rechenschaft ziehen konnte. Dieser Gedanke spornte Walther noch einmal an.
„Das ist deine letzte Chance, und ich weiß nicht, warum ich sie dir überhaupt gewähre“, sagte der Sieker. „Lass die Finger von ihr. Nähere dich ihr noch einmal, und ich bringe dich um. Nähere dich einer anderen Frau in dieser Weise, und ich werde dich den Viechern dort draußen zum Fraß vorwerfen. Und zwar in mundgerechten Stückchen. Hast du mich verstanden?“
Der Wächter sagte nichts. Walther drückte ihm die Waffe ins Gesicht, doch als sich immer noch nichts rührte, schlug er ihm kräftig mit der freien Faust in die Nieren. Der Wächter hustete vor Schmerz.
„Hast du verstanden?“ Walther wusste, dass er nur eine leere Drohung ausgesprochen und sich zudem einen neuen Feind geschaffen hatte. Aber der Wächter hatte ihn nicht erkannt und mit ein bisschen Glück würde er seine Frau so lange in Frieden lassen, bis sie sich einen neuen Beschützer gesucht hatte.
Der Wächter nickte.
„Ich gehe jetzt. Und du zählst bis hundert, oder, wenn du nicht so weit zählen kannst, der höchsten Zahl, die du kennst, bevor du aufstehst. Ich verspreche dir, wenn du zu früh aufstehst, knall ich dich einfach ab.“
Ohne eine Antwort abzuwarten, stand der Sieker auf und zog sich schnell, aber bestimmt in die Dunkelheit zurück. Der Wächter blieb auf der Straße liegen, die Zähne knirschten, als er sie zornig aufeinander malmen ließ. Jemand würde dafür bezahlen, seinen Zorn zu spüren bekommen, das war sicher. Aber als der Wächter sein Gesicht aus dem Schlamm und dem Dreck der Straße erhob, war Walther bereits verschwunden.
2
„Leute, passt auf, die Huya kommt!“
Die Frau auf dem Kutschbock lachte laut und ihr großer Busen bebte. Ihre rotbraunen Haare hatte sie für die Reise unter einem Tuch verdeckt. Der runde, rostige Wohnwagen, der samt eingebauter Toilette und Kfz-Kennzeichen noch aus der Zeit vor dem Ende stammte, wurde von ihrem alten Pferd gezogen. Neben einer Matratze fanden sich darin Fässer mit eingelegtem Gemüse, aber auch Tiegel mit Salben, Kästchen mit Kräutern und Säckchen mit Kristallen. Amulette hingen von der Decke. Vor dem geöffneten Fenster war über der Kupplung ein hölzerner Kutschbock angebracht worden, auf dem die Frau nun ihre Gerte schwang.
Der junge Mann, der auf der Matratze geschlafen hatte, rieb sich die Augen und kroch nach vorne.
„Sind wir schon da?“
Huya schlug ihm freundschaftlich auf die Schulter.
„Du hast lange geschlafen, Pejo. Du wirktest aber auch so erschöpft, als wärst du seit Tagen nur gerannt.“
„Vielleicht war es ja auch so“, murmelte Pejo und zog sich wieder in den Schatten des Wagens zurück, als sie ein paar Bauern überholten, die zu Fuß auf dem Weg zur Stadt waren. Huya entging dies nicht.
„Am besten bleibst du hinten, bis wir in der Stadt sind. Ich glaube zwar nicht, dass wir kontrolliert werden, schließlich ist Markt und die Leute kommen in Scharen nach Waldfurth. Aber man weiß ja nie. Verschließe das Fenster, so dass niemand dich sehen kann. Wir sind bald dort.“ Sie zeigte auf die Ansammlung von Häusern in dem tiefer gelegenen Tal.
„Da unten liegt Waldfurth. Einst sollen hier bis zu fünfzigtausend Menschen gelebt haben“, schwatzte sie. „Doch diese Zeiten sind schon lange vorbei.“
Pejo steckte den Kopf wieder heraus.
„Fünfzigtausend! Glaubst du, es gibt heute noch Städte, in denen so viele Leute leben? Ich habe davon gehört. In einer Stadt im Osten sollen es mehr als hunderttausend sein.“
Huya schüttelte den Kopf.
„Nein, das glaube ich nicht. Wie sollen denn so viele Menschen etwas zu essen bekommen? So viele Menschen gab es bestimmt früher einmal. Aber inzwischen ist eine solche Stadt bestimmt auch nur noch ein größeres Dorf. Wenn es sie überhaupt noch gibt. Ich kenne keinen, der jemals eine größere Stadt als Waldfurth gesehen hat. Früher aber müssen die Städte beeindruckend gewesen sein.“
Pejo nickte.
„Ja, man hört viele Geschichten.“
Doch als Huya noch etwas erwidern wollte, war Pejo bereits wieder verschwunden.
Das steinerne Stadttor war uralt. Vor der Katastrophe war es wohl nicht mehr als ein Relikt aus einer früheren Zeit gewesen. Damals war es von Straßen und Häusern umgeben und eine beliebte Touristenattraktion gewesen. Doch heute erfüllte es wieder seinen ursprünglichen Zweck. Das Tor war Teil einer Mauer, die das Städtchen Waldfurth eingrenzte. Dabei hatte man die Gebäude, die günstig standen, in die Mauer miteinbezogen. Die Lücken dazwischen waren mit Holz und Steinbarrikaden aufgefüllt worden. Alles außerhalb dieser Mauer war vor langer Zeit abgerissen worden oder von selbst zusammengefallen, da niemand mehr in diesen Häusern hatte leben wollen. Zudem brauchte man freie Sicht, um Besucher und Fremde rechtzeitig sehen zu können.
So lenkte Huya ihren Wagen über eine staubige Straße, die rechts und links von überwucherten Ruinen gesäumt war. Alles sah so aus, wie sich Huya das Ergebnis eines Bombenangriffs, von denen sie in den Geschichten der Alten gehört hatte, vorstellte. Rumpelnd näherte sich der Wagen dem alten Stadttor.
Das Bollwerk erhob sich drohend in den Himmel, doch seine Pforte war einladend geöffnet. Ein schmaler Strom an Menschen zog hindurch, stetig beäugt von den zwei Soldaten, die sich an den Seiten postiert hatten.
Einer der Posten fixierte Huya, als sie durch das Tor fuhr und trat ihr in den Weg. „Halt an, Hexe. Du kannst hier nicht so einfach ein Pferd in die Stadt bringen! Erst zeigst du mir dein Zertifikat, das bestätigt, dass du das Tier bei einer staatlich geprüften Zucht gekauft hast. Wir wollen ja schließlich keine gefährlichen Viecher in die Stadt lassen!“
Er griff in das Halfter des Pferdes und zwang es damit zum Anhalten.
Der Soldat war groß, blond und trug ein leichtes Gewehr um die Schultern. Auf seiner Wange waren tiefe, blutige Kratzer zu sehen, die sich zu entzünden schienen. Er funkelte Huya böse an. Nachdem er das von ihr seufzend hervorgekramte Zertifikat begutachtet hatte, fuhr er fort: „Du betrittst das Gebiet von Waldfurth, einer ökologisch befreiten Stadt. Es gelten strengste Einfuhrbestimmungen. Was versuchst du denn auf den Markt zu bringen, hm? Hast du genmanipuliertes Gemüse dabei? Verseuchten Mais? Oder chemisch gedüngte Kartoffeln? Rindfleisch aus Massentierhaltung oder Schweinefleisch, das mit Antibiotika versetzt ist?“
Er ließ das Pferd los und ging auf Huya zu. Dabei blickte er ihr streng in die Augen. Huya räusperte sich und beugte sich nach vorne.
„Antibiotika gibt es seit mehr als hundert Jahren nicht mehr in einer Menge, die man an die Schweine verfüttern müsste. Und woher soll ich wissen, ob mein Gemüse genmanipuliert ist? Es wächst auf den Feldern, auf denen ich es gestohlen habe, mehr weiß ich nicht!“
Huya lachte laut und hell über ihren eigenen Witz und zog dabei ihren Rock ein wenig über die Knie, so dass ihre nackten Beine zum Vorschein kamen.
„Aber mein Fleisch ist bestimmt natürlich gewachsen. Wieso kommst du nachher nicht mal vorbei, wenn deine Schicht vorüber ist?“
Der Soldat erstarrte.
„Versuchst du etwa, mich zu bestechen, du Aas? Was verbirgst du in deinem Wagen, was die Stadtwache nicht sehen darf? Oder versteckst du etwa Spione aus dem Norden? Los runter vom Bock, und Wagen öffnen!“
Mit diesen Worten zerrte er Huya an ihrem Arm vom Kutschbock.
Der zweite Soldat, der inzwischen das Tor verlassen hatte, kam hinzu. Er war nicht so groß wie sein Kollege, dafür aber um einiges breiter, was ihm das kompakte Aussehen einer Eiche verlieh. Er lächelte und raunte Huya zu:
„Mensch, der ist heute aber geladen! Ärger mit seiner Frau, die ihn ziemlich kurz hält. Jetzt rächt er sich schon den ganzen Tag an den Frauen, die durch ‚sein‘ Tor kommen. Vor allem an den hübschen.“
Mit diesen Worten ließ er einen bewundernden Blick über Huyas Körper gleiten.
Huya dankte ihm lächelnd, schritt aber schnell hinter dem Blonden her, der sich daran gemacht hatte, die Tür des Wagens zu öffnen.
„Dazu hast du kein Recht. Außerdem, was soll ich schon geladen haben, außer meinen Kräutern, meiner Kleidung und meiner Matratze. Seh’ ich aus wie ein Schmuggler?“
„Es sollen immer wieder Spione gesichtet worden sein. Wir müssen wachsam sein. Und natürlich habe ich das Recht, deinen Wagen zu untersuchen. Und dich gleich mit, wenn du dich wehrst.“
Mit diesen Worten riss er die Tür auf und starrte ins Innere des Wagens.
Dort standen zwei Kisten, ein Fass und eine Matratze auf einem kleinen Bettgestell. Von Pejo keine Spur. Doch von einer Leine baumelten dem Soldaten ein paar Damenunterhosen ins Gesicht.
„Also bist du doch auf meine Wäsche scharf gewesen.“ Huya lachte laut und der große Blonde bekam einen roten Kopf.
„Dein Gesicht merk ich mir, du rothaarige Hexe“, zischte er.
Sein Kollege legte im die Hand auf den Rücken und redete beschwichtigend auf ihn ein.
„Lass gut sein, Hans. Hör auf.“ Und zu Huya gewandt: „Du kannst weiterfahren. Genieße den Markt. Die ganze Umgebung scheint in die Stadt zu strömen. Ich bin übrigens Markus. Vielleicht sehen wir uns ja später.“
Mit diesen Worten verschwanden die Wachen und Huya fuhr den kleinen Wagen durch das große, steinerne Tor. Wo war Pejo, dachte sie? Wollte er doch nicht in die Stadt? Und wieso hatte er sich vor den Soldaten versteckt gehalten?
Seit Huya ihn im Wald aufgelesen hatte, hatte der Junge nicht viel mehr als seinen Namen von sich preisgegeben. Er hatte gegessen wie ein Löwe, als ob er seit Tagen keine vernünftige Mahlzeit mehr bekommen hätte. Seine Kleidung war abgetragen und verschlissen gewesen. Er gab Huya eine Reihe von Rätseln auf, doch machte er einen friedlichen und geselligen Eindruck, weshalb sie ihn auf ihrem Wagen mitgenommen hatte.
Der Sieker führte sein Pferd durch das alte Stadttor der befreiten Stadt Waldfurth auf die offene Landstraße. Hier saß er auf und betrachtete das kleine Wägelchen, das gerade das Tor passierte. Die rothaarige Frau auf dem Kutschbock zwinkerte ihm zu, doch sein Blick blieb unbewegt. Seine dunklen Haare, die strähnig unter einem unförmigen Zylinder hervorkamen, umrahmten sein blasses, fast starres Gesicht. Unter seinem Ledermantel schützte ihn ein speckiger Wollpullover vor der Kälte, wenn er in der Wildnis übernachten musste. Dazu trug er eine alte Tarnhose aus Armeebeständen. Walther musterte den Wohnwagen.
Irgendwo musste der Junge sein, dachte er. Die Fährte war nicht kalt gewesen und doch plötzlich abgerissen. Das Buch konnte sich überall befinden, der Junge konnte sich in jedem der Wagen verstecken, die ihm entgegen kamen. Doch Walther vertraute auf die Vorsehung. Er würde das Buch finden, und wenn es sein sollte, auch den Jungen. Er griff in die Tasche seines Ledermantels und holte ein paar weiche Handschuhe heraus. Er mochte keine rauen Hände und erst recht keinen Schmutz an den Fingern.
Mit leichtem Druck seiner Schenkel trieb er sein Pferd an. In der ‚befreiten Zone‘ Waldfurth hatte er keinen Erfolg gehabt. Und doch hatte es gut getan, nach so langer Zeit wieder einmal unter Menschen zu sein. Für kurze Zeit.
Am wohlsten aber fühlte er sich draußen, auf den Feldern, in den Wäldern oder auf der Straße. Allein mit seinen Gedanken. Am liebsten auf der Jagd. Doch es gab Situationen, da wurde ihm die Einsamkeit zu schwer und es drängte ihn in die kleinen Städte und Dörfer, um die er sonst einen Bogen machte.
Dort vergnügte er sich oft ein wenig. Er strich des Nachts durch die dunklen Gassen und träumte davon, was wohl hinter den geschlossenen Fensterläden vorging. Manchmal, wie hier in Waldfurth, hatte er Glück und konnte durch ein offenes Fenster in ein Haus hineinspähen. Dann setzte er sich in eine dunkle Ecke und beobachtete. Er sog das helle, warme Licht aus den Stuben in sich auf und wartete. Er sah die Menschen als Schatten hin- und hergehen, sah ihre Konturen so scharf, als ob sie nackt vor ihm stünden.
Doch jedes Mal hatte er bald schon wieder genug von diesem Spiel. Die Enge in den Siedlungen bedrückte ihn. Der Gestank anderer Menschen, der Schmutz, die Nähe waren ihm schnell zu viel. Oft begann es damit, dass dieser Geruch ihm in die Nase stieg, sein Gehirn erfasste und seine Sinne zerquetschte. Dann stürmte er, nach Atem ringend, aus der Stadt und beruhigte sich oft erst wieder, wenn er auf dem freien Feld unter dem Himmel lag und tief den Duft der Bäume und Wiesen in sich aufsog.
Und jetzt war er wieder auf der Suche. Man hatte ihn geschickt und er würde sein Ziel erreichen.
Der Sieker beschloss, seinem Pferd die Wahl des Weges zu überlassen. Wenn man nicht wusste, wo man als nächstes hin sollte, dann war es das Beste, das Schicksal entscheiden zu lassen. Und das tat er. Er beugte sich über den Kopf des Pferdes und flüsterte seinen Namen.
„Schicksal, du entscheidest, wo es langgeht. Lauf!“
Und damit gab der Sieker seinem Pferd Schicksal die Sporen.
3
Pejo hatte die Unaufmerksamkeit der Wachen genutzt, um sich unbemerkt durch das Tor zu schleichen. Er hatte ein schlechtes Gewissen, weil er Huya alleine gelassen hatte, doch er durfte auf keinen Fall erwischt werden. Einer genaueren Untersuchung würde seine Maskerade nicht standhalten.
Er wusste, dass es nicht ungefährlich war, sich in die Höhle des Löwen zu begeben. Waldfurth war besetzt von den Soldaten Lord Hansens, die ihn sicherlich als Spion des Nordens am nächstbesten Baum aufknüpfen würden, wenn sie ihn in die Finger bekämen. Aber Pejo fand, dass es sicherer war, sich zwischen vielen Menschen aufzuhalten, anstatt alleine in der Wildnis angetroffen zu werden. Außerdem brauchte er Verpflegung und würde versuchen müssen, ein paar Dinge zu tauschen. Wenn er jemals wieder nach Hause kommen wollte, dann sollte er hier versuchen, einen Weg zu finden, der ihn zurückführen könnte. Vielleicht würde ja ein Händler in den Norden fahren, oder zumindest konnte er versuchen zu erfragen, welcher Weg der sicherste und der unauffälligste sei. Denn Pejo hatte weder eine Ahnung davon, wo er sich wirklich befand, noch wusste er, welchen Weg er einschlagen musste, um zurückzugelangen.
Er zog die alte Jacke, die er vor einigen Tagen von einer Wäscheleine gestohlen hatte, enger um seinen knochigen Körper. Der Strom der Menschen führte ihn über die große Straße direkt in das Herz der Stadt. Pejo staunte. Sehr hohe Gebäude säumten die Einfallsstraße und sie war alt. Uralt. Der Straßenbelag stammte zum Teil noch aus den Zeiten vor dem Ende und war aus echtem Asphalt. Dort, wo der Teer durch Frost und Regen aufgeplatzt war, hatte man die schadhaften Stellen mit Sand und Kopfsteinpflaster aufgefüllt. Heutzutage war es schwierig, die Straßen zu teeren. Kaum jemand kannte noch die alten Techniken. Steinpflaster ließen sich leichter legen und hielten länger.
Pejo betrachtete die Ochsenkarren, mit denen die Bauern in Richtung Markt rumpelten. Früher waren hier Autos gefahren, dachte er. Und Motorräder. Kein Wunder, dass man so glatte Straßen brauchte. Ob den Menschen bei so hohen Geschwindigkeiten nicht schlecht geworden war? Er konnte sich nicht vorstellen, so schnell zu fahren. Er bekam schon auf einer schnellen Kutsche Angst.
Trotzdem, nach den holprigen Waldwegen war eine Teerstraße, und sei sie noch so alt, eine Erholung.
Der Markt der Absonderlichkeiten war eigentlich ein Volksfest für die Bewohner in und um Waldfurth. Pejo traf auf seinem Weg in die Altstadt auf Männer, die aussahen, als ob sie die ganzen drei Tage, die der Markt bereits dauerte, durchgefeiert hätten. Rotgesichtig wankten sie durch die Straßen und ihre Gesichter glühten so fröhlich, dass es Pejo ansteckte. Die Last und die Angst der vergangenen Tage fielen von ihm ab und er stürzte sich in das Getümmel.
Bald fand er sich mitten auf dem Markt wieder. Er betrachtete sich im Spiegel, der an einem Stand für Tuch und Kleidung aufgebaut war. Pejo straffte sich und richtete sich auf, als er seine hängenden Schultern sah. Seine Kleidung wirkte zu groß für seinen Körper und er bemerkte, dass er auf der Reise mehr Gewicht verloren hatte, als ihm bewusst gewesen war. Obwohl er bereits Anfang Zwanzig war, hatten ihn die Menschen in seiner Umgebung immer jünger eingeschätzt, was ihn stets geärgert hatte. Das lag zum einen daran, dass er immer etwas rundlicher gewesen war als die anderen Kinder in seinem Alter, zum anderen aber auch daran, dass er sehr behütet aufgewachsen war. Seine Altersgenossen arbeiteten zum Teil seit Jahren in den Fabriken, was entsprechende Spuren in ihren Gesichtern hinterlassen hatte.
Pejo hoffte nun, dass sein Aussehen ihn nicht verraten würde. Er hatte seine braunen Haare nach der aktuellen Mode der Oberschicht des Nordens relativ kurz geschnitten, vor allem im Nacken und an den Seiten. Die Menschen hier in Waldfurth hingegen, auch wenn die Bürger ansonsten sehr gepflegt wirkten, trugen das Haar im Allgemeinen eher länger. Pejo dachte daran, sich möglichst schnell eine Mütze zuzulegen.
Er rieb sich mit einer Hand über das Kinn und besah sich seinen Bartwuchs genau. Obwohl er sich schon seit mehreren Wochen nicht mehr rasiert hatte, blieben einige kahle Stellen am Kinn übrig, die sich einfach nicht von den kurzen dunklen Haaren bewachsen lassen wollten. Er ging weiter. Ein Mädchen in seinem Alter kam ihm entgegen, unter dem Arm einen Korb voller Eier und ein frisches, duftendes Brot. Sie lächelte ihn unter ihrer Haube hervor an.
Pejo schlug die Augen nieder. Als er den Mut gefasst hatte, wieder hochzublicken, war die junge Frau bereits in der Menge verschwunden.
Er hasste sich dafür. Wieso konnte er nicht einfach lächeln und ein Mädchen ansprechen? Andere in seinem Alter waren bereits verheiratet, hatten zum Teil seit Jahren den Bund geschlossen und wussten genau, was sie in der Zukunft erwartete.
Die hatten aber auch die Stadtmauern Flusshavens noch nie verlassen. Der Gedanke baute ihn wieder auf. Er hatte es so weit geschafft. Sich seiner Freiheit erneut bewusst, sog er die Luft des Marktes tief in seine Lungen und nahm plötzlich alles viel genauer wahr.
Seit dem Ende war es im Norden unüblich geworden zu reisen. Zu groß war die Angst vor Übergriffen oder Anschlägen. Und in den Süden konnte man schon gar nicht: Zu sehr waren die Fronten verhärtet. Dies lag nicht nur am Krieg, die beiden Teile des Landes, Panäa und Flusshaven, hatten sich auch vollkommen unterschiedlich entwickelt. Dementsprechend schwer fiel es Pejo nun, sich hier im Süden zurechtzufinden.
Obwohl er fremd war, konnte er sich in der Menge einigermaßen sicher fühlen, denn heute fiel hier keiner auf, so abstrus waren die Menschen zum Teil verkleidet. Pejo schlenderte durch die Gassen. An einer Ecke stand ein Gaukler, der seine Vorstellung vorbereitete. Mit einer Kartoffel, einem Ei und einem Hut schien er ganz erstaunliche Dinge vollbringen zu wollen. Um seinen Tisch hatte er mit einer auf dem Boden liegenden roten Schnur einen geschützten Bereich geschaffen. Pejo achtete darauf, diesen nicht zu betreten, als der Gaukler vortrat und sich vor ihm verbeugte. Dann zog der Mann aus seiner Tasche eine weitere Kartoffel hervor und übergab sie Pejo mit einer großen Geste. Pejo nahm sie dankend an und wollte weitergehen, doch der Gaukler hielt ihn auf. Ohne ein weiteres Wort legte er Pejos linke Hand auf dessen rechte, in der er immer noch die Kartoffel hielt.
Pejo wurde ganz warm im Gesicht, als er bemerkte, dass die Leute stehen blieben. Der Gaukler lächelte, dann drückte er Pejos Hände fest zusammen. Doch anstatt einer zermatschten Kartoffel fühlte Pejo plötzlich etwas Flauschiges in seiner Hand. Erschocken zog er seine linke Hand zurück und sah eine kleine Fledermaus auf seiner rechten Handfläche sitzen. Diese biss ihm kräftig in den Finger, bevor sie sich flatternd auf und davon machte.
Die Leute um ihn herum klatschten. Der Gaukler verbeugte sich, aber Pejo versuchte, möglichst schnell in der Menge zu verschwinden. So hatte er sich nicht vorgestellt, unbemerkt in der Stadt zu bleiben. Er musste vorsichtiger sein, dachte er. Ein paar Schritte weiter blieb er stehen und tat so, als würde er sich die Auslagen eines Standes anschauen. Dabei wollte er sich einfach nur mal kurz ausruhen und den Schrecken verarbeiten.
„Natürlichkeit, Bruder!“, sprach ein Mann neben ihm mit lauter Stimme, so dass alle umliegenden Händler und Kunden es hören konnte. Einige zogen den Kopf ein, andere machten sich vorsichtig davon. Pejo erschrak, bemerkte aber bald, dass nicht er gemeint war. Der Mann, großgewachsen und muskulös, steckte in einer Uniform. Ein Wächter Panäas. Pejo sank das Herz in die Hose, aber der Soldat beachtete ihn gar nicht.
Dem angesprochenen Händler hingegen, ein dicklicher kleiner Mann, sanken die Mundwinkel nach unten. Er begann zu schwitzen.
„Natürlichkeit, Bruder“, erwiderte er hastig. „Was kann ich für Euch tun?“
„Nun“, mit diesen Worten schlenderte der Wächter um den Tresen herum und legte den Arm und die Schultern des Dicken. „Ich interessiere mich da für etwas ganz besonderes. Für deine Batterien nämlich!“ Die letzten Worte hatte er wieder so laut gesprochen, dass es alle umliegenden Passanten hören konnten. Einige raunten ahnungsvoll.
„Batterien?“ Der Händler kicherte nervös. „Ich habe keine Batterien! Batterien sind doch seit dem Beschluss der Ewigdauernden Delegiertenversammlung nicht mehr für das Volk Panäas zugelassen.“
Wieder kicherte er.
„Richtig.“ Der Große nickte und lächelte. „Das hast du gut behalten.“
Der Kaufmann entspannte sich ein wenig und begann zu lächeln.
„Doch warum versteckst du sie dann unter deinem Wams?“, rief der Wächter und griff unter die Jacke des Händlers. Diesem wich das Blut aus dem Gesicht und er versuchte noch, den anderen aufzuhalten. Doch der Soldat hielt bereits triumphierend ein kleines Ledersäckchen in die Höhe. Kurz darauf flogen die Batterien durch die Luft. Ein zweiter Wächter, der in der Menge geblieben war, fing sie eine nach der anderen auf.
„Aber im Norden hat jeder Strom!“, sagte ein kleines Mädchen plötzlich.
Auf einen Wink des Mannes hin legten sich zwei schwere Hände auf die Schultern der Kleinen. Ein dritter Wächter, der durch seine zivile Kleidung nicht gleich als solcher zu erkennen gewesen war, beugte sich über das Kind, das vielleicht gerade mal neun oder zehn Jahre alt war. Pejo fragte sich, wo die Eltern des Mädchens waren und warum diese sich in einer solchen Situation nicht vor ihr Kind stellten.
„Und woher weißt du das, meine Kleine?“, flötete der Zivilbeamte mit zuckersüßer Stimme. Das Mädchen starrte ihn aus großen Augen an. Ihr schien langsam bewusst geworden zu sein, was sie gerade gesagt hatte. Wahrscheinlich hatte sie es am Frühstückstisch von ihrem Vater aufgeschnappt.
„Ich … ich habe es auf der Straße gehört.“ Sie schluckte.
Der Mann blickte das Kind lange an und lächelte dann.
„Du solltest aufpassen, in welchen Straßen du spielst. Das kann gefährlich werden.“
Dann wandte sich der erste Wächter, der das Geschehen beobachtet hatte, wieder dem Kaufmann zu.
„Mitkommen.“ Damit drehte er sich um und ging mit großen Schritten voran.
Pejo hatte genug gesehen. Er musste sich noch mehr in Acht nehmen, um nicht aufzufallen. Wie schnell man hier in den Fokus der Soldaten geraten konnte, hatte er gerade gesehen. Diese Wächter schienen auf die Einhaltung der Ideologie und der Lebensweise verstärkt zu achten. Er wollte nicht wissen, was mit dem Kaufmann geschehen würde. Langsam schlenderte Pejo ein paar Schritte und beobachtete aus den Augenwinkeln seine Umgebung, während er sich die Auslagen eines Tauschers ansah. Dieser hatte seine Waren auf einem Brett ausgelegt und rief auffordernd in die Menge.
„Ersatzteile! Plastikschüsseln! Plastikbesteck! Plastikbecher! Alles noch von vor dem Ende! Ich tausche, Leute!“
Und tatsächlich bog sich das Brett unter Schüsseln und Dosen, unter Flaschen und Metallteilen, die der Tauscher vor sich ausgebreitet hatte. Pejo nahm eine Plastikflasche und wog sie in der Hand.
„Das ist Plastik, mein junger Freund. Vorendsware. Unkaputtbar, wie es damals hieß. So etwas wird heutzutage nicht mehr hergestellt! Wie auch!“ Der Tauscher schnaubte kurz. Er war ein kleiner, dreckiger Mann. Seine Hände waren dunkel und er machte den Eindruck, als ob er am liebsten in der Erde wühlte oder alte Wracks ausschlachtete.
„Wo hast du das her?“, fragte Pejo.
Die Hand des Mannes zuckte nach vorne und packte ihn am Kragen.
„Wer will das wissen? Wozu willst du das wissen, Junge, hm?“ Er musterte Pejo nun genauer. Sein Blick fiel auf das kurze Haar und er runzelte die Stirn.
„Es war nur Neugierde …“, stammelte Pejo überrascht. Er hatte sich wirklich nichts bei der Frage gedacht. Der Tauscher schaute ihn an, dann schien er zu der Überzeugung zu gelangen, das Pejo harmlos war und ließ ihn los.
„Ich werde dir doch nicht auf die Nase binden, wo ich das Lager gefunden habe. Man verrät seine Ader nicht, das ist doch wohl klar, oder? Willst du nun was tauschen, oder nicht?“
Pejo nickte. Er überlegte kurz. Viel besaß er nicht, und das was er hatte, brauchte er eigentlich, um es gegen etwas Essbares zu tauschen. Trotzdem, eine echte Plastikflasche war ein besonderer Gegenstand. Und, redete er sich ein, es würde sicherlich von Vorteil sein, wenn er nur eine leichte Flasche auf seiner Wanderung schleppen musste, statt seines alten, schweren Behältnisses. Er griff entschlossen in seinen Rucksack. Da bemerkte er, dass der Tauscher immer noch seine Frisur betrachtete. Pejo wurde ganz warm. Wenn der Händler misstrauisch wurde und die Wachen rief, war er geliefert.
„Ist was?“, fragte er so frech wie möglich, um sich Selbstvertrauen zu schenken.
Der Tauscher hob die Augenbrauen. „Nun … einen ungewöhnlichen Haarschnitt hast du. Ich habe gehört, im Norden trägt man so etwas. Der Flusshaven-Schnitt.“
Er hatte es gesagt, dachte Pejo. Er musste reagieren, sonst war er verloren. Schnell ließ er die Glasflasche wieder in seinen Rucksack gleiten. Der geübte Blick des Händlers hätte vielleicht auch daran erkannt, dass er aus Flusshaven kam. Pejo wusste nicht, welche Waren es im Süden gab und welche nicht. Ihm wurde schlagartig bewusst, dass er eigentlich gar nichts über die Welt außerhalb Flusshavens wusste. Er atmete tief durch, dann sah er den Händler gelassen an.
„Es ist eine peinliche Geschichte“, sagte er. „Ich sollte Wache halten, am Feuer draußen in unserem Lager. Wegen der Viecher und den Streunern. Bin eingeschlafen.“
„Und da haben sie dir am Morgen den Kopf rasiert?“, fragte der Händler schadenfroh. Seine gelben Zähne glitzerten in der Sonne. „Eine gerechte Strafe für so eine Dummheit. Ein Kainsmal, das du nun verstecken möchtest, was?“
Pejo schluckte, dann nickte er und blickte zu Boden. Der Tauscher griff in einen Sack, den er hinter sich stehen hatte und holte eine hellblaue Mütze heraus. Er gab sie Pejo in die Hand.
„Sie ist ganz weich!“, sagte der Junge erstaunt. „Was ist das? Wolle? Nein … ich kenne das Material nicht.“
„Das ist Fleece!“, sagte der Händler. „Setz sie auf.“ Pejo tat, wie ihm geheißen wurde. Die Mütze verdeckte seine Haare bis hinunter zum Nacken. Niemand konnte so sehen, wie lang seine Strähnen waren.
„Das ist Fleece“, wiederholte der Tauscher. „Man hat es damals, vor dem Ende, aus alten Plastikflaschen hergestellt.“
Pejo zog sich sofort die Mütze vom Kopf und es knisterte. Erschrocken warf er sie dem Tauscher auf den Tisch.
„So ein Unsinn. Plastikflaschen sind hart und stabil, die Mütze aber ist weich und sanft. Wenn du mich verulken willst, kannst du dir einen anderen Dummen suchen.“
Der Tauscher nahm beleidigt die Mütze an sich.
„Es ist so, wie ich sage. So wird es erzählt, es war eines der Wunder der alten Welt. Aber wenn du kein Wunder kaufen willst, bitte. Ich finde einen anderen Interessenten.“
Doch gerade, als Pejo einlenken wollte, stellte sich ein Mann neben ihn. Pejo erschrak, da er gleich an die Wächter dachte, die auf dem Markt unterwegs waren. Hatten sie ihn erkannt? Hatte er sich verraten? Er wünschte, er hätte die Mütze auf dem Kopf gelassen.
Doch als er sich den Mann genauer ansah, bemerkte er, dass dieser in einen Umhang gehüllt war, der seine Gestalt verbarg. Er hielt dem Tauscher ein Stück Metall mit Drähten über den Tisch entgegen.
„Tauschst du?“ Dabei blickte er etwas gehetzt immer wieder über die Schulter.
Der Tauscher betrachtete das Teil kritisch.
„Wo hast du das denn her … das ist selten …“ Er kniff die Augen zusammen. Dann brüllte er plötzlich.
„Hau ab! Mach, dass du wegkommst!“ Er bückte sich und warf einen Stein nach dem Mann. Dieser zog schnell die Kapuze seines Mantels über das Gesicht, duckte sich und versuchte in der Menge unterzutauchen.
„Verdammter Mutant!“, rief der Händler. „Wollte mich bestehlen!“
Die Leute um sie herum murrten, einige stießen den vermummten Mann vor sich her. Die Atmosphäre lud sich so schnell auf, dass Pejo Angst hatte, sie würden gleich über den Flüchtenden herfallen. Dann war dieser aber ebenso schnell verschwunden, wie er aufgetaucht war.
„Was war mit ihm?“, fragte Pejo überrascht.
„Was mit ihm war? Ein verdammter Mutant war das. Hast du seine Finger nicht gezählt? Da waren ein paar zuviel an seiner Hand. Aber wolltest du nicht was tauschen?“
Pejo war geschockt. Er schaute den Tauscher nur mit großen Augen an. Mutanten, dachte er. In dieser Stadt? Schnell blickte er noch einmal über die Schulter. Er hatte nichts Gutes über Mutanten gehört, entsprechend verängstigt war er nun. Trotzdem, der Tauscher war ihm nun noch unsympathischer. Pejo schnürte seinen Rucksack zusammen. Alles, was er nun noch wollte, war diese Mütze, und dann so schnell wie möglich zu verschwinden.
„Wie teuer?“
4
Als die Sonne unterging, wurde das Treiben auf dem Markt immer bunter. Die ersten Händler begannen zwar, ihre Stände einzupacken, dafür feierten die Menschen aber immer ausgelassener. Nach einem heißen Tag war der Abend nun schwül und die Masse aufgeheizt. Viele Männer trugen Masken, die Stiere oder Drachen darstellen sollten, einige Frauen hingegen waren als Katzen geschminkt oder als Reh verkleidet.
Pejo war den ganzen Tag auf dem Markt herumgeschlendert. Er war froh darüber, dass es ihm gelungen war, die Kopfbedeckung beim Tauscher zu erhandeln. Nun hatte er zwar kein Taschenmesser mehr, dafür aber eine Mütze, die groß genug war, um zu verbergen, dass er die Haare anders trug, als die jungen Menschen in Waldfurth. Es war warm unter dem Fleece und er schwitzte, traute sich aber nicht mehr, die hellblaue Mütze abzusetzen.
Als er das bunte Treiben von einer freien Treppe aus beobachtete, setzte sich ein kleiner Junge neben ihn. Er war ganz in weiß-silbernes Leinen gekleidet und auf dem Kopf hatte er einen viel zu großen Motorradhelm, der sicher noch seinem Urgroßvater gehört hatte.
„Und als was bist du verkleidet?“, fragte Pejo.
„Als Astronaut!“, antwortete der Kleine. „Das sieht man doch.“
„Natürlich“, grinste Pejo. „Du hast recht, dass sieht man doch.“
Nach einem kurzen Schweigen, in dem beide sich den aufgehenden Mond anschauten, flüsterte der Kleine leise.
„Glaubst du, dass es sie wirklich gegeben hat?“
„Was meinst du?“