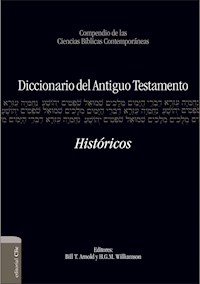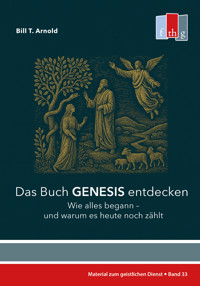
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Forum Theologie & Gemeinde
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In "Das Buch Genesis entdecken" lädt der renommierte Alttestamentler Bill T. Arnold dazu ein, das erste Buch der Bibel mit neuen Augen zu sehen. Mit wissenschaftlicher Tiefe und zugleich geistlichem Gespür erschließt er die großen Linien und theologischen Schlüsselthemen: Schöpfung und Sündenfall, Gottes Verheißungen, der Bund mit Abraham, der Weg der Patriarchen und die Berufung Israels als Gottes erwähltem Volk. Ideal geeignet für Studium, Hauskreis oder persönliche Bibellese bietet diese Veröffentlichung: - eine fundierte Einführung in Inhalt, Struktur und Theologie der Genesis - vertiefende Exkurse zu Schlüsselbegriffen und Kernthemen - Reflexionsfragen zur persönlichen und gemeinschaftlichen Anwendung - zahlreiche Impulse für Lehre, Predigt und Gemeindebau Dieses Buch ist mehr als ein Kommentar – es ist ein theologischer Wegbegleiter für alle, die die Genesis neu entdecken und tiefer verstehen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Vorwort des Verlegers
An die Studierenden
Vorwort des Verfassers
Bevor Sie beginnen …
Teil I: Begegnung mit Gottes Schöpfung
1 Die Erhabenheit von Gottes vollkommener Schöpfung
2 Die Geschichte der ersten menschlichen Familie
3 Was stimmt an diesem Bild nicht?
4 Die Befleckung der Schöpfung durch die Sünde
Teil II: Begegnung mit Abraham: Der treue Knecht Gottes
5 Der Beginn unseres Glaubenserbes
6 Auf den Spuren von Abram und seiner Familie
7 „Da gab ihm Gott den Bund“ (Apg 7,8)
8 Festhalten an Gottes Verheißungen
Teil III: Begegnung mit Jakob: Gottes problematischer Knecht
9 Jakob kämpft mit seiner Familie
10 Jakob ringt mit Gott
Teil IV: Begegnung mit Josef: Gottes vorbildlicher Diener
11 Josef in Ägypten
12 Josef über Ägypten
Teil V: Begegnung mit den Verfassern des Genesisbuches
13 Beweise für die Autorschaft
14 Interpretationen der Hinweise
15 Schluss: Genesis und darüber hinaus
Anhang
Ausgewählte Bibliografie der benutzten Literatur
Glossar
Über den Herausgeber
Seitenliste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Orientierungsmarken
Cover
Table of Contents
Forum Theologie & Gemeinde
Material zum geistlichen Dienst
Band 33
theologisch kompetent – praktisch relevant
Das Buch Genesis entdecken
Wie alles begann – und warum es heute noch zählt
Bill T. Arnold
Forum Theologie & Gemeinde
Bundeswerk des BFP
Encountering the Book of Genesis – A Study of its Content and Issues
Copyright © 1998 Bill T. Arnold
Published by Baker Academic, a division of Baker Publishing Group P.O. Box 6287, Grand Rapids, Ml 49516-6287.
Herausgeber der deutschen Ausgabe: Dr. Rudolf Fichtner
Übersetzung: Forum Theologie & Gemeinde
Copyright der dt. Ausgabe © 2025 Forum Theologie & Gemeinde (FThG)
im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden KdöR, Erzhausen
Bibelstellen sind aus dem Grundtext übersetzt oder, wenn nicht anders angegeben, der Revidierten Elberfelder Bibel, © 1985/1991/2006 SCM R. Brockhaus, Witten, entnommen.
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigungen in Form von Kopien einzelner Seiten oder Ausdrucken einzelner Abschnitte (digitale Version) sind nur für den privaten Gebrauch bzw. innerhalb einer Ortsgemeinde gestattet. Alle anderen Formen der Vervielfältigung (Mikrofilm, andere Verfahren oder die Verarbeitung durch elektronische Systeme) sind ohne schriftliche Einwilligung durch das Forum Theologie & Gemeinde nicht gestattet.
Bildnachweise:
Darwin, Kapitel 1: WikiImages/Pixabay.com
Dürer „Adam und Eva“, Kapitel 2: WikiImages/Pixabay.com
Assyrisches Relief – Gilgamesch, Kapitel 4: Wikimedia.org
Abbildung Einbalsamierung, Kapitel 12: OpenClipart-Vectors/Pixabay.com
Umschlagbild: KI-generiert, admida-Verlagsservice Erzhausen
Layout, Umschlaggestaltung: admida-Verlagsservice, Erzhausen
Realisierung E-Book: admida-Verlagsservice, Erzhausen
Druck: winterwork, Borsdorf
ISBN der Printausgabe: 978-3-942001-87-8
ISBN E-Book: 978-3-942001-46-5
Bestell-Nr. BUW052
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an:[email protected].
Forum Theologie & Gemeinde (FThG)
Industriestr. 6–8, 64390 Erzhausen
[email protected] • www.forum-thg.de
Für meine Eltern, Pastor Walter L. Arnold und seine Frau,
die offensichtlich machten, wie wahr der Rat des Weisheitsbuches ist:
Höre, mein Sohn, auf die Belehrung deines Vaters und achte nicht gering die Unterweisung deiner Mutter! Denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und eine Schmuckkette für deinen Hals.
— Sprüche Salomos 1,8-9 (Menge Bibel)—
Inhalt
Vorwort des Verlegers
An die Studierenden
Vorwort des Verfassers
Bevor Sie beginnen …
Teil I: Begegnung mit Gottes Schöpfung
1 Die Erhabenheit von Gottes vollkommener Schöpfung
2 Die Geschichte der ersten menschlichen Familie
3 Was stimmt an diesem Bild nicht?
4 Die Befleckung der Schöpfung durch die Sünde
Teil II: Begegnung mit Abraham: Der treue Knecht Gottes
5 Der Beginn unseres Glaubenserbes
6 Auf den Spuren von Abram und seiner Familie
7 „Da gab ihm Gott den Bund“ (Apg 7,8)
8 Festhalten an Gottes Verheißungen
Teil III: Begegnung mit Jakob: Gottes problematischer Knecht
9 Jakob kämpft mit seiner Familie
10 Jakob ringt mit Gott
Teil IV: Begegnung mit Josef: Gottes vorbildlicher Diener
11 Josef in Ägypten
12 Josef über Ägypten
Teil V: Begegnung mit den Verfassern des Genesisbuches
13 Beweise für die Autorschaft
14 Interpretationen der Hinweise
15 Schluss: Genesis und darüber hinaus
Anhang
Ausgewählte Bibliografie der benutzten Literatur
Glossar
Über den Herausgeber
Vorwort des Verlegers
Bibelkurse müssen als das Herzstück des Lehrplans für Bibelschulen und Theologische Seminare angesehen werden. Für Christen bildet die Bibel die Grundlage sowohl für unser geistliches als auch für unser intellektuelles Leben – ja, für das ganze Leben. Wenn diese Kurse grundlegend für die christliche Ausbildung sind, dann kommt den diesen Kursen zugrunde liegenden Lehrbüchern eine absolut entscheidende Rolle zu.
Baker Book House bringt zwei getrennte, aber verwandte Reihen von Bänden für Bibelkurse auf College- und Seminarniveau heraus. Encountering Biblical Studies besteht aus Texten für Studenten, während Engaging Biblical Studies Abhandlungen für Absolventen darstellt.
Begegnung mit dem Buch Genesis ist Teil der Encountering-Reihe für das Hochschul-Niveau und versucht, auf dem grundlegenden Überblickstext Encountering the Old Testament: A Christian Survey (Bill T. Arnold und Bryan E. Beyer) aufzubauen. Während der Überblickstext für Studienanfänger geschrieben ist, richtet sich dieser Genesis-Band in erster Linie an fortgeschrittene Studenten.
Statt einer ausführlichen exegetischen Analyse jedes einzelnen Verses in der Genesis gibt dieser Band einen Überblick über das gesamte Buch, wobei der Schwerpunkt auf der Herausarbeitung seiner theologischen Botschaft und seiner praktischen Bedeutung liegt. Er besteht aus einer sachgerechten Einführung und einem Überblicksmaterial mit den notwendigen historischen, literarischen, hermeneutischen und Hintergrundfragen, die in die Darstellung des biblischen Textes eingewoben sind. Einleitende kritische Fragen sind zumeist dem Ende des Bandes vorbehalten.
» Leitgedanken
Bei der Erarbeitung dieses Bandes haben die Herausgeber, der Autor und der Verleger der Reihe die folgenden Grundsätze aufgestellt:
1. Er muss das Beste der evangelikalen Gelehrsamkeit unserer Zeit widerspiegeln.
2. Er muss auf einem Niveau geschrieben sein, das die meisten Studierenden von heute verstehen können.
3. Er muss pädagogisch fundiert sein.
4. Er muss geeignetes Anschauungsmaterial wie Fotos, Karten, Diagramme, Grafiken, Abbildungen und Textboxen enthalten.
5. Er muss versuchen, die Studierenden zu gewinnen, indem er sich auf die biblische Lehre in Bezug auf wichtige lehrmäßige und ethische Angelegenheiten konzentriert.
» Ziele
Die Ziele für Begegnung mit dem Buch Genesis lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Verstand und persönliche Einstellung. Die intellektuellen Ziele bestehen darin, (1) den faktischen Inhalt jedes Buches des Alten Testaments darzustellen, (2) historische, geografische und kulturelle Hintergründe einzuführen, (3) primäre hermeneutische Prinzipien zu umreißen, (4) kritische Fragen anzusprechen (z. B. warum manche Menschen die Bibel anders lesen) und (5) den christlichen Glauben zu begründen.
Die Ziele der persönlichen Einstellung sind ebenfalls fünffach: (1) die Bibel zu einem Teil des Lebens der Studierenden zu machen, (2) ihnen eine Liebe zur Heiligen Schrift zu vermittlen, (3) sie zu besseren Menschen zu machen, (4) ihren Glauben zu stärken und (5) ihre Liebe zu Gott zu fördern. Kurz gesagt: Wenn dieser Text eine Grundlage für ein lebenslanges Bibelstudium schafft, werden der Autor und der Verleger reichlich belohnt werden.
» Übergreifende Themen
Drei wesentliche theologische Themen bestimmen Begegnung mit dem Buch Genesis:Gott, Menschen und das Evangelium, wie es sich auf den Einzelnen bezieht. Die Vorstellung, dass Gott eine Person ist – ein und drei – und ein transzendentes und immanentes Wesen, zieht sich durch den gesamten Text. Darüber hinaus hat dieser Gott Menschen nach seinem Bild geschaffen, die zwar gefallen sind, aber dennoch Objekte seiner erlösenden Liebe sind. Das Evangelium ist das Mittel, die aktive persönliche Kraft, die Gott einsetzt, um die Menschen aus der Finsternis und dem Tod zu retten. Aber das Evangelium leistet mehr als nur Rettung - es stellt wieder her. Es verleiht ansonsten hoffnungslosen Sündern die Entschlossenheit und Kraft, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, weil sie in der Liebe wandeln, die von Gott kommt.
» Merkmale
Das Ziel des Verlegers war es, einerseits ein außergewöhnliches, einzigartiges Hilfsmittel zu bieten, andererseits aber nicht nur im Trend zu sein. Einige der besonderen Merkmale, von denen wir hoffen, dass sie sich für den Lehrenden als hilfreich und für Studierende als inspirierend erweisen werden, sind die folgenden:
• Verwendung von Illustrationen – Fotografien, Abbildungen, Tabellen, Diagramme
• Textboxen, in denen ethische und theologische Fragen erörtert werden, die für Studierende von Interesse und Bedeutung sind
• Kapitelübersichten und Zielsetzungen zu Beginn jedes Kapitels
• Studienfragen am Ende eines jeden Kapitels
• Hilfreiches Glossar
Der Verleger ist davon überzeugt, dass dieses Lehrbuch so pädagogisch fundiert wie möglich sein und die besten Erkenntnisse der pädagogischen Psychologie widerspiegeln sollte. Begegnung mit dem Buch Genesis hat von der Arbeit zweier pädagogischer Spezialisten profitiert. Donald E. Ratcliff, Ph.D., bereitete die Kapitelziele vor und überprüfte die Studienfragen. Klaus Issler, Ph.D., entwickelte das Handbuch für den Ausbilder (mit Unterstützung von Dr. Ratcliff). Der Verleger dankt beiden sehr herzlich.
An die Studierenden
Es ist eine aufregende Erfahrung, dem Buch Genesis zum ersten Mal auf systematische Weise zu begegnen. Es kann aber auch überwältigend sein, weil es so viel zu lernen gibt. Sie müssen nicht nur den Inhalt dieses Buches der Anfänge lernen, sondern auch wichtige Hintergrundinformationen über die Welt, in der die Erzväter lebten.
Der Zweck dieses Lehrbuchs ist es, diese Begegnung etwas weniger entmutigend zu gestalten. Dafür wurde eine Reihe von Lernhilfen in den Text eingebaut. Wir empfehlen Ihnen, sich mit diesem Lehrbuch vertraut zu machen, indem Sie zunächst das Einführungsmaterial lesen, in dem Lernhilfen erklärt werden.
» Exkurse
Exkurse greifen zeitgenössische Themen auf und zeigen, was das Buch Genesis zu diesen drängenden ethischen und theologischen Fragen sagt.
» Kapitelübersichten
Am Anfang jedes Kapitels steht ein kurzer Abriss über den Inhalt des Kapitels. Studienvorschlag: Nehmen Sie sich vor dem Lesen des Kapitels ein paar Minuten Zeit, um die Gliederung zu lesen. Betrachten Sie sie als eine Art Straßenkarte und denken Sie daran, dass Sie Ihr Ziel leichter erreichen, wenn Sie wissen, wohin Sie unterwegs sind.
» Zielsetzungen des Kapitels
Am Anfang eines jeden Kapitels steht eine kurze Liste von Zielen. Diese stellen die Aufgaben dar, die Sie nach dem Lesen des Kapitels ausführen können sollten. Lernvorschläge: Lesen Sie die Ziele sorgfältig durch, bevor Sie mit der Lektüre des Textes beginnen. Behalten Sie beim Lesen des Textes diese Ziele im Hinterkopf und machen Sie sich Notizen, um sich an das Gelesene zu erinnern. Kehren Sie nach der Lektüre des Kapitels zu den Zielen zurück und überprüfen Sie, ob Sie die Aufgaben erfüllen können.
» Schlüsselbegriffe und Glossar
Wichtige Begriffe sind im gesamten Text durch Fettdruck gekennzeichnet. Dadurch werden Sie auf wichtige Wörter oder Ausdrücke aufmerksam gemacht, mit denen Sie möglicherweise nicht vertraut sind. Eine Definition dieser Begriffe finden Sie am Ende des Buches in einem alphabetischen Glossar. Lernvorschlag: Wenn Sie im Text auf einen wichtigen Begriff stoßen, lesen Sie zuerst die Definition, bevor Sie in dem Kapitel weiterlesen.
» Fragen zum Studium
Am Ende jedes Kapitels finden Sie einige Diskussionsfragen, die Sie zur Vorbereitung auf Prüfungen verwenden können. Studienvorschlag: Verfassen Sie zur Vorbereitung auf Prüfungen geeignete Antworten auf die Studienfragen.
» Weiterführende Literatur
Am Ende des Buches befindet sich eine hilfreiche Bibliografie für weiterführende Literatur. Studienvorschlag: Verwenden Sie diese Liste, um Bereiche von besonderem Interesse zu erkunden.
» Visuelle Hilfen
Dieses Lehrbuch enthält eine Vielzahl von Abbildungen in Form von Fotos, Karten und Diagrammen. Jede Illustration wurde sorgfältig ausgewählt und soll den Text nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch leichter zu bewältigen machen.
Möge Ihre Begegnung mit dem Buch Genesis ein spannendes Abenteuer sein!
Vorwort des Verfassers
Dieses Buch ist von Anfang an als Lehrbuch konzipiert worden. Das bedeutet, dass es sich in vielerlei Hinsicht von der Standardgattung der Bibelkommentare unterscheidet. Begegnung mit dem Buch Genesisversucht, den Studierenden in die Hauptthemen des ersten Buches der Bibel einzuführen, ohne jeden Vers oder Abschnitt zu kommentieren. Aus diesem Grund hat der Band einen selektiven Charakter. Lehrende, die es für ihren Unterricht verwenden, können den Inhalt mit ihren eigenen Vorlesungen ergänzen, indem sie bestimmte Themen rekapitulieren und andere hervorheben, die vielleicht im Text ausgelassen wurden. Außerdem sind die Anmerkungen voll mit Verweisen auf die besten Kommentare zur Genesis. Alle, die daran interessiert sind, mehr Details über einzelne Passagen zu erfahren, sollten sich an die vielen hervorragenden und veröffentlichten Quellen wenden. Das Buch ist dazu gedacht, zusammen mit dem Text der Genesis in einer modernen Übersetzung gelesen zu werden. Studierende sollten die am Anfang eines jeden Kapitels aufgeführten Bibelstellen lesen, bevor sie mit dem Kapitel selbst fortfahren.
Ich bin den Kuratoren und der Verwaltung des Asbury Theological Seminary dankbar für ein Forschungsfreisemester im Frühjahr 1997 und dafür, dass sie es mir ermöglichten, drei Monate im Tyndale House in Cambridge zu verbringen, um das Manuskript fertigzustellen. Ich bin auch dem Direktor von Tyndale House, Dr. Bruce Winter, und seinen fähigen Mitarbeitern zu Dank verpflichtet, die meine Zeit dort sowohl angenehm als auch produktiv gestaltet haben.
Meine studentische Hilfskraft, Christopher F. Morgan, hat die Studien- und Prüfungsfragen kompetent und zügig erstellt und bei der redaktionellen Bearbeitung geholfen. Ich bin dem Herausgeber der Reihe Altes Testament, Dr. Eugene H. Merrill, dankbar, der das Manuskript an mehreren Stellen mit hilfreichen Vorschlägen verbessert hat. Jim Weaver und seine Mitarbeiter bei Baker Book House waren wie immer sehr hilfreich.
Schließlich möchte ich diesen Band meinen Eltern, Rev. Walter L. Arnold und seiner Frau, widmen, die für mich immer Vorbilder im Glauben waren. Die Gnade Gottes ist in ihrem Leben offensichtlich, so wie sie auch im Leben der in der Genesis geschilderten Glaubensriesen war.
Bevor Sie beginnen …
Es gibt ein paar Dinge, die Sie über die Struktur des Buches Genesis wissen sollten, bevor Sie beginnen. Erstens gibt das Buch selbst explizite Richtlinien für das Lesen vor. Nur wenige Bücher der Bibel markieren ihre einzelnen Einheiten so deutlich wie die Genesis. Der Begriff tôlēdôt („Generationen“) wird elfmal verwendet, um die einzelnen Einheiten zu markieren, am häufigsten in dem Ausdruck „Dies sind die Generationen von …“. Jedes dieser Vorkommen leitet entweder eine Genealogie oder eine Erzählung ein, die folgt. Wenn es sich bei dem folgenden Material um eine Erzählung handelt, wird der Satz typischerweise so übersetzt: „Dies ist der Bericht von X …“
Wenn tôlēdôt eine Genealogie einleitet, wie es fünfmal der Fall ist, ist eine Übersetzung wie „Die Nachkommen von X …“ zu erwarten.
Die tôlēdôt-Vorkommen dienen als Schlagworte, um das Buch in elf Tafeln oder Abschnitte zu gliedern. Der Schöpfungsbericht in Genesis 1 ist die einzige Tafel, die nicht mit tôlēdôt eingeleitet wird, und dient als Prolog für das Ganze.
1,1–2,3 Prolog
2,4–4,26 tôlēdôt von Himmel und Erde
5,1–6,8 tôlēdôt von Adams Linie
6,9–9,29 tôlēdôt von Noah
10,1–11,9 tôlēdôt der Söhne Noahs (Sem, Ham und Jafeth)
11,10–26 tôlēdôt von Sem
11,27–25,11 tôlēdôt von Terach (Abraham-Erzählung)
25,12–18 tôlēdôt von Ismael
25,19–35,29 tôlēdôt von Isaak (Jakob-Erzählung)
36,1–37,1 tôlēdôt von Esau (zweimal verwendet)
37,2–50,26 tôlēdôt von Jakob (Josef-Erzählung)
Achten Sie auf die tôlēdôt-Formeln, wenn Sie sich durch die Genesis bewegen. Sie sind wie literarische „Scharniere“, die die Inhalte miteinander verbinden.
Außerdem sollten Sie im Auge behalten, dass diese elf Einheiten in der Genesis in vier größere Abschnitte gruppiert sind. Die ersten fünf tôlēdôt-Sprüche wurden zusammen mit dem Prolog zu einem Abschnitt zusammengefasst, der sich mit der Geschichte der Welt von der Schöpfung bis zur Berufung Abrahams beschäftigt (1,1–11,26). Dieser Abschnitt wird oft als Urgeschichte bezeichnet, da er sich mit den ersten Zeitaltern vor dem Erscheinen der Erzväter Israels beschäftigt.
Die restlichen tôlēdôt-Tafeln in der Genesis sind anhand der Erzväter-Geschichte gegliedert.
1,1–11,26 Urgeschichte
11,27–25,18 Abraham
25,19–37,1 Abrahams Familie: Isaak und Jakob
37,2–50,26 Josef
Im Aufbau dieses Buches bin ich dieser Gliederung gefolgt.
Teil I: Begegnung mit Gottes Schöpfung
Genesis 1–11
Des HERRN ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen.
– Psalm 24,1
1 Die Erhabenheit von Gottes vollkommener Schöpfung
Genesis 1,1–2,3
Durch des HERRN Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. […] Denn er sprach, und es geschah; er gebot, und es stand da.
– Ps 33,6.9
Ergänzende Lektüre: Psalm 8,3-9
Gliederung
• Wie hat alles angefangen?
• Einzelheiten aus Genesis 1
Die wiederkehrende Schöpfungsformel
Die Symmetrie von Genesis 1
Die Funktion von Genesis 1,1-2
• Bedeutung von Genesis 1
Souveränität Gottes
Die Güte der Schöpfung
Die Bestimmung des Menschen
Studienziele
Nach der Lektüre dieses Kapitels sollten Sie in der Lage sein:
1. Ablauf und Ergebnis im Schöpfungsbericht zu vergleichen und zu erkennen, wie diese mit den Ursprungstheorien zusammenhängen;
2. zwei literarische Muster in Genesis 1 zu beschreiben: die Schöpfungsformel und die Symmetrie zwischen den beiden Einheiten von je drei Tagen;
3. mehrere mögliche Übersetzungen von Genesis 1,1 zu nennen und auszuführen, wie sie sich auf die zentralen Aussagen des Kapitels auswirken;
4. die Lehre von Gottes Souveränität und die Art und Weise, wie sie in Genesis 1 vermittelt wird, zusammenzufassen;
5. zu beschreiben, was es bedeutet, dass der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde.
Wie oft denken Sie über Anfänge nach – den Anfang des Lebens, den Anfang der Welt, den Anfang der Zivilisation? Solche Fragen waren bei allen alten Völkern, auch bei den Israeliten, eine ständige Quelle der Spekulationen und haben den menschlichen Geist seit der frühesten Zivilisation beschäftigt.
Die Bibel beginnt mit einem Buch der Anfänge, der Genesis. Das Wort „Genesis“ selbst ist der griechische Titel des Buches und bedeutet „Ursprung“. Die Juden benannten es nach dem ersten hebräischen Wort, bērē⁾šît, „Im Anfang“. Als ein Buch der Anfänge handelt die Genesis vom Anfang der Welt, dem Anfang der Geschichte, dem Anfang der Sünde, der Erlösung und von Gottes Volk.
1.1 Wie hat alles angefangen?
Wir Menschen waren schon immer beeindruckt, ja geradezu überwältigt, von dieser spektakulären Welt um uns herum. Von den ersten primitiven Beobachtungen der Himmelsbewegungen, die von den alten Babyloniern aufgezeichnet wurden, bis hin zu den bemerkenswerten Fotos von der Erde, die von den Shuttles der NASA aufgenommen wurden – wir alle nehmen wahr, wie prachtvoll dieses Universum ist.
Es ist erstaunlich, wie wenig wir eigentlich über den Ablauf der Schöpfung wissen. Immerhin macht die Bibel dies selbst zu einem der zentralen Themen des christlichen Denkens. Hier, in den ersten Büchern der Bibel, ist die Schöpfung die Grundlage des mosaischen Gesetzes. Später wird die Schöpfung für die Psalmisten zum Grund, Gott zu loben (Ps 19,1-6; 104,24-30), und für Hiob zur Antwort auf das Problem des Bösen (Hiob 38). Die Großartigkeit der Schöpfung Gottes wurde zum prophetischen Paradigma für Wiederherstellung (Jes 66,22-23) und für die Ouvertüre im Johannesevangelium (Joh 1,1-5).
Doch so wichtig die Schöpfung theologisch auch ist, die genauen Details des Schöpfungsprozesses scheinen in den ersten Kapiteln der Genesis unwichtig zu sein. Wie es ein Autor formulierte: „Die Frage, was erschaffen wurde, geht der Frage voraus, wie die Schöpfung stattgefunden hat.“1
Unser Mangel an Informationen führt zu vielen Kontroversen im Zusammenhang mit der Schöpfung. Viele Christen verstricken sich in Debatten über die „Tag-Zeitalter-Theorie“, die „Lücken-Theorie“ oder die stets unbequeme Frage der Evolution. Wenn moderne Geologen recht haben und die Erde 4,5 Milliarden Jahre alt ist, hat Gott dann plötzlich eine Erde erschaffen, die nur scheinbar alt ist, oder ist eine Form der theistischen Evolution eher anzunehmen? Kann man eine alte Erde akzeptieren und gleichzeitig die Evolution ablehnen? Obwohl diese Fragen wichtig sind und diskutiert werden müssen, sind sie nicht das Hauptanliegen der biblischen Schöpfungsberichte.
Warum haben wir also nicht mehr Informationen zu den Details der Schöpfung? Offensichtlich geht es der Bibel um etwas anderes als diese kontroversen Themen. Wir müssen als christliche Leser zu dem Schluss kommen, dass Gott möchte, dass wir etwas anderes aus diesen Kapiteln herauslesen, etwas Offensichtlicheres. Obwohl wir diese umstrittenen Fragen kurz ansprechen werden, wird unser Hauptziel sein, die zentralen Botschaften der biblischen Schöpfungsberichte herauszuarbeiten.
Die Tag-Zeitalter-Debatte
Genesis 1 wirft eine verwirrende Frage über die Natur der sieben Schöpfungstage auf, die sich um das hebräische Wort yôm, „Tag“, dreht. Handelt es sich bei den sechs Schöpfungstagen buchstäblich um Tage mit 24 Stunden, die eine tatsächliche Woche beschreiben, in der Gott die Welt erschuf? Oder stellen die „Tage“ Zeitalter von unbestimmter Länge dar, die sogenannte Tag-Zeitalter-Theorie (day-age theory)? Leider kann der hebräische Begriff für „Tag“ auf beide Arten verwendet und die Frage nicht auf Grundlage des Begriffs selbst gelöst werden. Der Ausdruck. „An dem Tag, an dem Gott der Herr die Erde und den Himmel machte“ in Genesis 2,4b (NRSV) ist ein Beispiel für „Tag“ im unmittelbaren Kontext, das sicherlich ein Zeitalter von unbestimmter Länge bedeutet.
Die Frage, wie das Wort in Genesis 1 verwendet wird, ist schwierig genug. Aber zu allem Überfluss hängt das Problem mit einer anderen kontroversen Frage zusammen. Wer glaubt, dass jeder Tag je 24 Stunden hatte, muss auch die Theorie der „jungen Erde“ (young earth) akzeptieren, die wiederum mit den Beweisen der modernen Geologie in Einklang gebracht werden muss. Aktuelle geologische Beweise legen nahe, dass die Erde etwa 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Der „Tag-Zeitalter“-Ansatz ist leichter mit den geologischen Beweisen in Einklang zu bringen. Aber viele Christen fürchten, dass er die Tür für evolutionäre Theorien öffnet.
Wir sollten uns nicht zu sehr mit der Frage beschäftigen, wie lange Gott gebraucht hat, um das Universum zu erschaffen. Auch sollte diese Debatte nicht als Lackmustest verwendet werden, um festzustellen, wer es mit Christus wirklich ernst meint. Dies ist keine Glaubensfrage. Wenn es wichtig wäre zu wissen, wie lange Gott gebraucht hat, um die Welt zu erschaffen, dann hätte die Bibel das deutlich gemacht. Die wichtige Lehre aus Genesis 1 ist, dass er sie tatsächlich erschaffen hat, und dass er sie in jeder Hinsicht ordentlich und gut gemacht hat.
1.2 Details zu Genesis 1
Genesis 1 ist die Ouvertüre zu dem, was man wohl das größte literarische Meisterwerk der Welt nennen dürfte. Der gehobene Stil gleicht eher der Poesie und dieser Abschnitt ist einzigartig im Vergleich zu den erzählenden Passagen, die wir an anderer Stelle in Genesis finden. Wir werden damit beginnen, sich wiederholende Muster und die Symmetrie des Kapitels zu betrachten, und dann fragen, wie sich die ersten beiden Verse zum Ganzen verhalten.
» Die wiederkehrende Schöpfungsformel
Achten Sie beim Lesen von Genesis 1 (oder genauer gesagt von Genesis 1,1-2,3) auf das wiederkehrende Muster, das dem Ganzen Struktur verleiht.2 Ein charakteristisches Merkmal des Kapitels ist, dass der Autor dieses literarische Muster verwendet, um jeden Schöpfungstag einzuleiten.
1. Einleitung: „Und Gott sprach […]“
2. Befehl: „Es werde / es werde gesammelt / es bringe hervor“
3. Ausführung: „Und es war so“
4. Bewertung: „Und Gott sah, dass es gut war“
5. Zeitlicher Ablauf: „Und es wurde Abend, und es wurde Morgen“
Es gibt einen gewissen Grad an Variation in der Verwendung dieser wiederkehrenden Formel. Eine Konstante aber ist die göttliche Bewertung, dass jedes Element von Gottes Schöpfung „gut“ (hebr. ̣tôb) ist. In Kapitel 1 scheint der Begriff nicht moralisch oder ethisch konnotiert zu sein, wie in „gut“ im Gegensatz zu „schlecht“ oder „böse“, wie es in Genesis 2 der Fall ist. Hier geht es um Zustimmung und Akzeptanz. Das geschaffene Objekt ist genau so, wie es sein sollte, ohne Fehler oder Makel. An jedem Schöpfungstag ist Gott der begnadete Künstler, der zurücktritt, um sein eigenes Werk zu bewundern und zu billigen. Wenn Gott sein Werk betrachtet, ist er damit zufrieden.
Die Rolle des Menschen in der Schöpfung wird durch das Wirken Gottes am sechsten Schöpfungstag hervorgehoben (1,24-31). Dieses Mal beinhaltet die wiederkehrende Formel eine göttliche Bewertung mit einer subtilen Änderung. Als Gott seine Schöpfung von Mann und Frau begutachtet, hält er sie nicht nur für „gut“, sondern für „sehr gut“ (V. 31). Die wiederkehrende Formel ruft den Eindruck hervor, dass die Menschheit der Höhepunkt der Schöpfung ist und Gott mit dem Menschen mehr als zufrieden.
Die Tage der Schöpfung
Form
Fülle
Tag
erschaffenes Objekt
à
Tag
erschaffenes Objekt
1
ein Werk: Licht
à
4
ein Werk: Leuchten
2
ein Werk: Meer und Firmament
à
5
ein Werk: Vögel, Fische
3
zwei Werke: Erde und Pflanzen
à
6
zwei Werke: Landtiere und Menschen
Tab. 1: Die Tage der Schöpfung
» Die Symmetrie von Genesis 1
Die Verwendung der Schöpfungsformel als Einleitung und gleichzeitig Abschluss jedes Tages schafft auch eine interessante symmetrische Struktur in Genesis 1.3 Der Inhalt der ersten drei Schöpfungstage entspricht den letzten drei Tagen in einer Weise, die den dritten und sechsten Tag hervorhebt. Die Tage drei und sechs korrespondieren, weil sie jeweils zwei Schöpfungsakte enthalten: Erde und Vegetation am dritten Tag (V. 9-13) und Landtiere und Menschen am sechsten Tag (V. 24-31). Zu dieser inhaltlichen Entsprechung passt die literarische Form, da Schlüsselelemente der Schöpfungsformel für die Tage drei und sechs wiederholt werden: die Einleitung („Und Gott sprach“, V. 9, 11, 24, 26) und die göttliche Bewertung (mit ̣tôb, V. 10, 12, 25, 31).
Ähnliche inhaltliche Entsprechungen verbinden auch jeden der anderen Schöpfungstage. Die Leuchten des vierten Tages entsprechen der Erschaffung des Lichts am ersten Tag. Die am fünften Tag erschaffenen Vögel und Fische entsprechen dem Himmel des zweiten Tages. Außerdem dürfte diese jeweils aus drei Tagen bestehende Reihe Gottes Antwort auf das Chaos und die Unordnung von Vers 2 („formlos und leer“) sein, indem er Form und Fülle schuf. Die ersten drei Tage gaben der Erde Form und die letzten drei füllten sie. So gesehen sind Gottes Segnungen von Tieren und Menschen („seid fruchtbar und mehret euch“, V. 22 und 28) auch Hinweise, wie wir seine schöpferische Tätigkeit fortsetzen sollen. Das „formlose und leere“ Stadium der Schöpfung bedeutet schlicht, dass die Erde kahl war, ein unbewohnter Ort, der nun von den Menschen und den Tieren, die Gott geschaffen hat, bevölkert und bewohnt werden soll.4
Die Wiederholung der Schöpfungsformel und der symmetrische Aufbau der Schöpfungstage betonen die Einzigartigkeit des siebten Tages (2,1-3). Als Höhepunkt der Schöpfung ist Gottes Sabbatruhe nicht das, was wir uns normalerweise unter „Ruhe“ vorstellen, als ob Gott eine Pause von einer anstrengenden Arbeit bräuchte. Vielmehr bedeutet der Begriff im Grunde „Aufhören“ und impliziert gleichzeitig die Feier und Vollendung einer Leistung. Das Konzept wurde für das nationale Israel wichtig und birgt noch immer Hoffnung für gläubige Christen, da die Schöpfungsgeschichte sich zu diesem Punkt hin aufbaut und bezeugt, dass „bei dem lebendigen Gott Ruhe ist.“5 Gott erklärte das Werk eines jeden der anderen Schöpfungstage für gut, aber diesen einen heiligte er: „Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn“ (2,3).
» Die Funktion von Genesis 1,1-2
Wie der wichtige siebte Tag außerhalb der Schöpfungsformeln steht, so auch die ersten beiden Verse der Genesis. Diese Eröffnungsworte der Bibel werfen zwei miteinander verbundene Fragen auf, die zu zwei sich gegenseitig ausschließenden Interpretationen führen. Erstens müssen wir uns mit der Bedeutung des ersten Wortes von Vers 1 beschäftigen, bērē⁾šît, das traditionell mit „im Anfang“ übersetzt wird. Zweitens wird die Antwort auf diese Frage Auswirkungen darauf haben, wie sich die ersten drei Verse zueinander verhalten.
Das Problem bei der Auslegung von bērē⁾šît ist kompliziert und erfordert einige Kenntnisse des Hebräischen, um es vollständig zu verstehen.6 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dem Substantiv (rē⁾šîtAnfang) hier eine Präposition (bē in) vorangestellt ist, die in einer Form verwendet wird, die häufig einen bestimmten Artikel nach sich zieht, besonders bei einem Ausdruck wie „in (dem) Anfang“. Ohne den bestimmten Artikel würde diese Schreibweise des Wortes normalerweise in einer gebundenen bzw. constructus-Form mit einem folgenden Substantiv, einem Genitiv, auftreten, also „am Anfang des Schaffens“. In Genesis 1,1 gibt es jedoch weder einen bestimmten Artikel noch ein anderes Substantiv, das daran gebunden ist, wie zu erwarten wäre. Aus diesem Grund haben einige Gelehrte argumentiert, dass der Begriff ein abhängiger Temporalsatz ist: „Im Anfang, als Gott schuf […]“ oder „Als Gott begann, […] zu schaffen“. In diesem Fall wäre Vers 1 abhängig vom Hauptsatz in Vers 2: „Als Gott anfing zu schaffen […], war die Erde formlos und leer […]“ Eine andere Möglichkeit ist, dass Vers 1 von Vers 3 abhängig ist, wenn man davon ausgeht, dass Vers 2 ein Nebensatz ist: „Als Gott anfing zu schaffen […] (nun war die Erde formlos und leer), da sprach Gott […]“ In jedem Fall machte sich Gott an die Arbeit mit präexistenter, ursprünglicher Materie. Er schuf die Welt aus präexistenter Materie.
Obwohl diese Übersetzungen möglich sind, werden sie von den Regeln der hebräischen Grammatik nicht verlangt. Es finden sich weitere Beispiele im Alten Testament für ähnliche zeitliche Bezeichnungen ohne bestimmten Artikel, bei denen eindeutig keine Notwendigkeit besteht, das erste Wort bzw. den ersten Vers als einen abhängigen Satz zu interpretieren. Stattdessen gehen alle alten Übersetzungen des Alten Testaments und die überwiegende Mehrheit der zeitgenössischen Übersetzungen und Kommentare von dem traditionellen Verständnis der Anfangsworte als eigenständigem Hauptsatz aus: „Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.“ Doch damit noch nicht genug.
Auch unter denjenigen, die an diesem traditionellen Verständnis von Vers 1 festhalten, finden sich unterschiedliche Interpretationen. Einige haben Vers 1 so verstanden, dass er eine ursprüngliche, perfekte Schöpfung beschreibt. Zwischen den Versen 1 und 2 ereignete sich der Sündenfall Satans, der zu einer Verunreinigung der Schöpfung Gottes führte. Vers 2 beschreibe also den Zustand der Erde als Folge von Satans Fall. Vers 3 beginne dann mit einer Beschreibung von Gottes „Neuschöpfung“ oder Wiederaufbau der chaotischen Welt. Dies wird gemeinhin als „Lückentheorie“ (gap theory) bezeichnet, da Vers 2 eine Lücke von unbestimmbarer Dauer beschreibe. Viele, die diese Ansicht vertreten, ordnen die Dinosaurier und die Prä-Homo-Sapiens-Menschenaffen in diese nebulöse Zeitlücke ein.
Die Lückentheorie tut dem Text von Genesis 1,1-3 jedoch literarisch und sprachlich Unrecht.7 Ein ausgewogenerer Ansatz betrachtet Vers 1 als einen unabhängigen Hauptsatz, der die Ereignisse der Verse 2-31 zusammenfasst.8 Vers 1 ist ein Titel oder eine Überschrift für das gesamte Kapitel. Der Ausdruck „der Himmel und die Erde“ ist ein semitischer Merismus, ein rhetorisches Mittel, das Totalität ausdrückt (wie Alpha und Omega und alles dazwischen).
Vers 1 erklärt dann, dass alles, was existiert, ein Ergebnis der schöpferischen Tätigkeit Gottes ist, die in diesem Kapitel beschrieben wird. Vers 2 beschreibt die Situation vor der Schöpfung, das präexistierende Chaos. Obwohl diese Interpretation die vorherige Existenz chaotischer Materie voraussetzt, stellt sie nicht unbedingt ein Chaos dar, das sich Gottes Kontrolle entzieht oder seinen schöpferischen Prozessen entgegensteht. An anderer Stelle in der Bibel wird deutlich, dass Gott das Universum aus dem Nichts erschaffen hat, und zwar ohne seine Kräfte oder Energie zu strapazieren (Ps 33,6.9; 148,5; Hebr 11,3).
Neben der Interpretation des ersten Verses als Überschrift, kann man ihn auch als Beschreibung des ersten Schöpfungsaktes sehen.9 Dies würde auch Vers 1 als unabhängigen Hauptsatz auffassen und hat den Vorteil, dass es die älteste und traditionellste Lesart von Genesis 1,1-3 ist. Dieser Ansatz interpretiert die ersten drei Verse synchron: Vers 1 ist der erste Schöpfungsakt, Vers 2 ist die Folge von Vers 1, und Vers 3 ist das erste schöpferische Wort. Diese Interpretation wird von alten Übersetzungen und modernen Gelehrten unterstützt und ist am ehesten mit der biblischen Lehre der creatio ex nihilo (d. h. der Lehre, dass Gott das Universum aus dem Nichts und mühelos geschaffen hat) vereinbar.
Unabhängig von unserer Interpretation von Genesis 1,1-3 ist wesentlich, dass unser Text die Präexistenz Gottes bezeugt. Wie wir sehen werden, interessierten sich andere antike Völker nicht nur für die Erschaffung der Welt, sondern auch für die Herkunft der Götter! Im Gegensatz dazu hat Israel nie versucht, die Ursprünge Gottes zu erklären. Gott war immer schon da, und bevor er schuf, war er alleine. Er sprach einfach und der Rest des Universums kam ins Dasein. Dies war ein radikales und neues Konzept im Alten Orient, genauso wie für moderne Gläubige. Und tatsächlich ist dies der erste Schritt auf unserer Glaubensreise. Wenn wir diese große biblische Wahrheit akzeptieren, wird der Rest einfach sein.
1.3 Die Bedeutung von Genesis 1
Wie zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, haben Fragen über die Anfänge des Lebens und der Welt den menschlichen Geist seit Beginn der Geschichte schon immer beschäftigt. Wie wir in Kapitel 3 zeigen werden, bedienten sich alle anderen alten Kulturen der Mythologie, um alles zu rechtfertigen, was für das menschliche Leben und die Gesellschaft wesentlich schien, indem sie es auf irgendeine ursprüngliche, begründende Handlung bezogen.10 Aber die Antworten der Bibel auf solche Fragen sind anders. Schon in Genesis 1 sehen wir, dass die Israeliten nicht an mythologischen Erklärungen dessen interessiert waren, was ihnen wichtig erschien. Vielmehr wurde das Wesentliche für das menschliche Leben von einem souveränen, schöpferischen Gott bestimmt.
Wir haben das Buch der Genesis auch als „das größte literarische Meisterwerk der Welt“ bezeichnet. Doch christliche Leser erkennen darin seit 2000 Jahren mehr als literarische Kunstfertigkeit. Es ist auch Gottes Wort für die Gläubigen von heute. Als solches kann die theologische Bedeutung von Genesis 1 kaum genug werden. Unsere weitere Lektüre der Bibel wäre verarmt, ja unmöglich, wenn wir nicht zuerst die Lehren der Schöpfung lernen würden. Von den vielen wichtigen Konzepten möchte ich hier nur drei hervorheben: die Souveränität Gottes, die Güte seiner Schöpfung und die Bestimmung des Menschen in der Schöpfung.
» Souveränität Gottes
Auch andere alte Kulturen der alttestamentlichen Zeit hatten Schöpfungsberichte (siehe Kap. 3, unten). Diese verschiedenen Darstellungen der Schöpfung weisen mindestens zwei gemeinsame Merkmale auf: Erstens erschuf(en) der/die Gott/Götter die Welt unter großen Schwierigkeiten. Typischerweise war die Erschaffung des Universums das Ergebnis eines großen kosmischen Kampfes, und oft benutzte eine Gottheit Magie, um zu erschaffen. Zweitens begann die schöpferische Gottheit immer mit einer präexistenten Materie.
Die frühe Kirche erkannte die Bedeutung des Befehls in der Schöpfungsformel: „Es werde Licht.“ Die lateinische Übersetzung dieses Satzes (fiat lux) gab Anlass zu dem Ausdruck „Schöpfung per fiat“, der Gottes Methode der Schöpfung durch göttlichen Befehl oder Erlass betont. Die Implikation ist, dass die Schöpfung keine große Anstrengung von Seiten Gottes erforderte. Er spricht einfach, und die Dinge geschehen. Diese Lehre von der Schöpfung aus eigenem Antrieb lehrt Gottes Allmacht und Souveränität.
Obwohl die genaue Bedeutung der ersten drei Verse von Genesis 1 unsicher bleibt, ist die Bedeutung des Wortes „geschaffen“ in Vers 1 interessant.11 Im gesamten Alten Testament ist der Gott Israels immer das Subjekt dieses hebräischen Verbs (bārā⁾), niemals heidnische Gottheiten oder Menschen. Außerdem bezieht sich das Objekt dieses Verbs nie auf die bei der Schöpfung verwendeten Materialien, sondern auf den Gegenstand der Schöpfung selbst. Obwohl dieses Verb selbst nicht die Lehre der creatio ex nihilo („Schöpfung aus dem Nichts“) beweisen kann, impliziert es sicherlich Gottes Freiheit und Macht und seine mühelose Souveränität beim Erschaffen. Es muss anderen Stellen der Bibel überlassen bleiben, zu beweisen, dass Gott das Universum ohne Verwendung präexistenter Materie erschaffen hat (Ps 33,6.9; 148,5; Hebr 11,3).12
Der Eröffnungsvers der Genesis legt die theologischen Grundlagen für die wahrhaft biblische Religion fest. Jahwe, der Herr des Bundes mit Israel, ist auch der souveräne Gott der Schöpfung. Dies ist die Eingangsaussage der Schrift und sie dient dazu, die späteren Erklärungen Israels zu ergänzen, dass Jahwe der Gott der Erlösung ist.13
Hat Gott die Evolution benutzt, um die Welt zu erschaffen?
Wie verhält sich der Bericht der Genesis über die Ursprünge des Menschen zur modernen Wissenschaft, insbesondere zur Evolutionstheorie? Diese Frage wurde seit Charles Darwins Veröffentlichung von The Origin of Species (Die Entstehung der Arten) im Jahr 1859 auf unterschiedliche Weise beantwortet.14
Ich biete hier einen kurzen Überblick über drei Positionen.
1. „Theistische Evolutionisten“ glauben, dass die Bibel vertrauenswürdig ist, und akzeptieren die biblische Lehre, dass Gott die Welt geschaffen hat. Aber die Genesis erklärt nur, wer schuf, nicht, wie er es tat. Theistische Evolutionisten akzeptieren auch die von der modernen Wissenschaft definierten Prozesse als die Mittel, die Gott benutzte, um den Menschen zu erschaffen. Sie akzeptieren Konzepte wie die organische Evolution (vom Molekül zum Menschen) und die Makroevolution (vom Affen zum Menschen) als Erklärung für den Ursprung des Lebens. Die meisten theistischen Evolutionisten betrachten Genesis 1 als eine allegorische oder bildliche Erklärung der Abhängigkeit des Menschen vom Schöpfergott.
Obwohl der theistisch-evolutionäre Ansatz möglich ist, ist es schwierig, Genesis 1-2 mit bestimmten evolutionären Ideen in Einklang zu bringen. Die Evolutionstheorie lehrt, dass der Mensch aus zufälligen Ereignissen entstanden ist, das Ergebnis der natürlichen Auslese und des Überlebens des Stärkeren. Auf der anderen Seite stellt die Genesis ein erstes Menschenpaar als Eltern der gesamten menschlichen Spezies dar.
Adam und Eva wurden absichtlich von Gott nach seinem Bild geschaffen. Diese wichtige Lehre, die an anderer Stelle in der Schrift bestätigt wird, ist schwer mit der Zufälligkeit der Evolution in Einklang zu bringen.
Die immer noch schlecht belegte Theorie der organischen Evolution (die Entwicklung vom Molekül zum Menschen) schafft noch größere Probleme für die theistischen Evolutionisten. Genesis 2,7 scheint eine besondere Schöpfung aus anorganischem Material zu vermitteln und nicht durch eine vorher existierende Lebensform: „Gott der Herr formte den Menschen aus dem Staub der Erde.“
2. Als Reaktion auf die Evolutionstheorien akzeptieren einige eine Ansicht, die als „Kurzzeit-Kreationismus“ bezeichnet werden kann (auch bekannt als „flacher Kreationismus“, flat creationism). Diese Ansicht geht von einer wörtlichen Interpretation der 24-Stunden-Tage in Genesis 1 aus, was eine junge Erde erfordert. Die meisten Geologen glauben, dass die Erde etwa 4,5 bis 5 Milliarden Jahre alt ist. Kurzzeitkreationisten stellen jedoch die Schlussfolgerungen der modernen Datierungstechniken in Frage. Unter der Annahme, dass die Genealogien von Genesis 5 und 11 für eine präzise Chronologie verwendet werden können, übernehmen Kurzzeitkreationisten im Wesentlichen die Chronologie von Erzbischof James Ussher (1581–1656), wonach die Erde nicht mehr als 10 000 Jahre alt ist. Eine universelle Sintflut erklärt die Sedimentablagerungen und Fossilien und bietet eine teilweise Erklärung für das scheinbar hohe Alter der Erde.
3. Eine weitere Option ist der „progressive Kreationismus“. Diese Position erkennt die Problematik an, biblische Genealogien für eine präzise Chronologie anzuwenden. Angesichts der überwältigenden Beweise, die für ein hohes Alter der Erde sprechen, akzeptieren progressive Kreationisten die traditionelle Tag-Zeitalter-Interpretation der Schöpfungstage in Genesis 1. Das heißt, sie ordnen die Tage verschiedenen geologischen Perioden zu. Auf diese Weise betonen progressive Kreationisten die Komplementarität zwischen der Genesis und der modernen Wissenschaft.
Obwohl es verschiedene Arten von progressiven Kreationisten gibt, akzeptieren alle eine alte Erde und ein gewisses Maß an Mikroevolutionstheorie. Die Unterschiede zwischen den biologischen Arten werden durch Mutationen erklärt, die durch natürliche Selektion über einen langen Zeitraum hinweg entstanden sind. Eine solche Mikroevolution erklärt die heutige Vielfalt der Organismen aus den von Gott geschaffenen Urformen „nach ihren verschiedenen Arten“ (Gen 1,11). Aber progressive Kreationisten lehnen Makroevolution und organische Evolution ab, weil es an wissenschaftlichen Beweisen mangelt.
In der Bibel wird die Evolution nicht diskutiert. Die moderne Wissenschaft versucht, den Ursprung des Lebens mit einer „Wie“-Frage zu erklären, während die Bibel mit der Beantwortung der „Wer“- und „Was“-Fragen beginnt. Die Genesis beginnt mit einem persönlichen Gott, der das Universum absichtlich erschaffen hat und die Menschen nach seinem Ebenbild schuf. Der Mensch ist nicht das Ergebnis von blindem Zufall und natürlicher Selektion. Die Bibel und die objektive Wissenschaft stehen niemals im Widerspruch zueinander. Aber jeder wissenschaftliche Ansatz, der Gottes Schöpferrolle leugnet, gerät schnell in Konflikt mit der Bibel und denen, die sie für vertrauenswürdig halten.
» Die Güte der Schöpfung
Wie wir gesehen haben, bewertete Gott jedes Element der Schöpfung und erklärte es für „gut“. Die wiederkehrende Schöpfungsformel erreichte ihren Höhepunkt am sechsten Tag, als Gott die Menschen schuf und ihnen Pflanzen zu essen gab. Als Gott alles betrachtete, was er gemacht hatte, war er zufrieden („es war sehr gut“). Zu diesem Zeitpunkt im biblischen Bericht wurde nichts Schlechtes oder Böses erwähnt. Es gab nur die Güte von Gott und seiner Schöpfung.
Sehr bald wird klar werden, dass Gottes Schöpfung durch das Handeln der Menschen verunreinigt wurde. Der Rest der biblischen Geschichte ist eine Geschichte der Erlösung von Sünde und Gebrochenheit. Aber in all dem verkündet Genesis 1 die Überzeugung, dass Gottes Schöpfung von Natur aus gut ist und die Sünde und das Böse irgendwie aber dort eingedrungen sind, wo sie nicht hingehören und darum unwillkommene Gäste sind.
Dreieinigkeit in Genesis 1?
Am krönenden sechsten Tag schuf Gott die Menschheit (1,26-27). Der göttliche Erlass dieses Tages war anders als die anderen, in denen Gott die Erde oder einen Teil davon ansprach: „Lass das Wasser […] gesammelt werden“, „Lass das Land hervorbringen“ und „Lass das Wasser wimmeln“. Am sechsten Tag aber verwendet Gott Pluralpronomina der ersten Person: „Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei“ (1,26 LU 2017). Diese besondere Art der göttlichen Rede unterstreicht die erhabene Stellung des Menschen über die gesamte Schöpfung.
Es gibt mindestens sechs Verständnismöglichkeiten für die Pluralpronomina in 1,26.15 Erstens: Einige haben argumentiert, der Vers beziehe sich auf andere Götter und sei ein Überbleibsel der polytheistischen und mythologischen Quellen des Autors. Zweitens kann sich der Plural auf einen himmlischen Hofstaat beziehen, der aus einer Engelsschar besteht. Drittens spricht Gott zu etwas, das er kürzlich erschaffen hat, höchstwahrscheinlich die Erde. Viertens ist der angewandte Plural der „Plural der Majestät“, der vor allem von Königen verwendet wird. Das Fehlen eines hebräischen Majestätsplurals mit Verben und Pronomen hat die meisten Gelehrten dazu gebracht, diese Interpretation aufzugeben. Fünftens können die Pronomina ein Beispiel für den „Plural der Selbstberatung“ sein, in dem ein Individuum zu sich selbst spricht in der Entschlossenheit, etwas zu tun. Als Beispiel wird die göttliche Rede in Genesis 11,7 angeführt: „Komm, lass uns hinabsteigen“. Sechstens kann es sich bei dem Plural um einen „Plural der Fülle“ handeln, bei dem Gott mit dem Geist spricht, der in 1,2 erwähnt wird. Der Geist wird also zum Partner Gottes in der Schöpfung. Wir sollten vorsichtig sein, trinitarische Theologie in die hier und anderswo in der göttlichen Rede verwendeten Pluralpronomina hineinzulesen (siehe auch Gen 3,22; 11,7; Jes 6,8). Andererseits ist das Buch Genesis anspruchsvoll genug, um mit dem Konzept der Pluralität innerhalb der Einheit umzugehen. Gleich der nächste Vers (1,27) schildert den einzelnen Menschen, der als Pluralität geschaffen wurde, „männlich und weiblich“ (siehe auch Gen 5,1-2a). Die göttliche Pluralität von 1,26 nimmt die menschliche Pluralität von 1,27 vorweg und bereitet sie vor.16 So wie der eine Gott aus dem Ausdruck seiner Pluralität heraus schuf, so existiert der Mensch in seiner Pluralität. In diesem Sinne spiegelt die Beziehung zwischen Mann und Frau die Rolle dessen wider, wie Gott sich zu sich selbst verhält.
Obwohl wir nicht das Genesisbuch heranziehen sollten, um die Existenz der Dreieinigkeit zu beweisen, steht dieser Abschnitt auch nicht im Widerspruch zu einem christlichen Verständnis des dreieinigen Gottes. Das, was in Genesis nur als Andeutung und Ahnung erschien, musste auf die deutliche Aussage warten, bis „die Zeit erfüllt war“ (Gal 4,4).
» Die Bestimmung der Menschheit
Auf dem Höhepunkt des Schöpfungsberichtes werden die Würde des Menschen und die Bedeutung des ersten Menschenpaares hervorgehoben: „Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei“ (1,26, LU 2017).
Es ist unmöglich, die theologische Bedeutung des Geschaffenseins nach dem Bilde Gottes (dem imago Dei, mit den Worten der frühen Kirche) überzubewerten. Es gibt mindestens drei Implikationen. Erstens legt das Gebot, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren, sicherlich nahe, dass die Menschen die schöpferische Tätigkeit Gottes fortsetzen sollen (1,28). Sie sollen das fortsetzen, was er begonnen hat. Zweitens sollte die Menschheit als Träger des Ebenbildes Gottes die Herrschaft über die ganze Schöpfung haben (1,26). Adam und Eva waren die sichtbaren Vertreter Gottes in der Schöpfung. Drittens bedeutet die Erschaffung als Ebenbild Gottes auch, dass der Mensch speziell für die Beziehung zu Gott geschaffen wurde. Anders als der Rest der Schöpfung ist das menschliche Leben kein Selbstzweck. Es beinhaltet das Privileg der Beziehung zu Gott.17
Dieses erste Kapitel des Buches Genesis ist entscheidend für die Feststellung, wer Gott ist, wer wir sind und wie wir uns zur Welt um uns herum verhalten. Ihr Studium dieses Kapitels sollte Sie dazu bringen, sich den Heerscharen der Schöpfung anzuschließen und Gott zu loben – „Denn er gebot, und sie waren geschaffen“ (Ps 148,5).
Studienfragen
1. Wie hängen die sechs Tage des Schöpfungswerkes Gottes mit der Aussage in Vers 2 zusammen, dass die Erde „formlos und leer“ war?
2. Erläutern Sie zwei mögliche Bedeutungen des ersten hebräischen Wortes in Genesis und geben Sie die theologischen Implikationen jeder dieser Bedeutungen an.
3. Inwiefern unterscheidet sich der Schöpfungsbericht im Buch Genesis von den Schöpfungsberichten anderer alter Kulturen?
4. Erläutern Sie die Bedeutung der Aussage, „die Menschen sind nach dem Bilde Gottes geschaffen“.
5. Beschreiben Sie drei Möglichkeiten, Genesis 1 im Licht der Ansprüche der modernen Wissenschaft zu interpretieren.
6. Erläutern Sie mehrere Möglichkeiten bezüglich der Verwendung des Pluralpronomens in der ersten Person („uns“) in Genesis 1,26.
7. Geben Sie zwei Definitionen für das hebräische Wort yôm („Tag“) an und diskutieren Sie, wie diese Definitionen die Auslegung von Genesis 1 beeinflussen.
Claus Westermann, Genesis 1–11, übers. John J. Scullion, Continental Commentary (Minneapolis: Fortress, 1984), 22.
2Gordon J. Wenham, Genesis 1–15, Word Biblical Commentary 1 (Waco, Tex.: Word, 1987), 6; Westermann, Genesis 1–11, 84-85; und Victor P. Hamilton, Handbook on the Pentateuch: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium (Grand Rapids: Baker, 1982), 19-20.
3Victor P. Hamilton, The Book of Genesis: Chapters 1–17, New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 125; Derek Kidner, Genesis: An Introduction and Commentary, Tyndale Old Testament Commentary (Downers Grove: InterVarsity, 1967), 45-46; Allen P. Ross, Creation and Blessing: A Guide to the Study and Exposition of the Book of Genesis (Grand Rapids: Baker, 1988), 104; und Wenham, Genesis 1–15, 6-7.
David Toshio Tsumura, The Earth and the Waters in Genesis 1 and 2: A Linguistic Investigation, Journal for the Study of the Old Testament-Supplement Series 83 (Sheffield: JSOT, 1989), 17-43.
5Gerhard von Rad, Genesis: A Commentary, übers. John H. Marks, reV. ed., Old Testament Library (Philadelphia, Westminster, 1972), 62.
6Bill T. Arnold, „רֵאשׁית,“ in New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, hrsg. Willem A. VanGemeren, 5 vols. (Grand Rapids: Zondervan, 1997) 3:1025-1026.
7Ross, Creation and Blessing, 718-723.
Von Rad, Genesis, 47.
9Wenham, Genesis 1–15, 11-13.
10Raffaele Pettazzoni, „Myths of Beginnings and Creation-Myths,“ in Essays on the History of Religions, übers. H. J. Rose (Leiden: E. J. Brill, 1967), 24-26.
11Wieder verwendet in 1,21.27 (dreimal); 2,3; 5,1-2 (dreimal); 6,7; und an anderen Stellen im Alten Testament.
12Kenneth A. Mathews, Genesis 1–11,26, New American Commentary 1A (Nashville: Broadman, 1996), 128-129.
13Christoph Barth, God with Us: A Theological Introduction to the Old Testament, ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 9-11.
Für Details zum Folgenden und weiteren Literaturhinweisen s. Pattle P. T. Pun. „Evolution“ in: Evangelical dictionary of Theology. hrsg. Walter A. Elwell (Grand Rapids: Baker, 1984), 388-392.
15Für Einzelheiten zum Folgenden siehe Hamilton, Genesis 1–17, 132-134, und Eugene H. Merrill und Alan J. Hauser, „Is the Doctrine of the Trinity Implied in the Genesis Creation Account?“ in The Genesis Debate: Persistent Questions about Creation and the Flood, ed. Ronald F. Youngblood (Nashville: Thomas Nelson, 1986), 110-129
16John H. Sailhamer, The Pentateuch as Narrative: A Biblical-Theological Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1992), 95-96.
Gerald Bray, „The Significance of God’s Image in Man“, Tyndale Bulletin 42, Nr. 2 (1991): 224-225.
2 Die Geschichte der ersten menschlichen Familie
Genesis 2,4–4,26
Auf das erste Erröten der Sünde folgt ihre Gleichgültigkeit.
– Henry David Thoreau (1817–1762)1
Ergänzende Lektüre: Jakobus 1,12-15
Gliederung
Was ist anders in Genesis 2–4?
• Die Ereignisse im Garten Eden (2–3)
Adam und Eva im Garten (2)
Historizität von Adam und Eva
Sex als Geschenk Gottes
• Adam und Eva aus dem Garten vertrieben (3)
Woher kommt die Bosheit Satans?
Sollen Frauen den Männern untertan sein?
• Ereignisse außerhalb des Gartens Eden (4)
Studienziele
Nach der Lektüre dieses Kapitels sollten Sie in der Lage sein,
1. den literarischen Stil von Kapitel 1 mit dem Stil in den Kapiteln 2–4 zu vergleichen;
2. den Wechsel der Gottesnamen zu erklären;
3. in Genesis 2 die Unterschiede zwischen Gottes Erschaffung der Menschen und dem Rest seiner Schöpfung aufzuzeigen;
4. die moralischen Konsequenzen zusammenzufassen, die sich daraus ergeben, dass Adam und Eva von der verbotenen Frucht aßen;
5. die Merkmale der Versuchung in Genesis 3 zu nennen;
6. das Muster des Sündenfalls und dessen Folgen zu benennen;
7. die möglichen Beweggründe für den ersten Mord und die Bedeutung von Gottes Umgang mit Kain anzugeben.
In Genesis 1 war alles hell und schön. Gott begann, indem er Licht auf die Bühne brachte, und fuhr fort, indem er eine makellose und perfekte Welt ins Dasein rief. Diese ideale Welt wurde mit einem Menschenpaar gekrönt, das nach seinem Ebenbild geschaffen wurde und in perfekter Harmonie mit ihm lebt. Aber wie schnell geht die Bibel zur tragischen Wende über! Diese nächste Einheit der Genesis ist ebenso dunkel und düster, wie Genesis 1 hell und schön war.
2.1 Was ist anders an Genesis 2–4?
Wenn Sie diese Kapitel lesen, werden Sie vielleicht einige große Unterschiede im Vergleich zu Genesis 1 bemerken. Es fehlen die strikte Symmetrie und die wiederkehrenden Formeln. Auch der gehobene Prosastil mit seiner fast poetischen Qualität ist verschwunden. Stattdessen finden wir einen Erzählstil, der bodenständig, fast volkstümlich ist. Diese Erzählung schildert nun, was mit Gottes „guter“ Schöpfung geschehen ist, wobei dem Höhepunkt seiner Schöpfung, dem menschlichen Leben, besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Der Mensch wird „zum Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, so wie er in Kapitel 1 der Höhepunkt war.“2
Sie werden auch bemerken, dass die universelle, panoramische Sicht von Genesis 1 nun durch die Beschreibung eines spezifischen Gartens ersetzt wird. Anstatt die Erschaffung des Universums und alles darin zu beschreiben, erzählt Genesis 2 von der liebevollen Errichtung des Gartens Eden, einschließlich seiner Flüsse und Bäume. Die große universelle Szene von Genesis 1 wird in Genesis 2 durch eine kleinere Bühne ersetzt, auf der sich ein wichtiges Drama entfalten wird. So verlangsamt sich auch das Tempo. Kapitel 1 führte uns in atemberaubender Schnelligkeit durch die sechs Tage der Schöpfung. Nun verlangsamt sich das Tempo in Kapitel 2 dramatisch, und noch mehr in Kapitel 3, als der Autor von den intimen Details eines Gesprächs zwischen Eva und ihrem missgünstigen Gesprächspartner berichtet.
Es ist offensichtlich, dass die Details dieses Gesprächs und die Ereignisse, die nun folgen, für den Autor von großem Interesse sind. Tatsächlich können wir daraus schließen, dass Gott mehr daran interessiert ist, dass wir aus den tragischen menschlichen Entscheidungen im Garten Eden lernen, als daran, dass wir die Details verstehen, wie er das Universum geschaffen hat. Offensichtlich ist es wichtiger, wie wir auf eine Anfechtung reagieren, als über den Langzeitkreationismus oder die theistische Evolution zu streiten.
2.2 Die Ereignisse im Garten Eden (2–3)
Wie im Prolog erwähnt, findet sich im Buch Genesis elfmal der tôlēdôt-Ausdruck: „Dies sind die Geschlechter von […]“ Die erste Nennung steht in 2,4 – normalerweise übersetzt mit „Dies ist der Bericht über die Erschaffung der Himmel und der Erde“ (NLT). Die nächste Belegstelle findet sich in 5,1, welche die Kapitel 2–4 zu einer literarischen Einheit über die erste menschliche Familie verbindet.3 Genesis 2 beschreibt die Erschaffung der Familie in ihrem paradiesischen Garten, und Genesis 3 erzählt von ihrem Untergang.
Kapitel 2 und 3 sind außerdem verbunden durch einen plötzlichen Wechsel in der Verwendung des Gottesnamens. In Genesis 1,1–2,3 begegneten wir der Bezeichnung „Gott“, wenn der Autor den majestätischen Gott beschreiben wollte, der die Welt einfach ins Dasein sprach. In Genesis 2 und 3 wird dagegen plötzlich „Gott der HERR“ (bzw. Jahwe) verwendet, was merkwürdigerweise nur noch einmal im Pentateuch vorkommt (Ex 9,30).4 Der Autor verbindet in Genesis 2–3 das Wort für Gott mit dem persönlicheren Gottesnamen („Jahwe“), wohl um zu zeigen, dass der majestätische, souveräne Schöpfer derselbe persönliche, liebende Gott ist, der direkt zu Adam und Eva spricht und eine recht innige Beziehung zu ihnen zu haben scheint. Diese Verwendung des Gottesnamens in Genesis 1–3 spielte auch eine wichtige Rolle in modernen wissenschaftlichen Diskussionen über die Urheberschaft der Genesis, wie wir in Kapitel 14 sehen werden.
» Adam und Eva im Garten (2)
Genesis 2 (eigentlich 2,4-25) wird oft als ein zweiter Schöpfungsbericht aufgefasst. Zwar spiegelt sich die erhabene Erschaffung des Menschen in Genesis 1,27 in den ganz persönlichen Details von Gensis 2,7 wider, und es gibt weitere Parallelen zwischen diesen Kapiteln. Tatsächlich aber hat dieser Abschnitt einen ganz anderen Umfang und eine ganz andere Funktion als Genesis 1. Die Bibel bewegt sich schnell von der universalen Schöpfung zu einem Garten im Osten (2,8).
Historizität von Adam und Eva
Die Namen, die in dieser Erzählung für das erste Menschenpaar und ihr Garten-Heim verwendet werden, haben symbolische Bedeutung.5 „Adam“ ist sowohl Eigenname als auch ein Oberbegriff für „Mensch“. In den ersten Kapiteln der Genesis ist es sehr wahrscheinlich kein persönlicher Name, sondern bezieht sich auf die Erschaffung der Menschheit als Ganzes. Alttestamentliche Autoren verwendeten oft Paronomasien (= Wortspiele), und der Ausdruck „Gott der HERR formte den Menschen [ʾādām] aus dem Staub der Erde [ʾādāmâ]“ unterstreicht die Beziehung des Menschen zum Erdboden (Gen 2,7). Es gibt grammatikalische Hinweise dafür, „Adam“ zum ersten Mal in Genesis 4,25-26 (oder vielleicht 5,1-2) als Personennamen zu deuten.6
Ebenso haben die Namen „Eva“ und „Eden“ eine symbolische Bedeutung für den Erzähler. „Eva“ (ḥawwâ) ist ein Wortspiel mit dem Verb „leben“ und erklärt daher die Bemerkung des Mannes, sie werde „die Mutter aller Lebenden“ werden (Gen 3,20). Der Name des Gartens „Eden“ sollte mit dem hebräischen Wort „Vergnügen“ oder „Wonne“ in Verbindung gebracht werden. Sehr wahrscheinlich haben auch andere Namen in der Genesis-Erzählung, wie z. B. Kain und Abel, eine symbolische Bedeutung.
Die offensichtliche Symbolik, die durch diese Namen und bestimmte andere Merkmale beabsichtigt ist, hat viele zu der Annahme veranlasst, dass die hier beschriebenen Ereignisse nicht historisch sind. Es wird oft erklärt, dass die Erzählung ein metaphorischer Bericht über die Ursprünge der Menschheit und ein Paradigma für die Auswirkungen der Sünde im menschlichen Leben sei. In diesem Sinne repräsentieren Adam und Eva die Menschheit im Allgemeinen, waren aber keine historischen Figuren an einem buchstäblichen Ort namens Garten Eden. Außerdem wird von vielen bestritten, dass der Mensch von einem einzigen Eltern- bzw. einem ersten Menschenpaar abstammt (Monogenismus). Stattdessen glaubt man, dass die Menschheit nach und nach und vielleicht sogar aus mehreren Anfangspunkten hervorgegangen ist (Polygenese).
Allerdings zeigen sich mehrere Probleme bei diesem Ansatz. Es besteht kein Zweifel daran, dass ein Garten Gottes im Osten namens Eden symbolisch für die Anwesenheit Gottes in einer perfekten Umgebung stand. Aber die namentliche Erwähnung der Flüsse Tigris und Euphrat und andere Details in der Beschreibung des Gartens (Gen 2,10-14) zeigen, dass der Erzähler ihn als einen realen und historischen Ort ansah und wahrscheinlich in Mesopotamien verortete. Unsere Unfähigkeit, den Garten heute zu lokalisieren, ist kein Grund, seine antike Realität anzuzweifeln.
Darüber hinaus ist die Episode vom Garten Eden (Gen 2,4–4,26) durch ihre tôlēdôt-Einleitung („Dies ist der Bericht von den Himmeln und der Erde“, 2,4a) mit denen von Adams Linie (5,1–6,8), der von Noah (6,9–9,29) und so weiter verbunden, bis hin zu Abraham, Isaak und Jakobs Söhnen, den Vorfahren der zwölf Stämme des nationalen Israel.
Der Text der Bibel verwendet also Genealogien und Erzählungen, um eine gerade Linie von Adam zu Mose und den Israeliten und zu den übrigen Figuren der alttestamentlichen Geschichte zu ziehen. An welchem Punkt entlang dieser Reihenfolge sollten Schlüsselpersonen plötzlich mythisch oder metaphorisch werden? Die Antwort auf diese Frage impliziert einen subjektiven Eingriff in den Text. Der biblische Text enthält keinen Hinweis darauf, dass diese Personen etwas anderes als historische Figuren sind.
Genesis 1–11 wurde mit großer literarischer Kunstfertigkeit geschrieben. Das ist der Grund für all die Symbolik und Wortspiele. Es gibt keinen Grund für die Annahme, dass der Erzähler die Personen als etwas anderes als historisch ansah. Es ist wahrscheinlicher, dass die symbolischen Namen und Wortspiele in der Erzählung beabsichtigt sind – ein Ergebnis der literarischen Kunstfertigkeit des Erzählers. So ist die Erzählung ein Beispiel für die Natur der Sünde und ihre Folgen. Aber es ist auch ein historischer Bericht über unsere ersten Eltern und die Folgen ihrer Rebellion.7
In der Anfangsszene ist die Welt eine völlige Wüste (2,5). Das Problem war, dass Gott noch keinen Regen schickte und es keine Menschen gab, die sich um die Erde kümmerten. Aber dann „formte“ Gott, der Herr, den Menschen, wie ein begabter Töpfer behutsam ein neues Gefäß formt. Der Herr nahm den leblosen Körper des Menschen und „hauchte“ seinen eigenen Atem in seine Lungen, was den Menschen von allen anderen Geschöpfen unterscheidet. Der Mensch ist viel mehr als ein von Gott geformtes Stück Erde.8 Er trägt die Gabe des Lebens in sich, die eine Gabe Gottes selbst ist. Der Akt, dem Lehmgeschöpf Leben einzuhauchen, hat die Intimität eines Kusses – von Angesicht zu Angesicht – und stellt die persönliche Art und Weise der Beziehung zwischen Mensch und Gott dar.9 Wir alle wurden geschaffen, um in friedlicher und liebevoller Harmonie mit unserem Schöpfer zu leben.
Der folgende Abschnitt beschreibt dann den Garten, den Gott für das erste Menschenpaar vorbereitet hatte (2,8-14). Der wunderschöne Garten war ein perfekter Ort, mit herrlichen Bäumen und vier ertragreichen Flüssen. Der Garten befand sich an einem Ort namens Eden, was an das hebräische Wort für „Vergnügen“ oder „Wonne“ denken lässt. Gott sorgte vollständig für Adams Bedürfnisse nach einem perfekten, idealen Leben. Dazu gehörte ein Baum in der Mitte des Gartens, der die Quelle des Lebens selbst war – der „Baum des Lebens“ (2,9).
Adam und Eva lernen schnell, dass sie nicht das Zentrum ihres Universums sind und dass sich das Leben nicht um sie dreht. Selbst in einer idealen, paradiesischen Welt, in der Gott alles Notwendige für ein glückseliges Leben bereitgestellt hat, müssen die Menschen lernen, dass Gott und seine Gaben des Lebens genauso wie seine eigene persönliche Gegenwart im Mittelpunkt stehen.
Es gibt noch einen zweiten Baum, „der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“ (2,9).10 Alles, was wir über Gottes Schöpfung wissen, war „gut“, wie es in Genesis 1 betont wird. Nun hören wir zum ersten Mal von der Möglichkeit des „Bösen“. Die genaue Bedeutung der Erkenntnis, die durch den Verzehr der Frucht erlangt wird, wurde viel diskutiert.11 Sie scheint mit moralischer Autonomie zu tun zu haben oder mit der Fähigkeit zu entscheiden, was richtig ist, ohne Gottes Willen zu berücksichtigen. Das Gebot, nicht von dieser Frucht zu essen, ist gleichzeitig ein Verbot, selbst zu entscheiden, was das Beste für die eigene Zukunft ist. Jedes menschliche Bestreben, das ohne einen von Gott gegebenen Bezugsrahmen oder ohne moralische Richtlinien eine Handlungsweise vorgibt, ist moralische Meuterei, eine Usurpation der Autorität Gottes.