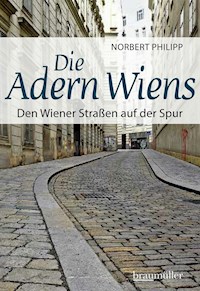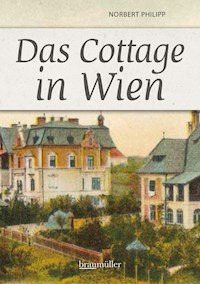
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Cottage-Viertel ist Villen-Kolonie, Schutzzone, Wohn-Vision, Gartenstadt und für viele genau jenes Wien, von dem man nur träumen kann. Aus Schottergrube und Weingarten entstand ein Wiener Unikat, eine Wohngegend, die heute als eine der teuersten und schönsten der Stadt gilt: ein luftiges Ensemble aus kleinen Burgen, Mini-Schlösschen und Villen. Begleiten Sie den Autor in ein Viertel, in dem sich die Architekturstile so vielfältig und ungewöhnlich kreuzen wie die Lebenslinien von berühmten Künstlern, Kreativen, Forschergeistern und Unternehmern, die die Häuser des Cottage seit jeher beseelt haben. Das Buch nimmt Sie mit zu den Ursprüngen einer großen Idee, geboren zwischen Stadtwachstum und Börsenkrach, führt durch die goldene Ära des Viertels bis hinein in dunklere Tage. Und weiter noch in die Gegenwart, in der verträumte Gassen noch immer zum Spazieren, Entdecken und Kennenlernen einladen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
NORBERT PHILIPP
Das Cottage in Wien
Inhalt
Einleitung
1 Wien, wie es baut, staubt und stinkt
2 Die Cottage-Idee geht ihren Weg
Exkurs 1: Die Netzwerkerin und der Widerstandskämpfer: Die Hasenauerstraße Nr. 61
3 Wien entdeckt seinen Rand
4 Eine Gegend macht Karriere
Exkurs 2: Die Universitätssternwarte
5 Wien in grüner Watte
6 Als die Häuser Villen wurden
Exkurs 3: Die Architekten, die im Cottage wirkten
Exkurs 4: Der Häuserzeichner
7 Lebenslinien und andere Wege
Exkurs 5: Stephi B. und das Cottage-Sanatorium
8 Das soziale Leben im Cottage
Exkurs 6: HADEP – Die Cottage-Clique vom Eislaufplatz
Danke
Quellennachweise
Früher war alles anders
Und heute ist es nicht anders als früher. Der Bogen, den dieses Buch schlägt, führt mehr als 150 Jahre zurück. In eine Ära, die sich als „Gründerzeit“ tief in die Biografie Wiens eingekerbt hat. Manches Kapitel, das das Buch aufschlägt, hätte man in einer Zeitung von heute genauso gut aufblättern können. Etwa: Wien demoliert sich selbst. Aber keine Sorge: nur, um sich wieder neu aufzubauen. Nur anders eben. In der Gründerzeit blieb kaum ein Stein auf dem anderen. Und vieles, was der Stadt aus dieser Phase stadtmorphologisch und architektonisch erhalten blieb, schätzen die Wiener heute noch mehr als in jener Zeit, in der es geschaffen wurde. In der neuen Gründerzeit, die Wien schon seit vielen Jahren durchläuft, ist die Dynamik kaum anders. Nur dass jene Teile Wiens, die davon in 150 Jahren noch übrig sein werden, kaum jemals so begehrt sein werden. Wenn das Wien von 2022 bis dahin überhaupt noch steht.
Wien wächst und ächzt. Fast wie vor 150 Jahren. Der Immobilienmarkt setzt die Stadt unter Druck. Die Investoren und Spekulanten sind die Städtebauer, die die Stadt und ihr architektonisches Bild am meisten prägen. Und das Wachstum in Rendite umschlagen. Mieten und Immobilienpreise steigen Anfang 2022 noch immer, da konnte eine Pandemie gar nicht wesentlich dazwischengrätschen. Und 1872, als das Projekt „Cottage-Viertel“ formell an den Start ging, durch die Gründung des Wiener Cottage Vereins, war es ähnlich. Nur dass die Stadt damals kein Konzept kannte, das heute „Soziales Wohnen“ heißt und wofür Wien im 21. Jahrhundert als Vorzeigemodell von einem Symposium zum anderen herumgereicht wird. Auf die Mietpreisspirale hatte die Stadt in der Hochgründerzeit noch keine Antwort. Deswegen befanden ein paar ambitionierte und engagierte Menschen in einem Verein vor mehr als 150 Jahren: Es ist Zeit, die Antwort selbst zu geben. Vor allem da sie die Architektur nicht so recht formulieren konnte. Scheinbar. Und auch dieser Prozess begann mit langen Phasen, in denen man überhaupt erst einmal versuchte, die richtigen Fragen zu stellen. Etwa: Wie wollen wir oder wie sollen wir überhaupt wohnen? Und was könnte denn „Wohnen“ bedeuten außer dem zweckbefreiten Aufenthalt in einem Raum, bis die Arbeit wieder ruft. Und diese rief ziemlich oft und beharrlich in den Tagen jener Ära, die man heute Gründerzeit nennt.
Das „Cottage“ in Wien war ein Vorschlag, das Wohnen neu zu denken. Und gleichzeitig auch die Beziehung zwischen dem Haus und der Familie, die es bewohnt, neu auszubalancieren. Und am besten das Verhältnis zur Nachbarschaft gleich mit. In einer Ära, in der das „Neue“ gar nicht die beste Ausgangsposition hatte, vor allem nicht architektonisch. Denn wenn alles Vertraute im wilden Wandel bröckelt, dann hält man sich lieber an andere Anker: Im Wandel des 19. Jahrhunderts war das auch so ähnlich wie heute. Die Verlässlichkeiten liegen in den Formen und Möglichkeiten, die man schon kennt. Das „Neu-Erfinden“ hatte damals in der Gestaltung nicht seine beste Phase. Dafür war wahrscheinlich rundherum – technologisch, industriell, ökonomisch – alles andere zu schnell zu neu geworden. Man hielt sich an jene Vorlagen, die die Kunst- und Architekturgeschichte längst brav in die Schubladen eingeordnet hatte. Man lieh, kopierte, imitierte und kupferte ab. So hielt sich der neue Palast oft an den Palazzo der Renaissance. Und die Architektur überhaupt gerne an die Vergangenheit. Wien orientierte sich an Paris. Und die Bürger an der baulichen Attitüde, die sie von den Adeligen so gut kannten. Zumindest in der Gestaltung lag die Gegenwart damals weit verstreut in anderen Zeiten. Oder gar in anderen Ländern.
Der „Wiener Cottage Verein“ berief sich schon in seinem Namen auf eine ganz bestimmte Vorlage. Sie war geborgt in England mitsamt dem Wort, das es bezeichnet: ein englisches Landhaus, das man in einen urbanen Kontext versetzen wollte, noch dazu in eine Stadt, die das Konzept des „frei stehenden Hauses“ so auch noch nicht gekannt hatte. Wien hatte Kirchen, architektonische Prunkstücke, Paläste. Aber Häuser wie diese, hatte Wien noch nicht. Das Projekt des „Wiener Cottage Vereins“ wurde zur Modellsiedlung. Das Engagement eines Vereins setzte diese Vorlage in eine Landschaft, die dadurch zum ersten Mal als „suburbaner Raum“ qualifiziert wurde. Dort war die Stadt nicht mehr so sehr „Stadt“, wie man sie bislang kannte. Und auch noch nicht so sehr „Land“, wie man es sich sonst vorgestellt hätte. Ein Siedlungsraum mit städtischen und ländlichen Qualitäten. Eine Gegend, die Stadt und Land war und keines von beiden zugleich.
Im heutigen 18. Bezirk hat sich in der Gegend, die schon damals auf Karten mit „Türkenschanze“ bezeichnet worden war, durch das Engagement des „Wiener Cottage Vereins“ eine Idee festgesetzt. Im Jahr 2022 wird der Verein 150 Jahre alt. Die Idee, die ihm zugrunde liegt und heute untrennbar Teil der Geschichte Wiens ist, ist noch älter. Und sie dauert an. Selbst wenn sie sich schließlich in vielerlei Hinsicht ganz anders entwickelt hat, als sich das die Gründer des Vereins vielleicht jemals ausgemalt hätten. Doch dass die Idee überhaupt in der Gegenwart Wiens angekommen ist, gemeinsam mit den Qualitäten im Stadtraum und -bild, die sie produziert hat, verdankt sich dem „Wiener Cottage Verein“. Sein Engagement, seine Beharrlichkeit und sein Vertrauen in die Ursprungsidee haben vieles von den städtebaulichen und architektonischen Qualitäten ins Heute getragen. Auch wenn dazwischen Bomben, düstere Zeiten, Ignoranz und Spekulantentum stark an dem Viertel gezerrt und gerüttelt haben.
Neue Zeiten, neues Wohnen
Eine Idee, geborgt und gleich phonetisch „verwienert“. Das war auch schon den „Bastionen“ aus Italien so ergangen, als sie zu den „Basteien“ wurden. Diesmal war das „Cottage“ dran. Und ein Schritt zum Wiener Wortgut führte über das Französische, oder in diesem Fall, das Pseudo-Französische: Deshalb klang es dann an manchen Stellen und in manchen Milieus bis in die Gegenwart nach „Koteesch“, wenn jemand über die Gegend sprach, in der sich Wiens erste Villenkolonie erfolgreich etablierte. In einer Ära, in der Straßen oft mit „Avenue“ und „Boulevard“ geadelt und Gehsteige zu „Trottoirs“ gerieten, konnte die Zukunft der Stadt gar nicht französisch genug sein. Justament an dieser Stelle der Geschichte beginnt auch die Erzählung dieser englischen Idee in Wien. Und dabei traut man sich ja gar nicht anzusetzen, ohne dieses berühmteste aller Handschreiben zu erwähnen. Ein Stück Papier, das man wohl hinter Panzerglas noch heute in Wien ausgestellt hätte, wenn es nicht beim Brand des Justizpalastes im Jahr 1927 verbrannt wäre.
Denn Städtebau im 19. Jahrhundert funktionierte landläufig noch nach einem Standardmuster: Ein Mann, ein Wille und der geschah. Tatsächlich, so fing es an: „Es ist mein Wille“, waren die Worte, die von Kaiser Franz Joseph fast so geläufig sind wie „Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut“. Ganz so floskelhaft und harmlos wie Zweiteres war die Willensbekundung allerdings nicht: Schließlich brachte sie etwas Gewaltiges in Gang, nämlich den Generalumbau der Reichshauptstadt. Wien wurde erst zu Wien in jenen Tagen. Durch den Abbruch der Stadtbasteien. Durch den Willen des Kaisers, die Stadt „groß“ und als „Weltstadt“ zu denken. Der Umbruch war radikal. Die architektonischen Ideen dagegen waren es nicht. Ja, einen Boulevard wie diesen, die Ringstraße, hatten die Wiener und auch Europa trotzdem noch nicht gesehen. Doch außer prunken, glänzen, imponieren und dick auftragen, war der Architektur an jener Stelle jedoch nicht viel eingefallen. Trotz immenser Expertise, die sich da über Jahrhunderte angehäuft hatte und innovativer Bautechnologien, die im Werkzeugkasten nur darauf warteten, endlich gezückt zu werden.
Ein halbes Jahrhundert lang geriet Wien zur Großbaustelle. Die Stadt quoll über. Und nicht nur von Wienern, die gerade erst zu Wienern wurden. Sondern auch von allem, was diese sonst noch so produzierten: angefangen bei Staub, Dreck und Gestank.
Alles, was Menschen brauchen, um gesund zu leben, war vor lauter Stadtwachstum dagegen knapp geworden: Licht, Luft, Platz. Und vor allem auch: Natur. Die einen wohnten im Luxus. Für die meisten anderen war Wohnen zum Luxus geraten. Vor lauter Übergröße, Superlativ und Welt, Welt, Welt in Begriffen, wie „Weltwirtschaft“ und „Weltausstellung“, auf die alle noch Anfang der 1870er-Jahre hinfieberten, bevor sie die Cholera tatsächlich erwischte, war eines aus dem Fokus geraten: die Welt, in der man tatsächlich lebt. Und die besteht für viele aus einer kleinen Gruppe von Menschen, in die man hineingeboren wird und die sich Familie nennt. Diese musste sich schon vornehmlich um sich selbst kümmern. Zuallererst um die Räume, in denen sie leben wollte. Denn so etwas wie soziale Agenden hatten sich auch die berühmtesten Architekten jener Zeit noch nicht auf die To-do-Liste geschrieben. Auf dieser standen meistens ganz andere Dinge, künstliche Bedürfnisse etwa wie jenes nach Repräsentation.
Doch einer der maßgeblichsten Gestalter jener Epoche, Heinrich Ferstel, definierte seinen Tellerrand nicht mit der Ringstraße, entlang welcher er auch emsig baute. Er machte sich Gedanken über das Haus als „Haus“, als schützende Blase der wesentlichen gesellschaftlichen Kernzelle, eben der Familie. Die Ideen, die er dazu gemeinsam mit seinem Freund Rudolf Eitelberger, dem Kunsthistoriker, Professor an der Akademie der bildenden Künste, dazu niederschrieb, waren die Grundlage, auf die sich der Cottage Verein bei seiner Gründung berief. Und diese passierte im März 1872. Da war das „Museum für Kunst und Industrie“, das Ferstel so imposant an den Ring gestellt hatte, gerade erst einmal fünf Monate fertig. Sein Co-Autor Eitelberger wurde hier erster Direktor.
Wohnqualitäten, die nicht altern
Zwischen Türkenschanze und Gürtelstraße formierte sich eine alternative Idee vom „idealen Wien“. „Ideal“ vor allem für Menschen, die nicht so sehr begünstigt vom Kapitalismus und ererbten Adel waren wie jene, die sich entlang des Rings baulich austobten. Die Idee nahm nicht nur konzeptiv eine Abzweigung vom Mainstream. Auch geografisch keimte sie auf einem Nebenschauplatz jener Tage des Umbruchs. Er lag sogar außerhalb der Stadt. In einer Gegend, die erst Jahrzehnte später auch offiziell und administrativ zu Wien gehören sollte. Dort steigen im Westen die Hänge sanft zum Wienerwald hinauf. Und dorthin hat der Wiener Cottage Verein ein paar grundlegende Prinzipien getragen: Dass Wohnen keine Ware sein darf etwa. Und dass Häuser für Menschen gebaut werden sollen, nicht für Renditen. Ein paar gerade Straßen genügten, um ein fruchtbares Experimentierfeld aufzuspannen. Hier sollte sich zeigen, dass man „große Ideen“ nicht an der Größe der Häuser ablesen muss. Leistbar sollte der Wohnraum sein. Und umgeben von Gärten und Luft. Als „Cottages“ nahmen die ersten Häuser Aufstellung. Doch „Villen“ hießen sie bald und für einige war selbst dieser Begriff irgendwann eher ein Euphemismus: Denn hier entstanden Miniaturburgen ebenso wie so manches Schlösschen im Familienformat. Alles, was die Fantasie der inzwischen wohlhabenden Bauherren und das Stilvokabular der Architekten hergab: Das Cottage in Wien wurde der Topf, in dem sich alles vermengte.
Doch 150 Jahre Stadtentwicklung und Immobilienwirtschaft ließen vom Merkmal „leistbar“ schließlich nicht viel übrig. Heute ist die Gegend eine der teuersten und attraktivsten Wohnviertel Wiens. Es scheint, als hätten sich die ambitionierten Gründer des Vereins beinahe zu gut eingefühlt in die Bedürfnisse der Menschen. Die Qualitäten, die sie schufen – zu schnell gerieten sie zu wertvoll in einer dichten, staubigen, lauten und stressigen Stadt. Dadurch wurden sie unerschwinglich für den Großteil der Bevölkerung. Profitiert haben schlussendlich dann doch alle: Viele der Werte, die sich im Cottage-Viertel als Erstes in seiner Ursprungsidee verdichtet hatten, sind auch an anderer Stelle eingesickert. In der Vorstellung einer lebenswerten Stadt etwa. Allein das Merkmal „grün“, ein Wesenszug des Viertels, hat anschließend tief im städtebaulichen Genpool Wiens Wurzeln geschlagen – der „Grüngürtel“ etwa rund um die Stadt wurde von Bürgermeister Karl Lueger 1905 festgeschrieben.
So wie das Cottage-Viertel in Währing selbst Modellen folgte, war es auch Vorlage für viele andere Viertel in Wien: Nicht nur für Hietzing, Penzing und Hetzendorf. Die Cottage-Idee wirkte weit in die Stadt hinein und in den städtebaulichen Diskurs. Es bestimmte das Bild, das man sich noch heute von Lebensqualität und von einem Wohnideal macht. Am intensivsten und unmittelbarsten wirkt die Idee aber nach wie vor im Cottage selbst. Wenn man es durchstreift, dann spürt man, wie viel sich noch erhalten hat von dem Anspruch an Luft, Raum, Frische und Ruhe. Obwohl der Wandel natürlich auch diesen Hang im westlichen Wien hinaufgebrandet ist. Schon ziemlich viele massive Kubaturen kreisen das Viertel heute ein oder haben sich mitunter direkt ins Ensemble der Häuser gemischt. Auch einiges an kulturell-architektonischen Werten wurde durch Ignoranz und Geringschätzung aus dem Stadtbild gelöscht. Doch der Wiener Cottage Verein setzt sich auch 150 Jahre nach seiner Gründung noch dafür ein, die Ursprungsidee zu pflegen. Und dadurch die Qualitäten zu erhalten – die ästhetischen, atmosphärischen und jene, die in Immobilienprospekten als „lebenswert“ apostrophiert werden würden. Diese Qualitäten sind Wien und Währing nicht in den Schoß gefallen. Sie wurden mit Beharrlichkeit und Eigeninitiative erkämpft. Und gleichzeitig sind sie die Konsequenz einer Überzeugung: Dass man mehr Lebensqualität für alle erreicht, wenn man sich gemeinsam um sie kümmert. Und in diesem Sinne ist der „Wiener Cottage Verein“ noch heute viel mehr als die ästhetische Interessensvertretung einer der beliebtesten Wohnviertel Wiens.
1
Wien, wie es baut, staubt und stinkt
Da mag ein Haus noch so „frei“ stehen wie die Villen in Währing, ganz unberührt von allem, was drumherum geschieht, steht es trotzdem nie. Auch über die Gegend, die heute das „Cottage“ ist, wehte viel mehr als jene verlässliche Brise vom Kahlenberg, die zeitgenössische Beschreibungen stets erwähnt haben. Die Platanen hatten 150 Jahre Zeit, den Häusern im Viertel über den Kopf zu wachsen, sich schützend vor sie zu stellen wie die gusseisernen Zäune, die die Gärten einfrieden. Der Wandel rauschte trotzdem ein. Und Wandel war es auch, der aus einer Gegend voller Klee, Wein und Schotter ein Villenviertel machte. Obwohl Wien ziemlich viel vorhatte im 19. Jahrhundert, eine Villenkolonie gehörte nicht dazu. Diese Agenda übernahm der engagierte Verein, der sich im März 1872 als „Wiener Cottage Verein“ gründete. Zu einem Zeitpunkt, an dem das Wort „Börsenkrach“ noch nie ausgesprochen worden war. Und als man noch kollektiv der Weltausstellung entgegenfieberte. Bislang hatte sie nur in Paris oder London stattgefunden. Da sollte also noch genügend Platz sein für Wien, um sich auf eine Stufe mit den „Weltstädten“ zu stellen.
1873 war dann Wien an der Reihe. Längst war nicht alles fertiggestellt, mit dem sich die Stadt vorgenommen hatte zu protzen. Angeleiert, initiiert und geplant war dagegen vieles, was heute noch ikonisch für die Stadt steht. Der letzte große Bahnhof der Stadt, der Nordwestbahnhof, erhielt gerade seinen Schlussstein. Der Linienwall, der Wien umspannte, wurde zur Gürtelstraße. Und nicht weit davon, nur ein paar hundert Meter die Anhöhe Richtung Türkenschanze hinauf, fuhren die Spaten in die frisch parzellierte Erde. In einer Gegend, die sich nicht allzu viel drum kümmerte, wie sich Wien ein paar Kilometer stadteinwärts als Weltstadt gebärdete. Denn dorthin sollten all die baulichen Bemühungen münden. Doch viel zu spät hatte man sich auf den Weg gemacht, um in einer Reihe mit Paris und London zu stehen. Viel zu lange hatte man sich unnötig einschnüren lassen von einem ganz bestimmten Bauwerk: der Wiener Stadtbefestigung. Türken und Franzosen hatten sie zwar schon ein wenig perforiert über die Jahrhunderte, aber noch immer stand sie eher der Stadt selbst als fremden Heeren im Weg. Der Kaiser musste es also doch wieder selbst erledigen. Zumindest die Anordnung ausformulieren, per Handschreiben, damit Wien auch so etwas wie Weltstadt werden konnte. In kaiserlichen Worten klang damals alles stets überaus bedeutsam und wichtig, das Schwurbeln war Teil des Codes, doch für Wien war die Anweisung tatsächlich die wichtigste seit Langem – wahrscheinlich seitdem die Babenberger 800 Jahre davor beschlossen hatten, Wien überhaupt zu ihrer Hauptstadt zu machen.
Jedenfalls habe es doch bitte jetzt endlich zu geschehen: Die Stadtmauern mussten weg. Alle waren sich darin einig, vom Kaiser abwärts. Sogar die Militärs hatten es eingesehen. Der Wachstumsschub war zu stark. Aus allen Kronländern waren die Menschen gekommen. Sie kamen, ohne dass man sie lockte. Sie blieben, ohne dass man sie dazu überreden musste. Die Stadt, die Hauptstadt eines Kaiserreichs, war Verheißung genug. So wartete Wien nur darauf, endlich herausplatzen zu können aus seiner Umklammerung. Die zum Projekt passende architektonische Attitüde war jedenfalls auch schnell gefunden: Der Kaiser wünschte sich eine ringförmige „Via Triumphalis“ statt dem steinernen Ring. Sollte er haben.
Mit dem Abbruch begann der Umbruch: So was hatte die Stadt noch nie gesehen. Dass die Basteien fielen, war für Wien das entscheidenste Ereignis von allen, in einem Jahrhundert, das schon ziemlich voll war von entscheidenden Ereignissen. Friedlich war die Befestigungsanlage ihrer Nutzlosigkeit entgegengealtert. Verteidigt hatte sie schon länger nichts mehr. Die letzten, die sich auch nicht aufhalten ließen, waren wohl die französischen Truppen. Im Jahr 1809 hatten sie vom Spittelberg aus noch die Innenstadt bombardiert, während sich Napoleon im Schloss Schönbrunn einquartiert hatte. Kurz vor ihrem Abzug sprengten sie Stücke aus der Burg- und auch der Mölkerbastei heraus. Eine unfreundliche Geste, die die Zukunft der Stadt trotzdem ein wenig symbolhaft vorweggenommen hatte.
Lang genug war die Stadt von der Befestigungsanlage eingeschnürt gewesen. Vorstadt und Stadt lagen deshalb auch noch im 19. Jahrhundert irgendwie unbeteiligt nebeneinander. Und gerade die Vorstädte mussten sich nach jeder militärischen Bedrohung, die da anrückte, mühsam wieder aufrappeln. Kaum waren die Türken wieder weg, hieß es: Wiederaufbau. Endlich schien es, als könnten die Vorstädte über ihren ehemaligen Zustand hinauswachsen. Ein militärischer Anachronismus waren die Stadtmauern ohnehin. Städte baute man längst anders. Denn das Revolutionsjahr 1848 hatte gezeigt: Der Feind musste nicht unbedingt von außen kommen. Ein breiter, langer Boulevard, das hieß nicht nur Glanz und Gloria, sondern konnte auch bedeuten: freie Schussbahn. Paris machte es wie so oft vor. Und Wien machte es wie so oft nach. Im Vergleich zur französischen Hauptstadt war Wien vor der Gründerzeit allerdings noch ein ziemlicher Zwerg. Besucher, die zuvor Paris gesehen hatten, standen erstaunt vor Wien und konnten es kaum glauben, dass die paar Häuser die Hauptstadt eines Riesenreichs sein sollten. So erstaunlich kleingehalten und eingezwängt war sie durch die Stadtmauern. Diese hatten ihren ursprünglichen Zweck ohnehin anständig erledigt. Nach der ersten Türkenbelagerung waren sie verstärkt worden, bei der zweiten wären sie trotzdem fast gefallen, so konsequent hatten die türkischen Mineure ihre Stollen unter die Mauern gesprengt. Doch Jan III. Sobieski kam gerade noch zur rechten Zeit aus Polen und Großwesir Kara Mustafa beging seinen inzwischen berüchtigten taktischen Fehler: Er widmete sich dem Entsatzheer und den Stadttruppen gleichzeitig. Auch wenn die Türken flüchteten, geblieben waren in Wien genügend Spuren von ihnen. Entlang von Mythen, Legenden, Straßennamen und sonstigen Toponymen kann man ihnen noch heute folgen. Bis hinauf zur Türkenschanze in Währing. Von dort hatten abertausende osmanische Soldaten einst auf die Stadt geblickt. Und exakt von dort sollte schon knapp 200 Jahre später eine Villenkolonie ins Weite schauen: das Cottage-Viertel.
Bis es dazu kommen konnte, mussten aber noch einige Steine aus der alten Bausubstanz purzeln und sich einige Ziegel zu neuen Häusern stapeln. Und das passierte vor allem auch rund 80 Meter tiefer. Dort konkretisierte sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die kollektive Wunschvorstellung von Wien. Andere Visionen davon, wie man zeitgemäß bauen sollte, hatten es allerdings von den Köpfen der Denker und Gestalter nicht weiter als auf Papier geschafft. Architekt Heinrich Ferstel trug zu jener Zeit auch schon länger ein Konzept mit sich herum. Seine Domäne war aber nicht die Sorge um die Lebensqualität der bürgerlichen Familie. Und auch nicht die Peripherie der Stadt. Vielmehr machte sich Ferstel baukünstlerisch in der Stadtsilhouette des Zentrums bis heute unübersehbar bemerkbar. Und das schon in frühen Jahren seiner gestalterischen Karriere. Zumindest mit einem Entwurf: Ferstel hatte überraschend den Wettbewerb für die Votivkirche gewonnen. Natürlich mit einem konservativen Vorschlag; der Historismus war die willkommene Verlässlichkeit in unvorhersehbaren Zeiten. Alt war der Stil, doch jung war der Mann: 27 Jahre alt war Ferstel damals. Ziemlich jung also für jemanden, der Wien architektonisch mitdefinieren sollte. Vor allem in einer Ära, in der weise, alte Männer überhaupt das Meiste definierten, inklusive der Zukunft. 1856 wurde der Grundstein der Kirche gelegt. Noch bevor Kaiser Franz Joseph I. seinen Willen per Handschreiben deklarierte. Das geschah ein Jahr danach. 22 Jahre später war die Votivkirche endlich fertig und der Kaiser durfte dort zur Einweihung seine Silberhochzeit feiern.
Eine Kirche als großes „Danke!“: Schließlich hatte Kaiser Franz Joseph ein Attentat überlebt. Heinrich Ferstel lieferte den Entwurf für die Votivkirche.
In der Zwischenzeit war viel passiert. Wien hatte sich umgekrempelt. Und Ferstel war einer der Chef-Umkrempler. Als er die Pläne für die Kirche zeichnete, hatte die Stadt 450.000 Einwohner. Als sie fertig war, fast doppelt so viele. Ferstel selbst hatte Karriere gemacht. Lifestylemagazine von heute hätten ihn wahrscheinlich „Star-Architekt“ genannt. Der Mainstream war sein gestalterisches Zuhause. Brav und meisterhaft zugleich hatte er Populäres und Prototypisches einer Ära abgeliefert. Darunter das Museum für angewandte Kunst etwa. Oder die Universität. Gebäude, die in Fachzeitschriften genauso bewundert wurden wie von den Wienern, aber irgendwie im Gestus auch stets sich selbst bewunderten. Doch Ferstel zweigte trotzdem manchmal vom Erwartbaren ab. Wenn auch anfangs nur theoretisch. Und noch dazu eher im Hinterkopf. In der Frage „Wie man wohnen soll?“ lehnte er sich jedenfalls trotzdem weit aus den Konventionen heraus. So weit, dass seine Ideen dazu irgendwann sogar vor den Stadtgrenzen Wiens landen sollten. Dort, wo man sich früher bestenfalls noch zur Sommerfrische hinkutschieren ließ. Und genau dorthin, in Richtung Wienerwald, führte auch Ferstel schließlich seine Gedanken spazieren. Wenn er an Häuser dachte, die umgeben von Grün, Gärten und Freiraum waren. So wie er es bei Studienreisen nach England gesehen hatte. Wo auch die Cottages standen, die er sich als Vorlage für einen neuen Typ Haus ausborgen wollte, den Wien so noch nicht gekannt hatte. In England war Ferstel auch 1850, als die Vorstädte Wiens eingemeindet wurden. Gemeinsam mit Rudolf Eitelberger schrieb er sich zehn Jahre später seine Gedanken zu Häusern von der Seele: in der Schrift „Das bürgerliche Wohnhaus und das Wiener Zinshaus“. Denn in den frei stehenden englischen Landhäusern meinte Ferstel das gefunden zu haben, was die meisten gar nicht so intensiv gesucht hatten: die ideale Wohnform für die Familie als schützenswerte Kernzelle der Gesellschaft. Man musste die Idee nur noch nach Wien versetzen.
Heinrich Ferstel zeichnete das Stadtbild Wiens deutlich mit: allein mit dem Palais Ferstel, dem Hauptgebäude der Universität Wien sowie dem Museum für angewandte Kunst am Ring.
Was Ferstel hier sehr motiviert einbrachte, musste auch erst einmal sickern: in einer Stadt, die vor allem mit sich selbst beschäftigt war. Es sollte noch ein paar Jahre dauern, bis sich die Gründer des Cottage Vereins dankbar auf die Idee von Ferstel beriefen. Seine Schrift und seine Haltung wurden zur Grundlage des Cottage-Viertels. Als dort die ersten Häuser im Jahr 1873 entstanden, war Ferstels Votivkirche noch immer nicht fertig. Und auch sonst war noch einiges im Prozess, was sich an der Ringstraße angesagt hatte. Zumindest war der Boulevard schon offiziell eröffnet, als die Stadt endgültig im Westen Wiens angekommen war. Dort, wo sich die Baustellen an der Ringstraße schon fleißig bedient hatten an Baumaterialien, an Schotter und an Sand. Denn all das kam auch von der Türkenschanze. Täglich ins staubige Zentrum hereingekarrt von Kutschen. Ein paar Jahre später schon war das Cottage-Viertel nicht nur topografisch ganz oben angekommen, sondern auch auf der Prestigekurve der Wiener Wohngegenden. Sicher auch ein Grund, dorthin zu ziehen für einen, dessen Leben eng mit dem Cottage-Viertel verknüpft ist: Arthur Schnitzler. Seine Wiener Wohnbiografie hatte in der Stadt dort begonnen, wo sie für viele jüdische Familien angefangen hatte: gleich neben dem Nordbahnhof, dem größten Bahnhof der Stadt jener Zeit, in der Leopoldstadt. Dort wurde Schnitzler geboren, in der Praterstraße, auf Nummer 16. Ein paar Jahre später sollte dann der Kaiser an einer jubelnden Menge in Richtung Prater kutschieren. Es gab eine Weltausstellung zu eröffnen. Zu jenem Zeitpunkt allerdings waren die Schnitzlers schon das zweite Mal weitergezogen: an die Adresse Burgring 1, wo Arthur Schnitzler später auch seine Privatpraxis hatte. Zuvor hatte ihn die erste Station des sozialen Aufstiegs vom „Judenviertel“ in Ringnähe geführt, in die Bösendorferstraße. Auch eine dieser vielen staubigen Gegenden im Umbruch damals. Schließlich ging gleich neben der Schnitzler-Wohnung das Privatpalais des Herzogs Philipp von Württemberg in Stellung – zur Weltausstellung 1873 sollte es das Hotel Imperial werden. Und auf der anderen Seite entstand gerade das Musikvereinsgebäude, entworfen von Theophil Hansen, der die Ringstraßen-Architektur ähnlich geprägt hatte wie Ferstel.
Eine Stadt, die ächzt und stöhnt
Als Ferstel 1850 nach England aufgebrochen war, war auch Wien schon längst aufgebrochen. So viele Pflastersteine waren noch nie auf den Straßen gelegen. Und so viele Hufe hatten noch nie auf ihnen geklappert. Wien hetzte seinem eigenen Wachstum hinterher, so wirkte es. Die Stadt ächzte. Und schepperte. Wien bröckelte an allen Ecken. Wer Metropole werden wollte, musste zuvor Großbaustelle werden. Die Gründerzeit war auch eine Zeit des Abschieds: Drei Viertel der Wohnhäuser in der Innenstadt, die vor 1840 gebaut worden waren, wurden abgerissen und neu aufgebaut. Die einen seufzten darüber, wie das alte, vertraute Wien verschwand. Die anderen echauffierten sich darüber, wie das Neu-Wien, das sich da imposant aufbäumte rund um die Innenstadt, stilistisch und ästhetisch ausgefallen war. Aus alten Zeiten wurde Schutt. Und die neuen Häuser beschworen erst recht in ihren Fassaden die alten Zeiten. Die Stadt zog gerade, was krumm war. Schubste aus dem Weg, was Fortschritt und Verkehr im Weg stehen könnte, legte der Welt Schienen bis vor die Tore des Linienwalls und dem Stadtwachstum die Rutsche bis weit hinaus in die Landschaft. Am Ende des Jahrhunderts war Wien wie ausgewechselt. Wo früher das Glacis war und die Wiener spazierten, führten die Architekten ihre Visionen spazieren: Zwischen 1860 und 1914 waren 58 öffentliche Gebäude und 590 Privatbauten entlang der Ringstraße entstanden. Als sie am 1. Mai 1865 eröffnet wurde, gab es noch immer viel zu tun. Der Kaiser kümmerte sich um das Grobe. Wie etwa Stadtmauer schleifen lassen und solche Dinge. Wenn es irgendetwas danach zum Eröffnen gab, war Franz Joseph natürlich wieder pünktlich zur Stelle.
Die Migranten, die in die Stadt strömten, erledigten die staubige Drecksarbeit auf den Baustellen und an den Ziegelöfen. Und niemand kümmerte sich so recht darum, wo all die Arbeiter wohnen sollten. Die Stadt sorgte sich vor allem einmal um das Wohl der Stadt selbst. Das Wasser wollte Wien zähmen, die Donau regulieren. Zu lange hatte es den Wienern und der Stadt zugesetzt, nicht nur friedlich gestreift, sondern verheerend geflutet regelmäßig. Und was die Häuser dann umspülte, war eher Dreckssuppe als Wasser. Oder: die Cholera. Sie steckte dem Wien der Gründerzeit allmählich ganz schön in den Knochen. Im Jahr 1873 kam sie zum letzten Mal „angeschwappt“ und spülte damit auch endgültig eines davon: die Aussicht, dass die Weltausstellung doch ein Erfolg werden könnte. Dafür kam ein anderer Schwall aus anderer Richtung: Die Wiener Hochquellwasserleitung wurde Ende des Jahres doch noch fertig. Als die Fontäne des Hochstrahlbrunnens auf dem Schwarzenbergplatz in die Höhe schoss, war das das plakative Zeichen dafür.
Wien war enger geworden. Und lauter. Die Menschen wuselten. Der Staub wirbelte. Der Geburtenüberschuss war es nicht, der all das ausgelöst hatte. Denn der setzte erst ab den 1870er-Jahren ein. Trotzdem füllten sich die Wohnungen so dicht, dass kaum jemand mehr als vier Quadratmeter für sich selber hatte. Ein Großteil der Menschen war nicht in Wien geboren. Die meisten von ihnen in Böhmen und Mähren. 1880 lag ihr Anteil etwa in Favoriten bei fast 40 Prozent. Die Migranten kamen nach Wien, weil sie Arbeit, Chancen und ein Bett zum Schlafen suchten. Doch oft konnte ihnen die Stadt nicht einmal diesen Wunsch erfüllen. Die „Bettgeher“ standen auf, wenn die anderen, die von der Schicht heimkamen, schlafen gehen wollten. Es reichte nicht für alle. So viel konnten die Arbeiter selbst gar nicht an Ziegeln zu Arbeiterquartieren stapeln, dass es gereicht hätte für alle. Doch die Weltwirtschaft feierte munter Hochkonjunktur und die Gesellschaft wollte trotzdem mehr von allem und das bitte bald: Lokomotiven, Ziegel, um Häuser zu bauen, Tabak, Nahrungsmittel, Bier. Die Fabriken lechzten nach Arbeitskräften. Und auch das Kleingewerbe suchte geschickte Hände. Um 1880 stammte mehr als die Hälfte der Beschäftigten in den Wiener Tischlereien und Schlossereien aus Böhmen und Mähren. Bei den Schneidern und Schustern waren es sogar zwei Drittel. Und für eines sorgten natürlich die Migranten auch noch: für noch mehr Ziegel für noch mehr Häuser.
Das Leben war anstrengend. Und jetzt wurde es noch dazu in der Stadt ziemlich ungesund. Wenn man 1850 auf die Welt kam, konnte man erwarten, ungefähr 20 Jahre alt zu werden im Durchschnitt. Sogar