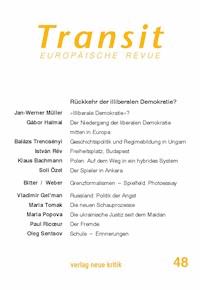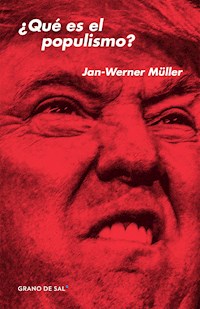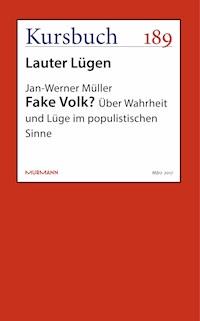23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das demokratische Zeitalter ist die erste umfassende Studie des politischen Denkens in Europa, die den ganzen Kontinent in den Blick nimmt und die Vorgeschichte des heute vieldiskutierten postdemokratischen Status quo liefert, ohne die sich dieser nicht verstehen lässt. Sie setzt 1918 ein und reicht bis zum Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten Osteuropas Ende der 1980er Jahre. In einer meisterhaften Mischung aus Geistes- und Kulturgeschichte zeichnet Jan-Werner Müller nach, welche politischen Ideen und Köpfe das Zeitalter der ideologischen Extreme bis 1945 geformt und welche das Schicksal Europas danach maßgeblich bestimmt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 768
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das demokratische Zeitalter ist die erste umfassende Studie des politischen Denkens in Europa, die seit dem Ende des Kalten Krieges erschienen ist und den ganzen Kontinent in den Blick nimmt. Sie setzt 1918 ein und reicht bis zum Zusammenbruch der kommunistischen bzw. realsozialistischen Staaten Osteuropas Ende der 1980er Jahre. In einer meisterhaften Mischung aus Geistes- und Kulturgeschichte, angereichert durch eine Fülle von höchst lebendigen biographischen Skizzen einflußreicher, heute zum Teil vergessener Denker aller Couleur, zeichnet Jan-Werner Müller nach, welche politischen Ideen und Köpfe das Zeitalter der ideologischen Extreme bis 1945 geformt und welche das Schicksal Europas danach maßgeblich bestimmt haben. Max Weber wird ebenso behandelt wie die Vordenker des Faschismus, die Frankfurter Schule und »1968« ebenso wie neokonservative Denkfabriken, etwa die Mont Pelerin Society. Daß sich die Christdemokratie als die prägende politische Strömung in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg erweist, gehört zu den spannendsten Erträgen dieses Buches, das mehr bietet als eine fulminante Ideengeschichte Europas im Zeitalter der Ideologien: Es liefert auch die Vorgeschichte des heute vieldiskutierten postdemokratischen Status quo, ohne die sich dieser nicht verstehen läßt.
Jan-Werner Müller, geboren 1970, ist Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Princeton University. Gastprofessuren führten ihn nach Budapest, New York, Paris und Florenz. Er ist Mitbegründer des European College of Liberal Arts (ECLA) in Berlin. Im Suhrkamp Verlag erschien von ihm: Verfassungspatriotismus(es 2612).
Jan-Werner Müller
Das demokratische Zeitalter
Eine politische Ideengeschichte Europasim 20. Jahrhundert
Aus dem Englischen von Michael Adrian
Suhrkamp
Bibliographische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek. Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Informationen sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Erste Auflage 2013
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag 2013
© Jan-Werner Müller
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
eISBN 978-3-518-73247-2
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Umschlagfoto: Scherl / Süddeutsche Zeitung Photo
www.suhrkamp.de
Inhalt
Einleitung
Die geschmolzene Masse
Experimente zwischen den Kriegen
Faschistische Subjekte
Denken im Wiederaufbau
Politisch folgenlos?
Antipolitik – und das Ende der Geschichte?
Anmerkungen
Register
Für Erika
7Einleitung
Sie wissen, daß ich weniger nach Tatsachen suche als vielmehr nach den Spuren des Gangs der Ideen und Empfindungen. Das vor allem ist es, was ich nachzeichnen möchte. […] [D]ie Schwierigkeiten sind immens. Am problematischsten erscheint mir dabei die Mischung der Geschichte im engeren Sinn mit historischer Philosophie. Ich sehe immer noch nicht, wie man beides miteinander verbinden soll (verbunden werden aber müssen sie, könnte man doch sagen, daß erstere die Leinwand ist und letztere die Farbe und daß man beides zugleich braucht, um ein Bild zu malen).
Alexis de Tocqueville
Habt ihr all die anderen Bankrotte vergessen? Was hat das Christentum in den diversen gesellschaftlichen Katastrophen gemacht? Was ist aus dem Liberalismus geworden? Was hat der Konservatismus bewirkt, sei es in seiner aufgeklärten oder in seiner reaktionären Gestalt? […] Wenn wir die ideologischen Bankrotte wirklich ehrlich gegeneinander aufrechnen wollen, dann haben wir uns einiges vorgenommen.
Victor Serge
Die Demokratie hat sich überall dort entwickelt, wo die abstrakte Anziehungskraft des Ideologen und die konkreten Experimente des Praktikers zusammenwirkten.
A.D. Lindsay*
Der Ideenhistoriker Isaiah Berlin bemerkte einmal: »Ich habe fast das ganze 20.Jahrhundert erlebt, ohne persönliche Not zu erleiden, wie ich hinzufügen muß. In meiner Erinnerung ist es nur das schrecklichste Jahrhundert in der Geschichte des Westens.«1 Zugleich war dieses Jahrhundert eines, in dem politische Ideen eine ungewöhnlich wichtige Rolle zu spielen schienen – und zwar in solchem Ausmaß, daß die Zeitgenossen sie unmittelbar mit den Katastrophen und Umwälzungen in Verbindung brachten, die sie durchlebten. Dieser Glaube an den geradezu unermeßlichen Ein8fluß von Ideen fand sich unabhängig von der politischen Ausrichtung. Der polnische Dichter (und Antikommunist) Czesław Miłosz bemerkte einmal: »Erst um die Mitte des 20.Jahrhunderts ist es den Einwohnern vieler europäischer Länder klargeworden – und meist war es für sie eine sehr bittere Erfahrung –, daß die gelehrten Werke der Philosophen, so unverständlich und absurd sie dem Durchschnittsmenschen auch erscheinen mochten, auf ganz unmittelbare Weise ihr Schicksal bestimmen konnten.«2 Ungefähr zur selben Zeit soll der sowjetische Partei- und Regierungschef Nikita Chruschtschow über den antisowjetischen Aufstand im sozialistischen Ungarn nüchtern festgestellt haben, dies »wäre nie passiert, wenn man rechtzeitig ein paar Schriftsteller erschossen hätte«.3
Folglich wird das 20.Jahrhundert häufig vor allem als ein »Zeitalter der Ideologien« interpretiert. Aus dieser Perspektive erscheinen Ideologien als Formen eines leidenschaftlichen, mitunter auch fanatischen Glaubens an Ideen und Entwürfe zur Perfektionierung der Gesellschaft.4 Die Story geht dann für gewöhnlich so: Um 1917, das Jahr der russischen Revolution, wurden die Europäer mehr oder weniger unbegreiflicherweise von einem ideologischen Fieber erfaßt, einer Krankheit, von der sie erst gegen 1991 durch den Untergang des Sowjetreichs und den offensichtlichen Triumph der liberalen Demokratie über Faschismus und Kommunismus geheilt werden sollten.
Betrachtet man das 20.Jahrhundert jedoch lediglich als eine Zeit irrationaler politischer Extreme oder gar als ein »Zeitalter des Hasses«, dann übersieht man, daß nicht nur Intellektuelle und führende Politiker, sondern auch gewöhnliche Männer und Frauen viele der in den abstrusen Büchern enthaltenen Ideologien (und der mit ihrer Hilfe gerechtfertigten Institutionen) eben auch als plausible Lösungen für ihre Probleme verstanden. Gewiß, Ideologien sollten nicht zuletzt Sinn und sogar Erlösung stiften, so daß es durchaus gerechtfertigt ist, manche von ihnen als »politische Religionen« oder, mit Churchill, als »gottlose Religionen« zu bezeichnen. Viele 9der in ihrem Namen geschaffenen Institutionen jedoch versprachen darüber hinaus wesentlich besser zu funktionieren als die des Liberalismus, der vielen Europäern wie ein hoffnungslos veraltetes Relikt des 19.Jahrhunderts vorkam. Rückblickend erscheint ein Satz wie der, den der faschistische Philosoph Giovanni Gentile 1927 in der amerikanischen Zeitschrift Foreign Affairs schrieb – »Der Faschismus entstand, um gravierende politische Probleme im Italien der Nachkriegszeit zu lösen« –, nicht nur als die abstoßende Verharmlosung, die er auch ist, sondern als Banalität.5 Doch jeder Darstellung, die den Anspruch der Ideologien auf Problemlösung und erfolgreiche Experimente auf institutionellem Feld vollkommen ausblendet, entgeht eine ihrer wesentlichen Dimensionen.6 Wir müssen wieder ein Bewußtsein dafür entwickeln, warum und auf welche Weise Ideologien derart attraktiv sein konnten – ohne damit natürlich irgend etwas entschuldigen zu wollen. Wenige Klischees haben in der Ideengeschichtsschreibung mehr Schaden angerichtet als die Devise tout comprendre, c’est tout pardonner.7
Um ein solches Verständnis zu gewinnen, dürfen wir uns nicht mit den vorliegenden Darstellungen der Entwicklung bedeutender politischer Philosophien des europäischen 20.Jahrhunderts begnügen. Wir sollten uns vielmehr auf das konzentrieren, was sich zwischen dem mehr oder weniger akademischen politischen Denken auf der einen Seite und der Schaffung (und Zerstörung) politischer Institutionen auf der anderen Seite abspielt. Mit einem Wort: Wir müssen jene politischen Theorien erfassen, die politisch folgenreich waren, jene Bereiche des politischen Denkens, in denen, wie es der britische Gelehrte A.D. Lindsay einmal sagte, die Arbeit des abstrakten Ideologen und Experimente in der Praxis zusammenwirken.8
Folglich wird der vorliegende Essay einen bestimmten Typus, den man als »Grenzgänger« bezeichnen könnte, besonders in den Blick nehmen, nämlich philosophierende Staatsmänner, öffentlich wirkende Juristen, Verfassungsberater, das eigentümliche und auf 10den ersten Blick in sich widersprüchliche Phänomen der »Bürokraten mit Visionen«, Philosophen, die politischen Parteien und Bewegungen nahestehen, sowie die »berufsmäßigen Ideenvermittler« oder »second-hand dealers« in Ideengütern, wie Friedrich von Hayek sie einmal nannte.9 Diese Titulierung war keineswegs abschätzig gemeint: In Hayeks Augen waren diese Leute oft bedeutend wichtiger als viele originelle Ideenlieferanten. In einer Zeit, in der die »Massendemokratie« zu voller Blüte kam, bestand tatsächlich ein besonderer Bedarf an solchen Vermittlern. Denn mit der Massendemokratie ging unter anderem die offensichtliche Notwendigkeit massenhafter Rechtfertigung (oder massenhafter Legitimation) einher, wie man dies nennen könnte – die Notwendigkeit also, Herrschafts- und Institutionsformen zu rechtfertigen, aber auch die weniger offensichtliche Entstehung ganz neuer politischer Subjekte, etwa einer ethnisch oder ideologisch »gesäuberten Nation« oder eines Volkes, das sein Vertrauen in eine einzige sozialistische »Avantgardepartei« setzte.10 Nachdem traditionelle Legitimitätsvorstellungen und die Prinzipien dynastischer Abstammung allgemein diskreditiert waren, also spätestens nach dem Ersten Weltkrieg, mußten sich die Rechtfertigungen politischer Herrschaft grundlegend ändern.
Das soll nicht heißen, vor etwa 1919 seien öffentliche Rechtfertigungen politischer Herrschaft nicht nötig gewesen – natürlich waren sie das. Doch mußten sie im 20.Jahrhundert sowohl umfassender als auch expliziter ausfallen. Dies galt sogar dann, wenn die Legitimität im persönlichen Charisma eines Führers gesucht wurde oder wenn sie sich auf eine funktionierende Staatsbürokratie stützte, die die Wünsche der Bürger zu befriedigen verstand: Weder Charisma noch die Bereitstellung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen sprechen für sich oder erklären sich selbst. Besonders offensichtlich war der neue Zwang zu öffentlicher Rechtfertigung sowohl in den rechtsgerichteten Regimen, die im Namen der Tradition zu herrschen versuchten, als auch in den Königsdiktaturen, wie sie vor 11allem in der Zwischenkriegszeit blühten: Tradition und monarchische Legitimität wurden eben nicht mehr als selbstverständlich betrachtet und auch nicht mehr aus reiner Gewohnheit akzeptiert – sie mußten ausbuchstabiert und aktiv beworben werden. Das Erfordernis massenhafter politischer Rechtfertigung war schlechterdings nicht mehr rückgängig zu machen.
Die Menschen, die das 20.Jahrhundert durchlebten, hatten ein waches Bewußtsein dafür, daß mit ihm etwas Neues Einzug gehalten hatte, daß dies ein Zeitalter des zwanghaften Produzierens (und Konsumierens) politischer Glaubenslehren war. Der britische Philosoph Michael Oakeshott stellte in seinem Überblick über die sozialen und politischen Lehren des zeitgenössischen Europa in den 1930er Jahren fest:
Wir leben in einem Zeitalter von Gemeinschaften, die sich ihrer selbst versichern müssen. Noch das primitivste Regime im heutigen Europa, das Regime, das sich eingestandenermaßen am wenigsten einer systematischen, durchdachten Lehre verdankt, nämlich das faschistische in Italien, scheint blasiert genug zu sein, um sich wie die anderen auf seine eigene Lehre berufen zu wollen. Der Opportunismus wurde so verwässert, daß man ihn zum Prinzip erheben konnte; wir haben nicht nur die Aufrichtigkeit eines Machiavelli verloren, sondern sogar die des Anti-Machiavel.11
In einem sehr spezifischen Sinn also war das europäische 20.Jahrhundert nach dem Ersten Weltkrieg ein demokratisches Zeitalter. Natürlich waren nicht alle europäischen Staaten demokratisch geworden. Im Gegenteil, viele der neu gegründeten Demokratien wurden in den 1920er und 1930er Jahren zerstört, was dazu führte, daß die Zukunft in den Augen vieler Europäer gerade nicht der liberalen Demokratie, sondern der einen oder anderen Form von Diktatur gehörte. Doch selbst die politischen Experimente, die sich in schroffem Gegensatz zur liberalen parlamentarischen Demokratie verstanden – wie, auf der einen Seite, der real existierende Staatssozialismus mit seinem Versprechen einer vollendet kommunisti12schen Gesellschaft und, auf der anderen, der Faschismus –, spielten auf der Klaviatur demokratischer Werte. Mitunter gaben sie sich sogar gleich als das Original aus: Gentile beispielsweise erklärte seinen amerikanischen Lesern, daß »der faschistische Staat […] ein Volksstaat ist und als solcher der demokratische Staat par excellence«.12
Selbstverständlich handelte es sich hier beim besten Willen nicht um Demokratien – obwohl, wie wir noch im Detail sehen werden, zahlreiche Verteidiger dieser Regime den Begriff mächtig überstrapazierten, um einer solchen Behauptung Plausibilität zu verleihen. Beide politischen Systeme aber versprachen, Werte zu verwirklichen, die man allgemein mit der Demokratie verbindet: Gleichheit, insbesondere eine substantiellere Form von Gleichheit als die formale Gleichheit vor dem Gesetz; eine echte Einbeziehung in die politische Gemeinschaft; und eine authentische, auf Dauer gestellte Teilhabe an der Politik, nicht zuletzt zu dem Zweck, ein politisches Kollektivsubjekt zu erschaffen (eine gesäuberte Nation etwa oder ein sozialistisches Volk), das dazu fähig wäre, das gemeinsame Schicksal zu meistern.13 So abstrakt dies vielleicht klingen mag, die leidenschaftliche Bejahung derartiger Werte war eine treibende Kraft für die zentralen Projekte einer Abwendung von der liberalen Demokratie. Dies nicht anzuerkennen wäre historisch naiv und zudem eine Form von liberaler Selbstzufriedenheit, die wir – das heißt vornehmlich wir im Westen – uns schlecht leisten können.
Diesen Punkt zu betonen heißt nicht, die Demokratie in Mißkredit bringen zu wollen. In Wirklichkeit unterstreicht er die Wirkmächtigkeit und Attraktivität demokratischer Ideen. Wie der österreichische Jurist Hans Kelsen um die Jahrhundertmitte in einem Aufsatz zur Verwendung demokratischer Vokabulare durch kommunistische Theoretiker schrieb: »Wie es scheint, hat das Symbol der Demokratie einen so allgemein anerkannten Wert erlangt, daß man die Substanz der Demokratie nicht preisgeben kann, ohne das Symbol beizubehalten.«14 Obwohl heute, gelinde gesagt, nur noch 13wenige die »germanische Demokratie« der Nationalsozialisten oder die osteuropäischen »Volksdemokratien« der Nachkriegszeit verteidigen würden, sollten wir festhalten, daß die meisten »demokratischen Versprechungen« dieser extrem antiliberalen Regime heuchlerisch oder zumindest in der Praxis dysfunktional waren. Es muß aber auch gefragt werden, warum sich diese Regime genötigt sahen, solche Versprechungen überhaupt zu machen. Ihre Rhetorik verrät die grundsätzlicheren Zwänge einer Zeit, in der die Forderung nach Partizipation schlichtweg nicht mehr überhört werden konnte, in der Herrschaftsansprüche sich eines politischen Vokabulars bedienen mußten, das zumindest zum Teil auch das der liberalen Demokratie war – einer Zeit, kurz gesagt, in der der Streit um das wahre Wesen der Demokratie im Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzungen stand.
Wichtiger noch für unsere Gegenwart: Wir können uns auf den besonderen Charakter der nach 1945 in Westeuropa geschaffenen Demokratien nur dann einen Reim machen, wenn wir verstehen, daß sie mit Blick sowohl auf die unmittelbare faschistische Vergangenheit als auch auf die Ansprüche ihrer östlichen Rivalen, die wahre Demokratie zu verkörpern, konzipiert wurden. Diese Nachkriegsdemokratien definierten sich nicht nur in schroffem Gegensatz zu Staatsterror oder aggressivem Nationalismus, sondern auch zur totalitären Vorstellung der uneingeschränkten historischen Handlungsmöglichkeiten von Kollektivsubjekten wie der nationalsozialistischen »Volksgemeinschaft«.
Es wäre nicht falsch, aber historisch viel zu unspezifisch, wenn man behaupten wollte, daß die zweite Hälfte des 20.Jahrhunderts eine »Rückkehr der Demokratie« oder eine »Rückkehr des Liberalismus« erlebte, zunächst im Großteil Westeuropas und später in Süd- und Osteuropa. Vielmehr schufen die Europäer etwas Neues, nämlich eine Demokratie, die – vor allem durch nichtgewählte Institutionen wie etwa Verfassungsgerichte – ausgesprochen starken Einschränkungen unterlag. Das konstitutionelle Ethos, das mit 14diesen Demokratien einherging, war den Idealen unbegrenzter Volkssouveränität so entschieden feindlich gesinnt wie den »Volksdemokratien« und später den »sozialistischen Demokratien« im Osten, die theoretisch auf der Vorstellung von einem kollektiven (sozialistischen) Subjekt beruhten, das sich der Geschichte bemächtigt. Es wird oft vergessen, daß dieses neue Bündel von Institutionen nicht durch überkommene politische Sprachen des Liberalismus gerechtfertigt wurde, nachdem ja der Liberalismus in den Augen der meisten Menschen den totalitären Alpträumen des Jahrhunderts überhaupt erst den Weg bereitet hatte. Auch zwei besonders wichtige Nachkriegsinnovationen – der demokratische Wohlfahrtsstaat und die Europäische Gemeinschaft – müssen in diesem Licht gesehen werden: Ersterer sollte einen Rückfall in den Faschismus verhindern (die Konkurrenz mit dem Osten war ein wichtiges, aber letztlich zweitrangiges Anliegen), indem er den Bürgern zu Sicherheit oder sogar, wie der britische Labourpolitiker Nye Bevan einmal sagte, zu »Gelassenheit« verhalf.15 Die europäische Integration wiederum sollte den nationalstaatlichen Demokratien weitere Beschränkungen durch nichtgewählte Institutionen auferlegen.
Die vorliegende Darstellung bezweifelt, daß es in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg jemals ein goldenes Zeitalter der Demokratie und insbesondere der Sozialdemokratie gab. Im Gegenteil, abgesehen von Großbritannien – und Skandinavien, einem Spezialfall, wie ich im 2.Kapitel zeigen werde – war die westeuropäische Nachkriegsordnung das Werk gemäßigt konservativer, vor allem christdemokratischer Kräfte. Müßte man eine einzige ideelle und parteipolitische Bewegung benennen, die jene politische Welt geschaffen hat, in der die Europäer heute immer noch leben, dann wäre dies die Christdemokratie. Das mag all jene überraschen, die Europa als die gesegnete (beziehungsweise zum Höllenfeuer verdammte) Insel des Säkularismus in unserer Welt betrachten. Zweifellos hat es der Christdemokratie geholfen, daß sie sich zugleich als antikommunistische Partei par excellence und als eine Bewegung 15präsentieren konnte, die, im Unterschied zur politischen Pseudoreligion des Faschismus, noch den Kontakt zu einer echten Religion hielt.
Die neue Nachkriegsform der Demokratie sah sich schließlich mit zwei großen Herausforderungen konfrontiert: der Rebellion, die gemeinhin mit der Chiffre »1968« bezeichnet wird, sowie den Rufen nach einem Zurechtstutzen des Staats und einer Befreiung des Marktes und des Individuums, die heute allgemein mit dem Schlagwort »Neoliberalismus« zusammengefaßt werden. Wie schon oft betont wurde, mag die vermeintliche Revolution von 1968 zwar in einer tiefgreifenden Krise der Repräsentation (der Jugend, der Frauen, der Homosexuellen) gewurzelt haben, die politischen Institutionen jedoch ließ sie im wesentlichen unangetastet. Folglich darf man sich sehr wohl fragen, ob 68 überhaupt einen prominenten Platz in einer Geschichte des europäischen politischen Denkens im 20.Jahrhundert verdient. Die Antwort wird freilich positiv ausfallen müssen, weil 68 eine radikale Herausforderung der nachkriegseuropäischen Verfassungsordnung sowie ihrer zentralen Prinzipien einer eingehegten Demokratie darstellte. Langfristig gesehen erbrachten die Nachwirkungen von 68 den Beweis, daß die Verfassungsordnung mit grundlegenden gesellschaftlichen, moralischen und letztlich auch politischen Veränderungen vereinbar war: mit dem Ende einer ganzen Kultur von Ehrerbietung und Hierarchie, ob in der Familie oder an der Universität; vor allem aber damit, daß Frauen (und Homosexuelle) die Verfügungsgewalt über ihre eigenen Körper erlangten.
Der Neoliberalismus bot eine plausible Alternative zu der »Krise der Regierbarkeit« oder »Unregierbarkeit«, von der in den 1970er Jahren viel die Rede war. Auf Großbritannien unter Margaret Thatcher hatte er zweifellos großen Einfluß. Sein ursprüngliches politisches und moralisches Programm jedoch hatte auf wesentlich mehr gezielt als die Schwächung der Gewerkschaften und die Deregulierung der Märkte – ein Umstand, den Thatcher offen einräumte, als 16sie 1983 erklärte: »Die Wirtschaft ist nur die Methode. Das Ziel ist es, die Seele zu verändern.«16 Jemand wie Hayek hätte gerne eine radikal neue Verfassungsordnung gesehen – wozu es ebenfalls nicht kam.
Es gibt keinen Grund, über die westeuropäische Nachkriegsverfassungsordnung, die nach 1989 im wesentlichen auf den Osten ausgedehnt wurde, und die sie stützenden Ideen in Triumphgeheul auszubrechen. Vielmehr könnte ein historisches Bewußtsein dafür, wie die Europäer zu ihr kamen, ein wenig dazu beitragen, die tröstliche Illusion zu zerstreuen, daß die liberale Demokratie der natürliche Sollzustand Europas oder des Westens insgesamt ist.
171 Die geschmolzene Masse
Die ganze Gesellschaft befindet sich mehr oder weniger im Schmelzzustand, und man kann dieser geschmolzenen Masse nahezu alles aufprägen, solange man es mit Nachdruck und Entschlossenheit tut …
David Lloyd George, 1917
Heute wird der Staat seliggesprochen. Wir wenden uns im nahezu blinden Vertrauen darauf an ihn, daß uns seine Wege Erlösung verheißen.
Harold Laski, 1917
Gerade heute ist die Beziehung des Staates zur Gewaltsamkeit besonders intim.
Max Weber, 1919
Heutzutage besteht ein sicheres Zeichen für die Macht der demokratischen Ideologie in der Tatsache, daß so viele Menschen vorgeben, sie zu akzeptieren. Ein sicheres Zeichen für den Niedergang der aristokratischen Ideologie besteht darin, daß sie nicht einen einzigen scheinheiligen Verteidiger hat.
Vilfredo Pareto, 1920
Der einzige Sinn, den ich in dem Wort »Volk« sehen kann, ist »Gemisch«; wenn man das Wort »Volk« durch die Wörter »Zahlen« und »Gemisch« ersetzt, ergeben sich überaus merkwürdige Ausdrücke … »die souveräne Mischung«, »der Wille der Mischung« und so weiter.
Paul Valéry*
Weihnachten 1918 war Max Weber aus Berlin nach München zurückgekehrt, nur um sich mitten in einem »blutigen Karneval« wiederzufinden. In der Hauptstadt hatte er eine herausgehobene Rolle bei den Beratungen über eine neue deutsche Verfassung gespielt. Das war 18durchaus nicht selbstverständlich gewesen: Seit fast zwanzig Jahren nämlich litt der Heidelberger Professor an verschiedenen Krankheiten und zeigte sich kaum noch in der Öffentlichkeit. In den letzten beiden Jahren vor dem Ersten Weltkrieg hatte er jedoch eine Reihe polemischer Aufsätze verfaßt und sich händeringend als politischer Erzieher der deutschen Nation versucht. Auch hatte er gehofft, für die verfassunggebende Versammlung und letztlich das Parlament kandidieren zu können. Doch war inzwischen deutlich geworden, daß die liberale Partei, die er selbst mitbegründet hatte, unter allen Umständen nur weitere Berufspolitiker nominieren würde und nicht einen weithin als aufbrausend bekannten Wissenschaftler. Davon abgesehen kann sich Weber keine großen Hoffnungen gemacht haben, daß die Autoren der Verfassung auch nur einer seiner Empfehlungen folgen würden.
Wenige Monate zuvor war Weber von einem Studentenbund gebeten worden, im Rahmen einer Reihe, in der er bereits 1917 über »Wissenschaft als Beruf« gesprochen hatte, einen Vortrag über »Politik als Beruf« zu halten. Zunächst hatte er gezögert, offensichtlich aber eingewilligt, als er erfuhr, daß die Studenten als Ersatz Kurt Eisner in Erwägung zogen. Eisner, freier Journalist und sein Leben lang Sozialist, hatte am 8.November 1918 noch vor der Abdankung des deutschen Kaisers in Berlin eine Republik in Bayern ausgerufen – und damit beschleunigt, was Weber den »blutigen Karneval« der Revolution nennen sollte. Für eine Gestalt wie Eisner hatte er nichts als Verachtung übrig: Nach seiner Einschätzung war der Mann ein in der Politik dilettierender Literat, ein in seine eigene Rhetorik verliebter Demagoge, nicht zuletzt aber auch das Opfer seines eigenen, äußerst kurzlebigen Erfolgs – den der Kopf der Münchner Räterepublik in Webers Augen mit einem echten politischen Erfolg verwechselte, obwohl es sich um einen bloß literarischen handelte: Statt daß Eisner über wirkliche Autorität (oder auch nur Macht) verfügt hätte, wurden romantische Hoffnungen auf eine Erlösung durch Politik auf einen Mann projiziert, der im Grunde genommen nichts als ein Schreiberling war.
19Für Weber gab es drei Grundlagen der Legitimation von Herrschaft: die Tradition, in der Männer und Frauen gehorchten, weil es immer schon so gewesen war; formale rechtliche Prozeduren von der Art, daß das Recht Legitimität beanspruchen konnte, wenn es durch die richtigen Kanäle geflossen war und von Bürokraten sine ira et studio angewandt werden konnte; schließlich das persönliche Charisma mit seiner Affinität zur revolutionären Politik.1 Dieser letzte Begriff entstammte der Sphäre der Religion und stand ursprünglich für die besonderen Qualitäten der Propheten, wie sie sich in der Formulierung ausdrücken: »Es steht geschrieben … Ich aber sage euch.« Weber zufolge ließ er sich allgemein auf Führungsgestalten anwenden, die mit besonderen Talenten gesegnet schienen und daher unter ihren Anhängern glühende Hingabe und tiefes Vertrauen erweckten. Eisner, meinte Weber, entsprach diesem Typus, und zwar in einer gefährlichen Variante. Statt also zuzulassen, daß der selbsterklärte Kopf des neuen bayerischen Volksstaats die Studenten mit seinen hochfliegenden sozialistischen Träumen verführte, zog er es vor, den jungen Menschen einige mühsam erworbene Lektionen in politischem Realismus zu erteilen.
Am 28.Januar 1919 begann Weber mit dem, wie sich zeigen sollte, wohl berühmtesten Vortrag in der Geschichte des politischen Denkens: »Politik als Beruf«, wobei sich »Beruf« gleichermaßen auf die Ausübung einer Tätigkeit wie auf das Gefühl einer persönlichen Berufung bezog. Weber schraubte die Erwartungen zunächst nicht gerade hoch:
Der Vortrag […] wird Sie nach verschiedenen Richtungen notwendig enttäuschen. In einer Rede über Politik als Beruf werden Sie unwillkürlich eine Stellungnahme zu aktuellen Tagesfragen erwarten. Das wird aber nur in einer rein formalen Art am Schlusse geschehen anläßlich bestimmter Fragen der Bedeutung des politischen Tuns innerhalb der gesamten Lebensführung. Ganz ausgeschaltet werden müssen dagegen in dem heutigen Vortrag alle Fragen, die sich darauf beziehen: Politik man treiben […] . Denn das hat mit der allgemeinen Frage […] nichts zu tun.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!