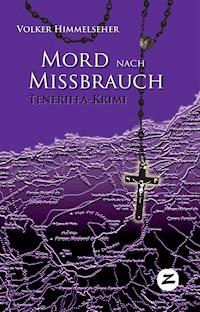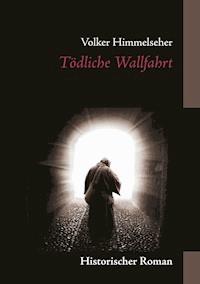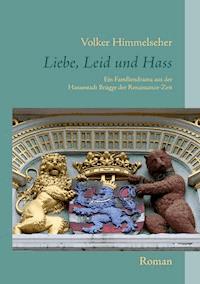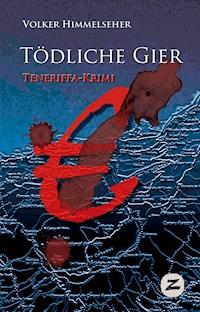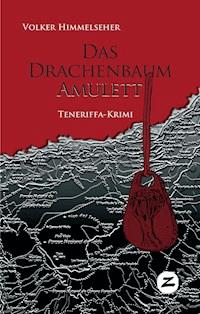
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zech Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ramón Martín & Teresa Zafón
- Sprache: Deutsch
Der 1. Fall von Inspektor Martín und Kriminalpsychologin Dr. Teresa Zafón. Auf Teneriffa ereignen sich rätselhafte Serienmorde, vor denen auch Touristen nicht verschont bleiben. Am Tatort bleibt jedes Mal ein kleines Drachenbaum-Amulett zurück: das Indiz für eine Opferweihe? Kriminalpsychologin Dr. Teresa Zafón zeichnet das Profil eines Ritualmörders, der schon bald wieder zuschlagen wird. Die Spur der Ermittler führt in den Souvenir-Großhandel...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Himmelseher
Das Drachenbaum-Amulett
Teneriffa-Krimi · Zech
DAS BUCH: Der 1. Fall von Inspektor Martín und Kriminalpsychologin Dr. Teresa Zafón. Auf Teneriffa ereignen sich rätselhafte Serienmorde, vor denen auch Touristen nicht verschont bleiben. Am Tatort bleibt jedes Mal ein kleines Drachenbaum-Amulett zurück: das Indiz für eine Opferweihe? Kriminalpsychologin Dr. Teresa Zafón zeichnet das Profil eines Ritualmörders, der schon bald wieder zuschlagen wird. Die Spur der Ermittler führt in den Souvenir-Großhandel...
DER AUTOR: Dr. Volker Himmelseher hat ein großes Unternehmen in Köln geführt. Dem Ruhestand nahe, schreibt er nun historische und Kriminalromane. Nach Das Drachenbaum-Amulett (2010) sind Tödliche Gier (2011) und Mord nach Missbrauch (2012) im Zech Verlag erschienen.
Impressum
Textgrundlage dieses E-Books ist die mit dem gleichnamigen Titel im Zech Verlag (Teneriffa 2010) erschienene Taschenbuchauflage, erstmals veröffentlicht im E-Pub-Format im April 2014.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, auch einzelner Teile, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, öffentlichen Vortrag, Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen, z.B. über das Internet.
Alle Rechte vorbehalten. © 2014 ZECH VERLAG
Verena Zech, E-38390 Santa Úrsula (Teneriffa, Kanarische Inseln, Spanien)
Tel./Fax: (34) 922-302596 · E-Mail: [email protected]
Text: Volker Himmelseher
Covergestaltung: Karin Tauer unter Verwendung eigener Zeichnungen und Fotos
Konvertierung: Zech Verlag
E-Book ISBN 978-84-941501-1-1 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-84-934857-8-8
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Webseite:
www.editorial-zech.es/de/
*
Und wieder begann ein feuchtkalter Januarmorgen auf Teneriffa. Die Tage mit den viel mundigen Neujahrswünschen »Próspero Ano Nuevo« waren noch nicht allzu lange vorbei. Es war ein Samstag. Es war winterlich. Trüber Himmel, böiger Wind und peitschender Regen, aber immerhin 19 Grad bestimmten den Tag. Die Einheimischen trugen dicke Wollpullover, meist braun und olivfarben, darüber sogar noch wattierte Jacken, erstaunlich viel Stoff für Touristenaugen. Die hatten nur leichte Kleidung dabei und versuchten mit deren fröhlichen Farben die Schlechtwetterperiode zu übertünchen. Nachts sanken die Temperaturen auf zwölf bis 13 Grad. Die schlecht isolierten Wände, die Kacheln, Steinfliesen und die einfach verglasten Fenster boten keinen Wärmeschutz, sondern verbrüderten sich allzu schnell mit der Kälte draußen. Auch die kleinen Elektroradiatoren an den Wänden der Zimmer brachten keine Abhilfe gegen die ungemütlichen Temperaturen.
Er war die ganze Nacht unruhig gewesen und hatte trotz seines kleinen Gasofens in der Stube gefroren. Er hatte schon deshalb die Wohnung recht früh am Morgen verlassen und den Bus nach Aguamansa genommen. Der Himmel war wieder einfarbig grau wie eine schmutzige Pfütze. Er wollte in den Kiefernwäldern oberhalb der Forellenzucht allein sein.
Er brauchte nur wenige hundert Meter von der Endstation des Busses bergauf zu gehen, dann umschloss ihn schon das dunkle Grün des Waldes und der Frühnebel. Der bröselige Lavaboden war durch die Nässe dunkelrot, wenn er unter den unzähligen Kiefernadeln überhaupt zu sehen war. Ab und zu zeigten sich auch hellbraune Spuren trockener Auswaschungen. Der Passatwind strich leise darüber und verstärkte die schleichende Erosion des Gerölls. Der Wind trug aus dem Atlantik einen Hauch feuchter Salzluft den steilen Hang hinauf und regnete sich hier oben ab. Aus den langen Nadeln der Kiefernbäume tropfte es stetig. Nässeschwaden standen wie eine Mauer aus feuchtem Dampf zwischen den Bäumen und ließen dem Blick nur einen Radius von höchstens zwei Metern.
Ärgerlich fuhr er sich mit der Hand durchs Gesicht: Er war achtlos in ein Spinnennetz gelaufen. Die klebrigen Fäden mit den kleinen Tautropfen pappten nun auf seiner Gesichtshaut. Die fernen Steilhänge und Schluchten außerhalb des Gehölzes verschwammen einen Moment vor seinen Augen. Von weitem tönte das Gebimmel einer Ziegenherde herüber, und in regelmäßigen Abständen schlug ein Hund an. Menschenlaute waren nicht zu hören. Er war allein mit seinen Gedanken, und das war gut so. Bald war er auf der Höhe vom Rastplatz La Caldera, der Endstation des Linienbusses angelangt. Er verharrte einen Moment auf der Stelle und starrte blicklos in das dunstige Brodeln.
Blutige Bilder tauchten vor seinem inneren Auge auf und erregten ihn. Er verspürte, er würde es bald tun müssen. Seine Seele, ja sein ganzer Körper verlangten danach. Seine Fußsohlen schwitzten trotz der Kühle des frühen Morgen. Er fühlte ein Ziehen im Magen. Er zwang sich trotzdem fortzuschreiten, bis er die nächste Wegkehre erreichte. Der Waldweg wurde plötzlich gerade und offen. Er trottete ihn eine ziemliche Strecke weiter, ohne in seinem eingeschränkten Blickfeld Einzelheiten zu beachten. Der Weg war nicht wichtig, aber er hatte ein Ziel.
Er war sein Leben lang bis zum heutigen Tag ein gläubiger Christ gewesen. Er hatte stets eine Leidenschaft für Kult, Priestertum und Opferbereitschaft in sich gefühlt. Nun war ihm diese Passion auf einmal nicht mehr genug. Jede Faser seines Inneren strebte nach einer stärkeren, kultischen Droge. Er hatte sich sehr mit den Mythen aus der Entstehungszeit seiner Heimatinsel beschäftigt. Die Blutopfer der Priester für die alten Götter berührten ihn stark und offenbarten ihm neue, verlockende Reize. Er wollte es ihnen gleich tun! Das Ganze war ein schleichender Prozess gewesen. Der kam nun zu einem drängenden Ende. Seine Schläfen pochten vor innerer Erregung. Der Schmerz wuchs langsam an, wie der Schimmel auf der Brotkante. Er fühlte, wie sich die Wurzeln des Heiligen Baumes, des »Árbol Santo«, in seinem Gehirn regten. Sie schrieen nach Blut. Es war, als wollte ihm der Kopf platzen.
Er beschloss, die Gier des Árbol in der kommenden Nacht zu sättigen und hatte bereits ein erstes Opfer ausgewählt. Er hatte den Ablauf der Opferung in den Wochen seiner Wandlung vorgeplant und sah nun in seinem Kopf vor sich, wie die Tat auszuführen war. Er hatte die Durchführung immer wieder akribisch durchdacht und modifiziert, bis ihm alles richtig und vollkommen erschienen war.
Die Zeit des Überlegens und Zauderns war nun vorbei. Seine Ungeduld wuchs von Minute zu Minute und machte ihn fast verrückt. Nur mühsam konnte er Disziplin wahren. ›Übereilte Hast kann alles kaputt machen‹, ermahnte er sich.
Er bog den Waldweg links ab und stieg bergab nach Aguamansa, er wollte im Lokal an der Hauptstraße gebratene Truchas zu essen. Die Forellen kamen aus der Zucht gegenüber frisch auf den Tisch und würden ihn mit für den Augenblick hoffentlich ein bisschen von der eingetretenen Krisis ablenken.
Das Essen kam schnell. Während er genüsslich die kross gebratenen Randgräten auskaute, dachte er zum wiederholten Mal an sein Opfer: Unten in Puerto auf dem Schotterparkplatz vor der Mole von La Ranilla stand seit mehreren Wochen ein klapperiges, angerostetes Wohnmobil. Darin lebte ein einsamer Mann. Die anderen Aussteiger, die ihm in den wärmeren Monaten mit ihren Wagen Gesellschaft geleistet hatten, waren längst in lauere Gefilde geflüchtet. Schon über Weihnachten und Neujahr hatte der Fremde mit seinem Wagen dort ganz allein gestanden. Die kühleren Nächte schreckten ihn scheinbar nicht. Er hatte ihn tagelang beobachtet. Der fremde Mann verbrachte die meiste Zeit in seinem Wagen. Wenn die Sonne herauskam, setzte er sich vor das Automobil oder ging zum Rand der Mole und schaute aufs Meer hinaus, als fände er dort eine Antwort auf die Fragen seines armseligen Lebens. Höchst selten kaufte er ein. In seinen schäbigen Klamotten schlurfte er dann, ungepflegt wie er war, in eines der nahe gelegenen kleinen Geschäfte, die dunkel und muffig im Parterre der alten Fischerhäuser lagen. Sie passten in ihrer Ärmlichkeit bestens zu ihm. Er kaufte meist nur Eier, Weißbrot und Tomaten. Immer war eine größere Menge Viña Sol dabei. Damit soff sich der Mann sein erbärmliches Leben schön.
Er hatte befunden, dass der Kerl ein gutes Opfer sein würde. Ein Opfer des Árbol Santo zu sein, war eine Gnade und eine höhere Erfüllung, als sich zu Tode zu saufen! Er hatte herausgefunden, dass der Mann ein Alemán, ein Deutscher war. Das Kennzeichen seines Wagens war ein »Dd« und stand für Dresden. Vielleicht brachte eine Infusion mit männlichem ausländischem Blut eine Stärkung für den Árbol und eine Beruhigung seines Drängens in ihm als seinem neuen Priester.
Er hatte sein Mittagsmahl beendet und bestellte bei der Kellnerin noch einen Carajillo, Espresso mit Schuss. Danach bezahlte er und machte sich auf den Weg nach Puerto zurück, um auf den Abend und die vorgesehene Stunde zu warten.
*
Er schlief traumlos, bis sein Wecker klingelte. Bedächtig kleidete er sich an. Seine Oberkleidung wählte er Dunkel, denn sein Vorhaben scheute das Licht. Vor dem Spiegel schlug er den Kragen seines Regenmantels hoch und zog sich die dunkelblaue Wollmütze tief in die Stirn. Niemand sollte ihn erkennen. Nun war er bereit, auszugehen. Sein Herz klopfte unruhig. Einen Moment blieb er hinter seiner Wohnungstür stehen und lauschte nach draußen. Es war kein Mucks zu hören.
Er trat hinaus in den Flur des Apartmenthauses und eilte die Stufen hinab, ohne Licht zu machen. Er kannte den Weg wie im Schlaf. Er erreichte die Straße, ohne jemandem zu begegnen, hielt sich im Dunklen und mied selbst das spärliche Licht der wenigen Straßenlaternen. Die Kirchturmglocken der »Nuestra Señora Peña de Francia« schlugen. Es war ein gewohnter Klang für ihn, das beruhigte ihn etwas. Er hörte die Zeit durch die Schwärze der Nacht. Die Glocken schlugen viermal. Es war noch genügend Zeit bis zum allgemeinen Erwachen, trotzdem sputete er sich. Seine Tat vertrug keine Zeugen, es musste noch dunkel sein.
Er wandte seine Schritte Richtung La Ranilla. Bald stank es nach dem Abwasser gesäuberter Fische und nach Fischabfall. Die ärmlichen Häuser im Rund waren nicht unterkellert, Vorräte lagerten in Holzschuppen neben den Gebäuden. Vor ihnen moderte der Abfall. Die Fischerhäuser waren aus Mampuesto, einer Mischung aus Lavaschotter, Lehm und Hächselgut erbaut. Nur an den Ecken bildeten größere Steine ein stützendes Gerüst für die Wände. Die Dächer waren mit Palmblättern eingedeckt und mit allerlei Pflanzenmaterial notdürftig geflickt. Was ein Glück, dass in dieser Gegend die Sonne die meiste Zeit über den Regen triumphierte! In La Ranilla herrschte wirkliche Armut! Nun war sie von der Dunkelheit gnädig überdeckt.
Vor dem Holzkreuz an einer Häuserwand in der Calle San Felipe bekreuzigte er sich flüchtig und sandte ein Stoßgebet gen Himmel. Er erbat sich von seinem christlichen Gott, dass ihm auch für seinen neuen Herrn, den heiligen Baum, ja alles gelänge. Doppelte Sicherheit war immer gut!
Als der Schotter auf dem Parkplatz an der Fischermole unter seinen Füßen zu knirschen begann, ging er vorsichtig weiter. Er roch das Wohnmobil bevor er es sah. Es roch nach Benzin und dem Gummi der Reifen. Er zog sich Handschuhe über. Behutsam schlich er sich an, eine Hand vorausgestreckt, um den Wagen vor einem Zusammenstoß zu ertasten. Das Mobil war von dunkler Farbe und in der mondarmen Nacht überhaupt nicht zu sehen.
Als seine Rechte endlich den kalten Lack des Wagens berührte, versuchte er sich vorsichtig zu orientieren. Schnell war er sich gewiss, hinter dem Fahrzeug zu stehen. Der Eingang des Wohnwagens lag auf der linken Seite. Dahin bewegte er sich nun mit behutsamen Schritten. Aus dem offenen Seitenfenster schlug ihm weingeschwängerte Luft entgegen. Abgehackte Schnarcher des Deutschen durchsägten die Luft. Der Mann schlief unruhig, hatte aber genügend Rotwein intus, um durch die Störung nicht aufzuwachen.
Mit der Rechten griff er in die Manteltasche und holte seine kleine Taschenlampe heraus. Dann ging er in die Knie und griff sich mit der Linken einen der größeren Steine, die vor dem Wagen zuhauf herumlagen. Der, den er auswählte, lag gut in der Hand. Sein Herz pochte ihm bis zum Hals. Er wusste, dass der Deutsche die Tür des Wagens niemals verschloss. So war es auch heute Nacht. Mit einem leichten Quietschen öffnete sie sich unter dem Druck seiner Hände. Das Schnarchen erstarrte für einen Moment, ging dann aber wieder in ein stöhnendes Pfeifen über. Sein Opfer schlief ahnungslos weiter. Er entspannte sich nach kurzem Erschrecken. Er wollte bestimmen, wann »el Alemán« erwachte! So geschah es dann auch.
Erst der gleißende Strahl seiner Taschenlampe ließ den Schlafenden hochfahren. Verstört blickte er blind in den grellen Lichtkegel.
»Was ist denn hier los?«, stammelte er schlaftrunken in seiner Muttersprache.
Er verstand ihn nicht, fackelte aber auch nicht lang. Mit grausamer Wucht schlug er den Stein an die Schläfe des vor ihm Sitzenden. Der sackte lautlos in sich zusammen.
Im Lichte der Taschenlampe wuchs in rasender Schnelligkeit ein Blutfleck und saugte sich in das zerknautschte Kopfkissen auf der Bettstelle. Er griff sich die halbvolle Korbflasche mit dem Rotwein und ließ ihn in die Bettwäsche sickern und auch auf den Fußboden tröpfeln, so dass er das leuchtende Rot des Blutes überdeckte. Den Stein warf er danach weit aus der Fahrzeugtür hinaus und hörte ihn kurz darauf im Dunkeln mehrfach aufschlagen. ›Die Feuchtigkeit wird die Blutspuren an ihm schnell verschwinden lassen‹, dachte er zufrieden. Das Ganze sollte nach seiner Planung wie der »Betriebsunfall« eines Betrunkenen aussehen.
Er begutachtete sein Opfer: Der bewusstlose Mann trug eine kurze Hose und ein T-Shirt. Der Deutsche war, wie beabsichtigt, außer Kraft gesetzt und rührte sich nicht mehr. Er sah sich im Wageninneren um. An einem Haken hing ein kurzer Mantel. Auf dem Tisch lagen einige zugeschnittene Schnüre. Die kamen ihm zupass. Er band dem Bewusstlosen damit Hände und Füße. Dann hängte er ihm den Mantel um und zerrte den leblosen Körper aus dem Innenraum nach draußen in die schwarze Nacht. Bevor er das Mobil endgültig verließ, nahm er ein kleines geschnitztes Amulett aus seiner Manteltasche und legte es auf den Campingtisch in der Ecke des Wagens. Es war ein zierliches Abbild des Drago, des heiligen Baums!
Mit einem kräftigen Ruck hievte er sich den Leblosen auf die Schulter und machte sich auf den Weg zur Ufermauer. Jetzt erst hatte er Ohren für das mächtige Toben der Brandung. Er hörte die Gischt über die Betonpflöcke spritzen und fühlte instinktiv, es war bei der sichtlosen Annäherung an die Uferbefestigung Vorsicht geboten. Im Dunkel der Nacht konnte er das grandiose Schauspiel der herantosenden Wogen nur erahnen, nach ihrer Lautstärke richtete er sich bei seinem Tun. Bald schmeckte er die salzige Nässe des Meers. Er spürte zusehends die Schwere seiner Last.
Endlich erreichte er die Uferbefestigung. Er legte den Körper auf das Mauerwerk, das er mit seinen Füßen vorher ertastet hatte. Hier draußen im Freien wollte er kein Licht benutzen. Nun löste er vorsichtig die Riemen von den Händen und Füßen des Bewusstlosen. Die Schnüre steckte er sorgfältig in seine Manteltasche. Jetzt brauchte der reglose Körper nur noch einen Tritt, um auf der Meerseite des Kais in die Tiefe zu verschwinden. Er schickte den Deutschen mit seinem rechten Fuß auf seine letzte Reise. Ein Adrenalinstoß durchfuhr ihn dabei. Ob der Deutsche zuerst von den Wellen erfasst wurde, um von ihnen in die großen Betonblöcke geschlagen zu werden, oder ob er direkt auf die harten Blöcke aufschlug, blieb im Dunkel. Eines war sicher: Für den Alemán gab es kein lebendes Entrinnen, nur den nassen Tod!
Er fühlte sich mit einmal ganz leicht. Das Pochen in seinem Kopf hatte aufgehört. Der heilige Baum war anscheinend zufrieden mit ihm, dessen Wurzeln quälten sein Hirn nicht mehr. Unentdeckt war er geblieben, lautlos und dunkel wie sein eigener Schatten. Im Hochgefühl der wieder erlangten Ruhe kam er in seine Wohnung zurück und legte sich nochmals zu Bett.
*
Der Tag erwachte so ungastlich, wie an den Tagen zuvor. Über dem Orotavatal hing eine tiefe, graue Wolkendecke fest. Er war aufgestanden und hatte den Tag völlig unberührt von seiner nächtlichen Tat wie immer begonnen. Er hatte zur Ehre des heiligen Drago gehandelt und fühlte sich frei von jeglicher Schuld ganz wie ein Engel im Himmel. Sein Kaffee glänzte schwarz in der Porzellantasse. Das Marmeladenbrötchen, das er schon verzehrt hatte, war nur noch an den vielen Krümeln auf Tisch und Teller zu erkennen. Zu einer zweiten Tasse Kaffee las er die Zeitung. Dann ging er wie gewohnt zur Arbeit.
*
Erst am frühen Nachmittag fand man die Leiche des Deutschen. Jack und Mary Bolton, ein englisches Touristenpaar, hatten die Warnung vor der hohen Brandung im wahrsten Sinne des Wortes in den Wind geschlagen und waren mit staunenden Augen über die nasse Kaimauer spaziert.
Es war Mary, die das graue Bündel zuerst entdeckte. Es hing dort zwischen den Betonquadern, die hereinrollenden Wellen zerrten gierig an ihm. Mary machte ihren Mann darauf aufmerksam, ihre knochige Hand wies ihm die Richtung. Beide waren sich sicher, dass dort ein menschlicher Körper im Meer schlingerte.
»Wir müssen die Polizei verständigen«, sagte Jack sichtlich verstört. Wie ferngesteuert griff er in seine Jackentasche und holte sein kleines, silbernes Mobiltelefon hervor. Er war ein vorsichtiger Mann, auch wenn ihr gefährlicher Spaziergang über die Ufermauer das nicht vermuten ließ. Jack hatte die allgemeine Notrufnummer gespeichert: 112. Er wählte.
Es war etwas mühsam, einen Beamten an den Apparat zu bekommen, der Englisch verstand. Als ihm das endlich gelang, schilderte er mit knappen Worten ihre grausige Beobachtung. Der Brite wurde gebeten, in der Nähe der Fundstelle auszuharren. Es könne etwas dauern, bis ein Bergungsfahrzeug zur Stelle war. Jack bestätigte pflichtbewusst und wandte sich seiner Frau zu, die sich mit aschfahlem Gesicht bei ihm eingehakt hatte und sich Schutz suchend an ihn drückte. Er fühlte das Zittern ihres Körpers, war selbst aber viel zu aufgewühlt, um tröstende Worte zu finden. Stattdessen schilderte er ihr umständlich den Gesprächsverlauf mit dem spanischen Polizisten.
Sie warteten über eine halbe Stunde. Sie blieben in dieser Zeit allein. Keiner der Einheimischen suchte den Weg zu diesem gefährlichen Ort. Auch weitere Touristen blieben aus. Wie von Magneten angezogen gingen die Blicke des Paars immer wieder hinunter in die Tiefe zu dem Toten. Gleichzeitig verfolgten sie ängstlich das laute Tosen der Brandung. Es schien ihnen klar, dass sich hier die gierigen Wellen ihre Beute geholt hatten. Sie traten deshalb etwas von der Ufermauer zurück. Sie wollten nicht die nächsten Opfer sein.
Endlich kam das Polizeiauto mit Blaulicht angebraust. Hinter ihm folgte ein Pick-up mit einer Hebevorrichtung am Heck. Teniente Ramón Martín, der als erster ausstieg, grüßte mit einem flüchtigen Wink zum Mützenschirm. Dann ließ er sich die Fundstelle zeigen und kommandierte seine Leute mit zackigen Worten an die Arbeit.
Ein junger Polizist machte sich für die Bergung bereit. Er schlüpfte in einen wattierten Anzug, der ihn vor den scharfen Kanten der Felsen schützen sollte, falls ihn die Naturgewalten trotz aller Vorsichtsmaßnahmen dagegen schlügen. Sorgsam zog er sich Stiefel mit schwerer Profilsohle an, die ihm bis über die Knie reichten, und verstaute zum Schluss seine kräftigen Hände in dicken Gummihandschuhen. Ein Kollege legte ihm ein Nylongeschirr um, das an der Hebevorrichtung des Pick-up befestigt wurde und ihn in die Tiefe tragen sollte. An einem Karabinerhaken hängte er sich noch eine weitere Leine um den Leib, an der er den Toten befestigen und heraufholen wollte. Bevor es endgültig losging, legte der junge Mann sich selbst noch einmal prüfend mit vollem Gewicht ins Geschirr und begutachtete sorgfältig Sitz und Haltbarkeit der Leinen. Dann machte er den letzten Schritt an den Mauerrand und ließ sich wie ein Bergsteiger an dem glatten Beton nach unten gleiten. Immer wieder gaben seine Kollegen vorsichtig Tau nach. Immer wieder stieß er sich mit den Füßen von der Mauer ab und sank Stück für Stück hinab. Zweimal schlug auf dem kurzen Weg nach unten eine Welle gegen ihn. Er brauchte alle Kraft in den Beinen, um sich von der Mauer abzustemmen und nicht dagegen geschleudert zu werden. Schließlich erreichte er den Grund.
Den Blick prüfend nach unten gerichtet suchte er Halt für seine Füße und fand ihn auf einem Betonblock, dessen Oberfläche fast waagerecht aus dem Wasser guckte. Nun musste er sich beeilen. Er hangelte sich zielstrebig zu der Leiche hin. Es war ein kleines Wunder, dass sie sich so fest zwischen den Steinen verkeilt hatte und nicht längst ins Meer hinaus gezerrt worden war. Er erreichte sie, wickelte das Tau von seinem Leib und befestigte es mit einer Lassoschlinge unter den Achseln des Toten. Mit seiner Rechten gab er nach oben ein Zeichen und sofort begann die Winde des Pick-up, den Leichnam anzuheben. Auf halber Höhe wurde der leblose Körper von einem Brecher erfasst und gegen die Ufermauer geschlagen. ›Lieber der als ich‹, dachte der junge Beamte und duckte sich hinter einem Betonblock. In der nächsten Sekunde fielen die aufgetürmten Wassermassen schon auf ihn herunter. Die eintretende Pause zwischen den Wellen nutzte er, um sich selbst wieder nach oben zu hangeln. Seine Kameraden betätigten die Winde mit aller Kraft, und so schoss er förmlich hinauf. Einmal schlug seine Schulter gegen die Mauer. Der wattierte Anzug machte sich bezahlt und hielt das Gröbste ab. Dann war er in Sicherheit. Erst jetzt, als die Anspannung von ihm abfiel, merkte er, wie verkrampft er die ganze Zeit gewesen war.
Nun lag der geborgene Körper zu Füßen seines Vorgesetzten. Die schäbigen Kleidungsstücke der Leiche waren an mehreren Stellen aufgeschlitzt. An den bloßen Hautstellen waren schlimme Schrunden zu sehen. Das Gesicht des Toten war schon leicht aufgedunsen.
Einer der Polizisten meldete sich zu Wort: »Den kenne ich. Das ist der Deutsche, der die letzten Monate dahinten in dem Wohnwagen kampiert hat.« Sein Zeigefinger wies zu der alten Rostlaube am Parkplatzrand hin. »Ich habe den Mann mehrfach überprüft. Eigentlich war er immer friedlich, trank nur etwas viel.«
»Scheint mir ein Unfall gewesen zu sein«, mutmaßte sein Vorgesetzter. »Wahrscheinlich hat sich der Kerl mit besoffenem Kopf zu nah an den Rand gewagt. Die Dummen sterben eben nie aus. Das letzte Wort hat unser Doktor, schafft die Leiche fort!«
Der Polizeiarzt bestätigte die Vermutungen der Beamten. Zu der Wunde am Kopf durch den Schlag des Mörders waren durch die scharfen Felsbrocken in der Brandung weitere hinzugekommen. Die erste Wunde fiel deshalb gar nicht auf. »Der Körper zeigt nur Gewalteinwirkungen, die von den Felsen herrühren können. Vermutlich wurde der Mann von den Wellen an die Kaimauer geschlagen und ist dann im ohnmächtigen Zustand ertrunken. Betrunken ist er auf jeden Fall gewesen. Er wird kaum etwas von dem Unglück gemerkt haben. Ein verhältnismäßig gnädiger Tod«, dozierte der Mediziner.
Der Wohnwagen des Toten wurde von den Beamten nach diesem Befund nur oberflächlich inspiziert. Juan Álvarez, einer der Polizisten sah auf dem Campingtischchen das kleine Amulett und erwog für einen Moment, es seiner kleinen Tochter mitzunehmen, doch dann ließ er es an seinem Platz. Was man sonst sah, passte mit der Diagnose des Doktors zusammen.
Eine Schwester erwies sich als die einzige Hinterbliebene des Deutschen. Sie machte keine Ansprüche auf die ärmliche Habe ihres Bruders geltend. Wahrscheinlich befürchtete sie zu hohe Kosten bei deren Rücktransport. Nun hatte der alte Wohnwagen ausgedient. Das Mobil wurde samt Inhalt für den Schrottplatz freigegeben.
Mit diesem Entscheid entwickelte sich der Vorfall zu einer Lappalie, die nicht einmal bis zu dem Polizeichef durchdrang. Der verbrachte diesen Tag hinter wichtigen Verwaltungsvorgängen. Auf seinem großen, mit Akten bedeckten Schreibtisch stand im Silberahmen ein Foto seiner Frau Maria, daneben ein Abbild des Wappens von Puerto de la Cruz, seiner Stadt. Auf der Mitte des Wappens prangte rot und grün umrandet ein Drachen. Auf seinem schuppigen Rücken trug er das lateinische Kreuz, das Wahrzeichen Puertos. Unter seinen Krallen schlängelten sich drei silbrige Wellen auf blauem Grund als Symbol des Ozeans. Auf ihnen schwamm ein Schlüssel, der den mutigen Seefahrern den Seeweg nach Indien öffnen sollte. Den Kopf des Wappens zierte die spanische Königskrone.
Der Polizeichef freute sich auf den kommenden Abend. Mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar aus Orotava wollte er den Geburtstag Marias nachfeiern. Er hatte einen schönen Tisch im Gourmettempel von Lucas Maes reserviert. Das Restaurant thronte als grau-weißer Block auf dem Hügel an der Autobahnauffahrt und war eines der besten der Insel. Das Menü hatte er selbst zusammengestellt. Als er jetzt daran dachte, lief ihm vor Vorfreude das Wasser im Mund zusammen.
Als Javier Torres am späten Nachmittag sein Büro verließ, schien seit langem wieder einmal die Sonne. Wie alle Jahre belebten in der Zeit zwischen Januar und März die riesigen Trompetenbaumgewächse mit ihrer auffälligen Blütenpracht das Stadtbild. Die orangefarbenen Blüten der großen Tulpenbäume leuchteten an diesem Nachmittag besonders schön im Sonnenlicht und verbesserten die Stimmung des Polizeidirektors noch mehr, als sie in Erwartung des genussvollen Abends ohnehin schon war.
Das Schicksal des ermordeten Deutschen endete geräuschlos in der Versenkung eines Armengrabes.
*
Eine Horrormeldung stahl ihm einen würdigen Nachruf auf der Titelseite der Tageszeitung: Hundert giftige Behälter mit Pestiziden, die Meeresbiologen zuerst bei einer Walbeobachtung vor El Hierro entdeckt und dann aus den Augen verloren hatten, waren in Punta del Hildalgo gestrandet. Einige waren beschädigt gewesen und den Strand verseucht. Weitere Behälter wurden noch auf See vermutet. Eine Spezialeinheit der Wasserschutzpolizei aus Santa Cruz barg den Giftmüll mit einem Großeinsatz und fuhr als Vorsichtsmaßnahme immer wieder den Küstenstreifen ab, um weitere Fässer zu bergen. Das war eine Bad News nach dem Geschmack der Journaille. Der beängstigende Bericht schloss mit einem schlimmen Szenario, was wäre gewesen wenn…
So fand der Deutsche zu seinem Gedächtnis nur Raum in einer kurzen Meldung auf Seite zwei. Die endete mit einer Warnung vor dem unbedachten Betreten der Ufermauern. Er wurde mit dem Ereignis von niemandem in Zusammenhang gebracht. Wo kein Zeuge war, war schließlich kein Kläger und erst Recht kein Richter.
*
Die Tage glitten vorüber wie die Kugeln eines Rosenkranzes durch die betenden Hände der Gläubigen. Er verbrachte sie wie gewohnt. Unauffällig ging er seiner Arbeit als Leiter der Finanzbuchhaltung nach, war höflich zu Kollegen und Nachbarn und lebte ansonsten zurückgezogen.
Einen großen Teil seiner Freizeit verbrachte er in der Calle Santo Domingo. Dort befand sich die »Casa Cruz Roja«. Über 2500 Mitglieder waren im örtlichen Rot-Kreuz-Verein registriert. Er gehörte dazu! Diese Männer und Frauen stellten mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit eine schlagkräftige kleine Armee für Zivilschutz, Brandbekämpfung, Bergungsmaßnahmen und Unfallrettung. Für ihn bot die freiwillige Arbeit den bedeutendsten Berührungspunkt mit dem anderen Geschlecht. Er war ein Single, hatte weder Frau noch Kinder. Er hatte noch nicht die Richtige gefunden. Er suchte aber auch nicht besonders engagiert. Er wollte in Anbetracht seiner persönlichen Entwicklung auch nicht, dass sich die Schmerzen in seinem Kopf in dem seiner Kinder fortsetzen würden. Er schien, wie es einem Priester eben gebührte, fürs Alleinsein bestimmt. Vorrangig war er aber kontaktscheu. Bei den Stationsdiensten in der Rot-Kreuz-Zentrale hatte er viel Zeit, nachzudenken. Dort kam ihm auch die Idee für eine nächste Opferung. Er wusste instinktiv, dass sich der heilige Baum bald wieder melden würde. Er plante deshalb schon einmal sorgfältig voraus, wie man es von einem Mann der Zahlen erwarten durfte!
Er gehörte ebenfalls noch der Rosenkranz-Bruderschaft an. Die Hermandad del Rosario hatte sich aus dem Fest der heiligen Maria del Rosario entwickelt. Das ging auf Santo Domingo zurück: Der Heilige führte einst im Kampf gegen die ketzerischen Albigenser das Rosenkranzgebet ein, bei dem die heilige Jungfrau eine besondere Rolle spielte. Ihr Fest wurde am ersten Sonntag im Oktober gefeiert. Die Brüder trafen sich jedoch auch über das Jahr hin mehrmals im Monat und natürlich sonntags beim Gottesdienst. Er war ein allseits anerkannter, gläubiger Bruder, hilfsbereit und unaufdringlich. Seit jüngstem plagte ihn Angst, der heilige Baum könnte ihm seine christliche Gläubigkeit verübeln. Aber bis jetzt hatte der zu seiner Erleichterung niemals in diese Richtung gemurrt. So konnte er seine bescheidenen Sozialkontakte zu den Brüdern aufrechterhalten. Seine Mitgliedschaft beim Roten Kreuz und die in der Bruderschaft verhinderten, dass er völlig zum Eigenbrötler wurde.
An seinem Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft hatte er keine Freunde und Bekannte, als Einzelkind hatte er auch keine Geschwister. Seine Eltern waren inzwischen beide tot, und weitere Verwandtschaft hatte er nicht. Die Erinnerung an seine Eltern war nicht allzu positiv. Sie hatten ihm die ganze Kindheit über versucht, seine Linkshändigkeit abzugewöhnen. ›Nicht das böse Händchen‹, kam ihm sofort in den Sinn, wenn er an sie dachte.
Er träumte in der nächsten Nacht einen Traum, in dem sich der Baum wieder meldete, sein Grummeln blieb jedoch noch sehr schwach. Er sah verschwommen Bilder davon, wie der Baum einstmals auf den Archipel gekommen war. Feuerspeiende Drachen flogen vor langer Zeit mit ihren großen, schuppigen Schwingen über die Insel. Hin und wieder lösten sich aus ihren hornigen Panzern und aus den rudernden Krokodilschwänzen dornige Schuppen und fielen zur Erde hinab. Sie gruben sich durch die Wucht des Aufpralls mit ihren harten Spitzen wie Samenkörner in den Boden. Das Drachenblut in ihnen entwickelte magische Kräfte. Schon bald sprossen kleine, schuppige Setzlinge aus dem Boden und schafften die Grundlage für wachsende Heiligkeit. Sie waren in diesem Traum noch zu klein, um Forderungen zu stellen. Aber er wusste: ›Sueño es realidad‹, Traum ist Wirklichkeit! Bald würde er das Sprießen der Wurzeln wieder in seinem Kopf verspüren!
Am nächsten Tag in seinem Büro wurde er erneut an den Árbol Santo erinnert. Die Fehlzündung eines Motorrades, die durch das offene Fenster seines kleinen Arbeitszimmers zu ihm herein knallte, holte ihn aus einem längeren Wachtraum zurück. Bestürzt sah er auf das Schreibblatt vor sich. Er hatte es ganz und gar mit großen Os beschriftet. O für Ofrenda, Opfergabe, dachte er. Angst stieg in ihm auf. Er hatte sich nicht unter Kontrolle! Es durfte nicht passieren, dass er sein heiliges Geheimnis so ungeschützt offenbarte. Dieses Mal war es noch gut gegangen, aber das war keine Garantie für die Zukunft. Er musste sich zusammenreißen. Schnell zerriss er das Blatt in kleine Stücke, warf es in den Papierkorb und wandte sich seinen Geschäftsvorgängen zu.
Nach Dienstschluss zog es ihn nicht sofort in seine Wohnung. Er spürte, dass er es mit sich selbst auf so engem Raum nicht aushalten würde. Er mischte sich auf der Calle Santo Domingo, die zum Meer hinunterführte, unter die Menschen. Punto del Viento, Ort des Windes, wurde die Stelle genannt, der er sich gemächlich näherte. Hier wehte immer eine frische Brise, selbst wenn es anderen Ortes in Puerto windstill war. Jung und Alt, Touristen und Einheimische lehnten zur anbrechenden Abendzeit an der Brüstung und genossen den erfrischenden Luftzug sowie den friedlichen Ausblick auf die Kapelle von San Telmo.
Er war froh, unter Menschen zu sein, das lenkte ihn ab. Er fühlte sich fast ein bisschen dazugehörig und für den Augenblick völlig entspannt. An der hohen Steinmauer zum Strand hin hatten sich mehrere kräftige Negerinnen postiert und buhlten um die Aufmerksamkeit der vorbeiflanierenden Touristinnen. In ihren grellbunt bedruckten, voluminösen Baumwollkleidern näherten sie sich den Frauen und boten an, ihr meist viel zu dünnes, blondes Haar in kleine Afro-Zöpfchen zu flechten. In den Händen hielten sie Fotos von solcher Art Haarschmuck, damit priesen sie ihre Fähigkeiten an.
Er ging nun zu der Ermita hinüber. Vor der Kapelle stand ein Prachtexemplar des Rauschopfs. Die dicke kugelrunde Krone dieses Agavengewächses bestand aus schmalen, strahlenförmig gewachsenen Blättern. Die untergehende Abendsonne beleuchtete sie und gab ihnen einen fast mystischen Glanz. Das Strahlen zog ihn magisch an. Von weitem wirkte die Kugel wie eine schimmernde Glasfaserleuchte. Als er sich daran erinnerte, dass in dem Kirchlein die deutschsprachige katholische Gemeinde ihre Gottesdienste abhielt, kam ihm wieder der Alemán von der Ufermauer in den Sinn. Seine innere Unruhe wuchs, und er machte sich eilig auf den Weg zu seiner Wohnung.
Der Vorfall an der Promenade hatte ihm den Appetit verdorben. Er zwang sich, trotzdem eine Kleinigkeit zu essen. Als er danach mit dem Aufräumen fertig war, spürte er wieder das gleiche Gefühl, das ihn diesen Nachmittag umgetrieben hatte: Diesen Abend würde er nicht allein zuhause aushalten, er musste nochmals hinaus! Er stromerte rastlos durch die Straßen. Noch war die Stadt belebt. Alte Männer saßen Zigarren rauchend vor den Häusern und diskutierten. Junge Mütter hielten ein Auge auf ihre Kinder, die sich vor dem Zubettgehen noch einmal tüchtig austoben durften. Deren Väter standen in kleinen Trauben zusammen und fachsimpelten über ihre Arbeit, Fußball und Politik. Touristen schlenderten herum und suchten das richtige Restaurant für das Abendessen. Viele Paare gingen verliebt Hand in Hand, registrierte er neidisch. Er war wie meistens allein.
Bald schon wurden die Straßen leerer. Die Bars und Tavernen hatten ihre abgefütterten Gäste wieder ausgespuckt und schlossen kurz darauf ihre Pforten. Vor ihren Türen wurden die Stühle hochgestellt und zusammengekettet. Vor der Kellerbar mit dem Schild »Hoyo del Ron«, Rumhöhle, torkelte ein Alter auf der Stelle. Er war mächtig betrunken. Die Kirchglocken bimmelten zur Abendruhe.
Die Luft wurde merklich kühler und ihn fröstelte. Ihm blieb nur der Weg in sein Heim, in die Einsamkeit. Er ging auf der Promenade zurück. Der Wind hatte sich gelegt. Auch das Meer war zur Ruhe gekommen und zu einem schwarzen, stillen Spiegel geworden. Er ließ den Tag noch einmal Revue passieren. Der heilige Baum hatte ihm das Leben heute wirklich nicht leicht gemacht. Er hoffte nun wenigstens auf eine ruhige Nacht.
Diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Vier Nächte lang leuchtete nun schon der Vollmond. Der drang gnadenlos durch die Ritzen seines Fensters und zwang ihn mehrfach aufzustehen und hinauszusehen. Die Häusermauern glitzerten in kaltem Licht. Er roch das Meer und sah in der Ferne das Weiß der Schaumkronen auf den hereinrollenden Wogen. Riefen die Wellen nach einem neuen Opfer? Er verdrängte diesen Gedanken. ›Der ist hoffentlich nur in mir selbst entstanden und nicht aus dem neuerlichen Bohren der Baumwurzeln erwachsen!‹ Das redete er sich zumindest erfolgreich ein und fand so doch noch seinen Schlaf.