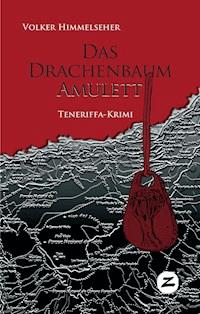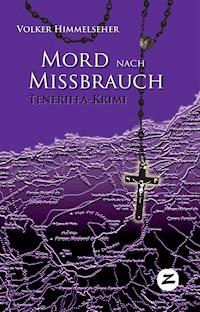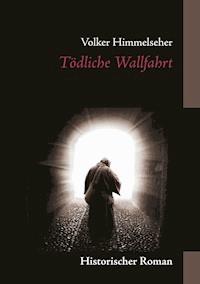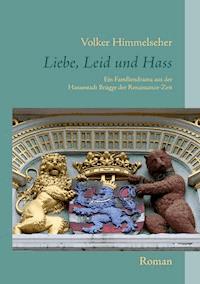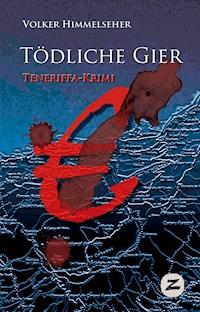
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zech Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ramón Martín & Teresa Zafón
- Sprache: Deutsch
Der 2. Fall von Inspektor Martín und Dr. Teresa Zafón: Der deutsche Rentner Erwin Stein wird in seinem Haus in Santa Úrsula ermordet aufgefunden. Wer sollte ein Motiv haben, den unbescholtenen Bürger umzubringen? Der allein stehende Deutsche hatte seine Immobilie noch zu Lebzeiten dem lokalen Grundstücksbaron gegen Leibrente verkauft. Die Spur führt bald hinter die Kulissen der honorigen Gesellschaft der Bauherren, Bürgermeister und Bankdirektoren...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Himmelseher
Tödliche Gier
Teneriffa-Krimi · Zech
DAS BUCH: Der 2. Fall von Inspektor Martín und Dr. Teresa Zafón: Der deutsche Rentner Erwin Stein wird in seinem Haus in Santa Úrsula ermordet aufgefunden. Wer sollte ein Motiv haben, den unbescholtenen Bürger umzubringen? Der allein stehende Deutsche hatte seine Immobilie noch zu Lebzeiten dem lokalen Grundstücksbaron gegen Leibrente verkauft. Die Spur führt bald hinter die Kulissen der honorigen Gesellschaft der Bauherren, Bürgermeister und Bankdirektoren...
DER AUTOR: Dr. Volker Himmelseher hat ein großes Unternehmen in Köln geführt. Dem Ruhestand nahe, schreibt er nun historische und Kriminalromane. Nach Das Drachenbaum-Amulett (2010) und Tödliche Gier (2011) ist auch der 3. Fall Mord nach Missbrauch (2012) im Zech Verlag erschienen.
Impressum
Textgrundlage dieses E-Books ist die mit dem gleichnamigen Titel im Zech Verlag (Teneriffa 2011) erschienene Taschenbuchauflage, erstmals veröffentlicht im E-Pub-Format im April 2014.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, auch einzelner Teile, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, öffentlichen Vortrag, Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen, z.B. über das Internet.
Alle Rechte vorbehalten. © 2014 ZECH VERLAG
Verena Zech, E-38390 Santa Úrsula (Teneriffa, Kanarische Inseln, Spanien)
Tel./Fax: (34) 922-302596 · E-Mail: [email protected]
Text: Volker Himmelseher
Covergestaltung: Karin Tauer
Konvertierung: Zech Verlag
E-Book ISBN 978-84-941501-2-8 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-84-938151-4-1
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Webseite:
www.editorial-zech.es/de/
Vorbemerkung des Autors
Dieser Roman ist in ein regionales Umfeld gebettet, das mir in mehr als zehn Jahren ein Stück zweite Heimat geworden ist. In ihm sind viele unvergessliche Eindrücke verarbeitet, welche die vielen »Auszeiten« auf der Sonneninsel mit sich brachten. Die Geschichte selbst sowie die in ihr handelnden Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit realen Vorkommnissen oder auch Zeitgenossen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
*
Das Wetter auf Teneriffa spielte zurzeit verrückt. Noch vor kurzem hatte im Orotava-Tal Weltuntergangstimmung geherrscht. Die schlimmsten Regenfälle seit vier Jahrzehnten waren heruntergeprasselt. Dieser unvorstellbare Herbstregenguss setzte Straßen und Wege unter Wasser. Selbst die Autobahnen wurden unpassierbar, denn die Wassermassen konnten vom knüppelharten Boden nicht mehr aufgenommen werden. Gewaltige Niederschlagsmengen strömten sturzbachartig durch die Barrancos und liefen die Hänge hinab. 180 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden ließen reißende Schlamm- und Geröllmassen entstehen, die selbst Autos mit sich schwemmten. Menschen und Tiere kamen zu Schaden.
Der beginnende Herbst machte sich bald mit neuen Strafen bemerkbar. Calima, Hitze, Sand und Staub aus Afrika hießen die Plagen! Die Temperatur nahm ständig zu und wurde für alle Kreatur unerträglich. Ein Hitzeschild stand wie eine Wand über der Insel – kein Luftzug, keine Erfrischung. Selbst der stets kühlere Norden litt unter der Glut, die aus bleischwerem Himmel auf das Land drückte, obwohl die Sonne hinter milchigen Schleiern kaum zu sehen war.
Nur manchmal öffnete sich das wolkenverhangene Grau. Doch es ließ nicht das übliche, strahlende Blau hervor. Es war vielmehr das Türkis eines mit kleinen, gefährlichen Äderchen durchzogenen Opals, das die Hitzewelle begleitete und das Meer mit giftig grünlichem Schimmer verzauberte. Die Luftfeuchtigkeit war langsam aber sicher ins Bodenlose gesunken und die Gluthölle aus Afrika hielt die Frühlingsinsel fest in ihren Fängen. Auch das Atmen fiel den Inselbewohnern schwer. Ihre Nasen waren andauernd trocken und innen rau wie Sandpapier, sodass sie beim Naseschneuzen schmerzten.
Touristen, die Woche für Woche zu Hunderttausenden einflogen, waren entsetzt. War das wirklich die Insel des ewigen Frühlings? 220 Sonnentage im Jahr, nicht über 30 Grad im Sommer und nicht unter 20 Grad im Winter hatte man ihnen versprochen! Sie wollten einen schönen Urlaub erleben, stattdessen kamen sie nun am besten mit dem Wetter zurecht, wenn sie in den Hotels blieben und nichts taten!
Die meisten Einheimischen dagegen konnten nicht einmal zu Hause bleiben, denn ihre Arbeit musste weitergehen. Sie konnten nur sehnlichst darauf hoffen, dass bald der Passatwind zurückkam, um eine Wetterwende einzuleiten. Erfahrene Insulaner wussten, dass selbst die Rückkehr des Windes nicht unbedingt das Ende des Übels bedeutete. Der Wind konnte neuerlich drehen, wieder heißen Sand aus der Sahara herbeibringen und alles mit ockerfarbenem Schleier überziehen.
Rien ne verais plus! Nichts würde mehr gehen. Der Flughafen würde gesperrt, genauso wie der Fährbetrieb zwischen den Inseln. Die Bananenplantagenbesitzer würden um ihre Ernte bangen; die sowieso schon verärgerten Herbsttouristen würden endgültig durchdrehen! Sie mussten nun nach Hause zurück, um ebenfalls wieder zu arbeiten und wurden durch die Unbilden der Natur daran gehindert.
Erst wenn dieser heiße Wind endgültig seine Kraft verlor, war mit Besserung zu rechnen, denn nur ein stabiler Passatwind konnte die Hitze fortblasen und das gewohnt milde Klima der Kanaren wieder aufbauen. Dann erst konnte das Großreinemachen beginnen. Der Sand lag in den Häusern auf Möbeln, Teppichen, auf technischen Geräten und selbst auf den Vorräten; in den Gärten auf Beeten, Pflanzen, den Abdeckungen der Swimmingpools und den Gartenmöbeln; in den Geschäften und Supermärkten auf den Regalen und Waren. Er musste nun sorgfältig weggefegt werden. Man durfte mit der Reinigung jedoch nicht zu früh beginnen: Morgen, mañana, war oftmals besser! Die Plage könnte schließlich zurückkommen, und dann hätte man umsonst geputzt!
Was Calima sonst noch alles mit sich brachte, war noch gar nicht richtig erforscht. Man wusste nur, dass Bakterien, Pilzsporen und Viren mit dem Saharawind auf die Insel getragen wurden, mitunter todbringende »Gäste«. Die erbarmungslose Hitze besiegte aber auch Hemmung und Moral der Menschen: Calima war die Zeit vermehrter Verbrechen und Untaten auf der sonst meist friedlichen Insel und auch dieses Mal sollte das sechste Gebot, welches fordert: »Du sollst nicht töten«, in der Höllenhitze des Leidens gebrochen werden!
*
Das neue Lokal in der früheren Garage lockte mit großer Schrift über dem Eingang: »Guachinche Pedrito, abierto de 7 a 11 horas, cerrado los domingos«. Hier, an dieser Straßenecke, war ihr morgendlicher Treffpunkt.
Die Bauarbeiter Alberto Alonso und Diego Sánchez trafen sich um 7 Uhr 30 hier am Anfang der Avenida Venezuela, Urbanisation Lomo Román, Santa Úrsula, um gemeinsam zu ihrer Baustelle zu gehen. Diego rauchte genüsslich und wurde von Alberto dafür wortreich gerügt: »...du schimpfst dich Sportler und willst ein guter Ringer sein«, schloss er vorwurfsvoll seine Vorhaltungen.
»Mein Großvater sagte immer, der liebe Gott raucht auch. Wo kämen denn sonst die vielen Wolken her?«, gab Diego patzig zurück.
Die beiden jungen Männer passierten die Unterführung unter der Autobahn und registrierten in ihrer Morgenmüdigkeit nicht einmal den hohen Geräuschpegel der vielen Autos. Mit dem kleinen weißen Wachhäuschen hinter der Unterführung begann die eigentliche Urbanisation Lomo Román.
Das Häuschen hatte mit einer Schranke die Einfahrt in diese »bessere Gegend« schützen sollen, war aber nie zum Einsatz gekommen. Inzwischen war es ziemlich verfallen und heruntergekommen. Getränkedosen und Zigarettenkippen lagen hier auf dem Boden. In ihm turtelten, besonders in den Abendstunden, gerne Liebespaare. An den Wänden waren die Namen vieler Liebenden verewigt. Auch Diegos Name prangte dazwischen zusammen mit dem von Mercedes, Albertos Schwester, obwohl die leider nichts von ihm wissen wollte. Diego hatte seine kleine Schwester in Verdacht, ihre Namen dort hingeschmiert zu haben. Er wollte sie schon längst entfernen, denn das Gekritzel bot seinen Freunden immer wieder Grund, ihn zu hänseln. Nach seiner harten Arbeit war er dazu aber bisher immer zu müde gewesen oder hatte anderes vorgehabt. So musste er sich auch diesen Morgen wieder von seinen Kollegen veralbern lassen.
Mit der Mahnung »Se ruega respetar las plantas«, bitte die Pflanzen respektieren, versuchte ein Schild am Rand der Straße die grüne Lunge der Urbanisation zu schützen. Diego sah eine Möglichkeit, das Thema zu wechseln. Er pieselte grinsend in die Hibisken: »Ich respektiere sie nicht nur, ich dünge sie sogar«, lachte er zu seinem Freund hin.
Auf mittlerer Höhe ging von der Avenida Venezuela die Calle Orinoco ab. Dort stieß Marco Fuentes zu ihnen. Er wohnte in einer der Seitenstraßen in einem ärmlichen Altbau, nicht weit entfernt von dem prächtigen Haus ihres Arbeitgebers Delgado Sociedad Anónima, S.A.
Die drei Männer sollten für Delgado die Treppenstufen ausbessern, die vom Wendehammer der Avenida zum Atlantik hinunter führten. Der Weg wurde inzwischen nur noch wenig benutzt, weil er stark verwildert und kaum noch begehbar war.
Die Urbanisation hatte sich in den letzten Jahren zum exklusiven Wohnort begüterter Bürger entwickelt, aber die drei Burschen kannten die Gegend von früher noch ganz genau. Sie hatten schon als Kinder unten am Meer Tintenfische harpuniert und stolz zu manchem Mittagsmahl ihrer Familien beigetragen. Pulpo guisado oder pulpo a la gallega mochte jeder auf der Insel!
Ein Blick zurück zeigte ihnen, dass der Teide immer noch im Hitzedunst verborgen lag. Der Tag würde wieder schwer zu ertragen sein.
Ein Hahn krähte. Waren sonst auf der Insel die Hunde mit ihrem anhaltenden Gekläffe die Herren des Morgenerwachens, so waren es in Lomo Román die Hühner und Hähne. Ein Einheimischer hatte vor längerer Zeit einige von ihnen auswildern lassen. Im unzugänglichen, kakteenbewachsenen Freiland zwischen den Häusern hatten sich die Tiere schnell vermehrt und bestimmten nun mit penetrantem Gegacker und Kikeriki zum Leidwesen vieler Residenten allzu früh deren Aufwachzeit. Eine ältere Dänin hatte versucht, ihre Nachbarn zu überreden, die Tiere abzuschießen. Die meisten Anwohner hatten sich jedoch zähneknirschend dafür entschieden, die Naturgeräusche weiter zu ertragen. Es gab schließlich immer weniger davon. Ein an die Mauer geklebter Zeitungsartikel wirkte bei der fortwährend gackernden Geräuschkulisse grotesk: »Un vergel en Santa Úrsula, un auténtico paraiso alejado del ruido y la contaminacion donde se oyen pájaros«. Ein Ziergarten in Santa Úrsula, ein wahres Paradies fernab vom Lärm und Umweltschmutz, wo Pflanzen gedeihen und Vögel singen.
Mehrere Eidechsen hatten sich bei der frühmorgendlichen Wärme nach draußen gewagt und verschwanden blitzschnell wieder in den Mauerritzen, als die drei jungen Männer bergab an ihnen vorbeitappten.
Aus den schwarzen, gelochten Gummischläuchen, die in den Beeten entlang des Straßenrandes lagen, plätscherte leise Wasser. Das war bei der herrschenden Trockenheit dringend nötig. Die vielen blühenden Pflanzen, Hibisken, Strelitzien, Bougainvillea, Oleander und Trompetenbäume dankten es mit intensivem Farbenspiel.
Die drei Arbeiter waren leicht gekleidet, kurze Baumwollshorts und Muskelshirts ließen viel Luft an ihre Körper, aber auch die war heiß.
Die jungen Männer hatten gedrungene, athletische Ringer-Figuren. Tatsächlich waren sie leidenschaftliche Luchadores und liebten ihren Nationalsport, der auf der ganzen Insel betrieben wurde und auch viele Touristen als Zuschauer anzog. Santa Úrsula, ihr Heimatort, war eine Hochburg für Lucha Canaria. Teams von zwölf Ringern traten dabei gegeneinander an. Ihr Ziel war, den Gegner mit spektakulären Bewegungsabläufen in dem mit Sand gefüllten Rund, genannt Terrero, auf den Boden zu werfen. Mit diesen Übungen konnten sie sich stundenlang beschäftigen.
Plötzlich wurde ihre Morgenroutine jäh unterbrochen. Die Männer schraken zusammen: Unten am Wendehammer, auf den ersten Stufen des Abstiegs zum Meer, direkt hinter der hüfthohen Mauer, lag zwischen blühenden Bougainvillea-Ranken der leblose Körper eines Mannes. Irgendetwas bewegte sich an ihm. Schlief er vielleicht nur? Ihr Schreck ging schnell in Grusel über. Er musste tot sein! Die Bewegung kam nicht von ihm selbst. Aus seinem rechten Nasenloch krabbelten vielmehr zwei große Ameisen hervor.
»Boquiabierto y muerto«, mit offenem Mund und tot, stellte Marco fest. »Und der Tod ist bunt«, ergänzte er mit Blick auf die prächtigen Bougainvillea, die sich um die Leiche wanden. Marco wollte trotz seines gehörigen Schreckens lässig erscheinen und versuchte, seine Betroffenheit durch flapsige Sprüche zu übertünchen.
Die drei identifizierten den leblosen Körper schnell. Es handelte sich um den deutschen Residenten Erwin Stein, der in einer Villa gegenüber dem Einstieg zum Meer wohnte. Stein war Witwer, das wussten sie. Zumindest zu Hause vermisste ihn also niemand.
Diego wollte ebenfalls von seiner aufgewühlten Gefühlslage ablenken und fragte seine Freunde: »Wisst ihr, wie man einen Mann nennt, der 90 Prozent seiner Denkfähigkeit verloren hat?«
»Witwer«, antwortete Alberto genervt.
»Aber der arme Kerl hier hat gar keine Denkfähigkeit mehr!«
Per Handy riefen sie die Policía Nacional zum Fundort der Leiche.
*
Inspektor Vicente Morales erschien mit der Spurensicherung und dem Polizeiarzt in weniger als zehn Minuten.
»Ich bin sicher, hier handelt es sich um Mord«, entschied er nach erstem Augenschein.
Ein junger Polizist, der seinen ersten Toten sah, fragte entsetzt: »Wer macht denn so etwas?«
Morales verbesserte ihn rechthaberisch: »Warum wurde das gemacht, und wem nutzt es? Das sind für uns wichtigere Fragen. Die Antwort darauf führt uns nämlich direkt zum Täter!« Der Teniente hatte in dem jungen Kollegen endlich wieder einmal ein geeignetes Opfer gefunden und fuhr mit seinen Belehrungen fort: »Mit den forensischen Untersuchungen beginnt man schon am Fundort einer Leiche. Mit Regen müssen wir nicht rechnen«, ergänzte er sarkastisch, den Blick auf die staubtrockene Gegend gerichtet. »Wir brauchen also keinen Wetterschutz«, fügte er für den Neuling erklärend hinzu.
Morales ließ die Fundstelle weiträumig absperren und wies seine Männer an, die gesamte Umgebung nach Beweismitteln abzusuchen: »Vom Zentrum aus spiralförmig nach außen, Fußabdrücke, Reifenspuren, Haare, Fasern, Blutflecken, einfach alles.« Er hatte eine Stimme, die zu befehlen gewohnt war und wusste sie auch zu nutzen: »Bevor ihr die Gegenstände einsammelt, markiert ihre Position und fotografiert sie, lieber zu oft, als zu wenig. Fehlende Bilder lassen sich später nicht wiederholen. Keiner von euch rührt den Toten an, bevor der Doktor mit ihm fertig ist!«
»Wir sind doch keine dummen Schuljungen«, zischelte einer seiner erfahreneren Männer leise vor sich hin. Ein Kollege verstand ihn trotzdem und nickte zustimmend.
Doktor Mendoza, der Polizeiarzt, machte sich an die Arbeit und diagnostizierte schnell: »Tod durch Erschlagen von hinten und zwar mit einem stumpfen Gegenstand! Sie haben Recht, Teniente, es war Mord, keinesfalls Selbstmord.«
Der Mediziner betonte, dass der Täter mit aller Gewalt zugeschlagen haben musste. »Der Schlag ist so hart gewesen, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit nur von einem Mann erfolgt sein kann, im äußersten Fall von einer sehr starken jungen Frau. Der Täter muss, so wie der Schlag ausgeführt wurde, Rechtshänder sein. Unter dem Kopf der Leiche ist eine große Blutlache. Alles deutet darauf hin, dass der Fundort auch der Tatort ist.«
Was nun getan werden musste, war Routine. Der Doktor verabscheute sie: Er hatte, zur Bestimmung des genauen Todeszeitpunktes, die innere Körpertemperatur des Toten mit Rektalmessung zu ermitteln. Die Temperatur sank normalerweise in den ersten zwölf Stunden etwa eineinhalb Grad pro Stunde. Das war der Anhaltspunkt für die Bestimmung.
Mendoza machte den Rücken des Toten frei und schob dessen Hose und Unterhose runter. »Aha, keine Schleifspuren an den hinteren Körperteilen. Das erhärtet meine Vermutung: Der Fundort ist der Tatort!«
Der nackte Rücken des Toten zeigte allerdings merkwürdige blaue Flecken. »Livor mortis, die blauen Flecken des Todes. Wenn das Herz nicht mehr schlägt, zirkuliert das Blut nicht mehr. Die roten Blutkörperchen sinken in die Körperteile ab, die auf dem Boden liegen, und färben sich innerhalb weniger Stunden blau«, dozierte Mendoza in die Runde. Dann führte er das Thermometer bedächtig in den After ein. Nach einem längeren Augenblick zog er es mit stoischer Miene wieder heraus und las den Wert von der Skala ab: 32,5 Grad!
»Die Verfärbung des Rückens und die Temperaturhöhe deuten darauf hin, dass das Opfer höchstens drei bis vier Stunden tot ist. Bei dieser Hitze sind die Richtwerte jedoch nicht ganz brauchbar. Sie müssen mir deshalb einen gewissen Spielraum einräumen«, wandte er sich an Teniente Morales. »Die Leichenstarre hat jedenfalls noch nicht eingesetzt.«
Am Rande der Blutlache unter dem Kopf war auf der Steinstufe ein blutiger Fußabdruck zu sehen. Der Arzt wies darauf und meinte: »Der kann natürlich von einem der drei Burschen sein, die den Toten gefunden haben, aber genauso gut vom Mörder. Das wird erst durch die Spurenauswertung geklärt werden können. Auf jeden Fall sollte man Abdrücke von den Sohlen der Drei nehmen, damit das benötigte Vergleichsmaterial vorliegt.«
Der Inspektor nickte zustimmend. Als er sah, dass der Arzt keine Anstalten mehr machte, mit seinen Untersuchungen an der Leiche fortzufahren, wies er seine Leute an, nun auch am Opfer selbst Spuren zu suchen. »Fremde Haare, Hautfetzen oder Fasern, seht nach Verdächtigem unter den Nägeln, vielleicht hat es vor dem Mord einen Kampf gegeben!«
Die Mordwaffe wurde nicht gefunden. Wenn der Täter sie in die Kakteen oder Dornenbüsche des Abhangs geworfen hatte, war sie wohl für immer verschwunden. Die stacheligen Pflanzen bedeckten den ganzen Berghang und machten ihn außerhalb des Weges unbegehbar und uneinsehbar. Dort etwas zu suchen, war schier unmöglich. Ein Versuch kam der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen gleich!
Inspektor Morales machte sich nun selbst an das Verhör der drei Arbeiter: »Könnt ihr was zu dem Toten sagen?«, begann er seine Befragung.
Diego reagierte am schnellsten: »Das ist Señor Stein, der hat sein Haus dort drüben.« Mit seiner Rechten wies er auf die Villa jenseits der Straße.
»Gut, das hilft uns schon weiter«, lobte ihn der Teniente. »Habt ihr hier irgendjemanden gesehen?«, fragte er weiter.
Sie erinnerten sich an einen Schwarzen, der in den letzten Tagen hier mehrmals herumgestreunt war. »Womöglich kampiert er in einem der leer stehenden Häuser oder wurde von Señor Stein beim Einbrechen überrascht«, mutmaßte Marco. »Viele der Anwesen werden nur als Ferienhäuser genutzt, sind ideale Unterschlupfplätze und für Einbrüche bestens geeignet«, erklärte er weiter.
Der Kerl wurde für den Teniente sofort zum Hauptverdächtigen. Sogleich ließ Morales die benachbarten Grundstücke absuchen. Ein aufgebrochenes Toilettenfenster im Kellergeschoss eines der Häuser wies seinen Männern den Weg.
Nach kurzer Suche fanden sie in einem der unteren Räume einen verängstigten Eindringling. In dem halb dunklen Raum roch es nach Angst und Schmutz. Weiße weit aufgerissene Augäpfel leuchteten ihnen aus dem Dämmerlicht entgegen. In die breiten Wangenknochen des Schwarzen waren Stammeszeichen eingeritzt. Trotz seiner jämmerlichen Gesamterscheinung sahen sie bedrohlich aus.
Um ihn herum war reichlich Diebesgut aufgetürmt. Ein Flachbildfernseher, eine Stereoanlage, mehrere aufgerollte Teppiche, Bilder, Schmuck und anderes Gerät waren darunter. Neben dem Mann lagen ein Glasschneider und ein Stemmeisen.
Weiterer Beweisstücke bedurfte es nicht! Der Kerl war mit Sicherheit im Haus auf Beutezug gewesen. »Hausbesetzung, versuchter Diebstahl und wohl auch Mord sind Gründe genug, ihn festzusetzen«, entschied Morales, froh, so schnell erfolgreich zu sein.
Zu ihrer Überraschung fanden die Beamten in den Taschen des Verdächtigen einen sudanesischen Pass. Er hatte sich hier offenbar recht sicher gefühlt. Sonst traf man selten bei solchen Kerlen auf einen Hinweis zur Identität. Ali Machoud hieß der Mann, er war vermutlich ein Illegaler, einer der Bootsflüchtlinge von der nahen afrikanischen Küste.
Inspektor Morales befand, dass hier unten vorerst nichts mehr zu tun war. Die Leiche und alle Fundstücke ließ er abtransportieren. Ali Machoud brachte man zum Verhör aufs Revier. Der Verhaftete folgte allen Anweisungen der Beamten sofort und widerstandslos.
»Gott sei Dank! Er spricht Spanisch. Wir brauchen keinen Dolmetscher«, stellte der Teniente fest.
*
Als die jungen Männer wieder unter sich waren, begann Marco gegen Diego zu sticheln. Mercedes Alonso, die Schwester Albertos, hatte man oft bei dem ermordeten Deutschen gesehen. Es wurde gemutmaßt, dass Diegos Angebetete in »ausländischen Gärten« genascht hatte.
»Mercedes ist nun wieder solo, wie schön für dich, Diego! Du hast doch wohl nicht nachgeholfen?«, lachte Marco zu seinem Kumpel hin.
Diego reagierte erbost, und auch Alberto fand Marcos Äußerungen gar nicht lustig. Schließlich gingen sie gegen seine Schwester und damit gegen die Familienehre!
»Halt dich geschlossen«, fuhr er Marco wütend an. »Sonst setzt‘s was!«
Die Männer nahmen schweigend ihre Arbeit auf. Sie hatten schon viel zu lange nichts getan.
*
Auf dem Polizeirevier in Santa Úrsula ging es zu wie in einem Bienenstock. Seit mehr als 15 Jahren hatte es im Ort keinen Mordfall mehr gegeben. Entsprechend groß war die Aufregung.
»Führen heißt schnell reagieren«, sagte sich der Revierleiter und gab die Parole aus, der Fall sei eiligst zu lösen. Es war bereits Mitte Oktober, und am 21. Oktober fanden die Fiestas Patronales de Santa Úrsula statt. Die durften durch nichts beeinträchtigt werden. Er hatte nicht vor, alle im Ort gegen sich aufzubringen. Der Mörder musste rasch überführt werden. So wie es aussah, musste er ja nur noch gestehen!
In der Stadt verbreitete sich die Nachricht von dem Mord wie ein Lauffeuer. Ein Gerücht jagte das andere. Der eine wusste zu berichten, der Mörder sei schon überführt und gefasst. Der nächste beteuerte, der Täter sei noch unerkannt und könne jederzeit wieder zuschlagen. Überall in den Straßen bildeten sich Grüppchen, die miteinander debattierten. Einer der Einheimischen meinte trocken: »Was für ein Glück, dass es keinen von uns getroffen hat.« Dem war nichts hinzuzufügen! Ein besonders Ängstlicher unkte jedoch: »Das kann ja noch kommen. Ich glaube nicht, dass sie den Mörder wirklich schon haben.«
Einige Neugierige liefen zur Polizeistation, um sich nach Einzelheiten zu erkundigen. Die Polizisten kamen den Anfragen nicht mehr nach. Es herrschte bald allgemeines Chaos auf dem Revier.
*
Ali Machoud grübelte in seiner Zelle. Er saß kerzengerade, sein Körper war steif wie ein Stock. Mit dem Zeigefinger kratzte er sich an der Messerstichnarbe an seinem Bauch. Er fühlte sich wie ein eingesperrtes Tier. Sein Blick hetzte umher, die Augen waren weit aufgerissen. Sein Puls schlug ungleichmäßig. Schweiß stand ihm auf der Stirn.
›Was werden die wohl mit mir machen?‹, dachte er voller Angst.
In dem Moment hörte er, wie ein Schlüssel in der Zellentür gedreht wurde. Die Tür öffnete sich. Ein Wärter trat ein, der ihn aufforderte, ihm zu folgen. Der Polizist war nicht unfreundlich, registrierte Machoud. Da war er aus seiner Heimat Schlimmeres gewöhnt!
Er wurde in einen hell beleuchteten Raum geführt und sah sich darin ängstlich um. Auf einem langen Tisch stand allerlei technisches Gerät. An seinem Ende war auf einem Stativ ein Fotoapparat aufgebaut. ›Der ist bestimmt für Erkennungsfotos‹, dachte Machoud und wurde nervös.
Was der Beamte von ihm wollte, verstand er nicht sofort. Doch als der ihm alles nochmal erklärt hatte, ließ er sich mit klopfendem Herzen Fingerabdrücke abnehmen. Nachdem sie mit der Prozedur fertig waren, nahm Machoud den hingehaltenen Lappen mit zitternden Händen und reinigte seine Finger gründlich. Er nahm sich Zeit. Diese Zeitspanne bedeutete eine kleine Atempause nach all dem Schreck.
Nun musste er sich zum Fotografieren auf den Stuhl setzen. Bei einem Foto seiner Seitenansicht kam sein geschlitztes Ohr richtig zur Geltung. Als das Blitzlicht zum ersten Mal aufflammte, zuckte Machoud mächtig zusammen.
»Der glaubt wohl, er würde erschossen«, lachte der Polizist dröhnend zu seinem Kollegen hin. Er scherte sich einen feuchten Kehricht darum, dass der Gefangene ihn verstand.
Machoud erduldete die Frechheit regungslos und schwieg. Er wollte aufkommendes Missfallen vermeiden.
Schließlich führte ihn der Beamte in den Verhörraum. Dort saßen bereits zwei Polizisten an einem Tisch und sahen ihn kalt an. Neben einem der Beamten stand das Aufnahmegerät. Der andere Polizist sah Machoud an, zeigte auf den leeren Stuhl und forderte ihn mürrisch auf, Platz zu nehmen.
Machoud tat alles, ohne zu zögern. Er schwitzte leicht. Sein Hemd klebte bereits an seinem Rücken. Er hatte Angst vor dem, was nun kam.
Der Kommissar blätterte in den Unterlagen vor sich und begann ohne Umschweife mit dem Verhör: »Sie heißen Ali Machoud?«
Der Gefangene nickte.
»Bitte antworten Sie mir mit Ihrer Stimme, unser Gespräch wird aufgezeichnet«, sagte Morales.
»Jawohl«, wiederholte Machoud mit gutturaler Stimme und setzte hinzu: »Ich bin sudanesischer Staatsbürger.«
Die Stirn des Kommissars krauste sich, doch er entschied sich, versöhnlich zu bleiben: »Sehen Sie, es geht doch! Aber trotzdem sollten Sie bitte nur auf das antworten, was Sie gefragt werden.«
Seine nächste Frage schloss er sofort an: »Wo sind Sie geboren und wann?«
»In Khartum am 15. Oktober 1972.«
Der Inspektor verglich die Angaben mit den Vermerken in Machouds Pass und gab sich zufrieden. Sie waren identisch.
»Sie werden mehrerer Straftaten verdächtigt, ich muss Sie belehren, dass Sie sich einen Anwalt nehmen dürfen«, fuhr er fort.
Machoud lehnte das ab.
›Gott sei Dank‹, dachte Morales. Jetzt blieb ihm wenigstens der obligatorische Satz aller Anwälte erspart: ›Die Inhaftierung meines Mandanten bei dieser dünnen Indizienlage ist ein Skandal!‹ Keine Haftbeschwerden also, jetzt musste nur noch ein Geständnis her, und daran wollte er arbeiten.
»Da hatten Sie aber eine ganz schön lange Reise, bis auf unsere Insel«, stellte er fest. »Haben Sie für Teneriffa überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung?«
Machouds Blick wurde unsicher, dann stotterte er: »Ich, ich verstehe nicht, was Sie meinen.«
»Haben wir auf einmal doch Sprachschwierigkeiten?«, fuhr ihn Morales spitz an.
»Haben Sie ein amtliches Papier, welches Ihnen den Aufenthalt auf der Insel Teneriffa gestattet?«, wiederholte er seine Frage mit anderen Worten.
Machoud überlegte kurz, wie er antworten sollte. »Ich bin ein Flüchtling, Señor«, erwiderte er wie zur Entschuldigung.
»Dann sind Sie wohl auch in das Haus geflüchtet, in dem wir Sie gefunden haben«, stellte der Teniente mit nun schärferer Stimme fest.
»Nein, ich weiß, es war unrecht, was ich dort tat, aber ich brauchte eine Unterkunft und hatte kein Geld«, erwiderte Machoud mit leiser Stimme.
»Das wollten Sie sich wohl mit den zusammengetragenen Wertgegenständen besorgen?« Der Inspektor blieb bei der eingeschlagenen schärferen Gangart.
»Gott möge mir verzeihen, ja, das wollte ich, Señor«, antwortete Machoud kleinlaut und senkte sein Gesicht zu Boden.
»Und dann kam Ihnen der Bewohner des Nebenhauses in die Quere und musste sterben«, folgerte der Inspektor messerscharf mit einer Stimme wie ein Peitschenhieb.
Machoud zuckte zusammen. »Welcher Bewohner, Señor? Ich kenne keinen Bewohner. Das Haus war leer. Ich habe auch niemanden getötet, das schwöre ich bei Gott!«
Morales schob ein Foto des toten Erwin Stein über den Tisch direkt vor den Gefangenen hin. »Schau dir den Toten ruhig an. Wir haben ihn direkt vor dem Haus gefunden, in das du eingedrungen warst. Nun sag mir ins Gesicht, dass du mit seinem Tod nichts zu tun hast!« Morales war vor lauter Ärger in das nicht statthafte »Du« verfallen.
Machouds Augen hatten sich bei seinem Wutausbruch erschrocken geweitet. Er schüttelte heftig den Kopf, blieb aber stumm.
»Du hattest Angst, er suchte nach dir, und da hast du...«
»Nein, nein, nein«, jaulte Machoud auf.
Morales versuchte es zur Abwechslung auf die sanfte Tour: »Hat dich der Mann vielleicht angegriffen, und du hast dich nur gewehrt? Dann wäre deine Tat Notwehr.«
Der Schwarze gab ihm erneut keine Antwort. Er witterte instinktiv die ihm gestellte Falle.
Morales musste sich schwer zusammenreißen, Machoud nicht an den Schultern zu packen und so lange durchzuschütteln, bis er endlich gestand. Der Teniente stand unter Druck, ein Mörder musste her! Bald sah er jedoch ein, dass heute nichts mehr aus dem Gefangenen herauszuholen war. Morgen würden die Untersuchungsergebnisse der Spurensicherung und des Arztes vorliegen, dann würde man weitersehen. Morales beschloss, es für diesen Tag genug sein zu lassen, und schickte den Häftling in die Zelle zurück.
Machoud verbrachte die ganze Nacht aufrecht sitzend, wie zu Hause als Wächter der Herde, ganz ohne Schlaf, aber mit viel Zeit zum Grübeln. Es ging schließlich nicht um illegalen Aufenthalt und Einbruch, nein, dieses Mal ging es um Mord!
*
Morales war am nächsten Morgen schon früh im Büro. Er blätterte den Bericht der Spurensicherung durch. Der brachte für ihn nicht viel Neues. Er rekapitulierte, was sich danach ergab:
– Der Fundort war der Tatort.
– Erwin Stein war drei bis vier Stunden vor der Auffindung seines Leichnams gestorben. Der Mord war demnach zwischen 3 Uhr und 4 Uhr 30 verübt worden. Eine genauere Festlegung ließ die Witterung am Tag des Mordes nicht zu.
– Man hatte viele Gegenstände sichergestellt, gebrauchte Präservative, Zigarettenkippen, ausgespuckte Kaugummis. Alle hatten nach dem Analyseergebnis schon lange vor dem Zeitpunkt des Mordes am Tatort gelegen und waren damit belanglos.
– An der Kleidung des Toten hatte man weiße Hundehaare und gescheckte Katzenhaare gefunden. Sie eigneten sich alleine nicht, um Rasse oder wenigstens Typ der Tiere zu bestimmen. Dazu brauchte man Vergleichshaare, hatte die Spurensicherung angemerkt. Der blutige Fußabdruck gehörte zum Turnschuh eines der Bauarbeiter. Alberto Alonso war wohl in die Blutlache getreten, als er den toten Deutschen gefunden hatte. Das klang plausibel.
– Es waren keine Abwehrverletzungen gefunden worden, auch keine Spuren unter Steins Fingernägeln, die auf den Mörder hinwiesen. Fingerabdrücke oder Hautpartikel, fremde Haare, fremde Speicheltröpfchen an der Leiche, alles Fehlanzeige! Der Mörder hatte sein Opfer nur einmal indirekt berührt und zwar mit der Mordwaffe und das sofort tödlich!
– Die Mordwaffe war nirgendwo aufgetaucht.
– Ali Machoud war bisher nie gefasst worden. Seine Fingerabdrücke waren jedoch an mehreren früheren Einbruchsorten entdeckt worden und konnten ihm nun aus der Kartei zugeordnet werden. Wie bei der Villa in Lomo Román hatte Machoud an diesen Tatorten Toilettenfenster ausgehebelt und war eingestiegen. Bei diesen Einbrüchen waren ebenfalls Geld, Schmucksachen, tragbare Kunstgegenstände und hochwertige Gebrauchsgegenstände entwendet worden.
*
Teniente Morales sah alle seine Mutmaßungen bestätigt. Nun zog er seinen Kollegen in die Überlegungen mit ein: »Es wundert mich nur, dass wir den Kerl nicht schon früher geschnappt haben. Man sagt doch, unsere Insel sei so klein, auf ihr käme nichts unentdeckt weg. Wo mag nur das bisherige Diebesgut geblieben sein?«
»Ihre Aussage gilt für früher! Heute geht das ganz anders vonstatten. Bevor du dich versiehst, sind die Sachen schon auf der Fähre oder im Flieger. Inselhopping«, grinste der Kollege ihn an.
»Der Schwarze ist nicht nur auf Einbrüche spezialisiert, er ist auch gefährlich«, fuhr Morales nach weiterer Lektüre des Berichts fort. »Er ist sehr impulsiv. In einem Haus, in das er eingebrochen ist und in dem nichts zu holen war, hat er vor Wut alles Mögliche zerstört und beschmiert! Dieser Charakterzug spricht dafür, dass er durchaus unser Mörder sein kann!« Zustimmung heischend sah er sich um.
»Für ein Gericht reicht deine Beweisführung kaum aus.« Der Kollege holte ihn auf den Boden der Tatsachen zurück.
»Ich komme aber nicht an ihn heran«, stöhnte der Teniente. »Kein Geständnis! Es ist wohl besser, unsere Psychologin hinzuzuziehen.« Er spürte den Zeitdruck mit aufkommendem Stress in seinem Nacken.
Schon am späten Mittag konnte die Psychologin es einrichten, vorbeizuschauen.
*
Frau Doktor Zafón war eine gut aussehende Frau. Sie war gewohnt, dass ihr sofort alle Männerherzen entgegenschlugen. So war es auch dieses Mal. Sie traf auf dem Revier nur auf Männer. Entsprechend entspannt und selbstsicher gab sie sich. Wie sie so da saß, ihre gut geformten Beinen lasziv übereinander geschlagen, sah sie aus wie eine Meernixe.
Morales kam sofort herbei und begrüßte sie. Er bemühte sich, besonders charmant zu sein. Auch er hatte eine Schwäche für diese bemerkenswerte Frau.
Bald saßen sie bei einem Café zusammen, und der Teniente erklärte ihr, wie die Dinge lagen. Es machte ihn etwas nervös, dass die Ärztin dabei mit ihrem Bleistift auf ein Blatt kritzelte. Als sie das bemerkte, lächelte sie und erklärte ihm: »Wer kritzelt, schärft unbewusst seine Konzentration! Stupides Nichtstun stumpft ab. Eine einfache Nebenbeschäftigung erhöht hingegen die Aufmerksamkeit und Motivation.«
Morales zog die Mundwinkel nach oben und sagte: »Ich verstehe.« Er nickte dabei und dachte bewundernd: ›Diese Frau ist hellwach. Sie analysiert sogar ihr eigenes Tun.‹
Beruhigt fuhr er fort: »Er hat beides zugegeben, Einbruch und Diebstahl, aber er bestreitet vehement den Mord. Dabei sprechen alle Anzeichen gegen ihn. Er ist äußerst nervös, schwitzt vor Angst beim Verhör und hat einen Grund für die Tat.«
Frau Doktor Zafón überdachte seine Worte, dann antwortete sie: »Vom Zeitpunkt der Tat an steht ein Täter unter Anspannung und ist gleichzeitig erschöpft und angreifbar. Da gilt, stetes Wasser höhlt den Stein, wenn Sie wissen, was ich meine. Unser Gehirn wandelt ständig seelische Reize in körperliche Reaktionen um. Vor Nervosität schwitzen, Herzklopfen bei Ängsten zum Beispiel. Beides trifft nach Ihren Worten auf den Gefangenen zu. Er ist nervös, erschöpft und hat Gründe, sich zu fürchten. Dafür muss allerdings nicht unbedingt ein Mord ursächlich sein.«
Ihre Stimme war während des Vortrags gleichmäßig tief und weich geblieben und wirkte auf Morales äußerst erotisch. »Ich sollte mir vielleicht doch selbst ein Bild von dem Häftling machen. Mir fehlt zurzeit noch jegliches eigenes Gefühl für ein Täterprofil. Ich bin keine Freudianerin und nähere mich dem Problem selten psychoanalytisch, eher durch echte Augenscheinnahme«, fuhr die Psychologin erklärend fort. Sie sah den Teniente bei diesen Worten mit wachen grauen Augen ernsthaft an. Ihre Miene zeigte eine Mischung aus verhaltener Skepsis und leichter Arroganz.
*
Ali Machoud wurde hereingebracht. Seine Befragung führte zum gleichen Ergebnis wie am Tag zuvor. Die Anwesenheit der fremden Frau beunruhigte ihn allerdings noch mehr. Frauen durften bei ihm zu Hause keinem Mann etwas befehlen!
»Der Gefangene ist wirklich verstockt«, sagte Dr. Zafón nach längerem Bemühen, Machoud zum Sprechen zu bringen. Sie bat den Teniente in einen Nebenraum, wollte unter vier Augen mit ihm sprechen: »Ich sehe nur eine vage Möglichkeit, den Häftling zu bewegen, die Wahrheit zu sagen. Wir könnten ihn in einen Schockzustand versetzen.« Sie streckte ihre langen schönen Beine von sich, wie zur Ablenkung gegen aufkommende Zweifel, und hatte Erfolg damit.