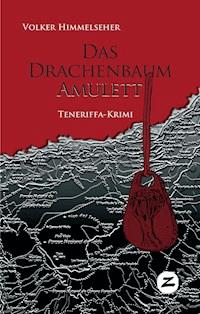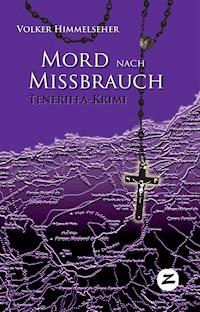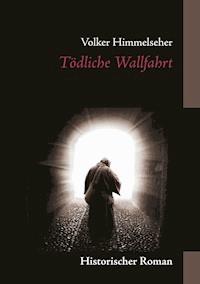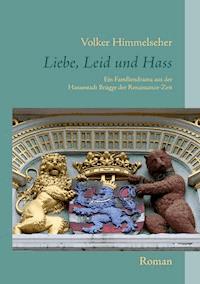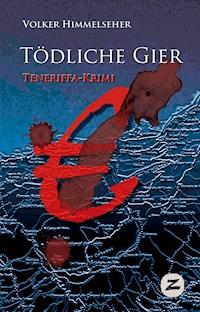Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein prächtiger Hawdala-Teller, von einem jüdischen Arzt in Köln im tiefsten Mittelalter für seine Familie angeschafft, nimmt in seiner Familie den Weg bis in die Neuzeit. Viele bewegende Geschichten, die ein Abbild jüdischen Lebens und Leidens sind, ranken sich bald um ihn. Der Teller kommt schließlich in die Hände einer amerikanischen Wissenschaftlerin, die sich nun selbst aufmachen will, seine Wanderung durch die Geschichte zu erforschen. So schließt sich der Kreis vieler eindrücklicher Geschehnisse …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorbemerkung des Autors
Die Stadt Köln war im Hochmittelalter eine Metropole mit vergleichsweise hohem jüdischem Bevölkerungsanteil. Die Chronik der Stadtgeschichte hat deshalb viele Bezugspunkte zum jüdischen Leben und Leiden.
Die Protagonisten dieses Romans sind fiktive Gestalten, ihr Schicksal basiert jedoch auf historischen Ereignissen. Es ist beklemmend, wie oft es im Lauf der Jahrhunderte zu antisemitischen Strömungen, zur Verfolgung und Ermordung jüdischer Minderheiten kam.
Wesentliche Unterstützung bei meiner Arbeit erfuhr ich durch Frau Ingrid Wilkening, die mir mit ihrer kritischen und gründlichen Lektoratsarbeit beiseitegestanden hat und der ich herzlich danke.
Dr. Volker Himmelseher
Inhaltsverzeichnis
Ja, Schmerz! Du machst Menschen erst zu Menschen ganz: Alphonse de Lamartine
Im Elend bleibt kein anderes Heilungsmittel als Hoffnung nur: Mario Claudio
Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder seine Kräfte auszubilden noch die Frucht derselben zu genießen: Wilhelm von Humboldt
Nicht nur fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf: Friedrich Nietzsche
Jedes Kind, das zur Welt kommt, predigt sogleich das Evangelium der Liebe: Karl Gutzkow
Nur der ist tot, der keinen guten Namen hinterlässt: Aus Persien
Alt ist man dann, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der Zukunft: John Knittel
Im Leben ist’s wie am Himmel: Eben dadurch, dass Sternbilder auf der einen Seite untersinken, müssen neue auf der anderen herauf: Jean Paul
Der Erfolg gebiert den Erfolg, wie das Geld das Geld: Sébastien-Roch Nicolas Chamfort
Bevor du dich beweibst, sorg selbst erst, wo du bleibst: Aus Spanien
Dem Unglück geht Bekümmernis voran: William Shakespeare
Freude und Trauer liegen oft nahe beisammen: Volksmund
Lieb’ ist es, welche die Kunst lehret, und außerhalb derselben wird kein Arzt geboren: Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus
Freude fehlt nie, wo Arbeit, Ordnung und Treue sind: Johann Kaspar Lavater
Ein Willkommen und freundliche Worte mangeln niemals im Haus eines guten Menschen: Aus Indien
Auf eine Weise werden wir geboren, auf tausendfache sterben wir: Aus Jugoslawien
Zur Weggenossenschaft gehören beide Gaben, nicht bloß ein gleiches Ziel, auch gleichen Schritt zu haben: Friedrich Rückert
Wer nichts für andere tut, tut nichts für sich: Johann Wolfgang von Goethe
Schüttle alles ab, was dich in deiner Entwicklung hemmt, und wenn’s auch ein Mensch wäre, der dich liebt!: Friedrich Hebbel
Wer die Jugend hat, hat die Zukunft: Franz Herzog von Reichstadt
Wunder kommen nur zu denen, die daran glauben: Aus Frankreich
Jedem steht sein Tag bevor: Publius Vergilius Maro, deutsch gewöhnlich Vergil
Wer sich heute freuen kann, soll nicht bis morgen warten: Sprichwort
Von oben herab muss reformiert werden, wenn nicht von unten herauf revolutioniert werden soll: Karl Julius Weber
Zum Abschiednehmen just das rechte Wetter: Grau wie der Himmel steht vor mir die Welt: Joseph Victor von Scheffel
Leben heißt kämpfen: Lucius Annaeus Seneca der Jüngere
Der Katzen Scherz ist der Mäuse Tod: Sprichwort
Die Zeit weilt, eilt, teilt und heilt: Sprichwort
Ebbe folgt nicht auf Ebbe. Dazwischen ist die Flut: Aus dem Sudan
Die Euch Hass predigen, erlösen Euch nicht: Marie von Ebner-Eschenbach
Sollen die Werke gut sein, so muss zuvor der Mann gut und fromm sein, der sie tut; denn wo nichts Gutes inne ist, kommt nichts Gutes raus: Martin Luther
Der Besitz macht uns nicht halb so glücklich, wie uns der Verlust unglücklich macht: Jean Paul
Schon wieder Krieg. Der Kluge hört’s nicht gern: Johann Wolfgang von Goethe
Schlechter Frieden ist noch allemal besser als guter Streit: Aus Russland
Aber sterben! Gehn, wer weiß wohin, daliegen, kalt und regungslos, und faulen!: Friedrich von Schiller
Das Wunderbare und das Erstaunliche halten nicht länger als eine Woche in Aufregung: Aus Abessinien
Es ist dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen: Sprichwort
Ein unnütz Leben ist ein früher Tod: Johann Wolfgang von Goethe
Das Leben besteht in der Bewegung: Aristoteles
Krieg und Liederlichkeit, die bleiben immer in Mode: William Shakespeare
Alle Revolutionen kommen aus dem Magen: Napoleon I.
Geld stinkt nicht: Flavius Titus Vespasianus, genannt Vespasian
Es bringt die Zeit ein anderes Gesetz: Friedrich Schiller
Der grause Scherge Tod verhaftet schleunig: Friedrich Schiller
Auf eine Revolution ist stets eine Reaktion gefolgt: Woodrow Wilson
Mein Sohn, von deiner Jugend an eigne dir Bildung an, und bis zum Greisenalter wirst du Weisheit erlangen!: Jesus Sirach
Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir: Seneca der Jüngere
Revolutionen bessern nichts, wohl aber Reformationen: Karl Julius Weber
Zwei Sperlinge auf einer Ähre: Nie Freundschaft!: Aus Spanien
Nie wird ein Feind zum Freund, selbst im Tode nicht: Sophokles
»Wenn die Deutschen Deutsche werden, gründen sie das Reich auf Erden, das die Völker all umschlingt und der Welt den Frieden bringt!«: Simrock
Bildung ist jenseits aller Standesunterschiede: Konfuzius
»Jeder Stoß ein Franzos! Jeder Schuss ein Russ!«: Kriegsvers
Der Sieg soll nie ohne Übung der Barmherzigkeit sein: Kaiser Karl V.
Mangelt im Beutel die Barschaft, fehlt es an allem: François Rabelais
Gewiss ist es fast noch wichtiger, wie der Mensch das Schicksal nimmt, als wie es ist: Heinrich von Humboldt
Und das Unglück schreitet schnell: Friedrich Schiller
Der Jude ist die Made im faulenden Leibe, Pestilenz, schlimmer als der schwarze Tod von einst, Bazillenträger der schlimmsten Art, ewiger Spaltpilz der Menschheit, die Drohne, die sich in die übrige Menschheit einschleicht, die Spinne, die dem Volk langsam das Blut aus den Poren saugt, eine sich blutig bekämpfende Rotte von Ratten, der Parasit im Körper anderer Völker, der typische Parasit, ein Schmarotzer, der wie ein schädlicher Bazillus sich immer mehr ausbreitet, der ewige Blutegel, der Völkerparasit, der Völkervampir!: Adolf Hitler: Mein Kampf
Es geht Gewalt über Recht: Martin Luther
Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um: Jesus Sirach 3,27
Wer aufgibt, wird aufgegeben: Emil Oesch
Künftige Ereignisse werfen ihren Schatten voraus: Thomas Campbells
Wer flieht, kann später wohl noch siegen. Ein toter Mann bleibt ewig liegen: Samuel Buttler
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende: Ferdinand von Schill
Die Tränen einer Witwe werden nicht vom ersten Wind getrocknet: Sprichwort
’s ist Fluch der Zeit, dass Tolle Blinde führen!: William Shakespeare
Im Elend bleibt kein anderes Heilmittel als Hoffnung nur: William Shakespeare
The almighty dollar!: Washington Irving
Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein: Johann Wolfgang von Goethe
Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen: Johann Wolfgang von Goethe
Ist denn Liebe ein Versprechen?: Christoph Martin Wieland
Krieg ist Geißel: Friedrich der Große
Welcher heiratet, der tut wohl: 1. Korinther 7,38
Zum Kriegführen sind drei Dinge nötig: Geld, Geld, Geld!: Marschall Gian Giacomo Trivulzio
Ein Feind von der Feder ist schlimmer als einer vom Leder: Sprichwort
Zweifel ist der Weisheit Anfang: René Descartes
Der Tod macht alle gleich: Er frisst Arm und Reich: Sprichwort
Ich will verzweifeln und will Feindschaft halten mit falscher Hoffnung, dieser Schmeichlerin: William Shakespeare
Nur wer an die Zukunft glaubt, glaubt an die Gegenwart: Aus Brasilien
Ein Land, darinnen Milch und Honig fließt: 1. Moses 3,8
Traurig ist es, wenn in einem Leben die Seele eher ermüdet als der Leib: Mark Aurel
Ja, Schmerz! Du machst Menschen erst
zu Menschen ganz.
(Alphonse de Lamartine)
1252 im April.
Das Kölner Becken saugte die Wolken aus dem Westen unaufhaltsam an und bot ihnen eine günstige Herberge. Die Stadt lag an diesem Morgen wieder einmal unter einem grauen Wolkenteppich, den westliche Winde nicht vertrieben, sondern eher verdichteten. Sprühregen peitschte durch die Straßen und Gassen und verwandelte Geh- und Fahrwege in einen zähen Brei aus Matsch und Unrat. Wer nicht in dringender Angelegenheit vor die Tür musste, blieb tunlichst zu Hause.
Erzbischof Konrad von Hochstaden saß zusammengesunken am brennenden Kamin im Lieblingssalon seines Palastes. Ihn fröstelte. Er schaute aus dem Fenster und dachte: Erst wenn sich die Wolken richtig abgeregnet haben und schwach und dünn werden, werden sie wieder den Blick auf das Himmelsblau freigeben, und die wärmenden Sonnenstrahlen werden endlich zurückkehren. Den Erzbischof quälten gerade bei dieser Witterung heftige Gliederschmerzen. Heute waren sie kaum noch auszuhalten. Und so fuhr er einen seiner Bediensteten herrisch an: »Los, hol mir den Arzt! Spute dich. Es tut not.«
Der Mann nahm sich kaum Zeit für eine Verbeugung und machte sich eiligst auf den Weg.
Sie kommen also wieder zu zweit, dachte der Erzbischof grimmig. Der Adlatus nimmt sich schon genauso wichtig wie der Arzt sich selbst.
Aber der Gehilfe blieb immerhin noch respektvoll einige Schritte hinter seinem Meister.
Der Arzt kam mit gemessenen Schritten auf den Geistlichen zu. Sein langes schwarzes Gewand berührte leicht den Boden. Er deutete eine Verbeugung an und fragte einfühlsam: »Wie fühlt Ihr Euch heute, Eminenz?«
Der Kirchenfürst stöhnte leise und antwortete ungnädig: »Es geht mir schlecht, schlechter noch als gestern. Eure Anwendungen haben mir keine Linderung gebracht. Meine Glieder schmerzen wie zuvor.«
»Dann müssen wir heute nochmals Euren Urin beschauen.«
Von Hochstaden war darauf vorbereitet und wies mit einer leidenden Geste auf das Gefäß neben seinem Sessel. Wichtig zeigte der Medikus mit der Hand auf das halbvolle Glas. Sein Assistent eilte hin, um es zu holen. Der Arzt nahm das Glas und ging ans Licht.
»Euer Urin müsste golden und klar sein«, sagte er. »Er ist aber dünn und trübe. Ihr seid auch heute wieder von melancholischem Gemüt. Ihr habt zu viel Blut. Wir müssen Euch erneut zur Ader lassen.«
»Das hat mir in der Nacht auf heute schon keine Linderung gebracht«, wehrte sich der Fürst vorwurfsvoll.
»Habt Geduld, hoher Herr. Bei Melancholikern bewirkt die schwarze Galle ein trauriges Gemüt. Wir müssen in Euren Säftehaushalt eingreifen und ihn regulieren. Glaubt mir, Schröpfen, Schwitzen und ein leichtes Brech- und Abführmittel sind auf Dauer die richtigen Hilfen für Euch.«
Des Bischofs trübe Augen guckten ungläubig, aber er ergab sich schließlich in sein Schicksal. Verbittert dachte er jedoch für sich: Der Kerl holt mir noch die letzten Lebenssäfte aus meinem kranken Leib, dabei brauche ich ihn gesund für all die Kämpfe und Streitigkeiten, die auf mich warten. – Die Spannungen mit dem Bischof von Paderborn und dem Grafen von Jülich steigerten sich langsam ins Unerträgliche, und auch ansonsten ereignete sich zurzeit viel Unerfreuliches.
Das Schröpfen war wie immer schmerzhaft und unangenehm.
Als der Medikus fertig war, schob er den schweren Brokatärmel des Bischofs in die Höhe und fühlte dessen Puls. Er wiegte bedenklich den Kopf und sagte: »Der Puls ist sehr schwach, ich kann Euch leider auch heute die bittere Medizin nicht ersparen.« Er griff in die schräge Tasche seines schwarzen Überkleides und holte ein Beutelchen hervor. »Nehmt dieses Pulver mit etwas lauwarmem Wasser, bevor Ihr zu Bette geht und morgens direkt nach dem Aufstehen noch einmal. Ihr werdet bald würgen und Euch erbrechen müssen. Die schlimmen Gifte werden auf diese Weise Euren Körper verlassen. Ihr werdet Euch besser fühlen. Jede Krankheit ist eine Warnung Gottes. Deshalb fällt die Medizin zur Buße bitter aus. Ein zusätzliches Gebet an den heiligen Andreas kann im Übrigen nicht schaden. Der steht bei solchen Leiden gottesfürchtigen Kranken stets bei.«
Den letzten Satz fügte der Arzt hinzu, weil er wusste, dass der Bischof zu gern auf die Hilfe der Heiligen setzte.
Die beiden Gelehrten erledigten ihre Arbeit und gingen genauso wichtig, wie sie gekommen waren.
Im Elend bleibt kein anderes Heilungsmittel
als Hoffnung nur.
(Mario Claudio)
Auf den Erzbischof kam eine unruhige Nacht zu und die Anwendungen brachten wieder keine Besserung.
Als er sich nach der Einnahme des Pulvers erleichtern wollte, wurde ihm schwarz vor den Augen. Er fiel vor seinem Bett in Ohnmacht. So fand ihn einer seiner Bediensteten und fürchtete schon das Allerschlimmste.
Doch der Erzbischof kam wieder zu sich, und am nächsten Morgen fasste er einen Entschluss und wies seinen Majordomus an: »Lasst den Judenarzt holen. Von ihm hört man wahre Wunderdinge. Er ist meine letzte Hoffnung.«
»Heute ist Sabbat, Eminenz. Das wird schwer werden, ihn zu holen«, wandte der Angesprochene ein.
»Der Jude wird nicht wagen, sich meinem Befehl zu widersetzen«, war die trotzige Antwort des Kirchenfürsten.
So machte sich ein dienstbarer Geist auf den Weg ins Judenviertel, um den jüdischen Arzt herbeizubringen. Der Bote hatte sich Holztrippen unter seine dünnen Schuhe geschnallt, um sie im Matsch nicht unnötig zu verschmutzen. Bald hatte er das Judenviertel erreicht.
Der Arzt Salomon wohnte im Jerusalemgässchen nahe dem jüdischen Kultbad, der Mikwe. Der Bote musste nur einmal fragen, um das Haus zu finden. Es war ein schmales hohes Haus. Der Löwe von Juda prangte als Türklopfer auf der Eingangstür. Laut und deutlich benutzte ihn der Mann. Nach einigen Augenblicken hörte er im Inneren des Hauses Schritte. Die Tür wurde geöffnet.
Ein hagerer, hoch aufgeschossener Mann trat ans Tageslicht. Er war von dunklem Typ, hatte schwarzes Haupthaar und einen glatten, gepflegten Bart. Auf dem Hinterkopf trug er eine kleine bestickte Kappe und sah den Ankömmling mit großen braunen Augen fragend an.
Der Bote wusste nicht so recht, wie er beginnen sollte. Als Christenmensch hatte er zwar alles Recht der Welt, gegenüber dem Juden befehlend aufzutreten. Aber das Erscheinungsbild des Mannes nötigte ihm Respekt ab.
Der war von Bildung, das war ein Gelehrter! So entschloss er sich, sein Begehr mit gebotener Höflichkeit zu äußern.
Der Arzt hörte ihm aufmerksam zu und nickte verständnisvoll. Dann erwiderte er mit wohltönender Stimme: »Ich bin sofort bereit, muss nur schnell meine Gerätschaften zusammenpacken. Ihr könnt schon einmal vorausgehen. Ich komme gleich nach.«
Der bischöfliche Bedienstete trat verlegen von einem Bein auf das andere und antwortete leise: »Ich glaube, ich warte lieber auf Euch. Es wäre nicht gut, wenn ich allein zurückkäme.«
Der Jude war auch damit einverstanden, drehte sich auf dem Absatz um und beeilte sich, schnell wieder zurück zu sein. Schon bald waren die beiden Männer durch Regen und Matsch auf dem Weg zum kurfürstlichen Palast.
Als Salomon den Salon betrat, saß der Erzbischof in seinem hohen Sessel. Eine Pelzdecke bedeckte seine Beine. Er las mit kurzsichtigen Augen in der Heiligen Schrift. Seine Hände zitterten unter der Last des Buches.
Die Luft in dem überhitzten Raum war schlecht und verbraucht. Salomon näherte sich dem Kranken mit selbstsicheren Schritten. Freundlich wandte er sich dabei an einen der Bediensteten und wies ihn an, frische Luft in den Raum zu lassen.
»Zuallererst wird die Luft krank. Erst dann befällt die Krankheit den Menschen, der die kranke Luft einatmet«, wandte er sich erklärend an von Hochstaden und deutete dabei respektvoll einen leichten Kniefall an.
Der Erzbischof sah ihn betroffen an. Er war nicht gewohnt, dass man über seinen Kopf hinweg entschied.
»Die Ärzte hatten mir bisher Wärme und Schwitzen verordnet«, nörgelte er.
»Das eine schließt das andere nicht aus, aber die bösen Gifte sitzen nicht nur im Körper, sie sind auch in der Luft. Von dort kann man sie mit Aderlass aber nicht vertreiben«, antwortete ihm der Arzt bestimmt. »Lasst mich fragen, Eminenz, welch böses Leiden Euch so quält«, fügte er nach einer kurzen Pause hinzu.
»Es sind starke Gliederschmerzen, aber fast täglich kommt ein weiteres Leiden dazu«, jammerte von Hochstaden.
»Was wollt Ihr damit sagen?«, fragte ihn der Medikus besorgt.
»Diese Nacht, als ich aufstand, um mich zu erleichtern, wurde mir schwarz vor Augen und ich sank in einen todesähnlichen Schlaf«, antwortete der Erzbischof.
Salomon schaute ihn nachdenklich an, dann erklärte er ihm mit ruhiger Stimme: »Bei großer Anstrengung oder Aufregung erweitert sich das Herz enorm und gibt seine natürliche Wärme an die anderen Organe ab. Es gerät in eine Kältestarre, und diese Ohnmacht vergeht erst wieder nach einiger Zeit. Die Gefahr dabei ist nicht allzu groß. Das Phänomen ist schon in Hesekiel 45, 27 nachzulesen: Als Jakob die Freudenbotschaft überbracht wurde, dass sein Sohn Josef lebt, blieb sein Herz stehen. Erst nach längerer Zeit lebte sein Geist wieder auf.«
»Es ist tröstlich zu hören, dass Ihr trotz Eures Irrglaubens in den richtigen Schriften lest«, antwortete ihm Konrad beeindruckt. »Nun aber erwarte ich Eure Hilfe.«
Der Arzt verneigte sich wie zum Dank und antwortete: »Es geziemt demjenigen, der sich mit der Heilung des menschlichen Leibes befasst, der edelsten Schöpfung der Natur, dass er die zu behandelnde Krankheit genau erwägt und seine Anordnungen erst nach sorgsamer Abwägung trifft, damit er keinen Fehler tut. Töricht handelt ein Arzt, der sofort über jede Krankheit Auskunft erteilt. Lasst mich eine Nacht darüber schlafen, meine Bücher wälzen und alle Zeichen überdenken, die Ihr mir genannt habt. Eines jedoch kann fürs Erste nicht schaden: Lässt man eine gute Hand voll Weidenrinde eine halbe Kerzenlänge in sprudelndem Wasser ziehen, so entsteht ein wunderbares Mittel gegen Gelenkschmerzen. Ihr müsst es dann nur noch warm trinken.«
»Eigentlich habe ich mir heute schon mehr von Euch erwartet«, maulte von Hochstaden, »aber ich will mich in Geduld üben und Euren ersten Ratschlag befolgen.« Beim Zubettgehen flehte der Bischof Judas Thaddäus, den Schutzpatron für verzweifelte Lagen, um Hilfe an. Die Nacht verstrich und am Morgen glaubte er, etwas Besserung zu verspüren.
Am späten Vormittag des nächsten Tages kam Salomon wieder.
»So früh an unserem hohen Feiertag«, tadelte ihn der Geistliche.
»Für Euch ist mir jede Zeit recht. Gestern hatten wir unseren Feiertag, hoher Herr. Ich kam auch da sofort für Euer Wohlbefinden.«
»Ich darf eigentlich gar nicht zulassen, was Ihr da beteuert. Das kanonische Edikt von Beziers verbietet uns Christen die Behandlung durch jüdische Ärzte. Es wäre vielleicht besser zu sterben, als Euch mein Leben anzuvertrauen«, antwortete der Fürst giftig. »Ihr solltet zum wahren Glauben übertreten, dann stünde für mich Eurer Hilfe nichts im Wege. Extra Ecclesiam nulla salus!« Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, ergänzte er in festem Glauben.
»Das sehen wir Juden anders, ehrwürdiger Herr. Wir glauben, dass die Frommen aller Völker Anteil am Jenseits haben werden«, antwortete ihm Salomon im Brustton der Überzeugung. »Ich würde es als Arzt und Mensch zutiefst bedauern, wenn ich Euch nicht helfen dürfte.«
Dem Erzbischof imponierte die Unerschrockenheit des Juden. Um den Disput für heute zu beenden, sprach er einen passenden Spruch aus der Bibel: »Ja, ja oder nein, nein, alles andere ist von Übel.« Dabei schlug er ein Kreuz und fragte den Medikus, was sein Studium der medizinischen Schriften über Nacht ergeben habe.
Salomon war erleichtert, dass das prekäre Gespräch damit ein Ende fand. »Zur Erhaltung der Gesundheit und zum Erreichen eines hohen Alters bedarf es neben Sittenreinheit und geistiger Tätigkeit, die bei Euch unzweifelhaft gegeben sind, eines genügsamen Lebenswandels«, dozierte der Arzt, »denn Völlerei und Leichtlebigkeit fördern den Schmerz in den Gliedern und führen früh ins Grab. Geisteskräfte hingegen haben gute Einwirkung auf die körperliche Gesundheit. Ich empfehle Euch zunächst nur magere Kost. Auf den schweren Roten von der Ahr solltet Ihr auch eine Zeit lang verzichten. Wenn Ihr das befolgt, werden meine Medikamente Euch Heilung bringen. Ich habe sie in dieser Nacht frisch zubereitet. Hier haben wir ein Wacholderöl aus den Spitzen von Wacholderzweigen mit Eisenhut gemischt. Eisenhut ist eine gefährliche Pflanze. Wenn man nur ein kleines Stückchen von seiner Wurzel isst, stirbt man über Nacht. Doch zerrieben und mit Öl vermischt ist sie ein hilfreiches Mittel gegen Gliederschmerzen. Das Öl lasst Euch, leicht erwärmt, auf alle schmerzhaften Stellen streichen. Es wird Euch helfen.« Dann hob der Jude ein Leinensäckchen in die Höhe und zeigte es dem Kranken: »Darin ist Glöckleinkraut. Eure Köchin soll es in einen Kessel voll Wasser legen und in dem Sack recht lange sieden. Den Sud lasst danach in eine Wanne geben und badet darin, so heiß Ihr es ertragen könnt.«
Mit welchem Mut wagt es dieser Jude, mir, in dessen Nähe er erzittern müsste, meine Fehler vorzuhalten und mein Sündenregister aufzuzählen?, dachte der Erzbischof. Irgendwie gefällt mir diese Courage, und wenn ich ehrlich bin, ist der Jud noch mild gewesen beim Levitenlesen. Auch mit meiner Sittenreinheit ist es nicht allzu weit her, dachte der Erzbischof insgeheim.
»Hofft für Euch, dass Eure Ratschläge von Nutzen sind. Für heute geht in Frieden«, entließ er den Arzt in versöhnlichem Ton.
Salomon erlaubte sich das letzte Wort: »Nicht der Arzt bewirkt die Heilung, Eminenz. Er bereitet und bahnt nur den Weg, bis die Natur, die eigentliche Heilerin, die Tat vollbringt.« Damit verabschiedete er sich ehrerbietig bis zum nächsten Tag.
Von Hochstaden befolgte über zwei Wochen hin die Vorschriften des Arztes gewissenhaft. Er verspürte von Tag zu Tag Besserung. Seine gute Laune kehrte zurück.
Pater Anton, der kleine quirlige Dominikanermönch, der oft um ihn war, registrierte die Veränderung mit Freude. Er wurde sogar Zeuge, wie der Erzbischof die Fähigkeiten des jüdischen Arztes vor anderen über den grünen Klee lobte. Der Pater konnte es sich nicht verkneifen, dem Erzbischof zu stecken, wie sehr sich die christlichen Heiler über die Bevorzugung des Juden beklagten.
»Ich habe einen Arzt gesucht und keinen Theologen angenommen«, entgegnete der Bischof bissig.
Die christlichen Ärzte, die sich für die kompetenteren Heilkundigen hielten, hörten nicht auf zu lamentieren. Sie verwiesen vehement darauf, dass es Christen nach kanonischem Recht verboten sei, sich von Juden behandeln zu lassen. Von Hochstaden blieb jedoch stur und verlangte fast täglich nach dem Juden.
Er schätzte nicht nur dessen medizinischen Rat, sondern hatte auch Freude an den Streitgesprächen mit ihm gewonnen. Er bot Salomon zum wiederholten Male an, außerhalb des Judenviertels zu wohnen, damit er auch während der Nacht ungehindert zu christlichen Patienten eilen könnte. Des Nachts war das Tor zum Judenviertel nämlich verschlossen. Doch Salomon lehnte ab. Er wollte lieber in der Gemeinschaft seiner Glaubensbrüder bleiben.
Nach der Linderung seiner Gicht lenkte der Bischof das Augenmerk des Arztes auf ein anderes lästiges Leiden.
Salomon hörte seine Schilderung geduldig an und kam schon bald zu einer Diagnose: »Es handelt sich um Hämorrhoiden, Eure Eminenz, ein Blutfluss, die Erweiterung der Blutgefäße im hinteren Darm- und Afterbereich. Hämorrhoiden treten häufig bei Menschen auf, die viel sitzen. Sie sind mit quälendem Juckreiz verbunden. Faserreiches Essen führt zu weichem Stuhl und hilft gegen diese Pein. Im schlimmsten Falle muss man die schmerzhaften Dinger entfernen.«
»Ich glaube, wir haben den schlimmsten Fall«, stöhnte der Geistliche zerknirscht.
Da er immer wieder drängelte, entschloss sich Salomon nach einigen Tagen, Erzbischof Konrad zu operieren. Er schilderte von Hochstaden zuvor die schmerzhafte Prozedur: »Ich werde Euch die lästigen Quälgeister mit einem glühenden Eisen veröden«, schloss er seine Erklärungen.
»Meint Ihr, mir wird es gelingen, bei Eurem Eingriff die Zähne zusammenzubeißen und den Schmerz still zu ertragen?«, fragte von Hochstaden ängstlich.
»Das glaube ich kaum, ehrwürdiger Herr. Der Schmerz wird Euch übermannen, und Ihr werdet schreien.«
Der Geistliche überdachte die Antwort des Juden einen Moment, bevor er erwiderte: »Das darf nicht sein. Zumindest darf mich keiner hören. Das bin ich meiner Stellung schuldig. Was ratet Ihr mir?«
Nun war es an Salomon, sich zu bedenken: »Schickt alle weg, lasst alle Türen fest verschließen. Als letzte Sicherheit empfehle ich, die Orgel in Eurer kleinen Kapelle mit Donnerschall ertönen zu lassen. Sie soll ein klingendes Gebet für das Gelingen der Operation gen Himmel senden. Das Getöse der Pfeifen wird Eure Schmerzenslaute bestimmt übertönen.«
Von Hochstaden nickte. »Das ist ein guter Vorschlag, wenngleich er mir die Angst vor Eurer Absicht nicht nimmt. Doch mir scheint keine andere Wahl zu bleiben. Ich werde mich in Eure unchristlichen Hände begeben.«
Durch göttliche Fügung sank der Erzbischof schon bei der ersten glühenden Berührung in tiefe Ohnmacht.
Die Operation gelang. Nachdem Salomon die Wunden aufopferungsvoll eine Woche lang gepflegt und versorgt hatte, war der hohe Herr geheilt und erneut des Lobes voll über seinen Juden.
Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder seine Kräfte
auszubilden noch die Frucht derselben zu genießen.
(Wilhelm von Humboldt)
Eines Tages, als der Arzt wieder zugegen war, drängte es Konrad, Salomon eine besondere Freude zu machen. So teilte er ihm als Erstem seinen Plan mit, den er über Nacht gefasst hatte: »Ich werde den Juden von Köln für die Dauer von zwei Jahren einen Schutzbrief ausstellen. Sie sollen dafür jährlich einen Tribut entrichten, dessen Höhe noch näher bestimmt werden wird. Zudem dürfen sie jedes Jahr aus ihren Reihen einen Judenbischof wählen, der ihre Anliegen vor mir vertritt. Ich verspreche Schutz und verpflichte mich, dafür Sorge zu tragen, dass man Euch und Euresgleichen zu keinen anderen Geldzahlungen als zu den von mir auferlegten zwingen wird. Die Richter, Bürgermeister, Schöffen und Räte von Köln werde ich auffordern, meinen Wunsch zu respektieren. Ihr sollt in unserer Stadt eine sichere Bleibe finden.«
Salomon erfreute, was er hörte. Er entrichtete ehrerbietig seinen Dank für diese Gnadenbeweise. Dann drängte es ihn, die Neuigkeiten schnellstmöglich den Seinen mitzuteilen. Frohen Herzens machte er sich auf den Weg in sein Viertel. Dabei reifte in ihm der Gedanke, diesen guten Tag besonders zu ehren. Da der Erzbischof ihn fürstlich entlohnt hatte, verfügte er über einen Batzen Geld. In der Gasse »Unter Goldschmieden« trat er in eine der führenden Kunstschmiedewerkstätten der Stadt.
Der Meister betrachtete den Juden skeptisch. Doch als er dessen pralle Geldkatze sah und Salomons Begehr hörte, wurde er sofort umgänglich.
Salomon gab bei ihm einen Hawdalateller in Auftrag. Ein solcher Teller gehörte zu den Kultgegenständen für die Zeremonie, die den Sabbat am Samstagabend feierlich beendete. Zum Abschluss der Zeremonie füllte der Hausherr einen Becher bis zum Überfließen mit Wein und fing den »Überfluss«, als Symbol für künftiges Wohlergehen, mit diesem Teller auf.
Der Arzt machte genaue Vorgaben zu den Maßen des Tellers und beschrieb die gewünschte Verzierung bis auf die kleinste Kleinigkeit. Besonders wichtig waren ihm in der Mitte eine neunzackige Sonne und der Text, der den Teller umranden sollte:
Gelobt seist Du, Ewiger, unser G’tt, König der Welt, Schöpfer der Feuerstrahlen.
Wegen seiner guten Laune feilschte Salomon mit dem Handwerker nicht einmal um den Preis. Er legte vielmehr wert auf möglichst schnelle Lieferung. Die sagte ihm der Kunstschmied gerne zu. Noch zufriedener als zuvor eilte der Arzt nach Hause. Er berichtete seinen Verwandten die Neuigkeiten, hielt jedoch die Überraschung mit dem Teller zurück.
Am Abend saß Salomon mit seiner Familie in der Wohnstube des Hauses beisammen.
Zwei kleine Ölfunzeln sorgten für spärliches Licht und strahlten Gemütlichkeit aus. Noah, Salomons Vater, der Rabbi der Kölner Judengemeinde, seine Frau Bela und Salomons Frau Judith besprachen ihr Tagwerk. Judith stammte aus Siegburg. Salomon verdankte die Ehe mit ihr dem emsigen Bemühen der alten Heiratsvermittlerin Golde und dem Segen ihrer Elternpaare. Der Arzt hatte die Hochzeit mit Judith nie bereut. Das Paar hatte sich schnell lieben und schätzen gelernt.
Gesprächsstoff gab es an diesem Abend genug. Der angekündigte Schutzbrief des Erzbischofs bewegte die Gemüter aller.
»Das ist ein guter Tag für unser Volk«, meldete sich der Rabbi zu Wort. »Die Christen tun sich immer wieder schwer im Umgang mit uns. Aber dieser Schutzbrief ist nun eine Garantie für unsere Sicherheit in Köln. Es scheint, als hätten wir endlich ein Heim in der Diaspora gefunden. Es leben immerhin schon fünfhundert jüdische Seelen hier, und das nun für die nächste Zeit in Frieden. Der Erzbischof ist ein mächtiger Mann. Da lohnt sich das Geld, das wir für seine Fürsorge zahlen müssen.«
Das Schweigen im Raum bedeutete Zustimmung.
Schließlich meldete sich Salomon zu Wort: »Vater, wir dürfen uns aber nicht in Sicherheit wiegen. Unser Wohlergehen und unser Erfolg bringt bei vielen Christen neue Missgunst mit sich. Ich bekomme die heute schon am eigenen Leib zu spüren. Die christlichen Ärzte schreien Zeter und Mordio, weil ich mein Handwerk sogar am Corpus des höchsten Kirchenfürsten unserer Stadt ausüben darf.«
»Das ist die Kehrseite der Medaille, mein Sohn. Damit müssen wir leben. Zu solcher Art Ärzte hat sich unser Glaubensbruder Carlo, der am Hofe des Königs von Neapel praktiziert, trefflich geäußert. Er zeigte auf, wie viele vermeintliche Heilkundige von ihrem Beruf gar keine Ahnung haben.«
Aus seinem guten Gedächtnis rezitierte Noah Carlos Spottreim:
»Der Arzt fühlt den Puls, beschaut Exkremente,
macht ernste Miene und viel Komplimente,
gilt beim Pöbel und Aristokrat
als großer Künstler und Hippokrat.
Wenn sich die Krankheit verschlimmert,
ist er zuvor ums Honorar bekümmert,
lässt alles sich schnell bezahlen, bar;
der Arzt kommt vor der Totenbahr!
Erst wenn ihm viele Patienten gestorben,
hat er Geld und Ruhm erworben!«
Bela schmunzelte. Judith belohnte den Schwiegervater sogar mit einem kleinen Lachen.
Der Rabbi sah seine Familie liebevoll an und wandte sich nochmals an sie: »Wir sollten an unsere Sicherheit glauben. Und ich meine, es ist nun Zeit, dass ihr beiden an Nachwuchs denkt«, wandte er sich speziell an Judith und Salomon. Zu Salomon blickend ergänzte er spitzbübisch: »Ich hoffe, du glaubst nicht, Studieren und Bücherschreiben erhält dein Andenken besser als Kinder.«
Wäre das Licht nicht so spärlich gewesen, hätte der Rabbi gesehen, wie Judith errötete.
Salomon zog es vor zu schweigen. Aber sein Vater hatte mit seinen Worten eine Seite in ihm zum Klingen gebracht.
Noch in der gleichen Nacht fand das Paar zusammen. Ihr Zusammenliegen war von Erfolg gekrönt. Es zeigte sich bald, dass Judith schwanger war. Neun Monate später brachte sie mit Ester ihr erstes Kind zur Welt. Die Geburt verlief problemlos. Und Klein Ester brachte viel Freude ins Haus.
Nicht nur fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf.
(Friedrich Nietzsche)
Salomons Familie brauchte nicht lange zu warten, bis sie das nächste freudige Ereignis feiern konnte. Schon Anfang Juni erhielt der Arzt Nachricht, dass der Hawdalateller fertig sei. Mit großer Neugierde machte er sich auf den Weg zum Kunstschmied. Der Teller übertraf seine kühnsten Erwartungen. Er hatte die richtige Größe, wirkte massiv und schimmerte in goldenem Glanz. Die Verzierungen hatte der Schmied sehr fein ausgeführt, und die Schrift war gut lesbar. Der Teller würde die ganze Familie erfreuen und die vorhandenen Gerätschaften für die Sabbatfeier wunderbar ergänzen. Salomon lobte den Meister und bezahlte zufrieden den Kaufpreis. Am Abend brachte er ihn sorgsam verpackt mit in die Stube und zeigte ihn seiner Familie. Die Überraschung gelang, als er das Päckchen auswickelte und den prächtigen Teller enthüllte. Der schimmerte wunderschön im Lichte der Kerzen. Salomon beobachtete die Reaktion seines Vaters voll freudiger Erwartung.
Als Noah den Teller sah, wurden seine Augen ganz weich, und mit belegter Stimme sagte er: »Du bist ein guter Junge, Salomon. Meine Erziehung hat gefruchtet. Obwohl ihr in eurer jungen Ehe noch viel Nützliches gebrauchen könnt, hast du dich für etwas entschieden, was deinen Glauben unter Beweis stellt. So soll es sein! Dieser Teller soll fortan unsere Familie bei jedem Sabbatfest begleiten und wird von Generation zu Generation weitergegeben werden.«
Salomon war glücklich, dass der Vater seinem Geschenk so viel Wert beimaß.
Auch seine Mutter zeigte Rührung: »Ach, könnte unsere Rachel diesen schönen Abend miterleben«, sagte sie wehmütig.
Rabbi Noah berührte zart ihren schmächtigen Arm und erwiderte tröstend: »Gräm dich nicht, Weib. Rachel hat einen guten Mann. Auch wenn sie fern von uns ist, sie lebt glücklich mit ihm und den Kindern in Frankfurt.«
Am nächsten Freitag machten sich Noah und Salomon auf den Weg zur Mikwe, um den Hawdalateller einer rituellen Waschung zu unterziehen.
Als Erstes gingen sie selbst ins Waschhaus und reinigten sich. Dann eilten sie an der Synagoge vorbei und standen vor der Mikwe. Die Treppe führte zunächst außen hinab.
In der Mitte des Schachtes traten die beiden durch einen Rundbogen in das Innere. In einer kleinen Nische legten sie ihre Gewänder ab und ließen ihre Lichter stehen. Bald erreichten sie das ein Fuß tiefe, rötliche Sandsteinbecken, das mit Quellwasser gefüllt war. Der Rabbi tauchte den Teller mehrere Male in das lebende Wasser, bevor er selbst hineinstieg. Salomon folgte ihm.
Nun war alles tahor, rein für das allwöchentlich wiederkehrende Fest, das an das Ruhen Adonajs nach der Erschaffung der Welt, den Auszug der Israeliten aus Ägypten und die Gesetzgebung am Sinai erinnerte.
Judith und Bela hatten freitags über den Tag das Haus geputzt und für den Abend ein Festmahl bereitet. Noah begab sich bereits zum Nachmittagsgottesdienst in die Synagoge. Mit dem Sonnenuntergang war der Tisch festlich gedeckt, Bela zündete die mit Öl gefüllte sternförmige Sabbatlampe an und rezitierte die vorgeschriebene Benediktion. Salomon machte sich auf den Weg zum Sabbatabendgottesdienst mit Schriftlesung.
Wieder zu Hause, füllte der Rabbi den Kidduschbecher mit dem Festwein und sprach den Kiddusch darüber. Er segnete auch die zwei geflochtenen Brote, Challot, Berches, die bis zur Segnung mit einem feinen Tuch zugedeckt gewesen waren. Bald saß die Familie traulich beim Mahl zusammen, betete, sang, lernte gemeinsam und aß. Während sonst Gäste hochwillkommen waren, feierte man dieses Mal unter sich.
Salomons Geschenk kam erst am nächsten Tag zu Ehren. Am Samstagvormittag traf sich die Gemeinde zur Lesung aus der Thora in der Synagoge. Danach verbrachte man den Tag in aller Muße mit Gebeten und dem Studium der Heiligen Schrift.
Am Abend wurde der Sabbat mit der Hawdalazeremonie verabschiedet. Judith hatte die Hawdalakerze angezündet und näherte sich mit gemessenen Schritten dem Schwiegervater. Salomon folgte ihr mit einem kleinen, turmartigen Behältnis in den Händen, das auf der Spitze eine Fahne trug. Aus dem Türmchen roch es wundervoll. Wohlriechende Gewürze, Zimt, Nelken und Myrte sollten die Trauer über das Sabbatende vertreiben.
Noah füllte den Becher erneut bis zum Rand mit Wein und sprach den Segen darüber, über die zweifach geflochtene Kerze und die Bessomimbüchse mit den duftenden Gewürzen. Als Zeichen der Fülle ließ er den Wein auf den neuen Hawdalateller überfließen.
Mit einem Tropfen des übergelaufenen Weines löschte er die Kerze und wünschte allen im Raum: »Gut Woch.«
Seine Familie bedankte sich mit der Antwort: »Gut Woch! Gut Jahr.«
In den nächsten Jahren hatten die Kölner Christen genug mit sich selbst zu tun. So verlief das Leben der jüdischen Gemeinde friedlich und angenehm. Die Jahre brachten für Salomon viel Erfreuliches. Er behielt die Vertrauensstellung am Hofe des Erzbischofs. Bald war der Medikus auch in allen höheren Kölner Familien ein gesuchter Mann.
Seit Jahren muss ich nun schon die Krankheiten der hohen Herren heilen und vernachlässige dabei die Thora und das Gebet zu Adonaj. Wie gern würde ich mich nur noch Studien über unseren Glauben widmen, dachte Salomon so manchen Abend, wenn er müde nach Hause kam. Wenn er so vor sich hin sinnierte und mit sich haderte, begann er schon wieder Heilmittel für den nächsten Kranken vorzubereiten. Kraft dazu fand er im Gebet:
»Oh Adonaj, lass meine Kranken durch Deine Kraft genesen.
Lass sie in Deinem Grimme nicht verwesen.
Die Mittel, die ich nun bereite,
Du bist es, der die Hand mir leite.
Ob sie gut, ob sie schlecht, ob sie rasch den Schmerze lindern,
ob sie lange während, dauerhaft ihn mindern,
Nur Du weißt es, ich trau nicht auf meine Kunst,
vertraue nur auf Deine Huld und Gunst!«
Wenn er so Glauben und Beruf wieder miteinander versöhnt hatte, gelang es ihm am Abend doch noch, ein liebevoller Ehemann, Vater und Sohn zu sein.
Jedes Kind, das zur Welt kommt, predigt
sogleich das Evangelium der Liebe.
(Karl Gutzkow)
Als sein Weib mit dem zweiten Kind in den Wehen lag, war Salomon an einem fremden Krankenbett. Gelassen vertraute er Elsa, der alten Hebamme der Gemeinde, die Judith bei der Geburt unterstützen sollte.
Judith war froh, dass er nicht daheim war, denn sie wusste, wie sehr er mit ihr gelitten hätte.
Die Hebamme setzte einen Kessel mit Wasser auf den Herd und erhitzte ihn. Dann ordnete sie die Windeln und Tücher. »Bald wird es losgehen«, sagte sie zu Judith.
Die Gebärende richtete sich stöhnend in den Kissen auf. Dabei stützte sie sich mit ihren Händen an der Bettkante ab. Ihr weißes Leinenhemd spannte bedrohlich über ihrem Leib und den geschwollenen Brüsten. Es rutschte hinauf bis zum Ansatz ihrer Schenkel. Die Geburtshelferin fühlte ihr den Puls. Judiths Stirn war kühl, sie fieberte nicht, befand die Alte zufrieden. Nun befahl sie ihr, tief ein- und auszuatmen und dabei im steten Rhythmus zu pressen.
Die werdende Mutter gehorchte, bemüht, sich der Folge immer schneller eintretender Wehen anzupassen. Schmerzwellen, die vom Rücken und Becken auf den ganzen Körper ausstrahlten, übermannten sie und brachten sie einer Ohnmacht nahe.
Judith wurde schwindelig, Schweißperlen traten auf ihre Stirn und ihre Fingernägel bohrten sich tief in das zarte Fleisch ihrer Handflächen.
Nach einer schier unendlichen halben Stunde weiteren Leidens stieß sie endlich das Kind, ein blutiges, glitschiges Menschenkind, mit einem spitzen Schrei aus sich heraus.
Die Hebamme trennte mit sachkundigem Schnitt die fahle Nabelschnur durch, hob das Neugeborene an seinen Füßen hoch und erweckte es mit einem festen Klaps auf den kleinen Hintern zum ersten krähenden Zeichen seines jungen Lebens.
»Es ist ein Junge«, sagte sie nach einem kurzen prüfenden Blick und sah in die glücklichen Augen der jungen Mutter. »Du hast deine Schuldigkeit getan.«
Judith war der Alten von ganzem Herzen dankbar und froh, dass sie Salomon ihre Leiden hatte ersparen können. Als der spät am Abend zurückkam, hatten Bela und Elsa die junge Mutter schon sorgsam hergerichtet. Salomon fand sein Weib friedlich ruhend im weißen Leinenkleid vor, das Kind im Arm. Er wurde von Wellen großen Glücksgefühls durchströmt und wusste kein Wort herauszubringen.
»Wir wollen ihn nach deinem verstorbenen Großvater Aaron nennen«, schlug Judith mit schwacher Stimme vor, und Salomon konnte nur dankbar nicken.
Zum Ausklang des folgenden Sabbatfestes ließ der Rabbi den Wein besonders reichlich auf den Hawdalateller schwappen, und seine Segenswünsche galten dabei insbesondere dem kleinen Neuankömmling in der Familie. Acht Tage nach seiner Geburt wurde von dem Mohel, dem Beschneider der Gemeinde, die Brit Mila