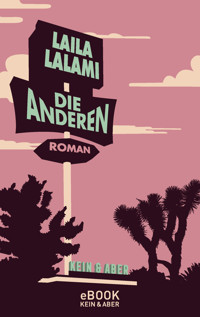18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Sara Hussein von einer Geschäftsreise nach Los Angeles zurückkehrt und den Flughafen verlassen will, wird sie von einem Angestellten des Amts für Risikobewertung aufgehalten: Ihr Risikowert sei zu hoch, denn die Analyse ihrer Traumdaten habe ergeben, dass sie zur Gefährdung für ihren Ehemann werden könnte. Zu seiner Sicherheit muss sie sich für einundzwanzig Tage unter Beobachtung begeben. Während ihr Mann ahnungslos mit den zweijährigen Zwillingen auf ihre Rückkehr wartet, wird Sara in Gewahrsam genommen. Zunächst versucht sie genau wie die anderen inhaftierten Frauen, ihre Unschuld zu beweisen. Doch als immer neue Gründe auftauchen, weshalb sich ihre Haft verlängert, beginnt Sara zu ahnen, dass sie auf eigene Faust für ihre Freiheit einstehen muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks der Autorin
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Laila Lalami wurde in Rabat geboren und hat in Marokko, Großbritannien und den Vereinigten Staaten studiert. Sie ist Autorin von vier Romanen und zahlreichen Essays, die u. a. in der Washington Post, The Nation und der New York Times erschienen sind. Ihre Bücher wurden in zwanzig Sprachen übersetzt. Bei Kein & Aber erschienen ihre Romane Die Anderen, der auf der Shortlist des National Book Award stand, sowie Der verbotene Bericht, mit dem sie den American Book Award erhielt und Finalistin des Pulitzer Prize wurde. Laila Lalami ist Professorin für Kreatives Schreiben an der University of California, Riverside. Sie lebt in Los Angeles.
ÜBER DAS BUCH
Als Sara Hussein von einer Geschäftsreise nach Los Angeles zurückkehrt und den Flughafen verlassen will, wird sie von einem Angestellten des Amts für Risikobewertung aufgehalten: Ihr Risikowert sei zu hoch, denn die Analyse ihrer Traumdaten habe ergeben, dass sie zur Gefährdung für ihren Ehemann werden könnte. Zu seiner Sicherheit muss sie sich für einundzwanzig Tage unter Beobachtung begeben. Während ihr Mann ahnungslos mit den zweijährigen Zwillingen auf ihre Rückkehr wartet, wird Sara in Gewahrsam genommen. Zunächst versucht sie genau wie die anderen inhaftierten Frauen, ihre Unschuld zu beweisen. Doch als immer neue Gründe auftauchen, weshalb sich ihre Haft verlängert, beginnt Sara zu ahnen, dass sie auf eigene Faust für ihre Freiheit einstehen muss.
Für A. und S.,die zehn Jahre gewartet haben
Du bist ein guter Mensch; wenn du eine Katastrophe aufhalten könntest, würdest du es wahrscheinlich tun. Bei jeder Schlagzeile über den Mord an einer Frau stellst du dir sofort die Frage, warum nie jemand eingeschritten ist – obwohl sie Platzwunden und blaue Flecke hatte und sich ärztlich behandeln ließ, obwohl ihr Freund sich wiederholt über das gerichtliche Kontaktverbot hinweggesetzt hat und trotz der alarmierenden Nachrichten, die er ihr schickte und in denen er in allen Details beschrieb, was er plante. Wenn im Park eine Kinderleiche gefunden wird, fragst du dich laut, ob denn niemand jemals den cholerischen alkoholkranken Vater bemerkt hat, den Sportlehrer, der sich in den Duschen herumtrieb, den seltsamen Typ, der auf der Bank am Spielplatzrand saß und gaffte. Stell dir die Frauen vor. Die Kinder. Was, wenn du sie vor solchen Monstern retten könntest? Du musst dafür nicht einmal etwas tun. Du hast längst die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert.
1
Der Traum weicht der Wirklichkeit – oder umgekehrt. Sie befreit sich aus dem verhedderten Laken und stolpert in den Gang. Wartet barfuß auf dem nackten Boden, bis das Klingeln aufhört. Regungslos, mit durchgedrückten Beinen, steht sie da, den Blick auf einen Punkt in mittlerer Distanz gerichtet. Wenn sie im Madison etwas gelernt hat, dann, dass Wohlverhalten im Körper beginnt. Der Trick besteht darin, jedes Aufflackern von Persönlichkeit, jeden Hinweis auf Anderssein zu verbergen. Aus weißen Kuppeln an der Decke sehen die Kameras zu.
Weitere Frauen stellen sich neben ihr auf, reiben sich den Schlaf aus den Augen, blinzeln unter den verchromten Leuchten, die noch von 1939 stammen, als das Madison eine Grundschule war, die jeden Herbst bis zu vierhundert Kinder aufnahm. Damals gab es in dem Städtchen Ellis eine Fabrik, die landwirtschaftliche Geräte produzierte, ein Kino, eine stets gut besuchte Billardhalle, zwei einfache Hotels sowie natürliche heiße Quellen, die noch aus dem hundertfünfzig Kilometer entfernten Los Angeles Touristen anzogen. Ein Jahrhundert später hatte die Fabrik dichtgemacht, und die Quellen waren versiegt. Das Schulgebäude hatte leer gestanden, und an den Wänden hatte der Schimmel gewuchert. Schließlich hatte der Stadtrat den Bau an Safe-X verkauft. Weil es hinsichtlich der Sanierung bestimmte rechtliche Auflagen gab, mussten die neuen Eigentümer zwar die originalen Leuchten und alle Metallteile erhalten, aber die Tafeln warfen sie weg, nahmen die Karten der Bundesstaaten und die ABC-Schaubilder von den Wänden, ließen das Mobiliar versteigern und verwandelten das Obergeschoss in einen Gefängnistrakt.
Als man sie an ihrem ersten Tag zu ihrer Pritsche in 208 brachte, wurde ihr vom Gestank des Bodenputzmittels übel. Sie zog und zerrte am Fenster, dass die Knöchel weiß anliefen, und begriff erst nach einiger Zeit, dass es zugeschweißt war. Inzwischen stört sie der künstliche Kiefernduft nicht mehr so sehr. Das Leben mit fremden Menschen in kahlen Räumen, ihre Nähe in der offenen Gemeinschaftsdusche und in der Schlange vor den KommKabs, den Kommunikationskabinen, hat sie gegen eher intime Gerüche empfindlich gemacht. Die Creme, die ihre Zimmergenossin wegen des Ausschlags verwendet, den sie im Knast bekommen hat, riecht sie aus eineinhalb Metern Entfernung.
Wenn eine Frau das Madison als Knast bezeichnet, werden die Aufseher sauer. Wir sind ein Einbehaltungszentrum, sagen sie, kein Gefängnis, keine Vollzugsanstalt. Man hat Sie nicht verurteilt, Sie sitzen hier keine Haftstrafe ab. Sie werden nur bis zum Abschluss Ihrer forensischen Beobachtung einbehalten. Und wie lange noch?, fragt immer irgendeine. Kommt darauf an, sagen die Aufseher. Manche Einbehaltene bleiben nur drei Wochen, manche müssen etwas länger warten. Die Aufseher bezeichnen die Frauen niemals als Häftlinge. Sie nennen sie Einbehaltene, Bewohnerinnen, Registrierte, hin und wieder auch Programmteilnehmerinnen.
Um sieben Minuten nach sechs taucht Hinton auf. Offenbar war viel Verkehr auf dem Highway, oder das Sicherheitsbriefing hat sich in die Länge gezogen. Seine Haare sind frisch geschnitten, was seine hohen Wangenknochen und die leuchtenden, hungrigen Augen zur Geltung bringt. Seine feinen Züge sind durch eine Brandnarbe verunziert, die unten am Hals, knapp über dem steifen Uniformkragen, verläuft. Diese Narbe ist im Madison oft Gesprächsthema. Die einen sagen, sie stamme vom großen Tujunga-Feuer, bei dem sein Haus bis auf die Grundmauern abgebrannt ist und sein Hund, angeblich ein Deutscher Schäferhund, umkam. Andere halten die Narbe für alt, für das Überbleibsel eines Unfalls in Hintons Jugendzeit, eines Missgeschicks mit einem Feuerwerkskörper oder einer Prügelei am Lagerfeuer. Aber wer weiß das schon. Jedenfalls verleiht sie ihm ein gewisses Etwas. Sie bewahrt sein Äußeres vor nichtssagender Perfektion.
Er geht in aller Ruhe durch den Gang. Vor 202 weist er zwei Einbehaltene zurecht, weil ein Handtuch auf dem Boden liegt. Dass es wahrscheinlich vom Haken gefallen ist, spielt keine Rolle; die Frauen müssen in ihrer Unterkunft Ordnung halten. In 205 gibt es ein anderes Problem, einen überquellenden Papierkorb. Doch erst in 207 zahlt sich seine Wachsamkeit wirklich aus. Er findet unter einer Decke ein batteriebetriebenes Nachtlicht, kleiner als ein Fingernagel. Nach zweiundzwanzig Uhr wach zu sein, ist gegen die Vorschriften, das wissen alle. »Einfach unglaublich«, sagt er und stößt in gespielter Bewunderung einen Pfiff aus. Dann zieht er seinen Tekmerion aus der Brusttasche und tippt auf das Display, um eine Meldung zu machen. »Sie versuchen ja nicht mal, Ihren Wert zu verringern.«
Noch zwei Schritte, dann hat er 208 erreicht. Sie riecht schon die Instant-Ramen, die er mit heißem Wasser aus dem Hahn zubereitet und vor Beginn seiner Schicht am Schreibtisch schlürfend und schmatzend gegessen hat. Weiß er, dass sie sich so viele Gedanken über ihn machen? Interessiert ihn das überhaupt? Vielleicht tratscht ja auch er über die Frauen, beim Mittagessen mit den anderen Aufsehern oder wenn nach einer langen Schicht in der Umkleide gelästert wird. Eines ist sicher: Hinton ist stolz auf seine Arbeit, er führt den morgendlichen Geräte-Check lieber selbst durch, als ihn an einen untergeordneten Aufseher zu delegieren. Und er hat es dabei nie eilig, auch wenn die Frauen im Gang vor Kälte bibbern.
Und wenn er noch so lange braucht, bis er bei ihr ist – sie senkt nie den Kopf, damit er leichter hinter ihr Ohr greifen kann. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber ihre einzige Chance, Widerstand zu demonstrieren. Er richtet den Scanner auf ihren Hinterkopf, und der Scanner zeigt mit einem Piepston an, dass die Neuroprothese an der Einbehaltenen M-7493002 [Benutzername Sara T. Hussein] nicht über Nacht manipuliert worden ist.
Sie will sich gerade umdrehen, da fragt er sie: »Was ist los?« Er sieht ihr in die Augen, ohne zu blinzeln. »Sie wirken heute ziemlich neben der Spur.«
Woran erkennt er das? Aber auch den Mund zu halten hat Sara im Madison gelernt. Jede Erwiderung, und sei sie noch so nichtssagend, könnte gegen sie verwendet werden. Sie hofft, dass in ihrer Miene nichts zu lesen ist, und wartet, bis er zu ihrer Zimmergenossin geht.
Jetzt kann der Tag beginnen.
Ein kühler Morgen im Oktober, der Tag, an dem sie achtunddreißig wird.
Den Blick auf den kleinen Spiegel über dem Waschbecken gerichtet, steckt Sara ihr Haar zu einem festen Dutt zusammen. Emily hat schon ihre Schuhe an; sie ist für den Küchendienst eingeteilt und muss dort sein, bevor die Frühstücksklingel ertönt. Die Frauen, die schon länger im Madison sind, wissen die Routine zu schätzen, während sich die Neuen nach dem Geräte-Check meistens gleich wieder hinlegen. Sie leugnen ihre Situation noch, gehen alles, was mit ihnen geschehen ist, immer wieder bis in die kleinsten Einzelheiten durch, weil sie glauben, sie könnten den einen Moment erkennen, in dem sich die Berechnungen des Algorithmus gegen sie gekehrt haben. Sie drehen das Gesicht zur Wand oder starren an die Decke, ohne auf die Schritte im Gang oder das Dröhnen eines Laubbläsers draußen vor dem Gebäude zu reagieren. Abends verlassen sie ihre Zimmer, essen schnell etwas und kehren zu ihrer stillen Meditation zurück. Ans Madison gewöhnt man sich nur langsam – nicht nur an das Zentrum, auch an die Idee, die dahintersteht.
Da ist zunächst das veränderte Zeitgefühl. Ein Tag verläuft wie der andere, und die Gleichförmigkeit steigert die Angst der Frauen, bringt sie zu Entscheidungen, die ihnen schaden. Sie weigern sich zum Beispiel, ihren psychischen Zustand beurteilen zu lassen oder eine Urinprobe abzugeben; manche liefern sich heftige Diskussionen mit dem Aufsichtspersonal. Aber auch die seltenen Tage, an denen die Monotonie unterbrochen wird, sind alles andere als einfach: Ein Anruf von einem Verwandten oder ein Anwaltsbesuch kann sowohl tröstlich sein als auch in tiefe Verzweiflung stürzen. So stellt beides, Gleichförmigkeit und Aufregung, eine jeweils eigene Belastung dar. Sara misst die Zeit nicht nach Tagen oder Stunden, sondern nach bestimmten Ereignissen.
Den ersten Schritten.
Guck-guck spielen.
Das Wort »Mama« sagen.
Und jetzt ihr Geburtstag.
Sie wäscht sich, lässt den Blick durchs Zimmer wandern und kontrolliert, ob alles den Regeln entsprechend weggeräumt ist. Auf dem Wandbord steht in einem Plastikrahmen, den sie im Laden des Zentrums gekauft hat, ein Foto von ihren Kindern in ihren Hochstühlen. Mona lächelt in die Kamera, Mohsin starrt die Bananenscheiben auf seinem Teller an, über denen seine Finger in der Luft verharren. Das Foto ist zwar längst nicht mehr aktuell, aber Sara gefällt es so sehr, wie ihre Zwillinge schauen, dass sie es nie gegen ein neueres Bild ausgetauscht hat. Neben dem Rahmen liegen ein Stapel Briefe, ein Buch mit Erzählungen von Jorge Luis Borges aus der Bibliothek und ihr Notizbuch.
Sie hat dem Reiz des Notizbuchs widerstanden, solange sie konnte. Sie hielt es für eine Art Kapitulation, wenn sie über ihr Leben im Madison schreiben würde – als würde sie damit stillschweigend anerkennen, dass ihre Einbehaltung kein Irrtum wäre, der mit entsprechenden Nachweisen sofort korrigiert werden könnte, sondern das Resultat begründeter Verdachtsmomente des AfR ihr gegenüber. Außerdem hat sie natürlich befürchtet, dass Behördenmitarbeiter, denen es nur um die Daten, nicht um die Wahrheit ging, ihr alles Geschriebene zur Last legen könnten. Tag für Tag lag sie auf ihrer Pritsche und grübelte, wie sie im Madison hatte landen können und wie sich beweisen ließe, dass sie mit den Gewalttaten, die sie angeblich plante, nichts zu tun hatte.
Eines Tages aber hatte sie es satt, an leere Wände zu starren, und ihre alten Gewohnheiten setzten sich durch. Sie hat Geschichte des postkolonialen Afrika mit Schwerpunkt auf Unabhängigkeitsbewegungen und Grenzkonzepte studiert, doch abgesehen von drei Jahren Lehrtätigkeit an der Cal State – der California State University von Los Angeles – nie als Historikerin gearbeitet. Den größten Teil ihres Berufslebens hat sie mit digitaler Archivierungsarbeit verbracht, einem Job, in dem sie keine Lehrveranstaltungen vorbereiten muss, die Möglichkeit hat, über Themen zu schreiben, die sie interessieren, und der ihr eine Krankenversicherung einbringt. Bisher zumindest.
Während sie auf die Frühstücksklingel wartet, schreibt sie ihre Träume mit allen Details, die ihr noch in Erinnerung sind, in das Notizbuch. In dem Traum von letzter Nacht hat sie sich beim Frühstück durch ihren Printastic-Feed gescrollt, bis sie auf ein Foto von 1954 stieß, das marokkanische Unabhängigkeitskämpfer zeigte, die fälschlicherweise als Rekruten der französischen Armee bezeichnet wurden. Ein peinlicher Fehler, der nicht mal einem Erstsemester in Afrikanischer Geschichte unterlaufen würde. Gleich darauf entdeckte sie zu ihrem größten Schrecken, dass das Foto von ihrem Account aus gepostet worden war. Es waren schon Unmengen von Kommentaren zu lesen, in denen sie wegen des Schnitzers verspottet und bloßgestellt wurde. Aber sooft sie im Traum auch auf Löschen tippte, das Foto blieb in ihrem Feed, und schon kamen neue Nachrichten, ping, ping, ping, der schrille Ton ihrer Schande. Das Foto ließ sich nur löschen, indem sie es aus dem Zentralrechner entfernte, der sich in einem Bunker unter dem Gebäude befand. Vor ihr erschien eine Treppe. Auf dem Weg in den Keller nahm sie immer zwei Stufen auf einmal und berührte kaum das Geländer. Plötzlich zerfloss die Treppe und wurde zu Treibsand, in dem Saras Füße versanken.
Wieder ein Traum, in dem sie gedemütigt wird. Beim Aufschreiben wird ihr bewusst, dass nicht der Moment der öffentlichen Blamage das Schlimmste war, sondern das Schweigen der Leute, von denen sie Beistand erwartet hatte. Das Gefühl, beschmutzt zu sein und ausgestoßen zu werden, tut weh. Es erinnert sie an ihre ersten Tage im Einbehaltungszentrum Madison, als sie fest damit gerechnet hat, dass ihre Freundin Myra, mit der sie früher an den Wochenenden oft im Will Rogers State Park gewandert ist, ihr beistehen würde. Auf dem gesamten Weg bis hinauf zum Inspiration Point hat Myra jedes Mal erzählt, wie sehr der Mann, mit dem sie gerade zusammen war, sie anwiderte, und dass sie nach Frankreich gehen werde, sobald sie ein Gebärfähigenvisum für das Land erhalte. Oben am Aussichtspunkt fiel sie angesichts des in der Sonne glänzenden Pazifik allerdings immer in träumerisches Schweigen. Und beim Abstieg erklärte sie, warum sie die Menschen, die sie liebe – Sara zum Beispiel –, niemals verlassen könne. Es war schön zu wissen, dass ihr die Freundschaft zu Sara so wichtig war. Seit Sara im Madison ist, hat allerdings nur ihre Familie Kontakt zu ihr. Alle anderen befürchten, dass sich ihr Risikowert verschlechtert, wenn sie mit ihr in Verbindung gebracht werden.
Sie geht ans Fenster. Wenn sie den Hals in einem bestimmten Winkel reckt und die Augen mit beiden Händen gegen das Licht der Deckenleuchte beschattet, sieht sie ein Stück Straße und dahinter einen Berg. Nicht besonders imposant, eigentlich eher ein Hügel, aber er ist mit Kreosotbüschen und gelb blühenden Enceliasträuchern bewachsen, die beim leisesten Lüftchen erzittern. An diesem Morgen ist der Himmel bewölkt. Ein Amselschwarm bringt sich in Formation, bricht sie wieder auf und verschwindet aus Saras Blickfeld. Wie Hinton ist auch die alte Frau heute ein bisschen spät dran. Sie trottet beladen mit Körben, Hüten und Matten aus Stroh zur Bushaltestelle, und ihre langen Glasperlenohrringe schwingen bei jedem Schritt. Sara hält die alte Frau für eine Künstlerin, die dreimal pro Woche die Werkstatt verlässt, um ihre handgefertigten Sachen auf den Bauernmärkten der Gegend zu verkaufen.
Der Bus kommt und hält mit quietschenden Bremsen an. Die alte Frau steigt ein, scannt ihr Gesicht und verstaut ihre Sachen auf der Gepäckablage. Der Fahrer wartet und sieht im Rückspiegel zu, wie sie sich in den Vorrechtsbereich auf der Seite des Busses setzt, die dem Madison zugewandt ist. Ob sie Sara aus dieser Distanz sehen kann? Unmöglich zu sagen. Doch Sara stellt sich die alte Frau gern als ihre Freundin vor, als eine nette Freundin, die mehrmals pro Woche nach ihr sieht.
Sie wartet, bis der Bus aus ihrem Blickfeld verschwunden ist und draußen wieder Ruhe herrscht. Stille Momente sind im Madison selten, und sie zieht diesen so sehr in die Länge, wie sie nur kann. Doch als die Frühstücksklingel ertönt, ist er vorbei.
Sie geht die Treppe hinunter und biegt um eine Ecke, die durch das Zyklopenauge eines runden Fensters erhellt wird. Die Architekten der Madison School wollten einen modernen Bau: Sie gaben ihm ein Flachdach, Geländer aus Stahlrohr und geschwungene Formen mit einem Anklang an die Ozeandampfer, die früher in Rekordgeschwindigkeit den Atlantik durchpflügten. Die Wände sollten glatt und weiß sein, die Fensterrahmen meerblau. Die Weltwirtschaftskrise, der Dust Bowl, die aufgrund beider Ereignisse errichteten Armensiedlungen – das war Vergangenheit. Die Zukunft stand im Zeichen von Fortschritt und Wissenschaft.
Auf dem Weg in die Kantine kommt sie an dem Wandgemälde neben dem Aula-Eingang vorbei, das die Arbeitsbeschaffungsbehörde damals finanziert hat. Weil es außer diesem Gemälde im ganzen Gebäude kein einziges Kunstwerk gibt, ist es nicht ungewöhnlich, dass ein, zwei Einbehaltene davorstehen und es betrachten. Es wurde von Wictor Arnautow gemalt und zeigt eine Farm-Szene in den 1930er Jahren: Landarbeiter mit Hüten knien zwischen Ackerfurchen und ernten Kopfsalat, während im Hintergrund ein Aufseher in blauer Latzhose an einem rostigen weißen Lastwagen lehnt. Die Farben wirken erstaunlich frisch, weil kein direktes Licht auf das Bild fällt. Immer wenn Sara vor dem Gemälde steht, und sei es noch so kurz, fühlt sie sich in die Zeit vor hundert Jahren versetzt. Und jedes Mal erschrickt sie ein bisschen, wenn sie danach in den nächsten Gang einbiegt, in dessen eine Wand auf ganzer Länge helle Computerbildschirme mit den Arbeitszuweisungen eingelassen sind.
Dienstags und donnerstags ist in der Kantine am meisten los; dann gibt es zum Frühstück Bratkartoffeln und Rührei. Heute ist Montag, die Schlange ist kurz. Nachdem das Gesichtserkennungssystem sie identifiziert hat, nimmt sich Sara ein Tablett. Der Haferbrei – oder das, was sich hier Haferbrei nennt – blubbert in einem riesigen Kochtopf mit dem eingestanzten Logo von MealSecure. Emily schöpft etwas von der gräulichen Pampe in eine Mulde von Saras Tablett und beendet die Prozedur mit einem resoluten Schlag auf die Kante. Dann legt sie eine Scheibe aus einem Korb mit noch halb gefrorenem Toast und einen Becher Obstsalat aus dem Haufen am anderen Ende der Theke dazu. »Nur für die Frühaufsteher«, sagt sie und reibt sich mit dem Innenarm den Hautausschlag in ihrem Gesicht. Egal welche Creme aus dem Laden sie ausprobiert – immer verschwindet der Ausschlag, kehrt aber nach ein paar Tagen zurück.
»Da habe ich ja richtig Glück!« Sara trägt ihr Essen zu einem freien Tisch unter den Fenstern. Der Haferbrei ist grobkörnig. Um ihn hinunterwürgen zu können, muss sie eine Erinnerung zu Hilfe rufen: fluffige Beghrir, ein Schälchen mit Lavendelhonig und eine Kanne Minztee – das Pfannkuchen-Frühstück, das ihre Mutter immer für sie zubereitet hat, wenn sie ein bisschen Aufheiterung brauchte.
Die Wanduhr zeigt 6:33 an. Auch mit zwei Arbeitsschichten erscheint der bevorstehende Tag unfassbar lang. Nur die Aussicht auf eine Karte von Elias und den Zwillingen lässt sie durchhalten. Es dürfen ihr zwar ausschließlich Sachen aus einem der beiden von Safe-X zugelassenen Webshops geschickt werden, doch bei Kinderzeichnungen machen sie eine Ausnahme, und Sara hofft, ein paar Bilder zu bekommen. Die Kritzeleien der Zwillinge stellen zwar noch nichts dar, aber sie glaubt, dass sich darin etwas von den Persönlichkeiten der Kinder zeigt, etwas, das Fotos nicht einfangen können.
Wo Toya wohl bleibt, denkt sie, stützt sich auf die Ellbogen und sucht mit gerecktem Hals noch einmal die Kantine ab, für den Fall, dass sie ihre Freundin übersehen hat. Ungefähr fünfzig Frauen nehmen gerade ihr Frühstück ein; die meisten sind schon lang genug da, um gegen das Essen abgehärtet zu sein, oder sie haben nicht genug Geld auf dem Konto, um sich im Laden Snacks zu kaufen. Toya ist nirgends zu sehen. Dafür erscheinen Lucy und Marcela mit ihren Kantinentabletts, ihrem verkniffenen Lächeln, ihrem belanglosen Geschwätz.
Marcela macht sich über ihren Haferbrei her und berichtet von einem Neuzugang. »Gegen Mitternacht ist sie angekommen.«
Lucy reißt die Augen auf. »Da warst du noch wach?«
»Auf dem Weg zum Klo«, erwidert Marcela und hebt zur Rechtfertigung eine Hand.
Nachts wird selten jemand eingeliefert, denkt Sara. Normalerweise erfolgt die Aufnahme tagsüber, wenn das reguläre Aufnahmepersonal Dienst hat. Die neuen Frauen werden medizinisch untersucht, man erfasst ihre Fingerabdrücke, entnimmt eine DNA-Probe und beschafft weitere biometrische Daten, sofern sie nicht schon in der Akte stehen. Dann werden die Vorschriften erklärt. Keine Handys oder Smart-Geräte. Rauchen verboten. Kein Lärm. Kein Herumstehen in den Gängen. Keine überflüssigen privaten Gegenstände – das sind alle Objekte, die das Zimmer einer Einbehaltenen unordentlich erscheinen lassen können. (Wie ordentlich oder unordentlich ein Zimmer ist, liegt im Ermessen der Aufseher.) Künstlerbedarf nur mit Genehmigung. Keine Ausweisdokumente, keine Kreditkarten, kein Bargeld. Kein Schmuck. Ausnahme: ein schlichter Ehering. Das T-Shirt hat jederzeit in der Hose zu stecken. Verschmutzte Uniformen müssen rechtzeitig zum Waschen abgegeben werden. Und so weiter.
Das Video mit den Vorschriften, das sich jeder Neuzugang ansehen muss, dauert zwei Stunden. Danach bekommt man ein Handbuch, das alle Regeln enthält. Da Unwissen nicht vor Strafe schützt, wird den Einbehaltenen während der Einweisung empfohlen, das Handbuch von der ersten bis zur letzten Seite zu lesen. Wer gegen die Vorschriften verstößt, wird aufgeschrieben, aufgeschrieben zu werden erhöht den Risikowert, ein erhöhter Risikowert verlängert die Einbehaltung.
»Und wo ist die Neue jetzt?« Sara lässt den Blick durch die Kantine schweifen.
»Keine Ahnung.«
»Bist du sicher, dass du das nicht geträumt hast?«
Marcela wischt sich mit der Hand übers Gesicht, das noch feucht vom Duschen ist. Sie hat ein Tattoo, das sich vom Ellbogen bis zum Handgelenk zieht – SHARPJELLO, der Name ihrer Band, in verlaufendem Orange. »Wird sich zeigen.«
Lucy verputzt ihren restlichen Obstsalat und fängt noch den letzten Tropfen Saft vom Boden des Plastikbehälters auf. »Heute hätten sie uns ruhig mehr geben können. Ist schließlich Feiertag.«
»Welcher Feiertag?«, fragt Marcela.
»Columbus Day.«
»Ach, der ist heute? Tja, das dürfte denen ziemlich egal sein.«
»Kein Mensch sagt mehr ›Columbus Day‹. Das heißt jetzt ›Tag der indigenen Bevölkerungen‹.«
»Ich sage weiter ›Columbus Day‹. Mann, bin ich hungrig!«
Nach kurzem Zögern gibt Marcela Lucy ihren Obstsalat. Die beiden sind ein ungleiches Paar, sie haben so gut wie nichts miteinander gemein. Marcela ist Mitte zwanzig, Lucy Ende fünfzig. Die eine ist Gitarristin in einer Indie-Band aus Bell Gardens, die andere Buchhalterin in einer Immobilienfirma in Sherman Oaks. Doch seit sie sich ein Zimmer teilen, sind sie miteinander verbündet, und Verbündete gibt es nicht viele im Madison. Es ist durchaus schon zu Meinungsverschiedenheiten und sogar Prügeleien zwischen Einbehaltenen gekommen, deren Beobachtungszeit daraufhin verlängert wurde.
»Dank dir, Kleine«, sagt Lucy und zieht die Abdeckfolie behutsam vom Behälter, damit ja kein Tropfen Saft verloren geht. Ihr Gesicht ist breiter geworden und ihr Haar mangels Friseurbesuchen grau. Sie erinnert mittlerweile an eine in die Jahre gekommene Matriarchin mit zwei Ex-Männern und fünf ständig streitenden Kindern.
Endlich taucht die Neue auf. Die Frau, groß und mit sportlicher Figur, geht zielstrebig zur Essensausgabe. Weil sie so spät kommt, erhält sie keinen Obstsalat mehr, sondern nur Haferbrei und eine Scheibe Toast. Nachdem sie ihr Tablett entgegengenommen hat, sieht sie sich nach einem freien Stuhl um. Als sie den Tisch an der Fensterseite entdeckt, an dem die drei Frauen sitzen, rutscht Lucy ein Stück zur Seite, um Platz zu machen. Jeder Neuzugang ist eine hochwillkommene Abwechslung vom immer gleichen Tagesablauf. »Ich bin Lucy Everett«, sagt Lucy nach einer kurzen Pause. »Das hier ist Marcela DeLeón, und die Stille da heißt Sara Hussein. Und du?«
»Eisley Richardson«, antwortet die Neue. Sie klingt wie eine Talkshow-Moderatorin, spricht jede Silbe deutlich aus. Sie weiß noch nicht, dass man hier monoton flüstern, die eigene Stimme mit den Stimmen der anderen vermengen muss, damit nicht alles, was man sagt, sofort gehört wird. Beim ersten Löffel Haferbrei verzieht sie angewidert das Gesicht, findet sich aber damit ab und isst alles auf, als würde sie eine Anweisung befolgen.
»Das Essen ist mies, aber was uns nicht umbringt – du weißt schon.« Lucy hat viel Lebenszeit mit Kunden verbracht und hält sich für äußerst eloquent. »Und woher kommst du?«
»Los Angeles.«
»Kein Grund zu schreien. Warum bist du hier gelandet?«
Eisley schüttelt den Kopf. »Ich habe nichts getan.«
»Jetzt rede doch endlich mal leiser!«
»Ich habe nichts getan.« Diesmal sagt sie es flüsternd.
Lucy nickt. »Schon klar. Aber welche künftige Tat legen sie dir zur Last?«
»Fahrlässige Tötung im Straßenverkehr.«
»Und wie lange sollst du hierbleiben?«
»Einundzwanzig Tage.«
Marcela und Lucy werfen sich einen bedeutungsschweren Blick zu, sagen der neuen Frau aber nicht, dass die wenigsten nach Ablauf ihrer forensischen Beobachtung entlassen werden. Wem das passiert, der hat Glück, denkt Sara, denn diese Leute sind fast sofort danach wieder SAUBER, während die meisten Einbehaltenen als FRAGLICH gelten; sie konnten ihren Risikowert im Zeitraum von drei Wochen nicht ausreichend senken und werden mit einer Verlängerung belegt.
Als Sara den Blick hebt, sieht sie, dass Hinton ihren Tisch beobachtet, als wären die Neuroprothesen, die Temperatursensoren und die mit der Emotion-Tracking-Software von Guardian ausgestatteten Kameras nicht schon genug. Das System ist nie zufrieden mit den Daten, die es bereits erfasst hat. Es will immer mehr, sei es in neuen Formaten, sei es aus neuen Quellen, zu denen auch menschliche Datensammler gehören. Sieht Hinton etwas, was den Kameras verborgen bleibt, meldet er es mithilfe seines Tekmerions. Je mehr Meldepunkte er hat, umso mehr Urlaub bekommt er.
»Wo haben sie dich reingesteckt?«, fragt Lucy die Neue.
»Zimmer 258.«
»Nein, in welchen Job?«
»Ich bin doch nur drei Wochen hier.«
Sara nimmt ihren Obstsalatbehälter und wischt mit der Hand den Staub vom Deckel. Auch sie hat sich nach ihrer Aufnahme im Madison geweigert, in den Trailern am Rand des Hofs zu arbeiten. Erst nach einiger Zeit begriff sie, dass der Algorithmus jede, die eine zugewiesene Arbeit ablehnt, als ARBEITSLOS bewertet. Arbeitslosigkeit ist im Madison ein negativer Verstärker des Risikowerts und verschlimmert damit jeden Regelverstoß beträchtlich. »Arbeite lieber«, flüstert sie in Eisleys Richtung und fügt nach einem Blick auf die Uhr über der Essensausgabe hinzu: »Wenn du dich gleich nach dem Frühstück eintragen lässt, schaffst du es noch in die heutige Schicht.«
Die Neue quittiert den unerbetenen Ratschlag mit einem bösen Blick und isst weiter, während Lucy sie ausfragt.
»Warum haben sie dich eigentlich nicht in der regulären Aufnahmezeit hergebracht?«
»Was machst du beruflich?«
»Was bedeutet das Tattoo an deinem Arm?«
Eisley reagiert auf jede Frage entweder mit einem Schulterzucken oder mit unverständlichem Grummeln. Lucy kapiert einfach nicht, dass die Frauen kurz nach der Einlieferung alles wollen, nur nicht reden, und schon gar nicht mit anderen Einbehaltenen. Wenn Eisley in etwa so drauf ist wie ich, sagt sich Sara, durchlebt sie gerade die Phase des Nicht-wahrhaben-Wollens und hält ihre Einbehaltung für einen Irrtum, der sicherlich bald korrigiert werden wird. Sie braucht schlicht Zeit, um sich einzugewöhnen.
Schweigend beenden sie ihre Mahlzeit. Das grelle Licht, das durch die Fenster hereinströmt, fällt in spitzen Winkeln auf die Kantinentische. Draußen schneiden die Gärtner die Stauden zurück, rechen Laub und scheuchen die Krähen bei ihrer Suche nach Raupen auf. Das Einbehaltungszentrum erstreckt sich über einen ganzen Häuserblock in Ellis, wirkt aber von den am Haupteingang vorbeifahrenden Autos aus nicht wesentlich anders als vor der Renovierung. Selbst die Paloverde-Bäume an der Frontseite sind geblieben; sie verbergen Teile des Hauptgebäudes und tragen, vor allem wenn sie blühen, zu dessen Verschönerung bei. Es gibt keine Wachtürme, keine Stahltüren, keinen Stacheldraht. Doch sollte sich Sara weiter entfernen als bis zu dem Maschendrahtzaun, der den Hof umgibt, würde ihre Neuroprothese den Aufsehern ihren genauen Standort melden.
Bevor sie ins Madison kam, hat sie nie groß über Ortungssysteme nachgedacht; sie war zu sehr mit ihrem Leben beschäftigt. Um diese Zeit frühstückte sie mit den Zwillingen, dachte sich dabei alberne Lieder über Bananen und Blaubeeren aus und brachte die beiden später auf dem Weg zur Arbeit in die Tagesstätte. Elias saß in der Stadtbahn, ging auf der Fahrt ins Klinikzentrum Los Angeles die Fälle des Tages durch, hatte seine Kopfhörer auf und hörte Musik. Nach dem merkwürdigen Virus, das sich im Jahr zuvor überall verbreitet hatte, ist der Bedarf an Sprachtherapie für Kinder enorm gestiegen, und Elias bekam wesentlich mehr zu tun. Trotzdem hat er sich vor Beginn der Therapiestunden immer bei ihr gemeldet, sie gefragt, wie es ihr geht oder ob er etwas fürs Abendessen besorgen soll. Sie hat ein normales Leben geführt. Um in dieses Leben zurückkehren zu können, muss sie ihr Verhalten verbessern, zeigen, dass sie in der Lage ist, die Regeln einzuhalten, zeigen, dass sie keine Kriminelle ist.
Sie trägt ihr Tablett zum Abräumwagen neben der Essensausgabe. Die Neue folgt ihr, stellt ihr Tablett in den Wagen, wirft den Löffel in den dafür vorgesehenen Behälter und meldet sich am Ausgang ab. Sie ist schon dabei, die Regeln zu lernen. Die Einbehaltenen haben zu essen, was sie bekommen, zu tun, was man ihnen sagt, zu schlafen, wenn das Licht ausgeht, aber sie gelten als FUB.
Frei, unter Beobachtung.
Der ganze Ärger begann am letzten Freitag vor Weihnachten am Terminal 8. Wegen eines Stromausfalls am frühen Vormittag war die Halle vor den Zoll- und Einreisekontrollen rappelvoll – Rentner mit Baseballcaps im Partnerlook, mies gelaunte Teenager in karierten Schlafanzughosen, völlig aufgelösten Eltern hinterhertrottende Kleinkinder. Als Sara vom Laufband heruntertrat, fiel ihr Blick auf ein Schild, das für den Concierge-Ankunftsservice warb. Wegen der saftigen Gebühr, die dafür fällig wurde, und weil sie unterwegs sowieso schon zu viel ausgegeben hatte, reihte sie sich seufzend in die Schlange vor der Passkontrolle ein, die sich durch die ganze Halle zog. Das wird dauern, schrieb sie Elias.
»Keine Handys erlaubt!«, fuhr sie ein Mann von der Flughafenpolizei an und deutete auf einen orangen Aushang, der die Nutzung von Handys verbot. »Schalten Sie es aus!«
»Entschuldigung«, sagte Sara und schob ihr Handy in die hintere Jeanstasche. »Das ist nur mein Mann. Er findet keinen Parkplatz.«
Den Polizisten überzeugte das offenbar nicht. Sara spürte auch dann noch seinen Blick auf sich, als zusätzliche Schalter geöffnet wurden und es kurz darauf in der Schlange stetig voranging. Eine Männerstimme ermahnte die Ankommenden durch die Lautsprecher zuerst auf Englisch, dann auf Spanisch, ihr Gepäck nie aus dem Blick zu lassen. Irgendwo schluchzte ein Kind. Als Sara an die Reihe kam, hob sie ihre Reisetasche vom Boden auf und schlurfte zum Scout, der sie anwies, ihre Hand auf den Fingerabdruckscanner zu legen, ihren Namen ins Mikrofon zu sagen und den Blick auf seine kleinen grünen Augen zu richten. Die Kameras machten sie leicht verlegen – sie war nicht geschminkt und ihr lockiges Haar zerzaust. »Stellen Sie sich in Schlange B«, sagte der Scout.
Komisch.
Sie machte einen Schritt nach hinten und trat noch einmal vor die KI, doch der Scout verweigerte ihr die Abfertigung. »Stellen Sie sich in Schlange B«, wiederholte er mit seiner blechernen Stimme.
In der neuen Schlange betrachtete Sara die anderen Passagiere, die zur Überprüfung durch menschliche Kontrolleure ausgesondert worden waren: ein ungepflegtes Backpacker-Paar, eine Frau mit einem schlafenden Kind auf dem Arm, mehrere alte Leute. Es kam – wenn auch selten – immer noch vor, dass das von der KI aufgenommene Foto eine Übereinstimmung mit mehr als nur einem Gesicht ergab und ein Grenzbeamter entscheiden musste, welches korrekt war. Vielleicht lag es an Saras zerzaustem Haar. Zum Glück war die neue Schlange sehr kurz. Das Handy in ihrer Hosentasche vibrierte schon wieder, aber sie riss sich zusammen und ging nicht dran. Es würde wegen des Ferienverkehrs einige Zeit dauern, bis Elias den Terminal ein zweites Mal umfahren hätte und wieder im Abholbereich angelangt wäre. Bis dahin würde sie hier fertig sein. Sie reichte der Beamtin der Zoll- und Grenzschutzbehörde, einer Frau mittleren Alters mit faltenlosem Gesicht und dünnen, schlampig schraffierten Augenbrauen, ihren Pass.
»Sara Tilila Hussein«, las die Frau vor, wobei sie die Silben in die Länge zog. »Habe ich das richtig ausgesprochen?«
»Ja.«
»Von wo sind Sie angereist?«
»Aus London.«
»Was haben Sie dort gemacht?«
»An einer Konferenz teilgenommen.«
»Welchen Beruf üben Sie aus?«
»Ich bin Archivarin. Ich arbeite fürs Getty Museum.«
»Das Museum oben in den Bergen? Sehr schön. Der Garten ist toll.« Die Frau scannte die Fotoseite des Passes. Dann schaute sie auf ihren Bildschirm und klickte sich von Tab zu Tab. Am Schalter nebenan zeigte ein älteres Paar seine Ausweispapiere vor, erhielt die erforderlichen Stempel und machte sich auf den Weg zur Gepäckausgabe. Ein Stück entfernt schob ein Flughafenangestellter eine Frau im Rollstuhl durch die Sicherheitsschleuse.
»Stimmt etwas nicht?«, fragte Sara. Sie bemühte sich, jeden Anflug von Ungeduld in ihrer Stimme zu unterdrücken.
»Nein, nein«, erwiderte die Beamtin, gab den Pass aber nicht zurück, sondern hielt ihn aufgeschlagen in einer Hand, während sie mit der anderen die Maus betätigte. Sie wirkte geradezu fasziniert von den Informationen auf ihrem Computerbildschirm, was Sara merkwürdig fand. Sie war schon sechs-, siebenmal auf der Konferenz in London gewesen, war immer mit derselben Fluggesellschaft geflogen und immer am selben Flughafen angekommen und abgereist, ohne dass ihr Pass jemals zusätzlich überprüft worden war. An der Gesichtserkennung lag es offenbar nicht. Hatte es vielleicht damit zu tun, dass sie trotz des Verbots ihr Handy benutzt hatte? Sie stellte die Tasche auf den Boden und rieb sich die schmerzende Hand. Weil ihr vom grellen Licht der Deckenleuchten in der Abfertigungshalle warm wurde, zog sie die Jacke aus, nahm das Halstuch ab und stopfte beides in die Tasche. Kurz darauf erhob sich die Frau, stellte sich auf die Zehenspitzen, sah aus ihrer verglasten Kabine hinaus zu den anderen Schaltern und rief: »Hernandez!«
Verdammt. Sara trat von einem Fuß auf den anderen. Die neuerliche Verzögerung bedeutete, dass Elias mit den dreizehn Monate alten Zwillingen in ihren Babysitzen ein drittes oder viertes Mal um den Terminal würde fahren müssen. Die beiden waren inzwischen bestimmt aus dem Mittagsschlaf erwacht und schrien nach ihren Fläschchen, die hinten, für Elias unerreichbar, in der Mini-Kühltasche standen. Wieder vibrierte das Handy, aber sie ging nicht dran. Sie stellte sich vor, dass er immer frustrierter wurde, weil sie seine Textnachrichten und Anrufe ignorierte. Er hatte die Kinder fünf Tage betreut und wünschte sich garantiert nichts sehnlicher, als dass seine Frau heimkam.
Der Beamte namens Hernandez betrat die Schalterkabine und stellte sich neben seine Kollegin, auf deren Namensschild, wie Sara erst jetzt bemerkte, Hastings stand. »Schau dir das mal an«, sagte Hastings, und beide starrten auf den Bildschirm. »Sieht nach einem 55–60 aus, oder was meinst du?«, fragte sie und hob um Bestätigung bittend den Blick zu ihm.
»Lass mich mal sehen.« Hernandez nahm sich die Maus und klickte und scrollte im gleichen Schneckentempo wie Hastings zuvor. Die anderen in der Schlange gafften bereits und flüsterten untereinander. Sara hatte das Gefühl, von einem Publikum beobachtet zu werden, das ihr nicht wohlgesinnt war – als würden nach ihrer wenig beeindruckenden Darbietung gleich die Rufe »Genau, 55–60!« von den billigen Plätzen ertönen. Einige Sekunden vergingen; dann sagte Hernandez: »Ja, stimmt.«
Nach diesem Urteil sahen beide wieder zu Sara, der sofort mulmig wurde, obwohl sie nichts Falsches getan hatte. »Sie müssen in die Abteilung Überprüfung und Vorbeugung gehen, Ms. Hussein«, sagte Hastings. »Der Aufzug ist rechts im Gang.«
»Was ist los?«
»Nur das übliche Verfahren.«
»Welches Verfahren?«
»Ihr Risikowert ist zu hoch.«
»Was? Aber wieso?« Sie hatte ihren Risikobericht zuletzt drei Jahre zuvor gesehen, als Elias und sie die Wohnung in ihrem familienfreundlichen Stadtteil kauften. Die Bank hatte eine Kopie gefordert, bevor sie das Darlehen mit der fünfzigjährigen Laufzeit genehmigen wollte. Damals hatte dort SAUBER gestanden. Bei beiden. Das Ganze musste ein Irrtum sein. Aber warum passierte es ausgerechnet am Flughafen, wo sie sowieso schon in Eile war!
»Der Kollege vom AfR wird Ihnen alles erklären. Müssen Sie noch Gepäck abholen?«
»Nein, ich habe nur diese Tasche.«
»Sehr gut. Officer Hernandez bringt Sie hin.«
»Und mein Pass?«
»Den nimmt Officer Hernandez mit. Folgen Sie ihm!«
Nicht nach so vielen Jahren ausgerechnet heute eine erweiterte Sicherheitskontrolle!, dachte Sara.
Unter den Blicken der anderen Passagiere verließ Officer Hernandez mit Saras Pass den kleinen Schalterraum und bat sie, ihm zu folgen. Er brachte sie im Aufzug ein Stockwerk nach oben und führte sie durch ein Labyrinth grauer Gänge zu einer Tür mit einem Schild, auf dem AMTFÜRRISIKOBEWERTUNG stand. Rechts und links davon saß je ein bewaffneter Securitymann; beide starrten mit glasigen Augen in ihre Handys. In dem Büro gab es einen Wartebereich und dahinter, durch eine Glaswand getrennt, einen Befragungsraum, in dem ein junger Officer gerade ein Gespräch mit einer rothaarigen Frau in einem Trainingsanzug führte. Hernandez legte Saras Pass in die Schiebemulde am Schalter. »Setzen Sie sich«, sagte er.
»Wie lange dauert das?«
»Nicht lang. Nur das übliche Verfahren.«
»Man hat mir noch immer nicht erklärt, wie das Verfahren abläuft«, murrte sie. Andererseits hatte sie sich inzwischen mit der bürokratischen Langsamkeit abgefunden und setzte sich auf einen der Vinylstühle, um Elias anzurufen. Doch sie bekam keinen Empfang, auch nicht nachdem sie ihr Handy aus- und wieder eingeschaltet hatte. Das Vorhaben, sie abzuholen, ohne zu parken, hatte Elias wahrscheinlich aufgegeben und probierte es wieder im Parkhaus. Mit etwas Glück würde er einen Stellplatz finden, könnte die Kinder aus dem Auto zerren und in den Zwillingsbuggy setzen, auch wenn man damit im Flughafen schlecht vorankam. Sara dachte sehnsüchtig an das geplante Mittagessen im Mimi, einem neu eröffneten Lokal, in dem man angeblich den besten Lomo saltado der ganzen Stadt aß. Sie hatte den Tisch am Abend zuvor im Internet reserviert – eine kleine Entschädigung dafür, dass Elias bereit gewesen war, sie an einem Ferienwochenende vom Flughafen Los Angeles abzuholen. Jetzt bezweifelte sie, dass sie es noch schaffen würden. 11:45 las sie auf ihrem Handy. Noch nicht vollkommen ausgeschlossen, dachte sie voller Zweckoptimismus. Wenn die Befragung zwanzig oder dreißig Minuten dauerte und es auf dem Sepulveda Boulevard kein Verkehrschaos gab, könnten sie um 13:30 Uhr dort sein. Die Zwillinge wären dann zwar müde, aber sie könnte sie mit Spielen auf ihren Tablets ablenken.
Sie steckte ihr Handy in die Handtasche und wartete. Gründliche Kontrollen an Flughäfen waren nichts Neues für sie – von der Untersuchung der Hände auf Sprengstoffpartikel durch die Transportsicherheitsbehörde bis hin zu ausführlichen Befragungen durch aggressive Kontrolleure hatte sie fast schon alles erlebt. In ihrer Kindheit hatte ihr Vater immer dafür gesorgt, dass die Familie für den Fall zusätzlicher Überprüfungen drei Stunden früher als nötig am Flughafen war. Dass er gern jede Möglichkeit einkalkulierte, lag weniger an seinem Beruf – er war Physiker – als an der chronischen Angst des Immigranten vor jedem Uniformierten. Saras Mutter ärgerte sich über seine Vorsicht – »Warum sind wir dann überhaupt hergezogen?« – und sabotierte sie immer wieder, indem sie beispielsweise einen unverfänglichen Gegenstand in drei Lagen Seidenpapier einwickelte, das die Kontrolleure Schicht für Schicht entfernen mussten, um dann festzustellen, dass sie eine alte Haarbürste oder ein Brillenetui ausgepackt hatten. Oder sie machte bei der Sicherheitskontrolle eine Szene, indem sie mit ihrem starken Akzent jede Aufforderung des Personals laut wiederholte und den Leuten unerbetene Tipps gab. »Da ist noch eine Reißverschlusstasche innen, die haben Sie übersehen«, sagte sie etwa, oder: »Warten Sie, ich zeige es Ihnen«, oder: »Und was ist mit meinem Wäschebeutel? Wollen Sie den nicht auch durchsuchen?« Die anderen Fluggäste starrten.
Doch so genau Saras Vater alle möglichen Scherereien auch vorhersah und zu entschärfen versuchte, blieben sie ihnen doch nie erspart. Regelmäßig erhielt er Bordkarten mit dem gefürchteten SSSS-Code oder wurde zum Gate gerufen, wo er vor den Augen der anderen Passagiere erniedrigende Überprüfungen durchmachen musste. Als er sich einmal über eine zusätzliche Durchsuchung beschwerte, ließ die Kontrolleurin ihren Ärger an Sara und deren Bruder Saïd aus. Sie waren damals acht beziehungsweise vier, steckten von Kopf bis Fuß in nagelneuer Wanderkleidung und freuten sich auf die Reise zum Grand Canyon, weil ihre Eltern ihnen einen Ritt auf einem Maultier versprochen hatten. Auf einem großen Maultier mit Sattel und allem Drum und Dran. »Zieht eure Schuhe aus!«, befahl die Mitarbeiterin des Sicherheitspersonals. Saïds Teva-Sandalen waren grün, ihre blau; das wusste sie noch. Barfuß sahen die beiden zu, wie die Kontrolleurin jeden Schuh so stark bog, dass er brach. Das Klebeband, mit dem Sara die Teile wieder zusammenfügte, pappten am Fußgewölbe; sie hatte tagelang Blasen. Die Blasen waren ihre einzige Erinnerung an den Grand Canyon.
Ein andermal kamen sie aus Marokko zurück, wo sie jedes Jahr Urlaub machten, und wurden am Dulles International Airport in Washington exakt so lange aufgehalten, dass sie den Anschlussflug nach Hause verpassten. Dann durften sie sofort gehen, ohne eine Erklärung bekommen zu haben. Aufgrund der Verzögerung versäumte ihr Vater eine Zeremonie, bei der er und drei Kollegen vom Caltech, dem California Institute of Technology, für ihre Arbeit an einer neuen Marsrover-Generation geehrt werden sollten. Das Schlimme an diesen Vorfällen war nicht, dass dabei nie etwas herauskam und die Zeit aller Beteiligten verschwendet wurde, sondern der nagende Verdacht, dass für Saras Familie die Möglichkeit, ihr Leben zu leben, ganz und gar vom Ermessen uniformierter Menschen abhing. Obwohl sie damals noch ein Kind war, empfand Sara bei jedem Aufenthalt in einem Flughafen große Angst.
Kaum hatte der Staat an den Sicherheitsschleusen Scout eingesetzt, war der Ärger wie weggeblasen. Sara war inzwischen Zehntklässlerin in der Highschool und bemerkte den Unterschied, als sie mit ihrem Fußballteam auf Trainingsreise nach Mexiko flog. Sie musste sich nur vor Scout hinstellen, schon griff die KI auf ihre Fluggastdaten, die biometrischen Informationen und ihr Vorstrafenregister zu. Das Lämpchen leuchtete grün, und sie war überprüft. Keine Schlangen mehr, keine Fragen. Ein neues Zeitalter digitaler Polizeiarbeit hatte begonnen, und die junge Sara Hussein fand das gut. Man brachte Flughäfen damit schnell und unkompliziert hinter sich.
Allerdings offenbar nur bis heute.
Weil es sonst nichts zu tun gab, beobachtete sie die Befragung, die auf der anderen Seite der schalldichten Glasscheibe stattfand. Die junge Frau war so empört, dass ihr Gesicht rot anlief. Sie zog ein Blatt Papier aus der Handtasche und fuchtelte damit unhöflich dicht vor dem Gesicht des Beamten herum, der aber ruhig blieb. Er warf einen Blick auf das Papier, stellte ihr einige weitere Fragen, gab es ihr dann zurück und stempelte ihren Pass. Sie verließ den Befragungsraum leise fluchend mit zwei zueinanderpassenden Koffern, die sie hinter sich herzog.
Dann war Sara an der Reihe. Der Beamte nahm ihren Pass aus der Schiebemulde und trat an die Tür. Diesmal las sie das Namensschild gleich. Segura. Dass der Name zu seiner beruflichen Tätigkeit passte, fiel ihr erst später auf. »Ms. Hussein?«
»Ja.« Sie stand auf.
»Bitte kommen Sie rein und nehmen Sie Platz.«
In dem Raum stand ein großer Schreibtisch mit zwei Computermonitoren, aber ohne irgendwelche persönlichen Gegenstände wie gerahmte Fotos, Topfpflanzen oder witzigen Nippes. An einer Wand hing ein Bildschirm, auf dem bei abgestelltem Ton ein Werbeclip für Luxusurlaub in Hawaii lief, was Sara verwunderte. Die Wand gegenüber zierte ein Messingschild mit Dienstsiegel und einem Mission Statement. Die Buchstaben waren zu klein, als dass Sara den Text von ihrem Stuhl aus hätte lesen können.
Aus der Nähe fiel ihr auf, dass seine Uniform eine etwas andere Farbe hatte als die der Beamten unten an der Zoll- und Einreisekontrolle – sie war eher dunkelblau als schwarz – und dass er keine Waffe trug. An seinem Ärmel befand sich ein Aufnäher mit den Buchstaben AfR. Die kleine Motion-Tracking-Kamera, die neben dem Computer lag, war auf ihr Gesicht gerichtet.
»Sie kommen also aus London, ist das korrekt?«, fragte Segura.
»Ja.«
»Und wohnen in L.A.?«
»Ja.«
Er bat sie um ihre Adresse, ihren Beruf und weitere persönliche Informationen. Jede Antwort glich er mit den Angaben im Computer ab. Sein dichtes, glänzendes Haar war mit Gel in Form gebracht, und im rechten Ohrläppchen steckte ein winziger Diamant. Sara konnte sich ihn gut ohne Uniform vorstellen – in einer hippen Jacke und Jeans an der Theke einer Bar in Silver Lake. Der Gedanke machte ihr noch stärker bewusst, wie verlottert sie aussah. Sie war für das kühlere Wetter in London gekleidet, trug Jeans und ein altes Flanellhemd, an dessen einem Ärmel ein Knopf fehlte. Und sie hatte Schweißflecken unter den Achseln, die immer größer wurden. Aus Angst, man könnte etwas riechen, verschränkte sie die Arme vor der Brust.
»Was ist auf dem Flug von London passiert? Hier steht, dass die Polizei gerufen wurde.«
Deshalb also hatte man sie zur erweiterten Kontrolle abkommandiert. »Das war ein medizinischer Notfall«, berichtete sie. »Kurz bevor unsere Maschine in Heathrow vom Gate auf die Rollbahn geschoben wurde, griff sich der alte Herr neben mir an die Brust, als würde er keine Luft mehr bekommen, und röchelte dabei ganz komisch. Ich dachte, es wäre ein Herzinfarkt, und rief die Flugbegleiterin. Die bat einen Arzt um Hilfe, der ein paar Reihen entfernt saß. Der Arzt erklärte dem Mann, dass es das Beste wäre, wenn er das Flugzeug noch vor dem Start verlassen würde, aber der Mann weigerte sich. Er müsse unbedingt nach L.A., sagte er, er habe noch nie seine Enkelkinder gesehen. Jedenfalls kam es zu einem Streit mit der Crew, und irgendwann wurde die Polizei gerufen, um ihn aus der Maschine zu bringen. Der Abflug verzögerte sich um eine halbe Stunde.«
»Sehr ärgerlich«, sagte Segura.
Und beängstigend. Der alte Mann hatte so angestrengt nach Luft geschnappt, während er mit der Crew stritt, dass sein Gesicht tiefrot angelaufen war. Als ihm der Kabinenchef mitteilte, dass er das Flugzeug verlassen müsse, konnte Sara ihre Erleichterung kaum verbergen. Schließlich hätte sich sein Zustand auf halber Strecke über dem Atlantik verschlimmern können, und was dann? Allerdings war er sofort nach der Verkündigung der Anordnung sehr, sehr wütend geworden. Er hatte ihr Vorwürfe gemacht, weil sie sein Gesundheitsproblem gemeldet hatte, und als ihn Polizeibeamte aus der Maschine holten, hatte er laut gerufen, Sara habe sich in seine privaten Angelegenheiten eingemischt. Hatte er ihr etwas angehängt? Vielleicht stand die Sache mit der Polizei aus diesem Grund in ihrem Risikobericht, obwohl sie nicht das Geringste damit zu tun gehabt hatte. Sie war plötzlich wahnsinnig sauer. Sie hatte dem Mann helfen wollen und war für ihre Mühe auch noch in eine Kontrolle gezogen worden.
»Und wer hat Ihre Reise nach London bezahlt?«
»Mein Arbeitgeber. Ich habe dienstlich an einer Konferenz teilgenommen.«
»Gut«, sagte Segura und tippte ihre Antwort sorgfältig ein. Sara schätzte ihn auf Ende zwanzig, doch wegen seiner Körperhaltung wirkte er wie ein ältlicher Büroangestellter mit verkniffenem Mund und hängenden Schultern. Noch zehn Jahre, dachte sie, dann hat er chronische Rückenschmerzen. Er klickte ein neues Fenster an, runzelte plötzlich die Stirn und sagte: »Nennen Sie mir bitte Ihre Social-Media-Benutzernamen.«
»Meine Benutzernamen?« Welche Verbindung sollte es zwischen dem Vorfall in Heathrow und ihren Feeds in den sozialen Medien geben? Sie konnte keine erkennen. »Also, ich habe einen Nabe-Account«, sagte sie, »den ich aber kaum noch benutze. Mein Name dort lautet SaraTHussein ohne Bindestriche oder Leerzeichen.«
Er nickte. »Was noch?«
»Printastic. Aber das scheinen Sie ja schon zu wissen. Können Sie mir bitte sagen, worum es eigentlich geht?«
»Der Algorithmus wertet Sie als akute Gefahr«, antwortete Segura in ausgesucht höflichem Ton. In seiner Miene war nichts zu lesen. Sara konnte nicht sagen, ob er dem Algorithmus glaubte oder sich schlicht an die Vorschriften hielt.
»Ich? Eine akute Gefahr?« Sara gluckste nervös in sich hinein. Sie spürte wieder die Angst und die Frustration, die früher jeder Flughafen in ihr ausgelöst hatte. Auf Nabe folgte sie diversen Museen, postete ab und zu etwas über die historische Serie der BBC, von der alle sprachen, und hielt den Kontakt zu Freundinnen und Freunden aus der Highschool und dem College. Ein paar Monate zuvor war sie in einen heftigen Streit mit einem Computerprogrammierer geraten, der während ihrer Studienzeit in Berkeley ihr Zimmernachbar gewesen war. Darren hatte oft bei den Partys im Hof des Wohnheims aufgelegt. Er hatte damals ganz unpolitisch gewirkt, hatte nie kommentiert, dass Sara und andere die studentischen Hilfskräfte gewerkschaftlich organisieren oder die Uni-Leitung dazu bringen wollten, nicht mehr in Wasseraktien zu investieren. Im Grunde hatte er sich von den meisten anderen Studierenden im Wohnheim nicht unterschieden.
Als sie nach Los Angeles zurückgezogen war, hatte Sara mit allen, die sie aus Berkeley kannte, über Nabe Kontakt gehalten und dort Darrens mit Verschwörungstheorien gespickte Posts und seine fanatische Liebe zu Schusswaffen entdeckt. Nachdem sie auf eine seiner ausführlichen Äußerungen über die Chinesen mit einer Richtigstellung reagiert hatte, antwortete er innerhalb von Sekunden und brach einen Streit vom Zaun, der sich die ganze Nacht hinzog und vom Boxeraufstand bis zum Tiananmen-Platz so ziemlich alles umfasste. Sara fand den Austausch so anstrengend, dass sie sich schwor, nie wieder mit ihm zu chatten, was aber nichts nützte, weil Darren sich an ihr rächte, indem er zwei ihrer Archivfotos wegen Nacktheit meldete, sodass Nabe sie für drei Tage sperrte. Kaum hatte sie ihren Account wieder benutzen dürfen, meldete er sie erneut, diesmal wegen Spam, weil sie mehrere Links zu einer Fotoausstellung in San Diego gepostet hatte, bei der sie als Co-Kuratorin tätig gewesen war. Sie musste ihn blockieren, um die Schikane zu stoppen.
Aber so etwas hatte doch jeder erlebt. Man konnte in den sozialen Medien nicht mehr aktiv sein, ohne es mit Trollen, Bots, Cyborgs, Betrügern, Fakeaccounts, Reply Guys oder Verschwörungserzählern zu tun zu bekommen – Leuten, die man am besten mied, ignorierte oder blockierte. Sara war nicht so dumm gewesen, Darren in Posts zu bedrohen, andere gegen ihn aufzuhetzen oder auch nur ansatzweise Dinge zu äußern, die einem Sicherheitsbeamten wie Segura ins Auge gestochen wären. Außerdem war ihr Account privat.
Das Printastic-Konto war zwar öffentlich, beinhaltete aber ausschließlich Berufliches. Sie zeigte dort Archivbilder aus Bereichen, die sie in wissenschaftlicher Hinsicht interessierten. Das Getty Museum hatte zu ihrer großen Freude eine wichtige Sammlung von Fotografien aus dem Rifkrieg gekauft, die sie digitalisieren und katalogisieren sollte. In der Hoffnung, Follower anzulocken, die sich später für die von ihr zu kuratierende Ausstellung im Museum interessieren würden, hatte sie eine Menge Open-Source-Fotos von Kämpfern der Aufständischen gepostet, aber auch kurze Texte über wichtige Momente in der Geschichte der arabischen Welt und der Amazigh im frühen zwanzigsten Jahrhundert. Auch diese Artikel konnten für Menschen außerhalb ihres Berufsfelds kaum von Interesse sein.
Segura sah sie ruhig an. »Ja, Ms. Hussein. Eine akute Gefahr in Hinblick auf ein Verbrechen.«
»Aber auf welcher Grundlage?«, fragte sie. Ihr Puls ging jetzt schneller. Ihr wurde so heiß, dass sie am liebsten das Flanellhemd ausgezogen hätte. »Die Sache in Heathrow war wie gesagt ein medizinischer Notfall.«
»Die Software führt immer eine Gesamtüberprüfung unter Verwendung vieler verschiedener Quellen durch.« Er klang so stolz, als wäre er persönlich an der Sammlung der Daten beteiligt gewesen.
Sara verzog das Gesicht. Seit sie ihren Risikobericht das letzte Mal gesehen hatte, war nichts Gravierendes in ihrem Leben passiert. Sie hatte weder ihren Job verloren, noch war sie zwangsgeräumt worden, sie hatte alle finanziellen Verpflichtungen eingehalten, bezog keine Sozialleistungen, war keinen Kindesunterhalt schuldig, nahm keine Drogen, befand sich in keiner psychischen Krise – alles Umstände, die ihren Risikowert hätten steigen lassen. Und sie hatte keine Vorstrafen – war das nicht der wichtigste Faktor bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines künftigen Verbrechens? »Aber ich bin nie verhaftet worden«, sagte sie.
»Richtig, auch das steht hier«, erwiderte er, und sein Blick schoss wieder zum Monitor. Leise vor sich hinsummend wägte er die Informationen auf dem Bildschirm gegeneinander ab. Nach einer Weile wandte er sich wieder zu Sara und sagte: »Zeigen Sie mir mal Ihr Handy.«
Sara hatte zwar einmal gelesen, dass die Beamten der Zoll- und Grenzschutzbehörde berechtigt waren, an der Grenze Handys zu durchsuchen, doch bei der Vorstellung, dem Mann etwas so Persönliches auszuhändigen, empfand sie trotzdem Unbehagen. Außerdem war Segura für eine ganz andere Behörde tätig, was sie an der Rechtmäßigkeit seiner Forderung zweifeln ließ. »Wozu brauchen Sie mein Handy?«, fragte sie.
»Ich versuche nur herauszufinden, warum wir auf Sie hingewiesen wurden, Miss.«
Sein Ton machte unmissverständlich klar, dass alle Bedenken ihrerseits nur zu weiteren Verzögerungen führen würden. Sie seufzte, entsperrte ihr Handy und gab es Segura. Es war ein älteres Modell mit einem gesprungenen Display; bisher hatte sie keine Zeit gehabt, es austauschen zu lassen. Ihre Social-Media-Accounts sah sich Segura trotz seiner Fragen gar nicht erst an. Stattdessen beschäftigte er sich eingehend mit ihren Apps – drei Zeitungsabos, ein Lebensmittel-Lieferdienst, ein Babyfon, ein Thermostatsensor, ein Buchstabenspiel, ein Schlaftracker und weitere zehn oder fünfzehn, von denen sie nicht mal mehr wusste, dass sie auf ihrem Handy waren. Dann öffnete er ihre Fotomediathek und begann zu scrollen. Wenn er das lang genug machte, würde er die Zwillinge von ihrem vierzehnten Lebensmonat bis zur Geburt zu sehen bekommen, dachte Sara. Sie würden nach und nach wieder zu Säuglingen werden, so winzig und zart, dass sie nur mit Mühe trinken konnten. Noch weiter hinunter, und er würde sie schwanger sehen, ihren gewaltigen Bauch mit den Dehnungsstreifen, die sich wie Weinranken darüber zogen. Noch ein Stück weiter unten sähe er Fotos von ihr im Bikini, aufgenommen im letzten Urlaub von ihr und Elias ohne Kinder. Und noch etwas weiter unten … Warum ging er die Fotos eigentlich so lange durch?
Weil sie nicht wusste, was er suchte, und sich ziemlich sicher war, dass er es selbst nicht wusste, war das Ganze ihrem Gefühl nach so übergriffig, als würde ein Fremder durch ihr Schlafzimmerfenster spähen. Schließlich kam ihr der Verdacht, dass Segura in Wahrheit gar nicht ihr Handy überprüfte, sondern vielmehr hatte testen wollen, ob sie seine Anweisung, es ihm zu geben, befolgen würde. Hätte er es ihr negativ ausgelegt, wenn sie Nein gesagt hätte?
»Ich bin Museumsarchivarin«, sagte sie. Ihr war selbst nicht klar, warum sie ihren Beruf ins Spiel gebracht hatte. Sie hatte es instinktiv getan, aus dem Glauben heraus, dass man eine Museumsarchivarin unmöglich für eine Gesetzesbrecherin halten konnte. Irgendwo musste ein Fehler gemacht worden sein, denn in welcher Funktion hätte sie bei einer kriminellen Unternehmung eingesetzt werden können? Als Beraterin, die irgendwelchen hohen Tieren Tipps gab, wie sie ihre Akten am besten organisierten? Das war absurd! »Ich habe diese Reise schon mehrmals gemacht, und es gab nie Probleme«, sagte sie. »Warum diesmal?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Segura, reichte ihr das Handy und richtete den Blick wieder auf den Bildschirm. Es schien ihm tatsächlich ein Rätsel zu sein, warum sie in seinem Büro saß. Er schlug ihren Pass auf, blätterte darin herum. »Wer hat Sie zu mir geschickt?«
»Officer Hernandez hat mich hergebracht – Sie haben ihn ja gesehen. Aber geschickt hat mich Officer Hastings.«
»Ach, die.« Er schüttelte langsam den Kopf – wie ein alter Mönch über einen besonders eifrigen Novizen, dachte Sara. Warum zeigte er seine Enttäuschung so offen? Sara hatte das Gefühl, nichts ahnend in ein Gewirr aus Büro-Intrigen geraten zu sein. In so etwas verstrickt zu werden, war das Letzte, was sie jetzt brauchte. Segura blätterte ihren Pass noch einmal durch. Sie dachte schon, er würde ihn stempeln, weil er mit der anderen Hand nach der Schreibtischschublade griff. Genau so war es früher gewesen, als ihre Eltern zur Überprüfung beiseitegenommen wurden: ein paar Fragen, viel Ärger, und am Ende durften sie gehen. Die Erwartung, gleich entlassen zu werden, ließ ihren Magen laut knurren.
Segura lachte. »Sie haben Hunger!«
»Entschuldigung, aber ich habe seit gestern Abend nichts mehr gegessen.«
In diesem Moment betrat ein anderer Officer den Raum, ohne zu klopfen. »Hey, Segura, du sollst zu Wheeler.«
»Jetzt? Ich dachte, er wollte erst morgen entscheiden.«
»Ja, jetzt. Ich mache hier weiter.«
»Und ich kann gehen?«, fragte Sara.
Segura, der schon auf halbem Weg zur Tür war, antwortete: »Warten Sie eine Sekunde, ich bin gleich wieder da.«
AMT FÜR RISIKOBEWERTUNG
Das Amt für Risikobewertung sorgt für die Sicherheit der amerikanischen Bevölkerung. Wir identifizieren Gefahren für die öffentliche Sicherheit und ermitteln verdächtige Personen, um künftige Verbrechen zu verhindern. Unter Verwendung hoch entwickelter Datenanalysetools bewahren wir gesetzestreue Amerikaner vor Unheil und schützen zugleich ihre Privatsphäre. Unsere Grundprinzipien sind Sorgfalt, Respekt und Verantwortungsbewusstsein.
Das Morgenlicht überzieht die Glasbausteine der Bibliotheksfenster mit einem silbrigen Schein. An der Wand über dem Rückgaberegal hängt ein Schild mit der Aufschrift RUHE. Der Teppichboden dämpft Saras Schritte. Sein modriger Gestank, verbunden mit dem Geruch alten Papiers, kitzelt sie in der Nase; sie niest. »Gesundheit!«, schallt hinter ihr überlaut eine Stimme, und Sara dreht sich erschrocken um. Die Neue ist ihr gefolgt wie ein verirrtes Kind, das dem erstbesten Fremden nachläuft.
»Entschuldigung«, sagt Eisley schlagartig flüsternd. »Gesundheit. Ich wollte nur fragen, ob man von diesen Computern E-Mails verschicken kann.«
»Nein.« Die fünf Geräte hinten in der Ecke bieten den Einbehaltenen Zugang zu Nachrichten, erklärt Sara, allerdings ausschließlich zu solchen aus den fünf von Safe-X zugelassenen Quellen. »Mails kannst du nur über ein kostenpflichtiges PostPal-Konto verschicken.«
»Ach so.« Eisley hat schüttere Augenbrauen, eine platte Nase, einen kleinen Mund. Ein Gesicht wie eine leere Leinwand, ein Gesicht, von dem die meisten sagen würden, dass sie es bei einer polizeilichen Gegenüberstellung bestimmt nicht erkennen würden. Sie wirkt ungefähr so bedrohlich wie ein Fisch auf zerstoßenem Eis. »Ich möchte nämlich … Ich würde gern meinem Mann eine E-Mail schreiben.«
»Kannst du. Aber zuerst musst du ein PostPal-Konto anlegen.«
»Ist das teuer?«
»Vierhundert Dollar für zwei Monate.«
»Ich bin aber nur drei Wochen hier.«
»So funktioniert nun mal das Abrechnungssystem von PostPal. Und die Mails kannst du nur auf einem Tablet lesen, das du dir von ihnen leihen musst. Sobald du das Konto eröffnet hast, wird dir alles erklärt.«
Eisley betrachtet die holzgetäfelte Buchausgabe, die drei Lesetische, das Magazin mit den Regalen, in denen alte Bücher stehen – manche mit Klebeband zusammengehalten, andere ohne Einband oder mit fehlenden Seiten. »Muss man fürs Bücherlesen auch bezahlen?«
»Nein.« Die Bücher stammen von einer gemeinnützigen Organisation in Minnesota, die sich dafür engagiert, dass in den Zentren für Verbrechensvorbeugung überall im Land mehr gelesen wird. Sie kauft ganze Bestände aus Schulen und Colleges auf, die geschlossen wurden – Bücher, die eigentlich eingestampft werden sollen –, und verteilt sie kostenlos an Einbehaltungszentren. Der Bestand im Madison ist zwar klein – nur tausendfünfhundert Titel –, aber als einzige öffentliche Quelle trotzdem überaus wertvoll. »Das ist umsonst.«
Ein weiterer Computerplatz wird besetzt.
»PostPal ist gleich dahinten im Gang, auf der rechten Seite.«
Endlich trollt sich Eisley.
Sara erwischt den letzten noch freien Computer. Sie lässt sich gern Zeit und liest die überregionalen Blätter gründlicher als vor ihrer Einbehaltung. Sie hatte mit den Zwillingen so viel Arbeit, dass mehr als ein Blick auf die Schlagzeilen auf dem Weg zur Arbeit nicht drin war. An diesem Morgen beherrscht die Meldung eines Korruptionsskandals die Titelseite der Los Angeles Times, in den ein neunmal wiedergewählter Kongressabgeordneter aus Arizona verwickelt ist. Außerdem berichtet die erste Seite über Waldbrände in Oregon, Überschwemmungen in Texas und einen Blizzard in Ohio. Alles nicht wahnsinnig neu. Doch weiter unten entdeckt sie einen Artikel über die Pläne von OmniCloud, eine Firma für Bildungstechnologie zu kaufen, deren Software in Kindergärten und Schulen im ganzen Land eingesetzt wird. OmniCloud möchte die Daten gewinnen, um seine Kunden bei der Einstellung von Arbeitnehmern zu unterstützen, deren Lebensgeschichten möglichst gut zu den offenen Stellen passen – beziehungsweise diejenigen loszuwerden, die für die Posten, die sie bereits haben, nicht ideal sind.
OmniCloud wächst in erstaunlichem Tempo. Der einzige ernstzunehmende Konkurrent ist der chinesische Mischkonzern, den einige Senatoren gern verbieten würden. OmniCloud ist immer hungrig, es funktioniert nur, indem es sich ständig selbst füttert. Nicht zum ersten Mal fühlt sie sich an die verstaubten kolonialen Volkszählungen erinnert, mit denen sie sich beschäftigt hat, als sie in Berkeley ihre Dissertation schrieb. Jede Ausgabe im Regal war dicker als die vorherige. Die frühesten Zählungen betrafen die Bewohner diverser Gebiete des British Empire, doch im Lauf der Zeit entwickelten sich die Bände mit ihren aufgelisteten Angaben über Alter, Beruf, Familienstand bis hin zu den sogenannten Gebrechen der Menschen zu einem riesigen Schatz an Informationen über koloniale Themen. Wenn Sara in Erfahrung bringen wollte, wie viele körperlich gesunde männliche Arbeiter es 1930 in Gambia gab, musste sie nur die richtige Tabelle finden.
Jetzt ist sie an der Reihe. Jetzt findet sie – einen digitalen Schritt nach dem anderen – Eingang in die Erhebung, indem sie Spuren hinterlässt, die sie nie hinterlassen wollte. Wenn ihre Kinder einmal alt genug sind, wird man auch sie zu Zeilen in OmniClouds gigantischer Datenbank machen, wird jeden Aspekt ihres Verhaltens auflisten, quantifizieren und zu Zwecken verkaufen, die sie sich heute kaum vorstellen kann. Ein starker Beschützerinstinkt packt sie. Sie muss hier raus. Sie muss ihre Kinder vor dem einen Auge und den zahllosen Fangarmen von OmniCloud schützen – nur wie?