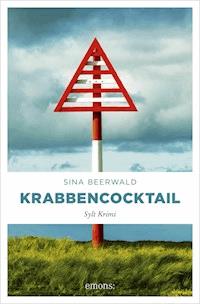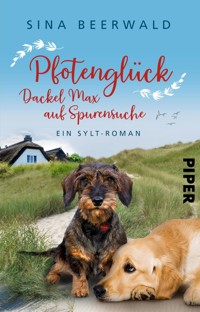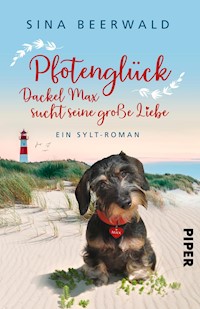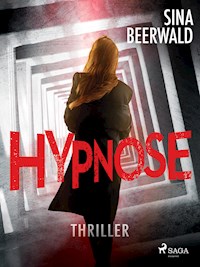9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Sylt-Saga
- Sprache: Deutsch
Urlaub vom Alltag auf der Insel Sylt: Willkommen in Moikens Strand-Café und im Berlin der glanzvollen 20er Jahre! Endlich ist der erste Weltkrieg vorbei und Moiken steht vor einem scheinbar unüberwindbaren Berg an Aufgaben. Gelingt es ihr trotz wirtschaftlich schwieriger Verhältnisse und unter dem Argwohn der Männer, das Hotel "Strandvilla" und ihr Café im Dünenpavillon auf Sylt wieder im alten Glanz erstrahlen zu lassen? Ihre süßen Kreationen jedenfalls sind legendär, ein illustres Publikum genießt das Seebad und Moiken setzt alles daran, die Gäste in ihrem Dünencafé mit Törtchen und Pralinen zu verwöhnen. Mitten hinein platzt die Nachricht, dass der Hindenburgdamm gebaut werden soll. Teufelswerk für die Gegner, doch die Befürworter, zu denen auch Moiken gehört, versprechen sich großen wirtschaftlichen Aufschwung. Freunde werden zu Feinden und die Insel spaltet sich in zwei Lager. Zu Moikens Überraschung steht plötzlich der charismatische Wasserbauingenieur Adam von Baudissin wieder vor ihr. An ein Wiedersehen hatte sie nicht geglaubt. Moiken könnte glücklich sein – wären da nicht noch die Gefühle für ihre unerfüllte große Liebe Boy Lassen, und die Sorge um ihre Tochter Emma, die die Insel verlassen hat und zu Boy nach Berlin gegangen ist. Schließlich macht Moiken sich selbst auf den Weg ins brodelnde Berlin, und versucht ihre Tochter zur Rückkehr nach Sylt zu bewegen. In Sina Beerwalds Insel-Roman »Das Dünencafé« gibt es ein Wiedersehen mit einigen liebgewonnenen Figuren, die im Roman »Die Strandvilla« auf Sylt um ihre Träume gekämpft haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sina Beerwald
Das Dünencafe
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Moiken Jacobsen hat harte Zeiten hinter sich, als 1923 ihr Hotel Strandvilla und ihr Café im Dünenpavillon endlich wieder in altem Glanz erstrahlen. Ihre süßen Kreationen sind mittlerweile legendär, und Moiken könnte glücklich sein – wäre da nicht die Sorge um ihre Tochter Emma, die mit ihrem Vater, Moikens großer Liebe Boy Lassen, nach Berlin gegangen ist. Denn Emmas Briefe sind über den Winter immer seltener geworden, und Moiken weiß um die große Not, die die steigende Inflation in den Städten ausgelöst hat. Schließlich macht Moiken sich selbst auf den Weg in die brodelnde Hauptstadt, um Emma zu suchen.
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
2. Buch
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
3. Buch
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
4. Buch
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
5. Buch
Kapitel 19
Kapitel 20
6. Buch
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
7. Buch
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
8. Buch
Kapitel 28
Kapitel 29
9. Buch
Kapitel 30
Kapitel 31
Nachwort
Danksagung
Rezept
Für Lauris
1. Buch
Kapitel 1
Es war ein milder Tag, viel zu warm für Ende November, denn die Sonne schien nach Kräften, als wollte sie die Menschen aus ihren Häusern locken und sagen: Kommt heraus, es ist vorüber.
Moiken stand auf der Promenade, hinter ihr die Strandvilla auf der hohen Düne, und sie schaute hinaus aufs Meer. Die Sonnenstrahlen wärmten ihr Gesicht, und sie roch die würzige Seeluft. Der Seewind war zwar kühl, aber in der Mittagssonne und mit dem Blick auf die Weite der Nordsee keimte ein lange nicht mehr empfundenes Gefühl in ihr auf: Sie spürte wieder leise Hoffnung.
Die schweren Tage des Winters standen ihnen zwar noch bevor, doch der Krieg – er war tatsächlich seit rund zwei Wochen beendet. Am 11. November war das Waffenstillstandsabkommen in einem Eisenbahnwaggon im Wald von Compiègne unterzeichnet worden. Noch glich Sylt einer Festung. Sehnsüchtig warteten sie alle auf die erlösende Nachricht, dass das Verlassen und Betreten der Insel wieder ungehindert erlaubt waren.
Die Nordsee glitzerte in der Sonne, als wollte sie zum Baden einladen, im leichten Wind rollten die Wellen sanft am goldgelben Strand aus. Möwen segelten auf der Suche nach Beute über das Meer dahin, manch eine fasste in Sekundenbruchteilen den Entschluss, sich in die Tiefe zu stürzen – meist erfolglos.
Ihre kleine Tochter spielte nahe der Brandung am Strand.
Viel zu nah.
»Du sollst nicht so dicht ans Wasser gehen, Frieda!«, rief Moiken in den Wind. Aus dem kleinen Sorgenkind Frieda war ein hübsches viereinhalbjähriges Mädchen geworden, immer noch ein wenig zu dünn, aber ein Sonnenschein und charakterlich das Gegenteil ihrer bereits erwachsenen Halbschwester Emma.
»Ja, Mutter! Aber sieh doch! Sieh mal, was ich gefunden habe! Der sieht so anders aus als alle anderen Steine. Da wird sich meine Elva freuen!« Frieda kam angelaufen und präsentierte ihr mit hochroten Wangen einen kleinen rotbraunen Stein, wie eine Trophäe, einen Schatz, den es zu hüten galt.
»Du hast tatsächlich einen Bernstein gefunden!«, entfuhr es Moiken. Wie oft hatte sie schon nach stürmischen Tagen vergeblich am Flutsaum danach gesucht.
»Was ist Bernstein?«, fragte ihre Tochter und zog das Näschen kraus.
»Das ist ein wertvoller Schmuckstein, der viele Millionen Jahre alt ist, also sehr, sehr alt. Wenn man ihn schleift, wird er noch schöner. Das können wir gleich zu Hause machen, vielleicht kommt dabei noch ein Einschluss zum Vorschein, ein Pflanzenteil oder ein winziges Tier zum Beispiel.«
»Au ja, das machen wir – aber ich will heute auch noch baden gehen!«
Moiken schüttelte lächelnd den Kopf. So übermütig kannte sie ihre Tochter gar nicht. Erst in den vergangenen beiden Wochen seit Kriegsende hatte Frieda die Strandvilla und ihre nähere Umgebung, insbesondere den Strand, als Spielplatz für sich entdeckt. In Zeiten des Krieges hatte Frieda am liebsten unter dem Schreibtisch selbstvergessen mit ihrer Puppe Elva gespielt und sich in der Nähe ihrer Mutter am wohlsten gefühlt.
»Mein Schatz, das Meer ist doch viel zu kalt um diese Jahreszeit, außerdem kannst du gar nicht schwimmen!«, tadelte sie ihre Tochter besorgt und strich ihr die windzerzausten blonden Haare hinter die Ohren, die sich aus den beiden langen Zöpfen gelöst hatten.
Diese enttäuschte Miene war Theodor wie aus dem Gesicht geschnitten, dachte Moiken wehmütig. Mit ihrem Vater hätte sich Frieda sicherlich gut verstanden, und sie wäre sein ganzer Stolz. Doch er hatte sich zu Beginn des Krieges anders entschieden und seinem Leben im Meer ein Ende gesetzt.
Die genauen Umstände kannte Frieda noch nicht, doch sie wusste, dass ihr Vater in den Himmel gegangen war, als sie gerade ein paar Wochen alt gewesen war.
Wann es wohl an der Zeit war, ihr zu erklären, dass ihr Vater freiwillig aus dem Leben geschieden war? Jedenfalls musste sie ihrer Tochter deutlich die Gefahren des Meeres erklären, ohne ihr Angst zu machen. Es behagte ihr nicht, dass sich Frieda vom Meer neuerdings so angezogen fühlte.
Moiken nahm Friedas kleine, erstaunlich warme Hand in ihre, und sie gingen die Promenade entlang und weiter in Richtung des achteckigen Pavillons am Ende des hölzernen Wegs.
Mit ihrer geliebten Tochter an der Hand, das Knirschen des Sandes auf den Holzplanken unter ihren Schuhen, wehten ihre traurigen Gedanken davon.
Sie nahm einen tiefen Atemzug.
Ja, es war Zeit, nach vorn zu sehen.
Der Krieg war vorbei, das musste sie sich immer wieder sagen, weil sie es noch kaum glauben konnte.
Eine sanfte Welle des Glücks durchströmte sie und rollte auf ihren Lippen zu einem Summen aus.
Die Töne formten sich zu einer Melodie, die sie schon lange nicht mehr angestimmt hatte, ein Lied, das sie zuletzt vor Kriegsbeginn mit Sehnsucht auf das Frühjahr gesungen hatte. »Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün …«
Nach einem Moment des Zuhörens stimmte Frieda in die Melodie mit ein – noch etwas unbeholfen, aber sie zauberte ihr ein Lächeln aufs Gesicht und sie hielt die Hand ihrer Tochter noch fester umschlossen.
Mit der ersten Strophe glitt Moikens Blick zum Pavillon am Ende der hölzernen Promenade: das Dünencafé.
Ihr Café, ihr Lebenstraum, den sie sich gegen den Willen ihres Ehemanns erfüllt hatte. Ihr hölzerner, achteckiger Pavillon, den sie in ein Kleinod verwandelt hatte. Ihre Gäste, denen sie selbst kreierte Pralinen und Törtchen zum Kaffee serviert hatte.
Ihr wahr gewordener Traum, vom Krieg zerstört.
Die Eröffnung ihres Cafés war gerade vier Wochen her gewesen, als die Nachricht wie eine Bombe in die sommerliche Strandidylle geplatzt war: Krieg! Der allgemeine Mobilmachungsbefehl. Das Seebad musste innerhalb von drei Tagen geschlossen werden, Sylt wurde zur Festung erklärt.
Offiziere und Soldaten zogen in die Strandvilla ein und bestimmten diese zu ihrem Eigentum, in dem sie hausten, als gäbe es kein Morgen mehr. Gleiches galt für ihr Dünencafé, dessen Fassade recht unbeschadet geblieben, das im Inneren jedoch verwüstet worden war. Zwar hatte man im Hotel Reichshof extra ein Soldatenheim eingerichtet, doch das war natürlich uninteressant für ausschweifende Gelage, weil es von den Befehlshabern kontrolliert wurde.
Die Beschlagnahmung der Strandvilla, Offiziere, die ihrem zweiten Ehemann Theodor von Lengenfeldt das Lebenswerk nahmen, Soldaten, die es besetzten – das war für Theodor unerträglich gewesen, und zusammen mit seiner hohen Verschuldung, die er sich selbst zuschreiben musste, hatte er keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als für immer ins Meer hinauszugehen.
Hinterlassen hatte er ihr neben einem Abschiedsbrief und ihrer gemeinsamen Tochter Frieda ihre größte Aufgabe: die Strandvilla.
Die Höhe ihrer Schulden war bedrückend, und sie wagte nicht, sich auszurechnen, wie viele Jahre das Hotel gut ausgelastet sein müsste, bis sie abbezahlt wären. Da half auch nicht die Aussicht auf eine staatlich gewährte Unterstützung, als Kriegsentschädigung in Form eines Hypothekendarlehens. Überhaupt – wenn ihr jemand vor sechs Jahren gesagt hätte, als sie noch in vollkommen bescheidenen Verhältnissen in Keitum gelebt hatte, dass sie eines Tages Hotelbesitzerin und Inhaberin eines Strandcafés sein würde …
Immerhin, seit Kriegsende hatten sich schon erstaunlich viele Stammgäste angemeldet, angetrieben von der Erinnerung an schöne Zeiten, die man sich zurückerobern wollte.
Es versprach ein glanzvoller Sommer zu werden.
Frieda zog unsanft an Moikens Hand. »Mutter, ich will nicht mehr weitergehen. Ich möchte Elva den Stein zeigen!«, quengelte sie.
Moiken blieb ihr die Antwort schuldig. Stattdessen schweifte ihr Blick über das Meer und die Dünen. Der Wind, der von der Nordsee auf die Insel traf, frischte spürbar auf.
Noch einmal atmete sie tief durch.
»Ja, lass uns zurückgehen. Es wird jetzt doch etwas kühl.«
Die Erinnerungen an den Krieg holten sie immer wieder ein, und sie war sich nicht sicher, ob diese bis zum Beginn der Saison so weit verblasst sein würden, dass sie die sehnlich erwarteten Sommerfrischler unbeschwert begrüßen konnte.
Zwar war die Insel von Angriffen verschont geblieben, doch am 9. August 1915 – dieses Datum hatte sich in ihr Gedächtnis eingebrannt, obwohl es nebensächlich war – waren fünf englische Panzerkreuzer vor der Insel aufgetaucht. Sofort wurde Alarm gegeben. Ihre Nerven lagen blank, doch die Schiffe entfernten sich wieder.
Dann aber, mitten im Krieg, am 16. Februar 1916, geschah das Unvorhergesehene. Dieses Datum, dachte Moiken schaudernd, würde sie erst recht nie mehr vergessen, denn es war zu ihrem zweiten Geburtstag geworden.
Kein feindlicher Angriff, jedenfalls nicht direkt. Es war der Sturm, der über die Insel raste, wie sie ihn seit 1911 nicht mehr erlebt hatten. Die tosenden Nordseewellen brachen sich am Fuß der Düne, auf der die Strandvilla stand, überspülten die Promenade und reichten bis nahe an den Pavillon heran … an ihr Café, das den Soldaten als Raum für die wilden Gelage diente. Doch nun drohte der achteckige Holzbau ein Opfer der Fluten zu werden.
Umtobt vom Blanken Hans schleppte sie Sandsäcke heran und bangte um ihren Lebenstraum, doch niemand rechnete mit der Gefahr, die das Meer zudem in sich barg: Eine Seemine wurde von der Kraft der Wellen in Sichtweite auf die Strandmauer geschleudert. Das entstandene Loch war so groß, dass drei Männer bequem darin Platz fanden.
Das Dünencafé trug nur leichte Schäden durch umherfliegende Steine davon und sie keine ernsthaften Verletzungen, dafür jedoch den Schock ihres Lebens.
Bis zum Sommer hatte sie sich noch nicht von diesem Schreck erholt, als ein dumpfes Grollen am Abend des 1. Juni 1916 zwischen halb acht und halb zehn ihre Nerven erzittern ließ. Im Norden tobte vor der dänischen Küste die Skagerrakschlacht, bei der die Schlachtkreuzergeschwader der Briten und Deutschen mit rund 250 Schiffen beider Flotten aufeinandertrafen. Unfassbar, wie weit die schweren Geschütze zu hören gewesen waren.
In jener Nacht hatte sie schlecht geschlafen, denn die Gefechte, von denen sie ansonsten nur in der Zeitung gelesen hatte, waren plötzlich erschreckend nah gekommen. So nah, dass einige tote Seeleute dieser Schlacht zwei Wochen später entlang der Westküste antrieben und einer direkt vor ihrem Hotel vom Meer an den Strand geworfen wurde. Den grauenvollen Anblick des aufgetriebenen, leblosen Körpers würde sie nie mehr vergessen.
»Mutter! Lass uns nach Hause gehen«, insistierte Frieda und holte sie, die mit verhangenem Blick auf die Nordsee schaute, in die Gegenwart zurück. Erneut zog Frieda sie unsanft am Arm. »Mutter!«
»Verzeih, mein Schatz. Ich war mit meinen Gedanken weit draußen auf dem Meer«, antwortete Moiken und setzte sich erneut in Bewegung.
»Jaja, das sagst du immer. Mir ist ganz kalt, und ich habe Hunger.«
»Entschuldige, dann lass uns jetzt wirklich schnell zurückgehen.«
Frieda tippelte an der Hand neben ihr her.
Ja, der Hunger. Aufgrund der Einquartierung der Soldaten hatte es im Hotel einigermaßen ausreichend Nahrungsmittel gegeben, denn für die Verpflegung eines Mannes, gleich welchen militärischen Ranges, hatte sie eine Mark zwanzig erhalten. Die Verpflegungsportion hatte nebst Brot aus 250 Gramm Fleisch und 60 Gramm Rindernierenfett zu bestehen, lieber sahen die Männer jedoch 200 Gramm Speck und 25 Gramm Butter. Kaffee war mit täglich 15 Gramm gebrannten Bohnen ein rares Gut. Heidekraut diente als Ersatz für Brennkohle, das Sylter Intelligenzblatt warb für den Konsum von Miesmuscheln, die sich im Watt sammeln ließen, Strand-Wegerich und Queller aus den Salzwiesen dienten als Gemüseersatz, außerdem trugen die eigene Stromversorgung per Windrad und der Brunnen im Hof dazu bei, dass die Lebensumstände in der Strandvilla halbwegs erträglich blieben – jedenfalls, was das Essen anbetraf.
Der Alkohol war Fluch und Segen zugleich gewesen, denn er war die Währung, in der sie während des Krieges und auch heute noch bezahlte.
Theodor hatte ihr einen Weinkeller hinterlassen, dessen Ausmaße sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht ausgemalt hätte und den sie nach dem Tod ihres Mannes erstmals gesehen hatte.
Rund eine Viertelmillion Flaschen lagerten unter der Düne, erlesene Sorten aus aller Welt, die Theodor während der Jahrzehnte als Hotelier gesammelt hatte. Sein heiliges Reich. Was an Flaschen im offiziellen Keller lagerte, den die Bediensteten betreten durften, war nur ein Bruchteil der Schätze gewesen.
Da nutzte es auch nichts, dass Oberst von Rohde per schriftlicher Bekanntmachung auf das Strengste verboten hatte, alkoholhaltige Getränke in solchem Maße an Personen des Soldatenstands abzugeben, vom Feldwebel abwärts, dass deren dienstliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigt würde – denn es herrschte Selbstbedienung.
Solange der Alkohol in Strömen geflossen war, waren die Soldaten bei guter Laune gewesen und hatten auch die Frauen in Ruhe gelassen.
Meist.
Doch was unter dem Deckmantel eines Symphoniekonzerts des Kommandantur-Orchesters, organisiert von Unteroffizier Donker, im Foyer der Strandvilla an einem Abend sittsam und beschaulich begonnen hatte, um die schweren Gedanken an den Ausgang des Krieges auf kraftvollen Melodien davonzuspülen, hatte in einem ausufernden Besäufnis geendet – und mehr.
Dunkle Bilder überrollten Moiken wie eine mächtige Welle, drohten sie von den Füßen zu reißen.
Ihre Schritte wurden langsamer, intuitiv hielt sie Frieda fester an der Hand, so als ob die Erinnerungen an die dunkle Zeit ihr ihre Tochter entreißen könnten.
»Aua, Mutter! Du tust mir weh!«, protestierte ihre kleine Tochter, die zum Glück nicht viel vom Krieg verstanden hatte und für die die Einquartierung der Soldaten so etwas wie ein großes Spiel gewesen war, weil sie die Männer nie betrunken erlebt hatte. Nüchtern waren sie sehr freundlich gewesen.
Erschrocken erkannte Moiken, dass sie von den düsteren Bildern aus der Vergangenheit eingeholt worden war, und lockerte ihren Griff.
Der Krieg war vorbei. Das musste sie sich immer wieder sagen.
Sie zwang sich zu einer aufrechten Haltung, brachte wieder Spannung in ihren dünnen Körper, der in einem viel zu weiten blauen Kleid mit aufgesetzten Taschen steckte, und sang erneut das Frühlingslied, dieses Mal lauter. »Wie möcht’ ich doch so gerne ein Veilchen wieder seh’n! Ach, lieber Mai, wie gerne einmal spazieren geh’n! Komm, lieber Mai …«
Im Foyer der Strandvilla sah es fast schon wieder aus wie früher, eigentlich fehlten nur noch die Pflanzen. Der bodenlange Spiegel an der Wand neben der Tür zum Speisesaal war gestern ersetzt worden, und eines der Zimmermädchen war dabei, das Glas auf Hochglanz zu polieren. Auch der Marmorboden erstrahlte in Erwartung neuer Gäste, das Telefonkabinett neben dem Empfangstresen und der Aufzug aus dem Hause Flor, Theodors ganzer Stolz, funktionierten. Die Sitzmöbel im Foyer waren nicht zu retten gewesen und durch gebrauchte, aber sehr gut erhaltene, gemütliche Ohrensessel ersetzt worden.
»Leopold! Sieh mal, was ich habe!«, rief Frieda aus, als sie sich dem alten Portier hinter seinem Empfangstresen näherten.
Der treue Leopold, dachte Moiken mit einem liebevollen Lächeln.
»Willkommen zurück, gnädiges Fräulein! Gnädige Frau …«, begrüßte der Portier sie mit seinem wienerischen Charme, als seien sie die ersten Gäste, die zur Sommerfrische eintreffen würden.
»Ach Leopold, nennen Sie mich bitte nicht immer gnädige Frau.« Ein immergleicher Dialog – denn so sehr, wie er die Höflichkeit schätze, so fremd blieb ihr diese Anrede.
Seit vier Jahrzehnten war Leopold die gute Seele des Hauses, sein Alter von fast siebzig Jahren war ihm aufgrund seiner schlohweißen Haare mittlerweile anzusehen, doch sein Elan war ungebrochen.
Die Frage, wann er sich denn zur Ruhe setzen wolle, war für ihn eine persönliche Beleidigung.
Wie ein Kutscher hielt er die Zügel geschickt in der Hand, er wusste über alle Vorgänge in der Strandvilla Bescheid und behielt auch jetzt den Überblick über den Stand der Renovierungsarbeiten.
»Verzeihen Sie, gnädige Frau, aber das werde ich mir wohl nicht mehr beibringen können. Der Mensch hat eben seine Gewohnheiten. Sie gehen doch auch lieber die ausgetretene Stiege hinunter, als den Selbstfahrer zu benutzen.« Er deutete zum Aufzug hinüber, den das Militär tatsächlich als eins der wenigen Dinge schadlos hinterlassen hatte.
Gewohnheiten – mit das Wichtigste in Kriegszeiten, und niemals hätte Moiken geglaubt, dass sie sich auch an schreckliche Dinge gewöhnen könnte.
Offenkundig war er gerade dabei, einige Karten, auf denen die Eigenheiten, Vorlieben und besondere Wünsche eines jeden Gastes vermerkt waren, aus dem Karteikasten zu ziehen.
Ja, er hatte die Militärangehörigen wie Gäste behandelt und sich dabei nie anmerken lassen, wie schwer ihm das gefallen war. Mit seiner Art hatte er selbst die Cholerischen unter ihnen im Handumdrehen zur Ruhe gebracht, zudem hatte sich Leopolds Respekt den Soldaten gegenüber auf deren Benehmen übertragen und – zumindest manchmal – die Strandvilla vor manch zusätzlichem Schaden bewahrt.
Karteikarten entfernte er sonst nur, wenn es zugleich einen Kondolenzbrief zu verfassen galt. Offenkundig wollte er nun die Kriegszeit begraben und keinen dieser Herrschaften je wieder in der Strandvilla sehen.
»Was hast du denn da, gnädiges Fräulein? Oh, einen Bernstein! Das ist aber ein ganz besonderer Fund! Du bist eben ein Glückskind«, fügte er lächelnd hinzu.
»Den will ich gleich meiner Elva zeigen!«, erwiderte Frieda stolz.
»Dann sollte das gnädige Fräulein, wenn es die Frau Mutter denn gestattet, so schnell wie möglich zur Elva gehen und danach bei meiner Frau Wilma in der Küche vorbeisehen – sie hat einen kleinen Imbiss vorbereitet. Ich nehme an, das gnädige Fräulein hat Hunger«, hofierte Leopold die kleine Frieda, die sich geschmeichelt und sichtlich wie eine Prinzessin fühlte.
»Darf ich gehen, Mutter, ja? Darf ich?«, sprudelte es aus ihr heraus.
»Ja, geh nur. Aber vergiss nicht, Wilma ein Dankeschön zu …«, antwortete Moiken, doch da war ihre Tochter schon losgelaufen und verschwand über die Stufen des Foyers zu ihrem Zimmer.
Moiken sah ihr amüsiert hinterher. Frieda genoss es sichtlich, sich endlich frei im Hotel bewegen zu dürfen, und doch war sie im Kern ein ruhiges und besonnenes Wesen, bei dem man keine Dummheiten befürchten musste und das man trotz seiner jungen Jahre nicht an ein Dankeschön erinnern musste. Im Gegensatz zu ihrer großen Schwester war Frieda wirklich pflegeleicht.
Ohne ein persönliches Wort des Abschieds war Emma vor Kriegsausbruch ihrem Vater Boy nach Berlin gefolgt, während sie, Moiken, im Sommer 1914 mit ihrer kleinen Tochter Frieda, einem schwachen Säugling unter Tuberkuloseverdacht, in der Strandvilla ausharrte und dem plötzlichen Hereinbrechen des Krieges hatte zusehen müssen – zum zweiten Mal in ihrem Leben zur Witwe geworden.
Während des Krieges hatte Leopolds Frau Wilma als Küchenvorsteherin eisern über die Vorräte gewacht und als zweite gute Seele des Hauses aus dem Wenigen stets ein köstliches Essen gezaubert, doch mit Kriegsende war Wilma plötzlich erkrankt. Über zwei Wochen hinweg hatte sie unerklärliches Fieber gehabt, so als hätte sie mit letzten Kräften nur auf den Tag gewartet, an dem die Soldaten abgezogen waren.
»Geht es Wilma denn besser?«
»Ja, das Fieber ist weg, endlich! Sie hat sich erholt und ist wieder voller Tatendrang. Vom Krankheitausbrüten hatte sie die Nase voll, viel lieber brütet sie jetzt wieder über den Vorratslisten.«
Moiken lachte. »War die Post schon da?« Wie wohltuend diese Frage doch war. Sie bedeutete Alltag, Gewohnheit und vielleicht mal wieder gute Nachrichten. Vielleicht war ja endlich ein Brief aus Berlin dabei, setzte sie stumm hinzu. Dort hatten sich Boy und ihre mittlerweile zwanzigjährige Tochter ein gut gehendes Fotoatelier aufgebaut.
Boy, der Strandfotograf, der ihr einst mit sandigen Lippen den ersten Kuss geraubt, der ihr Leben nach einem Wiedersehen auf den Kopf gestellt und mit dessen Auftauchen Emma nach vierzehn Jahren ihren wahren Vater kennengelernt hatte.
»Ja, der Briefbote war hier, aber der Zeitungsjunge noch nicht. Seitdem wir unseren Matthis als Pagen eingestellt haben, haben wir zugleich einen pünktlichen und zuverlässigen Zusteller verloren.«
»Man kann eben nicht alles haben«, entgegnete Moiken belustigt, denn sie war froh um die Entscheidung, diesen fleißigen und zuverlässigen Jungen eingestellt zu haben, nachdem er die Schule beendet hatte. Im Vergleich zu einem Zeitungsjungen bot ihm die Stellung als Page ein viel besseres Auskommen, denn der dreizehnjährige Bursche war unterdessen Halbwaise geworden und musste seinem Vater helfen, die sechs jüngeren Geschwister zu versorgen.
»Wo ist Matthis?«, fragte Moiken. »Ich brauche ihn gleich noch für einen Botengang zur Druckerei.«
Leopold hob fragend die Schultern, eine hilflose Geste, die man selten an ihm bemerkte. »Bestimmt hilft er irgendwem, aber dieser Bursche ist wie ein junger Feldhase, er ist der Einzige, den ich in diesem Haus aus dem Blick verliere. Er macht wirklich zuverlässig seine Arbeit, gnädige Frau, ist aber einfach noch nicht daran gewöhnt, mir Meldung zu machen, was er gerade tut. Vielleicht hilft er in der Küche mit den schweren Töpfen, weil meine Frau sich ja noch nicht so anstrengen soll, ich gehe mal nachsehen …«
»Keine Eile«, bremste ihn Moiken. »Wenn Sie ihn wieder zu Gesicht bekommen, richten Sie ihm einfach aus, er solle sich bei mir für einen Botengang melden.«
»Sehr wohl. Dann bittschön, hier ist die Post, gnädige Frau.«
Wie immer hatte er alle Briefe ohne den Vermerk »vertraulich« bereits geöffnet und sortiert. Moiken blätterte die Seiten durch.
Erfreulicherweise gleich drei Schreiben von Stammgästen, die sich für die kommende Saison anmelden wollten, des Weiteren Geschäftsanzeigen mit den geplanten Daten der Wiedereröffnung diverser Hotels und leider auch ein offizielles Schreiben der Badeverwaltung, dass das Kurhaus zur kommenden Saison noch nicht wieder öffnen könne, die Schäden darin seien immens, und es könne aus finanziellen Gründen nicht vor Ablauf eines Jahres instandgesetzt werden. Zuletzt lagen noch zwei Einladungen zum Tee in benachbarte Hotels im Stapel.
Sie hielt sie Leopold entgegen. »Wie viele solcher Art habe ich mittlerweile bekommen? Zehn oder fünfzehn? Wenn ich die alle annehme, komme ich selbst nicht mehr mit der Renovierung voran, das könnte der Konkurrenz so passen.«
Natürlich wollte jeder vom anderen wissen, wie viel Schaden man erlitten hatte, und auf freundliche Art aushorchen, welchen Standard man seinen Gästen in der ersten Saison nach dem Krieg zu bieten beabsichtige. Hierbei war die Strandvilla als erstes Hotel am Platze das Maß der Dinge für die anderen Hoteliers, noch vor dem Nachbarhotel Miramar.
»Wollen Sie nicht vielleicht die eine oder andere Einladung annehmen?«, fragte Leopold vorsichtig.
»Wozu?«, entgegnete Moiken. »Ich werde von den Herren Hoteliers ohnehin nicht ernst genommen. Hugo Hast vom Hotel zum Deutschen Kaiser, Eduard Wulff Junior vom Grand Hotel, Georg Busse vom Miramar – als Theodor noch lebte, habe ich sie alle kennengelernt. Vordergründig sind sie freundlich zu mir, aber keiner traut mir die Leitung des Hotels zu.« Mit dem Blick senkte sie auch die Stimme. »Vielleicht behalten sie damit sogar recht, aber ich will alles dafür tun, die Strandvilla wieder zum Leben zu erwecken.«
»Ich bin zur Stelle!«, sagte Leopold, und sein Lächeln gab ihr Kraft, ihre inneren Zweifel, die sie trotz aller Zuversicht plagten, wenigstens für den Moment beiseitezuschieben.
Außerdem war da noch eine andere Sorge: »Aus Berlin war kein Brief dabei?«, fragte sie, während sie den Stapel noch einmal durchging.
»Nein, leider nicht«, bedauerte Leopold. Traurig blickte er sie mit seinen Knopfaugen an.
Moiken wusste nicht, was sie entgegnen sollte, und erst recht nicht, wohin mit ihrer Enttäuschung. Unbeholfen steckte sie die Hände in die Taschen ihres blauen Leinenkleids.
Dort fühlte sie die Reste einer ehemals sechs Punkte umfassenden Liste des Obersts und Inselkommandanten Müller, wie man sich bei Fliegerangriffen zu verhalten habe. Jahrelang hatte dieses Papier sie begleitet, genau wie die tägliche Angst vor Angriffen.
Bevor sie heute mit Frieda zum Spaziergang aufgebrochen war, hatte sie die Liste vernichtet – zerrissen und zerrupft –, bis nur noch ein Haufen Fetzen vor ihr gelegen hatte. Eigentlich wollte sie diese der Nordsee übergeben.
Sie legte die Fetzen stumm auf den Tresen, wo Leopold sie wissend einsammelte und in den Papierkorb warf.
»Wie geht es unserem Herrn Frohmann?«, fragte sie, um ein Thema aufzugreifen, mit dem sie wieder zur Sprache fand.
Wilhelm Frohmann war im Moment der einzige Gast im Haus, ein Sylter und alter Freund von Theodor, der mit einer Schussverletzung aus dem Krieg heimgekehrt war und dabei erfahren musste, dass Frau und Kind an einer Lungenentzündung verstorben waren. Da er sonst keine Verwandtschaft auf der Insel hatte, die sich um ihn kümmern könnte, hatte er bis zu seiner Genesung um Kost und Logis bei seinem Freund in der Strandvilla gebeten, denn von der Versorgung abgesehen, hielt er es nicht allein in seinem Haus aus. Leider musste Moiken ihm mitteilen, dass sein guter Freund Theodor ebenfalls verstorben war.
»Ich weiß nicht so recht. Frühstücken wollte er nichts. Er hat mir aber versprochen, von der Milchsuppe heute Mittag zu essen. Die Hauptspeise, Brathering mit Kartoffeln, hat er abgelehnt. Er war freundlich, aber kaum zum Reden zu bewegen. Ich hab ihn wieder mit seinen Krücken im Sessel sitzend vorgefunden, den Blick aufs Meer gewandt.«
»So ist es jeden Tag«, sagte Moiken. Sie kannte den Anblick des ehemaligen Offiziers, wie er dort saß, während seine Lippen Gedichtzeilen formten, die er in einem unendlichen Fluss zu Papier brachte.
»Vielleicht hat er ja Hunger, aber kann sich die Kost zur Logis nicht auch noch leisten?«, wandte Leopold vorsichtig ein.
»Ich berechne ihm nichts, weder für Kost noch für Logis. Das bringe ich nicht übers Herz, und davon geht die Strandvilla auch nicht unter. Außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass alles Gute irgendwann zurückkommt.« Bevor der Mann in den Krieg ziehen musste, hatte er Theaterstücke geschrieben, die es bis auf die großen Hamburger Bühnen geschafft hatten, wo er zugleich Regie geführt hatte. Kleinere Lustspiele waren auch in der Strandvilla aufgeführt worden. Damit hatte er nie viel Geld verdient, aber es hatte zum Leben gereicht.
»Das Gute kommt immer zurück«, bestätigte Leopold, und neben seinen Knopfaugen spannten sich unzählige Lachfältchen auf. »In solchen Zeiten muss man zusammenhalten.«
»Ich bin wieder da!« Friedas zartes Stimmchen wehte durchs Foyer, und sie setzte sich mit ihrer Puppe in einen der Ohrensessel am großen Fenster, wo der Blick aufs Meer reichte und die Sonne hereinschien. »Wilma hat Arme Ritter für mich gemacht, die waren richtig süß, und dazu habe ich sogar noch einen Löffel ganz, ganz süßes Apfelmus bekommen.«
Moiken lächelte. »Das war bestimmt lecker. Wenn es nach dir ginge, könntest du nur dieses mit der süßen Eiermischung überbackene Weißbrot essen.«
Frieda blieb ihr eine Antwort schuldig, denn sie hatte selbstvergessen ein Gespräch mit ihrer Puppe Elva begonnen. Offenkundig spielte ihre kleine Tochter gerade eine Prinzessin, die in der Strandvilla Urlaub zu machen wünschte, und Elva fragte eifrig nach den Vorlieben ihres hohen Gastes. Die beinhalteten eine Schaukel, viele Bonbons und eine goldene Kutsche.
Wie schön, dass Friedas Welt in Ordnung war. In Wirklichkeit würden zum Beginn der Saison zwar keine Prinzessinnen, dafür jedoch hoffentlich wieder viele zahlungskräftige Gäste einziehen.
Bis dahin stand ihnen noch jede Menge Arbeit bevor, vor allem in den Zimmern.
»Wir benötigen noch dringend neue Matratzen, die bis zum Frühjahr irgendwie beschafft werden müssen«, sagte Moiken halb zu sich und dann an Leopold gewandt. »Also, wenn Sie etwas von einem Verkauf hören oder lesen, sagen Sie mir sofort Bescheid. Es müssen gute Matratzen sein. Die Betten sollten bequem und behaglich sein, das ist das Wichtigste überhaupt, damit sich die Gäste wohlfühlen. Außerdem brauchen wir neue, saubere Läufer für die Flure, die müssen sehr dick sein, das ist unerlässlich, um Trittgeräusche zu dämpfen.«
»Ich höre mich nach Angeboten um. Ach ja, vorhin kam ein Anruf aus Hamburg. Die Lieferung der schweren, lichtundurchlässigen Vorhänge könne noch etwas dauern, sagte der Lieferant. Eine genauere Aussage konnte er nicht treffen.«
»Hauptsache, sie werden geliefert. Die brauchen wir. Es muss dunkel sein in den Zimmern. Ruhe und Erholung für die Gäste …und dann das Frühstück!«
»Dafür wird meine Wilma schon sorgen, da bin ich mir sicher.« Sein liebevoller Blick in Richtung Küche zeugte davon, wie sehr er seine Frau nach rund vierzig Jahren Ehe immer noch schätzte. Er war klein wie seine Frau Wilma, doch im Gegensatz zu ihr dünn und schmal gebaut, fast wie ein Schuljunge.
»Wenn ich Sie beide nicht hätte …«, seufzte Moiken glückselig. »Der Gast muss gut geschlafen und gefrühstückt haben, dazu eine freundliche Begrüßung und eine verbindliche Verabschiedung, das sind die bleibenden Eindrücke bei der Abreise und nach meiner Überzeugung auch die Gründe für einen erneuten Besuch.«
»Wir werden die Strandvilla wieder zum Erblühen bringen, ganz bestimmt.«
Alle zogen an einem Strang, das war ein wunderbares Gefühl …nur wenn sie von ihrem Dünencafé sprach, ging ein Aufseufzen durch die Belegschaft, vor allem durch die Reihe der männlichen Bediensteten.
Musste das auch noch sein? So fragte man sie mit hochgezogenen Augenbrauen, denn es gab doch so vieles, was man instand setzen müsse, und schließlich könne man auf der Terrasse der Strandvilla auch wunderbar sitzen.
Das stimmte natürlich, aber eben nur die Gäste der Strandvilla, eines Hotels, das ihr Erbe war und nicht ihr Lebenstraum.
Die Strandvilla war ein schweres Los in diesen Zeiten, aber sie hatte nicht zuletzt die Verantwortung für die Belegschaft und deshalb die Aufgabe, das Hotel wieder zum Erblühen zu bringen.
Ihr Herz schlug jedoch für ihr Dünencafé, für ihren Traum, für den sie schon fast alles in ihrem Leben aufgegeben hatte. Sogar ihre große Liebe Boy.
»Es gibt noch viel im Hause zu tun«, sagte Leopold, so als wäre er ihren Gedanken gefolgt.
»Ja, das fängt schon bei der Wiederbeschaffung aller Gegenstände aus Kupfer, Nickel und Messing an, die wir im Rahmen der Metallspende für die Rüstungsindustrie abgeben mussten.«
»Besser so, als für ein Jahr ins Gefängnis zu wandern oder eine Strafzahlung von zehntausend Mark riskiert zu haben. Der Krieg ist vorbei, das ist die Hauptsache. Den Wiederaufbau schaffen wir schon.«
Ja, der Krieg war vorbei.
Die Inselwache hatte den Feind nie zu Gesicht bekommen. In vier Kompanien waren die Männer über die gesamte Insel verteilt in Barackenlagern entlang der Inselbahntrasse untergebracht gewesen.
Von ihren Patrouillengängen entlang der Küste brachten die Männer keine Feindbotschaften, dafür jede Menge Strandgut und Möweneier mit.
Für den Verteidigungsfall waren von List bis nach Hörnum sechs schwere Batterien mit Kalibern bis zu 24 Zentimetern und mit einer Reichweite von fünf Kilometern aufgestellt worden. Die Artillerie bezog ihre Stellungen in List und Hörnum, um die dortigen Häfen zu schützen.
Vorbei. Der Krieg war beendet.
Plötzlich herrschte wieder Frieden – das war kaum begreifbar, und tatsächlich stand die junge Republik noch auf sehr wackligen Beinen, wie sich in Berlin zeigte.
Wenn sie an die neuesten Unruhen und Machtkämpfe dort dachte, die sich um die Grundsatzfrage entzündeten, ob ein Rätesystem wie in Russland oder ein demokratisches Parteiensystem die bessere Form für die Bildung der neuen Regierung war, überkam sie doch wieder die Angst um Emma und Boy und die Sorge, dass der Friede nur auf einem dünnen Blatt Papier existierte, das im Sturm der Auseinandersetzung zwischen radikalen Linken und Sozialdemokraten jederzeit vom Tisch geweht werden könnte.
Plötzlich vernahm Moiken ein klägliches Miauen hinterm Empfangstresen, und auch Leopold sah irritiert zu seinen Füßen, dann schmunzelte er.
Frieda hatte sich auf allen vieren herangeschlichen und streifte wie eine Katze um die Beine des alten Portiers. Es war ihr Lieblingsspiel, denn nun musste sich Leopold zu ihr bücken, ihr das Köpfchen streicheln und dabei sagen: »Armer schwarzer Kater.«
Prompt musste Leopold dabei lachen, und somit war er der Spielregel nach dran, die Katze zu sein.
»Aber Frieda, dafür ist unser Leopold doch schon zu alt!«, mischte sich Moiken ein, als Leopold tatsächlich Anstalten machte, auf alle viere zu gehen.
»Ach was, das halten meine Knochen schon noch aus! Und für so einen Spaß ist man nie zu alt. Außerdem bin ich so froh, dass wir endlich alle wieder etwas zu lachen haben. Miau! Miau!«
Versonnen und kopfschüttelnd zugleich sah Moiken dem Portier nach, wie er durchs Foyer krabbelte und ihre jauchzende Tochter um ihn herumsprang – immer auf der Hut, dass sie nicht gleich wieder die Katze sein musste.
Wie schön, dass endlich wieder Fröhlichkeit im Haus herrschte, dachte Moiken glückselig, doch prompt landeten ihre Gedanken in Berlin. Ob Emma und Boy dort auch einen Grund zum Lachen fanden? Hoffentlich ging es ihnen gut.
Bevor Emma vor Kriegsbeginn ihrem Vater nach Berlin gefolgt war, hatte sie ein sehr liebevolles Verhältnis zu ihrer Halbschwester Frieda entwickelt, die noch ein Säugling gewesen war.
Ihre große Tochter war damals im Streit nach Berlin abgereist, allerdings hatten die vergangenen Jahre dazu geführt, dass sie sich zumindest auf brieflicher Ebene wieder annäherten und regelmäßig in Kontakt standen.
Von Boy hatte sie seither keinen Brief erhalten, denn natürlich verzieh er ihr nicht, dass sie ihrer Vernunft gefolgt war, als Seefahrerwitwe den Hotelier Theodor von Lengenfeldt geheiratet und mit ihm ein Kind bekommen hatte. Doch wie hätte sie sich für ihre Liebe zu Boy entscheiden sollen, nachdem er sich plötzlich mit dieser Felice Bauer, der Verlobten von Franz Kafka, verabredet hatte? Vor ihren Augen. So sehr hatte Felice bei der ersten zufälligen Begegnung Eindruck auf Boy gemacht.
Seither waren fünf Jahre vergangen, und sie fragte sich oft, wie es ihm ging. Darüber schrieb Emma leider nie etwas. Wohl mit Absicht, weil Boy ihrem Leben fernbleiben wollte. Ob es Felice noch in seinem Leben gab? Auch darüber verlor Emma kein Wort.
Hingegen erzählte sie viel von dem fotografischen Atelier, das Boy in der Nebenstraße zur Hauptschlagader Berlins, Unter den Linden, eingerichtet hatte. Zu seinen Hauptauftraggebern gehörten große Hotels, unter anderem auch das Hotel Adlon, das gleich um die Ecke lag, wie Emma stolz berichtet hatte.
Emma war bei ihrem Vater in die Lehre gegangen, und nun, nach Kriegsende, hatte sie die Hoffnung, ihre Leidenschaft als Fotografin richtig ausleben zu können.
Hoffnung, dachte Moiken. Vor ihrem geistigen Auge erlebte sie ein freudiges Wiedersehen mit ihrer Tochter. Erleichtert fielen sie einander in die Arme, und Emma bestaunte ihre groß gewordene Halbschwester.
Boy war auf diesem inneren Bild nicht zu sehen.
Am liebsten würde sie so bald wie möglich nach Berlin reisen. Der Brief an Emma mit der Frage, wann sie dort willkommen wäre oder ob Emma lieber nach Sylt kommen wolle, war jedenfalls schon unterwegs.
Nur was, wenn die Unruhen in der Hauptstadt zunahmen oder, noch schlimmer, wenn Emma etwas zustieß – ausgerechnet jetzt, nachdem sie den Krieg unversehrt überstanden hatten? Regelmäßig überkam sie die unbändige Angst, ihre Tochter nie mehr wiederzusehen.
Anfang November begannen sich die Ereignisse zu überschlagen. So leise und plötzlich, wie der Krieg gekommen war, so laut war das Angst einflößende Getöse, unter dem er beendet worden war und das noch immer anhielt.
Ausgehend von Meutereien kriegsmüder Matrosen, die nicht zur Entscheidungsschlacht gegen England auslaufen wollten …galt doch der Krieg in ihren Augen ohnehin schon als verloren –, breiteten sich die Aufstände wie ein Lauffeuer aus, griffen auf das Feldheer über, die Menschen gingen auf die Straßen, forderten Brot und Frieden und die Abdankung des Kaisers.
Von einem dieser gewaltigen Demonstrationszüge, die sich von den Fabriken am Stadtrand ins Herz der Hauptstadt wälzten, hatte Emma in ihrem letzten Brief ein Foto beigelegt.
Mit ihrer Kamera war Emma stets am Puls der Ereignisse, die Porträtfotografie empfand sie als langweilig, und so war ihre Tochter immer dort zu finden, wo etwas los war.
Mit angespannter Sorge hatte Moiken die Ereignisse in Berlin über die Zeitungen und vor allem durch Emmas ausführlichen Brief verfolgt. Gespannt hatte sie die turbulente Schilderung gelesen, wie der Sozialdemokrat Scheidemann von den Stufen des Reichstags die Republik ausrief, noch während der kaiserliche Reichskanzler Prinz Max von Baden dem Kaiser die Abdankung überhaupt erst nahelegte, und wie der kaiserliche Reichskanzler kurz danach selbst die Beine in die Hand genommen hatte, nachdem er schnell noch den Vorsitzenden der Sozialdemokraten, Friedrich Ebert, zum neuen Reichskanzler ernannt hatte.
In bildhaften Sätzen schilderte Emma die sich weiter überschlagenden Ereignisse an jenem Tag, und es kam Moiken vor, als würde sie mit Emma durch Berlins Straßen ziehen, hin zum Berliner Stadtschloss.
Dort rief der linksradikale Karl Liebknecht nur zwei Stunden später die freie sozialistische Republik Deutschland aus und schwor die Bevölkerung auf eine internationale Revolution ein.
Doch damit nicht genug. Emma wetterte in ihrem Brief gegen dieses spontane Handeln, denn keiner habe das Recht, eine Republik auszurufen.
Damit lag sie auf gleicher Linie mit dem neuen Reichskanzler, denn auch seiner Meinung nach müsse eine verfassungsgebende Versammlung entscheiden, was aus Deutschland werden solle – ob nun eine Republik oder was auch immer.
Just als Moiken den Brief in Händen gehalten hatte, hörte sie durch die Fenster der Strandvilla den Klang von Pauken, Fanfaren und Trompeten. In Westerland veranstalteten die Revolutionäre einen Umzug unter lautstarkem Absingen der Internationalen.
Arbeiter- und Soldatenräte wurden gegründet, und während es in Berlin seither zu heftigen Unruhen kam, war es auf der Insel verdächtig still geblieben. Überhaupt sah man kaum jemanden auf der Straße, doch vermutlich waren alle, so wie sie mit ihrer treuen Belegschaft, damit beschäftigt, die Spuren des Krieges möglichst schnell zu beseitigen, damit zum Beginn der Badesaison die ersten Gäste einziehen konnten.
Kinderlachen durchbrach ihre Gedanken, und sie beobachtete, wie Frieda mit Leopold die Rollen tauschte und sie nun wieder die Katze war.
Plötzlich hörte Moiken laute Männerstimmen vor dem Portal der Strandvilla. Was war da los?
Grölen und Rufen. Derbe Satzfetzen drangen ihr durch Mark und Bein.
Und schon flog die Tür auf. Soldaten stürmten herein. Sie hatten die Kokarde von ihren Mützen abgerissen und trugen Gewehre bei sich.
Moiken erstarrte.
Dann ging alles ganz schnell.
Binnen kürzester Zeit trieben die Eindringlinge alle Bediensteten im Foyer zusammen, während Moiken immer noch nicht wusste, wie ihr geschah.
Leopold stellte sich schützend vor Frieda und postierte sich mit ihr in der Nähe der Tür, als sie sich in Reih und Glied aufstellen mussten – vor ihnen die Revolutionäre mit entsicherten Gewehren.
Einer von ihnen, offenbar der Anführer, trat vor.
Mit seinem Körperbau hielt er jedem Sturm stand, doch die ausgemergelten Wangen verrieten die entbehrungsreichen Kriegsjahre.
Sein stechender Blick traf jeden Anwesenden.
»Wer ist der Hotelier? Vortreten!«
Moiken holte tief Luft, ihre Knie drohten nachzugeben, als sie zwei Schritte nach vorn machte.
»Hier«, stieß sie hervor. Ohne die angestaute Luft hätte ihre Stimme versagt.
Der Anführer musterte sie von Kopf bis Fuß. »Ihr Name?«
Keine Angst zeigen, redete sie sich ein. »Moiken von Lengenfeldt.«
»Aha?«
Sein Nebenmann ging einen halben Schritt vor und flüsterte dem Redeführer etwas ins Ohr.
»Soso, die Witwe also. Und wo ist der Geschäftsführer?«
»Er steht vor Ihnen.« Wie aus der Pistole geschossen hatte sie geantwortet, und sofort sah sie am Gesicht des Anführers, dass das keine gute Idee gewesen war.
Der Revolutionär hob die Augenbrauen. »Mir ist nicht nach Scherzen zumute.«
»Mir auch nicht«, entgegnete Moiken halblaut.
»Dann sind wir uns ja einig«, bemerkte der Revolutionär mit einem süffisanten Lächeln und wandte sich der versammelten Belegschaft zu. »Wir vom Arbeiter- und Soldatenrat Sylt geben bekannt, dass in der Stadt Westerland und auf der gesamten Insel die Gewalt von uns übernommen wurde, bis der Staat sich neu gebildet hat. Der Soldatenrat regelt die militärische Sache, während der Arbeiterrat auf kommunalem Gebiet tätig ist. Der Arbeiterrat wird also auch eine geregelte Wasser-, Licht- und Kohlenversorgung mit überwachen. Sollte sich gegen unsere Arbeit Widerstand zeigen, sind wir gezwungen, Störungen zu unterdrücken, die eine friedliche Abwicklung gefährden. Ein jeder erhebe nun den rechten Arm mit der geballten Faust und rufe auf mein Kommando hin dreimal laut: Es lebe die Republik!«
Vereinzelte brüchige Stimmen folgten seinem Aufruf.
»Lauter, ich höre nichts!«, schrie der Anführer, wobei eine dicke Ader auf seiner Stirn erschien.
Noch ehe Leopold es verhindern und Moiken von ihrer Position aus irgendwie reagieren konnte, sprang Frieda auf einen der Ohrensessel, hüpfte darauf auf und ab und rief lauthals: »Es lebe die Republik! Es lebe die Republik! Es lebe die Republik!«
Als der Anführer die Hände auf dem Rücken verschränkte und langsam auf ihre Tochter zuging, blieb Moiken das Herz stehen. Wie ein Wolf, der mit geschmeidigen Bewegungen auf ein ahnungsloses Schaf zuschlich.
Frieda war mit Soldaten im Haus aufgewachsen, und Moiken hatte sich als Mutter alle Mühe gegeben, die Einquartierung des Militärs in Friedas Augen wie ein großes Spiel aussehen zu lassen. Das rächte sich nun.
Endlich konnte sich Moiken aus ihrer Erstarrung lösen.
»Lassen Sie meine Tochter in Ruhe!«, rief sie und stürzte auf den Anführer zu, der gerade bei Frieda angekommen war.
»Oh, eine bissige Stute!«, bemerkte der und wich in gespieltem Entsetzen einen Schritt zurück. Seine Männer lachten.
»In der Tat. Sie werden meiner Frieda kein Haar krümmen, ansonsten bekommen Sie es mit mir zu tun.«
»Ich wollte Ihrer Tochter nur ein Kompliment machen. Wie alt ist die Kleine? Vier, fünf? Und schon weiß sie, was sich gehört, und hat noch dazu ein hübsches Stimmchen. Sorgen Sie dafür, dass sie bei meinem nächsten Besuch die Internationale singen kann, dann bin ich auch mit Ihnen versöhnt.« Kaum hatte er ausgesprochen, wandte er sich an die Bediensteten. »Das Hotel wird nun nach Waffen und Kriegshetzern durchsucht, und Sie …«, Sein Blick traf wieder auf Moiken, »erklären feierlich, dass sich in diesem Haus keine Waffen mehr befinden und keine Offiziere oder Kapitalisten verborgen gehalten werden.«
»Ich erkläre es feierlich«, antwortete Moiken schnell und im besten Glauben an die Wahrheit, doch in der nächsten Sekunde fiel ihr siedend heiß ein, dass Theodors Freund erwähnt hatte, Offizier gewesen zu sein. Was jetzt?
»Nichts und niemand?«, entgegnete der Revolutionär skeptisch. »Sie sind sich der Tragweite Ihrer Aussage bewusst und wirklich sicher?«
Zu lange durfte sie nicht überlegen, schoss es ihr durch den Kopf. »Ja«, entgegnete sie fest.
»Das haben alle gehört.« Er blickte in die Runde, ließ sich die Bestätigung seiner Mitstreiter durch ein Nicken erteilen und fixierte Moiken mit durchdringendem Blick. »Los! Hier rüber! Sie stellen sich mit der Nasenspitze an die Marmorsäule, die Hände auf den Rücken, und rühren sich nicht vom Fleck. Sie stehen unter Bewachung! Und falls …« Er verlieh seiner Befehlsstimme einen dunklen Klang. »Falls auch nur eine Waffe oder gar ein Offizier gefunden wird, dann werden Sie an Ort und Stelle wegen Widerstands erschossen.«
Kapitel 2
Wie lange hast du nun schon nichts mehr von deiner Mutter gehört?«
Als ihr Vater die Küche betrat, sah Emma im morgendlichen Dämmerlicht von den Fotos auf, die vor ihr auf dem kleinen wurmstichigen Tisch lagen.
Es war der einzige Tisch in der Berliner Wohnung, und der diente je nach Tageszeit als Küchenbrett, Esstisch oder Arbeitsplatz im einzigen beheizten Raum.
Das Licht der Petroleumlampe reichte nicht aus, um das Zimmer zu erhellen, doch es zeigte schonungslos die Augenringe im ausgezehrten Gesicht ihres Vaters.
Die Kriegsjahre hatten den Glanz aus seinen meerblauen Augen gewischt. Seine Fahrkarte aus dem Lazarett nach Hause war ein Granatsplitter im Unterschenkel mit nachfolgender Entzündung gewesen, die ihn zwar nicht das Leben, aber das Bein gekostet hatte.
Umständlich ließ sich Boy mit seiner Prothese auf dem Schlaflager an der gegenüberliegenden Wand nieder, eine Wand, von der der Putz so stark abbröckelte, dass sie den Namen schon fast nicht mehr verdiente.
Mit einem erschöpften Seufzer streckte er sich aus. »Gibst du mir keine Antwort?«
»Seit wann sorgst du dich um meine Mutter?«, entgegnete sie ausweichend. »Ich dachte, sie wäre dir gleichgültig?«
»Na ja, heute ist Heiligabend.«
»Heute ist der 24. Dezember, ein ganz normaler Dienstagabend.« Zumindest redete sie sich das ein, seit sie vor einer Stunde in morgendlicher Dunkelheit von ihrer stockfleckigen Matratze neben dem Herd aufgestanden war. Auch ihr Vater sah nicht danach aus, als wäre heute ein Festtag.
Er steckte in einer abgenutzten Hose, die nur durch Hosenträger an seiner Taille hielt. Der Kragen war abgewetzt, und am Ellbogen, wo sie das mausgraue Leinenhemd geflickt hatte, zeigte sich das nächste Loch. »Und wenn du es genau wissen willst – Mutter und ich haben uns gestritten.«
»Geht das wieder los?«, seufzte Boy und rieb sich die offenkundig schmerzende Schulter, denn dort verlief der Lederriemen, der die Beinprothese an ihrem Platz hielt.
»Wieder Verspannungen oder eine wunde Stelle?«, fragte Emma. »Kann ich dir irgendwie helfen? Salbe oder massieren?«
»Mir ist nicht zu helfen, aber du weichst mir aus. Ihr habt euch doch zuletzt so gut verstanden.« Falten erschienen auf seiner hohen Stirn, bis hinauf zu den Geheimratsecken, die sich seit seinem vierzigsten Geburtstag in diesem Jahr deutlich ausgebreitet hatten.
Emma hatte keine Lust, weiter über ihre Mutter zu reden. »Warst du die ganze Nacht in der Dunkelkammer?« Das Ablenkungsmanöver war offensichtlich, doch ihr Vater verstand das Signal. Überhaupt genügte oft nur ein Blick, um zu wissen, was der andere sagen wollte.
Vom Charakter her waren sie aus demselben Holz geschnitzt, doch äußerlich war sie das Ebenbild ihrer Mutter – das Kinn zu spitz, die Nase zu stupsig, die Brüste zu klein und die Hüften zu schmal. Nur mit ihren blauen Augen, umkränzt von dichten dunklen Wimpern, war sie zufrieden.
Während ihr Vater antwortete, band er sich die schulterlangen Haare zu einem neuen Zopf, da sich ein paar Strähnen gelöst hatten. »Die halbe Nacht hab ich gearbeitet. Ich konnte nicht schlafen, weil ich dir so gern einen schönen Heiligabend geboten hätte – den ersten nach dem Krieg.«
»Ach, mach dir deshalb bitte keinen Kopf. Wir haben überlebt, das ist die Hauptsache, und ab jetzt geht es aufwärts. Sind gute Fotos dabei?«
»Und ob! Du hast unfassbar tolle Aufnahmen von der Revolution gemacht. Die Soldaten, wie sie sich lachend die Kokarde von der Uniform reißen und auf den Boden werfen – perfekt eingefangen! Dann der Moment, als Arbeiter, Soldaten und Matrosen beim Generalstreik durchs Brandenburger Tor marschieren, oder das Foto in der Zimmerstraße, alles schwarz vor Menschen und mittendrin die Straßenbahn, auf deren Dach die Demonstranten stehen und die rote Fahne schwingen. Wenn man das nur in Farbe sehen könnte! Aber perfekt eingefangen, Chapeau, Madame!«
Sie lächelte und errötete, denn ihr Vater war ein Perfektionist, und bei ihm galt es schon als Lob, wenn er mal nichts zu kritisieren hatte. Aber durch diese harte Schule ging sie gern, ohnehin hätte sie als Frau bei einem anderen Fotografen nicht mal eine Lehrstelle bekommen – und sie wollte perfekt werden. Eine Fotografin, vor der die Männer den Hut ziehen würden.
»Danke.«
»Schon gut. Aus dir wird mal noch was, mein Mädchen, da glaube ich fest dran.«
»Dazu müsste ich meine Aufnahmen veröffentlichen können. Warum interessieren sich die Zeitungen generell kaum für Fotos, da würden viel mehr Leute zugreifen, wenn sie was zu sehen bekämen? Stattdessen immer nur diese langatmigen Texte.«
Ihr Vater wiegte den Kopf, dann legte er sich auf die Seite und griff gewohnheitsmäßig nach seinem Hosenbein, um die Prothese in die richtige Position zu bringen. »Die Berliner Illustrirte Zeitung hat das immerhin schon erkannt.«
»Aber sie veröffentlichen meine Fotos nur, wenn ich sie unter deinem Namen einreiche.«
Energisch wischte ihr Vater ein paar Krümel von der Matratze, die vom Wandputz stammten. »Die Krusten brechen auf, glaub mir, du musst dranbleiben. Material hast du jedenfalls genug. Ich komme gar nicht so schnell mit dem Entwickeln hinterher – wir haben einfach zu wenig Platz zum Aufhängen in der Dunkelkammer.«
Emma nickte. Die Dunkelkammer, das einzige weitere Zimmer der Wohnung, war wirklich klein, zudem lagerten derzeit darin wertvolle Kameras und alles, was sich sonst noch aus dem Ladengeschäft im Erdgeschoss zu stehlen gelohnt hätte.
»Bald wird es uns möglich sein, das Fotoatelier wiederzueröffnen, und dann ist es absehbar, bis wir uns einen Anbau leisten und darin die Dunkelkammer unterbringen können«, sagte sie, um ihrem Vater etwas Hoffnung zu machen, und natürlich lebte sie selbst auch von dieser Vorstellung.
»Dein Wort in Gottes Ohr. Und da heute Heiligabend ist, willst du nicht deiner Mutter schreiben und dich mit ihr versöhnen?«, setzte er hinzu und kam so auf das unerwünschte Thema zurück.
»Das sagst gerade du, der du seit Jahren kein Wort an sie gerichtet hast!«, platzte es aus ihr heraus, obwohl sie sich in die Beziehung ihrer Eltern nicht einmischen wollte. In eine Liebe, die die beiden nie leben konnten.
»Weshalb sollte ich? Sie hat sich durch die Heirat mit dem Hotelier ein zweites Mal gegen unsere Liebe entschieden. Du weißt, das hat mich tief getroffen, und zugleich musste ich es respektieren. Nun ist sie schon seit vier Jahren Witwe. Wenn sie Interesse an einem Kontakt zu mir hätte, rein freundschaftlich, hätte sie mir längst schreiben können. Aber du solltest ihr schreiben, um euren Streit beizulegen. Worum geht es da überhaupt, wenn ich fragen darf?«
»Ich habe nicht angefangen. Mitte November hatte ich ihr gleich geantwortet, dass ich mich zwar ebenfalls sehr auf ein Wiedersehen freue, im Moment aber kein Geld habe, um nach Sylt zu fahren, und sie soll es auch lieber sparen und nicht nach Berlin kommen. Wir würden uns treffen, wenn die Zeiten bald besser sind. Seitdem kein Brief von ihr, also ist sie offenkundig beleidigt, aber das kann ich auch nicht ändern.«
Boy stützte den Kopf auf den abgewinkelten Arm und sah sie aus dieser Position heraus schief an. »Aber verstehen kannst du das, oder? Es ist Kriegsende, und nach all den Jahren hätte sich deine Mutter bestimmt sehr gefreut, dich wiederzusehen und hat nicht mit so einer ablehnenden Antwort gerechnet. Oder es ist alles ein großes Missverständnis, weil ihr Brief während der Unruhen irgendwo untergegangen ist. Und nun glaubt sie, du hättest dich zurückgezogen, weil du dich von ihr bedrängt gefühlt hast.«
»Was sollte ich denn machen?«, fuhr Emma auf. »Wenn sie sieht, wie wir hier hausen, wird sie mich sofort nach Sylt mitnehmen wollen.«
»Gut möglich«, gab Boy gedankenverloren zurück, und sein Blick glitt in die Ferne. Nach Sylt, das war seinem melancholischen Ausdruck anzusehen.
Auf die Insel, auf der er aufgewachsen war und wo er schon als junger Bursche seine große Liebe gefunden hatte, ihre Mutter, auf die er tatsächlich sein halbes Leben gewartet hatte.
»Du denkst doch nicht daran, als Strandfotograf nach Sylt zurückzukehren?«, fragte sie vorsichtig.
Die Entscheidung, nach Berlin zu gehen, war ihm vor fünf Jahren nicht leichtgefallen, aber am Ende hatte es ihm ihre Mutter leicht gemacht.
Er gab keine Antwort, aber für sie war es undenkbar, nach Sylt zurückzukehren – genauso undenkbar erschien es jedoch, ohne ihn in der Hauptstadt zu bleiben. »Vater? In Berlin liegen unsere Chancen. Es herrscht doch jetzt Frieden, bald kommt der Aufschwung, wir müssen nur durchhalten.«
»Ja, wahrscheinlich hast du recht.« Boy gähnte herzhaft und sah aus, als würden ihm jeden Moment die Augen zufallen.
»Leg dich doch schlafen, dann mache ich in der Dunkelkammer weiter.« Sie begann, die auf dem Tisch ausgebreiteten Fotos in mehrere Stapel zu sortieren, um sie danach ordentlich in Kisten abzulegen.
»Schlafen?«, entgegnete Boy, als hätte sie ein Fremdwort benutzt. »Ich muss heute Vormittag noch meine Aufwartung bei Lorenz Adlon machen und ihm für die vielen Aufträge in diesem Jahr danken, bevor in seinem Hotel die weihnachtlichen Feierlichkeiten losgehen. Ohne ihn hätten wir nicht überlebt.«
»Langweilige Aufträge«, bemerkte sie und ordnete die Fotos weiter nach Themen.
»Wie bitte?«, fuhr ihr Vater auf. »Wir hatten den Chef des Großen Generalstabs vor der Linse, außerdem den Reichskanzler und als Krönung Kaiser Wilhelm. Das nennst du langweilig?«
»Du hast sie fotografieren dürfen, als sie zu Gesprächen im Hotel waren, ich war nur deine Handlangerin, weil die Herren mir keine gute Aufnahme zugetraut haben.«
Geknickt senkte er den Kopf und verlor damit zugleich seine Körperspannung. »Gegen solche Ressentiments wirst du immer wieder kämpfen müssen, Emma, das habe ich dir schon oft gesagt, und es tut mir leid, dass ich manchmal bei meinen Geschlechtsgenossen gegen Mauern renne, aber ich weiß, was meine Tochter kann. So, und nun zurück zu deiner Mutter«, bemerkte er sanft. »Wann hast du den Brief fertig? Dann kann ich ihn gleich zum Postamt mitnehmen. Ich weiß, wie ungern du am Schalter in der Schlange stehst …das ist also keine Ausrede.«
»Schreib du ihr doch, wenn es dir so verdammt wichtig ist!«, wehrte sie sich gegen seinen ungelenken Überzeugungsversuch. »Du willst doch nur, dass ich mich bei ihr melde, weil du dich nicht traust, ihr zu schreiben.«
»Das stimmt«, gab ihr Vater unumwunden zu.
»Ach. Immerhin bist du endlich mal ehrlich. Und ich bleibe dabei, meine Mutter soll sich bei mir melden! Warum muss ich den ersten Schritt machen?«
Ihr Vater seufzte. »Weil du niemals so stur werden wolltest wie sie.«
Das saß.
Emma seufzte ergeben. »Na schön, gewonnen. Aber keinen Brief, nur ein Telegramm. Das geht schneller – in jeglicher Hinsicht«, ergänzte sie trotzig wie ein kleines Kind, und daraufhin mussten sie beide lachen.
Emma nahm eine der Extra-Ausgaben des Vorwärts, die am Tag der Revolution alle zwei Stunden neu erschienen war, und nutzte den leeren Blattrand, um zwei kurze Zeilen zu notieren. Kostenlose Extra-Blätter waren die einzige Sache, die es derzeit im Überfluss gab, und die Vielfalt ihrer Verwendungszwecke kannte keine Grenzen.
Energisch kritzelte sie zwei Zeilen mit Weihnachtsgrüßen darauf, riss die beschriebene Ecke aus der Zeitung und stand auf, um ihrem Vater den Fetzen zu überreichen.
In diesem Moment ertönte draußen ein ohrenbetäubender Knall, wie ein Donnerschlag, dicht gefolgt von einem zweiten, dritten, vierten und fünften.
Emma erstarrte. »Was war das?«, hauchte sie.
»Panzerschüsse?«, stieß Boy hervor und rappelte sich auf. Der Blick aus dem Fenster brachte keine Klarheit, also eilte er kommentarlos aus der Wohnung, um nachzusehen.
»Panzer? Das kann doch nicht sein!«, rief Emma ihm hinterher, obwohl er es schon nicht mehr hören konnte. Reflexartig griff sie nach ihrer Kamera und rannte ihm nach.
Unten an der Ladentür holte sie ihren Vater ein, weil er stocksteif stehen geblieben war.
Erneute Schüsse. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr. Panzer! Nicht zu sehen, aber viel zu nah! Vermutlich rollten sie Unter den Linden entlang, vielleicht in Richtung Stadtschloss, vielleicht befanden sich die Panzer auch schon auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor und damit nur eine Querstraße entfernt.
Mit schweißnassen Händen umklammerte Emma ihre Kamera, voller Panik starrte sie ihren Vater an.
War der Krieg etwa zurück?
Auch ihrem Vater stand die Angst ins Gesicht geschrieben. Er zitterte.
Immer mehr Menschen liefen auf der Straße zusammen, manche noch im Morgenrock, einige Frauen hatten ihre Kinder auf dem Arm, und die Männer hoben diskutierend die Hände. In der Eile hatte kaum jemand daran gedacht, einen Mantel überzuziehen.
Plötzlich hörten sie Rufe, eine Gruppe von Männern in Zivil rannte die schmale Wohnstraße entlang, ihre atemlosen Stimmen verloren sich zwischen Panzerschüssen und im Tumult jener Anwohner, die offenkundig bereits erfasst hatten, was los war.
Nun verstand auch Emma, was die Männer riefen.
»Blutige Weihnachten!«
»Das Stadtschloss! Panzerangriffe!«
»Schon über fünfzig Tote!«
»Auch Zivilisten darunter, bleibt fern!«
»Die Volksmarinedivision hält das Schloss weiterhin besetzt, trotz Ultimatum!«
»Division fordert 80 000 Mark ausstehende Löhne!«
»Der Stadtkommandant als Geisel! Das Schloss schwer beschädigt!«
»Regierungstruppen mit Karabinern und Stielhandgranaten!«
»Panzerwagen im Schlosshof!«
»1200 Mann Infanterie mit schwerer Artillerie im Anmarsch!«
Emma fühlte einen Ruck am Arm, und wenn ihr Vater sie nicht energisch beiseitegezogen hätte, wäre sie von den Männern umgerannt worden, die sich zum Ziel gesetzt hatten, die Bevölkerung eilends zu warnen.
Endlich konnte sie sich aus ihrer Erstarrung lösen. »Ist das ein neuer Krieg?«
»Woher soll ich das wissen?«, rief ihr Vater. »Keine Ahnung, aber in der neuen Regierung ist man sich offenkundig nicht einig, und das ist eine große Gefahr, so viel ist mir … Emma, wo willst du denn hin?«
»Zum Schloss natürlich!«, gab sie über die Schulter zurück und lief los.
Ihre Angst hatte sich in den unbändigen Drang verwandelt, alles mit eigenen Augen zu sehen, das Geschehen mit der Kamera festzuhalten, damit sie begreifen konnten, was alle anderen nicht sehen wollten, die gerade in den Schutz ihrer Häuser zurückdrängten.
»Bist du wahnsinnig, Emma? Bleib stehen! Komm zurück!«
Kapitel 3
Ist das zu fassen?«, rief Moiken und sah Leopold über den Empfangstresen hinweg an. »Das neue Jahr fängt ja gut an«, setzte sie mit einem Seufzer hinzu.
Leopold knetete seine Unterlippe mit den Zähnen, bevor er sich zu einer Antwort entschloss. »Tuans eana ned ärgern, gnädige Frau. Samma doch froh, dass ma no lebn! Dagegn is des jo goar nix, mit Verlaub.«
So gesehen war der Fehler bei der Lieferung der neuen Vorhänge, die nicht blickdicht und dunkel, sondern durchscheinend und weiß waren, natürlich eine Lappalie und eine Sache, die sich ändern ließ.
Sie wusste schon, worauf Leopold anspielte, denn damit meinte er nicht, dass sie den Krieg überlebt hatten.
Mit Schrecken dachte Moiken an den Tag zurück, als die Revolutionäre die Strandvilla gestürmt hatten, um das Haus nach Waffen und versteckt gehaltenen Widerständlern zu durchsuchen.
Wäre ihr Page Matthis nicht gewesen, stünde sie tatsächlich nicht mehr hier und könnte sich ärgern.
Der Junge war im ersten Stock gewesen und hatte die Revolutionäre gehört. Geistesgegenwärtig war er ins Zimmer des kriegsversehrten Offiziers gelaufen, hatte dessen Uniform geschnappt, sie eilends samt der übersichtliche Habe in den Koffer geworfen und den an Krücken gehenden Wilhelm Frohmann durch die Hintertreppe und den Dienstbotenausgang nach draußen gebracht.
Nachdem die Revolutionäre die Durchsuchung erfolglos beendet und die Strandvilla verlassen hatten, waren die beiden durch den Haupteingang wieder hereinspaziert, und Matthis war als Held gefeiert worden, während die Uniform im Feuer verbrannte.
»Sie haben schon recht, Leopold, wir müssen dankbar sein, noch am Leben zu sein. Aber die Sache mit den Vorhängen ärgert mich trotzdem, weil es unnötige Scherereien mit sich bringt. In der Zeit hätte ich …« Sie brach ab.
In der Zeit hätte sie sich über die Instandsetzung ihres Dünencafés Gedanken machen können, setzte sie im Stillen hinzu, doch der ursprüngliche Plan, das Café zu Saisonbeginn wieder zu eröffnen, war weit in den Hintergrund gerückt und erschien derzeit so umsetzbar wie das Vorhaben, bei Ebbe in See zu stechen. »War die Post schon da?«, fragte sie zur Ablenkung.
»Ja. Hier sind noch einige Neujahrsglückwünsche, und auch sonst sind nur gute Nachrichten dabei.« Mit diesen Worten überreichte ihr Leopold den Stapel, und sie rang sich ein Lächeln ab, denn ihre verärgerte Stimmung hielt an, auch während sie die erfreulichen Nachrichten las.
So kannte sie sich gar nicht. Doch wahrscheinlich regte sie sich über die falschen Vorhänge so auf, weil ein enormer Druck auf ihr lastete. Erstens war da die große Aufgabe, die Strandvilla trotz finanzieller Schwierigkeiten innerhalb eines halben Jahres bis zum Beginn der neuen Saison in frischem Glanz erstrahlen zu lassen, zweitens war da die geringe Aussicht auf die Wiedereröffnung ihres Cafés, und drittens, aber nicht zuletzt, lastete die Sorge um Emma auf ihr – und der Kummer, dass ihre Tochter auf keinen ihrer Briefe reagiert hatte.
Sie sah von der Post auf, hin zu der eingerahmten Nachricht, die Leopold vor fünf Wochen aus der Sylter Zeitung ausgeschnitten und dort aufgehängt hatte, damit es jeder sehen und glauben konnte.
Bekanntmachung
Zum Betreten und Verlassen der Insel Sylt bedarf es von heute ab
keiner besonderen Erlaubnis mehr.
Inselkommandantur Sylt, am 29. November 1918
Schlichte Zeilen, die ihnen allen wieder das Tor zur Welt öffneten und die Hoffnung auf Alltag und Frieden zurückgaben. Nichts hatte sie sich mehr gewünscht und darum ihre Tochter auch sofort um ein Wiedersehen gebeten.
Doch offenbar war sie damit zu voreilig gewesen, denn Emma hatte die Tür zu ihrem Leben plötzlich verschlossen und auf die zwei Briefe vor Weihnachten nicht mehr reagiert.
Daraufhin hatte sie beschlossen, die Füße still zu halten. Emma war erwachsen, das musste sich Moiken immer wieder selbst vorsagen, ihre Tochter hatte das Recht auf eigene Entscheidungen, auch darüber, wann sie ihre Mutter an ihrem Leben teilhaben lassen wollte.
Das schmerzte, und es fiel ihr schwer, das zu akzeptieren, vor allem, weil sie sich solche Sorgen machte. Die Zeitungen waren voll mit erschreckenden Nachrichten aus Berlin.
Doch sie hatte sich vorgenommen, ihrer Tochter nicht mehr zu schreiben, bis Emma sich meldete. Denn wenn ihr etwas zugestoßen wäre, würde sie schließlich Nachricht von Boy erhalten.
»Ach, hier habe ich noch was«, sagte Leopold in ihre Gedanken hinein. »Der neue Sylt-Reiseführer, frisch aus der Meyer’schen Druckerei geliefert. Carl Meyer ist persönlich hier gewesen, um ihn abzugeben, aber da waren Sie gerade mit der Reklamation der Vorhänge beschäftigt, so wollte er nicht stören.«