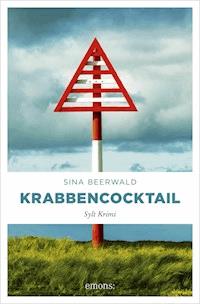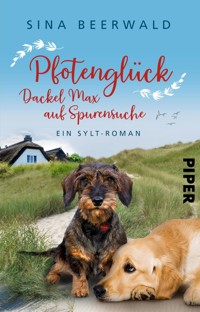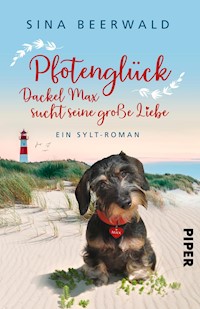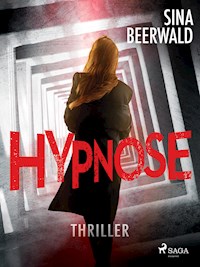Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Thalia Bücher GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Sylt-Saga
- Sprache: Deutsch
Ein Roman wie ein Sommer-Urlaub auf Sylt, voller nostalgischem Insel-Charme Sylt 1913: Für die junge Seefahrer-Witwe Moiken Jacobsen scheint ein Traum in Erfüllung zu gehen, als der Hotelier Theodor von Lengenfeldt um ihre Hand anhält. Vom beschaulichen Keitum bringt er sie ins mondäne Westerland und ermöglicht es ihr, sich in der »Strandvilla«, dem besten Hotel auf der Insel, eine eigene Konditorei einzurichten. Heimlich träumt Moiken davon, eines Tages das verlassene Strand-Café im Dünenpavillon wiederzueröffnen und steckt all ihre Kraft und Leidenschaft in süße Köstlichkeiten, die sie bis spät in die Nacht kreiert. Bald muss sie allerdings feststellen, dass Theodor sie vor allem geheiratet hat, damit sie ihm einen Stammhalter schenkt. Von ihren beruflichen Plänen ist er wenig begeistert. Als Moiken dann auch noch dem erfolgreichen Strand-Fotografen Boy Lassen begegnet, geraten ihre Lebenspläne ins Wanken. Denn kein anderer als Boy hat ihr einst mit sandigen Lippen den ersten unschuldigen Kuss geraubt … Urlaubs-Lektüre, historischer Roman, romantische Liebesgeschichte: Sina Beerwald hat mit »Die Strandvilla« einen zauberhaften Roman über Sylt geschrieben, der nicht nur Nordsee-Urlauber begeistern wird.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sina Beerwald
Die Strandvilla
Ein Sylt-Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sylt 1913: Für die junge Seefahrer-Witwe Moiken Jacobsen scheint ein Traum in Erfüllung zu gehen, als der Hotelier Theodor von Lengenfeldt um ihre Hand anhält. Vom beschaulichen Keitum bringt er sie ins mondäne Westerland und ermöglicht es ihr, sich in der »Strandvilla«, dem besten Hotel auf der Insel, eine eigene Konditorei einzurichten. Heimlich träumt Moiken davon, eines Tages das verlassene Strand-Café im Dünenpavillon wiederzueröffnen und steckt all ihre Kraft und Leidenschaft in süße Köstlichkeiten, die sie bis spät in die Nacht kreiert.
Bald muss sie allerdings feststellen, dass Theodor sie vor allem geheiratet hat, damit sie ihm einen Stammhalter schenkt. Von ihren beruflichen Plänen ist er wenig begeistert.
Als Moiken dann auch noch dem erfolgreichen Strand-Fotografen Boy Lassen begegnet, geraten ihre Lebenspläne ins Wanken. Denn kein anderer als Boy hat ihr einst mit sandigen Lippen den ersten unschuldigen Kuss geraubt …
Inhaltsübersicht
Widmung
Die Strandvilla
1. Buch
Januar 1913
2. Buch
August bis Dezember 1913
3. Buch
Mai bis August 1914
Nachwort
Dank
Für Lauris
Die Strandvilla
Ein eigenthümlicheres Café mag es kaum auf Erden geben. […] Es herrschte eine clair obscur, eine Ruhe und Stille in dem kleinen Häuschen [… ] Ich ließ mich nieder und bat die Wirthin, die mit ihrer Tochter ganz allein der Wirtschaft vorstand, mich durch eine Tasse Kaffee zu erfrischen.«Graf von Baudissin
1. Buch
Januar 1913
Was machen Sie denn da?« Entrüstet stellte sich Moiken dem jungen Burschen entgegen, der mit seinen Fellstiefeln den schneebedeckten Takerwai entlanggestapft war – schon dabei hatte sie ihn beobachtet, denn Fremde verirrten sich selten in die schmale Gasse –, und dieser dreiste Bursche hatte soeben sein hölzernes Stativ mit der Kamera vor ihrem kleinen Reetdachhaus aufgestellt und schickte sich an, unter dem schwarzen Tuch zu verschwinden. »Sie können doch nicht einfach mein Haus fotografieren!«
»Er hat mich gefragt, und ich habe es ihm erlaubt«, hörte Moiken ihre fünfzehnjährige Tochter von der Hausecke her sagen. Dort stellte Emma gerade einen halb gefüllten Sack mit Schafskötteln ab, nachdem sie zwei Stunden der Spur der Tiere durch die schneebedeckte Braderuper Heide gefolgt war, um das kostbare Brennmaterial zu sammeln.
Ärgerlich zog Moiken die Stirn in Falten. »Emma!« Mehr sagte sie nicht. Dieser ungebetene junge Fotograf war die eine Sache, der nur halb gefüllte Sack missfiel ihr jedoch viel mehr, und das wusste ihre Tochter.
Der Winter war noch lang. Erst seit drei Tagen schrieb Moiken das neue Jahr 1913 über die Einträge in ihr Tagebuch, die seit Ende Oktober von Ungewissheit handelten. Ihr Mann war nicht wie geplant in den Hamburger Hafen zurückgekehrt, sein Schiff, auf dem er als Steuermann fuhr, allerdings schon, so viel hatte sie herausgefunden.
Peter war zuverlässig, sie konnte sich nicht vorstellen, dass er sich abgesetzt hatte. Es musste ihm also etwas zugestoßen sein – auf dem Schiff oder an Land, darüber hatte sie noch keine Auskunft. Deshalb hoffte sie täglich, er würde vor der Tür stehen, denn mit fünfunddreißig Jahren wollte sie noch nicht zur Witwe werden.
»Was ist?«, fragte Emma in gereiztem Ton. »Habe ich hier gar nichts zu sagen?«
Moiken versuchte schon allein wegen der Anwesenheit des Fotografen ruhig zu bleiben, aber um den würde sie sich gleich kümmern. Erst einmal musste sie Emma zurechtweisen. »Darum geht es nicht. Es ist dummes Zeug von dir gewesen, die Arbeit heute nur halb zu erledigen, das weißt du genau. Den Schafsmist brauchen wir dringend zum Heizen.«
Holz war ein kostbares Gut auf einer Insel, auf der die Einwohner eine Ansammlung von ein paar windschiefen Bäumen bereits als Wald bezeichneten und deshalb anstelle von Zäunen Friesenwälle aus Steinen bauten, große Steine, die ihnen das Meer vor die Füße warf.
Was Emma jedoch nicht wusste: In den vergangenen drei Monaten, seit sie auf die Rückkehr von Ehemann und Vater warteten, waren die Ersparnisse bis auf ein paar Mark geschrumpft.
Von dem Geld, das Peter nach Hause gebracht hatte, hatten sie immer gut leben können, und das, was sie mit dem Backen von Torten und Kuchen für Festlichkeiten verdiente, war ein nettes Zubrot gewesen. Leider auch nicht mehr, selbst wenn sie im östlichen Teil der Insel für ihre schmackhaften Köstlichkeiten bekannt war und viele Brautpaare und Jubilare zu ihr kamen. Doch die Bestellungen allein reichten nicht zum Überleben.
»Also, was hast du dazu zu sagen, Emma?«, forderte sie ihre Tochter auf.
Emma verdrehte die Augen. »Du willst ernsthaft eine Erklärung von mir, weshalb ich nur einen halben Sack gesammelt habe? Bitte. Gern. Es ist Winter. Die Schafe finden wenig zum Fressen. Darum scheißen sie nicht viel. Deshalb ist der Sack entgegen deinen Wünschen nur halb gefüllt. Zufrieden jetzt? Und ich werde doch wohl einem jungen Fotografen erlauben dürfen, unser Haus abzulichten.«
»Das stimmt, und Ihr Fräulein Tochter war so freundlich«, bestätigte der Bursche in heiterem Ton und zog seinen Hut tiefer ins Gesicht, um den Lichteinfall der schon um die Mittagszeit tief stehenden Wintersonne zu prüfen. Er achtete nicht weiter auf sie und lief geschäftig hin und her, um den besten Standort für seine Kamera zu finden.
Ihr Fräulein Tochter … dachte Moiken kopfschüttelnd, während sie den dreisten schlaksigen Burschen, der seine blonden Haare wie ein Künstler zum Zopf gebunden trug, mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Amüsiertheit beobachtete. Er führte sich auf, als wäre er ein berühmter Fotograf.
Emma schien die Anrede gefallen zu haben, sie machte den Rücken gerade, nahm ihre Schultern nach hinten und lächelte.
Es fehlte nur noch ein halber Kopf, dann war ihre Tochter so groß wie sie. Wo war nur die Zeit geblieben? Eben war sie doch noch so klein gewesen, und nun wurde sie vom Mädchen zur Frau.
Emma stand unbeweglich an der Hausecke, ihre Augen hatte sie noch immer auf den jungen Fotografen gerichtet, und dennoch ging ihr Blick in die Ferne. Wenn sie ihre Tochter betrachtete, glaubte Moiken, sich selbst als junges Mädchen dort stehen zu sehen. Äußerlich waren sie sich wie aus dem Gesicht geschnitten. Beide hatten sie kräftiges, dunkelblondes langes Haar, wobei Emma es am liebsten zu einem geflochtenen Zopf und Moiken es meistens hochgesteckt trug. Beide waren sie groß und auffallend schlank, die blauen Augen waren von besonders dichten, dunklen Wimpern umkränzt, das Kinn ein wenig zu spitz, die Nase dafür klein und stupsig.
In letzter Zeit verlor sich Emma oft in ihren Gedanken, wahrscheinlich war ihr das eben beim Schafsmistsammeln auf dem acht Kilometer langen idyllischen Weg durch die Dünen von Keitum bis nach Kampen auch wieder passiert.
Moiken hätte zu gern gewusst, was in ihrer Tochter vorging, doch Emma ließ sie nicht daran teilhaben. Sicher war nur, dass auch Emma in Sorge um ihren Vater war und in Gedanken gern in andere Welten entfloh, indem sie Luftschlösser über dem Wattenmeer baute und sich in ihren Tagträumen mit dem Azurblau des stillen Wattenmeers, dem leuchtenden Gold des Sands und dem Immergrün der Heide ihre Zukunft bunt und schön malte.
Ihr Fräulein Tochter – solche Anreden benutzte niemand in ihrem Dorf im Osten der Insel. So sprach man nur im mondänen Seebad Westerland, wo seit rund fünfzig Jahren die gut betuchten Sommerfrischler Erholung suchten und kaum noch Ruhe fanden, angesichts der dicht an dicht stehenden Sandburgen, mit denen die rund dreißigtausend Gäste im Verlauf der Saison ihr Strandkorb-Revier begrenzten.
Zwar waren es bis zur Westseite ins quirlige Westerland nur vier Kilometer, mit der Inselbahn kaum zehn Minuten Fahrtzeit, und doch hatte Emma diese andere Welt noch nie bereist.
Alles, was sie für das tägliche Leben benötigten, gab es in Keitum, auch einen Arzt. Für Moiken Gründe genug, nicht in die Stadt zu fahren, in der sie aufgewachsen war. Tatsächlich aber wollte sie nicht mit ihren Erinnerungen konfrontiert werden.
Unbeirrt suchte der Bursche weiter die beste Position für seine Kamera, wobei er mittlerweile in deutlich schräger Linie zum Haus stand. Wie sollte das überhaupt etwas werden? Er war kaum älter als Emma, vielleicht siebzehn, wahrscheinlich noch ein Lehrling. Wie auch immer – an Dreistigkeit mangelte es ihm jedenfalls nicht.
Das kleine Reetdachhaus, in dem sie lebten, trug gewiss zu Emmas Empfindungen von Beengung bei. Besonders zwischen den anderen Reetdachhäusern, die entlang des schmalen Takerwais wie dahingewürfelt lagen, wirkte es wie ein Puppenhaus, denn es besaß einen auffallend niedrigen Giebel und eine Eingangstür, durch die sich jeder bücken musste.
Doch genau an dieser außergewöhnlichen Optik hatte wohl der junge Fotograf Gefallen gefunden, obwohl es genug schöne Häuser in Keitum gab, deren Abbilder man auf Postkarten hätte drucken und verkaufen können – doch diese Häuser waren eben austauschbar.
»Hübsch!«, rief er in diesem Moment und tauchte begeistert unter dem schwarzen Tuch vor.
Verdutzt legte Moiken den Kopf schräg. Das sah doch ein Blinder mit Krückstock, dass er aus diesem Winkel allenfalls die Hausecke aufgenommen haben konnte.
Und kaum hatte Moiken verstanden, was tatsächlich sein Motiv gewesen war, klopfte die Wut im Takt ihres schnellen Pulses in ihrer Halsader. Nun reichte es aber. Was für eine Unverfrorenheit!
»Was erlaubst du dir, ungebeten meine Tochter zu porträtieren?« Mit der höflichen Anrede war es vorbei. Und mit ihrem Gleichmut ebenfalls.
Sie raffte den Rock ihres grauen Hauskleids aus grobem Leinen, damit der Saum nicht von einer Mischung aus Schneematsch, feuchter Erde und Hühnerdreck beschmutzt wurde, und ging auf den Burschen zu, um ihn fortzuweisen.
Beschwichtigend hob der junge Mann die Hände. »Verzeihung, aber in Westerland freuen sich die Menschen, wenn ich sie fotografiere. Ich wollte Ihrer Tochter nicht zu nahe treten. Nur das Sonnenlicht fiel gerade so wundervoll auf ihr Gesicht – da konnte ich nicht anders. Wenn Sie uns im Fotoatelier in Westerland besuchen, bekommen Sie einen Abzug geschenkt.«
Ein scheinbar nettes Angebot, aber auf diese billige Masche des Kundenfangs fiel Moiken bestimmt nicht herein. »Ich fahre nicht nach Westerland«, gab sie brüsk zurück. »Schon gar nicht wegen einer Fotografie!«
Der enttäuschte und zornige Blick, den sie von ihrer Tochter erntete, versprach noch eine lebhafte Diskussion. Immerhin war Emma schlau genug, jetzt keine Widerrede zu leisten. Mit ihrem Dickschädel rannte sie nicht mehr gegen jede Mauer, daran merkte man, dass sie älter und reifer wurde. Eigensinnig blieb sie dennoch.
Der Fotograf stand da, als hätte er Wurzeln geschlagen.
»Geh deines Wegs, du hast mir schon genug Zeit gestohlen«, forderte sie ihn auf. Das war hoffentlich deutlich genug gewesen. Doch weit gefehlt. Der Fotograf packte zwar sein Stativ, allerdings zog er damit nur ein paar Meter weiter, von wo aus er nun tatsächlich eine perfekte Sicht auf das Haus hatte.
»Einen Augenblick nur, ich bin gleich fertig.«
Moiken blieb angesichts dieser Frechheit die Spucke weg. Konnte es sein, dass dieser Bursche sie überhaupt nicht ernst nahm? Aber war das wirklich verwunderlich?
In solchen Zeiten, in denen auch noch die jungen Mannsbilder lernten, dass das Wort einer Frau nichts galt? Hinter vorgehaltener Hand natürlich, vordergründig stimmte man dem allgemeinen Tenor zu, dass eine Frau zu respektieren sei und zudem mehr Recht auf Selbstbestimmung haben solle. Aber damit war selbstverständlich nur die Selbstbestimmung gemeint, die mit der Entscheidung zu tun hatte, was es zum Mittagessen geben, wo eingekauft und mit welcher Wolle das Kinderjäckchen gestrickt werden sollte.
Während Moiken tief Luft holte, um den Fotografen, der nach einigen prüfenden Blicken durch die Linse zufrieden war, endgültig und unmissverständlich zum Gehen aufzufordern, kam ihr im Hinblick auf ihre finanzielle Situation urplötzlich ein ganz anderer Gedanke: »Wenn dein Meister schon sein Geld mit dem Verkauf von Postkarten verdienen will und dich losschickt, dann sollte er auch so anständig sein und mir etwas für die Ablichtung meines Hauses bezahlen.« Ihre Stimme hatte sehr selbstsicher geklungen, was Moiken mit innerlichem Stolz erfüllte, und sie lobte sich für ihren Einfall, der ihnen helfen könnte, zumindest den Januar besser zu überstehen.
Nun war es an dem jungen Burschen, verdutzt dreinzuschauen. »Ist das hier nicht das Haus von Peter Jacobsen?«
»Doch, das ist es – aber was tut das zur Sache?«
»Ich komme genau genommen im Auftrag von Herrn Theodor von Lengenfeldt. Er hat gehört, dass dieses Haus zum Verkauf steht, und da dem gnädigen Herrn momentan selbst die Zeit fehlt, sich vor Ort ein Bild von dem Haus zu machen, hat er unser Atelier mit einer Fotografie beauftragt, und ich wurde losgeschickt. So entscheidend ist das Foto nämlich nicht, denn im Grunde ist der gnädige Herr bei dem günstigen Preis schon längst vom Kauf überzeugt. Das ist aber auch ein niedliches Häuschen.«
Nun musste Moiken doch lachen, vor allem, weil sie so erleichtert war. »Das ist ein Irrtum. Dieses Haus steht nicht zum Verkauf. Aber der Name meines Mannes ist ja nicht gerade selten vertreten auf der Insel.«
Irritiert zog der Bursche die Brauen zusammen und sah sich um. »Aber wir sind doch hier im Takerwai in Keitum? Gibt es hier noch einen Peter Jacobsen?«
»Nein, natürlich nicht. Da muss Ihrem Auftraggeber etwas Falsches zu Ohren gekommen sein.«
»Nein, nein, er hat es vom Buchhändler Julius Meyer gehört, und hier …« Er kramte in seiner Hosentasche und zog einen Zettel hervor, den er selbst noch einmal überflog, bevor er ihr die ausgeschnittene Zeitungsannonce entgegenhielt. »Gestern in der Sylter Zeitung erschienen.«
Mit zwei Schritten war sie bei ihm und riss ihm den Zettel aus der Hand. Tatsächlich. Schwarz auf weiß.
Wer hatte sich denn diesen Scherz erlaubt? Etwas anderes konnte das doch nicht sein.
Nun war auch Emma an ihrer Seite und las sich die Anzeige durch. »Aber Mutter, warum hast du mir nichts davon gesagt? Ist es, weil Vater nicht zurückkommt? Ist er auf See geblieben?«
»Still jetzt. Sprich solche Dinge nicht aus, sonst werden sie wahr. Und selbst wenn es so wäre, dann bin ich die Erbin und würde einzig und allein über einen Verkauf bestimmen. Es ist also alles, wie ich schon sagte, ein großer Irrtum.« Sie sprach es überzeugt aus, doch in ihrem Kopf türmten sich die Fragen zu einem Berg auf. Trotzdem setzte sie hoch erhobenen Hauptes hinzu: »Richten Sie das Ihrem Auftraggeber, diesem Theodor Langenfels, aus, und …«
»Lengenfeldt …«, unterbrach sie der Bursche, der sich nun sichtlich unwohl in seiner Haut fühlte.
»Meinetwegen auch dem«, giftete Moiken ihn an, kurz davor, ihre gute Kinderstube zu vergessen.
»Ich werde Herrn von Lengenfeldt wohl kaum glaubhaft machen können, dass dies ein Irrtum ist.«
»Dann muss das eben Ihr Meister erledigen!«
»Der ist gerade in Berlin. Das werden Sie Herrn von Lengenfeldt wohl persönlich erklären müssen.«
»Ich muss gar nichts!«, gab sie zurück, wurde dann aber doch nachdenklich. Wäre es nicht besser, dieser Sache nachzugehen? Von Lengenfeldt … Moiken kramte in ihrem Gedächtnis, in welchem Zusammenhang sie diesen Namen schon einmal gehört hatte. »Ist er nicht der Besitzer dieses Hotels in Westerland, das so wagemutig auf der hohen Düne direkt am Meer erbaut wurde?« Moiken erinnerte sich an die Bauzeit, während der sie als Kind in Westerland gelebt hatte. Da war der Name Lengenfeldt in aller Munde gewesen, allerdings im selben Atemzug mit zweifelhaften Titulierungen wie größenwahnsinnig, vollkommen verrückt und der Irre vom Festland. Schließlich würde kein vernünftiger und vorausschauend denkender Hotelier den Platz für sein Bauwerk so auswählen, dass man es der gefräßigen Nordsee auch gleich in den Schlund werfen könnte.
Nun, immerhin stand das Gebäude heute noch, und Otto Busse hatte es ihm nach ein paar Jahren mit seinem Hotel Miramar ein paar Schritte weiter südlich tatsächlich nachgetan, sich sogar noch näher an den Flutsaum gewagt.
»So ist es«, bemerkte der Bursche, als sei er ihren Gedanken gefolgt. »Die Strandvilla. Das teuerste, aber zugleich auch modernste Hotel, das Westerland zu bieten hat. Gerade lässt er es für die nächste Saison erneut aufwendig renovieren. Darum hat er keine Zeit, selbst nach Keitum zu kommen.«
»Das ist ja auch eine Weltreise«, spottete Moiken. »Warum will er überhaupt meine kleine Puppenstube kaufen? Das ist doch ein Witz! Genau wie diese Annonce. Ich will nur wissen, wer die aufgegeben hat. Und dass es sich um einen Irrtum handelt, kläre ich mit diesem viel beschäftigten Herrn von Lengenfeldt in einer halben Minute.« Westerland, dachte Moiken bei aller Entschlossenheit mit starker Beklemmung, ausgerechnet Westerland. Ob sie ihm vielleicht doch nur einen Brief schreiben sollte? Dadurch könnte sie sich eine Konfrontation mit der Vergangenheit ersparen.
Andererseits hatte sie das dringende Bedürfnis, diese Angelegenheit persönlich zu klären und vor allem schnell aus der Welt zu schaffen.
Zweifelnd hob der Bursche die Augenbrauen, was sie innerlich noch mehr in Rage brachte. Nach seinem frechen Auftritt glaubte er wohl, sie könne einem Mannsbild kein Paroli bieten.
»Nun, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg«, sagte er achselzuckend und packte seine Kameraausrüstung ein. »Herr von Lengenfeldt ist sehr an dem Haus interessiert, und wenn sich der gnädige Herr einmal etwas in den Kopf gesetzt hat …«
»Dann kann er sich das an den Hut schmieren! Emma, spann Adriano vor den Karren! Wir fahren nach Westerland!«
Adriano schnaubte unwillig. Auf der Suche nach etwas Fressbarem senkte das schwarze Pferd den Kopf, doch das Maul des Friesen traf nur auf Schnee und Sand.
Die Räder zogen tiefe Spurrinnen. Den Karren durch die Strandstraße in Westerland, die ihrem Namen alle Ehre machte, dem Wind entgegenzuziehen erschöpfte Adriano. Sein Alter sah man ihm aufgrund der kräftigen, friesentypischen Muskeln nicht an, doch ihr treues Kutschpferd mit der langen schwarzen Mähne blieb immer wieder stehen, und darum stiegen sie beide vom Karren ab und führten den Rappen entlang zahlreicher kleiner Läden den ansteigenden Weg hinauf, begleitet von abfälligen und belustigten Blicken der Passanten und tuschelnden Bemerkungen hinter Moikens Rücken.
Das machte ihr besonders zu schaffen. Nicht, weil man über ihr treues Pferd lästern könnte. Vielmehr wollte Moiken gar nicht wissen, ob das Gerede auch ihr galt, weil jemand sie wiedererkannt hatte.
Das war Vergangenheit, und die sollte ruhen.
Als sie das Ende der Strandstraße erreichten und von der hohen Dünenkuppe aufs Meer blickten, wehte ihnen eine steife Brise entgegen. Der Sand, den der Wind mit sich trug, ließ ihre Wangen prickeln.
Moiken hatte ganz vergessen, wie frisch, herb und wunderbar würzig die raue Nordsee riechen konnte, seitdem sie in Keitum wohnte und ihr tagtäglich der algenschwere Duft des Wattenmeers in der Nase hing. Nicht unangenehm, aber anders.
An Tagen mit Ostwind musste sie jedoch oft die Fenster geschlossen halten, weil vom Schlickwatt her ein modriger Geruch herüberzog. Zuweilen stank es sogar nach fauligen Eiern, dann sagte man, das Wattenmeer arbeite, und alles Schlechte werde in etwas Gutes umgewandelt. Ein schöner Gedanke, aber das machte den unerträglichen Duft nicht besser.
Moiken nahm einen tiefen Atemzug, füllte ihre Lunge mit der frischen Meeresluft und dem salzigen Duft der tosenden Nordsee. Nur langsam ließ sie die Luft entweichen, und das linderte ihre Anspannung etwas.
Wie lange war sie schon nicht mehr hier gewesen? Ihre Eltern hatten ihre einzige Enkeltochter nicht mehr kennengelernt, die im November 1897 geboren worden war, weil beide im Jahr zuvor im Winter kurz hintereinander an einer schweren Lungenentzündung verstorben waren. Sie hatten schon nicht mehr erlebt, wie Moiken im März, acht Monate vor Emmas Geburt, mit neunzehn Jahren geheiratet hatte und nach Keitum in das kleine Reetdachhaus im Takerwai gezogen war.
Ihr Elternhaus war ein schlichtes Backsteinhaus in der Damenbadstraße unweit des Friedhofs der Heimatlosen gewesen, das Dach marode und das Mauerwerk undicht. So hatte sie nicht viel Geld dafür bekommen, aber für eine ordentliche Mitgift hatte es gereicht, und um die ersten zehn Jahre gut zu leben – von sorgenfrei konnte nicht die Rede sein, denn der Verkauf des Hauses hatte die Gerüchteküche erst recht angeheizt und dazu geführt, dass sie Westerland nicht mehr betreten hatte.
Fünfzehn Jahre lang hatte die Vergangenheit geruht.
»Ich will an den Strand, Mutter! Es ist wunderschön hier.« Mit diesem Ausruf riss Emma sie aus ihren Gedanken.
Es ließ sich nicht leugnen, selbst bei diesem stürmischen, aber sonnigen Winterwetter übte der breite und unendlich lange Strand, der sich vom Nord- bis zum Südzipfel der Insel erstreckte, einen unwiderstehlichen Reiz aus.
Erinnerungen an Kindertage stiegen in ihr hoch, als sie in den Dünen spielten und das Urlaubsleben der Badegäste von dort oben beobachteten, weil die profanen Inselkinder nichts zwischen den adretten Sommerfrischlern zu suchen hatten und auf der Promenade nicht erwünscht waren.
Sie erinnerte sich, wie sie als Mädchen die Frauen in ihren schönen Kleidern bewundert hatte, wie diese mit Schirmchen auf der hölzernen Wandelbahn entlangflanierten, vorbei an Strandkörben, die durch kunstvolle Sandwälle ringsum zum eigenen Revier erklärt wurden. So viele, dicht an dicht, dass selbst die einfachen Strandstühle, die für einen Tag zu mieten waren, kaum mehr Platz fanden.
Gebadet wurde streng getrennt im Damen- und Herrenbad, die gut einen Kilometer voneinander entfernt lagen. Die Männer wurden schon weit vorher mit Warnschildern, vor denen man die Hacken zusammenschlagen mochte, darauf aufmerksam gemacht, sich dem Damenbadbereich nicht weiter zu nähern.
Als vor sieben Jahren das Familienbad direkt vor der Strandvilla eröffnet wurde, drang der Aufschrei bis nach Keitum, und das, obwohl Junggesellen selbstverständlich keinen Zutritt haben sollten. Doch zum Erstaunen vieler Kritiker vollzog sich das Badeleben dort in tadelloser Ordnung, wie man auch zum Ende der vergangenen Saison in der Sylter Kurzeitung, dem Sylter Intelligenz-Blatt und der Sylter Zeitung übereinstimmend feststellte. Selten waren sich die Blätter so einig gewesen.
»Wir sind nicht zum Vergnügen hier«, konstatierte Moiken, nachdem sie aus ihren Erinnerungen zurückgefunden hatte, und richtete den Blick auf die Strandvilla, die vor ihnen auf der Düne thronte.
Eine Schlosstreppe führte zu dem aufwendig verzierten Portal in der Beletage des dreigeschossigen Gebäudes. Besonders auffällig war das große hölzerne Windrad, das wie ein Wahrzeichen neben dem Hotel stand.
Angesichts der imposanten Strandvilla begannen ihre Nerven zu flattern, und sie fühlte sich nicht mehr ganz so selbstbewusst wie vor ihrem beschaulichen Häuschen.
»Ich gehe da nicht mit rein«, sagte Emma entschieden.
Moiken seufzte. Widerworte konnte sie jetzt nicht gebrauchen. »Dann bleibst du eben bei Adriano, und du rührst dich keinen Schritt von ihm weg. Hast du gehört? Ich bin gleich wieder zurück.«
Emma verzog das Gesicht und nickte, während sie zu Boden sah und dabei die schwarze Mähne ihres Pferds kraulte.
Theodor von Lengenfeldt beugte sich in der Empfangshalle gemeinsam mit dem Bankier über einen Berg von Papieren. Umbaupläne, Buchungslisten und Bilanzrechnungen. Überzeugungsmaterial für den Bankier, bevor gleich der Rundgang durch die Villa beginnen sollte.
Er schenkte dem schmallippigen Mann, der mit seiner spitzen Nase und dem dünnen langen Schnurrbart an eine Maus erinnerte, ein gewinnendes Lächeln. »Dank des großzügigen Kredits Ihres Kreditinstituts konnten wir im vergangenen Winter bereits die Zimmer renovieren. Ein jedes verfügt jetzt über Warmwasser, elektrisches Licht, Heizung und eine eigene Toilette. Das müssen mir die anderen Hotels erst einmal nachmachen.«
»Sehr schön, ja«, sagte der Bankier, und sein Schnurrbart zitterte beim Sprechen tatsächlich wie bei einer schnuppernden Maus. Wirklich überzeugt hatte er nicht geklungen, doch ein Theodor von Lengenfeldt ließ sich davon nicht beirren.
Unauffällig prüfte er sein Aussehen im bodenlangen Spiegel des Foyers. Der weise Lessing hatte recht gehabt: Kleider machen Leute. Und für den Besuch des Bankiers hatte er seinen teuersten Frack herausgeholt, feinster Pariser Baumwollstoff, mit einem Revers aus Satin und auf seine stattliche Figur maßgeschneidert. Seinem buschigen Kaiser-Wilhelm-Bart hatte er heute Morgen eine Extraportion Wachs verpasst, damit ja kein Haar in die falsche Richtung stand, wobei die aufgebogenen Spitzen des dunklen, mit grauen Haaren durchsetzten Schnurrbarts eigentlich bereits eine schöne Form hatten, weil er sie jede Nacht mit einer hinter den Ohren befestigten Bartbinde nach oben band. Doch hier durfte nichts dem Zufall überlassen werden.
»Und nun sehen Sie hier meine weiteren Pläne, werter Herr Erk. Vom großen Saal soll ein Konversationszimmer abgetrennt werden. Die Gäste der heutigen Zeit legen großen Wert auf Privatsphäre. Ein Separee für Besprechungen während eines Diners ist unabdingbar.« Mit einer beiläufigen Handbewegung prüfte er den Sitz seiner nach hinten gekämmten, grau melierten Haare, bevor er weitersprach. »Außerdem benötige ich neben der Rezeption ein Telefonkabinett hinter Glas für unsere Gäste. Da wir über einen eigenen Anschluss verfügen, ist es meinen Gästen nicht zumutbar, bei Wind und Wetter die gesamte Friedrichstraße hinunterzulaufen, um ein privates Telefonat zu führen. Und wir haben zwar schon unsere Dampfmaschine zur eigenen Stromerzeugung, es soll nun aber noch ein neuer großer Verteilerkasten für das elektrische Licht hinzukommen, was noch mehr sicheren Komfort bringt, damit die Gäste nicht wie in anderen Hotels von ständigen Stromausfällen aufgrund überlasteter Leitungen betroffen sind und beim Essen plötzlich im Dunkeln sitzen. Wir halten, was wir versprechen, und das schätzen unsere Gäste. Dazu die einmalige Lage, der vortreffliche Meerblick …«
Ein Windstoß unterbrach ihn in seinen Ausführungen, und die Eingangstür ging auf. Endlich, das konnte nur der Lieferant vom Kaufhaus H.B. Jensen sein, wo er Fleisch, Schinken, Käse, Eier, Butter, Rum und Cognac geordert sowie Teile seines Services nachbestellt hatte, die bei der ausschweifenden Silvesterfeier am Dienstag zu Bruch gegangen waren.
»Gur Dai. Verzeihen Sie bitte …«, sagte eine zögerliche Frauenstimme.
Theodor blickte nur halb von seinen Plänen auf und machte eine Handbewegung zur nächstgelegenen Tür. Die arme Frau sah recht abgekämpft aus, wie er mit einem weiteren Blick feststellte. Ihrer Begrüßung auf Söl’ring nach zu urteilen, stammte sie aus einem der östlichen Inseldörfer, wo diese Sprache noch gesprochen wurde. Tatsächlich war es ein richtiger Dialekt des Friesischen mit eigenen Wörtern, die er nicht verstand, weil er das Sylterfriesisch leider nie erlernt hatte. Er liebte dieses weiche Gur Dai, es klang viel schöner als das harte Moin zur Begrüßung, bei dem man stets versucht war, zugleich zu salutieren. Nun wurde also schon eine Verkäuferin ausgeschickt, weil es dem Kaufhaus offenkundig an Laufburschen mangelte.
Das wiederum war nicht verwunderlich, denn selbstverständlich war die Witwe von Hans Boy Jensen als Frau mit der Führung des Betriebs überfordert. Immerhin war sie klug genug gewesen, einen Geschäftsführer einzustellen, der vor sechs Jahren mit kaufmännischer Weitsicht entschieden hatte, das Grundstück des abgebrannten Strandhotels am unteren Ende der Friedrichstraße, Ecke Maybachstraße zu erwerben, um das Ladengeschäft aus dem Norden Westerlands dorthin zu verlegen, wo die Kundschaft von selbst hinfand.
Noch besser wäre natürlich eine Dependance in der Strandstraße, denn deren Verlängerung führte direkt zum Ostbahnhof, wo alle Sommerfrischler ankamen. Doch am klügsten wäre es, dachte Theodor von Lengenfeldt enerviert, ihn als besten Kunden unter den Hoteliers ganz oben auf die Prioritätenliste zu setzen. Andernfalls würde er doch wieder auf Einzellieferanten umschwenken, auch wenn das für die Bestellung und Abrechnung unkommod war.
»Das wurde aber auch Zeit!«, sagte er in deutlichem, aber für seine Verhältnisse noch recht mildem Ton, denn die Frau konnte schließlich nichts dafür – allerdings wollte er die Verspätung nicht unkommentiert hinnehmen. »Bringen Sie die bestellte Ware für das Neujahrsbankett in die Küche, dort wartet man schon. Ich hatte die Ware auf acht Uhr terminiert. Richten Sie Frau Jensen oder besser Herrn Alwart bitte aus, dass ich die Überstunden meiner Köche von der Rechnung abziehen werde. Bis morgen Abend muss schließlich alles vorbereitet sein.« Kaum ausgesprochen, wandte er sich wieder an den Bankier.
»Meine Strandvilla war schon immer ein modernes Haus, aber ich möchte nicht nur ein Hotel ersten Ranges sein, die Strandvilla Lengenfeldt soll unübertrefflich werden. Sehen Sie hier …« Mit schwungvoller Geste zog er ein großes Papier aus dem Stapel und tippte auf die Zeichnung. »Als absolutes Glanzlicht und zur Bequemlichkeit der Gäste soll ein elektrischer Aufzug eingerichtet werden. Die neueste technische Errungenschaft in meinem Haus, allein deshalb werden die Gäste hier hereinströmen und übernachten wollen.«
Der Bankier verzog den spitzen Mund. »Nun, das hört sich alles sehr formidabel an, aber das wäre eine beträchtliche Summe, über die Sie mit unserem Bankhaus im Begriff sind zu verhandeln. Und zuallererst sollten auch noch die ausgetretenen Treppenstufen erneuert werden, die das Bauamt bemängelt hat, davon haben Sie noch nicht gesprochen.«
»Wenn ich einen Aufzug einbaue, wird kein Mensch mehr Treppen steigen wollen, auch nicht in den ersten Stock, das werden Sie schon sehen. Aber meinetwegen lasse ich auch noch die Holztreppe erneuern, darauf kommt es schließlich nicht mehr an.«
»Es erhöht die ohnehin beträchtliche Kreditsumme.«
»Werter Herr Erk, Sie zweifeln doch nicht etwa an meiner wirtschaftlichen Integrität?« Theodor von Lengenfeldt straffte sich. Das wäre doch gelacht, wenn er diesen engstirnigen Zahlenbürokraten nicht überzeugen könnte. »Das habe ich in wenigen Jahren wieder hereingeholt. Die Geschäfte laufen sehr gut. Sylt ist zu einer beliebten Destination geworden. Denken Sie doch nur daran, wie bei der Gründung des Seebads vor gut 60 Jahren namentlich nur 98 Gäste in der gesamten Saison kamen, und heute sind es über dreißigtausend. Familie Hast wird an ihr Hotel zum Deutschen Kaiser doch auch in diesem Jahr noch sage und schreibe drei Logierhäuser anbauen. Damit verfügen sie dann über 131 Zimmer und 200 Betten. Diesen Kredit werden Sie doch auch bewilligt haben.«
Der Bankier gab einen unduldsamen Schnalzlaut von sich. »Ich weiß, dass es sich bei der Familie Hast um Ihre schärfsten Konkurrenten handelt.«
»Konkurrenz, pah!«, spie er das Wort aus, als hätte er auf eine Bittermandel gebissen. »Ich setze auf Qualität, nicht auf Quantität. Nicht einmal mein Nachbar Otto Busse kann mir mit seinem Hotel Miramar das Wasser reichen.« Er lachte, als hätte er einen Scherz gemacht. »Der Versuch hat ihn einen ordentlichen Griff in seine Privatschatulle gekostet und mir dieses Betonbollwerk als Promenade beschert. Aber die Gäste lieben es, dort zu flanieren. Und sie kommen zahlreich, daran gibt es nichts zu rütteln!«
»Sie vergessen eine Tatsache, werter Herr von Lengenfeldt. Vor rund fünfzig Jahren gab es nur das Hotel Union. Seither schießen die Unterkünfte wie Pilze aus dem Boden, über zweihundert Hotels, Logierhäuser und Privatunterkünfte gibt es jetzt allein in Westerland – und wir als Sylter Spar- und Leihkasse vergeben nur Gelder für solide finanzierte Projekte.«
Er hob die Augenbrauen und sah den Bankier leicht schräg an, so als könne dieser seine Worte nicht so gemeint haben. »Das sagen Sie einem Theodor von Lengenfeldt? Wollen Sie dem erfolgreichsten Sylter Hotelier unterstellen, er könne nicht rechnen? Werter Herr Erk, Sie wollen sich doch nicht lächerlich machen. Haben Sie von mir noch nicht genug Sicherheiten? Und sehen Sie sich die Einnahmen aus den vergangenen Jahren an, insbesondere von der letzten Saison. Stetig steigend, die Gäste schätzen den Luxus, und davon will ich ihnen noch mehr bieten. Als Geschäftsmann darf man niemals stehen bleiben.«
»Sie sollten sich aber auch nicht übernehmen. Und die wirtschaftliche Lage kann sich schnell ändern. Sie wissen, es gibt da gewisse Unruhen auf dem Balkan.«
»Papperlapapp, was geht uns das in Deutschland an. Befürchten Sie etwa einen Krieg? Immer dieses negative Denken, aber das scheint wohl zu Ihrer Geschäftspolitik zu gehören, um die Zinsen für den Kredit in die Höhe zu treiben. Und bitte, wenn Ihnen an einer weiteren Sicherheit gelegen ist, so soll es daran nicht scheitern. Ich bin gerade im Begriff, ein wundervolles Häuslein in Keitum zu kaufen, weit unter Wert. Das kann sich Ihre Bank gern als potenziellen Leckerbissen auf die Liste mit Sicherheiten schreiben. Bekommen werden Sie es von mir ohnehin nicht. Oder glauben Sie etwa diesen Unkenrufen, dass es einen Großen Krieg geben soll? Das ist ja nun wirklich absurd.«
»Da irren Sie sich«, ließ sich die Frau vernehmen, die er längst in der Küche vermutet hatte.
Theodor von Lengenfeldt sah ruckartig auf. Widerspruch war er nicht gewohnt, und mit einem Mal hatte sie seine volle Aufmerksamkeit. »Wie bitte?« Er musterte sie. Nicht verärgert, eher belustigt.
Dunkelblonde Strähnen hatten sich aus ihrem einfachen Haarknoten gelöst, ihr graues Leinenkleid war am Saum beschmutzt, und an der weißen Schürze hatte wohl ein Pferd sein Maul gerieben, jedenfalls begleitete sie ein entsprechender Geruch. Trotz des derangierten Erscheinungsbilds strahlte sie einen gewissen Zauber aus.
»Sie stehen ja immer noch hier herum. Sie werden verzeihen, dass es mir meine Zeit nicht erlaubt, mit einer Frau über Politik zu diskutieren«, beschied er ihr kurz angebunden.
»Ich bin keine Lieferantin und auch nicht gekommen, um mit Ihnen politische Debatten zu führen!«, fauchte die Frau. »Dafür ist mir meine Zeit nämlich auch zu kostbar!«
Stutzig und zugleich ein wenig erschrocken hob er die Augenbrauen. Wer wagte es, so mit ihm zu sprechen? Kaum stellte er sich die Frage, fiel ihm siedend heiß eine Erklärung ein. »Oh, dann sind Sie … Verzeihen Sie, Ihre Durchlaucht. Dann müssen Sie Prinzessin Lobkowitz aus Prag sein. Wir hatten Ihre Ankunft erst für den morgigen Samstag erwartet, aber das ist natürlich eine vortreffliche Idee, inkognito einen Tag eher anzureisen. Selbst in diesem einfachen Kostüm sehen Ihre Durchlaucht ganz bezaubernd aus.«
»Sie irren sich wiederum«, bekräftigte die Frau. Mit einer energischen Bewegung strich sie sich eine widerspenstige Strähne hinters Ohr. »Und zwar auf ganzer Linie. Mein Name ist Moiken Jacobsen, ich komme aus Keitum, und das Häuslein, von dem Sie sprechen, steht nicht zum Verkauf. Und schon gar nicht weit unter Wert.«
Jetzt wurde es interessant, aber nicht nur im Hinblick auf die Sachlage. Diese Moiken Jacobsen gefiel ihm zunehmend. »Wer behauptet das? Es stand doch so in der Zeitung, auch der fabelhafte Preis.«
»Ein schlechter Scherz. Ich muss es wissen. Das Haus gehört mir.«
Er lächelte. Wann hatte er es zuletzt erlebt, dass sich jemand gegen ihn auflehnte? Und nun wagte es diese einfache Frau. Nun ja, sie mochte in schlichter Kleidung stecken, doch ihre Art faszinierte ihn. »Ihre Resolutheit gefällt mir. Das ist ungewöhnlich.« Sie gefallen mir, hätte er beinahe noch hinzugefügt, doch er biss sich auf die Zunge. Es war nicht die Zeit für Komplimente.
Moiken Jacobsen verschränkte die Arme vor der Brust. »Die Keitumer Frauen sind so. An mir ist nichts Besonderes. Unser Dorf ist ein alter Seefahrerort, wir Frauen sind es gewohnt, über Monate hinweg dem Haus allein vorzustehen und die Kinder zu erziehen. Ich backe Torten für Festlichkeiten im Inselosten und verdiene so das Zubrot, und wir Frauen warten geduldig, bis der Mann eines Tages wieder mit dem Geld von See nach Hause kommt – oder eben nicht.« Kaum hatte sie es ausgesprochen, verzog sie das Gesicht, als hätte sie auf eine Nelke gebissen.
»Sie sind also Witwe, da das Haus Ihnen gehört?«
»Das tut nichts zur Sache.«
Oh, dachte er betreten, da hatte er wohl einen wunden Punkt getroffen. »Verzeihen Sie, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.«
Moiken Jacobsen richtete den Blick zu Boden und schwieg. Der Bankier beschäftigte sich geflissentlich mit den Papieren, doch seine Ungeduld konnte er dadurch nicht verbergen. Es war nicht gut, ihn warten zu lassen, aber die Sache mit dem Haus musste geklärt werden. Wenn ihr Mann nicht zurückgekehrt war, musste sie doch über kurz oder lang Geldsorgen haben.
»Mein Interesse an Ihrem Häuslein ist jedenfalls ungebrochen. Über den Preis lässt sich selbstverständlich reden, wenn sich da ein Fehler eingeschlichen haben sollte.«
»Ich sagte es bereits, das Haus steht nicht zum Verkauf«, entgegnete sie, und eine Zornesfalte erschien auf ihrer Stirn.
»Dann möchte ich nur wissen, wer die Annonce aufgegeben hat. Aber darüber wird mir Julius Meyer Auskunft geben können«, sagte er mehr zu sich selbst, denn sein guter Freund, der Papierwarenhändler in der Mitte der Friedrichstraße, war auch für die Annahme der Anzeigen zuständig.
Er musste dieses Haus besitzen, daran führte kein Weg vorbei. Es passte perfekt in seinen Plan. Und er musste diese Frau wiedersehen.
Noch während er darüber nachsann, wie er das am besten einfädeln könnte, ohne sie gegen sich aufzubringen, ging erneut die Tür auf.
Ein junges Mädchen erschien, durchgefroren und mit hochroten Wangen. Wenn man diesem Fräulein die gesamte Lieferung allein aufgebürdet hatte, wäre er tatsächlich die längste Zeit Kunde des Kaufhauses gewesen, so dringend er die Ware auch erwartete.
»Mutter, wo bleibst du denn?«, rief das Mädchen ohne Umschweife. »Ich dachte, es dauert nur zwei Minuten?«
Theodor lächelte in sich hinein. Da war der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen. Nicht nur, dass Mutter und Tochter einander wie aus dem Gesicht geschnitten waren, wie er jetzt erkannte – das Mädchen war genauso wenig auf den Mund gefallen und in ihrem jugendlichen Temperament sogar noch forscher als die Mutter.
»Schon gut, Emma. Ich wollte mich gerade verabschieden.«
»Warten Sie einen Augenblick!«, rief er, nachdem sich Mutter und Tochter bereits zum Gehen gewandt hatten. »Kommen Sie beide doch morgen Abend zu meinem großen Neujahrsbankett. Es würde mir eine Freude sein, Sie begrüßen zu dürfen.«
Das Mädchen schaute überrascht, dann strahlte sie über das ganze Gesicht, und es fehlte offensichtlich nicht viel, dass sie auf der Stelle gehüpft wäre. Ihre Mutter hingegen schüttelte entschieden den Kopf. »Das ist sehr freundlich von Ihnen, vielen Dank. Aber mein Platz ist in Keitum, ich gehöre nicht auf ein solches Bankett.«
»Die Einladung gilt für alle, mein Hotel ist ein offenes Haus. Es kommen Gäste aus allen Berufsständen, ganz gleich, ob Diener oder Hausherr. Einmal im Jahr möchte ich mit allen feiern, und besonders willkommen sind mir zwei hübsche Damen aus Keitum.« Er lächelte, weil er es ehrlich meinte, doch er war im Zweifel, ob er sich nicht zu plump ausgedrückt hatte. Herrje, wann hatte er sich zuletzt so unsicher gefühlt?
Aber er konnte sich auch nicht erinnern, wann er zuletzt einer so bezaubernden Frau gegenübergestanden hatte. Nicht einmal seine verstorbene Gattin hatte diesen Reiz auf ihn ausgeübt, und dabei kannte er diese Moiken Jacobsen noch nicht einmal näher.
Er konnte regelrecht zusehen, wie sich ihre Miene noch mehr verschloss.
»Ich habe andere Dinge zu tun, der Winter ist noch lang.«
»Ihr Pflichtbewusstsein ehrt Sie, aber gönnen Sie sich doch einmal einen schönen Abend«, versuchte er es erneut.
»Mir ist nicht nach Feiern zumute, wenn Sie das bitte verstehen möchten. Komm, Emma.«
Mit diesen Worten verschwand sie mit ihrer Tochter aus der Tür, und er sah ihr versonnen nach, bis ihn der Bankier mit einem Räuspern in die Gegenwart zurückholte.
Das würde nicht einfach werden, dachte er, doch Herausforderungen hatten ihn schon immer gereizt.
»Warum können wir nicht auf dieses Fest gehen?«, platzte es aus Emma heraus, kaum dass sie die Strandvilla verlassen hatten.
»Du hast meine Gründe gehört.« Moiken fröstelte und zog sich die Kapuze ihres Mantels über. In Keitum, auf der Ostseite der Insel, war der Wind weit weniger spürbar. An einen Schal hätte sie denken müssen.
»Das sind Ausflüchte, mehr nicht!«, rief Emma erbost.
»Hüte deine Zunge«, gab Moiken zurück und griff nach dem Zügel von Adriano, um ihn die Strandstraße hinunterzuführen. Dort zweigte eine Querstraße zur Friedrichstraße ab, wo der alte Julius Meyer seit Jahr und Tag seine Buch- und Papierwarenhandlung führte. Ihn wollte sie aufsuchen, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Adriano ging langsam, immer wieder musste sie ihn zum Weitergehen animieren. Wie sehr ihm sein Alter zu schaffen machte, hatte sich in Keitum noch nicht so bemerkbar gemacht, weil sie ihn dort nur für kurze Wege brauchte. Er wurde doch hoffentlich nicht krank? Einen Tierarzt könnten sie sich nicht leisten und ein neues Pferd schon gar nicht.
»Ja, ja!«, keifte Emma. »Mir den Mund verbieten und dein Leben schwer nehmen – mehr kannst du nicht.«
»Ich sorge mich um unsere Existenz«, zischte Moiken, doch Emma war schon außer Hörweite, denn sie war einige Meter weiter vor einem Ladengeschäft stehen geblieben, über dem ein handbemaltes Schild hing. Südfrüchte, Conserven, Chocolade und Nougatstangen.
Der Laden von Modje Köhler. Ein Paradies, verlockend besonders für Kinder. Moiken erinnerte sich peinlich berührt daran, wie respektlos sie sich früher als Kinderschar gegenüber der ledig gebliebenen »Großmutter« verhalten hatten. Wenn die Modje jeden Nachmittag mit einem Kinderwagen voller Waren durch die Straßen zog, um sie feilzubieten, hatten sie der klein gewachsenen Frau einen Spottvers hinterhergerufen. »Die Modje hat’n Fehler – an de Lung, an de Tung, an de Leber.«
Und wenn Marie Köhler sich als glühende Verehrerin Seiner Majestät, Kaiser Wilhelm II., mit ihrer Kundschaft im Laden mal wieder in wirtschaftlich-politische Diskussionen verstrickt hatte, hatten sie ihr hinterrücks die Süßigkeiten geklaut.
Die Wände ihres Lädchens, das konnte man durch die beiden großen Schaufenster erkennen, hatte sie noch immer mit Fotografien und Zeitungsausschnitten nahezu tapeziert, und direkt hinter der Kasse hing das gerahmte Telegramm, das der Kaiser an sie gerichtet hatte.
Wie gern, dachte Moiken, würde sie ihrer Tochter dieses Kuriositätenkabinett zeigen, doch erstens hatte sie kein Geld übrig, um eine der Leckereien zu kaufen, und zweitens hatte Moiken Angst vor einer Begegnung mit der Modje, weil diese den Grund kannte, weshalb sie in die Ehe und nach Keitum geflohen war.
Aus heutiger Sicht bewunderte Moiken die selbstständige Geschäftsfrau, die nie verheiratet gewesen und zugegebenermaßen recht wunderlich war. Bewunderte sie für die Kraft, die Sturheit und ihren Stolz – denn damit hatte sie sich ihre berufliche Existenz aufgebaut und erhalten. Wie alt mochte die Modje jetzt sein? Schon damals war sie als Großmutter bezeichnet worden, aber jetzt müsste sie aller Schätzung nach um die siebzig sein.
»Mutter, wo bist du denn mit deinen Gedanken? Lass uns in diesen Laden reingehen, da drin sieht es interessant aus und es gibt leckere Sachen.«
Erschrocken bemerkte Moiken, dass sie schon viel zu lange vor dem Schaufenster gestanden hatten. Es würde ihr gerade noch fehlen, wenn die Modje jetzt in Verheißung auf Kundschaft die Tür öffnen und sie hereinbitten würde.
»Wir haben für so etwas keine Zeit«, drängte sie Emma unvermittelt.
»Siehst du, genau das meine ich. Du willst mir einfach kein bisschen Vergnügen gönnen. Und warum hast du es auf einmal so eilig?«
Moiken überging die Provokation und entgegnete sachlich: »Wir müssen in die Friedrichstraße, zur Papierwarenhandlung von Julius Meyer. Ich muss wissen, wer diese Annonce aufgegeben hat.«
Das schien für Emma ein Argument zu sein, denn sie folgte ihr nun ohne Widerspruch – bis sie vor dem Schaufenster von Reichardt-Kakao stehen blieb. Deutschlands größte Kakaofabrik aus Hamburg unterhielt hier während der Sommermonate einen Fabrikverkauf, wie ein Schild an der Tür verriet.
Die Fenster des geschlossenen Ladens waren salzverkrustet, was Emma nicht daran hinderte, die dekorativ ausgestellten Verpackungen von Kakaodosen und Schokoladenkeksen und anderen Leckereien zu bewundern. Ein weiteres Schild empfahl Hämoglobinkakao als besonderes Stärkungsmittel zur nachhaltigen Unterstützung jeder Erholungsreise.
»Wir müssen weiter«, sagte Moiken etwas sanfter zu ihrer Tochter, denn sie konnte natürlich verstehen, wie sehr Emma von der bunten Vielfalt dieser unbekannten Reize fasziniert war. Sie kannte nur den Krämerladen in Keitum, wo man die einfachen Dinge für den täglichen Bedarf erhielt. Für sie war Schokolade ein Luxusgut, das es nur gab, wenn ihr Vater von seinen Schiffsreisen zurückkehrte.
»Moin, meine sehr verehrten Damen, wie wäre es zum neuen Jahr mit einer Frisur à la Cléo de Mérode«, sprach sie ein dickbäuchiger Herr an, der in weißer Kittelschürze in seiner halb geöffneten Ladentür stand und Begeisterung heischend auf eine Fotografie zeigte, auf der eine bildhübsche junge Frau mit leicht geneigtem Kopf ihre Frisur präsentierte, bei der die Haare in sanften Wellen nur bis knapp über die Ohren reichten.
Wunderschön, dachte Moiken innerlich seufzend. So ein hübscher Schnitt, wenn sie sich den nur leisten könnte.
Der Friseur August Griepke schien sie nicht zu erkennen, woher auch, sonst hätte er sie wohl weder so überfreundlich angesprochen noch ihr als Insulanerin überhaupt einen teuren Haarschnitt nach der neuesten Mode offeriert. Sie kannte ihn natürlich als Ladenbesitzer, doch sie war in ihrem Leben noch bei keinem Friseur gewesen.
Seit sie nach Keitum gezogen war, hatte ihr immer die Nachbarin die Haare geschnitten, die sich ansonsten ihr Geld damit verdiente, die in der Vogelkoje gefangenen Enten zu rupfen, und genauso fühlte sich Moiken dann auch anschließend, nur mit dem Unterschied, dass sie ihre krumm und schief geschnittenen Haare wenigstens hochstecken konnte.
»Nun, meine Damen?«, fragte der Friseur und trat trotz der Kälte ein paar Schritte vor, um sie mit einer einladenden Geste in sein schmuckes Haus mit der weißen Holzveranda im Seebäderstil zu bitten.
»Uah, was bietet der Friseur denn noch an?«, flüsterte Emma entsetzt, als sie nun das Schild neben dem Eingang entdeckte. »Operationen an Hühneraugen und eingewachsenen Zehennägeln.«
»Uah«, machte auch Moiken, und damit war ihr Traum von einer schönen Frisur zwar nicht geplatzt, doch sie war nun schon fast froh, ihre Wunschvorstellung mangels Geld nicht umsetzen zu können.
Als sie weitergingen, sah Emma erwartungsvoll in alle Richtungen. Keinen der neuen Eindrücke wollte sie verpassen, obwohl sie bereits sichtlich überwältigt war. Doch ihre Augen leuchteten, wie Moiken es schon lange nicht mehr bei ihr gesehen hatte.
»Was wird denn hier verkauft?«, fragte Emma, und man hörte das Erschaudern in ihrer Stimme, als sie an der Ecke zur Neuen Straße abermals innehielt. »Möwen-Bazar«, las sie zweifelnd vor, so als könne sie es besser glauben, wenn sie es laut aussprach. »Einziges Spezialgeschäft der Sylter Möwen-Industrie. Seehundswaren in unübertroffener Auswahl.«
An diesem Haus wollte Moiken besonders schnell vorbeigehen, und das lag nicht nur an dem zweifelhaften Warenangebot.
»Das gehört einer alten Schulkameradin von mir. Lass uns …«
Weiter kam Moiken nicht, denn die Ladenbesitzerin musste begierig auf Kundschaft an der Tür gelauert haben, so schnell, wie diese nun aufging.
»Einen schönen guten Tag, die Damen. Was kann ich für Sie tun? Suchen Sie etwas Dekoratives zum Verschenken? Oder für sich selbst etwas Kleidsames? Wir haben heute Handschuhe aus Seehundsfell im Angebot, das wäre doch etwas für das junge Fräulein, und für Sie hätte ich einen Schal … Oh, wir kennen uns doch? Bist du nicht Moiken?«, fragte Henriette Grondziel bass erstaunt und unterbrach damit ihren eigenen Redefluss.
Ausgerechnet, dachte Moiken, und ihr Magen zog sich zusammen. Ausgerechnet von Henriette war sie erkannt worden. Zu Schulzeiten waren sie in eine Klasse gegangen und einst beste Freundinnen gewesen. Aber das war lange her, sehr lange, und aus Freundschaft war Feindschaft geworden. Henriette hatte sich über die Jahre wenig verändert. Ihr Gesicht war voller Sommersprossen, die im Verlauf der Jahre etwas dunkler geworden waren, genau wie ihre roten Haare, die sie mittlerweile kurz geschnitten trug. Zöpfe und Haarnadeln hatte Henriette schon immer gehasst, genau wie alle anderen weiblichen Attitüden.
Und nun? Leugnen – oder die Flucht nach vorne antreten und sich zu erkennen geben? Doch wozu, fragte sich Moiken. Als vor gut fünfzehn Jahren das Feuer in der Gerüchteküche besonders hell loderte, hatte Henriette Grondziel sozusagen am Blasebalg gestanden und dafür gesorgt, dass das Brodeln im Kessel nicht aufhörte, bis Moiken die Flucht nach Keitum ergriffen hatte.
Nachdem von ihr so lange keine Reaktion kam, wurde Henriette unsicher. »Bist du nicht Moiken Petersen aus Klanxbüll?«
Der Mädchenname stimmte, offenkundig war Henriette jedoch die Heirat entgangen, und mit einiger Genugtuung nahm Moiken zur Kenntnis, dass Henriette hinsichtlich des Wohnorts selbst einem Gerücht aufgesessen war.
»Jacobsen«, sagte Emma, noch ehe Moiken sich entschieden hatte, wie sie reagieren sollte. »Wir heißen Jacobsen und wohnen in Keitum.«
Henriette legte den Kopf schräg. »Nun, dann war das wohl eine Verwechslung – Verzeihung, es ist schon lange her. Aber das hätte mich auch gewundert, wenn sich diese Weibsperson noch einmal in Westerland blicken ließe. Nun, womit kann ich Ihnen also dienen? Kommen Sie doch herein!«
Wortlos zog Moiken ihr Pferd am Zügel weiter und ihre Tochter an der Hand hinterher.
»Lass mich los, ich bin doch kein Kleinkind!«, rief Emma, kaum dass die Ladentür mit einem Glöckchenläuten ins Schloss gefallen war. Und nachdem sie ein paar Schritte gegangen waren, setzte Emma hinzu: »Nun behaupte du noch einmal, ich sei unfreundlich zu den Leuten, weil ich vergessen habe, Bitte oder Danke zu sagen – du hast dich von der Ladenbesitzerin nicht mal verabschiedet.«
»Ich habe meine Gründe, das kannst du mir glauben.«
»So, so. Welche Gründe denn?«
»Das geht dich nichts an«, erwiderte Moiken harscher als gewollt, denn sie hatte nur die Absicht, ihre Tochter vor der Geschichte zu schützen, durch die ihre Mutter unter einen so schrecklichen Verdacht geraten war.
»Hör auf, mich wie ein kleines Kind zu behandeln! Ich bin fünfzehn! Und sag mir endlich die Wahrheit, warum Vater nicht zurückkehrt.«
Moiken holte Luft, und die scheinbar tonnenschwere Last auf ihren Schultern machte daraus einen tiefen Aufseufzer. »Das weiß ich selbst nicht.«
»Ihr habt euch doch vor seiner Abreise gestritten.«
»Gestritten?« Nun war es an Moiken innezuhalten. »Das stimmt doch gar nicht, wie kommst du denn darauf?«
»Ich bilde mir wohl nicht ein, dass Vater zwei Tage vor seinem Aufbruch plötzlich kaum mehr ein Wort für dich übrig hatte, er ist dir aus dem Weg gegangen, und zuletzt hättest du auch einen Baum umarmen können, so reglos, wie Vater dastand. Und am schlimmsten für mich war, dass er sich mir gegenüber genauso distanziert verhalten hat.«
»Abschiede sind manchmal schwierig«, wand sich Moiken unter den Vorhaltungen ihrer Tochter, mit denen sie natürlich recht hatte. Doch eine Erklärung für sein abweisendes Verhalten hatte sie von ihrem Mann auch nicht bekommen.
In den vergangenen drei Monaten hatte Moiken häufiger darüber nachgedacht, ob das ein Vorbote gewesen war, dass er nicht zurückkehren würde, allerdings konnte sie sich keinen wirklichen Reim darauf machen. »Wir haben jedenfalls nicht gestritten«, fügte sie hinzu.
»Du lügst!«, rief Emma.
»Hüte deine Zunge!«, raunte Moiken im Angesicht eines pelzbemäntelten Ehepaars, das kopfschüttelnd vorüberging. »Ich sage es dir ein letztes Mal.«
»Von dir lasse ich mir gar nichts mehr sagen!«, keifte Emma.
Moiken hielt es für angebracht, nichts zu entgegnen.
Schweigend gingen sie weiter die Neue Straße entlang und an der katholischen Kapelle vorbei, die vor siebzehn Jahren auf Betreiben eines einzigen Katholiken erbaut worden war.
Ob der stadtbekannte Wenzel Wohner wohl noch lebte? Der Österreicher war der Liebe wegen über 1000 Kilometer zu Fuß bis nach Westerland gegangen, doch mit seinem Brief, in dem er den zuständigen Bischof um einen Kirchenbau für sich, den einzigen Katholiken, bat, erreichte er nicht das Ziel. Keinen Pfennig, so schrieb der Bischof zurück, gebe er für den Bau einer solchen Kirche – auf einer Insel ohne Moral. Diese Antwort war bald in aller Munde gewesen, Spott hatte sich über Wenzel Wohner ergossen, doch er hatte nicht aufgegeben. Die Berge gegen das flache Eiland zu tauschen mochte der Liebe wegen ja noch angehen, aber auf den Weihrauch zu verzichten – undenkbar.
Moiken sah sogar noch die Anzeige mit der Bitte um Bausteine im Sylter Intelligenz-Blatt vor ihrem geistigen Auge. Tatsächlich kamen 2000 Goldmark zusammen, und die Zeitung freute sich, dass mit dem Bau der stattlichen Kapelle für 160 Personen nun für manchen ein Hindernis im Besuch des Seebades beseitigt sei.
Damals hatte Wenzel Wohner im Süden Westerlands am Anfang der Damenbadstraße gewohnt, nur ein paar Häuser weiter lebte Käpt’n Corl, wie man ihn im Volksmund nannte, jedenfalls auch ein Unikat. Er müsste mit seinen nunmehr rund fünfzig Jahren eigentlich noch leben, und sie würde ihn sehr gern mal besuchen, doch direkt daneben befand sich ihr Elternhaus, gegenüber dem Friedhof der Heimatlosen, wo Leichen beerdigt wurden, die das Meer angespült hatte. Was, wenn ihr Ehemann an irgendeiner Küste angespült worden war und nun auf einem solchen Friedhof lag? Ihre Briefe an die Reederei und sämtliche Nachfragen per Telegramm waren unbeantwortet geblieben.
Je näher sie der Friedrichstraße kamen, desto kälter pfiff der Westwind zwischen den Häusern hindurch, und Moiken zog die Kapuze unter dem Kinn zusammen, unter der sie im doppelten Sinne Schutz suchte, bis sie das Eckhaus erreichten.
Die Buch- und Papierwarenhandlung von Julius Meyer befand sich in einem Anbau, der schlicht und gerade so breit wie das Schaufenster nebst Tür war. In deutlichem Kontrast dazu stand das angrenzende mondäne Logierhaus im Seebäderstil mit schmucken, weiß gestrichenen Holzveranden auf allen drei Stockwerken.
Moiken kannte den freundlichen Besitzer noch von früher, mittlerweile müsste er bestimmt über siebzig sein. Jedes Kind, so erinnerte sich Moiken, das seinen Laden betrat, bekam ein Bonbon geschenkt, was viele weidlich ausgenutzt hatten.
Doch nichts konnte die Engelsgeduld des Mannes ins Wanken bringen, erst recht nicht die Schar seiner eigenen Kinder, für die zwei Hände gerade noch zum Zählen ausreichten.
Schöne Erinnerungen, und dennoch zögerte Moiken bei dem Gedanken, gleich durch diese Tür treten zu müssen. Was, wenn sie am Ende gar nicht hören wollte, wer die Annonce aufgegeben hatte – wenn es doch kein schlechter Scherz war? Aber blieb ihr eine andere Wahl, als das herauszufinden?
»Möchtest du wieder draußen warten?«, fragte sie ihre Tochter, die selbstvergessen Adrianos Zügel hielt und ein Ehepaar beobachtete, das aus dem gegenüberliegenden Hotel und Restaurant Seestern kam, wo auf einer großen Tafel für Suppe aus frischen Schildkröten geworben wurde. Als Kinder hatten sie sich mal in den Hinterhof geschlichen, wo die frisch geschlachteten Riesenschildkröten aufgehängt waren. Damals waren sie fasziniert gewesen, heute erschauderte sie allein beim Gedanken daran.
»Also, was ist nun, Emma?«
»Natürlich will ich nicht draußen warten! Erstens will ich nicht noch mal fast erfrieren, und zweitens will ich mit eigenen Ohren hören, wer diese Annonce aufgegeben hat – wer weiß, ob du mir die Wahrheit sagen würdest.«
Moiken zuckte unter den Worten zusammen, denn Emma hatte recht. Zwar wohl nicht in diesem Fall, doch grundsätzlich verbarg sie zu viel vor ihrer Tochter, und deshalb stand es leider mit ihrem Vertrauensverhältnis nicht zum Besten. Oft hatte Emma nach den Gründen gefragt, weshalb sie nicht mal nach Westerland fuhren, und nur Antworten erhalten, die ihre Tochter mittlerweile als faule Ausreden erkannte.
Es wäre längst an der Zeit, mit Emma über die Geschehnisse in jener Nacht zu sprechen, in der ihr Onkel ums Leben gekommen war, denn für seinen Tod war sie, Moiken, nicht verantwortlich. Aber das war schließlich nicht alles, was in jenen Stunden passiert war. Nur war es nicht besser, Emma zu schützen? Wie würde sie darauf reagieren, wenn sie erfuhr, dass auch ein anderer Mann ihr Vater sein könnte? Könnte Emma ohne dieses Wissen nicht unbeschwerter durchs Leben gehen? Wer tatsächlich Emmas Vater war, würde man ohnehin nie feststellen können.
Moiken seufzte tief. »Dann binde Adriano am Zaun an und komm.«
Julius Meyer stand wie immer hinter seiner hölzernen Theke, so als ob keine Zeit vergangen wäre. Schon damals waren sein langer Spitzbart und die bis in den Nacken reichenden Haare schlohweiß gewesen. Im Laden war wesentlich mehr Platz, als man von außen vermutete, da er sich über die gesamte Länge des Hauses erstreckte.
Der Buchhändler war gerade mit einer Kundin im Gespräch und hatte etwas in einem Verzeichnis nachgeschlagen.
Der Büchergeruch wirkte unmittelbar wie Seelenbalsam auf Moiken. Wie gern würde sie sich jetzt ein Buch kaufen und Emma sagen, dass sie sich auch eines aussuchen dürfe.
An langen Winterabenden am Ofen sitzen und lesen, anstatt Kleidung zu flicken oder Wolle zu spinnen. Welch ein Luxus.
Julius Meyer hatte ihr Eintreten bemerkt und bedeutete ihr mit einem freundlichen Nicken, noch kurz zu warten. Er schob seine Lesebrille mit den runden Gläsern zurück auf die Stirn, wie es seine Gewohnheit war. Nicht etwa auf den Kopf, sondern tatsächlich nur bis knapp über seine buschigen Augenbrauen, wo das Gestell erstaunlicherweise Halt fand, sogar als er die Stirn runzelte.
»Die blonde Sylterin von Max Eggendorf muss ich leider erst bestellen. Aber die Sagen und Erzählungen unseres Inselchronisten C.P. Hansen habe ich alle auf Lager. Wenn Sie sich einmal im Regal umschauen möchten?«
»Nein, möchte ich nicht«, entgegnete die Dame pikiert. »Welches davon empfehlen Sie mir, das nehme ich.«
»Ich weiß ja nicht, was Ihrem Geschmack entspricht«, entgegnete Julius Meyer leicht irritiert. »Grundsätzlich sind alle Schriften unseres Inselchronisten sehr empfehlenswert, aber suchen Sie sich doch gern etwas aus, das Ihnen inhaltlich zusagt. Die blonde Sylterin wäre dann zu nächster Woche hier.«
Die Dame schüttelte vehement den Kopf. »Sie verstehen nicht. Ich möchte ein Buch lesen, das mir empfohlen wurde, und keines nach Geschmack. Wir sind doch hier nicht in der Küche.«
»Ich fürchte, dann verstehen wir uns wirklich nicht. Mit einem guten Buch ist es wie mit der Liebe. Natürlich kann ich Ihnen ein möglicherweise geeignetes Exemplar empfehlen, doch besser ist es, Sie gehen selbst ans Regal, betrachten die Auswahl, befühlen das Buch, lesen hinein, und ich bin mir sicher, Sie merken dann sofort, für welches Ihr Herz schlägt.«
»Was reden Sie denn für dummes Zeug daher, ich muss mich wundern«, entgegnete die Dame. »Wobei ich während meines Aufenthalts hier schon zahlreiche Menschen mit wunderlicher Geisteshaltung angetroffen habe. Das scheint wohl an der Beschränktheit dieser Insel zu liegen, die sich auf ihre Bewohner überträgt. Offenkundig gilt das auch für Sie.«
Spätestens jetzt hätte Moiken anstelle des Buchhändlers aufgebracht reagiert, doch der zuckte unbeeindruckt die Schultern. »Genau genommen ist es so, dass das Buch seinen Leser findet, so wie die Liebe zu einem kommt, ohne dass man sich das aussuchen kann. Aber ich denke mir, das werden Sie erst recht nicht verstehen.«
»Wollen Sie damit jetzt sagen, ich sei dumm, nur weil ich Ihr Gerede nicht nachvollziehen kann?«, echauffierte sich die Dame.
»Niemals.« Julius Meyer stützte sich auf den Tresen. »Aber ich behaupte, dass es Menschen gibt, die das Reizklima auf dieser Insel nicht vertragen. Diese Personen sollten dann auch nicht mehr wiederkommen, wenn sie schlau sind.«
»Pah!«, machte die Dame, zog sich ihre weißen Handschuhe an und wandte sich zum Gehen. »Dann auf Wiedersehen.«
Kopfschüttelnd sah Julius Meyer die Frau an. »Wir haben uns immer noch nicht verstanden. Ich meinte nicht ›auf Wiedersehen‹.«
»Das ist ja unerhört! So etwas habe ich noch nicht erlebt!«, rief die Frau und rauschte aus dem Laden, dass die Tür krachend ins Schloss fiel.
Belustigt sah Moiken der Dame hinterher. Ganz schön mutig von dem Buchhändler, dachte sie, so mit seiner Kundschaft umzugehen. »Sind alle Sommerfrischler so?«, fragte Moiken. »Wobei Sie auf die Beleidigungen der Dame noch ganz anders hätten reagieren können.«
»Ich habe meine Prinzipien«, sagte Julius Meyer. »Und über die Jahre habe ich viel über wunderliche Sommerfrischler gelernt. Alles muss so laufen, wie diese das wünschen, ansonsten beschweren sie sich. Nun denn, vielleicht hätte ich ihr doch Sigmund Freud nahelegen sollen, insbesondere sein Buch zur Psychopathologie des Alltagslebens. Besonders schlimm ist es mit den Gästen, wenn das Wetter schlecht ist. Dann weiß ich schon am Morgen, dass schwierige Kunden auf mich warten. Aber das hier ist mein Laden und meine Art, Bücher zu verkaufen. Wer sich darauf nicht einlassen möchte und deshalb meint, mich beleidigen zu müssen, den muss ich enttäuschen. So einfach ist das.«
Moiken nickte. Wenn es nur immer so einfach wäre, dachte sie.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte Julius Meyer und wandte sich zugleich an Emma. »Du schaust dich so um, als ob du noch nie in einer Buchhandlung gewesen wärst?«
»Das stimmt auch«, entgegnete Emma. »Und das alles verkaufen Sie? So viele Bücher?«, hakte sie fasziniert nach.
Lächelnd kam Julius Meyer hinter seinem Tresen vor. »Sogar noch viel mehr. Man bekommt bei mir Papierwaren aller Art, außerdem Postkarten, wunderschöne Bildermappen der Insel, Landkarten, Reiseführer, Broschüren und in der Strandlesehalle, oberhalb der Promenade, stelle ich 450 der wichtigsten Tagesblätter, Zeitschriften, Illustrations- und Fachjournale bereit.«
»So viele …?«, begann Emma, doch es hatte ihr die Sprache verschlagen.
Der Buchhändler lachte auf, sodass sein Spitzbart erzitterte. »Ja, das ist eine beeindruckende Zahl, nicht wahr? Die Betreuung übernimmt zum Glück meine Frau, denn ich muss mich ja hier auch noch um meine wohlassortierte Leihbibliothek kümmern, die ich neben dem Verkauf führe. Und du kommst von der Insel, bist aber zum ersten Mal in Westerland, junges Fräulein?«, fügte er nahtlos an, als sei das, worüber er soeben gesprochen hatte, nichts Besonderes gewesen.
Emma nickte nur. Ihre Aufmerksamkeit wurde von einem Buch eingenommen, das auf dem Tresen mit dem Vermerk »neu« ausgestellt war. Darauf war als Zeichnung eine fliegende Möwenschar zu sehen, und der Titel war vor blauem Hintergrund mit gelben Buchstaben gesetzt: Sylt – Nordseebäder Westerland und Wenningstedt.
»Sieh es dir ruhig an«, ermunterte er sie und reichte ihr das Buch. »Es ist druckfrisch.«
Emma nahm es entgegen wie einen kostbaren Schatz und blätterte die bebilderten Seiten fasziniert durch. »Darf ich … also … könnte ich … dürfte ich mir dieses Buch vielleicht einmal ausleihen?«, fragte Emma.
»Leider kann man Reiseführer bei mir nicht ausleihen, nur kaufen.«
»Oh«, machte Emma und senkte den Kopf. Sie wusste, dass dafür kein Geld da war, allerdings war sie offenbar vollkommen in den Bann dieses Buches geraten, denn es führte ihr eine neue Welt vor Augen, über die sie unbedingt mehr wissen wollte.
Moiken überlegte einerseits, wie sie ihrer Tochter diesen Wunsch erfüllen könnte. Andererseits machte ihr das Interesse ihrer Tochter etwas Angst. Das Leben in Keitum war bislang so schön ruhig und beschaulich – und vor allem überschaubar gewesen. Das sollte auch Emma lieber zu schätzen wissen und nicht dem Reiz des Neuen verfallen.
In ihre Gedanken hinein ergriff Julius Meyer wieder das Wort, der Emma unterdessen genau dabei beobachtet hatte, wie sie erneut in dem Buch blätterte und den Inhalt der Seiten begierig aufsog.
»Wie heißt du denn?«, wollte Julius Meyer nun wissen, und er musste die Frage wiederholen, bevor sie reagierte, weil sie so versunken gewesen war.
»Emma.«
»Weißt du was, Emma, ich schenke dir das Buch.«
»Nein, nein«, fuhr Moiken dazwischen und erntete dafür einen bösen Blick ihrer Tochter. »Das können wir nicht annehmen. Außerdem sind wir keine Touristen.«
»Das weiß ich doch«, erwiderte Julius Meyer. »Außerdem habe ich dich erkannt. Du bist Moiken, nicht wahr? Bist lange nicht mehr in der Stadt gewesen.«