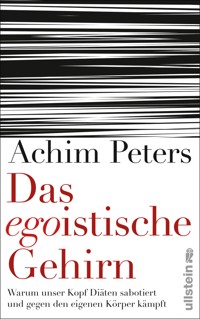
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Unser Gehirn ist ein egoistischer Despot. Kommt es in Versorgungsnot, können wir noch so entschlossen sein, eine Diät einzuhalten – unser egoistisches Gehirn wird etwas dagegen haben und seine eigenen Energieansprüche sogar gegen unseren Willen durchsetzen. Das hat der renommierte Hirnforscher und Internist Professor Dr. Achim Peters in weltweit einzigartigen Studien nachgewiesen. Bei Stress reicht die übliche Energie für unser Gehirn nicht aus – wir essen mehr, um es gut zu versorgen. Wenn wir uns aber an Dauerstress gewöhnen, kann das fatale Folgen haben: Wir werden dick und bekommen die überflüssigen Kilos nicht wieder los. Hier berichtet Peters erstmals, auf welchen Forschungen seine sensationellen Erkenntnisse fußen und wie das Gehirn der Schlüssel für erfolgreiche Therapien sein kann. Dieses Buch ist eine aufregende Entdeckungsreise zu uns selbst. Informieren Sie sich auch bei unserem Kooperationspartner www.diabetesDE.org.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Achim Petersmit Sebastian Junge
Das egoistische Gehirn
Warum unser Kopf Diäten sabotiert undgegen den eigenen Körper kämpft
Ullstein
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwaVervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oderÜbertragung können zivil- oder strafrechtlichverfolgt werden.
ISBN 978-3-8437-0016-0
© 2011 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenAbbildungen: Deutscher Infografikdienst, infografikdienst.deeBook: LVD GmbH, Berlin
Für Lisa Marie und Lasse
Prolog Das Rätsel von Sikinien
Im Sommer des Jahres 2008 befand ich mich auf einem Flug von Hamburg nach Spanien. Ich blickte gedankenverloren aus dem Fenster und sah, wie die Maschine bei klarem Wetter Lausanne und Montreux am Genfer See überflog. Hier hatte ich eine Woche zuvor meinen Freund und Kollegen Luc Pellerin besucht. Es waren aufregende Tage, in denen wir Ideen diskutiert und Forschungsergebnisse ausgetauscht hatten. Während weit unter mir mächtige Bergformationen vorüberglitten, durchströmte mich plötzlich ein tiefes Glücksgefühl. Inspiriert durch die Lektüre eines Buches, in dem ein Philosoph den Moment seiner Jugend beschreibt, in dem er eine entscheidende Erkenntnis machte, die sein Leben prägen sollte, war auch ich in meine Vergangenheit abgetaucht … Sommer 1976, ich hatte endlich mein Abitur in der Tasche und in Vorbereitung auf mein Medizinstudium ein Krankenpflegepraktikum begonnen. In jenem Sommer nahm ich auch an der zweiten Runde im Bundeswettbewerb Mathematik teil. Man musste in zwei Monaten vier Aufgaben zu Hause lösen, drei hatte ich schon. Die vierte gestaltete sich schwieriger, ich suchte schon seit Wochen nach einer Lösung: »Auf der Insel Sikinien gehen von jedem Dorf drei Straßen aus. Jede dieser Straßen führt wieder in ein anderes sikinisches Dorf. Andere Straßen gibt es dort nicht, und die Zahl der Dörfer ist begrenzt. Ein Wanderer startet im Dorf A und wählt im nächsten Dorf die linke Straße der Gabelung, im übernächsten die rechte, dann wieder die linke, immer abwechselnd. Beweise, dass der Mann schließlich ins Dorf A zurückkommt.«
Plötzlich fällt mir der entscheidende Gedankenschritt ein. Die Lösung muss etwas damit zu tun haben, dass es nicht unendlich viele Dörfer auf Sikinien gibt! Ja, so konnte ich zeigen, dass sich der Straßenzug zu einer »geschlossenen Figur« fügt, die zum Ausgangspunkt zurückführt. Das Glücksgefühl, als ich diese vierte Aufgabe endlich gelöst hatte, war unbeschreiblich. Und ich weiß noch, wie ich später oft davon träumte, dass ich eine so klare Lösung auch einmal für ein Problem im Bereich der Medizin finden würde. Als ich nun im Flugzeug aus dem Fenster blickte, begriff ich plötzlich, wie nahe ich der Verwirklichung dieses Traums gekommen war. Ich hatte meine geschlossene Figur gefunden! Denn so wie der Wanderer auf unserer Insel wieder an den Ausgangspunkt seines Weges zurückkehrt, so hatte ich herausgefunden, dass die Energie für das Gehirn von dem Ort aus bestellt wird, an dem sie benötigt wird. Die Lösung meines medizinischen Rätsels von Sikinien lautete nämlich: »Das Gehirn versorgt sich selbst zuerst.«
TEIL I
Wie unser Gehirn den Stoffwechsel kontrolliert
Übergewicht – alles nureine Frage des Willens?
Der Blick auf die Waage bestätigt die schlimmsten Befürchtungen: zwei Kilo zugenommen, innerhalb weniger Tage. Wieder einmal waren die wochenlangen Diätbemühungen vergebens. Dabei hatte alles so hoffnungsvoll begonnen: Die Pfunde schmolzen dahin wie Butter an einem schönen Sommertag. Doch der Stolz über die ersten geschwundenen Pfunde verflog rasch. Der Verzicht, das Mit-sich-Ringen um jede Mahlzeit, die schlechte Laune, die quälenden Heißhungerattacken und die ständigen Gedanken ans Essen nagen am Felsen der Entschlusskraft – bis zu jenem entscheidenden Moment der Schwäche, in dem man alle Vorsätze über Bord wirft. Plötzlich scheint alles egal, Hauptsache, wieder einmal richtig essen …
Jeder, der schon einmal eine Diät gemacht hat, kennt solche Situationen. Dabei suggerieren uns Ratgeber und Zeitschriften, dass die Sache mit dem Abnehmen doch ganz einfach sei. Gewicht verlieren ist schließlich nur eine Willensfrage, nicht wahr? Oder warum fühlen wir uns schuldig, wenn wir trotz aller Bemühungen nicht abnehmen oder schon in kürzester Zeit wieder an Gewicht zulegen? Schlanksein ist längst zu einer zentralen Wertenorm in unserer Gesellschaft geworden, und wer ihr nicht entspricht, hat es schwerer, anerkannt zu werden. Schlank zu sein suggeriert Aktivität, Lebensfreude und Leistungsfähigkeit. Übergewicht hingegen scheint der Inbegriff mangelnder Disziplin zu sein, gepaart mit der Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Wer das noch nicht einmal für den eigenen Körper schafft, wie kann so ein Mensch dann zu einem vollwertigen Leistungsträger der Gesellschaft werden, die uns doch immer mehr Dynamik und Flexibilität abverlangt?
Die Sichtweise, dass das Streben nach Lustgewinn ein Ausdruck mangelnder Willenskraft sei, hat im abendländisch-christlichen Kulturkreis eine lange Tradition. Im Mittelalter wurde unmäßiges Essen sogar als Todsünde angesehen. So beschreibt der italienische Dichter Dante in seiner Göttlichen Komödie, wie Schlemmer und Fresssäcke in der Hölle bestraft werden: »Tief im Schlamm und Kot liegen sie, der Regen klatscht unerbittlich auf sie nieder … wegen der Gaumensünde, der verderblichen.« Bis heute werden übergewichtige Menschen stigmatisiert. Nicht immer geschieht dies aus Bosheit. Im Gegenteil: Vieles, was sich übergewichtige Menschen anhören müssen – von den Medien, Mitmenschen oder Experten –, wird mit besten Absichten geäußert. Es geht ihnen um die Vorbeugung von gesundheitlichen Problemen, sie warnen vor einem Anstieg von Diabetes und anderen Erkrankungen, die nicht nur für den Einzelnen, sondern für das ganze Gesundheitssystem gravierende Folgen haben.
Tatsächlich aber offenbaren all die gutgemeinten Abnehmempfehlungen eine große Ratlosigkeit. Denn die Medizin blieb bis heute konkrete Antworten auf die Frage nach den Ursachen von Übergewicht schuldig. Betrachtet man die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), so scheinen sie zu bestätigen, dass es uns bis heute an den richtigen Angriffspunkten zur Vorbeugung und Behandlung mangelt. Es sind die Zahlen einer stillen Gesundheitskatastrophe: Weltweit sind 1,6 Milliarden Erwachsene übergewichtig. 400 Millionen von ihnen haben Adipositas, also so starkes Übergewicht, dass es als Krankheitsbild eingestuft wird. 42 Millionen Kinder unter fünf Jahren wiegen ebenfalls deutlich zu viel. Im Report der WHO wird Übergewicht seit Jahren als globale Epidemie aufgeführt – und als das kostspieligste Gesundheitsproblem der kommenden Jahrzehnte. In einigen Bundesstaaten der USA hat sich die Zahl der an Adipositas erkrankten Erwachsenen seit 1980 mehr als verdreifacht; dort wurde inzwischen sogar der Begriff der Superadipositas (ab einem Body-Mass-Index von über 35) eingeführt. Ähnlich dramatisch ist die Situation in Großbritannien, Osteuropa oder Ozeanien. Und in der EU liegt Deutschland mit 75,4 Prozent übergewichtigen Männern und 58,9 Prozent übergewichtigen Frauen auf Platz eins. Insbesondere für deutsche Kinder und Jugendliche sind die Zahlen beunruhigend gestiegen, bereits heute sind 14,8 Prozent oder 1,7 Millionen übergewichtig. Was müssen wir ändern, damit unsere Kinder schlank bleiben und die Epidemie endlich zum Stillstand kommt?
Auch das chinesische Gesundheitswesen sieht sich mit einer zunehmenden Übergewichtsproblematik konfrontiert – zumindest in der Bevölkerung der schnell wachsenden Metropolen. Hier hinterlässt der rasante wirtschaftliche Aufstieg Spuren im Stoffwechsel der Menschen, und das mit einer Geschwindigkeit, die alarmierend ist: 53,9 Prozent der Einwohner von Peking und 34 Prozent der Einwohner von Shanghai wiegen zu viel. Und was ist mit dem Kontinent, der im allgemeinen Bewusstsein mit Hunger und Unterernährung in Zusammenhang gebracht wird? So unglaublich es klingen mag, selbst in Afrika breitet sich Übergewicht aus. Doch warum gelingt es nicht, dieser Epidemie Einhalt zu gebieten, obwohl in vielen Ländern enormer finanzieller und therapeutischer Aufwand betrieben wird? Gegessen hat die Menschheit immer – warum wurde Essen plötzlich zum Problem? Und warum kann niemand dieses Problem lösen? Woran liegt es also, dass die Menschen immer dicker werden?
»Der Grund für Übergewicht liegt im Energiestoffwechsel des Körpers«, davon war der Physiologe Jean Mayer überzeugt. Er hatte in den 1950er Jahren als Erster den Versuch unternommen, die Stigmatisierung von übergewichtigen Menschen durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu beenden. Er wollte mit einem physiologischen Modell belegen, dass die Nahrungsaufnahme nicht vom Willen abhängt, sondern vom Energielevel in unserem Körper reguliert wird. Ausgehend von dieser Grundidee nahm Mayer den medizinischen und gesundheitspolitischen Kampf gegen das Phänomen des Übergewichts in den USA auf.
Der gebürtige Franzose, ein Ernährungsexperte mit ausgeprägtem politischem Bewusstsein und großem Einfluss, wurde zu einem der maßgeblichen Vordenker im Kampf gegen die Ausbreitung von Übergewicht und Typ-2-Diabetes. Mayer, der aus einer traditionsreichen Familie von Unternehmern und Ärzten stammte, wurde am 19. Februar 1920 in Paris geboren. An der Sorbonne studiert er zunächst Philosophie, Mathematik und Biologie, bis ihn der Zweite Weltkrieg zur vorläufigen Aufgabe seiner Universitätslaufbahn zwingt. Nach dem Krieg entschließt sich Mayer, in die USA auszuwandern, wo er wissenschaftlich in die Fußstapfen seines Vaters, eines renommierten Physiologen, tritt. In Yale promoviert er in Physiologischer Chemie, weitere Stationen seiner wissenschaftlichen Karriere werden die Washington Medical School und Harvard. Mayer ist der neue strahlende Stern am Wissenschaftshimmel – zumal er sich mit einem Bereich beschäftigt, der medizinisch und gesundheitspolitisch an Bedeutung gewinnt. Sein Interesse gilt der Ernährungsforschung, die Entstehung und Behandlung von Übergewicht und Diabetes macht er zu seinem Spezialgebiet. Nach Jahrzehnten, die geprägt waren von Wirtschaftskrisen, Mangel, Krieg und Rationierungen, bricht mit den 1950er Jahren eine Epoche des Wohlstands an. Die Ernährungsgewohnheiten der Amerikaner verändern sich dramatisch. Aus dem American Diner entstehen Fastfood-Ketten. Schnelles Essen verdrängt zunehmend die häusliche Kultur des Kochens und des gemeinsamen Miteinanders bei Tisch. Die Folgen dieses Wandels sind aus damaliger medizinischer Sicht eklatant: Übergewicht und Diabetes breiten sich in der Bevölkerung aus. Für die Behandlung von Stoffwechselerkrankungen waren Ärzte damals nur unzureichend gerüstet. Insbesondere der insulinabhängige jugendliche Diabetes (Typ 1) stellte die Mediziner vor Probleme. Der Blutzucker konnte nur langwierig in Monatsabständen vom Hausarzt gemessen werden, während es heutzutage Teststreifen gibt, mit denen jeder Diabetespatient selbst mehrfach am Tag seinen Blutzucker rasch bestimmen und so seine Nahrungsaufnahme und seine Insulindosis anpassen kann. Auch die medizinischen Möglichkeiten, das Risiko von Folgeerkrankungen zu senken, waren vor fünfzig Jahren wesentlich begrenzter als heute. Und die Ursachen, die überhaupt erst zur Eskalation des Stoffwechsels und damit zu Übergewicht und zum nicht-insulinabhängigen Alters-Diabetes (Typ 2) führen, lagen im Dunkeln.
Mayer wollte dies ändern. Er setzte sich das Ziel, die Gesetze der Energieversorgung des Körpers zu finden und zu erklären. Dabei legte er zunächst einen Grundgedanken fest: Der Energiefüllstand im Körper bestimmt die Nahrungsaufnahme. Mit anderen Worten: Wenn zu wenig Energie in unserem Körper vorhanden ist, werden wir hungrig und essen; wenn das Energielevel im Körper wieder ansteigt, sind wir satt und hören auf zu essen. Dieser Prämisse folgend, müsste es also ein Signal geben, das zunächst anzeigt, dass der Körper Energie benötigt, und diese dann gezielt anfordert.
Auf der Suche nach einem solchen Botenstoff, der den Energiefüllstand im Körper signalisiert, hatte sich Mayer dem Naheliegendsten zugewandt: dem Blut. Glukose war als wichtigste Energiewährung des Körpers bereits bekannt, und Blutzuckerwerte spielten schon bei der Behandlung der größten bekannten menschlichen Energiekrise, des Typ-1-Diabetes, eine entscheidende Rolle. Genau dort knüpft Mayers »Glukostatische Theorie« an. Sie besagt, dass das Gleichgewicht des Blutzuckers der entscheidende Faktor bei der Energieversorgung des Körpers ist. Der Blutzucker, der durch die Nahrungsaufnahme reguliert wird, bestimmt die Energieversorgung aller Organsysteme einschließlich des Gehirns.
Jean Mayer veröffentlichte seine Theorie im Jahr 1953. Noch im selben Jahr kam eine Variante von Mayers Grundgedanken auf: die »Lipostatische Theorie« von Gordon C. Kennedy. Auch er ging davon aus, dass der Energiehaushalt durch einen Botenstoff aus dem Körper reguliert würde. Kennedy vermutete diesen Stoff aber nicht im Blut, sondern im Fettgewebe. Nach seiner Theorie setzen Fettzellen je nach Füllstand Botenstoffe frei, die dafür sorgen, dass mehr oder weniger Nahrung zugeführt wird. Kennedy suchte nach einer Art Sättigungshormon, ohne es allerdings finden zu können. Andere Wissenschaftler folgten ähnlichen Ansätzen und forschten im Magen-Darm-Trakt nach einem eindeutigen Hinweis zur Energieregulierung. Einen entscheidenden Durchbruch bei der Frage nach der Entstehung von Übergewicht erzielte mit all diesen Forschungsansätzen bis heute niemand.
Am Ende setzte sich Mayers Grundgedanke in der medizinischen Behandlung von Übergewicht und Diabetes durch. Jean Mayer investierte viel Zeit in die Erforschung seiner Glukostatischen Theorie. Er konnte durch Studien und Publikationen ihren Geltungsbereich erweitern, allerdings gelang ihm dies nicht lückenlos. Trotz seiner jahrzehntelangen Bemühungen blieben viele Fragen offen, darunter eine ganz entscheidende: Warum isst ein Patient mit Diabetes, obwohl sein Blutzucker dramatisch erhöht ist? Aufgrund seines hohen Blutzuckers müsste er gemäß Mayers Theorie eigentlich sofort zu essen aufhören. Die aus Mayers Grundgedanken abgeleitete Lipostatische Theorie wies eine ähnliche Lücke auf: Warum isst ein Patient mit Übergewicht, obwohl seine Fettspeicher übervoll sind? Gemäß den Vorhersagen des Modells dürfte auch er wegen des hohen Energiefüllstandes im Körper nicht mehr essen. Warum sich diese Prognosen in der Praxis nicht bestätigen, auf diese Frage konnte bis heute niemand eine Antwort geben.
Von 1969 an kehrte Mayer der experimentellen Forschung den Rücken, wurde Präsident der Tufts University und in den folgenden Jahren gesundheitspolitischer Berater von drei US-Präsidenten – Richard Nixon, Gerald Ford und Jimmy Carter. Obwohl seine Theorie offenkundige Schwächen hatte, war er bis 1993 der einflussreichste Experte für Ernährungsfragen in den USA. Unter seiner Leitung wurden diverse Programme und Richtlinien zur Bekämpfung von Unter- und Überernährung aufgelegt und zum Teil zu Gesetzen und Verordnungen geformt. Sein Denkansatz fand weltweit Beachtung und hatte auch Auswirkungen auf das Gesundheitswesen in Deutschland. Die gesamte Fachrichtung der Diabetologie etwa basiert auf Mayers Theorie und formuliert dementsprechend ihre Therapieziele: Der Blutzucker soll in engen Grenzen normal oder nahe normal eingestellt werden, auch bei Menschen mit Typ-2-Diabetes. Gleiches gilt für die Bewertung von Gesundheitsrisiken durch Übergewicht in der Inneren Medizin; auch das Körpergewicht soll gemäß der von Mayers Grundidee abstammenden Lipostatischen Theorie auf normal eingestellt werden. Dementsprechend zielt die daraus abgeleitete Therapie von Adipositas schlicht auf eine Normalisierung des Körpergewichts.
Jean Mayers Konzept hat über die vergangenen Jahrzehnte die gesundheitspolitische Diskussion geprägt. Die Erfolge indes sind bescheiden. Die Industrienationen geben nach wie vor Milliarden für die Behandlung von Übergewicht und den daraus entstehenden Folgeerkrankungen aus. Parallel dazu hat sich ein weiterer Milliardenmarkt etabliert, der Unsummen mit Diäten, kalorienreduzierten Lebensmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln verdient. Alles, um das Übergewichtsproblem zu lösen. Alles vergebens, wie die Statistiken der WHO belegen.
Erstaunlicherweise machen trotzdem alle so weiter wie bisher: die Mediziner, die Politiker, die Ernährungsberater, die Physiologen … In einer Situation, in der ein Problem trotz vielfältiger Bemühungen unlösbar erscheint, steht die Schuldfrage hoch im Kurs. Irgendjemand muss doch für die Übergewichtsepidemie verantwortlich sein. Diesen endlosen und ebenso sinnlosen Diskurs hat der Kinderarzt Robert H. Lustig in einem Artikel in der Fachzeitschrift Pediatric Annals treffend so beschrieben: »Die Gesundheitsbehörden sagen, Übergewicht resultiert aus einem Ungleichgewicht im Energiehaushalt – es wird zu kalorienreich gegessen und zu wenig Sport getrieben. Die Lebensmittelkonzerne beklagen, dass sich die Menschen nicht genug bewegen, die TV-Industrie behauptet, es liegt an der falschen Ernährung, die Atkins-Leute verteufeln die Kohlenhydrate, die Ornish-Befürworter verdammen das Fett, die Fruchtsafthersteller machen die Limonaden verantwortlich, die Limonadenhersteller verweisen auf die Fruchtsäfte. Die Schule sieht die Verantwortung bei den Eltern, die Eltern sehen die Schule in der Pflicht. Wie soll man ein Problem lösen, wenn sich niemand verantwortlich fühlt?« Und das Problem wird immer drängender. Die eingangs erwähnten WHO-Zahlen werden schon bald überholt sein. Besonders dramatisch ist der rasante Anstieg von übergewichtigen Kindern. Übergewicht in der Kindheit und Jugend wiederum ist ein maßgebliches Vorzeichen für Übergewicht im Erwachsenenalter. Und: Je früher Übergewicht auftritt, desto früher erhöht sich auch das Krankheitsrisiko. Es ist nicht die Zeit, einfach so weiterzumachen. Es ist an der Zeit, eine Krise auszurufen: Wir haben ein riesiges Gesundheitsproblem mit übergewichtigen Kindern und Erwachsenen, und Schuldzuweisungen werden es nicht lösen. Es ist an der Zeit, alte Überzeugungen in Frage zu stellen und die Ursachen, die zu Übergewicht führen, besser zu erforschen und neu zu bewerten. Ein wichtiger Fingerzeig dafür sind neue Forschungsergebnisse, die belegen, dass vermehrte Nahrungsaufnahme letztlich nichts anderes als eine Notlösung des Gehirns ist, das sich in einer Energiekrise befindet. Welche Rolle Stress dabei spielt, was das für Fragen der Ernährung, für Diäten, für die Richtigkeit von Therapien bei Übergewicht und Diabetes, ja sogar für die Erziehung unserer Kinder bedeutet, darum geht es in diesem Buch. Und um die Erkenntnis, dass diese neue wissenschaftliche Sicht herkömmliche Denkansätze zur Entstehung von Übergewicht, die auf »Lustgewinn« und »Schuldzuweisung« beruhen, endlich überflüssig macht.
Das Gehirn auf der Waage
Als selbstkritischer Wissenschaftler setzte sich Jean Mayer immer wieder mit experimentellen Ergebnissen auseinander, die nicht zu seinem Konzept passten. Interessanterweise hätte er die Chance gehabt, eine der entscheidenden Lücken zu schließen, die sowohl in der Glukostatischen wie auch in der Lipostatischen Theorie vorhanden waren, und damit sein Konzept entscheidend zu erweitern und zu verbessern. Denn schon 1921 hatte Marie Krieger, eine Pathologin aus Jena, eine Studie veröffentlicht, die in Mayers Theorie zu einem wichtigen Grundpfeiler hätte werden können. Mayer könnten ihre Arbeiten vorgelegen haben. Umso mehr, da sein Vater und Kriegers Doktorvater, Robert Rössle aus Berlin, die berühmtesten Physiologen ihrer Zeit waren und sicherlich die Arbeiten des jeweils anderen kannten. Jedenfalls hat Mayer die Studie nie in einer seiner Publikationen erwähnt. Was Marie Krieger vor über neunzig Jahren herausfand, können wir also erst heute bewerten: als einen Meilenstein in der Erforschung der Frage, welchen Einfluss der Energiebedarf des Gehirns auf unser Körpergewicht hat.
Frühjahr 1917: Über zehn Millionen deutsche Soldaten führen einen Zweifrontenkrieg – im Westen gegen Frankreich und seine Verbündeten England und die USA, im Osten gegen das zerfallende russische Reich. Nicht nur für die Soldaten, auch für die Zivilbevölkerung hat der lange, zermürbende Krieg fatale Folgen. Aufgrund der Kontinentalblockade der Alliierten wird die Versorgungslage in Deutschland immer schwieriger. Es fehlt an Brennstoffen, Medikamenten und vor allem an Nahrungsmitteln. Im sogenannten Steckrübenwinter des Jahres 1916/17 spitzt sich die Situation dramatisch zu. Viele Menschen sind chronisch unterernährt und gesundheitlich geschwächt. Typhus, Ruhr und Tuberkulose breiten sich aus.
Im Pathologischen Institut der Friedrich-Schiller-Universität in Jena werden täglich Opfer der tödlichen Entbehrungen eingeliefert. Die von Krankheit und Hunger ausgemergelten Körper werden dem Institut zu Forschungszwecken überstellt. Im Keller des Gebäudes arbeitet Marie Krieger als junge Doktorandin. »Über die Atrophie der menschlichen Organe bei Inanition« lautet der Titel ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Atrophie bezeichnet den Gewebeschwund des Körpers und seiner Organe. Die Ursache dafür nennt das zweite medizinische Fachwort im Titel: Inanition. Darunter verstehen Mediziner die Abmagerung des Körpers auf ein extremes Maß unterhalb des Normalgewichts. Die Körper, die Marie Krieger untersucht, unterschreiten diesen Wert deutlich. Einige der Leichname weisen bis zu 45 Prozent Gewichtsverlust auf. Die Ursachen dafür sind vielfältig, wenngleich alle mit den Folgen des Krieges in Zusammenhang stehen: psychische Erkrankungen, die zu massiven Essstörungen führten, Ruhrfälle, wodurch die Nahrungsaufnahme der Kranken zum Erliegen kam, vor allem aber extreme Mangelversorgung beijungen Soldaten.
Für die Medizinerin wird diese Jahrhundertkatastrophe zur wissenschaftlichen Chance, niemand hat bislang die organischen Folgen von Hunger und Auszehrung beim Menschen dokumentiert. Ausgangspunkte von Kriegers Untersuchungen sind ganz einfache Fragen: Wenn unser Körper abnimmt – durch Hungern oder Fasten –, schrumpfen dann nicht nur Muskeln und Fett, sondern auch die inneren Organe? Und wenn ja, trifft das auf alle Organe zu?
Um diese Fragen beantworten zu können, ermittelte die Wissenschaftlerin zunächst die Durchschnittsgewichte der inneren Organe normal ernährter Männer und Frauen. Für die Leber zum Beispiel notierte sie: »Beim gesunden Erwachsenen im normalen Ernährungszustand macht die Leber 2,69 Prozent des Körpergewichts aus – sie wiegt zwischen 1592 und 1659 Gramm.« Für das Gehirn stellte sie ein Durchschnittsgewicht von 1405 Gramm fest. Dann entnahm sie den ausgemergelten Toten verschiedene Organe und legte sie auf die Waage. Im Vergleich zu den Normalwerten wichen die meisten Messergebnisse stark ab. Alle inneren Organe waren durch die Auszehrung um bis zu 40 Prozent leichter als bei normal genährten Erwachsenen – alle, bis auf das Gehirn. Nur zwei Prozent oder weniger Gewichtsverlust ergaben Marie Kriegers Messungen. Selbst unter schlimmsten Ernährungsbedingungen, so ihre sensationelle Entdeckung, verändert das Gehirn sein Gewicht nur minimal.
Im Jahr 1921 veröffentlichte sie ihre Ergebnisse, und obwohl Kriegers Analysemöglichkeiten damals nur bescheiden waren, hat ihr Befund bis heute Bestand. Mittlerweile lassen sich Gewichtsverluste innerer Organe durch die moderne Magnetresonanztomographie (MRT) auch bei lebenden Menschen präzise ermitteln. Bei Menschen, die an Magersucht (Anorexie) leiden, weisen die inneren Organe im Extremfall Gewichtsverluste von bis zu 40 Prozent auf, während das Gehirn nur minimal an Masse und Gewicht einbüßt. Auch neueste MRT-Ergebnisse zu stark übergewichtigen Patienten, die mit Hilfe einer kalorienreduzierten Diät Körpermasse verlieren, belegen, dass das Gehirn im Gegensatz zu allen anderen Organen nicht abnimmt.
Woran liegt das? Warum gibt es ein Organ in unserem Körper, das selbst während einer Hungersnot nicht von der Mangelernährung betroffen zu sein scheint? Für dieses Phänomen kann es nur eine Erklärung geben: Das Gehirn nimmt in der Stoffwechselhierarchie des Körpers eine Sonderstellung ein. Es stellt zuerst seine eigene Versorgung sicher, während sich der Rest des Körpers mit der Energie begnügen muss, die dann noch übrigbleibt. In Zeiten des Mangels bedeutet dies, dass die anderen Organe hungern und dem Gehirn alle verfügbaren Energiereserven überlassen müssen. Kann es sein, dass unser Gehirn wie ein egoistischer Despot agiert?
Checks and Balances – das Prinzip der Gewaltenteilung in unserem Gehirn
Es mag auf den ersten Blick befremdlich erscheinen, dass unser Gehirn wirklich selbstsüchtig oder egoistisch sein kann. Denn das würde bedeuten, dass unser Zentralnervensystem in der Lage ist, eigenständig zu handeln, möglicherweise ohne unsere Wünsche und Interessen zu berücksichtigen. Doch dieser Egoismus des Gehirns verschafft uns Menschen Vorteile. Ist es also denkbar, dass uns gerade ein solchermaßen konkurrenzfähiges Gehirn dabei hilft, unseren Körper auch in Zeiten des Nahrungsüberangebotes schlank zu halten?
Das funktioniert natürlich nicht einfach per Knopfdruck. Die Entscheidungs- und Handlungsprozesse, die in unserem Kopf ablaufen, sind viel komplexer, als wir denken, und am ehesten vergleichbar mit der Funktionsweise eines demokratischen Rechtsstaats. »Checks and Balances« ist eine Redewendung aus der angelsächsischen Politikwissenschaft. Frei ins Deutsche übersetzt bedeutet sie: kontrollieren und ausgleichen. Ein solches Regulationssystem ermöglicht demokratischen Regierungen innerhalb definierter Grenzen Handlungsfreiheit und reduziert die Gefahr einer Diktatur. Denn Macht und Entscheidungsgewalt sind auf verschiedene Instanzen verteilt, die sich gegenseitig beeinflussen und kontrollieren. In einem demokratischen Staat sind das die Regierung, die Parteien, das Parlament, die Gerichte und die Wähler. Keiner kann allein entscheiden. Und solange die Zeiten gut und stabil sind und das System intakt ist, wird keiner die uneingeschränkte Macht an sich reißen können. So entsteht eine ideale Balance, die es ermöglicht, die wesentlichen Bedürfnisse aller zu befriedigen.
Diese Gewaltenteilung ist auch ein grundsätzliches Prinzip unseres Gehirns. Sie gilt sowohl für unsere bewussten als auch für unsere unbewussten Entscheidungen. Jeder der verschiedenen Gehirnteile ist an Entscheidungen beteiligt, kein Teil regiert allein. Welcher sich am Ende durchsetzt, welche Instanzen im Gehirn ein Entscheidungsimpuls durchläuft und inwieweit dieser dabei noch modifiziert wird, das hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Wenn das System defekt ist oder in schlechten Zeiten unter Druck gerät, kann es sich zwar an die geänderte Situation anpassen, aber es entsteht eine neue Balance: Die Kompetenzen werden umverteilt, Bedürfnisse anders befriedigt. Dieses neue Gleichgewicht ist nicht mehr so ideal wie der Ausgangszustand, aber unter vielen schlechten Optionen dennoch die beste.
Eine derartige »Stabilisierung durch Veränderung«, wie diese Form der Anpassung in der Hirnforschung genannt wird, vollzieht sich insbesondere bei stoffwechselphysiologischen Vorgängen, also dann, wenn Energie im Körper verteilt wird. Denn sobald es Engpässe bei der Energieversorgung des Gehirns gibt, tritt eine besondere Fähigkeit unseres Denkapparates zutage, die für unser Überleben ausschlaggebend ist: Das Gehirn entscheidet selbständig und teilweise sogar egoistisch gegen den eigenen Körper. Geostrategisch formuliert könnte man sagen: Energiepolitik ist für das Gehirn eine Frage der neuronalen Sicherheit – sie hat höchste Priorität.
Energie – freie Fahrt ins Gehirn
Diesen Grundgedanken der Selfish-Brain-Theorie habe ich erstmals im Mai 1987 in der kanadischen Metropole Toronto formuliert. Ein Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft hatte es mir damals ermöglicht, im Hospital for Sick Children, eine der renommiertesten Kliniken Nordamerikas, meine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Diabetes aufzunehmen. Toronto ist für die Diabetesforschung von großer historischer Bedeutung. Hier wurde die medikamentöse Anwendung von Insulin erfunden und erprobt. Ganz in der Nähe meines Büros lag das Institut, in dem Fred Banting und Charles Best 1921 erstmals Insulin isoliert und einem kleinen Jungen namens Leonard verabreicht hatten. Leonard, ihr Patient 0, war an Typ-1-Diabetes erkrankt. Die Inselzellen seiner Bauchspeicheldrüse hatten nach und nach ihre Insulinproduktion eingestellt. Insulin aber ist lebensnotwendig, damit der Körper die aufgenommene Energie in Form von Zucker (Glukose) in den Depots abspeichern kann. Ein Mensch, dessen Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produziert, kann so viel essen, wie er will, und wird doch innerhalb weniger Wochen verhungern. Leonard war der erste Mensch mit Typ-1-Diabetes, der die Krankheit überlebt hat. Seitdem wird Diabetes mit Insulinspritzen behandelt, die Lebenserwartung der Patienten ist von praktisch null auf »nahezu normal« gestiegen.
Trotz dieser medizinischen Erfolgsgeschichte stellte die Diagnose Ärzte und Patienten noch in den 1980er Jahren vor ein schwerwiegendes Problem. Denn es gab keine Richtwerte, wie viel Insulin der Körper eines Betroffenen tatsächlich braucht. Die Insulintherapie ist eine der komplexesten Einstellungen in der Medizin, der Blutzucker muss viermal täglich analysiert werden, um die richtige Dosisaufteilung zu finden. Eigentlich kann dies nur eine medizinische Fachkraft optimal berechnen – für die Betroffenen auf Dauer ein unzumutbarer Zustand. Deshalb konzentrierte ich mich während meines Aufenthaltes in Toronto auf die Frage, wie man Menschen mit Zuckerkrankheit dabei helfen könnte, die richtige Insulinmenge selbst zu bestimmen.
Ich glaubte, einen Lösungsansatz für das Problem finden zu können. Mitte der 1980er Jahre gab es die ersten Minicomputer auf der Basis leistungsfähiger Taschenrechner. Was wäre, wenn man ein solches Gerät dahingehend programmierte, dass jeder Patient den mittels eines Teststreifens selbstermittelten Blutzuckerwert einfach in den Computer eintippt und dieser daraus die angemessene Insulindosis errechnet? Eine präzise Hochrechnung, nicht wie bisher eine Schätzung, das wäre ein großer Fortschritt. Die Wirkung des Insulins würde verbessert. Und das Risiko einer Überdosierung würde gesenkt, wodurch sich insbesondere eine drohende Gewichtszunahme einerseits und die durch Unterzucker ausgelösten Ohnmachtsanfälle andererseits eindämmen ließen. Nach der präzisen Berechnung könnte sich der Patient die ermittelte Dosis selbst spritzen. Das wäre die größtmögliche Verbindung von wirksamer Therapie und Lebensqualität.
Doch wie würde so ein Computerprogramm aussehen? Welches Schaltschema läge ihm zugrunde? Um diese Frage beantworten zu können, müsste man wissen, wie unser Körper im gesunden Zustand das Problem der optimierten Insulinausschüttung gelöst hat. Eine Frage, die der Medizin noch immer Rätsel aufgab.
Eines Morgens nahm ich nicht den direkten Weg in mein Büro, sondern wanderte durch die Straßen von Downtown Toronto und genoss die frische Frühlingsluft. Beim Gehen kommen einem die besten Ideen, heißt es. Ich erreichte eine Kreuzung und musste an einer Fußgängerampel warten. Autos fuhren an, während die Wagen auf der kreuzenden Straße stoppten. Dann schaltete die Ampel wieder um, und der Gegenverkehr begann von neuem zu fließen. Ich war so in Gedanken, dass ich die nächste Grünphase verpasst hatte. Fasziniert starrte ich auf die Kreuzung: Wenn zwei Straßen aufeinandertreffen, lässt sich der Verkehrsfluss mit einer einfachen Rot-Grün-Phase sicher und effektiv regulieren. Wäre dieses Modell auch für den Stoffwechsel denkbar? Eine Art Ampelschaltung des menschlichen Organismus, die die Glukosezufuhr zum Gehirn beziehungsweise zu den Speicherorganen reguliert?
Beflügelt eilte ich ins Büro und ging mein Bücherregal durch. Ich hatte mich schon früher mit Mathematik und der Berechnung von Schaltkreisen beschäftigt, Joseph J. DiStefanos Buch Theory and Problems of Feedback and Control Systems über Regelungstheorie musste hier irgendwo sein. Tatsächlich entdeckte ich darin die Schaltung einer Ampel, die den Verkehr der sich kreuzenden Straßen A und B regelt. Diese Ampel war aber nicht, wie im Straßenverkehr üblich, starr programmiert. Hier ging es um eine flexible Ampelschaltung, die ständig Informationen über das aktuelle Verkehrsaufkommen erhält und die Grünphasen für A und B rechnerisch so anpasst, dass Verkehrsstaus vermieden werden.
Ließe sich so ein flexibles System auf die Regulierung des Blutzuckers bei Menschen wie dem kleinen Leonard übertragen? Ich spielte das Szenario durch: Straße A führt ins Gehirn, Straße B ins Fett- und Muskelgewebe. Bei einem Energiemissverhältnis (zu wenig Glukose gelangt ins Gehirn, zu viel in die Speicher) ergeht ein Signal an die Bauchspeicheldrüse: »Insulinausschüttung drosseln!« Fett- und Muskelzellen können jetzt keine Glukose mehr aufnehmen, der »Blutzuckerverkehr« fließt ungehindert ins Gehirn. Entsteht dort eine Überkapazität, erfolgt der gegenteilige Befehl: »Insulin ausschütten!« Jetzt sind die Speicher im Muskel- und Fettgewebe offen, der Glukose-Strom wird gezielt dorthin geleitet.
Wenn dieses Prinzip zutraf, könnte so auch ein Insulinrechner funktionieren – wie eine intelligente Ampelschaltung, die aufgrund aktuell erhobener Blutzuckerwerte den Energiefluss des Körpers durch eine rechnerisch optimal angepasste Insulindosis reguliert. Ob dieses Schaltmodell so oder ähnlich tatsächlich im Körper arbeitet, war 1987 allerdings noch nicht zu belegen. Viele physiologische Aspekte lagen im Dunkeln, auch die Frage, welche Rolle das Gehirn bei der Entscheidung spielt, wohin der Blutzucker gelenkt wird, war ungeklärt. Wer weiß, vielleicht war sogar das Gehirn allein für die Programmierung der Stoffwechsel-Ampel in unserem Körper verantwortlich. Diese einfache, aber fundamentale Frage nach der Kontrolle des Energieflusses durch das Gehirn war schließlich der Ausgangspunkt für die Entstehung der Selfish-Brain-Theorie. Bis dahin hatte die Medizin versucht, Störungen im Energiehaushalt des Körpers symptomatisch zu behandeln, ohne näher zu erforschen, wo die tieferen Ursachen für das Ungleichgewicht lagen.
Jetzt musste man die Studien nur noch in einen Zusammenhang stellen. Interessanterweise war genau dies bisher nicht geschehen. Pellerin, Friedman und Spanswick kannten die Forschungen der jeweils anderen zu wenig. Aber wenn man diese hervorragenden Arbeiten aus den Gebieten des Körper- und Hirnstoffwechsels wie bei einem Puzzle zusammenfügte, würde ein völlig neues Bild Konturen annehmen. Das Ergebnis war die Selfish-Brain-Theorie, die erklärt, wie das Gehirn selbstbestimmt seine Energieversorgung sichert und dabei in Krisenzeiten alle anderen Organe in die zweite Reihe verweist.
1998 formulierte ich die Selfish-Brain-Theorie in Lübeck, 2004 wurde sie publiziert. Wie die Golden-Gate-Brücke in San Francisco ruht die Theorie auf zwei fundamentalen Grundpfeilern:
Das Gehirn reguliert zuerst seinen eigenen Energiefüllstand. Dazu aktiviert es sein Stresssystem, das die Energie aus den Körperreserven ins Gehirn leitet (die Ampel zeigt Grün Richtung Gehirn).
Anschließend kehrt das Stresssystem wieder zurück in seine Ruhelage. Jetzt erfolgt die Nahrungsaufnahme, um die Körperreserven wieder aufzufüllen (die Ampel zeigt Grün Richtung Körper).
Die Selfish-Brain-Theorie wurde inzwischen anhand von mehr als 10 000 Studien aus den unterschiedlichsten Fachdisziplinen geprüft und findet sich mit diesen im Einklang. Sie wurde auf »Plausibilität« getestet, in zahlreichen persönlichen Gesprächen und auf zwei internationalen Selfish-Brain-Konferenzen mit ausgewählten Experten der Bereiche Neuroenergetik, Stressforschung, Adipositas, Diabetes, Schlaf und Gedächtnis. 2004 rief die Deutsche Forschungsgemeinschaft an der Universität zu Lübeck die Klinische Forschergruppe »Selfish Brain: Gehirnglukose und Metabolisches Syndrom« ins Leben. In diesem Team forschen seitdem unter meiner Leitung 36 Wissenschaftler und fünfzig Doktoranden aus den Disziplinen Hirnforschung, Innere Medizin, Diabetologie, Psychiatrie, Psychologie, Neuroendokrinologie, Pharmakologie, Ökotrophologie, Biochemie, Chemie und Mathematik zum gleichen Thema: zur Selbstsucht des Gehirns.
Wie wir später noch sehen werden, ist der Egoismus des Gehirns aber kein reiner Selbstzweck, sondern verschafft uns evolutionäre Vorteile. Der prähistorische Mensch war ständig von Nahrungsknappheit und Gefahren aus der Umwelt bedroht – ein Problem, das noch weit bis in die Neuzeit reichte. Um darauf adäquat reagieren zu können, war es vor allem wichtig, dass das Gehirn funktionierte. Die Wahrnehmung musste geschärft sein, man musste in Situationen der Gefahr die richtige Entscheidung treffen und wissen, wo man in Zeiten des Mangels Nahrung finden konnte. Also hieß die Devise: Alle Energie in die Schaltzentrale! Diese Mechanismen, die uns damals in Zeiten der Nahrungsknappheit eine gute Hirnleistung garantiert haben, wirken in uns noch heute. Wenn sie reibungslos funktionieren, ermöglichen sie uns, trotz des Nahrungsüberangebots schlank zu bleiben. Tritt allerdings eine Störung auf, dann – und nur dann – werden wir dick.
Dieses Thema ist natürlich aus wissenschaftlicher Sicht hochspannend – vor allem aber ist es für jeden Einzelnen von uns von großer Bedeutung. Denn es zeigt, wie groß der Einfluss unseres Gehirns auf unseren gesamten Stoffwechsel ist. Wenn die Ampelschaltung funktioniert, können wir vom Egoismus des Gehirns profitieren, denn er sichert in schlechten Zeiten unser Überleben und hält uns in guten Zeiten schlank. Wenn das System aber aus dem Tritt kommt, hat das gravierende Folgen. Übergewicht, Typ-2-Diabetes, Magersucht und Bulimie, die vermeintlichen Zivilisationskrankheiten unserer Zeit, haben ihren Ursprung in einer Veränderung in unserer Ampel-Schaltzentrale und nicht in »Maßlosigkeit« oder bewusstem »Verzicht«. Erst wenn wir die Rolle des Gehirns als Verbraucher Nummer eins und Regulator Nummer eins im menschlichen Energiestoffwechsel verstehen, können wir Therapien entwickeln, die nicht nur die Symptome behandeln, sondern endlich die Ursachen von Übergewicht und Diabetes bekämpfen. Und wir können uns von der Idee verabschieden, dass wir nur streng genug Diät halten müssen, um dauerhaft abzunehmen. Dabei wird es auch um die Fragen gehen, inwieweit unser Gefühlsleben und unser Umgang mit Stress mit dem Stoffwechsel von Gehirn und Körper zusammenhängen.
Energie auf Bestellung – eine Tasse Zucker täglich
Die Studien von Marie Krieger waren der erste Beleg dafür, dass sich unser Stoffwechsel in Notzeiten zugunsten des Gehirns radikalisiert. Mit anderen Worten: Der Kampf um Nahrung, den der hungernde Mensch gegen die Natur oder andere Menschen führt, vollzieht sich spiegelbildlich auch in seinem Inneren. Gekämpft wird dabei um den wichtigsten Rohstoff des Körpers: Zucker. Diese Kohlenhydratverbindung zirkuliert in den Blutbahnen in Form von Glukose, dem begehrtesten Energieträger des Stoffwechsels. Unter normalen Umständen nimmt ein Mensch pro Tag 200 Gramm Glukose zu sich. Dass unser Gehirn ein egoistischer Herrscher ist, der sich selbst zuerst bedient, wissen wir bereits. Man kann also vermuten, dass das Gehirn gerade beim Zucker den Löwenanteil für sich fordert. Aber wie groß ist dieser Teil, was gelangt noch in die anderen Organe?
Bereits in den 1940er Jahren entwickelten die amerikanischen Neurowissenschaftler Seymour Kety und Carl Schmidt ein Verfahren, durch das sie wichtige Einblicke in den Hirnstoffwechsel erhielten. Dazu legten sie Probanden einen Katheter in die Armarterien, um den Blutglukosegehalt vor der Passage durchs Gehirn zu bestimmen. Weitere Katheter wurden in beide großen Halsgefäße bis auf Höhe der Ohren eingeführt – eine Messstation, die das abfließende Blut nach seinem Weg durchs Gehirn passieren musste. Aus der Messung des Glukosegehalts im zu- und abfließenden Blut ergibt sich eine genaue Analyse der Glukoseausbeute des Gehirns. Allerdings birgt dieses Verfahren Verletzungsrisiken für die Versuchsperson und wird daher heute nur noch in Ausnahmefällen angewendet. Doch bereits in den 1950er und 1960er Jahren wurde auf der Grundlage der Kety-Schmidt-Methode ermittelt, wie viel Glukose in 24 Stunden im Blut umgesetzt und wie viel davon im Gehirn verbrannt wird. Die Ergebnisse beider Untersuchungsreihen waren verblüffend: Von den 200 Gramm Glukose, die ein Mensch täglich zu sich nimmt, beansprucht das Gehirn allein 130 Gramm für sich – das entspricht in etwa der gleichen Menge Haushaltszucker (das ist so viel, wie in eine nicht ganz randvoll gefüllte Kaffeetasse passt). Eine solche Tasse Zucker wird jeden Tag in unser Gehirn transportiert und dort verbrannt, damit wir denken, fühlen, entscheiden, träumen und unseren Körper kontrollieren können.
Aber wie kommt es, dass das Gehirn diesen hochenergetischen Stoff fast ausschließlich für sich beanspruchen kann? Was ist mit den Muskeln und anderen verbrennungsintensiven Organsystemen? Warum rebellieren sie nicht gegen diese »ungerechte« Energieverteilung? Auf der Suche nach einer Erklärung für dieses Phänomen konzentrierte sich die Forschung zunächst auf die Frage, wie die Energiebeschaffung bei Neuronen, den einzelnen Nervenzellen des Gehirns, abläuft.
Jede einzelne Nervenzelle kümmert sich selbst um die Logistik der eigenen Versorgung. Neuronen beziehen ihre Energie von sogenannten Astrozyten, das sind Zellen, die gewissermaßen wie Tankstellen im Hirngewebe funktionieren. Mit ihren sternförmigen Ausstülpungen docken sie auf der einen Seite an den Nervenzellen an, auf der gegenüberliegenden an den Kapillaren. Diese kleinsten Blutgefäße unseres Körpers transportieren den Kraftstoff Blut bis zur Zelle. Sowohl an den Kapillar- als auch an den Astrozytenwänden befinden sich Transportvorrichtungen, die Glukosemoleküle aufnehmen und weiterreichen können. Zunächst nahm man an, dass diese Glukosetransporter einfache Verbindungsporen von der Art starrer Röhren seien, durch die Glukose aus dem Blut hindurchgedrückt würde. Das hätte bedeutet, dass Nervenzellen passiv mit Zucker versorgt werden: Je mehr im Blut angeboten wird, desto mehr wird in die Zellen gedrückt.
Tatsächlich agiert das System wesentlich raffinierter. Die Glukosetransporter in den Astrozytenwänden sind zwar wie Röhren, aber sie sind flexibel, gehen auf und zu. Sie öffnen sich, wenn die Zelle Energiebedarf hat, und sie schließen sich wieder, wenn der Bedarf gedeckt ist. Mit anderen Worten: Die Astrozyten nehmen aktiv Energie auf. Sobald nun der Glukosenachschub über die geöffneten Poren zum Astrozyten gelangt ist, wird er dort chemisch in Laktat (Milchsäure) umgeformt. Jetzt ist das Kohlenhydrat so weit raffiniert, dass es in der Nervenzelle verbrannt werden kann.
So weit das Funktionsprinzip. Aber woher weiß der Astrozyt, wann sein Neuron Energie benötigt? Und vor allem, wie viel? Der kanadische Physiologe Luc Pellerin vermutete, dass es eine Art chemisches Signal geben müsse, mit dem der Energieaustausch reguliert wird. Er experimentierte mit dem Botenstoff Glutamat, dem wichtigsten chemischen Überträgerstoff für Informationen von Nervenzelle zu Nervenzelle. Mit Glutamat kommen auch Astrozyten in Berührung, wenn sie mit ihren sternförmigen Ausstülpungen an den Kontaktstellen zwischen sendender und empfangender Nervenzelle andocken. Bei dieser Verbindung entsteht zwischen Neuron und Astrozyt ein Kontaktspalt, eine Art Schnittstelle, die dazu geeignet ist, Informationen aufzunehmen. Im Laborversuch wollte Pellerin belegen, dass der Astrozyt Glutamat in sich aufnimmt und auf die Befehle des Botenstoffs reagiert: Als der Wissenschaftler den Astrozyten, die er als Zellkultur angezüchtet hatte, eine bestimmte Menge Glutamat verabreichte, begannen die Zellen tatsächlich Glukose zu saugen und zu verarbeiten. Damit war dem Kanadier ein wichtiger Durchbruch gelungen: Die Hirnzelle selbst bestellt die benötigte Energie, und zwar mit Hilfe des Glutamats. Energy on demand, Energie auf Abruf, nannte Pellerin das Konzept, mit dem eine bis dahin in der Wissenschaft verbreitete These zumindest auf der Zellebene widerlegt wurde: nämlich dass die Gehirnversorgung nur vom Angebot aus dem Körper abhängt und das Gehirn auf diese Weise ausschließlich passiv versorgt wird. Stattdessen wusste man nun: Nervenzellen des Gehirns bestellen Energie und werden je nach Angebot und Nachfrage bedient.
Wenn sich Pellerins Erkenntnisse über die Energieregulierung auf zellulärer Ebene auch auf den Energiehaushalt unseres Körpers und auf die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns übertragen ließen, könnte man die Frage beantworten, warum unser Gehirn sich den Löwenanteil Glukose sichern kann. Bei einer solchen Übertragung stößt man zwangsläufig auf das »Prinzip der Selbstähnlichkeit«. In der belebten und unbelebten Natur entdeckt man verblüffend oft das Phänomen, dass sich große und kleine Strukturen eines Systems auffallend ähneln. Vergrößert man zum Beispiel das Satellitenbild einer Küstenlinie immer weiter, stellt man fest, dass die Windungen und Einbuchtungen eines kleinen Strandabschnitts dem Verlauf der gesamten Küste erstaunlich gleichen. Es hat beinahe den Anschein, als befänden sich Mikrokosmos und Makrokosmos in einem Ideenaustausch.
Während sich Pellerin mit dem Mikrokosmos (Zellstoffwechsel) beschäftigte, forschte ich über den Makrokosmos (Energieversorgung der Organe). Als er mich 2002 erstmals in Lübeck besuchte, lautete unsere gemeinsame Kernfrage: Wie kommt die Energie in die Nervenzelle, beziehungsweise in die Organe und das Gehirn? Pellerin hatte diese Frage für seinen Bereich mit einem Laborexperiment erfolgreich beantwortet. Für die Selfish-Brain-Forschung würde dieser Nachweis auf der Ebene der Organe nicht so einfach zu erbringen sein. Muskeln, ein kompletter Blutkreislauf und ein Gehirn lassen sich nicht als Laborkultur in einer Nährlösung anlegen. Hier kam uns nun das Prinzip der Selbstähnlichkeit zu Hilfe. Träfe es auch in diesem Fall zu, würde das bedeuten, dass nicht nur eine Nervenzelle im kleinen Maßstab, sondern auch das Gehirn im großen Maßstab genau die Energiemenge anfordert, die es braucht – jede Sekunde, jede Minute, unser ganzes Leben lang, auch wenn wir schlafen.
Man kann sich vorstellen, wie schwierig es für den Körper sein muss, solchen permanenten Energieforderungen nachzukommen. Das Gehirn verhält sich dabei im Grunde wie der anstrengendste Gast eines Luxushotels, der den kompletten Service für sich beansprucht und das Personal Tag und Nacht tyrannisiert. Ist genug Energie im Blut? Gelangt sie schnell genug ins Gehirn? Ist der Nachschub gesichert? Wie lange wird es dauern, bis die nächste Lieferung eintrifft? Der Beschaffungsdruck, den ein derartiges System ausübt, wäre enorm und hätte einen permanenten Einfluss auf unser Leben.
Es gibt nur eine Kraft im Gehirn, die so stark ist, den Körper dazu zu zwingen, sich derart zu fügen: das Stresssystem. Wenn wir diesen Begriff hören, denken wir vielleicht an äußere Einflüsse, durch die wir unter »Stress« geraten – etwa, wenn wir im Stau stehen und dringend zum nächsten Termin müssten, wenn wir eine Prüfung ablegen müssen oder in einen Streit verwickelt sind. Tatsächlich war das Stresssystem in der Evolution der Wirbeltiere ursprünglich dazu da, Gefahrensituationen besser zu meistern und sofort mit einer Kampf- oder Fluchtreaktion auf einen Stressor (einen bedrohlichen Reiz von außen) zu reagieren. Bei einer Bedrohung wird die Reaktionsfähigkeit gesteigert, das Stresshormon Adrenalin ausgeschüttet, der Blutdruck steigt, das Herz klopft, der Körper läuft auf Hochtouren. Ist die Gefahr gebannt, kehrt das Stresssystem wieder in seine Ruhelage zurück. Wie bei einem Fernsehgerät steht es so lange auf Standby, bis das Drücken des Startknopfes das Programm wieder aktiviert.
Wie genau unser Stresssystem funktioniert, denn natürlich reicht bei uns ein Knopfdruck allein nicht aus, kann man am besten mit einem Beispiel erklären: Stellen Sie sich vor, der Ausstellungsraum eines großen Kunstmuseums soll ganzjährig exakt auf 20 °C temperiert werden. Das übernimmt die Heizungsanlage (das Stresssystem), ein teures und hochsensibles System, denn die alten Gemälde sind sehr empfindlich und wertvoll. Plötzlich reißt ein Unbefugter das Fenster im Ausstellungsraum auf (Stressor von außen). Sofort misst der empfindliche Thermostat (die Energiefühler im Gehirn) einen minimalen, für den Besucher kaum spürbaren Temperaturabfall auf 19,8 °C (Energiekrise im Gehirn). Der Thermostat gibt der Heizung nun die Anweisung, hochzufahren – schnell und genau in dem Umfang, der nötig ist, um zur gewünschten Ausgangstemperatur zurückzukehren. Die Anlage arbeitet dabei so präzise und effizient, dass es erst gar nicht zu einem größeren Temperaturabfall kommt. Kleinste Veränderungen von ±1 % in der Temperatur führen also bereits zu großer Aktivität des Systems. Die Heizung hält die Hochleistung (Stresssystem unter Belastung), bis jemand das Fenster wieder schließt und die Lage sich entspannt (Stresssystem kehrt langsam zurück in die Ruhelage). Nun bringt sie wieder ihre Grundleistung, die den Raum auf jenen 20 °C »Wohlfühltemperatur« hält, die für die Bilder optimal sind (Gehirnenergie im Gleichgewicht).
Zu solchen präzisen Leistungen ist auch das Gehirn mit seinem Stresssystem fähig.
System unter Stress





























