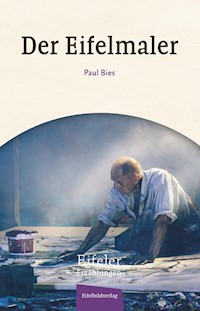4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eifelbildverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Eifeler Erzählungen
- Sprache: Deutsch
Während sich Ben in Delft im Auftrag seiner Kölner Kulturredaktion aufhält, erreicht ihn die Nachricht vom Tod seines Vaters. Er fährt sofort in sein Elternhaus nach Luxemburg zu seiner Mutter und seinem Bruder. Nach der Beerdigung seines Vaters schlägt Bens Verlagschef ihm vor, in die Eifel zu fahren, um ein Buchprojekt über die Eifel vorzubereiten. Nach kurzem Zögern willigt Ben ein und lässt sich in einer Pension am Schalkenmehrener Maar nieder. Während er sich nachts Erlebnisse mit seinem Vater ins Gedächtnis ruft, ist er tagsüber an zahlreichen Eifelorten (Manderscheid, Maria Laach, Burg Eltz usw.) unterwegs, um für das Eifelprojekt zu recherchieren. Der Aufenthalt in der Eifel gibt ihm nach und nach wieder seine ursprüngliche Lebenskraft zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
DAS EIFEL-PROJEKT
EIFELER ERZÄHLUNGEN
PAUL BIES
Eifeler Erzählungen
Das Eifel-Projekt
Paul Bies
1. Auflage 2022
Eifelbildverlag
Ein Imprint der Kraterleuchten GmbH,
Gartenstraße 3, 54550 Daun
Verlagsleitung: Sven Nieder
Alle Rechte vorbehalten.
Gestaltung: Björn Pollmeyer
Titelfoto: Sven Nieder
Lektorat und Korrektorat: Tim Becker
ISBN 978-3-98508-037-3
www.eifelbildverlag.de
INHALT
1. Die Nachricht
2. Der Redenschreiber
3. Merl
4. Auf dem Friedhof
5. Pieter de Hooch
6. Väter und Söhne
7. Wo bist du?
8. Patrick Walther
9. Fahrt nach Daun
10. Das Zimmer
11. Das Totenmaar
12. Nachtfahrt
13. Am Computer
14. Die Manderscheider Burgen
15. Über den Stadtplan gebeugt
16. In der Teufelsschlucht
17. Romane
18. Nerother Kopf
19. Johann Sebastian Bach und Albert Camus
20. Mühlsteine
21. Ecole Européenne, Luxembourg
22. Burg Eltz
23. Im Paradies spricht man luxemburgisch
24. Maria Laach
25. Deutschland – Brasilien
26. Gehen
27. Der Kirschdieb
28. Rotes Haus, Monschau
29. Am Küchentisch
30. Der Liebesbote
31. Lego
32. Wolken
33. Auf der Schaukel
34. Der Gärtner
35. Der blaue Traktor
36. Sülm
37. Das Auto hier heißt Ferdinand
38. Fritz von Wille
39. Lintgasse, Köln
40. Anne
Paul Bies
Bisher in der Reihe »Eifeler Erzählungen« erschienen:
DIE NACHRICHT
Der Anruf meines Bruders erreichte mich, nachdem ich den Prinzenhof verlassen hatte. Ich sah auf die schmale Gracht und die Oude Kerk von Delft und trug in mir noch die Lichteinfälle der Gemälde von Pieter de Hooch, die ich in der Ausstellung gesehen hatte. Ich freute mich auf einen Abend in einer der Delfter Kneipen, freute mich auf Käsekroketten, Bier und Genever und überlegte, ob ich noch zuvor ans Meer fahren sollte, um den warmen Spätsommernachmittag zu genießen, als das Handy klingelte. Es war Richard, mein Bruder:
» Es ist etwas Schreckliches passiert.«
Dann hörte ich erst einmal gar nichts, dann ein lautes Rauschen, dann Motorengeräusche. Ich hasste es, wenn er von seinem Auto aus zwischen zwei Terminen telefonierte und die Verbindung schlecht war oder sogar immer wieder unterbrochen wurde.
» Ich verstehe dich nicht«, sagte ich in die wieder aufkommende Stille hinein.
Dann hörte ich ganz deutlich seine Worte:
» Unser Vater ist gestorben.«
Ich erinnere mich natürlich ganz genau an diesen Satz. Er sagte wirklich »unser Vater« und nicht etwa »Papa«, wie er sonst immer gesagt hat. Ich habe mir später auch einmal überlegt, ob es eine behutsamere Art und Weise hätte geben können, mir den Tod meines Vaters mitzuteilen, aber natürlich kann es keine behutsame geben.
» Bist du auf der Autobahn?«, fragte ich ihn. Auf diese Frage wiederum ist Richard oft zurückgekommen. Er hat es nicht verstanden, dass ich auf seine Nachricht hin mich erkundigt habe, ob er auf der Autobahn sei.
» Er ist gestürzt«, sagte Richard. »auf der Treppe in unserem Haus«.
Ich sah es vor mir: Mein Vater auf den Steinstufen in unserem Elternhaus hinunterfallend.
» Um Gottes willen«, sagte ich, »der arme Papa!«
» Er ist mit dem Kopf auf eine der Steinstufen aufgeschlagen«, bestätigte mein Bruder.
Wir sagten beide nichts mehr. Ein schweres Gewicht legte sich auf meine Brust, ich konnte kaum mehr atmen und geriet in Panik.
» Ich bin auf dem Weg zu Mama«, sagte Richard. »Bist du noch da?«
Ich nickte. Erst ein wenig später fiel mir ein, dass er mein Nicken nicht sehen konnte. So war eine lange Pause entstanden.
» Ja«, sagte ich schließlich, immer noch um Atem ringend, »und jetzt?«
» Vielleicht ist es besser, wenn du dich heute nicht mehr ins Auto setzt. Komm morgen!«
» Es tut so weh«, sagte ich plötzlich, »es tut jetzt schon so weh!«
» Wir müssen Mama helfen«, sagte Richard.
Ich verstand die Zusammenhänge zwischen seinen einzelnen Aussagen nicht. Dann brach die Verbindung ab. Ich weiß nicht mehr, was in den Minuten nach dem Anruf geschah. In meiner Erinnerung sehe ich mich lange an der Stelle stehen, wo mich der Anruf erreicht hat. Ich glaube, ich war unfähig, mich zu bewegen. Ich weiß, dass ich nicht geweint habe.
Geweint habe ich später, als ich durch die Dünen lief. Ich habe nämlich das gemacht, was mein Bruder mir gesagt hat. Ich bin nicht sofort ins Hotel gegangen, um auszuchecken und zu unserer Mutter zu fahren. Ich war froh, dass mir jemand gesagt hatte, was jetzt zu tun sei, und zwar sich nicht sofort auf die Autobahn zu begeben. Warum ich mich dann aber trotzdem ins Auto gesetzt habe und ans Meer gefahren bin, weiß ich nicht. Ich habe keine Erinnerung an die kurze Autofahrt ans Meer. Irgendwie lief ich dann aber in den Dünen, lief auf einer Sandbank, lief am Meer entlang. Ich hätte so gerne um einen Aufschub gefleht, ich hätte so gerne noch ein wenig Lebenszeit mit meinem Vater verbracht, ich wusste sogleich, dass ich zu nachlässig mit der Zeit umgegangen war, die wir beide zusammen verbracht haben. Mir tat mein Herz weh, nicht nur in einem metaphorischen Sinne, ich war erstaunt festzustellen, dass mir wirklich mein Herz wehtat. Manchmal nahm ich etwas wahr: das Licht, leuchtend über dem blauen Meer, glasklar, die großen Büscheln der Dünengräser, plötzlich ein paar kleine, weiße Wolken. Mein Gesicht war nass von der Gischt, so dachte ich zumindest. Erst später bemerkte ich, dass es vielmehr die Tränen waren, die meine Wangen runterliefen. Ich weinte still vor mich hin. Kurz der Gedanke, ich sollte Lisa über den Tod meines Vaters informieren, ein Gedanke, den ich aber bald wieder verwarf, denn unsere Trennung lag jetzt schon fünf Jahre zurück und ich wollte keinerlei Kontakt mehr mit ihr, auch nicht oder erst recht nicht unter diesen Bedingungen. An den Weg zurück nach Delft erinnere ich mich genau. So wenig ich von der Hinfahrt weiß, desto mehr weiß ich von der Rückfahrt: Ich hatte mich gegen die Autobahn und für die Landstraße entschieden, aber ich war in den Feierabendverkehr geraten. Die Leute fuhren nach Hause. In den Häusern würden bald die Familien – hungrig, lachend und diskutierend – ihr Abendbrot essen. Warum ging das Leben einfach weiter? Die Nacht war rasch und irgendwie unerwartet gekommen, und in den kleinen Ortschaften staute sich vor den Ampeln die Wagenkolonne, die landeinwärts strebte. Zwischen den Ortschaften war es stockdunkel, kein freier Blick auf die Wiesen und Kanäle, nichts, wo sich das Auge ausruhen konnte. Ich folgte den Rücklichtern des vor mir fahrenden Autos, in dem auch nur ein einzelner Mann saß. Ich erinnere mich heute noch an das Nummernschild (70-KKJ-3). Am Ende dieser Rückfahrt nach Delft hatte ich plötzlich das Gefühl, alles sei nur für mich da und mir ein Zeichen. Ich müsse nur noch diese Zeichen deuten. Das würde mir Hilfe geben in einer ausweglosen Situation. Aber ich musste sogleich feststellen, dass ich zu keinerlei Erklärung kam. Was sollten mir denn die Buchstaben und Zahlen des Nummernschildes bedeuten, was die Abstände zwischen den Bäumen in der Allee, die ich durchfuhr, was die schmale Ziehbrücke, die Kanäle, die Anzahl der Fahrradfahrer? Oder sah ich nicht genau genug hin? Dabei prasselte alles ungeschützt auf mich ein, ich konnte mich nicht dagegen wehren. Ich empfand auch zugleich das Erlebte, die Vergangenheit dieses Tages als brutal wirklich, als eingraviert in Herz und Kopf: die Gemälde Pieter de Hoochs, die Todesnachricht, das Licht über dem blauen Meer. All dies würde ich in meinem Leben nicht mehr vergessen. Dabei konnte ich mir keine Zukunft vorstellen. Wie sollte denn mein Leben weitergehen?
DER REDENSCHREIBER
Mein Vater schrieb Reden für den deutschen Botschafter in Luxemburg. (Die Verwendung der Vergangenheitsform ist grausam und erscheint mir grotesk.) Nun ist Redenschreiber kein eigener Posten im Verwaltungsapparat einer Botschaft, aber es ist das, was Richard und ich zu Hause mitbekamen: unser Vater deklamierend und Varianten ausprobierend, in seinem Arbeitszimmer (ja, er arbeitete auch zu Hause und das dann natürlich insbesondere am Wochenende) auf und ab gehend. Wir hörten ihn durch die geschlossene Tür hindurch. Die schweren Holztüren im Haus dämpften zwar die Geräusche, aber den Vater hörten wir deutlich, da er sehr laut sprach. Wir lebten in einem umgebauten, ehemaligen Bauernhof in Merl, einem Stadtteil von Luxemburg, unweit der Molkerei LUXLAIT. Richard und ich nahmen jeden Morgen den Bus hinaus auf den Kirchberg zur Europäischen Schule und kehrten erst am späten Nachmittag zurück. Manchmal trafen wir dann meinen Vater an, der mit meiner Mutter in der geräumigen Küche am großen Esstisch saß, beide Zeitung lesend, scherzend, sie hatten schon eine Flasche Weißwein geöffnet und griffen immer wieder zu ihren Gläsern, täglich wurde bei uns Alkohol getrunken, während wir, nachdem wir unsere Schultaschen auf den Boden geworfen hatten, uns einfach dazusetzten. Richard holte bald zwei kleine Flaschen Limonade für uns beide aus dem Kühlschrank, ich ließ mich immer von ihm bedienen. Nur jetzt nicht sofort nach der Schule gefragt werden, war die einzig gültige Spielregel, die alle kannten und befolgten. Entweder Richards oder meine Frage »Was gibt es heute eigentlich zu essen?« scheuchte Mama oder Papa auf. Beide konnten wunderbar kochen, die Küche füllte sich bald mit Essensgerüchen. Richard und ich schoben aber noch einmal die Gläser beiseite und kramten in unseren Taschen nach den Schulheften, um dann doch unsere Hausaufgaben zu machen.
Oft aber war mein Vater gar nicht zu Hause, sondern begleitete den Botschafter zu einem der zahlreichen Abendtermine. Einige Male, insbesondere in meinem letzten Schuljahr kurz vor dem Abitur, nahm ich daran teil. Ein Abend ist mir in besonderer Erinnerung: Anlässlich einer Autorenlesung (Sten Nadolny war nach Luxemburg gekommen, um seinen Roman »Die Entdeckung der Langsamkeit« vorzustellen) hatte mein Vater eine kurze Rede geschrieben, die als Einführung in das Gesamtwerk und eben den neuesten Roman des Autors diente. Während der Ansprache des Botschafters beobachtete ich meinen Vater. Ich hatte nicht neben ihm sitzen wollen. Schließlich saßen wir beide zwar doch in der zweiten Reihe, waren aber durch den Mittelgang getrennt, sodass ich in Ruhe hinüberschauen und seine Reaktion während der Ansprache des Botschafters mit verfolgen konnte, auch wenn das Glas Sekt, das mein Vater mir vor Beginn der eigentlichen Veranstaltung ausgegeben hatte, und das Bier, das ich, unbemerkt von meinem Vater, noch schnell getrunken hatte, mich etwas benebelten. Mein Vater sprach alle Sätze des Botschafters tonlos mit. Die Lippen meines Vaters formulierten eindeutig die Wörter. Er lächelte zufrieden dabei. Lediglich zwei- oder dreimal runzelte er die Stirn, als der Botschafter wohl von der Textvorlage abwich; so jedenfalls deutete ich seine Mimik. Wie ihn seine Position als Redenschreiber befriedigen konnte, fragte ich mich oft: niemals selbst ans Mikrofon treten zu können, niemals selbst die Rede zu halten und den Applaus einzuheimsen. Ganz im Gegenteil: Der Botschafter wurde bewundert für die passenden Worte, die er gefunden hatte, kassierte Komplimente, wohlwollende Blicke. Ich hatte aber nie den Eindruck, dass meinem Vater etwas fehlte, dass er unzufrieden sei mit seiner Rolle. Er wirkte im Übrigen aber auch nie devot. Nichts an seinem Verhalten war peinlich, weder für ihn noch für seine Familienangehörigen. Ich bin überzeugt davon, dass er nicht danach strebte, es dem Botschafter immer nur recht zu machen und sich aus Bequemlichkeit einfach unterzuordnen. Vielmehr hatte er irgendwie klammheimliche Freude an seiner Position, wusste er doch als einer der wenigen, dass jedes Wort des Botschafters auf seinen Einfall und seine Formulierung zurückzuführen war. So strahlte mein Vater immer Sicherheit aus, die ich mit genießen konnte, Selbstbewusstsein, an dem ich jedes Mal Gefallen fand.
MERL
Meine Mutter war gefasst. Das war mein erster Eindruck, als ich das Haus in Merl betrat. Ich hatte Angst gehabt, in das Haus zurückzukehren, in dem mein Vater natürlich ständig präsent sein würde, war auf der Autobahn kurz vor Luxemburg immer langsamer gefahren und zum Ärgernis der anderen Verkehrsteilnehmer geworden. Meine Mutter umarmte mich, dann nahm auch Richard mich in die Arme, sie gingen vor mir her in die Küche und setzten sich an den großen Tisch, auf dem Papiere lagen, alte Schreiben der Versicherungen, wie ich auf den ersten Blick sah, natürlich gab es einiges zu sichten. Sie kümmerten sich zunächst gar nicht um mich, machten wohl gerade da weiter, wo ich ihre Arbeit unterbrochen hatte. Neugierig blickte Mikesch, unser schwarzer Kater mit der weißen Schnauze, zur Küche hinein, aber nachdem er mich erblickt hatte, zog er wieder beruhigt von dannen.
» Es ist gut, dass du da bist!«, sagte schließlich meine Mutter.
Richard lächelte mich verlegen an. Plötzlich stand meine Mutter mit einem Ruck auf:
» Ich mache uns erst einmal einen Kaffee.«
Erst jetzt fiel mir auf, dass sie ganz in Schwarz gekleidet war. Ich freute mich auf den Kaffee, den sie zubereitete: Sie machte ihn immer sehr stark, dazu gab es dann aber auch viel heiße Milch, die sie süßte, ohne uns je vorher zu fragen. Plötzlich glaubte ich Schritte auf der Treppe zu hören, ich stellte mir vor, mein Vater würde herunterkommen und sich zu uns setzen, und mir liefen die Tränen die Backen hinunter. Meine Mutter sah mich an und fing auch an, still vor sich hin zu weinen, Richard blätterte hastig in den Papieren. Wir tranken den Kaffee, der mich nicht wirklich tröstete, sondern mir lediglich einen kurzen Moment der Erleichterung gab. Wie sollte ich hier in dem Haus mit meinen Schmerzen umgehen, meiner Sehnsucht nach meinem Vater? Und wie erst sollte es meine Mutter tun?
» Jetzt ist er von uns gegangen«, sagte meine Mutter.
Ich hatte mir auf der Fahrt hierher viele Fragen zurechtgelegt, wie mein Vater die letzten Tage verbracht hatte, warum er gestürzt war, aber schließlich war ich sprachlos.
» Er ist einfach nicht mehr da«, sagte meine Mutter mit klarer Stimme, feststellend, nicht klagend, »könnt ihr euch das vorstellen?«
Wir schüttelten, beide im gleichen Rhythmus, mehrfach den Kopf. Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Ich blieb einfach am Tisch sitzen, während meine Mutter und Richard weiter in den Papieren wühlten. Dabei hatte ich nicht den Eindruck, dass sie bei der Sache waren und wussten, was sie da suchten oder sortierten. Richard und ich schwiegen. Meine Mutter brabbelte manchmal ein paar Wortfetzen. Ich verstand nicht, was sie sagte.
» Es ist noch Kaffee da«, sagte sie irgendwann. »Soll ich noch einmal die Milch heiß machen? Braucht ihr noch mehr Zucker?«