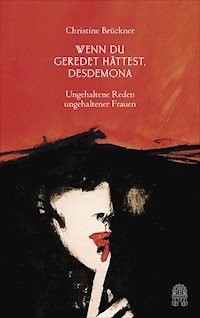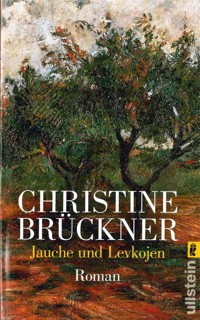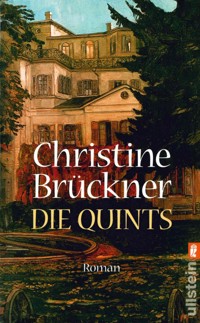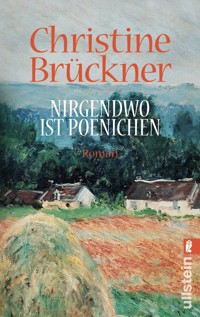3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf einer Bahnreise lernt die Schriftstellerin P. einen jungen Mann kennen, der ebenfalls mit Literatur zu tun hat, jedoch weniger erfolgreich ist als sie. Auf der Rückreise sitzt ihr dieselbe Person gegenüber, aber diesmal als Frau. Jemand, der die Rollen wechselt! Dass ein solcher Wechsel möglich ist, fasziniert die Autorin. Der Zufall spielt ihr beides auf einmal zu, das Thema und die Hauptperson.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Gedicht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Von Christine Brückner sind bei Refinery erschienen:
Die AutorinChristine Brückner (1921 - 1996) zählt zu den renommiertesten Schriftstellerinnen Deutschlands. Sie verfasste Romane, Erzählungen, Kommentare, Essays, Schauspiele, auch Jugend- und Bilderbücher. Besonders mit der Poenichen-Trilogie wurde sie einem großen Publikum bekannt. Mehr über Christine Brückner erfahren Sie über die Stiftung Brückner-Kühner unter http://www.brueckner-kuehner.de/.
Das Buch
Auf einer Bahnreise lernt die Schriftstellerin P. einen jungen Mann kennen, der ebenfalls mit Literatur zu tun hat, jedoch weniger erfolgreich ist als sie. Auf der Rückreise sitzt ihr dieselbe Person gegenüber, aber diesmal als Frau. Jemand, der die Rollen wechselt! Dass ein solcher Wechsel möglich ist, fasziniert die Autorin. Der Zufall spielt ihr beides auf einmal zu, das Thema und die Hauptperson:
Christine Brückner
Das eine sein, das andere lieben
Refinery by Ullsteinwww.ullteinbucherlage.de/verlage/refinery
Neuausgabe bei Refinery Refinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Oktober 2017 (1) © Ullstein Buchverlage GmbH & Co. KG, Berlin 1981/1998 Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin ISBN 978-3-96048-082-2 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Gingo biloba
Dieses Baums Blatt, der von
Osten Meinem Garten anvertraut,
Gibt geheimen Sinn zu kosten,
Wie’s den Wissenden erbaut.
Ist es ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen,
Daß man sie als eines kennt?
Solche Frage zu erwidern
Fand ich wohl den rechten Sinn;
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Daß ich eins und doppelt bin?
Goethe, »West-östlicher Divan«
1
Jedesmal wenn sie auf einem Bahnsteig den Ruf ›Zurückbleiben!‹ hörte und sich der Zug gleich darauf in Bewegung setzte, erschrak sie über die Unerbittlichkeit: Zurückbleiben! Der Befehl betraf sie dieses Mal nicht. Sie reiste allein.
Sie hatte gehofft, ein D-Zug-Abteil für sich allein zu haben, da sie sich für die Abendveranstaltung noch vorbereiten wollte. Unwillig über die Störung erwiderte sie daher den Gruß des Eintretenden flüchtig und ohne aufzublikken. Zunächst las sie die Feuilletonbeilagen der Wochenendausgaben, die sich bei ihr angesammelt hatten.
Nachdem der Mitreisende ihr zweimal die Zeitungen aufgehoben hatte, die ihr vom Schoß geglitten waren, sah sie ihn sich schließlich an, mußte dazu die Lesebrille abnehmen. Ein gutaussehender Mann von Anfang Dreißig, nachlässig, aber mit Eleganz gekleidet. Das frischgewaschene Haar trug er halblang; sobald es ihm ins Gesicht fiel, warf er es mit einer raschen Bewegung des Kopfes zurück. Keine Krawatte, statt dessen ein Halstuch, im Ton zu den Socken passend.
P. wandte sich wieder der Lektüre ihrer Zeitung zu. Draußen dämmerte es. – Sie kannte die Strecke, war sie zu allen Tages- und Jahreszeiten schon gefahren. Ein Blick durchs Fenster genügte, und sie wußte, wo man sich befand. Wenig Fahrgeräusche, die sich aber merklich änderten und lauter wurden, sobald der Zug über eine Brücke fuhr. P. nahm die Brille ab und sah zum Fenster hinaus. Ihr Gegenüber sagte: »Die Donau!«
Der Tonfall, in dem dies gesagt wurde, überraschte P. Es war hörbar Freude in der Stimme. Sie sah den Mitreisenden fragend an, und er erklärte in heiterem Selbstbewußtsein: »Mein Fluß!«
P. lachte.
Er lachte auch, aber wie er lachte! Das war kein dem Anlaß entsprechendes Lächeln, sondern ein Lachen mit weit geöffnetem Mund. P. sah zwei makellose Zahnreihen, sah rosiges Zahnfleisch. So lachten, nach ihren Erfahrungen, nur Sänger und Schauspieler mit Gesangoder Sprechausbildung, deren Lachen in den letzten Sitzreihen ankommen soll. Nachdem sie ihn zunächst der Modebranche zugeordnet hatte, mutmaßte sie jetzt: Theater. Er lachte noch, als sie längst damit aufgehört hatte. Sie nahm ihre Bücher aus der Tasche, um mit der Vorbereitung des Autoren-Abends zu beginnen.
Es fiel ihr, besonders auf Reisen, oft etwas zu Boden; diesmal glitt ihr eines ihrer Bücher vom Knie. Ihr Gegenüber hob es auf, hatte dabei wohl einen Blick auf den Titel geworfen. P. spürte, daß er sie von nun an aufmerksam beobachtete, reagierte aber nicht darauf.
Wenig später vertiefte er sich ebenfalls in ein Buch, machte Striche an den Rand, brachte Ausrufungszeichen an, blätterte, schrieb ganze Sätze auf das Vorsatzpapier. Das störte sie als Bücherschreiberin; ein Buch blieb schließlich immer das Buch des Autors, auch wenn der Leser es käuflich erworben hatte.
Sie notierte sich einige Sätze, die sie zur Einführung sagen wollte (falls der Veranstalter es nicht seinerseits tun würde), blätterte unschlüssig in dem vor wenigen Tagen erst erschienenen Erzählungsband. Nach ihren Erfahrungen wollten die Zuhörer immer das Neueste hören, am liebsten etwas, das noch nicht im Druck erschienen war – was sie aber strikt ablehnte. Sie zog das Bewährte dem Unerprobten vor und entschied sich für eine Geschichte, die ihr zum ›Anwärmen‹ des Publikums geeignet erschien, aber gekürzt werden mußte. Sie brachte ein paar Striche an, war in ihren Text vertieft, vergaß, daß sie nicht allein war, murmelte die Sätze vor sich hin, probte die Betonung, den Auftritt. Und erschrak, als sich ihr Gegenüber einmischte: »Den Satz sollten Sie nicht streichen!«
Ein Grund, die Lesebrille wieder abzunehmen.
»Der Absatz vorher, der bringt nicht viel«, fügte er hinzu.
Er hielt das gleiche Buch in der Hand, eines der Vorausexemplare, die von den Verlagen an die Redaktionen geschickt werden, betrachtete das Foto auf der Rückseite, dann wieder P. und sagte: »Sie sollten dem Verlag ein neues Foto schicken! Wie jetzt, angeregt, überrascht, neugierig! Ein subjektives Foto! Nicht so ein objektives! So fotografiert man Teekannen, aber keine Frau!«
Noch immer war sie nicht zu einer Unterhaltung bereit, beließ es bei einem Lächeln, setzte die Brille wieder auf, was heißen sollte: Kein Wort weiter!, und so wurde es auch verstanden. Beide lasen in dem gleichen Buch weiter. Sobald ihr Gegenüber auflachte, versuchte sie zu erraten, welche Stelle seine Heiterkeit ausgelöst hatte. Dieses schöne offene Lachen, dem man schwer widerstehen konnte, das so selten zu sehen ist. Sobald ihr ein Mann gefiel, der wesentlich jünger war als sie, pflegte sie zu sich zu sagen: ›Marschallin, es wird Abend!‹, rief sich mit diesem Satz aus dem ›Rosenkavalier‹ zur Ordnung.
Es verging eine weitere Stunde, dann schob er das Buch in seine Mappe und fragte: »Gehen wir zusammen in den Speisewagen?«
Warum hätte sie nein sagen sollen?
Der Speisewagen war nur mäßig besetzt, die Lämpchen auf den Tischen leuchteten. Sie saßen sich wieder gegenüber, jetzt durch einen Tisch getrennt.
»Nehmen Sie bitte die Brille ab«, sagte er, machte im übrigen keine Anstalten, sich ihr vorzustellen, obwohl er wußte, wer sie war. Da P. ihn vermutlich nie Wiedersehen würde, störte es sie nicht. Es entstand unter dieser Voraussetzung eine Atmosphäre der Ungezwungenheit. Sie vergaß ihre Abendveranstaltung; die Nervosität, die sonst unweigerlich einige Stunden vor Beginn einsetzte, kam nicht auf. Sie bestellte zwei Viertel ›Burgenländer‹, den er empfohlen hatte, und für jeden einen Imbiß. Mit dem Recht der Älteren und Erfolgreichen lud sie ihn ein, was er sich, ohne zu widersprechen, gefallen ließ.
Statt sich zu bedanken, sagte er: »Ich hatte damit gerechnet.«
Flüchtig stieg Unwille in ihr auf, als sie merkte, daß er sie auszunutzen gedachte. Andererseits gefiel ihr, daß es so unverblümt geschah.
»Kennen Sie jemanden bei –?«
Er nannte den Namen einer Wochenzeitung, nannte den Herausgeber der Zeitung. Sie mußte verneinen, was ihn jedoch nicht zu enttäuschen schien.
»Man sucht dort jemanden fürs Feuilleton. Halten Sie mich für ›aufgeschlossen gegenüber dem Leben im allgemeinen und der Kultur im besonderen‹? Meinen Sie, daß ich ›das richtige Gespür für das habe, was heute ankommt‹? ›Eigenwillig, aber fähig, im Team zu arbeiten‹? ›Lebens- und Schreiberfahrung erwünscht‹.«
Sie sah ihn sich gründlich an und faßte das Ergebnis in dem Satz zusammen: »Ich würde Sie einstellen!«
»Geben Sie mir das schriftlich?«
Warum hätte sie es ihm nicht schriftlich geben sollen? Es konnte ihm in keinem Falle schaden, möglicherweise nutzen, keiner würde sie zur Rechenschaft ziehen, Gerüchte wären immerhin möglich, im Sinne von ›Marschallin, es wird Abend‹, aber diese Vorstellung erheiterte sie, wie sie überhaupt während ihres Zusammenseins sehr heiter war. Sie schrieb zwei Sätze auf ihre Visitenkarte, reichte sie ihm und sagte, daß er hoffentlich außer dieser noch weitere Referenzen besäße.
»Referenzen!« sagte er im Tonfall von: Was nutzen Referenzen! »Auf mich selber wird es ankommen.«
»Aber Zeugnisse werden Sie doch vorlegen können?« fragte sie in gespielt lehrerhaftem Ton.
»Keine lückenlosen«, sagte er in ebenfalls gespieltem Bedauern. »Mein Leben weist erhebliche Lücken auf.«
Mehr sagte er über sein privates Leben nicht, und sie war keine von denen, die einen anderen ausfragten. Was jemand ihr freiwillig erzählte, hörte sie sich an, ermunterte aber niemanden dazu.
Im Lauf des Gesprächs machte P. den Vorschlag, daß er sich einen Bart stehen lassen solle, da ihr sein Gesicht zu weich erschiene. Schließlich wurde es höchste Zeit, ins Abteil zurückzukehren. Sie ließ sich vom Zählkellner eine Quittung ausstellen und schob sie in ihre Brieftasche zu den übrigen Spesenbelegen.
Ihr Gegenüber beobachtete sie und sagte: »Sie müssen auf der Rückseite eintragen, mit wem Sie das Vergnügen hatten, diese Spesen zu machen!«, verschwieg aber weiterhin seinen Namen, und P. fragte auch jetzt nicht danach.
Sie war am Ziel. Er mußte noch einige Stationen weiter fahren. Bevor sie ausstieg, half er ihr in den Mantel und reichte ihr den Handkoffer. Sie wünschten sich gegenseitig guten Erfolg.
Am nächsten Tag fuhr P. mit dem Gegenzug zurück. In jedem Abteil der ersten Klasse saß ein einzelner Reisender, auch in dem, das sie sich schließlich aus wählte: eine junge Frau, die Zeitung las. Durch Zufall war sie in dasselbe Abteil wie am Vortag geraten; sie erkannte es an dem Reklame-Foto, das über ihrem Sitz angebracht war. P. hatte die Frau flüchtig gegrüßt und richtete sich für die mehrstündige Fahrt ein. Da sie am Abend zuvor spät zu Bett gegangen war und die Diskussion, die sich der Lesung anschloß, heftiger verlaufen war als sonst, fühlte sie sich müde und abgespannt; sie schloß die Augen und schlief für kurze Zeit ein. Erst ein Wechsel im Fahrgeräusch ließ sie aufschrecken. Sie blickte aus dem Fenster. Sie fuhren über eine Brücke.
In diesem Augenblick sagte die junge Frau in einem Tonfall, den P. bereits kannte: »Die Donau!« Und gleich darauf: »Mein Fluß!«
Dasselbe, ihr bereits bekannte Lachen mit weit geöffnetem Mund!
Die Frau genoß P.s Verblüffung sichtlich, machte sich einen Spaß daraus, warf das Haar diesmal nicht zurück, sondern strich es mit der Hand aus dem Gesicht, wie Frauen es zu tun pflegen. Es bestand kein Zweifel: Diesmal saß ihr eine junge Frau gegenüber, obwohl sie sich in der Kleidung auf den ersten Blick nicht von einem Mann unterschied. Erst bei näherem Betrachten sah P., daß das Herrenhemd von gestern heute eine Hemdbluse war; die Absätze an den Stiefeln schienen höher zu sein, obwohl ja auch Männer, der Mode entsprechend, heute höhere Absätze tragen. Allerdings mehrere Halsketten. Eine Handtasche lag neben ihr. Aber Männer tragen neuerdings ja ebenfalls Handtaschen.
Die Frau griff sich ans Kinn, als wollte sie P. an etwas erinnern. Es fiel ihr ein: Am Tag zuvor hatte sie ihr, beziehungsweise ihm, im Speisewagen den Vorschlag gemacht, einen Bart zu tragen, weil ihr das Gesicht zu weich erschienen war. Jetzt erschienen ihr dieselben Züge eher zu kräftig für eine junge Frau.
P.s Müdigkeit war größer als ihre Neugierde. Sie schloß wieder die Augen. Aber der Schlaf wollte nicht zurückkehren. Sie griff zu Brille und Zeitung, wobei ihr die Kollegmappe vom Sitz glitt. Sie wurde nicht aufgehoben, ihr nicht zugereicht. P. bückte sich. Während sie die Brille aufsetzte, registrierte ihr flüchtiger Blick: Reißverschlüsse, neutrale Reißverschlüsse; es wurde weder von rechts nach links noch von links nach rechts geknöpft. Ein Reißverschluß an der Bluse, die sie gestern für ein Oberhemd gehalten hatte, ein Reißverschluß an den Cordhosen, die im übrigen nicht so eng saßen, daß sich ein Geschlechtsmerkmal hätte abzeichnen können. Geschlechtslose Reißverschlüsse.
Um sich zu vergewissern, daß ihr Gedächtnis sie nicht täuschte – warum sollte nicht auch ein anderer die Donau freudig begrüßen? –, fragte P.: »Nun?« Eine geeignetere Frage fiel ihr nicht ein.
Die Frau wiederholte im gleichen Tonfall: »Nun?«, lachte wieder, und P. zweifelte keinen Augenblick daran, daß dies ein weibliches Lachen war, solidarisch, fast schwesterlich. Für eine Sekunde dachte sie sogar: eine Lesbierin. Auch als Frau war ihr diese Person sympathisch.
»Was ist aus Ihrer Bewerbung geworden?« fragte P.
»Man hat sich für eine Frau entschieden, für eine andere Frau«, fügte sie dann hinzu und fuhr ungefragt fort: »Vor kurzem hatte ich mich bei einer Frauenzeitschrift beworben, aber dort suchte man eine männliche Kraft. Frauen fehle die Dynamik, hieß es. Frauen eigneten sich weniger für Team-Arbeit. Bei Frauen gebe es zu viele Ausfälle. Sie bekämen immer noch zu leicht Kinder.«
P. versuchte, ihren Worten zu folgen. »Und da haben Sie sich also gestern als Mann beworben?« fragte sie.
»Ja. Und ausgerechnet diesmal hatte man vor, aus Gründen der Parität eine Frau einzustellen. Um das weibliche Element nicht zu kurz kommen zu lassen, im Bewußtsein, daß ein großer Teil der Leserschaft …«
P. wollte etwas einwerfen, kam aber nur bis zu einem »Aber –«.
»Nun ja«, sagte die Person.
»Und jetzt?«
»Ich werde noch ein wenig als Bewerber oder Bewerberin reisen müssen. Das ist übrigens ein einträglicher Job: Bewerber! Die Spesen sind nicht schlecht. Diesmal war ich meiner Sache eigentlich sicher. Ich hatte bereits gekündigt.«
»War das nicht leichtsinnig?«
»Aber ja!« Die Antwort klang nicht besorgt, eher belustigt.
»Und warum haben Sie vorzeitig und so unbesonnen gekündigt?«
P. zeigte, während sie das sagte, auf die neueste Ausgabe der Zeitung, die sie in der Hand hielt.
»Der Chef brauchte jemanden, der ihm mehr war als nur ein Mitarbeiter. Mein Vertrag ist gelöst, zur Diskretion bin ich nicht mehr verpflichtet.«
»Fürs Bett?« fragte P. sachlich und gab sich Mühe, so freimütig über diese Dinge zu sprechen, wie das unter jungen Leuten üblich ist.
»Sie können sich seine Überraschung vorstellen!«
Vorerst war es P., die überrascht und sichtlich verwirrt war. Sie unterdrückte die törichte Frage, ob die Mitreisende vielleicht ein Zwilling sei. Noch während sie es dachte, fiel ihr ein, daß eineiige Zwillinge das gleiche Geschlecht und zweieiige nicht mehr Ähnlichkeit miteinander haben als andere Geschwister auch. Sie schloß ihre Gedanken mit ›Was geht es dich an‹ ab und blickte aus dem Fenster.
Es dämmerte. P. liebte diese Stunden. Dieses Ineinander von Tag und Nacht, wie sie überhaupt die Übergänge liebte, die Übergänge der Jahreszeiten, Vorfrühling, Spätherbst, aber auch die Waldränder, die Meeresküsten, halb Land, halb Wasser. Es fielen ihr einige Formulierungen ein, die sie sich notierte.
Das gleichmäßige Fahrgeräusch, das P. zunächst eingeschläfert hatte, setzte ihre Gedanken in Bewegung. Eine Erinnerung stieg in ihr auf. Der erste Paris-Aufenthalt, sie studierte noch. Sie hatte mit einigen anderen Studenten vor dem Café ›Deux Magots‹ gesessen und darauf gewartet, Sartre zu sehen; sie beobachteten, wer in das Café hineinging und wer herauskam, beobachteten aber auch die Vorübergehenden und entdeckten dabei ein hinreißend schönes junges Geschöpf, ein Mischling, ein Halbblut mit kurzen dunklen Locken. Die junge Person trug Hosen, ging mit weichen Schritten, wie Barfüßige gehen. Sie waren sicher: ein junger Mann. Als die Person ein zweites Mal vorüberkam, waren sie ebenso sicher: ein Mädchen. Es blieb unentschieden. Sie waren weggegangen, ohne Sartre gesehen zu haben. P. hatte jene Person, die in zweifacher Hinsicht ein Mischling war, vergessen, bis sie jetzt aus ihrem Gedächtnis wieder aufstieg, mit ihrem ganzen Zauber, für den sie aber damals, unwesentlich älter als dieses Geschöpf im Zwitteralter, weniger empfänglich gewesen war als heute. Bei ihrem Gegenüber handelte es sich um einen Erwachsenen in einem Alter, wo bei anderen längst entschieden ist: eine Frau, die ihre Frauenrolle übernommen hat, oder ein Mann, der seine Männerrolle übernommen hat.
P. blickte auf die Uhr und sagte: »Ich werde jetzt im Speisewagen essen, darf ich Sie einladen?«
»Gern«, sagte die Person. »Ich werde in der nächsten Zeit wohl auf Einladungen angewiesen sein.«
Nach dem Aperitif entschloß P. sich dann doch, eine persönliche Frage zu stellen.
»Halten Sie mich bitte nicht für neugierig …«
Sie wurde sogleich unterbrochen. »Sie leben von Ihrer Neugier, nehme ich an, und nicht zu knapp, wie mir scheint. Man sieht Ihren Namen auf den Bestsellerlisten.«
»Dafür kann ein Autor nichts.«
»Sie müssen sich nicht entschuldigen!«
»Ein Leser kann sich sein Buch aussuchen, ein Buch kann sich seinen Leser nicht aussuchen.«
Eine Floskel, die sie gelegentlich verwendete, wenn das Wort ›Erfolgsautor‹ fiel. Ihr Gegenüber kannte sie bereits, worüber P. sich ärgerte, noch mehr ärgerte sie sich über die eigene Empfindlichkeit.
P. setzte aufs neue zu ihrer Frage an. Bevor sie sie formulieren konnte, kam schon die Gegenfrage.
»Ist die Kenntnis der Zugehörigkeit zu dem einen oder dem anderen Geschlecht für Sie von Bedeutung?«
Sowohl der Tonfall wie auch der Ausdruck des Gesichts ließen P. erröten. Ungezogen, dachte sie, aber nur für den Bruchteil einer Sekunde, dann mußte sie lachen und beließ es, ohne weitere Stellungnahme, beim Lachen.
Männlich – weiblich, das konnte allenfalls den jeweiligen Partner interessieren, und auch diesen weniger, als man dem Publikum einzureden versuchte.
»Dieser ganze Sex …« sagte sie, verlor aber im selben Augenblick die Lust, mit einer wildfremden Person über Sexualität zu sprechen, und brach mitten im Satz ab, wollte dann aber doch ihre Vermutung bestätigt wissen.
»Sie wechseln demnach?«
»Ich wundere mich, daß andere es aushalten, immer nur ein Mann zu sein. Oder noch schlimmer: immer nur eine Frau! Was für eine Einschränkung der Lebensmöglichkeiten und der Lebenserfahrungen!«
Von dieser Seite hatte P. das Problem noch nie gesehen, aber es überzeugte sie sofort, machte ihr sogar Spaß. Zunächst überlegte sie natürlich, ob ein Wechsel überhaupt durchführbar war.
»Sie müssen doch einen Paß haben!«
»Darin wird nicht nach dem Geschlecht gefragt, wußten Sie das nicht? Ich kann jederzeit sogar die Neugier eines Polizeipräsidenten befriedigen.«
Die Person holte mit sicherem, wie es schien weiblichem, Griff den Reisepaß aus ihrer Handtasche und reichte ihn P. Sie las: ›Der Inhaber dieses Passes ist Deutscher.‹ Sie las ›Marion Amend‹, erinnerte sich, daß sie den Namen Mario Amend – der Vorname also ohne ›n‹ – schon einmal unter einer Rezension gelesen hatte, und fragte, ob sie unter männlichem Pseudonym schreibe.
»Das wechselt«, antwortete sie.
»Amend, wie betonen Sie das, auf der ersten oder auf der letzten Silbe?« fragte P. weiter.
»Sie meinen: ›Am Ende‹ oder ›Amen‹?«
»Ja.«
»Das kommt auf dasselbe hinaus!«
P. betrachtete das Paßbild. Die Haare waren darauf länger, als sie es jetzt waren. Die Unterschrift war großzügig, weiträumig, sagte ihr nichts; von Graphologie verstand sie bis zu dieser Begegnung nichts.
Es kam P. wohl schon in diesem Augenblick ins Bewußtsein, daß sie jemandem gegenübersaß, der am 8. Mai 1945 geboren war, dem Tag, an dem der Krieg zu Ende ging. Sie war, zumindest nicht bewußt, noch nie jemandem mit diesem Geburtsdatum begegnet. Der Geburtsort, der sie natürlich ebenfalls interessiert hätte, war im Paß nicht angegeben.
Der Bazillus, der die Infektion auslösen würde, war bereits spürbar. Es handelte sich nur noch um eine kurze Inkubationszeit, in der sie aber alles bereits voraussah, alle Schwierigkeiten, alle Mühe, alles Vergnügen. Sie hatte ihr Thema gefunden, hatte sogar die Hauptperson, an der sie es abhandeln konnte, vor Augen. Ihr Gegenüber hätte diesen Klick-Laut, dieses Einrasten eines Satzes, hören müssen. Sie saß wieder einmal fest, war auf den Leim gegangen, hatte ihr Opfer gefunden, aber in Wahrheit war sie selbst das Opfer, das sich nun auf die Suche machen mußte. Fährtensuche.
Schon an dieser Stelle muß ganz deutlich gesagt werden, daß es sich hier nicht um ein Monstrum handelte, nichts für den Jahrmarkt. Undeutlichkeiten und Mißverständnisse waren vorauszusehen, aber: kein zoologischer Zwitter! Ein wenn auch vielleicht fragwürdiger Vergleich mit der Pflanzenwelt bot sich an: ›monoklin‹. ›Diese Person ist monoklin.‹ Das Wort gefiel P. Sie gewöhnte sich an, ›diese Person‹ zu denken, ›diese monokline Person‹ und schon bald ›meine Person‹.
Monoklin, das war das eine. Das andere Eigenschaftswort, das ihr jedesmal einfiel, wenn sie diese Person sah – und sie sah sie später noch oft –, war: entwaffnend. Sie wirkte entwaffnend, ein Mensch ohne Aggressionen, was P. zwar nicht unmittelbar, aber doch mittelbar mit ›monoklin‹ zusammenzuhängen schien. Sie gestand sich ein, daß sie sich in diese Person verliebt hatte, immer war sie in ihre Personen verliebt gewesen, selbst dann noch, wenn sie später den Lesern unsympathisch waren: immer besaßen sie die Zuneigung ihrer Erfinderin. Sie versuchte, das Gespräch wieder in Gang zu bringen. »Ich frage mich nur …«
Die Person unterbrach sie erneut.
»Fragen Sie doch lieber mich!«
Mit solchen Einwürfen entwaffnete sie den Angreifer. P. kam sich umständlich vor, weitschweifig. Der aufsteigende Ärger verflog aber rasch, er richtete sich immer nur gegen sie selbst, nicht gegen die Person. Über diese ›Monokline‹ hat sie sich auch später, als sie zusammen reisten, nie geärgert. Sie besaß, was ihr selbst fehlte: Leichtigkeit.
Ohne weitere Umschweife stellte P. fest: »Sie haben schauspielerisches Talent.«
»Von meiner Mutter, sie soll Schauspielerin gewesen sein.«
»Soll gewesen sein! Das müßte sich doch feststellen lassen«, sagte P.
»Nein! Sie hat sich von mir getrennt. Frühzeitig.«
»Und Ihr Vater?«
»Falls es einen gegeben haben sollte – ein unbekannter Faktor.«
»Haben Sie sich nie für Ihre Herkunft interessiert?«
»Nein«, sagte die Person, als wäre ihre Abstammung ebenso unwichtig wie das Geschlecht. Aber was war dann überhaupt noch wichtig?
P. stellte die Frage nach der Wichtigkeit vorerst nicht, gab sich den Anschein, als hätte sie zu arbeiten, nahm ein Manuskript aus der Tasche und machte sich einige Notizen, die bereits die Person betrafen. ›Donau‹ schrieb sie, ›8. Mai 1945‹, ›Reißverschluß‹, ›entwaffnend‹ und natürlich auch ›monoklin‹. Erste Reizworte für die Phantasie.
P. stellte fest, daß ihr Gegenüber ebenfalls zu schreiben begonnen hatte. Hin und wieder begegneten sich die Blicke. Auch die Person beobachtete P. zunächst unauffällig, fing dann aber deren Blick ein. Mit jenem offenen Lachen, das für den Anlaß wieder zu groß angesetzt war – ein Lächeln hätte genügt –, sagte sie: »Wer schreibt über wen? Ich über Sie? Sie über mich?«
An diese Möglichkeit hatte P. bisher nicht gedacht. Stoff genug hatte sie geboten. Sie sah bereits die Überschriften vor sich: ›Eine Reise mit …‹ oder ›Ihre erste Frage galt dem Sex‹. P.s flüchtiges Unbehagen wurde durch die Heiterkeit der Person schnell besiegt, ihre Leichtigkeit sprang über.
»Wollen wir knobeln?« fragte sie.
»Wie macht man das?« fragte P. zurück.
»Schere oder Stein?«
Die Frage kam so rasch, daß P. genauso schnell und unbewußt reagierte und die Hand zur Faust ballte. Ihr Gegenüber hatte Zeige- und Mittelfinger zur Schere gespreizt. P. sah sich die Hand an, sie war kräftig und schön geformt.
»Stein schleift Schere. Sie sind dran!«
P. blickte überrascht auf ihre geballte Hand, die demnach einen Stein darstellen sollte. Sie war sich nicht bewußt, daß sie dazu neigte, eine Faust zu machen. Der Augenblick der Zeugung eines Romans? Einer Erzählung? ›Stein schleift Schere.‹ Wäre das ein Titel? Schon gingen ihre Gedanken in eine bestimmte Richtung. Ihr Blick lag noch immer mit Interesse auf der fremden gespreizten Hand. Die Finger eines Menschen erschienen ihr immer wie seine Wurzeln; in ihnen saß das Fingerspitzengefühl. Die Person hielt die Hand nach oben gestreckt, Luftwurzeln also, dachte P. Die meisten Menschen hielten die Hände nach unten gerichtet, wurzelten tiefer. P. hatte eine spitz geformte Hand vor Augen. Anpassungsfähigkeit also, Unverbindlichkeit, Schönheitssinn, Haltlosigkeit. Ungenaue Deutungen, die ihr durch den Kopf gingen. Lange, kräftige Finger, die bogenförmig angesetzt waren, was – wie die Chiromanten behaupten – als Zeichen für Harmonie zwischen Geist und Triebnatur anzusehen ist. Einzelheiten der Chiromantie hatten P. allerdings nie interessiert, eine Hilfswissenschaft, mit der sie sich nie näher befaßt hatte. Die Chinesen nannten die Finger den Drachen, die Handflächen den Tiger. Wer fraß wen? Der Drache den Tiger vermutlich. So ging es ihr oft, sie vergaß die Bedeutung. Menschen mit großen Händen galten als vorsichtig, zögernd, keinesfalls zupackend, wie man als Laie annehmen mochte. In diesem Falle war der Handrumpf im Vergleich zu den Fingern klein geraten.
So weit war sie mit ihren, wie sie annahm, unauffälligen Beobachtungen gekommen, als die Person lachend beide Hände, zur Schale geöffnet, auf den Tisch legte. Erwartungsvolle Hände, bereit aufzunehmen.
»Eben haben Sie ausgesehen wie eine Zigeunerin!« sagte sie.
P. erzählte beiläufig, daß sie als Kind davon überzeugt gewesen sei, von Zigeunern abzustammen; die Dorfkinder, die fast ausnahmslos blond waren, hätten ›Zigeuner‹ hinter ihr hergerufen, und sie sei zitternd mit dem Fahrrad an den Zigeunerwagen vorbeigefahren, die im Sommer wochenlang auf einer Waldlichtung standen. Ihre Geschichte wurde wieder unterbrochen.
»Sie haben doch gehofft, daß die Zigeuner Sie mitnehmen würden?«
»Fürchten und Hoffen, das liegt nahe beieinander.«
»Eine Ihrer Sentenzen?«
Wieder machte der Charme, mit dem die Frage gestellt wurde, P.s aufsteigenden Ärger zunichte.