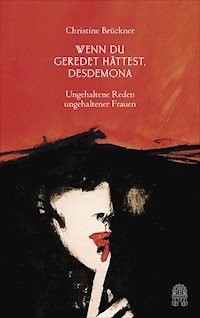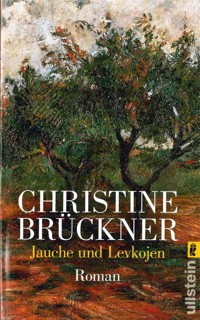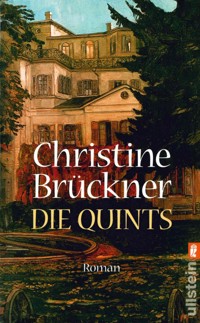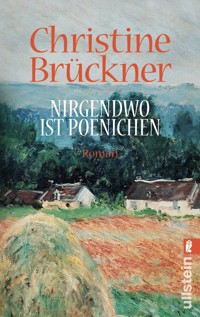3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Zeit danach ist die Zeit nach der Scheidung, ein Rechenschaftsbericht in Tagebuchform, den die Heldin sich selbst und den beiden Männern, die sie liebt, abgibt. Vergessenes und längst Verdrängtes wird schmerzhaft bewusstgemacht. Johanna ordnet ihr Leben neu und versucht dadurch, endlich Abstand zu gewinnen. Ein einfühlsamer, bewegender Roman von der großen deutschen Erzählerin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die AutorinChristine Brückner (1921 - 1996) zählt zu den renommiertesten Schriftstellerinnen Deutschlands. Sie verfasste Romane, Erzählungen, Kommentare, Essays, Schauspiele, auch Jugend- und Bilderbücher. Besonders mit der Poenichen-Trilogie wurde sie einem großen Publikum bekannt. Mehr über Christine Brückner erfahren Sie über die Stiftung Brückner-Kühner unter http://www.brueckner-kuehner.de/.
Das Buch
Die Zeit danach ist die Zeit nach der Scheidung, ein Rechenschaftsbericht in Tagebuchform, den die Heldin sich selbst und den beiden Männern, die sie liebt, abgibt. Vergessenes und längst Verdrängtes wird schmerzhaft bewusstgemacht. Johanna ordnet ihr Leben neu und versucht dadurch, endlich Abstand zu gewinnen. Ein einfühlsamer, bewegender Roman von der großen deutschen Erzählerin.
Christine Brückner
Die Zeit danach
Refinery by Ullsteinwww.ullteinbucherlage.de/verlage/refinery
Neuausgabe bei Refinery Refinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Oktober 2017 (1) © Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München 2000 © Ullstein Buchverlage GmbH & Co. KG, Berlin 1961, 1980, 1996 Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin ISBN 978-3-96048-085-3 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
»Was zählt denn in der Liebe – außer der Liebe? Versprechen? Nichts.
Erinnerungen? Nichts.
Nichts – außer der Liebe.«
J. am 26. Mai
Ich vermute, dies ist eine Situation, in der mein Vater sagen würde: Haltung, Johanna, Haltung!
Dann würde er zu meiner Mutter hinsehen und fragen: Und du, Astrid? Was sagst du?
Meine Mutter würde mich aufmerksam von oben bis unten betrachten und sagen: Ich denke, du machst dich jetzt ein wenig frisch, Hanna.
Also gut. Ich mache mich ein wenig frisch. Die Ratschläge meiner Mutter ließen sich immer leichter befolgen als die meines Vaters. Ich gehe in das Badezimmer, in dem nur noch ein Zahnputzbecher steht, mit einer Zahnbürste; nur ein Badetuch, nur noch ein Schwamm. Auch der Geruch ist schon verändert. Den Bademantel hat er an der Tür hängenlassen. Dunkelblau mit weißen Streifen, schon ein wenig schäbig, der Kragen abgescheuert und oberhalb des linken Knies das eingesengte Loch von meiner Zigarette. So etwas bleibt dann übrig.
Ich betrachte mich aufmerksam im Spiegel. Irgendwo habe ich gelesen, daß nicht die eitlen Frauen vor den Spiegeln stehen, sondern die klugen und die einsamen, das kommt am Ende auf dasselbe heraus. Vor einem Spiegel fühlt man sich weniger einsam, wenn man weint. Man hört dann auch bald auf. Wenn man über dreißig ist, schaden Tränen dem Teint; aber das sagt meine Mutter. Ich vermute, auch das ist Lebensweisheit, ungefähr dasselbe, was mein Vater meint, wenn er sagt: Haltung, Johanna, Haltung!
Nährcreme auf die Augenlider, Skin Tonic, Puder. Selbst Cremedosen bekommen so was wie Vergangenheit.
Ich ziehe Alberts Bademantel an. Wie früher, wenn ich abends auf seine Rückkehr gewartet habe. Ich hocke mich in den Sessel, die Beine hochgezogen, »Embryostellung«, auch das wie früher. Ich denke darüber nach, wo er jetzt wohl ist, ob er schon unterwegs ist, wann er ankommt, ob er Ärger gehabt hat, ob – ob – ob. Und wenn es zehn Uhr wird und elf und halb zwölf, dann werde ich denken, es könnte ihm etwas passiert sein. Er war nicht zur Inspektion mit dem Wagen. Es ist neblig. Das Radio hat Bodenfrost angesagt. Ich werde versuchen zu lesen, ich werde auf und ab gehen, am Fenster stehen. Wenn ihm wirklich etwas passiert, wird man nicht mehr mich verständigen. Ich werde ins Schlafzimmer gehen und die Betten aufdekken. Ich werde – nein, das werde ich sicher nicht tun. Es gab eine Zeit, da stopfte ich Alberts Schlafanzug mit Sofakissen aus und legte ihn neben mich ins Bett. Die Puppe Albert bekam eine Zeitung zu lesen, manchmal bekam sie auch eine Flasche in den Arm, manchmal ein Taschentuch, eine Rose – je nachdem.
Ich sitze und warte. Warte auf nichts und niemanden, höchstens, daß es Morgen wird, der 15. November. Der Tag, an dem ich Albert zum zweitenmal mein Jawort geben werde. Ich weiß diesmal so wenig, ob ich ja oder nein sagen soll, wie damals, als ich ihn geheiratet habe. Damals hätte ich am liebsten nein gesagt. Nein – nein – nein. Heute –
Es ist einerlei, was ich am liebsten tun würde; ich tue, was man von mir erwartet, und damals wie heute erwartet man mein Ja. Haltung, Johanna. Das schwarze Kostüm ist gereinigt. Ich habe mir eine weiße Bluse gekauft. Albert wird finden, daß sie proper sei und zu mir passe. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Alles geschieht mit meinem Einverständnis, sogar auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin. Nichts Elenderes als dieses: Ich habe es selbst so gewollt.
Habe ich es gewollt? Allem Anschein nach. Sonst träfen wir uns nicht morgen am Landgericht. Anschließend gehen wir zusammen frühstücken. Das Programm für solche Familienfeierlichkeiten bestimme immer ich. Frühstück mit Sekt. Wir können uns das jetzt leisten. »Morning after night before« nannte Albert das früher. Sehr viel früher. Jetzt also nur noch das Frühstück. Aber mit Sekt.
Ohne Zeugen. Ohne Alberts Professor, der ihn aufgegeben hat, ohne Max, der mich aufgegeben hat. Ohne Publikum. In aller Stille. Albert wird verlegen sein. Man erledigt das alles rascher, nüchterner nach seiner Meinung. Aber er wird sich Mühe geben, er ist froh, daß ich sowenig Schwierigkeiten gemacht habe, daß ich großzügig bin. Warum ist er nicht mißtrauisch? Frauen pflegen nicht großzügig zu sein. Er wird ein paar Blumen mitbringen, so etwas hat er gelernt im Umgang mit der »Tochter aus gutem Hause«. Er wird den Strauß im Auto lassen. Sicher sind es wieder Nelken; er hat nicht begriffen, daß ich Nelken nicht mag, daß es bei Blumen nicht auf die Haltbarkeit ankommt. Er ist ein Kaufmann. Nachher, wenn wir zusammen im Auto sitzen, werde ich ihm eine Nelke ins Knopfloch stecken und mir auch, und man wird uns für Brautleute halten, in gesetztem Alter; und dann fahren wir noch ein Stück am Rhein entlang, und ich werde nichts sagen, und das wird ihm unheimlich sein. Er wird sich räuspern und Sätze anfangen, immer neue Sätze, Sätze, bis ich ihn erlöse und sage: Fahr mich nach Hause. Ganz ruhig werde ich das sagen, jedes Wort für sich. Mich nach Hause. Und wenn er dann vor unserer Tür hält und nicht weiß, was denn nun, dann sage ich: Komm, steig mit aus, es ist noch eine Kleinigkeit zu erledigen. An der Haustür hole ich den Schraubenzieher aus der Handtasche und bitte ihn, sein Türschild abzuschrauben. Dr. Albert Grönland. Und dann gebe ich ihm den Zettel, den ich vorbereitet habe, mit Tusche auf einer Visitenkarte, länger als ein Jahr braucht er nicht zu halten. Johanna Grönland.
Und dann noch die Schlüssel, Albert.
Und er wird sagen: Doch nicht hier vor der Tür, das hat doch Zeit. Und ich werde lächeln und sagen – nein, sagen werde ich nichts, nur abwarten und die Schlüssel, zweimal gekerbt für die Etagentür, einmal gekerbt für die Haustür, einstecken und ihm die Hand reichen. Vermutlich wird er sie küssen, was er sonst nie tut, nur wenn er mir gegenüber unsicher wird; er wird sich umdrehen und zum Auto gehen.
Und vorher wird sich hoffentlich eine Gelegenheit ergeben haben, daß ich sage: Begnadigt zu zehn Jahren. Damals, vor der Tür des Standesamtes, hat er zu mir gesagt: Lebenslänglich Grönland, arme Johanna!
18. November
Um elf Uhr war der Beamte von den Stadtwerken hier und hat den Zählerstand der Gas- und Stromuhren abgelesen.
Seit drei Tagen hatte ich mit niemandem gesprochen. Als er schon gehen wollte, habe ich ihn gebeten, den Namen des Haushaltungsvorstandes zu ändern. Das sei jetzt ich, Johanna Grönland. Er hat nicht einmal hochgesehen, nur gefragt: Beruf? – Ohne. Wahrscheinlich haben solche Leute Übung darin, sie sehen soviel in den Wohnungen. Takt wird es nicht sein. Weil ich einmal dabei war, habe ich mich an die Schreibmaschine gesetzt und es den anderen auch mitgeteilt. Dem zuständigen Postamt für Zeitungen und Rundfunk. Dem Fernsprechamt, der Bank, der Versicherungsgesellschaft für Hausrat und Diebstahl. Aber man kann es nicht dem Weinhändler und dem Kohlenlieferanten mitteilen. Im Haus weiß man es, seit Albert ausgezogen ist. Albert hat nur ein paar Koffer mit seinen persönlichen Sachen mitgenommen. Er wollte nicht einmal seine Bücher haben, obwohl es sich um medizinische Zeitschriften, Fachbücher, Lexika handelt. Was soll ich damit?
Und was soll er damit? Keiner hat das gesagt. Gedacht haben wir es beide. Das gehört zu den Themen, über die wir nicht mehr reden. Jetzt sind seine Bücher fort, auch den Globus hat er mitgenommen. Mein erstes Geschenk. Weil damals Grönland der Mittelpunkt einer Welt war, die sich um Albert drehte – so etwas sagt man; es hat sogar lange gestimmt. Nur wenn man es aufschreibt, ist es banal.
An jenem Abend, als Albert seine Sachen zusammenpackte und den Finger auf Grönland legte und die Welt sich noch einmal drehen ließ, da war es auch nicht banal. Was blieb mir denn zu sagen als: Sieh zu, daß du trockenen Auges fortkommst!
Trockenen Fußes, trockenen Auges. Bahnsteiggespräche. Aus dem ersten Jahr. Sieh zu, daß du trocken nach Hause kommst! Es muß wohl immer geregnet haben in jenem Frühling. Albert hatte dann zu sagen: Trockenen Fußes? Und ich sagte: Trockenen Auges, Herr Doktor! Und dann fuhr der Zug ab, und er rief hinterher: Trockenen Genitivs, Johanna! Und wir lachten, weil wir so unglücklich waren. Ich stand vor dem Wäscheschrank, er kniete vor seinem Koffer, und ich reichte ihm seine Aussteuer. Das gehört sich wohl so, daß ein Mann in seine zweite Ehe eine Aussteuer mitbringt. Ich habe redlich geteilt und nicht versäumt zu sagen: Ihr seid zu zweit, ihr braucht natürlich mehr Handtücher. Hat Lisa eigentlich Wäsche und so etwas? Habt ihr so ein großes französisches Bett gekauft, wie wir es immer haben wollten? Wahrscheinlich haßt er mich dafür. Dabei ist das meine einzige Möglichkeit, gegen die Sentimentalität anzukämpfen. Man nennt die Dinge beim Namen.
Jeder war großzügig. Jeder sagte: Nein, behalt du das! Das hast du doch immer gern gehabt. Das habe ich dir geschenkt. Nein, ich. Nein, du mir. Und dann hat er seinen Koffer genommen. Es war spät, nach elf schon. Auf dem Treppenabsatz hat er kehrtgemacht, ist noch einmal nach oben gekommen und hat gesagt: Wielandstraße 30. Wenn du mich brauchen solltest.
Ich weiß nicht, ob er allein dort wohnt. Ich habe nicht gefragt. Wir haben während des Packens Wodka getrunken, und ich habe gesagt wie früher: Skål, du Eisheiliger.
Vielleicht ist er nun erleichtert. Wahrscheinlich sogar. Wir sind beide strapaziert. Jeder weiß zu gut, an welchen Stellen der andere verletzbar ist, und schont ihn nicht mehr. Wir halten die Spielregeln nicht mehr ein.
Ich bin nicht ans Telefon gegangen. Es hat ein paarmal geläutet in den drei Tagen. Soll ich sagen: Dr. Grönland erreichen Sie unter einer anderen Nummer. Nein, ich kann Ihnen nicht sagen, ob er zur Zeit in der Stadt ist. Nein, ich weiß es nicht.
Wozu?
Ich will auch nicht mit J. telefonieren. Ich will nicht, und ich kann nicht. Was könnte er mir sagen? Was ich ihm? Er hat keine Blumen geschickt. Er ist auch nicht am selben Abend noch gekommen, wie ich’s gehofft hatte. Merkwürdig, daß ich noch immer nicht weiß, wie er reagiert. Manchmal denke ich, daß ich, meine Art ihn irritieren, auch ihn, genau wie Albert. Keine Blumen. Ich hätte ihm schreiben müssen: Termin am 15. November vor dem hiesigen Landgericht.
Er weiß nichts. Und ich nehme ihm übel, daß er es nicht weiß.
Vor dem Hauptportal des Landgerichts wartete Albert auf mich. Es war zwei Minuten vor halb, er sagte anerkennend: Pünktlichkeit gehörte immer zu deinen Tugenden. Und dann, als er mir die Tür aufhielt, warnend: Dies ist nur ein juristischer Akt, Hanna, bitte! Vielleicht hat es daran gelegen, ich hatte auf einmal kein Konzept mehr. Ich konnte meine Rolle nicht. Er war viel besser. Wir mußten in diesem schrecklichen Gang warten, ich wurde immer nervöser, und drinnen, in diesem Zimmer 31, habe ich dann genau das getan, was ich nicht tun wollte. Ich habe geweint. Als ob nicht vorher und nachher genug Gelegenheit dazu gewesen wäre. Es war peinlich für alle, besonders für Albert. Er mußte sich vorkommen wie ein Verbrecher. Alles klang fadenscheinig, was mein Anwalt gegen ihn vorbrachte. Einen Augenblick lang sah es so aus, als ob Albert »die Wahrheit über unsere Ehe« sagen wollte, vor den Schranken des Gerichts. Ausgerechnet. Alles verlief ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte.
Immerhin weiß ich seit diesem 15. November, daß ich außer dem einen auch noch ein physisches Herz habe. Albert mußte mich nach Hause fahren. Kein Frühstück und kein Sekt. Er hat gewartet, bis ich mich hingelegt hatte. Er hat mir Kompressen verordnet, kam mit Frotteetüchern und einer Schüssel mit heißem Wasser an mein Bett. Wring das Tuch gut aus, warm auflegen, so warm, wie du es vertragen kannst. In die Herzgegend. Flach atmen. Und dann ging er aus dem Zimmer. Nicht mehr mein Mann und auch kein Arzt mehr. Mein Herz geht ihn nichts mehr an, weder das eine noch das andere. Er hat mir noch einen Kognak gebracht und gefragt, ob er sich ebenfalls einen eingießen dürfe. Und er hat mir die rosa Dragées zur Beruhigung hingestellt. Den ganzen Vorrat an Ärztemustem hat er mir hiergelassen. Für gute Verdauung, gegen Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, zur Beruhigung, für alles ist gesorgt. Lebenslänglich, zwei Fächer voll. Was für eine weitgehende Fürsorge.
Er weiß natürlich, daß dieser Kollaps daher rührt, daß ich zuviel Kaffee trinke, daß ich zuviel muche; auch zuviel Alkohol. Ich schlafe zuwenig, ich esse nicht regelmäßig. Was soll man darüber reden? Nach dem Kognak war es besser. Albert ist gegangen. Den Hausschlüssel hat er noch. An der Tür steht noch sein Name. Am Abend habe ich die Kompresse erneuert, ich dachte, ich würde schlafen können. Ich bin liegengeblieben. Auch als das Telefon geläutet hat. Vielleicht war es J.
Das alles ist erst drei Tage her.
Meine Mutter hat das auch getan. Von Zeit zu Zeit nahm sie ein paar Tage lang nicht am Leben der Familie teil. Sie blieb dann aus einem für uns Kinder nicht ersichtlichen Grund im Bett. Dreimal am Tag bekam sie ein Tablett mit den Mahlzeiten in ihr Zimmer gebracht, die sie kaum anrührte. Vater ließ sie gewähren, er nannte das: Mutter hat sich dispensiert. Eines Morgens saß sie dann wieder am Frühstückstisch, gelassen, ausgeruht, in dem ihr möglichen Maße sogar heiter. Was vorher geschehen war, was dazu führte, weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht viel von ihr. Sie hat nie versucht, mich zu verstehen.
Ich liege und sehe zur Zimmerdecke, sehe zum Fenster hin. Nachts lasse ich die Vorhänge offen. In der letzten Nacht zog der Mond vorbei, er benötigt dazu drei Stunden. Manchmal schlafe ich ein, für eine halbe Stunde, länger wohl nicht. Ich denke nicht einmal nach. Ich liege da, liege und sehe zur Decke, nichts sonst. Draußen geht das Leben weiter. Ich weiß das, aber ich glaube es nicht.
Gegen Morgen wird es sehr laut unten auf der Straße, in den späten Vormittagsstunden wird es ruhiger, gegen achtzehn Uhr hat der Straßenlärm seine höchste Phonzahl erreicht. Um zweiundzwanzig Uhr dreißig ist die letzte Kinovorstellung aus, das dauert dann noch einmal eine Viertelstunde. Motoren, die Warmlaufen, Türen, die zuschlagen. Aus einem großen Behälter voller Menschen füllen sich kleine Behälter mit zweien, manchmal mit dreien und fahren fort. Meist sind es zwei, die aus dem Kino zusammen nach Hause fahren. Dann nur noch Turmuhren, Schritte, vereinzelt Autos, und ab sechs Uhr dann die Glocken.
Heute regnet es. Gegen Morgen hat es angefangen. Ich höre es gern, dieses Tropfen auf das Blech vom Fenster. J. sagt, es mache ihn nervös.
Meine Uhr ist stehengeblieben. Wenn die Nachmittagspost kommt, ist es fünfzehn Uhr fünfzehn. Fast auf die Minute. Dann werde ich gehen und meine Einkäufe machen. Hundert Gramm gemischten Aufschnitt, ein Viertel Butter, ein Paket Knäckebrot, einen Streichkäse, sechs Eier. Ich habe oft Frauen beobachtet, wenn sie einkaufen, alleinstehende Frauen. Abendbrot und Frühstück für eine Person. Die einen stehen am Fensterbrett und essen ihr Brot aus dem Papier. Wozu der Umstand? Es lohnt nicht. Die anderen machen es sich behaglich, decken den Tisch, mit Kerze, mit Blumen. »Verwöhn dich selbst!« – »Du mußt das Leben genießen!« – »Hab Sonne im Herzen!« Konditionen.
Noch ist ungewiß, zu welcher Sorte ich gehöre. Bisher: Apfelsinen, Schokolade, Nüsse. Und natürlich Kaffee, Zigaretten.
20. November
Albert war hier. Warum ich nicht ans Telefon gehe. Ich könne mir doch wohl vorstellen, daß er sich Sorgen mache.
Ich habe nein gesagt. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Er hat Ingwerstäbchen mitgebracht. Ausgerechnet. Lisa ißt gern Ingwer. Er hat sie im Flur auf den Tisch gelegt. Ich habe sie erst gefunden, als er fort war; vielleicht hat er sie versehentlich liegenlassen. Er hat an der Korridortür geklingelt, und erst als ich nicht kam, um zu öffnen, hat er seinen Schlüssel benutzt. Ich lag auf dem Bett. Ich habe mich dann angezogen. Ich habe uns Kaffee gekocht. Aber was soll das? Was um alles in der Welt soll das! Wir haben über die Erdölfunde in der Sahara gesprochen, über die Versuche, die Wüste zu bewässern, und Vermutungen angestellt, wie viele Menschen dort, falls das Vorhaben gelingen sollte, Arbeit und Brot finden könnten. Was soll das?
An der Tür: Paß auf dich auf, Hanna!
Keine Angst, ich verwahrlose nicht.
Verwahrlosen, warum sage ich das? Ich weiß, daß er solche Ausdrücke nicht mag. Sie passen auch nicht zu mir.
Kuß auf die Backe.
Warum ziehst du keinen Mantel an bei dem Wetter? Du wirst dich erkälten, aber bitte, das geht mich ja nichts an.
Er hat den Wagen nicht vorm Haus geparkt.
Noch einer, der sein Auto in einer Nebenstraße abstellt.
27. November
Der Anwalt hat zwei Ausfertigungen des außergerichtlichen Vergleichs geschickt. Mein Anspruch bezieht sich vornehmlich auf meine Mitarbeit. Das Führen von Alberts Büchern, die Erledigung seiner Korrespondenz. Bei der ersten Unterredung hat der Anwalt gesagt, daß ich diese Summe allein der Großmut meines Mannes verdanke. Ohne die würde ich lediglich ein angemessenes Übergangsgeld bekommen, für ein halbes Jahr etwa, während dem ich mir eine Tätigkeit suchen müsse. Nach diesem halben Jahr bin ich laut BGB verpflichtet, mir meinen Unterhalt wieder selbst zu verdienen. Kein Kündigungsschutz für Ehefrauen. An seinem zynischen Ton bin ich schuld, er weiß sich auf seine Mandantinnen einzustellen. Die Wohnung für mich und zehntausend in bar. Albert behält das Haus in W. Was sollte ich mit einer Jagd? Mit einem abgelegenen Blockhaus im Wald, ohne Auto, ohne …
Es war nicht schwer, sich zu verständigen. Albert fühlt sich im Unrecht, er wagt nicht zu widersprechen. Es ist leicht, einem Mann das Gefühl beizubringen, er sei im Unrecht. Ich habe ihm gesagt: Du mußt selbst am besten wissen, wieviel dir deine Freiheit wert ist. Ein Kaufvertrag. Dabei will ich nicht mehr als ein Jahr Ruhe. Ein Jahr Unabhängigkeit. Ein Jahr für mich allein, in dem ich mich nicht entscheiden muß, nicht für einen Beruf, nicht für einen Menschen, für nichts. In dem ich leben kann, wie es mir paßt. Reisen, vielleicht auch reisen, oder einfach: in Ruhe lernen, eine geschiedene Frau zu sein. Ich fühle mich den Anforderungen, die man an eine berufstätige, alleinstehende Frau stellt, nicht gewachsen, so wie ich jetzt bin.
Was gehen diese Erwägungen den Anwalt an, was gehen sie Albert an? Manchmal glaube ich, daß er mehr weiß, daß er vielleicht sogar begriffen hat, worum es eigentlich zwischen uns geht.
Albert hat mir ein Konto eingerichtet und das Geld gleich nach Unterzeichnung des Vergleichs angewiesen. Vermutlich hat er einen Kredit aufnehmen müssen bei seiner Firma. Er muß außerdem seine neue Wohnung einrichten, für die er eine hohe Mietvorauszahlung hat leisten müssen. Die Anwaltskosten, die Gerichtskosten. Er verstrickt sich immer mehr in Geldangelegenheiten. Geld, das er braucht, Geld, das er verdienen muß, das er nicht mehr entbehren kann. Aus dem Arzt ist ein Arzneimittel-Vertreter geworden.
Der Schlußpassus dieses Schriftstückes: Die Beklagte hat für die Zukunft keinerlei Ansprüche zu stellen, es sei denn, daß sie unverschuldet in Not gerät.
So viel Not gibt es hoffentlich nicht, daß ich Albert noch einmal bemühen müßte.
2. Dezember
Heute morgen hat es geschellt. Eine Frau stand vor der Tür, vermutlich in meinem Alter, ihr kleines Mädchen an der Hand, mit einem Blumenstrauß. Ich kannte sie vom Sehen, gegrüßt hatten wir uns nie. Man traf sich beim Bäcker oder in der Drogerie. Sie war verlegen, sie wollte mir offensichtlich einen Besuch machen, ich bat sie herein.
Die Kleine heißt Waltraut, wird aber Mausi genannt, sie hat ein blasses, spitzes Gesichtchen, sie ist nicht hübsch. Ich war noch beim Frühstück, ich holte eine zweite Tasse, für die Kleine eine Banane. Sie habe mich schon immer gern kennenlemen wollen; aber erst seit heute nacht oder, genauer, seit heute früh, wo sie die Namensschilder neben der Klingel gelesen habe, wisse sie, daß wir Wand an Wand wohnen. Sie sei auch soviel allein.
Während die Kleine im Hur mit einer Apfelsine und meinem Schirm Hockey spielte, hat sie es gesagt. Ich weine nachts. Sie hört das. Unsere Schlafzimmer liegen Wand an Wand. Sie schläft oft schlecht.
Vielleicht hat sie gedacht, ich würde ihr mein Herz, ausschütten. Aussprache zwischen Nachbarinnen.
Was sollte ich tun? Ich wollte sie nicht kränken. Der Weg zu mir – »aus einer Einsamkeit in die andere« – wird ihr nicht leicht geworden sein. Oder doch? Ein Vorwand für ihre Neugierde? Vielleicht.
Wir haben noch eine Zigarette geraucht, ich habe ihr gesagt, daß ich als Kind oft im Schlaf geweint hätte, meine Eltern wären darüber beunruhigt gewesen. Ich habe gelächelt und sie daran erinnert, daß vor einiger Zeit als Schlagzeile über einer Wochenzeitung stand: »Millionen Frauen weinen jede Nacht.«
Sie heißt Sylvia, ihr Mann ist Ingenieur und arbeitet seit einem halben Jahr in einem Stahlwerk in Argentinien, oder war es Brasilien? Ich habe nicht hingehört. Sie will das Kind herüberschicken, damit ich nicht immer allein bin.
6. Dezember
Ein Brief von Vater. Ob ich schon einmal daran gedacht hätte, zu ihnen zu ziehen, nach Hamburg. Es sei zu erwägen, das Haus sei groß genug. Wahrscheinlich haben sie lange überlegt, ob sie mir das vorschlagen sollen oder nicht. Er schreibt es nicht, aber er, und Mutter wohl erst recht, sind betroffen, daß ich sie vor vollendete Tatsachen gestellt habe. Sollte ich denn mit Albert nach Hamburg kommen, damit er meinen Eltern die Hand der Tochter zurückgibt, um die er sie einmal gebeten hat? Da habt ihr sie wieder, ich brauche sie nicht mehr; was für szenische Möglichkeiten, die da noch ungenutzt sind!
Sie möchten, daß ich zu Weihnachten zu ihnen komme. Ich weiß keinen Grund, das abzulehnen. Es muß schwer sein für Eltern, eine erwachsene Tochter zu haben.
Manchmal vergehen ein paar Stunden über zwei, drei Sätzen. Immerhin. Es vergehen zwei und drei Stunden. Vielleicht schreibe ich nur deshalb. Aber es ist auch Neugierde dabei. Ich will im nächsten Jahr, am 15. November, nachlesen können, was ich mit diesem Jahr Freiheit angefangen habe. Es gibt Perioden, in denen man nur leben kann in der Vorstellung, daß das alles vorübergehen wird und nicht von Dauer sein kann. Wieviel schlimmer ist es, wenn man sich von einer Situation, menschlichen Konstellation, nicht vorzustellen vermag, daß sie von Dauer sein könnte, beständig, zuverlässig. Dann rächt sich das: Es ist alles nur ein Übergang. Dann hat man nichts als Angst: Auch das geht vorbei. Endgültig ist nichts.
J. war hier. Für eine Stunde.
Wieder habe ich nichts gesagt.
8. Dezember
Ich habe Albert gesehen. Was tut er vormittags am Bahnhof? Er hatte die Reisetasche mit.
Ich saß oben in dem Bahnhofscafe und trank einen Weinbrand. Ich bin gern am Bahnhof, da ist alles rascher, wirklicher, man sieht Gesichter, unkontrollierte Gesichter. J. sagt: Wenn ich ein lachendes Gesicht sehen will, muß ich es mir für sechzig Pfennig am Kiosk kaufen. Alberts Haar wird dünn. Von oben kann man das sehen. Er hält sich schlecht. Er wirkt angestrengt. Ist etwas mit dem Auto? Wohin wollte er? Nach W.? Allein?
Merkwürdig. Ich kann mir das nicht vorstellen: Albert allein. Was tut er dann? Ist er dann mehr er selbst? An einen einsamen Albert zu denken ist schwer, an Albert zusammen mit Lisa, das ist schlimmer, aber vorstellbar. Wie er zu Frauen ist, weiß ich.
Diese Wohnung ist jetzt oft wie eine Gruft. Nässe und Dunkelheit dringen ein. Ich könnte ausgehen, natürlich könnte ich das. Ich habe Geld. Theater, Konzerte, Kino, Vorträge, Ausstellungen, Restaurants, eine ganze Industrie wartet darauf, daß ich einen Stuhl besetze, ihnen mein Geld bringe, daß ich Beifall klatsche und konsumiere, was sie mir vorsetzen.
Aber: ich gehe nicht, höchstens an den Bahnhof. Ich könnte telefonieren. Ich könnte sogar J. anrufen. Er ist jetzt, im Weihnachtsgeschäft, abends lange in seinem Laden und meist allein. Oder die Eltern, die es sehr beunruhigen würde, so spät, nach zehn Uhr abends, ohne dringenden Anlaß. Haltung, Johanna!
Am besten ruft man am Abend Frauen an, solche wie mich, denen man nichts zu erklären braucht. Aber: ich rufe niemanden an.
Ich könnte das Radio einschalten. Albert hat mir zum Geburtstag den kleinen Apparat geschenkt, wohl schon im Hinblick darauf, daß er den großen mitnehmen würde, den ich ja doch nicht ausnutze. Eine Rundfunkzeitung kaufe ich nicht mehr. Ich lebe ohne Programm. Manchmal drehe ich an den Knöpfen. Wortfetzen, Musikfetzen, und dann schalte ich aus. Keine Hilfsmittel.
Ich lese auch nicht. Manchmal schreibe ich Briefe. Statt besonderer Anzeige.
Heute hat Marlene geantwortet. »Was soll man dazu sagen, Hanne? Was könnte man dazu sagen? Daß es schlimm ist, aber mit jedem Tag leichter wird? Nicht einmal das stimmt. Wenn man gerade eben meint, man hätte es nun geschafft und sei fertig damit, dann wirft einen irgend etwas um, ärger als in der allerersten Zeit, wo man gewappnet ist bis an die Zähne. Jedes Angriffs gewärtig, parierend, nicht mit einem Schild, sondern gleich mit dem Dolch. (Ich gebe gerade Geschichte in einer Quarta!) Später, dann kommen Abende … Warum sage ich das überhaupt? Am Ende verwindet es sich. Genau das: Es verwindet sich. Ein Vorgang, der von uns unabhängig ist, intransitiv. Die Zeit frißt sogar unseren Kummer. Ich hatte Albert gern, sehr gern, wer hatte das nicht? Manchmal scheint mir, als scheiterten mehr glückliche als unglückliche, von vornherein nicht auf Glück hin angelegte Ehen. Aber kaum hat man einen solchen Satz aufgeschrieben, sieht man, wie falsch er ist. Manche Menschen meinen, reden nützt. Nur einfach darüber reden. Wenn es das ist, dann besuch mich. Wir können auch darüber schweigen, es gibt vieles andere, zum Beispiel den Geschichtsunterricht in der Quarta! Ich bin älter. Über diese fünf Jahre haben wir früher manchmal gelacht; aber heute merke ich es deutlicher denn je: Ich habe das, was in meinem Leben Schicksal war, hinter mir. Schon lange. Viele denken, ich sei bitter geworden, doch das stimmt nicht. Wir geben uns alle anders, als wir sind, und leiden dann darunter, daß man uns nicht versteht. Immer wollen wir verstehen und immer verstanden sein. Ach, Hanne! Dabei kommt es doch nur darauf an, sich selbst zu erkennen und zu begreifen und sich nichts vorzumachen. Und die anderen zu lieben. Statt dessen ist es umgekehrt, statt dessen wollen wir die Menschen, die wir lieben sollten, verstehen; und lieben tun wir uns selber, gehen behutsam mit uns um, vermeiden, hinter unsere wahren Beweggründe zu kommen. Sagen will ich mit alledem aber nur: Du bist jetzt dran, damals war ich’s. Alles, was vorher war, war Vorbereitung für diesen Augenblick. Bis jetzt hat Dich das Leben geschont, wenn wir mal von Tutti absehen, das war natürlich schlimm, aber doch kein Schicksal. Jetzt muß sich entscheiden, was an Dir dran ist, was gut ist, was böse. In jedem Falle ist es ein Scheitelpunkt. Gott sei Dank hat jedes Leben nur einen, zwei höchstens …«
Seit dieser Brief hier ist, denke ich an Marlene. Zum erstenmal seit langem bin ich imstande, an einen Menschen zu denken, der nicht verstrickt ist in dieses Gewirr von …
Marlene ist Studienrätin an einem Lyzeum. Man sieht ihr nichts mehr an. Wenn sie in den Pausen auf dem Ecksofa im Lehrerzimmer sitzt, unterscheidet sie sich in nichts von ihren Kolleginnen. Ihr Leben wird durch den Philologenkalender bestimmt. Es ist Jahre her, da hat sie ihn mir gezeigt und gesagt: Jetzt brauche ich, bis ich fünfundsechzig bin, nichts anderes zu tun, als diesen Kalender abzuleben, er bestimmt den täglichen Stundenplan, er bestimmt, wann ich Ferien habe, wann meine Feiertage sind, wieviel Geld ich zur Verfügung habe. Und das sollte ich mir nicht zutrauen? Ein sorgfältig abgegrenzter Lebensbereich, in dem mir nicht mehr viel passieren kann. Man sieht ihr nichts mehr an. Aber: sie hat ihr Geheimnis. Das mögen andere auch haben, jeder meint ja, er trüge etwas an sich, das ihn unverwechselbar macht, aber sie hat außerdem ihren Sohn, der sie manchmal am Schultor abholt. Sein Gymnasium liegt nicht weit von der Schule entfernt, an der sie unterrichtet. Ein junger Humanist, wie seine beiden Väter.
Sie ist ein Stück meiner Vergangenheit, längst vergangener Vergangenheit, jetzt steigt das wieder auf. Ich bin fortgegangen, und sie ist geblieben. In der Stadt, in der das alles geschehen ist. Das Leben hat ihr recht gegeben, es ist ein merkwürdiger Richter. Ihr Sohn wächst auf, wie sie es gewollt hat. Wer erinnert sich noch? Was weiß ihr Sohn? Was wird sie ihm je sagen? Lebt überhaupt noch einer von denen, die mit dabei waren, außer mir? Ich studierte. Mein erstes Semester. Und sie hielt ein Proseminar über Shakespeares Königsdramen. Es war März. März neunzehnhundertvierundvierzig. Man vergißt das ganz, es gab Proseminare. Man las Shakespeare, begierig nach Erschütterungen, die von Dauer waren und von innen her kamen.
März. März vierundvierzig. Marlenes Hochzeit war auf den zwölften angesetzt, nachmittags, drei Uhr. Die auswärtigen Gäste waren bereits am Vortag eingetroffen, die Trauung sollte im Haus stattfinden, damit die Mutter der Braut daran teilnehmen konnte. Ein Onkel Marlenes sollte die Zeremonie vollziehen. Den Bräutigam erwartete man am Morgen des Hochzeitstages, zusammen mit einem Freund, dem Trauzeugen. Sie kamen aus dem Westen, von der ruhigen Front, die Invasion hatte noch nicht begonnen, aber man rechnete schon damit.
Keiner wußte, warum Marlene diesen Mann heiraten wollte, einen aktiven Offizier, sie, eine ehrgeizige Philologin. Liebte sie ihn? Man hatte wenig Zeit, darüber nachzudenken, man brauchte sie, um alle Schwierigkeiten zu überwinden, die sich einem Fest entgegenstellten. Im nächsten Semester hätte sie ihr Staatsexamen ablegen sollen; statt dessen hatte sie sich exmatrikulieren lassen. Anglistin im neunten Semester.
Am Vorabend kamen alle Gäste zu uns. Unsere Gärten grenzten aneinander. Gegen zweiundzwanzig Uhr gab es Luftwamung. Wir nahmen das Radio mit in den Luftschutzkeller, die Gläser auch, der Wein lagerte unten. Es gab Wein, ebenso wie es Shakespeare gab. Alles nebeneinander. Es passierte nichts in jener Nacht, zum tausendstenmal passierte nichts. Die Stadt blieb nahezu bis zum Kriegsende unversehrt. Aber nur nahezu. In der Feme schoß die Hak. Marlenes Vater nannte es die Salutschüsse zu Ehren seiner Tochter. Ein heiterer Abend. Wir waren an Kellerfeste gewöhnt. Marlene war still. Wir beide standen zusammen auf der Treppe, vor dem dunklen Haus. Zwei junge Mädchen. Die Nacht war sternenhell, unten lag dunkel die Stadt. In regelmäßigen Abständen strichen Scheinwerfer über den Himmel, wischten die Sterne weg, die zitternd wieder auftauchten. Marlene legte mir den Arm um die Schulter. Ich spürte, wie erregt sie war. Etwas war nun vorbei. Diese Nacht beendete unsere Freundschaft, ich wußte das; sie machte auch mich älter. Ich habe sie gefragt. Sie drehte ihr Gesicht weg, sie war blaß, aber das war sie immer, ist sie heute noch. Ich will etwas haben zum Verlieren, sagte sie. Sonst lebt man nicht wirklich. Ich will leben, wie eine Frau im Krieg leben muß, die wartet und Angst hat und… Aber da heulten die Sirenen auf, ich weiß nicht, was sie noch sagen wollte. Die Gäste kamen aus dem Keller, die Gläser in der Hand. Als die Sirenen schwiegen, rief es von irgendwo: Licht aus, Licht aus. Man durfte die Tür seines Hauses nicht öffnen, wenn irgendwo noch eine Lampe brannte. Die Gäste verabschiedeten sich, laut und fröhlich. Mein Vater nahm mich beim Arm und ging den Gartenweg mit mir auf und ab. Die Veilchen dufteten. Shakespeare – Wein – Veilchen und ein Vater, der mit seiner Tochter in einer Frühlingsnacht im Garten spazierengeht. Drei Wochen Genesungsurlaub. Keine Verwundung, nur Gelenkrheumatismus, der ihn zeitweise völlig lähmte. Aber doch nur zeitweise. In wenigen Tagen mußte er zurück an die Front. Rußland. Mittelabschnitt. Sieben Jahre ist er fortgeblieben. Nicht in Rußland. Auch er war erregt, blieb immer wieder stehen, setzte zum Sprechen an, aber mehr als »etwas geschieht, etwas geschieht« hat er nicht gesagt. Dann rief meine Mutter nach uns: Kommt doch herein, ihr werdet euch erkälten, es ist feucht. Vater lachte auf, wie das seine Art war. Hörst du, Johanna, vor Erkältungen muß man sich in acht nehmen, merk dir das!
Am Morgen des Hochzeitstages gingen wir abwechselnd zum Bahnhof, genau wußte man nicht, wann die Fronturlauberzüge eintrafen. Gegen Mittag fielen die ersten noch lachend geäußerten Bemerkungen. Hochzeitsreise ohne Mann! Die einzige, die unverändert blieb, war Marlene. Um zwei Uhr ging sie in ihr Zimmer, um ihr Brautkleid anzuziehen. Schlimm war bis dahin nur die Mutter, die in ihrem Stuhl von einem Raum in den anderen rollte, mit dem Stock kurz und heftig gegen die Türen stieß, bis man sie ihr öffnete. Sie fuhr an den Gästen vorbei, die in Gruppen herumstanden und nur, wenn der Rollstuhl auftauchte, nervöse Gespräche führten. Sie trug ein schwarzes Kleid, die verkrüppelten Beine waren von einem Plaid bedeckt, demselben, aus dem ihr Enkel später seinen ersten Mantel bekommen hat. Der Onkel saß schon seit ein paar Stunden am Klavier, gelegentlich raffte er sich zu einem Choral auf, intonierte, präludierte. In meiner Erinnerung ist das zu einem endlosen »O selig Haus, wo man dich aufgenommen« geworden.
Um fünf Uhr ging ich zum drittenmal an den Bahnhof. Ich steckte das Kleid hoch, damit es nicht unter dem Mantel hervorsah. Ich hatte mich umziehen wollen, aber Marlene ließ das nicht zu. Bleib so, sagte sie, bleibt alle so, wir müssen auf den Bräutigam warten. Mir gab sie die Taschenlampe mit, falls es spät würde. Sie küßte mich, was sie nie getan hatte. Als ich gegen sieben Uhr zurückkam, war alles unverändert. Blumensträuße lagen auf den Tischen, niemand hatte sie in Vasen gestellt, keiner hatte etwas gegessen, seit dem Vormittag nicht. In der Küche stand alles bereit für das Hochzeitsmahl. Die Frau, die es richten sollte, saß am Küchentisch und strickte. Der Onkel schien seinen Platz am Klavier nicht verlassen zu haben. Als ich eintrat, sang er wieder: »O selig Haus, da du die Wunden heilest.« Aber vielleicht apostrophiert mein Gedächtnis eigenmächtig.
Der Rollstuhl war endlich zur Ruhe gekommen. Die Gäste hatten sich in der geräumigen Wohnung verteilt, hatten Bücher aus den Schränken genommen und gaben vor zu lesen. Man wartete. Man hatte Angst. Das scheint immer zusammenzuhängen. Warten und Angsthaben. Marlene war nach oben gegangen. Ich fand sie in ihrem Zimmer. Sie war dabei, ihren Koffer auszupacken. Sie hatte noch das weiße Kleid an, Kranz und Schleier hatte sie abgelegt. Ich hatte vorher nie gesehen, daß sie schön war. Sie lächelte. Siehst du, nun fängt das schon an! Um acht Uhr gingen wir zusammen nach unten. Als wir eintraten, drehte sich der Onkel auf seinem Klavierschemel um, er rauchte eine Zigarre. Er schien darüber nachzudenken, ob die Situation bereits seinen seelsorgerlichen Beistand erfordere. Als sein Blick auf Marlene fiel, sagte er und hob dabei in einer Geste, die so ungeschickt und berufsmäßig war, daß wir alle zusammenzuckten, die Arme, ließ sie dann wieder sinken, rief dabei: Mein armes, liebes Kind! Wir dachten, Marlene würde die Fassung verlieren und aufweinen. Vielleicht hätte sie es tun sollen, damit wir alle es konnten, aber sie sah uns gar nicht, ging an uns vorbei zum Rundfunkgerät und schaltete den Deutschlandsender ein. Sie mußte vorher auf die Uhr gesehen haben, denn unmittelbar darauf wurden die Nachrichten durchgegeben.
Am Ende des Wehrmachtsberichtes wußten wir es. Es gab keine andere Möglichkeit. Der Onkel räusperte sich. Er fühlte sich wohl zuständig für Erklärungen und Trost. Aber bevor er nur den Mund auftun konnte, rief Marlenes Mutter: Kein Wort jetzt, Karl! und setzte ihren Rollstuhl in Bewegung. Ich lief, ihr die Tür zu öffnen, bevor sie mit ihrem Stock dagegenstoßen konnte. Ich machte die Schlafzimmertür auf, aber sie wies zur Küche hin.
In diesem Augenblick klingelte es an der Haustür. Im Wohnzimmer blieb es still, niemand außer mir schien es gehört zu haben. Vor der Tür stand der Freund. Ich wußte sofort, daß er es war. Unter der Uniformmütze, die er nicht abnahm, trug er einen Stirnverband. Er sagte: Ich muß Marlene sprechen, sofort, allein. Ich nickte. Ich ging ins Zimmer. Ich sagte laut: Ein Fremder steht vor der Tür, er will dich sprechen. Während Marlene draußen im Hausflur war, präludierte der Onkel auf dem Klavier; wenn er leise spielte, hörte man das Klappern der Pfannen und Töpfe aus der Küche. Stimmen aus dem Flur hörte man nicht.
Später erfuhren wir ein paar Einzelheiten. Der Fronturlauberzug, der aus Richtung Lyon kam, war in der Höhe von Bonn von feindlichen Tieffliegern angegriffen worden. Es war Befehl gegeben worden, die Waggons zu verlassen und an den Böschungen Deckung zu suchen. Drei Tote, der Bräutigam einer davon. Der Freund ließ sich, nachdem er verbunden war, zur zuständigen Kommandantur bringen und erreichte dort, daß man ihm einen Wagen zur Verfügung stellte. Man händigte ihm sogar die Papiere des Toten aus, um sie den Angehörigen zu überbringen, ebenso wie die Ringe, die der Bräutigam bei sich trug. Bis dahin verlief alles folgerichtig. Im Krieg gilt als folgerichtig, daß ein Mann am Tag seiner Hochzeit an einem Bauchschuß stirbt.
Marlene kam wieder ins Zimmer, den Fremden hatte sie nach oben gebracht, damit er sich waschen konnte. Sie benutzte seine Abwesenheit, um uns mitzuteilen, was sie erfahren hatte. Zum Schluß sagte sie uns dann, daß die Trauung vollzogen werden sollte. Juristisch sei das möglich, der Fremde wisse auch darüber Bescheid. Die notwendigen Formalitäten könnten nachträglich in Ordnung gebracht werden, sage der Fremde. Noch mehrere Male sagte sie »der Fremde«, nie sagte sie »sein Freund«. Sie wolle von nun an den Namen ihres Mannes tragen und seinen Ring. Dann wandte sie sich an den Onkel, sprach leise und eindringlich auf ihn ein, und wir gaben uns Mühe, nicht hinzuhören. Zuletzt forderte sie uns auf, in zehn Minuten in der Diele zu sein.
Keiner erhob Einspruch. Wir waren wohl erleichtert, daß endlich etwas geschehen würde, das in absehbarer Zeit dem allen ein Ende machte. Keiner kam auf den Gedanken, seinen Mantel zu nehmen und dieses Haus zu verlassen. Nur das Kind schickte man fort, das bis dahin die Tür geöffnet und die Gratulationen in Empfang genommen hatte. Was jetzt kam, war nichts für Kinder.
Der Pastor, der inzwischen den Talar angelegt hatte, nahm mich mit in die Diele. Wir richteten zusammen den Tisch, stellten die Schale mit Narzissen darauf und Kerzen. Er legte die Bibel aufgeschlagen in die Mitte und fragte, ob ich Klavier spielen könne, dann sollte ich jetzt nach nebenan gehen und anfangen. Ich könne ja weiterhin »Befiehl du deine Wege« spielen, das passe immer.
Als ich mich umdrehte, um seinem Auftrag nachzukommen, stand im Halbdunkel oben auf der Treppe der Fremde. Ich schrie auf, der Pastor faßte mich beim Arm, aber ich weiß, daß auch er gesehen hat, was ich gesehen habe. Es war der Tod. Lange danach habe ich ihn noch immer so gesehen, und als Tutti starb, da sah der Tod wieder so aus wie der Fremde. Inkarnation des Krieges, des verlorenen Krieges, dieses Krieges, der nie ein Ende nahm. Der Fremde trug den Stimverband wie einen Nimbus. Er setzte sich in Bewegung und kam auf uns zu, starr und fremd und schön.
Ich lief nach nebenan, setzte mich ans Klavier und versuchte, den Choral zu spielen. Ich weiß nicht, wie lange ich so saß und nichts hörte von dem, was meine Finger spielten. Als ich in die Diele zurückkehrte, hatten die Gäste sich im Halbkreis um den Tisch gestellt, der Brautvater hinter den Rollstuhl, die Hände auf den Schultern seiner Frau. Marlene wandte sich an den Fremden. Mein Mann war Ihr Freund. Ich bitte Sie, neben mir zu stehen während der Trauung. Als sein Stellvertreter! Es verwunderte uns nicht, niemand verwehrte es; es schien ganz natürlich, daß hier ein Mädchen dem Tod angetraut wurde. Sie stand stellvertretend für uns alle. Der Pastor schien nicht mehr der, der im Wohnzimmer ratlos am Klavier gesessen hatte. Sein geistliches Gewand gab ihm Sicherheit ebenso wie der Umgang mit dem vertrauten Gerät. Er hielt uns eine Predigt, von der ich glaubte, daß ich sie nie vergessen würde. Aber ich habe alles vergessen, Wort für Wort. Das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen, das wird es wohl gewesen sein, es lag nahe. Aber es war nicht die Ansprache, die er im Konzept bei sich trug, die er zur Hochzeit seiner gelehrten Nichte vorbereitet hatte.
Die Trauungszeremonie. Kein Zögern, als er sagte: Bis daß der Tod euch scheide. Er nahm die Ringe und schob den ersten an die Hand der Braut, nahm den zweiten, um ihn über den ersten zu schieben. Eine Witwe. Aber Marlene zog die Hand zurück, griff mit der anderen selbst nach dem Ring und gab ihn dem Fremden. Sie blickte ihn an, und für die Dauer dieses Augenblicks ging etwas wie ein Lächeln, ein Erkennen über beide Gesichter. Marlene nahm dann den Arm des Fremden und sagte: Wir wollen zu Tisch gehen. Die beiden voran, der Vater folgte, immer noch eine Hand auf der Schulter der Gelähmten. Wir anderen schlossen uns an.
Auf dem Platz des Bräutigams saß der Fremde, der Platz neben mir blieb leer. Nach der Vorspeise sollte es Sekt geben. Die Braut wandte sich an ihren Vater: Willst du uns nicht einschenken? Als das geschehen war und immer noch keiner zum Glas griff, stand sie auf und fragte: Trinkt keiner auf mein Wohl?
Ich weiß nicht, von welchem Zeitpunkt an wir vergessen haben, daß der wahre Bräutigam tot war und nur ein Stellvertreter auf seinem Platz saß. Wann sie es vergessen hat, ob sie es überhaupt vergessen hat? Keiner hat erfahren, was zwischen den beiden geschehen ist in den Minuten der Trauung. Allmählich wich die Erstarrung von uns. Wir griffen häufiger zum Glas, wir redeten, lachten. Bald nach Mitternacht erhob sich der Pastor, wartete, bis das Gespräch verebbt war, und sagte, daß wir dieses Fest nun beenden wollten, aber wir sollten es doch nicht tun, ohne Gott zu danken und ihn um eine ruhige Nacht zu bitten. Er hat in seinem Gebet den Toten nicht erwähnt. Keiner von uns hat das bemerkt, die meisten kannten ihn ja auch nicht.
Am darauffolgenden Tag ging ich mittags ins Nachbarhaus. Beim Frühstück hatte ich versucht, den Eltern zu berichten, was geschehen war. Die sachlichen Zwischenfragen meiner Mutter verwirrten mich, alles, was ich erzählte, erschien auf einmal unglaubwürdig, als habe ich es nur geträumt. Marlenes Vater öffnete mir die Tür. Für ihn war ich, auch noch nach dieser Nacht, das Kind aus dem Nachbargarten.
Ich entnahm seinen wenigen Worten nur, daß Marlene fort sei. Wohin, erfuhr ich nicht. Auch der Fremde war fort. Das Haus war leer, aufgeräumt, als habe dieses Fest nie stattgefunden.
Sie ist mit ihm gegangen. Sie sind zusammengeblieben, bis sein Urlaub zu Ende ging. Zehn Tage. Sie ist nicht zur Beisetzung des Mannes gefahren, dessen Namen sie und ihr Sohn führen. Der Fremde wurde bald nach jenem Urlaub zur Heeresgruppe Süd kommandiert. Rußland. Die Invasion hatte noch immer nicht begonnen. Es wird wohl im Juni gewesen sein, sie haben sich noch einmal getroffen, für zweimal zwölf Stunden, bevor er zum Einsatz kam.
Im letzten Kriegswinter erreichte mich in meiner Flakstellung ihr Brief, in dem sie mich bat, die Patenschaft für ihr Kind zu übernehmen. Ein fremder Pfarrer hat es getauft, auf den Vornamen des Mannes, auf dessen Heimkehr sie wartete. Oder wartete sie schon nicht mehr –? Wartet sie heute noch?
Was dann kam, war Leben wie andere Leben auch. Ihre Eltern starben bald nacheinander. Nach Wiedereröffnung der Universitäten legte sie ihr Staatsexamen ab. Sie wurde Referendarin, sie promovierte zum Dr. phil., sie bezog das Haus ihrer Eltern, wurde Assessorin am Lyzeum. Heute ist sie Studienrätin, sitzt in den Pausen auf ihrem Platz in dem Ecksofa des Lehrerzimmers, kaum zu unterscheiden von ihren Kolleginnen. Aber manchmal holt Klaus sie am Schultor ab.
Marlene –
Hier sitze ich und werfe mein Netz aus. Fange mir Menschen ein. Denke an sie. Rede mit ihnen. Und dann öffne ich das Netz und gebe sie wieder frei.
Die Abendvorstellung im Kino ist schon lange aus. Die Nacht ist dunkel, naß, ölig. Die Autos fahren langsam durch den Nebel. Wieder ist ein Tag vorbei. Einer von diesen mühsamen Tagen.
Geh schlafen, Johanna.
10. Dezember
Die Kleine von nebenan war hier. Manchmal höre ich sie jetzt. Das tackemde Geräusch, von dem ich bisher nicht wußte, was es sein könnte, macht ihr rotes Blechauto, in dem sie auf dem langen Korridor hin und her fährt. Auf die Straße darf sie es nicht mitnehmen. Auch das Nebenhaus hat keinen Fahrstuhl.
Ob ich keinen Adventskranz habe, hat sie gefragt. Sie hat mir »Tochter Zion« vorgesungen und weiß doch nicht einmal, was Jerusalem ist. Alles sind noch Worte, sie will noch gar nicht wissen, was sich dahinter verbirgt. Worte und Dinge sind noch zweierlei.
Dann fragte sie: Hast du keine Kinder?
Nein. Ich zögerte, aber nur einen Augenblick, dann sagte ich, weil es diesem Kinde gegenüber leicht ist, davon zu reden: Ich hatte ein kleines Mädchen, das ist gestorben, als es zwei Jahre alt war.
Richtig tot?
Ich nickte. Richtig tot.
Sie nickte auch und betrachtete mich ernsthaft, mit neuem Interesse.
Rundgang durch die Wohnung. Zeig mir alles! Alles! Zeig mir, wo du schläfst! Hinter der Wand wohnen wir!
Ich kann dich hören, wenn du Auto fährst, Mausi.
Sag nicht Mausi zu mir! Wer schläft in dem anderen Bett?
Mein Mann.
Wo ist der?
Genug gefragt, Mausi, komm, wir kochen uns Schokolade.
Dann haben wir gemalt. Katzen von hinten, Eichhörnchen von der Seite, Eulen von vom. Sie hat die Bilder mitgenommen.
Ich kann ja auch mal mit dir spazierengehen, Tante Grönland, wenn du immer allein bist. Sie ist sich ihres Auftrags bewußt.
Als sie fort war, habe ich die Adventskette hervorgeholt und über der Couch aufgehängt. J. sollte sie haben. Einen Tag habe ich damit zugebracht, alle die Dinge einzukaufen, kleine Schnapsflaschen, Zigaretten, goldene Nüsse, Marzipan, ein Feuerzeug, und alles eingepackt in buntes, glänzendes Papier und an eine Kette aus gedrehten Goldfäden gehängt, für jeden Adventstag ein Päckchen und für den ersten Sonntag einen blauen gläsernen Vogel. Und nun liegt die Kette da. In einer Schublade. J. hat keine Wand, an die er sie hängen könnte. Aber das ist mir erst eingefallen, als die Kette fertig war. Jetzt schwebt der blaue Vogel unter der Decke meines Wohnzimmers. Abends, wenn die Lampe brennt, scheint er zu fliegen.
Wie lange ist das her, daß ich Albert eine solche Kette geschickt habe. Fünf Jahre, sechs Jahre. Es war jener Herbst, in dem er den ganzen November und noch den Dezember fort war. Bodenseegebiet. Zum ersten Mal besuchte er Kliniken, er fing an, Erfolg zu haben, er konnte nicht nach Hause kommen, er mußte die neugeknüpften Beziehungen ausnutzen, damit ihm kein anderer dazwischenkam. Alles wiederholt sich. Als ich die Kette für J. knotete, hatte ich vergessen, daß ich das schon einmal tat, für einen anderen. Das Gefühl bleibt. Der Gegenstand wechselt. »Das Bittersalz der Ironie«.
Später am Abend rief Albert an. Er will mich wohl kontrollieren. Ich nehme an, er fürchtet, daß ich zuviel trinke. Vielleicht auch, daß ich so auf dem Bettrand sitze wie einmal im letzten Herbst, als er unerwartet kam. So kannst du doch nicht sitzen bleiben, Hanna!
Was soll ich sonst tun?
Deine Mutter würde sagen: Kind …
… mach dich ein wenig frisch, ich weiß. Aber diese Sätze passen nicht mehr. Wir lachen nicht mehr darüber. Formeln, die ihren Zauber eingebüßt haben. Ich stand trotzdem auf, als sei alles wie sonst, ging ins Badezimmer, machte mich frisch. Solange ich seine Frau war, hatte er Anspruch darauf, daß ich gepflegt aussah, proper, wie er’s gewöhnt war.
Seitdem hat er Angst um mich. Vorher war er von meiner Selbständigkeit und Sicherheit überzeugt. Er hielt mich für eine von den Frauen, die durchaus allein mit dem Leben fertig werden. Oft genug habe ich es ihm in den beiden letzten Jahren gesagt, wahrscheinlich zu oft.
Er fragt am Telefon: Wie geht es? Er sagt: Paß auf dich auf, Hanna! Genau wie Vater: Haltung, Johanna, Haltung!
Ich wollte, ich paßte weniger auf. Ich wollte, es paßte ein anderer auf. Das habe ich alles nicht gesagt, sondern: Ja, natürlich, danke.
Kann ich etwas für dich tun? – zögernd gefragt. Hast du alles? Nach einer Pause: Ich war draußen, mit der Bahn.
Ich weiß.
Hast du mich gesehen?
Ja.
Er will unser kleines Haus verkaufen. Er hat einen Interessenten. Ob ich mitkommen will. Es wäre gut, wenn wir zusammen Ordnung machten vorher. Vielleicht ist da noch das eine oder andere, was du haben möchtest, zur Erinnerung? Entschuldige!
Mein Gott, Albert! Wozu denn? Erinnerungen. Es sind doch so schon zu viele.
Langer Exkurs über warum und wozu. Warum fragt nach der geistigen Ursache; wozu nach dem Ziel, zu dem hin und so weiter. Nicht alles habe einen Zweck. Ich sei realistisch, wie alle Frauen übrigens.
Ich: Aus dem Stadium des Fragens nach dem Warum sei ich hoffentlich endlich heraus. Wenn man die Zwangsläufigkeit einer Entwicklung erkannt hat, dann muß man zusehen dahinterzukommen, zu welchem Zweck es einem widerfahren ist. Mit anderen Worten, wozu es gut ist.
Albert: Gut ist –? Gut –?
Ich: Gut war.
Am Telefon können wir leichter miteinander reden. Wenn wir uns gegenüberstehen, irritieren wir uns wie früher.
Am nächsten Sonnabend fahren wir. Er holt mich schon früh ab, damit genug Zeit ist zum Aufräumen und zum Aussortieren. Warum habe ich nicht nein gesagt? Warum – wozu. Wie war der Unterschied? Zu welchem Zweck? Heute früh wußte ich es noch.
11. Dezember
Am Rhein mit der Kleinen von nebenan. Vorher Kaugummi gekauft in der Drogerie an der Ecke.
Nanu, Frau Doktor? Ein Seitenblick auf das Kind.
Warum sagte der Mann Frau Doktor zu dir, Tante Grönland?
Das tut man, wenn der Mann einen Titel hat.
Was ist ein Titel? Wo ist der Titel? Wohnt der nicht bei dir?
Geduldig alles beantwortet.
Vielleicht hätte ich gleich fortziehen sollen. Hier kennt man mich, hier fragt man. Ich glaubte, es sei besser, man redet über mich, als daß niemand mich kennt. Dafür muß ich das »Guten Morgen, Frau Doktor« hinnehmen und die Seitenblicke auch. »Sie essen doch auch Sanella, Frau Doktor?« Margarinereklame. Vor Jahren, vielen Jahren, heute essen sie alle keine Margarine auf dem Brot. Wir wollten es auch nicht, schon damals nicht. Vielleicht hat alles daran gelegen? Unser täglich Brot gib uns heute. Als ich fünf Jahre alt war, habe ich Mutter gefragt: Vater verdient das Brot, aber was ist mit der Butter? Frauen sind realistisch.
Die Schiffe sind gezählt. Schlepper, Tanker. Keine Personendampfer mehr, auch das Fährschiff liegt still. Der Tag dunkelte so hin, die Autos fuhren mit Nebellichtern über die Brücken, und die Sirenen der Schlepper tuteten. Bei Ostwind kann ich sie nachts bis hierher hören.
Ich habe dem Kind versprochen, daß die weißen Pappglocken an den Girlanden über den Straßen in der Weihnachtszeit läuten werden. Zum erstenmal wieder mit einer Kinderhand in meiner.
J. hat mir einen Band moderner französischer Lyrik geschickt. Nur ein Zettel lag darin: Statt eines Besuches. So vieles ist bei ihm: statt dessen, anstatt –
Irgendwo wird in dem Buch etwas stehen, das für mich bestimmt ist. Ohne Bezug wird es nicht sein. Angestrichen ist nichts. Ich bin nicht aufmerksam genug, ich müßte hellhöriger sein für alles, was von ihm kommt. Wie anders das einmal war. Da sagte ich: Ich weiß. Aber damals war es Albert. Ich bin so leicht zu irritieren, ich bin meiner Sache nicht sicher genug. Ein Traumwandler, der schon einmal abgestürzt ist –
Es ist lange her, daß ich etwas übersetzt habe. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, für später?
Ich habe über dem Buch gesessen und jene Stelle, die für mich dort steht, gesucht; ich habe mit blinden Fingern auf eine Zeile getippt. Des Fleurs du Papier – Papierblumen.
»Je t’avais dit tu m’avais dit Je t’avais dit je t’avais dit tu m’avais dit Je t’avais dit tu m’avais dit je t’avais …«
Ein paar Zeilen weiter: Es ist unmöglich, die Zeit der Sonne wiederzufinden, die Zeit der Zukunft – des fleurs du papier! Und wieder dieses quälende: Ich habe dir gesagt, du hast mir gesagt. – Worte! Worte! Hundertmal gesagt und weggeworfen wie Papierfetzen, wie Blumen, wertlos, zerrissen, staubig, welk. Diese doppelte, verzweifelte Vergänglichkeit, Blumen – Papier – Worte. Die fremde Sprache, die fremde Wahl von Rhythmus und Wort, es ist, als ob durch die zweifache Verschlüsselung vieles deutlicher würde, als höbe das eine Geheimnis das andere auf.
Oder hat er das gemeint:
»Elle est l’amour qu’elle refuse pour la comprendre il faut l’ouvrir II ne restera rien qu’un pas imperceptible De pétales froissés …«
Wieder die Rose, wieder ein Gleichnis, seit Ewigkeiten die Rose. Sie ist die Liebe, die sich verweigert. Um sie zu verstehen, müßte man sie öffnen. Nichts wird dann bleiben als die Unvollkommenheit eines zerstörten, welken Blütenblattes. Wenn man das könnte: dem anderen sein Geheimnis lassen. Und nicht Hülle auf Hülle abschälen, mit ungeduldigen Fingern. Immer: es wird nichts bleiben. Nur Unvollkommenheit, nur Enttäuschung, Ernüchterung, man wird wieder abstürzen, man weiß es und tut es wieder.
Il ne restera rien – es bleibt nichts.
Vielleicht finde ich morgen eine bessere Zeile.
12. Dezember
Ein Brief von Carola. Wieder ein Angebot, meine Beine unter einen fremden Tisch zu strecken, als ob es damit getan wäre. Als ob man nur wegzugehen brauche, den Rükken kehren, einen neuen Schauplatz suchen und von vom anfangen.
Sie kommt sich sehr weise vor, meine kleine Schwester, sie hat ja auch alles so gut und richtig gemacht bisher. »Du bist doch noch gar nicht so alt. Das Leben liegt doch noch vor Dir.«
Ganz recht. Es liegt noch vor mir, nur nicht wie eine blühende Wiese. Weihnachten bei euch? Lieber nicht. Mit den Kindern ist es jetzt so hübsch? Sie lernen schon Gedichte und können sieben Weihnachtslieder. Kann sein. Auch das ist nicht eben ein Anreiz.
Schreiben kann man ihr das nicht. Sie hält mich für verbittert, für ungerecht, das bin ich ja auch. Alles ist gut gemeint, was sie schreibt, treuherzig. »David sieht Dir so ähnlich, er hat Dein Kinn, und die kleine Falte über der Nase, die hast Du doch auch, wenn Du Dich ärgerst, und er ärgert sich so leicht.«
Und nachher dann: »›Laß die Traurigkeit aus deinem Herzen und tue fröhlich deine Arbeit!‹ Sprüche Salomonis, die mußt Du unbedingt mal lesen!«
Sprüche, Cora, außerdem falsch zitiert. Es gibt Zeiten, da kann man mit Sprüchen gar nichts anfangen, da sind einem Sprüche verhaßt, es gibt nämlich für alle Lebenslagen die passenden Sprüche; hoffentlich erfährt sie es nie. Ich werde ihr schreiben: »Weh dem, der allein ist! Wenn er fällt, so ist kein anderer da, der ihm aufhelfe.« Ebenfalls der Prediger Salomo. Spruchweisheit. Kaum besser als Horoskope.
Sie hat darüber nachgedacht und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß es doch alles wohl gut so war, wie es gekommen ist: »Du weißt, daß ich fest daran glaube, daß uns alle Dinge (alle Dinge zweimal unterstrichen) zum besten dienen. Auch daß Tutti gestorben ist. Du bist unabhängig, Du kannst noch mal neu anfangen. Es ist so schwer, ein Kind allein zu erziehen. Kinder ohne Vater tun mir immer entsetzlich leid.«
Warum schickt sie nicht einfach eine schwarzgeränderte Karte: Herzliche Teilnahme, Deine Schwester.
Sie weiß doch nichts. Warum mischt sie sich ein? Warum denkt sie, es sei nicht auch mein Wille gewesen; glaubt sie denn, daß Albert mich verlassen hat? Warum redet sie von dem Kind? Ich habe es ihr damals nicht gestattet und werde es heute erst recht nicht tun. Soll ich denn auch darüber noch nachdenken, was geworden wäre, wenn Tutti noch lebte? Ob Albert und ich zusammengeblieben wären, um des Kindes willen, ob es besser wäre, ich wüßte jetzt, wofür ich zu sorgen hätte, wofür es sich lohnte, nur das: morgens aufzustehen. Und nachts hörte ich wieder das Atmen des Kindes. Soll ich das auch noch alles denken: Was geworden wäre, wenn, alle Möglichkeiten, die es auch noch gegeben hätte. Nein, Cora, nein! Keine Sprüche, weder die von Salomo noch die von Carola Levius.
»Ich bin so glücklich mit meinem Mann!« Gewiß, Cora, sei es, vor allem bleib es, aber red nicht drüber, sonst würde ich eines Tages aus Versehen, nur weil du mich reizt, etwas sagen, was du nicht gern hören würdest, zum Beispiel, warum ich meine Beine nicht unter euren Familientisch zu strecken gedenke. Dein Mann hat nämlich eine fatale Angewohnheit, so zu tun, als habe er die Schwester seiner Frau mitgeheiratet. Willst du Einzelheiten?
Ich behellige dich nicht mit meinen Dingen – deinem Leid, sagt sie –, tu du es bitte nicht mit deinem Glück.
Glück! Da genügt doch schon ein Wort. Und sie schreibt es einfach so hin, in einen Brief, nach Tisch, wenn die Kinder schlafen und die Aufwartefrau in der Küche den Abwasch macht.
Die Maßstäbe sind verschieden, auch die für das Glück.
Selbst wenn ich sage: Man muß da gerecht sein, bin ich noch ungerecht.
13. Dezember
Keine Post.
Mittags beim Friseur. Sie sollten die Haare kurz tragen, gnädige Frau, das ist jugendlicher. Sie haben eine so schöne Stirn.
Albert wollte immer, daß ich das Haar lang trug. Er schlang es sich ums Handgelenk. An irgendwas muß sich ein Mann doch halten können.
Die Haare sind kurz. Aus Demonstration? Was tut man eigentlich, ohne etwas demonstrieren zu wollen? Neben mir saß eine Frau mit einem trägen, schwer gewordenen Körper, die Hände flach auf den Schenkeln, vier Ringe. Geschenke eines schlechten Gewissens. Nach kurzer Zeit schlief sie ein, und durch das Gesumm der Trockenhauben drang ihr gleichmäßiger blasender Atem. Das Gesicht erhitzt, aufgedunsen. Heiße Tortur, für wen? Das ist jugendlicher, gnädige Frau. Ein ganzes Leben lang. Spielregeln, an die man sich hält. Niemand lobt sie mehr dafür.
Weihnachtseinkäufe.
In der Nähe vom Neumarkt ein Menschenknäuel, aus dem ein Reporter mit ein paar raschen Schritten auf mich zukam, das Mikrophon in der Hand: Junge Frau, darf man einmal fragen, wieviel Geschenke Sie bereits gekauft haben? Sie machen doch eben gerade Weihnachtseinkäufe? Wieviel Geld geben Sie in diesem Jahr für Geschenke aus? Was wollen Sie anlegen, was können Sie anlegen? Für unsere Hörerinnen: Die Dame ist etwa dreißig Jahre alt – fünfunddreißig, junger Mann! –, elegant, grauer Tuchmantel mit Seehundkragen, weiße Stiefel, weißer Garbohut, der Wagen steht vermutlich in einer Nebenstraße. Sie fahren doch einen Wagen? Nein, bitte, nein, nennen Sie keine Marke, wegen der Reklame, gnädige Frau, das ist hier kein Werbefunk. Sie sind nicht von hier, nicht wahr, die Rheinländerin ist schneller zu Fuß mit der Zunge. Würden Sie uns nun einmal verraten, was in dem großen Paket ist? Warten Sie, darf ich einmal raten, ein – ein Reiseplaid für den Herrn Gemahl, stimmt’s?
Er machte eine Pause, in die hinein ich sagte: Ja, mit Fransen, drehte mich um, konnte entkommen. Ich war nicht befriedigt von meinem Abgang, ich fand ihn nicht einmal witzig.
In der Hohen Straße wurden bereits die neuesten Karnevalsschlager verkauft. Gemischten Aufschnitt zum Abendbrot. Das Kirschwasser hat Albert noch gekauft.
16. Dezember
Vielleicht lag es einfach daran: etwas Vorhaben. Erwartet werden. Vorbereitungen treffen. Vielleicht auch dieses Stück heraufbeschworene Vergangenheit. Es würde noch einmal sein wie früher, nur ohne die Selbstverständlichkeit von früher.
Müßig, jetzt, zwei Tage danach, Erwägungen anzustellen, ob es richtig war, daß ich mich darauf eingelassen habe. Ich weiß ja nicht einmal, ob ich es bereue, es ungeschehen wünsche. Dabei – geschehen, was ist schon geschehen? Ein bandagierter Fuß und neue Unruhe, sonst nichts.
Albert kam pünktlich um halb neun. Ich erwartete ihn schon, ich war fertig, ich brauchte nur noch den Mantel überzuziehen. Zuverlässig im Kleinen. Pünktlich. Proper. Prädikate, die Mutter zukommen, nicht mir.