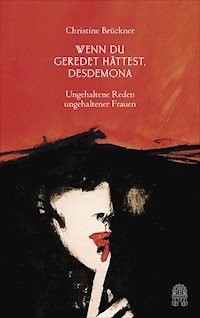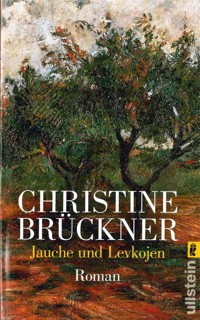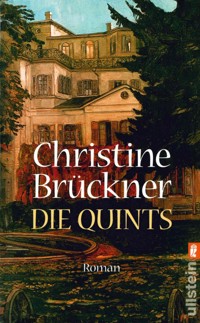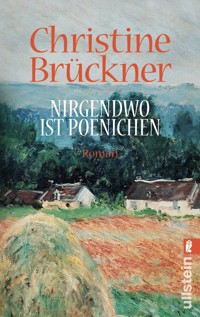3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Schriftstellerin Agnes Pierchotta, die sich 'a.p.' nennt, lernt auf einer Tagung den Rundfunkredakteur J.W. Hück kennen. Es dauert länger als ein Jahrzehnt, bis aus der Bekanntschaft eine Ehe wird. Die beiden lassen keine Zwischenstation aus, nicht die kollegiale Freundschaft, nicht den Flirt, nicht die ungebundene Liebe. Beide veröffentlichen in diesen Jahren Bücher, schreiben sich Briefe, unternehmen Reisen, jeder allein, dann auch zu zweit. Sie sind mißtrauisch gegenüber den Gefühlen des Anderen, aber auch gegenüber den eigenen. Erst als sie sich selbst und einander erprobt haben, entschließen sie sich zur Ehe, die für beide die zweite Ehe ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die AutorinChristine Brückner (1921 - 1996) zählt zu den renommiertesten Schriftstellerinnen Deutschlands. Sie verfasste Romane, Erzählungen, Kommentare, Essays, Schauspiele, auch Jugend- und Bilderbücher. Besonders mit der Poenichen-Trilogie wurde sie einem großen Publikum bekannt. Mehr über Christine Brückner erfahren Sie über die Stiftung Brückner-Kühner unter http://www.brueckner-kuehner.de/.
Das Buch
Die Schriftstellerin Agnes Pierchotta, die sich 'a.p.' nennt, lernt auf einer Tagung den Rundfunkredakteur J.W. Hück kennen. Es dauert länger als ein Jahrzehnt, bis aus der Bekanntschaft eine Ehe wird. Die beiden lassen keine Zwischenstation aus, nicht die kollegiale Freundschaft, nicht den Flirt, nicht die ungebundene Liebe. Beide veröffentlichen in diesen Jahren Bücher, schreiben sich Briefe, unternehmen Reisen, jeder allein, dann auch zu zweit. Sie sind mißtrauisch gegenüber den Gefühlen des Anderen, aber auch gegenüber den eigenen. Erst als sie sich selbst und einander erprobt haben, entschließen sie sich zur Ehe, die für beide die zweite Ehe ist.
Christine Brückner
Das glückliche Buch der a.p.
Refinery by Ullsteinwww.ullteinbucherlage.de/verlage/refinery
Neuausgabe bei Refinery Refinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Oktober 2017 (1) © Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M - Berlin 1970/1994 Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin ISBN 978-3-96048-083-9 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
I
Solange der Mensch ein Buch schreibt, kann er nicht unglücklich sein (Briefe I)
Die erste Begegnung ist verbürgt. Beide nahmen an einer Tagung teil, die im September 1954 in Bad S. stattfand. Ihre Namen sind in der Anwesenheitsliste aufgeführt. Johannes W. Hück las aus seinem soeben erschienenen Essayband »Fragen ohne Antwort«, Agnes Piechotta aus ihrem ersten Roman »Morgen kommt B.«.
Sie sprachen ein paar Sätze miteinander, an die sie sich später nicht erinnerten. Beide waren jedoch an den Veröffentlichungen des anderen interessiert. Sie tauschten die Adressen, um nach der Rückkehr dem anderen ihre Bücher zuschicken zu können. Daraus entstand ein Briefwechsel, der, wenn auch nicht lückenlos, erhalten ist. Zusammen mit Tagebüchern, Aufsätzen und Dokumenten ein Report der Beziehungen zwischen einem Mann und einer Frau.
20. Sept. 1954
Liebe gnädige Frau!
Das ist ein schönes und, so will mir scheinen, auch eigenwilliges Buch. Es steht im Regal und erinnert mich an Sie. Ich wünschte, Sie würden es mir vorlesen! Man hört (und sieht!) Ihnen gerne zu. Sie heißen Agnes! Dabei sehen Sie aus, als möchten Sie Melusine heißen. Ich könnte mir vorstellen, daß Sie immer sonnabends – oder gar montags? – Fischgestalt annehmen. Haben Sie Ihrem Mann bereits 10 Söhne geschenkt? Daß Sie ihm Glück und Ansehen schenken, daran zweifle ich nicht. Warum waren Sie nicht in Begleitung des Herrn P.?
Dank und Gruß von Ihrem J. W. Hück
20. Okt. 1954
Lieber Herr Hück!
Keine 10 Söhne, wenig Glück und wenig Ansehen. Ich habe ›Herrn P.‹ aber auch nicht ›klagend und in Drachengestalt‹ (ich las inzwischen die Geschichte der Melusine!) verlassen. Ich trage weder samstags noch montags einen Fischschwanz, meine Mutter ist keine Fee, sondern die Frau eines Landarztes, aber: Melusine wäre schön. Genug Biographisches! Dank für Ihre »Fragen …«! Ich wüßte ein paar Antworten. Frauen fragen zwar weniger, lernen auch weniger dazu, wissen aber mehr. Fragen Sie weiter! Wo eigentlich? Im Nachtstudio? Welcher Sender?
Der Baum vor meinem Fenster färbt sich golden, eine Pappel, man wünscht immer, daß man sich im Laufe eines Jahres ebenso erneuern und verändern könnte wie ein Baum. Im Mai gibt es Tage, da ist man erstaunt, daß man an Armen und Beinen nicht Blätter treibt, daß man so ausgeschlossen ist … Jetzt wäre ich gern golden.
Grüße von a. p.
10. Nov. 1954
Verehrteste, Melusine,
was für Rätsel geben Sie mir auf! Sie sind eine Graphikerin! Ihre Schrift läßt alle Deutungen offen. Sie geben Zeichen, aber machen keine Mitteilungen. Sie verschlüsseln. Wer kennt den Code? Könnte man ihn lernen …? Ich brauchte Tage, um Ihren Brief zu entziffern. Ich erkenne ein Wort, rätsele, was das Wort davor, was das Wort danach heißen könnte. Da steht ›Baum‹, was wollen Sie mir über einen Baum mitteilen, beziehungsweise was wollen Sie (mir) nicht mitteilen?
Aber das ist wohl Ihre Absicht, Sie Melusine, deren Mutter eine Arztfrau war, daß ich mich tagelang mit Ihnen beschäftige!
Ihr ergebener J. W. H.
Wie schade, liebe a. p., wie ernüchternd: Dieser Baum konnte die Esche Yggdrasil sein, der Weltenbaum, und nun schreiben Sie, es handle sich um den Baum vor Ihrem Fenster, der inzwischen kahl sei. Ihrem Brief fehlten alle Geheimnisse, alle Möglichkeiten der Deutung. Diesmal kann ich aus Ihrem Brief nicht mehr herauslesen, als Sie hineingeschrieben haben. Jetzt muß ich mich mit diesen festgeprägten Schreibmaschinentypen begnügen, die so endgültig sind: Dies und nicht mehr.
Fröhliche Weihnachten wünscht Ihr J. W. H.
P.S.
Sie sollten einmal bei uns lesen, soll ich das arrangieren? Vielleicht im Nachmittagsprogramm. Sehen Sie: Benutzt man die Schreibmaschine, schreibt man gleich von Geschäften!
9. Jan. 1955
Lieber Herr Hück!
Vor lauter Schreiben komme ich nicht zum (Briefe-) Schreiben; weder mit der Maschine noch mit der Hand, weder leserlich noch unleserlich. Welche Nerven- und Körperkraft erfordert ein Roman, haben Sie das je ausprobiert? Was haben Sie bisher geschrieben? Sollte ich das wissen? Wieviel Ausdauer ist in unserem Beruf nötig. Man muß sich selber Impuls sein. Menzel soll gesagt haben, Kunst sei 99 Prozent Transpiration und 1 Prozent Inspiration. Meine kleine Nichte, die für eine Weile zu Besuch bei uns ist, baut sich vor meinem Schreibtisch auf und fragt: Kann ich dich was fragen, Tante Agnes? Inspirierst du oder transpirierst du gerade?
Welche Verführung: so ein leerer Bogen! Die Leute sagen, Papier sei geduldig, ich sage: Es ist ungeduldig, nichts ist ungeduldiger als ein Blatt Papier – . Ich schreibe übers Schreiben, fülle den Bogen. Vielleicht komme ich im März durch M. Auf der Durchreise in den Süden, wenn das Buch soweit ist. Soll ich anrufen?
a. p.
15. Jan. 1955
Liebe a. p.!
Natürlich sollen Sie (anrufen)! Ich freue mich. Ich sehe Sie immer in einem grünen Kleid vor mir. Und wie Sie sich das Haar aus dem Gesicht streifen. Sehen Sie überhaupt genug hinter Ihren Vorhängen? Es wird schön werden! Wie gern geht der Geist auf Abenteuer –
Ihr J. W. H.
Pardon, lieber Herr Hück! Orselina, 10. April 1955 Ich unterbrach die Reise nicht. Ich war müde. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß irgendwer auf der Welt mich sehen möchte. Zu müde für Fragen. Und Antworten weiß ich erst recht keine. Hier ist Frühling, seinetwegen fuhr ich hierher, jetzt wird es mir fast zu viel. Ich steige oft ein Stück die Berge hinauf, weg aus diesem Überschwang, dahin, wo jetzt die wilden Kirschen zwischen den Kastanienbäumen blühen und darunter Primeln und Veilchen. Die Wasserfälle rauschen. Man möchte ein Wasserfall sein.
Ein andermal also. a. p.
Liebe a. p.!
Ende Dezember 1955
Entsteht aus zwei Karten eine Briefschuld? Dann bin ich bei Ihnen verschuldet. Das Jahr geht zu Ende. Ich bezahle Rechnungen und erledige Korrespondenz. Man versucht an leidlich reinem Tisch das neue Jahr zu beginnen.
Wissen Sie eigentlich, daß ich Weib und Kind, so etwas wie eine Familie besitze? Es ist eine etwas absonderliche Ehe; wir leben – allerdings in voller Übereinstimmung – nicht beieinander. Meine Frau hält mich nicht für ehetauglich, sie hat wohl recht. Aber »ein jeglicher in seine Stadt« (Lukas 2, 3). Ich ging dorthin, »wo ich geschätzet werde«. Ein gutes, erfolgreiches Jahr, Frau Kollegin! Ihr J. W. H.
So sollte Ihre Welt aussehen, lieber J. W. Hück! Blau und phantastisch, mit einem goldenen Mond, wie bei Paul Klee. Ein reiches und erfülltes Jahr, in dem Sie hier und da einen Zipfel des Glücks erwischen.
Ich las das Geburtsdatum im ›Who’s who‹. Verh., 1 Kind. Worte und Widerworte! Sätze und Gegensätze! Die Feindschaft besteht nur auf dem (Zeitungs-) Papier.
1. März 1956
Ihre a. p.
3. März 1956
Danke, liebe Frau Kollegin!
Ich antworte an dem Tag, an dem sich zum 36. Male der Tag jährt, an dem mich mein Vater eigenhändig in die Welt holte. Ganz recht! Wir sind von gleicher Herkunft. Das müßte uns verbinden!
Im Mai ist diese Preisverleihung. Ich werde Sie anrufen. Ich freue mich auf das Wiedersehen. Es wird die Begegnung zweier Menschen sein, hinter denen eine Zeit des Streites und der Versöhnung liegt, zweier auf solche Art gereinigter Menschen – und das alles hat sich nicht mittels Fäusten und Schimpfkanonaden abgespielt, sondern in unserem Inneren und vor aller Augen, in dieser Zeitung. Wir haben eine Entwicklung durchgemacht. Wohin? Das werden wir vielleicht spüren, wenn wir uns wiedersehen. Aber ich will nicht weiter davon sprechen, sonst bekomme ich einen ›Erweckungskomplex‹, und alles wird ganz mühsam sein. Vielleicht: Straßenbahngeklingel, ein Nagel im Schuh, nervöse Magenstörungen (mit denen ich häufig zu tun habe) oder: Sie heben den Telefonhörer nicht ab.
Grüße von Ihrem J. W. H.
19. Mai 1956
Liebe und bewunderte a. p.!
Was waren Sie für ein charmanter Cicerone durch Ihre nächtliche Stadt! Ich sage ›Ihre‹ Stadt, und mir schien in diesen Stunden, sie gehöre wahrhaftig Ihnen und Sie machten sie mir zum Geschenk. Türme und Brunnen, Denkmale und Schwäne. Sie waren sehr freigebig! Der Abschied vollzog sich unerwartet schnell.
Sie sind sehr viel schneller als ich (bei Ihnen war es schon drei Uhr, und mir schien es gerade erst 23 Uhr zu sein!). Ich kam nicht einmal dazu, mich zu bedanken oder überhaupt ein gewichtigeres Wort zu sagen, nachdem wir die ganze Zeit so übermütig waren. So wohltuend übermütig, nach dem ›Festakt‹ am Vormittag. Man sieht in einem schwarzen Anzug aus wie eine Elster.
Ich wollte Sie am nächsten Morgen, bevor ich zur Bahn ging, anrufen, aber Sie hörten meinen Ruf nicht. Herzlichen Dank also!
Ihr J. W. H.
P.S.
War unser Plan von dem ›gemeinsamen Roman‹ und dem ›ebensolchen‹ Haus in den Bergen nur ein nacht- und weingeborener Gedanke?
Ich habe das gern, wenn Sie – ganz prononciert! – ›lieber J. W. H.!‹ sagen.
Ich fahre übrigens für 3 Wochen nach Berlin als Gast der Stadt. Soll ich Sie den Herren dort ans Herz legen? Sind Sie an solch einem Aufenthalt interessiert? Man kann anschließend etwas über Berlin schreiben, verpflichtet ist man nicht.
12. Juni 1956
Lieber J. W. H.! (prononciert gesagt)
Nett von Ihnen, mich diesen Herren der Stadt Berlin ans Herz legen zu wollen. Ich bin neugierig, ob und wann man reagieren wird. Außerdem bin ich neugierig, wie sich bei Ihnen Berlin niederschlägt. Unsere Niederschläge! Einmal von Hamburg bis Altona gefahren, und gleich fragt jemand, ob man etwas darüber schreiben will.
Ich weiß nicht, ob ich zu ›Berlin‹ etwas zu sagen hätte, was sollte ich sehen, was andere nicht auch sehen? Ich suche immer noch nach einem Beruf, bei dem man nicht nach zwei Stunden oder Tagen oder Jahren von sich geben muß, was man heute erlebt. Oder –? Suche ich etwa gar nicht?
Ich bin zur Zeit unproduktiv. Ich pflücke Erdbeeren und schneide den Rasen, nähe Sommerkleider für die Nichte.
Ein Schweizer Freund war kürzlich hier, die Grundstückspreise steigen, es wird nichts mit jenem ›ebensolchen Haus‹, falls nicht einer – Sie oder ich – einen ›Bestseller‹ schreibt. Ist da Aussicht? Bei mir nicht.
Herzliche Grüße von Ihrer a. p.
Liebe a. p.!
14. Nov. 1957
Wir haben ein Jahr lang nichts voneinander gehört. Eben las ich einen Artikel von Ihnen, sah Sie vor mir. Wie schön war der Abend in H.! Melusine!
Lassen Sie uns bald ein Wiedersehen vereinbaren! Ich freue mich sehr darauf. Sie sollten hier leben oder zumindest näher. Wie können Sie denn nördlich der Mainlinie leben? Die Berührung mit Ihrer leichteren Lebensart täte mir wohl. Auch dort, wo Sie melancholisch sind, scheinen Sie es auf leichtere Weise zu sein. Antworten Sie bald!
Ihr J. W. H.
12. Dez. 1957
Der Schein trügt, lieber J. W. H., aber darauf lege ich es wohl an. Ich bin gar nicht so ein Fisch, der immer munter obenauf schwimmt – leider nicht! Wäre ich wenigstens eine Libelle, zu der Bäche und blühende Sommerwiesen gehören, nichts da! Oft liege ich ausgedörrt an Land, ein Stockfisch.
Genug von den Fischen! Ich bin keine Melusine, ich sagte das schon. Ich schreibe mitten aus den Weihnachtsvorbereitungen heraus. Ich feiere nämlich gern Feste …
Ich versuche mich an einem historischen beziehungsweise religiösen Projekt. Dem Kindermord von Bethlehem. Können Sie mir weiterhelfen? Sie sind doch Historiker? Ich fahnde nach Literatur. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, nach Quellen zu suchen, ich habe mich in den letzten Jahren immer nur in unserer Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit aufgehalten, da weiß ich leidlich Bescheid. Es täte mir gut, für eine solche Arbeit – Drama? Hörspiel? – Quellenstudium betreiben zu müssen. Ich brauche, darüber haben wir schon einmal ausführlich gesprochen, festen Boden unter den Füßen. Die bloße Phantasie genügt einem nicht, und Haus und Garten sind nur ein unzureichendes Gegengewicht an Realität.
Lassen Sie sich nicht durch diesen Brief stören, nur ermutigen, daß hier einer auf etwas Neues von Ihnen wartet und sich darauf freut. Wie gut, daß die Leser nicht wissen, wie schwer es ist, über der Fertigstellung eines Buches keine Neurose (auch keine Gastritis!) zu bekommen. Wüßten sie’s, schriebe vielleicht manchmal einer: Nur weiter, ich warte auf ein Buch von Piechotta. Aber es ist ja doch das schönste Handwerk, das ich kenne. Wer hat das schon: diese Möglichkeit, neben dem oft mühsamen eigenen ein paar weitere Leben leben zu können und es in denen besser zu machen, klüger zu sein, auch törichter … ganz nach eigener souveräner Willkür.
Reden wir weiter, wenn Sie hier sind!
Im Weinhaus Doelle oder hier bei mir, wo es viel zu behaglich zum Arbeiten ist. Ich schreibe ›bei mir‹ und nicht mehr ›bei uns‹. Denken Sie sich dazu Ihr Teil.
Die Festtage werden vorübergehen. Ich sage immer, daß sie nicht für mich gemacht wurden, und tue meinen Teil an Freude und Dank in Weihnachtspakete, wickle Geschenke in Seidenpapier, verschnüre sie mit Bändern. Ich schreibe so lange ›fröhliche Weihnachten‹, bis alle Fröhlichkeit dahin ist. Was übrig bleibt, ist das dann Weihnachten? Ihr Weihnachtsfest findet im Schoß der Familie statt? Beherrschen Sie Ihre Familienvaterrolle? Im vorigen Jahr schrieben Sie: »Ein jeglicher in seine Stadt.« Mußten Sie ›Lukas 2‹ auch immer unterm Weihnachtsbaum aufsagen? Solange man sich zu Weihnachten aufmacht und dorthin geht, wohin man dem Gesetz nach gehört, ist in vieler Hinsicht noch alles in Ordnung.
Geduld, eine ruhige Hand zum Schreiben, einen wachen Kopf und ein fröhliches Herz – was brauchen Sie noch fürs Neue Jahr? Ich wünsche es Ihnen! Ihre a. p.
2. Jan. 1958
Melusine!
Ich sehe Sie nun immer so vor mir: ein toter Fisch, der ausgedörrt am Ufer liegt …
Ich habe mir ›mein Teil‹ gedacht, aber ob ich richtig denke …? Im ›Who’s who‹ steht: »verh. mit Dr. Peter Piechotta, Studienrat.« Sie sind sehr sparsam mit Ihren biographischen Angaben.
Ich weiß nicht, ob ich dort ›geschätzt‹ wurde, wo ich zu Weihnachten dem Gesetz nach war. ›Lukas 2‹ unterm Weihnachtsbaum! Wir waren fünf Geschwister, ich bin der Jüngste. Ich mußte immer aufsagen: »Es waren aber Hirten in derselbigen Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herden.« Nie hat mir jemand erklärt, wo ›dieselbige Gegend‹ war. Ich suche sie noch heute.
Ich komme zu Ihnen, in erster Linie, in zweiter zu dieser Lesung.
Stets Ihr J. W. H.
20. April 1958
Liebe a. p.! Seien Sie doch großmütig!
Es bleibt mir nichts weiter übrig, als ein wenig (oder viel?) beschämt zu sein und Sie um Entschuldigung zu bitten! Sie haben zornig gesagt: ›Welche Erfahrungen haben Sie denn mit Frauen gemacht?‹ Ihre Geschlechtsgenossinnen sind wirklich nicht ganz unschuldig daran. Man ist sich nie ganz klar darüber, was man tun soll, was nicht. Nehmen wir diesen Abend als Irrtum und: sei es wieder, wie es war! Bei mir ist so vieles (oder das meiste) ohnedies nur Theorie. Bei Ihnen wird es nicht anders sein. Was haben wir – nicht nur unsere erfundenen Gestalten! – in Gedanken schon getan! Würde es sich realisieren, um uns und in uns wäre ein einziges Chaos.
Pardon für das, was nicht passierte!
Ihr ergebener J. W. H.
3. Mai 1958
Lieber J. W. H.
Hätten wir nicht schweigend darüber weggehen sollen? Ich hatte das Angebot angenommen, in der zur Zeit leerstehenden Wohnung Ihrer Freunde für die Dauer jener Zeit zu wohnen, die ich in München zu tun haben würde. War das leichtsinnig? Wahrscheinlich, aber ich habe einfach wenig Geld. Ihre Freunde haben es Ihnen freigestellt, während ihrer Amerika-Reise über die Wohnung zu verfügen. Warum also nicht? Weil ich eine Frau bin? Das ist doch 19. Jahrhundert.
Ich war allenfalls ein höflicher Gast. Mehr war nicht möglich. Sie hatten eine andere erwartet, eine Melusine. Ich habe es seit langem ziemlich schwer mit mir, kämpfe den alten Kampf, suche die Ordnung und stoße mich, sobald ich sie habe, wund daran.
Ich habe dem neuen Roman das Motto gegeben, das ich mit Ihrer Hilfe fand, das Wort von der Wiederholung, die der Ernst des Lebens ist. Ein Satz von Kierkegaard, den Sie so oft zitieren. Dieses ewige ›encore une fois‹, das man noch von der Quarta her im Ohr hat. »Agnes, encore une fois ›La cigale et la fourmi‹.«
Noch einmal und noch einmal!
Ich versuche das im Leben und beim Schreiben als Vorzug zu sehen. Aber welche Mühe – bei beidem! Nirgends ein rechtes Fortkommen oder gar Vorwärtskommen. Man wird von Jahr zu Jahr komplizierter. Ich kann da wohl ruhig von ›man‹ und ›wir‹ sprechen. Man sehnt sich mehr und mehr nach Einfachheit und Einklang – um beides dann sehr bald zu verachten. Es war schön dort, wo ich in den letzten Wochen war. Ich stieg auf die Berge und fuhr über den See, zählte die ersten Veilchen, hörte dem Regen zu, trank viel, oder auch zu viel, sah melancholisch ins Kaminfeuer, nicht allein, aber auch nicht gefährdet. Das sind Freunde, die mich gewähren lassen. Ich fuhr nicht wieder über M. Keine Wiederholung! Ich war bei einer Freundin, die mir nahesteht und auch ein wenig ähnlich ist, in der Verletzbarkeit, aber auch in der Tapferkeit, immer wieder zu Felde zu ziehen.
Hier erwarteten mich Sorgen. Meine alte Mutter lag wochenlang im Krankenhaus und befindet sich jetzt in meiner ungeduldigen Pflege. Sorgen, Mühe, auch Kummer, richtiger und ausgedehnter Herzenskummer, in den ich manchmal wie in einen Brunnen stürze, daß ich denke, ich käme nicht wieder nach oben. Aber, s. o., ich komme! Die Steuererklärung liegt auf dem Schreibtisch, so etwas tut einem gut: vor sich selbst und vor dem Finanzamt schwarz auf weiß erklären zu müssen, was es für ein Jahr gewesen ist, was es einbrachte, ob man seine Existenz gerechtfertigt und wenigstens so viel an den Fiskus bezahlt hat, daß man die öffentlichen Dienste ruhigen Gewissens weiter in Anspruch nehmen kann.
Der Brief gerät lang, ist sarkastisch-bitter. Das ist kein guter Grundton. Ich habe in den letzten Tagen ein ganzes Kapitel geschrieben, ich glaube, daß es geraten ist. Bis daraus ein Buch wird, wird noch viel Wasser die Elbe hinunter, werden noch viele Tränen über mein Gesicht fließen.
Mein Agent war einen Abend lang hier. Es war heiter, geistreich, wie an jenem Abend, als wir zu dritt zusammensaßen.
So wie er müßte man ausgestattet sein, dann könnte einem nicht viel passieren, oder was einem passierte, reichte doch nicht bis in jene Schicht, wo es weh tut. Er ist für Leute wie mich eine Wohltat. Man plaudert, man ist sogar offen, man kommt sich ein wenig verwegen vor, aber: man lacht darüber.
Ich habe schon wieder ein Haus entdeckt, das ich haben möchte: hoch über einem See, mit einer steinernen Stiege in den ersten Stock und einer Veranda aus Kastanienholz, 200 Jahre alt. Aber, ach: Friedlands Sterne! Ich muß hier alle Fenster streichen lassen, muß einen neuen Rasenmäher erwerben. Sorgen, Angst und Not ums Brot. Am Ende muß ich mir einen Ernährer suchen. Die Kunst geht betteln. Wenn Sie einmal nichts für die Unsterblichkeit schreiben müssen, lieber Freund, dann schreiben Sie an mich. Ich habe jenen Abend in der kalten Wohnung, bei flackerndem Feuer, mit hochgeschlagenem Mantelkragen und viel Kognak in makabrer Erinnerung.
a. p.
Liebe Freundin, ich lese Ihren Brief einmal, zweimal und fühle mich nicht mehr so allein. Schreiben Sie mir immer wieder! Sollten wir nicht einen literarischen Briefwechsel führen? Nicht für die Nachwelt, sondern als Ersatz für ein Tagebuch? Man hat bisweilen Gedanken und Empfindungen, die man gern zu Papier bringen möchte, um sie formulieren zu müssen. Aber ein Tagebuch ist museal, steril, narzißtisch. Es fehlt der ›andere‹, dessen Zorn und Reizbarkeit. Das Korrektiv.
Was ist das für ein Haus? Ein ›ebensolches‹ im früheren Sinne? Man müßte viel mehr unternehmen! Ein ganz banaler und dennoch wahrer Satz: Man hat die Chance zu leben nur einmal! Und alles Leben ist Erinnerung.
Sie haben jenen Abend in ›makabrer Erinnerung‹! Darf ich einmal ganz offen eine Frage stellen? Antworten Sie ebenso offen, und wir wollen das Ganze als eine Art Spiel betrachten, als literarischen Fall. Nach französischer Logik, im Umgang der Geschlechter, hätte Nacht plus einsame Wohnung plus Frau plus Mann plus Kognak plus Bett plus Kälte zumindest zum Versuch einer Verführung führen müssen, andernfalls hätte es eine Beleidigung der Frau dargestellt.
Zumindest hätte ich Ihnen (wie zwei gute »Tiere im Winterwald«, Franz Marc) von meiner Hautwärme und Seelenwärme abgeben können (müssen?). Frage also: Hatten Sie es erwartet? Antworten Sie ruhig! Ich bin über 800 km entfernt! Ich gestehe offen, ich wäre gern zu Ihrer Bewachung und Erwärmung geblieben, aber: Sie haben mich weggeschickt, unmißverständlich. Für Augenblicke hatte ich sogar den Wunsch, es würde mir mit Ihnen noch einmal passieren, was mir vor Jahren mit einer anderen Frau passierte. Etwas Endgültiges. Manchmal stelle ich mir vor, ich würde mit Ihnen in einem ›ebensolchen‹ Haus im Wallis, auf den Lofoten, auf Orplid leben. Oder mit Ihnen unentwegt durch die Welt reisen …
Zurück in die Wirklichkeit, und die heißt: Schreibtisch, Termin, Geld, Medikamente – ein vollwertiges Glied der Gesellschaft bleiben …!
J. W. H.
6. Juni 1958
Als Sie Ihre Rechnung aufstellten, lieber J. W. H., hat darin ein Posten gefehlt! Haben Sie das nicht bemerkt?
An jenem Tag, bevor ich nach München reiste, wurde meine Ehe vor dem Landgericht geschieden, um 10 Uhr 15. Auf eigenen Wunsch! Eingegangen auf eigenen Wunsch und geschieden auf eigenen Wunsch, nach 13 Jahren. So gehen Wünsche in Erfüllung.
Narben. Man sollte einmal einen Roman schreiben, der »Narben« heißt. »Du lachst und weinst und gehst an dir zugrunde«, so steht es in einem Gedicht der Bachmann. Stimmt das? Man lacht und weint und geht doch nicht zugrunde!
Ende August packe ich wieder den Koffer und fahre (Kategorie A, Einzelzimmer mit Komfort) nach Hellas, zum ersten Mal.
Schrieb ich Ihnen, daß ich in die Redaktion einer Wochenzeitung gehen wollte? Frauenseite. Gut und regelmäßig bezahlt. Ich widerstand der Versuchung. Geld ist die geringste Versuchung, der ich ausgesetzt bin. Ich bleibe in H. und schreibe und versuche nach meiner Devise zu leben: bescheiden und frei.
Grüße von a. p.
15. Juni 1958
Liebe a. p.
Sie sind also eine geschiedene Frau! Ich versuche soviel wie möglich aus den drei Zeilen herauszulesen. Natürlich respektiere ich, daß Sie nichts Weiteres darüber sagen wollen. 13 Jahre sind eine lange Zeit, und man weiß nicht einmal, der wievielte Teil des Lebens. Der vierte? Der fünfte, der sechste?
Ich tauge nicht für eine Ehe. Ich lebe besser und lieber mit Mozart. Die Knöpfe näht eine Aufwartefrau an, die alle zwei Wochen hier saubermacht und die Schuhe putzt.
Essen und Trinken spielen bei mir keine große Rolle. Man ernährt sich und bemüht sich, der Ernährer der Familie zu sein. Oft trinke ich morgens heißes Wasser. Die Bereitung von Kaffee oder Tee ist mir lästig. Was ich betreibe, ist Dekartellisierung. Es kann nicht eine einzige Frau alle anderen ersetzen. Soll ich dieser einen Frau zum Vorwurf machen, daß ich keiner Liebe zu ihr fähig bin? Sie hält sich an die Ehe, die katholisch geschlossen wurde. Gelübde und Sakrament, unauflöslich. Kein christlicher Orden nimmt mehr ein ewiges Gelübde ab, aber dieser Bund zweier Menschen, den sie zumeist in unzurechnungsfähigem Zustand eingegangen sind, verliebt oder gezwungen, weil ein Kind kam, der ist ein Sakrament! Zwei Menschen, die nicht miteinander leben können, wo einer den anderen leiblich und seelisch krank macht. Daher rühren meine Magenbeschwerden. Zwei, die einander nicht helfen oder nutzen, sondern sich zugrunde richten, aber durch das Band der Ehe verbunden, aneinander gekettet durch ein ewiges Gelübde! Wen wundert es, wenn man die Ketten schleifen läßt –? Wo ist der Wert der Treue, wenn sie nicht Liebe bedeutet? Treue ist eine Frage des Temperaments. Ein Mann von meiner Art lebt besser mit Mozart. In allem übrigen kann er sich arrangieren.
Glückliche Reise! Ihr J. W. H.
20. Okt. 1958
Lieber J. W. H.,
ich bin zurück aus Griechenland. Ich nähre eine neue Sehnsucht im Herzen und muß nun wohl immer zurückkehren, jetzt, da ich weiß, wo es am schönsten ist.
Ich habe Gesicht und Hände im kastalischen Quell gebadet und nicht von der Lethe getrunken, damit ich nicht das Falsche behalte und das Rechte vergesse. Ich war vier Wochen lang sehr glücklich, und niemand war neben mir, der verlangte, die Ursache meines Glücks zu sein. Ich habe versucht zu leben, als ob das ein Geschenk der Götter sei und ich nichts zurückzahlen müßte in der kleinen, mühsamen Münze der Worte. Im nächsten Jahr werde ich auf einem Esel über den Helikon reiten –
Soviel von Ihrer a. p.
… mit wem wollen Sie über den Helikon reiten? Ich war einmal Chef einer Kosakenschwadron, falls das eine Empfehlung ist! Im Ernst: wollen wir nicht einmal zusammen in den Süden? Ich verstehe mich nicht auf den Süden. Ich bin ein Mann des Nordens, der Wälder, Sümpfe, Fjorde.
J. W. H.
10. Mai 1959
Lieber Freund – es kam ein kurzer, verständnisvoller Brief von Ihnen. Was Sie da über das ›Nicht-im-Anonymen-sterben-Wollen‹ schreiben – bei mir ist das wohl ähnlich. Es gibt ein Fünfminutengedicht, das anfängt: »Lacht mich nur aus, / ich hätte gern eine Tafel am Haus / …« Man schreibt gegen die Vergänglichkeit und Vergeblichkeit an.
Meine Mutter hat ihren ›eigenen Tod‹ gehabt, ich konnte sie nicht in jener Klinik lassen. Wir haben zu dritt unter einem Dach gelebt: meine Mutter, ich und der Tod. Einen ganzen Winter lang. Lektionen am Sterbebett. Der Körper der Mutter ist fremd, fast feindlich und: erbarmungswürdig. Ist er dann tot, hat man seine Herkunft verloren, ist in einem neuen Sinn ohne Heimat. Empfindet eine Frau anders? In vielem wird es männliches und weibliches Denken immer geben.
Meine Mutter hat meinen Vater fast um 20 Jahre überlebt. Zwanzig Jahre, in denen sie ohne seine bewundernde Liebe weiterleben mußte, ohne seinen Schutz. Sie benötigte Liebe, ohne imstande zu sein, sie im gleichen Maße zurückzugeben. Sie war in ihren Äußerungen gehemmt. Sie hatte sehr genaue Vorstellungen von dem, was recht und richtig ist. Treue und Pflichterfüllung. Sie zog nichts in Frage. Eine Mutter umsorgt und liebt ihre Kinder ein Leben lang, stellt eigene Wünsche zurück ein Leben lang, ordnet sich ihrem Mann unter ein Leben lang. Sie führte das Leben ihres Mannes weiter, blieb eine Arztfrau, übte weiterhin Nächstenliebe, kümmerte sich um andere, teilte ihre sparsamen Einkünfte sorgsam ein, brauchte wenig für sich. Genügsamkeit gehörte zu ihren Tugenden. Es wird auch bei ihr innere Nöte gegeben haben, aber darüber sprach sie nicht. Hätte ich mit ihr darüber reden müssen? Hätte ich dann nicht meine Zweifel in sie gesät? Sie las in ihren letzten Jahren viel in der Bibel; sie benutzte dabei die Bibel meines Vaters, sie stammt noch von seinem Vater, der Landpfarrer war. Manche seiner Randnotizen tragen ein Fragezeichen von ihrer Hand. Sie benutzte Gottes Wort, um weiter mit ihm in Verbindung zu bleiben. Was für eine Korrespondenz! Und jetzt führe ich sie weiter: lese die Randbemerkungen meines Vaters und denke über die Fragezeichen meiner Mutter nach.
In den letzten Monaten war ihr Bett von Dämonen umstellt. Sie deutete in eine Zimmerecke: dorther kamen sie. Dort hockten sie, immer in derselben Ecke, bis ich sie ebenfalls sah. Ihr Blick war entleert, oft auch entsetzt und wild. Manchmal erkannte sie mich: Da bist du. War ich nicht bei ihr, rief sie nach mir, rief laut meinen Namen, aber das tat sie auch, wenn ich ihre Hand hielt.
Ich sang alle Lieder, von denen ich wußte, daß sie sie liebte. Ich sang die Lieblingschoräle meines Großvaters, ich las ihr Gebete vor. Was sie verstand, weiß ich nicht, aber es beruhigte sie. Und ich betete: Gott, nimm sie zu dir.
Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als daß er es getan hat. Sie hat leiden müssen, der Tod erschien ihr als Gnade. Jetzt ist es soweit.‹ Die Agonie dauerte noch einmal zwei Nächte und einen Tag. ›Herr, laß sie sehen, woran sie geglaubt hat‹, sagte der Pfarrer am Grab.
Herr P. stand mir noch einmal buchstäblich zur Seite. Es ist viel Freundschaft übriggeblieben. Ich hatte schon früh erkannt, daß er nicht der richtige Partner für mich war; wie lange habe ich dann noch gebraucht, bis ich begriff, daß auch ich für ihn nicht richtig war! Es ist zwischen uns etwas erhalten geblieben, dem kein Streit und keine Trennung etwas hat anhaben können, Unzerstörbares. Ich war nie zornig oder verzweifelt, eher traurig, daß es uns nicht geraten war, eine Ehe zu führen. Wenn man einen Menschen nicht glücklich machen kann, sollte man ihn wenigstens nicht unglücklich machen. Er hätte mein Bruder sein sollen.
In diesem langen Winter habe ich einen kleinen heiteren Roman geschrieben. Um am Leben zu bleiben, um für Stunden dem Tod zu entfliehen. Niemand wird es dem Buch anmerken können, in welchem Zustand ich es geschrieben habe.
Seien Sie gegrüßt von Ihrer a. p.
25. Mai 1959
Liebe tapfere a. p. – Kein Sterbens-Wort von Ihnen seit wieviel Monaten, und jetzt dieses Zutrauen. Ich danke Ihnen! Der Tod ist unser Thema.
Ich kannte hier einen alten, achtzigjährigen Mann, der stundenlang am Grab seiner Frau saß, jeden Tag, bei jedem Wetter, er, der immer so bedacht war auf seine eigene Gesundheit. Er hat ihr ein Erster-Klasse-Begräbnis spendiert. Einen Grabstein für 8000 Mark. Er, der immer geizig war. Für diese bescheidene alte Frau! Jetzt liebe ich sie erst wahrhaftig, hat er gesagt. Jetzt lerne ich sie erst kennen. Jetzt höre ich ihr erst zu. Ich weiß erst heute, welche Rolle sie in meinem Leben gespielt hat.
Um 2 Jahre hat er sie überlebt. Er starb in der vorigen Woche. So viel Zeit war ihm für seine Liebe gelassen. Er hatte die kleine geduldige Frau auf ihren alten wehen Füßen in entfernte Stadtteile gehen lassen, weil es dort eine Leberwurst gab, die er gern aß. Erst jetzt kam ihm der Gedanke, daß sie vielleicht nicht glücklich gewesen sei. Daß der einzige Mensch, dessen Glück er hätte sein können (und müssen), dessen Existenz allein von ihm abhing, nicht glücklich war. Daß sie das Leben an seiner Seite in treuer Pflichterfüllung ertrug, weil es ihrem gütigen, geduldigen Wesen entsprach und natürlich auch ihrer Erziehung, seiner gesellschaftlichen Stellung.
Der Tod ist unser Lehrmeister, Sie haben recht.
Wir hätten uns so viel zu sagen! Ihr J. W. H.
10. Juni 1959
Lieber J. W. H.
Ich fand Ihren Brief erst bei meiner Rückkehr vor. Ich war zwei Wochen lang im Roussillon. In Begleitung. Ich war sehr glücklich, natürlich auch oft sehr unglücklich, immerhin aber doch auch glücklich. Und solange das der Fall ist, tausche ich jederzeit meine Einsamkeit gegen eine Zweisamkeit.
Ich überlege, ob ich es einmal mit kurzen, grotesken Geschichten versuchen sollte. Im Stil von Heinrich Bölls »Dr. Murkes gesammeltes Schweigen«. Aber vermutlich ist auch das nichts, wonach der deutsche Leser hungert. Wonach hungert er überhaupt? Wenn man das nicht herausfindet, muß man es am Ende selbst: hungern. Ich werde von Jahr zu Jahr kostspieliger. Bald kann ich mir mich nicht mehr leisten. Der Kaffee stärker, die Zigarette nicht mehr zu 8½, sondern zu 10 Pfennig, die Seife von Guerlain. Wenn einem Einsamkeit und Tristesse zusetzen, gibt man nach, sagt: ›Erbarmen mit den Frauen‹ und ›Mach dir ein paar frohe Stunden‹, ›Verwöhn dich selbst‹ und gießt das Glas voller. Keine Bange! Die preußischpietistische Erziehung ist unter einer ganz dünnen Schicht Bohème verborgen.
Kürzlich Astrid Claes. Sie hat ein sehr schönes Liebesgedicht geschrieben. »Der Delphin«. »… Keiner soll mich je zur Nacht geleiten / bis wir beide einst beisammen sind.« Man kann sich kaum vorstellen, daß unser Jahrhundert solche Frauen hat. Frauen von der zarten grausamen Sorte. Aus Seide und Stahl. Nie buhlte sie um die Gunst ihres Publikums. Statt dessen buhlte das Publikum um einen Blick, ein Lächeln von ihr. – Nichts!
Was tun Sie, was leben Sie, was schreiben Sie?
Dies ist ein Morgen, an dem ich besser Gelee kochen sollte. (Aber: für wen?)
Durchaus herzlich Ihre a. p.
Im Juni 1959
Ich grüße Sie aus dem Lande Oswald von Wolkensteins, liebe a. p. »Zergangen ist meins hertzen we /seit das nun fliessen will der sne / ab seiser alben …«
In den alten Burghöfen wachsen Edelkastanien und Weinstöcke; die Vegetation ist schon südlich. Die Bergwände sind gelb und grau. Wildbäche stürzen sich über die Felsen, bei anhaltender Trockenheit versiegen sie. Nach Regenfällen entstehen sie neu. Sie haben einmal gesagt, daß Sie Wasserfälle lieben: sie sind unterwegs und bleiben doch an ihrem Ort – ist es das? Hier, in den Bergen, bin ich hoch (heute mittag 3100 Meter!) –gestimmt, da fällt viel Schwere von mir ab. Meine Bergsteigerfreunde grüßen Sie!
Ihr J. W.H.
Lieber J. W. H.
»Zergangen ist meins hertzen we« schrieben Sie mir im Juni, jetzt ist schon wieder Herbst. In Frankfurt ist Buchmesse. Warum bin ich nicht dort? Ich mag Messen und Jahrmärkte. Ich führe ein Rentnerdasein am Stadtrand, sprenge den Rasen, harke das Laub zusammen, lese Zeitungen, lade Besucher ein. Kürzlich war eine Lektorin für drei Tage hier, wir haben den kleinen Roman aus dem Winter satzfertig gemacht. Eine Frau nach meinem Herzen: klug, unprätentiös, herzlich, dabei nett anzusehen. Mit ihr kann man sogar über den Konjunktiv reden.
Sie fragten nach dem Filmprojekt. Das ist wieder einmal den Weg aller meiner Filmprojekte gegangen: ins Nichts. Ich sehe keinen Vorwand, südwärts zu fahren, es sei denn, der Winter würde mir zu lang, dann reise ich vielleicht nur so zum Pläsier auf der Hinreise über München und besuche Sie. Demnach fallen Sie unter Pläsier! Der Herbstsonnenschein verwirrt mir den Kopf. Ich schreibe (Briefe), um nicht schreiben zu müssen.
Ich halte meine selbstgesetzten Termine nicht ein. Woher nehmen Sie die Disziplin? Bei mir liegen Bequemlichkeit und Ehrgeiz im Streit; aber die Bequemlichkeit ist so sehr überlegen, daß es ein ganz sanfter Streit ist, mehr ein Streicheln.
Sie beenden schon wieder ein Buch! Seien Sie doch nicht so tüchtig! Schreiben Sie mir lieber hin und wieder einen Brief. Wenn der Winter kommt, muß man sich seiner Freundschaften versichern.
Ihre a. p.
15. Okt. 1959
Liebe a. p.
Wenn ich einen Brief von Ihnen erhalte, bekomme ich Lust, Sie zu sehen.
Könnte man sich bei Ihnen einmal einladen?
Wir würden einen Dienstplan machen. 9–13 Uhr ›dichten‹, 13–15 Uhr gemeinsames Mittagessen (falls bei Ihnen: gegen Bezahlung), 15–16 Uhr Zeitung lesen, 16–19 Uhr ›weiterdichten‹, anschließend Abendessen und Ausgang mit Unterhaltung über das am Tag Geschriebene. Ist das alles auch nur ein nachtgeborener Gedanke –? Es ist längst Mitternacht vorüber.
P.S. Ohne eine Antwort abzuwarten: Soll ich kommen? Mitte November? Hier ist das neue Buch. Sagen Sie selbst …
J. W. H.
18. Okt. 1959
Lieber J. W. H.
Anbei ein Vorschußlorbeerblatt. Ich brachte mir im vorigen Jahr einen Vorrat aus Delphi mit. Noch las ich Ihr neues Buch nicht, zunächst freue ich mich nur am Papier, am frischen Leimgeruch, am Umschlag. Ich fasse so gern die Dinge an. Ein Buch ist auch ein haptisches Erlebnis. Was das angeht, kenne ich Ihr Buch bereits genau! Wollen Sie mir daraus vorlesen? Sie haben einen Zeitplan aufgestellt, an den ich mich halten könnte. Aber auch ich würde meine Bedingungen stellen, die Sie kennen …
Sie haben Bergtouren in den Dolomiten gemacht! Wie klug von Ihnen, dies mit zwei Männern zu tun. Ich nahm nur einen mit auf die Tour. Ins Roussillon. Das war gewiß nicht klug, wenn auch bisweilen sehr schön. Ich weiß nicht, wie andere es machen, daß sie sagen können, sie seien 14 Tage lang glücklich gewesen. Ich kehrte wie immer mit Blasen an Füßen und Herz zurück. Das alles ist in einem langen Sommer geheilt, aufgebrochen, wieder geheilt. Und wenn ich meinen eigenen Worten Glauben schenken soll, muß ich völlig vernarbt sein. An den Füßen sieht man nichts mehr. Durchaus freundschaftlich a. p.
Liebe a. p.
21. Okt. 1959
War das nun eine Einladung?
Sicher ist es unhöflich, hieran gleich das Anerbieten anzuschließen, daß Sie selbstverständlich jederzeit jene Wohnung, die Sie kennen, beziehen dürfen. Meine Freunde befinden sich auf ihrer zweiten Amerikareise. Ich bin (leider!) ein Mensch, der nie und nirgendwo etwas umsonst annimmt, aus dem Gefühl heraus, die Leute, die für mich Zeit und Mühe opfern, müßten dafür entschädigt werden. Es gibt Menschen, die durch ihr bloßes Dasein schon entschädigen, sei es durch Temperament, Vitalität, Geselligkeit, Erscheinung; aber zu denen zähle ich nicht. Ich will mit solcher Bescheidenheit nicht kokettieren, aber man kennt sich allmählich. Im Grunde bin ich introvertiert, kontemplativ, höre lieber zu, als daß ich spreche, ein Mensch, der nicht so leicht mit anderen Kontakt findet, etwas scheu und gehemmt, was ich mit scheinbarer Gesprächigkeit überspiele. Aber es gibt ein paar Menschen auf der Welt, mit denen ich beim ersten Zusammentreffen gleich warm geworden bin, und zu diesen zählen Sie. Deshalb möchte ich gern kommen. Hätte ein anderer mich eingeladen, hätte ich abgesagt oder mich in ein entlegenes Hotel und in mich selbst zurückgezogen (was ich am liebsten tue, es sei denn, ich kann einen jener wenigen Menschen treffen …).
Ich werde Ihnen einen Garantieschein für Ihren Seelenfrieden, für jede Form des Friedens ausstellen. Ich würde als Freund, als Kollege kommen.
Ihr J. W. H.
26. Okt.
Einen glücklichen Nehmer hat Gott auch lieb! Wissen Sie das nicht? Wovon sollen die fröhlichen Geber leben, wenn keiner fröhlich (an-)nehmen will? In allem übrigen: Dank für die Einführung in Johannes W. Hück. Brauchen Sie auch eine Einführung in a. p.? Aber ich bin wohl übersichtlicher als Sie. Ich bin im November hier. Ein Anruf genügt.
a. p.
14. Nov.
Liebe a. p.
Ich kann nicht reisen. Ich kann nicht zu Ihnen kommen. Mit dem besten Willen nicht. Sie kennen meine äußeren und inneren Schwierigkeiten. Schade. Sehr schade! Sonst ist da nichts zu sagen.
J. W. H.
8. Dez. 1959
Was ist denn, lieber Kollege Hück! Warum – wenn Sie nicht kommen können – machen Sie nicht wenigstens einen schriftlichen Besuch bei mir? Der Zeitpunkt ist nicht fern, da verlasse ich diesen Kontinent für lange Zeit. Ich will versuchen, die fehlende Weltanschauung auf dem Wege der eigenen Anschauung zu bekommen. Insgeheim hoffe ich, daß noch einer rechtzeitig sagt: Bleib doch! Bleib! Weil ich ja ein Hasenherz habe – wissen Sie das? Weil ich ja gar nicht so selbständig, so alleinstehend bin und sein möchte, wie ich’s vorgebe.
Ich schreibe eine Weihnachtsgeschichte. Von Jahr zu Jahr wird das schwerer. Ich war auf einer kurzen Autoren-Reise. Alle waren freundlich zu mir, ich las aus dem Erzählungsband, auch ein paar Gedichte, obwohl ich nicht glaube, daß ich Gedichte machen kann. Die Poesie hat sich aus der Kunst verzogen, manchmal findet man sie wieder: in poetischen Augenblicken des Lebens.
P.S. Ich sah den neuen Beckett. »Endspiel«. Meine Meinung dazu? ›Ich glaube nicht / daß die Mülltonne wichtiger ist / als dieser Quittenbaum / Ich glaube nicht an Grau / ich glaube / daß es Weiß gibt und Schwarz / und vor allem glaube ich an / Blau / Ich versuche zu glauben / daß es Blau gibt / Blau / im Wasserspiegel dieser Pfütze / neben der Mülltonne.‹
Unsere Literatur ist grau, ohne Heiterkeit, ohne Charme. Nach Auschwitz darf das alles nicht mehr sein, sagt man. Ich versuche das zu verstehen, aber könnten Heiterkeit und Daseinsfreude ein Auschwitz nicht eher verhindern? Ich meine nicht Oberflächlichkeit, ich meine eine vertiefte Heiterkeit.
Ohne Glanz mag ich nicht leben.
Ihre a. p.
11. Dez. 1959
Liebe a(nmutige) p.
Ich schreibe Ihnen so wenig! Dabei sind Sie der einzige Mensch, zu dem ich manchmal fliehen möchte, nur um mich Ihnen anzuvertrauen oder bei Ihnen Rat zu suchen. Dank für den Brief! Ich habe Sorgen, Aufregungen. Diese Ehe, die keine ist, wohl nie eine werden kann. Auch durch meine Schuld. Aber sprechen wir von anderem! Sie wollen fort? Ohne mich? Ohne Geld?
Wohin? Amerika? Der alte Plan? Sie Glückliche! Sie Vagabund! Wann globetrotten Sie wieder hier durch?
Ich lag kurze Zeit im Krankenhaus. Ich hatte plötzlich Zeit. So viele Bücher wären zu lesen, Lolita, Blechtrommel, Durrells Justine. Wie soll man denn Bücher lesen, wenn man selber Bücher schreibt? Meine »Unbescholtenen« machen sich sehr breit: 400 Seiten und noch nicht fertig.
Gute einzige Freundin! Wohnen Sie doch nicht so weit von mir!
P.S. Wollen wir nicht wirklich einmal zusammen … wohin …? Ich bin zur Zeit karg mit Worten – Sie haben recht –, aber nicht nur Ihnen gegenüber. Sie stehen in der Rangliste meiner Briefpartner an zweiter Stelle. An erster stehen meine Eltern.
Ich muß arbeiten! Ich muß meiner Pflicht als Ernährer leidlich nachkommen, wenn ich die Rolle des Ehemannes und Vaters schon so schlecht kann. Übersetzungen, Bearbeitungen, Reise-Features. Fleißarbeit. Die Reisen, über die man schreibt, kann man wenigstens von der Steuer absetzen. Das ist ein mühsames Brot.
Ich gedenke im nächsten Sommer nach Island zu reisen, davon verspreche ich mir viel; weitgehend zu Fuß wie immer. Anschließend werde ich wohl eine Kneippkur machen, aus gesundheitlichen, aber auch aus literarischen Gründen. Ich wüßte gern, wie man sich, bis an die Knie im kalten Wasser stehend, fühlt.
Da Sie von gemeinsamen Plänen offensichtlich nichts wissen wollen, klammere ich Sie aus allem aus. Sie haben die Grenzen unserer Freundschaft eng gezogen, Sie werden Gründe haben.
In einem Ihrer letzten Briefe – wo ist er? Ich lebe unter Papierschichten, ganzen Erdzeitaltern, Ablagerungen, vielleicht habe ich ihn auch vernichtet mit Rücksicht auf meine Frau – nun, Sie fragten: Warum schreiben wir so künstlich, warum schreiben wir nicht mehr alles der Reihe nach und bringen Ordnung in den Wirrwarr? Hier meine Antwort. Weil ich mich dagegen sträube, wie Stifter oder Thomas Mann (weiter-) zu schreiben. Die sind ja alle schon so gut! Und die Aufhebung der Sukzessivität? Weil wir wissen, daß Vergangenes (in der Erinnerung) und Zukünftiges (in der Angst oder Hoffnung) genauso real und gegenwärtig sind wie die Gegenwart, also gleichzeitig ›da‹ sind. Ich verteidige die Neuen, auch den nouveau roman, Robbe-Grillet, Butor. Alles ist gleich wichtig und vorhanden. James Joyce hätte bestimmt auch einen herkömmlichen Roman schreiben können, aber er hat statt dessen dieses Ungeheuer von einem inneren Monolog geschrieben. Picasso hat bewiesen, daß er auch ›normal‹ malen kann, aber er hat das bloße Sehen in Bewußtseinsvorgänge aufgelöst. Vielleicht haben Sie trotzdem recht: Wir machen aus der Not eine Tugend, und man hat sich nur deshalb in die Form geflüchtet, weil man nicht mehr erzählen kann, der Reihe nach, in Zusammenhängen. Welcher Sog: »Es geschah in einer stürmischen Herbstnacht des Jahres 1776, daß auf dem Leuchtturm von Kap Finisterre der Wärter …«
Ich mag Sie (sehr), oder ist das bereits wieder zu weit gegangen? Wenigstens zu Weihnachten muß ich das schreiben dürfen! Ich werde Ihnen außer dem kleinen Band mit frühen Erzählungen, den ich beilege, meine Aufmerksamkeit, meine Gunst, meine zuverlässige Freundschaft für ein weiteres Jahr schenken. Stets und gern Ihr J. W. H. P.S. Sie haben mich einmal nach dem Funk-Feuilleton über Lappland gefragt. Es wurde im vergangenen Jahr bereits gesendet, wird aber am 17. Dezember wiederholt, die Uhrzeit gebe ich Ihnen telefonisch durch.
II
»In der Halle der Riesen« (Lappland-Feature des J. W. H.)
… Wenn ich jetzt mein Tagebuch aus Lappland aufschlage, so ist es, als erstehe, von zaubermächtigem Anruf angerührt, jenes Land vor mir als eine große Symphonie. Da ist es, als werde plötzlich alles wieder Klang, der reißende Wildbach, der Fall der Steine in der stillen Bergwand und das elfische Licht von Sonne und Mond am Mitternachtshimmel …
Seit zwei Tagen sitze ich in der Bahn, auf der Fahrt über die ganze Länge der skandinavischen Halbinsel. Immer wenn ich aufschaue, sehe ich vor dem Fenster Wald oder eine spiegelnde Wasserfläche. Die Welt besteht nur noch aus Wäldern und Seen, hier und da ein kleines Holzhaus am Ufer. Aber sie sind hier grau gestrichen, nicht mehr rot wie weiter südlich. Auch die Kühe werden immer grauer. Sie tragen keine Hörner mehr. Die Nadelwälder gehen über in lichte Birkenwälder, die schon die nahe Tundra ahnen lassen. Zwischen dem hohen Gras blitzt es silbern auf: die Sümpfe Lapplands beginnen, das große unfruchtbare Gebiet nördlich der Ackerbaugrenze. In unserer Fahrtrichtung ziehen sich drüben im Westen lange Bergketten dahin; sogar schneebedeckte Gipfel sind zu erkennen. Aber immer noch durchqueren wir flaches weites Land mit breiten Strömen, mit Wald und Steppe …
… Ich stehe am Ufer. Enten schnarren, Wellen schlagen leise an die Steine. Alles ist aus Wasser, Fels und Himmel gemacht. Ich bin plötzlich erdenalt, Jahrtausende durchrinnen mich, bin Berg und Wasser. Alles ist unwirklich, die Luft wie von Träumen und Ahnungen durchwoben, eine Luft wie von Alben, von seltsam zwielichtigen Wesen … Abenteuer der Mitternachtssonne!
Es ist die gleiche Sonne wie am Tage, aber doch ist die Nacht nicht wie ein Tag, es ist die Helle einer erleuchteten Dunkelheit, einer Nacht, die im Verzug und in einer gewissen Art unentschlossen ist, und Abendrot und Morgenrot sind eines.
Sonne – ich habe lange deine Wandlungen am stemenlosen Himmel verfolgt – wie du von orangefarbenem Dunst und Nebel aufgesogen wurdest und als blasse, milchige Scheibe in den Wolken verschwandest. Wer hat die Sonne je gesehen, es sei denn hier oben! Sie nimmt hier nicht teil an den kleinen Versammlungen und Verlockungen von Markisen, Torbögen und Plätzen, sie spielt nicht mit Fensterscheiben, Springbrunnen und Turmspitzen – sie spielt mit dem Erdball selber. Und sie macht den Sumpf zum Sumpf, den Berg zum Berg und das Wasser zu Wasser …
Heute beginnen wir unsere Wanderung durch die schwedischen Lappmarken.
Durch die ›Lapporten‹, durch jenes mächtige Tor, das von zwei Bergen gebildet wird, traten wir in die Hochgebirgsregion ein. Es war die Schwelle in eine andere Welt, in eine andere Zeit. Wir ließen hinter uns Eisenbahn, Straßen und Brücken und sahen vor uns eine Wildnis, in der es nicht Weg und Steg gab. Wir haben die Karte gefragt … Haltet euch an den ›Kungsleden‹, den Königsweg, hat man uns gesagt. Dann findet ihr bisweilen eine kleine Hängebrücke über die reißenden Bäche oder ein Boot am Flußufer. Ihr werdet im Abstand von Tagesmärschen eine Hütte oder eine Kote in der Art der Lappenzelte finden. Das Abweichen vom Weg kann Stunden oder Tage kosten, und man kann sich in den Sümpfen und Gletschern verirren …
Unsere einsamen Schritte klingen durch die Stille. Nur von den Felswänden des weiten Tales tönt das Geläute und Geschelle der Wasserfälle. Selbstlos stellen sie sich zur Schau in unermeßlichem Aufwand. Und sie tun es schon seit Jahrtausenden, ohne daß sie jemand betrachtet oder bewundert. Zweckloses Verschwenden, einzig als ›Laudate‹, Lobpreisung der Allmacht, Hymne, Darstellung und Opferung, Ausgießen von Wasser, Besprengen von Felsaltären. Aber man gewöhnt sich an diese ungeheuren Selbstdarstellungen, blickt schon nicht mehr hin, sondern hält Ausschau nach den aufeinandergeschichteten Steinen, die den Pfad markieren. Oft sind sie plötzlich nicht mehr zu sehen. Ist man von der Richtung abgekommen, oder gab es keine Steine mehr, die man hätte aufeinanderschichten können? Die Spuren verlieren sich in einem der zahllosen Sümpfe, die sich quer übers Tal legen und sich bis unter die Felswände hochziehen. Oder man steht plötzlich vor einem reißenden Gebirgsbach.
Aber wir fanden einen Übergang, und wir fanden auch die Markierung wieder, jene aufeinandergeschichteten Steine. Wie begrüßt man diese kleinen Pyramiden, wenn sie wieder wie Trolle oder Kobolde am Weg auftauchen, wie winkende Männlein! Kleine Steingötzen. Sie verheißen wieder Richtung, Ziel und abendliche Ankunft.
Bald werden wir in der Hütte sein und endlich schlafen können. Wir werden nicht schlafen können. Die milchweiße Nacht läßt uns nicht zur Ruhe kommen. Wir sitzen vor der Hütte und schauen in den Himmel. Er ist hier niedriger als im Süden, und er ist fast nie ohne Wolken. Die Berge ragen in einsamer Größe auf, und die Sonne ist für kurze Zeit hinter ihnen untergetaucht. Aber sie schickt rosarote Wolken vor sich her über die Gletscher, und sie wird gleich wieder als rote Scheibe auftauchen aus den dunklen Bergseen. Ein Tag, der sich selbst überdauert. Vom Ufer dringt das leise Pfeifen eines Wasservogels zu uns herüber.
Niemand kommt jetzt zum Schlafen, nicht der Berg, nicht Tier, nicht Mensch.
Und man möchte plötzlich, daß irgendwo ein Hahn kräht oder Glocken zum Abend läuten, und es wird einem etwas bewußt von der Wohltat der Wandlung von Gottes Wort, daß er machte aus Abend und Morgen den ersten Tag …
… Und laß es einen Herbsttag geben Nach langem Sommer, den ich kaum ertrage,
Und eine dunkle Nacht nach hellem Tage,
Laß ihn vergehn und gib mir neben Dem Ewigen der Monde Schauer,
Der Sterne Aufgang und ein Abendrot,
Doch gib mir nicht der Dinge Dauer,
Gib nach dem Leben mir den Tod.
Untragbar wär ein immer gleiches Kleid,
Gib ihm Verwandlung, gib ihm Endlichkeit.
… Ein enges nebliges Tal. Man sieht nicht weiter als bis zu seinen Rändern. Nach oben hin ist es abgeschlossen von der niederen Decke der Wolken und dahintreibenden Nebelschwaden. Sie lassen zu beiden Seiten die Berge verschwinden und gießen die Seitentäler und Schluchten mit flüssigem Gips aus. Kein Himmel mehr, keine Weite, keine Höhe. Nur Nähe. Nur noch Erde. Erde in allen Tonungen von Grau, in schmalen Streifen übereinandergeschichtet das metallfarbene stille Gewässer mit den graugrünen Eisstücken, der Schnee am Ufer, durchtränkt von Wasser, das kahle Gestein, die kalkigen Schneefelder mit dunklen, ausgeschmolzenen Ovalen, Nebel wie treibender Qualm …
Mehr nicht, nur Stücke … Fetzen … Trümmer, grau und wieder grau und kalt und naß. Die Leere, das Nichts, das Nirgendwo. Verneinung, Kehrbild, Gegenteil. Unendliche Fülle von Leere!
Aber alles enthält sie schon: den blauen Golf, die Pinienwälder, den Azurhimmel, den Kuckucksruf. Alle Farben gemischt zu dem Grau, daraus sie sich alle wieder lösen werden, Grundierung für Orchidee, Koralle und Granat …
Ich besaß noch nie so sehr alles wie jetzt, wo ich nichts habe. Auch die Stille ist übereinandergeschichtet, die Stille des Wassers, die Stille des Steins und die Stille über dem Schnee. Jede Stille ist anders. Wer kennt, wenn nicht von hier, ihre leisen Unterschiede, die Stufungen der Stille. Und so schreibe ich in mein Tagebuch: Großer Schweiger Lappland!
Ich hatte Wasser vom Bach geholt. Wir sind in der Hütte und kochen Kaffee. Kaffee und Zucker, auch Töpfe und Gerät, sind überall in diesen Hütten zu finden und stehen jedermann zur Verfügung. Welch ein Land, wo die Hütten am Weg immer offenstehen und wo man selber für einige Stunden sein eigener Wirt und Gast ist – und wo man später einmal drunten in Stockholm für all das ein paar Kronen zahlen wird, alles ungebucht und ohne Vermerk.
Wir haben Feuer gemacht, und jetzt trocknen unsere Kleider am Ofen. Wieder zu wissen, was das ist: Wasser holen, Feuer anzünden, Flamme, Wärme, ein festes Dach. Und draußen regnet es. Aus alter Zeit, aus der Saga, klingt eine Weisung auf …
»Feuer braucht, wer von fernher kam / an den Knien kalt / Gewand und Speise der Wanderer braucht / der übers Hochland hinzog …«
… Stumme mächtige Anbeter Berge! Offenbarung und Wahrheit, steingewordenes Wort Gottes auf Erden! »Es werde eine Feste zwischen den Wassern!«
Aus Meer und Berg ward die Erde. Wasser und Fels kämpfen miteinander im Sturm der Brandung und unterm Schrei der Vögel. Daraus wird täglich die Erde.
Und der Sturm, in den Bergen droben gebrochen, bricht hervor und jagt uns durch das Hochtal. Ächzend und stöhnend wirbt er um unsere Angst. Seine schwarzen Mantelfalten flattern um die Bergspitzen, und er bläst den Bart auf, daß uns die nassen Haare ums Gesicht schlagen. Aber schon erreichen wir die Höhe des Gebirgspasses, wo er nach Süden hin abfällt. Und dort, im Windschatten der ersten Neigung, zittert zwischen Schnee und Gestein ein Moosglöckchen – seit langem wieder die erste Blüte – und klammert sich mit seinem zarten Stengel an den Boden. Der Sturm donnert drüber hinweg, als wolle er die Felsen aus ihren Wirbeln brechen. Die Blume verheißt südlichere Segnung und Abstieg ins Tal.
Wir lassen das Getümmel und die Empörung hinter uns. Soll der Sturm sich dort oben in den engen Wänden seiner steinernen Kammer austoben. Unter uns weitet sich groß und einsam ein Urstromtal, weithin bedeckt mit grünen Inseln. Der Fluß, der das Reich der Riesen, des Felsenvolks, vom Götterland trennt.
Es wurde uns heiß unter dem schweren Rucksack, der Weg geht steil bergan. Der Wind, der sich an den Gletschern abgekühlt hat, streift uns angenehm. Er weht ins Tal hinunter, er zerriß auch bald den Nebel, und vor unseren Augen tauchten in der Feme die Bergmassive Norwegens auf. Hoch über uns ließ der Wind feine dünne Wasserfalle – ›Brautschleier‹ nennt man sie hier – in der Bergwand hin und her wehen. Oder spielte der Wind mit dem Gesträhle, dem Silberhaar der alten Gletscher am Selka?
… Und wieder ein Berg und wieder ein Tal. Noch kein Mensch hat sie betreten, nur ihre Stille rinnt bisweilen durch die Seitentäler herab bis zu euch. Dort haust der Bergriese. Aber ihr könntet ihn nicht sehen. Er ist zu groß. Seht euch um! Das ist die Halle der Riesen, auf den vier Horizonten errichtet, gestützt auf die Pfeiler der Berge, die Wände besetzt mit Sternen und behangen mit Gewebe aus Nebel und grünem Licht. Und die Berge sind ihre Tische und Sitze.
Vor dem Großen ist alles andere so klein, daß ihr es ebenfalls nicht sehen könnt – die Uldas und die kunstreichen Zwerge in den Bergen. Sie hämmern bei Tag und Nacht in ihrem finsteren Geklüft, Jetzt sind sie hinter ihre steinernen Türen verbannt, solange die Sonne scheint – die Sonne, die alles versteinert, Berge und Täler und alle Wesen unter und über der Erde – bis sie im Winter, während der langen Nacht, alle wieder erwachen …
Durch ein enges Steintal steigen wir auf, über vereiste Felsen und über Gletscher, die hier tief in die Täler herabreichen. An ihrem Rande blüht die weiße Eisranunkel. Sie blühte schon, als Berge und Felsen sich erst bildeten, und sie grüßt nun aus jener Zeit herüber …
Vor unseren Blicken baut sich Berg an Berg und Gipfel an Gipfel, als stünden wir auf den höchsten Stufen eines mächtigen Theaters und blickten hinunter auf das Jahrmillionenspiel der Erde, in welchem das Schicksal unseres Gestirns abläuft. Der tiefe Abgrund der Zeit legt sich zwischen uns und die steilen Felswände, die ferne hinabtauchen in Täler und Moore, in Schluchten und grünes Fjordwasser. Es schwindelt einem, schaut man so von der Höhe hinab in die Tiefe vergangener Welten; das Leuchten des ewigen Schnees und der Glanz des blauen Eises blenden den Blick …
Wir warten auf den Zug, der uns wieder zurückbringen soll. Die Bahnstation liegt still da. Drinnen im Dienstraum tickt eine Uhr. Das Summen der Stechmücken mischt sich mit dem Brummen der elektrischen Leitung über dem Gleise. Oder ist es der Telefonmast oder einer der Erzzüge, die sich schon von weitem durch ein leises dumpfes Rollen in den Schienen ankündigen, um dann plötzlich da zu sein, groß, riesig, donnernd unter der schweren Last. Ist es vorüber, wird es um so stiller. Nur die Uhr im Dienstraum tickt leise und erinnert daran, daß man in der Zeit ist … und daß die Erzzüge unaufhörlich weiterrollen werden hinüber nach Narvik. Denn die Zeit ist ins Land gekommen. Der Pfiff der Lokomotive weckt den Schlaf der Berge und das Rattern des Zuges den Schlummer der Sümpfe und Moore. Und alles flieht vor den peitschenden Detonationen, dem Dröhnen der Preßlufthämmer, Trolle und Bären und Zwerge – selbst die Riesen …
Dennoch will man glauben, daß die Blume neben dem Bahnkörper diese neuen gewaltigen Kräfte überdauern wird wie die Eisranunkel droben am Kebnekajse. Alle diese Kräfte erscheinen wie vergebliche Anstrengungen angesichts der Mitternachtssonne und des Nordlichts am dunklen Himmel.
Schon zeigen sich seine weiten Bögen! Es gibt wieder Abende, der Sommer geht zu Ende. Er ist kurz hier oben. Das Laub der Polarbirke färbt sich, die gelben Beeren der Multe leuchten unter dem Gesträuch. Zwischen den Büsehen schimmern die bunten Röcke der Lappenmädchen. Sie sammeln die gelben und blauen Beeren und bringen sie in kleinen Holzfässern zur Stadt.
Jetzt zieht das Bergvolk mit den Rentierherden wieder zu Tal. Der große Abtrieb beginnt.
Die große Lapplandsymphonie –
Könnte der, der sie hört, darin etwas vernehmen vom Klang der Wasser, vom singenden Ton der Sümpfe, Moore und Seen, etwas von der Stille des Schnees der arktischen Berge in ihrer majestätischen Ruhe … Er würde schon das große Schweigen des Pols ahnen, jenseits des Eismeeres, dessen hinterer Rand im kalten Nebel verschwimmt …
III
Leben oder schreiben. Es ist zweierlei (Briefe II)
20. Dez. 1959
Lob und Dank, lieber Kollege!
Für den Brief und den Anruf, für die Geschichten und für den Hinweis auf Ihre Lappland-Sendung. Was für eine fremde Welt! Eine einzige Apotheose auf den Norden! Kälte und Einsamkeit schlug mir entgegen. Ihr Norden hat nicht meine Maße. Eine Welt für Riesen. Ich erkannte Sie sehr deutlich hinter den Worten. Wer ist die andere Hälfte des ›wir‹? Jene Schwedin, von der Sie mir einmal erzählten? Ist von dieser Freundschaft nicht mehr geblieben als: Lappland?
Herzliche Weihnachtsgrüße! Gute Wünsche auch für das Neue Jahr. Zuversicht vor allem, ohne die man nicht existieren kann. Ich werde irgendwohin fahren, allein. Diese Weihnachtsfeste! Wo ein jeglicher dorthin fährt, wohin ihn das Gesetz befiehlt; die Pflicht und nicht die Liebe. Sie kennen das, ich muß das lernen, ich lebe außerhalb der Legalität. Dank für die zuverlässige Freundschaft und für die Gunst!
Ihre a. p.
Silvester 1959
Liebe a. p.!
Wollen Sie in dem Jahr, das in wenigen Stunden beginnt, wieder nur durchreisen? Oder ein paar Tage bleiben? Ich verspreche, Ihren Seelenfrieden stets zu respektieren!
Lappland: Ja, der andere Teil ›wir‹ war eine schwedische Studentin, die ich an der Universität kennengelernt hatte. Ob von der Freundschaft nicht mehr zurückgeblieben ist als 10 Seiten Text? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie es besser gewußt. Sie hat einmal gesagt, ich liebte ihr Land mehr als sie; sie sei für mich nur das Medium für den Norden. Vielleicht war hieran etwas Richtiges. Aber da war noch manches andere, vielleicht auch das, daß sie eine feste Bindung anstrebte und ich nicht. Sie ist inzwischen mit einem hohen Beamten in Göteborg verheiratet und hat drei Kinder. Kinder sind doch wohl ein Beweis für Glück. Das tröstet mich. Aber ein Verrat an ihr war es dennoch. Davon befreit mich nichts.
Ich verabschiede mich von Ihnen und dem Jahr 1959. Ein Jahrzehnt ist zu Ende.
Ihr J. W. H.
In Eile: Über ›Kneippkur‹ ließe ich mit mir reden! Da muß – bis an die Knie in kaltem Wasser! – keiner für seinen Seelenfrieden fürchten, und die von Ihnen so geschätzte Hautwärme entsteht, wenn ich Pfarrer Kneipp richtig verstanden habe, mit Hilfe von Blitzgüssen, Tautreten etc.
a. p.
15. Jan. 1960
Liebe Freundin,
… der Sommer ist vergeben, bevor noch der Winter vergangen ist. Die Monate verplant. Wir Schriftsteller haben einen unsteten Beruf. Immer ist man unterwegs auf der Suche nach Schauplätzen und Lebensumständen, die einem nicht vertraut sind. Jedes neue Schreibprojekt ist ein Anlaß zum Reisen. Wie viele Unbequemlichkeiten nimmt man auf sich! Es bliebe allenfalls der Mai für Kneipp, mit allen von Ihnen vorgesehenen Einschränkungen, Seele und Haut betreffend.