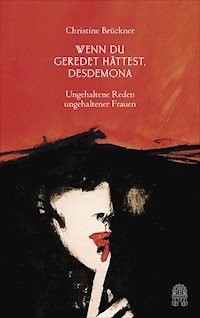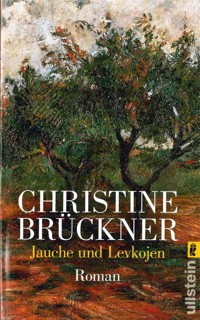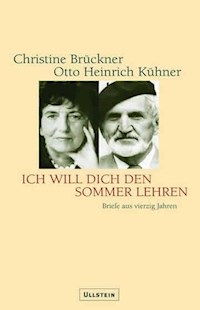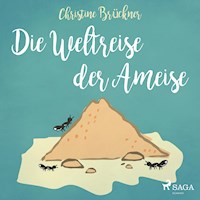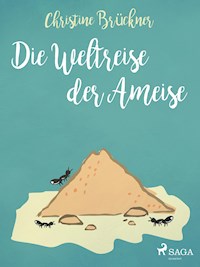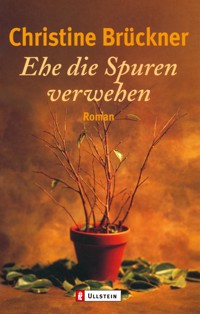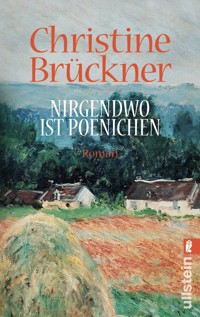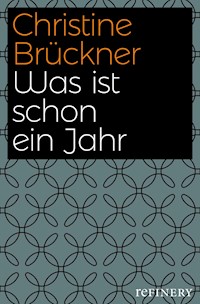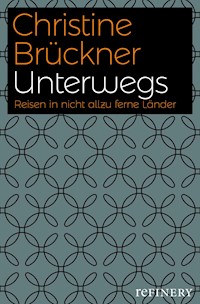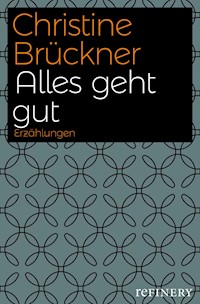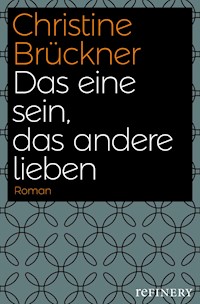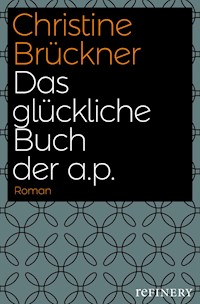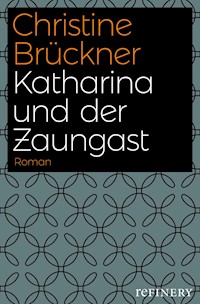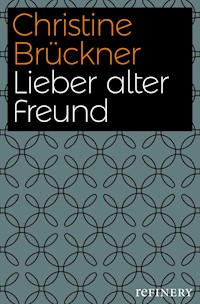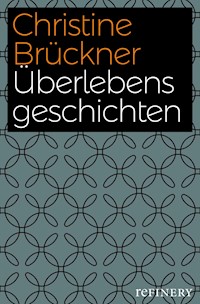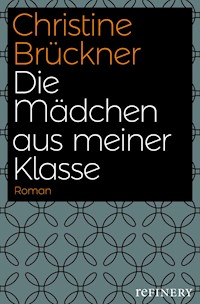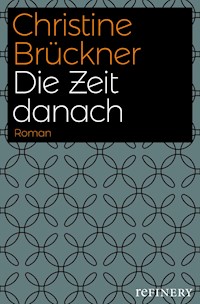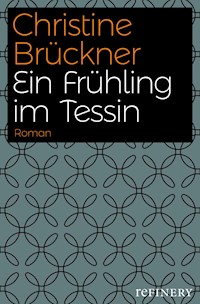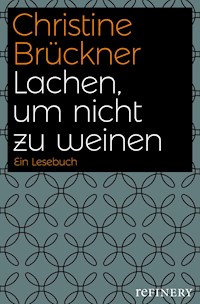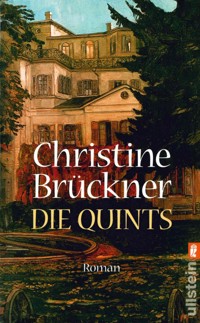
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
'Aus den pommerschen Quints ist nach der Flucht doch nichts Rechtes mehr geworden.' Dieser Satz, bei der Einweihung des Burg-Hotels Eyckel im Fränkischen Anfang der siebziger Jahre geäußert, könnte als Leitgedanke vor diesem dritten und letzten Teil der 'Poeninchen'-Romane stehen. Mehr über Christine Brückner erfahren Sie über die Stiftung Brückner-Kühner unter http://www.brueckner-kuehner.de/.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
»Aus den pommerschen Quints ist nach der Flucht doch nichts Rechtes mehr geworden.« Dieser Satz, bei der Einweihung des Burg-Hotels Eyckel im Fränkischen Anfang der siebziger Jahre geäußert, könnte als Leitgedanke vor diesem dritten und letzten Teil der Poenichen-Romane stehen. Wie in Jauche und Levkojen (UB 20077) und Nirgendwo ist Poenichen (UB 20181) steht Maximiliane Quint, geborene von Quindt, im Mittelpunkt: als Erbin von Poenichen in Hinterpommern aufgewachsen, eine Kriegswaise des Ersten, eine Kriegerwitwe des Zweiten Weltkriegs. 1945 ist sie mit ihren Kindern auf die Flucht gegangen, ist nicht wieder seßhaft geworden. Die Kinder haben die Unruhe der Mutter geerbt, sie erweisen sich als Aussteiger, als Umsteiger, auch als Aufsteiger. Doch so unterschiedlich sie sind, eines haben sie gemeinsam: Sie suchen nach neuen Lebensformen. Poenichen ist nur noch eine Metapher für Heimat. Jenes Land jenseits von Oder und Neiße.
Die Autorin
Christine Brückner, am 10. 12. 1921 in einem waldeckischen Pfarrhaus geboren, am 21. 12. 1996 in Kassel gestorben. Nach Abitur, Kriegseinsatz, Studium, häufigem Berufs- und Ortswechsel wurde sie in Kassel seßhaft. 1954 erhielt sie für ihren ersten Roman einen ersten Preis und war seitdem eine hauptberufliche Schriftstellerin, schrieb Romane, Erzählungen, Kommentare, Essays, Schauspiele, auch Jugend- und Bilderbücher. Von 1980–1984 war sie Vizepräsidentin des deutschen PEN; 1982 wurde sie mit der Goethe-Plakette des Landes Hessen ausgezeichnet, 1990 mit dem Hessischen Verdienstorden, 1991 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Christine Brückner war Ehrenbürgerin der Stadt Kassel und stiftete 1984, zusammen mit ihrem Ehemann Otto Heinrich Kühner, den »Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor«.
Christine Brückners Gesamtwerk ist im Ullstein Verlag erschienen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch 16. Auflage 2010 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2006 © 2003 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG © 2000 by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München Umschlaggestaltung: Büro Hamburg (nach einer Vorlage von Morian & Bayer Eynck, Coesfeld) Titelabbildung: Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin E-Book-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm Printed in Germany ISBN 978-3-8437-1010-7
Heide M. Sauer gewidmet, die 1945, nach der Flucht aus Pommern, geboren wurde.
1
›Ich geh kaputt, gehst du mit?‹
Sponti der achtziger Jahre
Maximiliane lehnte sich fest gegen die Sandsteinmauer. Ihr Bedürfnis, sich anzulehnen, hatte sich verstärkt. Sie suchte Halt, besaß seit langem niemanden mehr, an den sie sich anlehnen konnte. Hatte sie überhaupt jemals wieder einen Halt gehabt, seit sie sich als Kind gegen das Knie des Großvaters, des alten Quindt, gedrückt hatte? Niemand fragte sie danach, auch sie sich nicht. Man hatte nie mehr gesehen, daß sie einen Baumstamm umarmte, wohl aber, daß sie sich mit dem Rücken an den Stamm eines Baumes lehnte. Joachim, ihr ältester Sohn, hatte einmal gesagt: »Der Baum fällt nicht um, du mußt ihn nicht abstützen!« Daraufhin hatte sie den Kopf in den Nacken gelegt, in die Krone des Baumes geblickt und gefragt: »Bist du sicher?« Sie hatten sich in dem schönen Einverständnis, das zwischen ihnen herrschte, zugelacht, und Maximiliane hatte gefragt: »Versprichst du mir das?« Woraufhin ihr Sohn den Baum prüfend betrachtet hatte, von Bäumen verstand er etwas. »Das verspreche ich dir!« Vertraute Spiele. ›Bist du sicher?‹ – ›Versprichst du mir das?‹
Um mit ihrer Tochter Viktoria zu reden, mußte Maximiliane einen anderen Ton finden. Mutter und Tochter hatten sich auf den höchsten Punkt des Burg-Hotels Eyckel, den Burgfried, zurückgezogen; man hatte, im Zug der nostalgischen Welle, die mittelalterlichen Bezeichnungen beibehalten, als der vom Verfall bedrohte Eyckel in ein Hotel umgebaut worden war. Hier würde niemand sie stören, hier würden sie miteinander reden können. Vorerst schwiegen allerdings beide. Maximiliane in einem Trachtenkleid, blau in blau, der Ausschnitt nicht mehr so tief, die Ellenbogen von den Ärmeln bedeckt, immer noch ein erfreulicher Anblick. Viktoria mit hochgezogenen Knien auf der breiten Brüstung in drei Meter Entfernung, ein Stoffbündel, einen unförmigen Beutel neben sich. Maximiliane unterdrückte das Bedürfnis, die junge Frau in die Arme zu nehmen, weil sie fürchtete, zurückgewiesen zu werden. Sie wartete ab. Diese abwartende Haltung hatte sie sich gegenüber ihren Kindern angewöhnt. Viktoria kaute an ihren Fingernägeln. Alles vererbt sich. Maximiliane hat diese Gewohnheit abgelegt, niemandem ist es aufgefallen. Aber man erinnert sich vielleicht noch: Auf einem der drei bemoosten Säulenstümpfe der ehemaligen Vorhalle von Poenichen, das heute im polnischen Pomorze liegt und Peniczyn heißt, im Dickicht des ehemaligen Parks hat sie zum letzten Mal an ihren Nägeln gekaut. Danach nie wieder. Seit jener Reise ins ehemalige Hinterpommern hat sie sich verändert. Sie lebt im festen Angestelltenverhältnis im Burg-Hotel Eyckel, dem ehemaligen Stammsitz der Quindts; kein Wort wäre so oft zu benutzen wie das Wort ehemalig, aber es wird nicht von ihr benutzt.
Eigentümer des Hotels ist nach wie vor die Brauerei Brandes, der Name Quindt taucht weder in der adligen noch in der bürgerlichen Fassung im Prospekt auf, trotzdem kennen ihn die Stammgäste. Als ›guten Geist des Hauses‹ hat Herr Brandes Maximiliane Quint, geborene von Quindt, bei der Einweihung des Hotels engagiert.
Seit sechs Uhr früh auf den Beinen, ist Maximiliane jetzt, am späten Nachmittag, ermüdet. »Bist du gekommen, um mir mitzuteilen, daß wieder etwas kaputtgegangen ist?« fragt sie schließlich die Tochter.
»Um dir zu sagen, daß ich es versucht habe«, antwortet Viktoria. »Du hast früher immer gesagt: ›Ich kann es ja mal versuchen‹, und du hast es dann geschafft. Ich habe es auch versucht und habe es nicht geschafft. Das ist der Sachverhalt, und das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich bin ausgestiegen.«
»Warst du nicht gerade erst eingestiegen?«
»Deinetwegen habe ich das getan!«
»Ich habe dich nie beeinflußt. Du gehst deinen Weg, allerdings im Zickzack.«
»Willst du wissen, wie ich überhaupt in den Scheißladen hineingeraten konnte?«
Maximiliane blickt ihrer Tochter abwartend ins Gesicht, mit Schonung hat sie nicht zu rechnen; diese Tochter, die man von klein auf geschont hatte, weil sie dünnhäutig war, schont niemanden, noch immer sieht sie aus wie ein altgewordenes Hippiemädchen, ein Aprilkind, auf das viele Tränen gefallen sind. Irgendwas muß sie bei der Erziehung falsch gemacht haben, aber dasselbe hat sie auch bei ihren anderen Kindern schon gedacht.
Viktoria sagt, nachdem sie wieder eine Weile geschwiegen hat: »Bei eurem Familientag, als ihr diese Absteige für die Reichen eingeweiht habt und du uns mit deinem kategorischen ›Komm!‹ hierher beordert hattest, da stand ich zufällig neben jemandem, der nicht wußte, daß ich zum Clan gehöre. Er hat gesagt: ›Aus den pommerschen Quints ist nach der Flucht doch nichts Rechtes mehr geworden, aus keinem.‹«
»Hat er das so gesagt?«
»Willst du wissen, wer?«
»Nein! Ich weiß ja nicht einmal genau, was das ist: etwas Rechtes.«
»Ich auch nicht! Aber irgendwie hast du mir plötzlich leid getan. Am selben Abend habe ich das Angebot in der Industrie angenommen. Die Leute meinen doch alle nur Stellung und Besitz, sonst zählt doch nichts.«
»Von mir hast du das nie gehört.«
»Du hast zu uns gesagt: ›Stehlen ist besser als betteln …‹«
»Habe ich das gesagt?«
Viktoria zeigt ins Tal, wo man am Ufer der Pegnitz ein paar Dächer erkennen kann. »Unten im Dorf, als wir Äpfel geklaut hatten.«
»Damals ist nicht heute, Tora!«
»Ich stehle ja auch nicht. Aber ich will nicht mitmachen. Ich will nur weg.«
»Weißt du denn auch, wohin?«
»Der kommt am weitesten, der nicht weiß, wohin er geht.«
»Ich weiß nicht, wo das steht, Tora, aber es ist nicht von dir.«
»Von Nietzsche oder Sokrates. Ich weiß es nicht. Sokrates wäre besser! Er lebte in freiwilliger Armut. Diogenes und seine Schüler lebten wie Bettler.«
»Wo gebettelt wird, muß es auch jemanden geben, bei dem etwas zu erbetteln ist.«
»Du stehst auf der falschen Seite!«
»Das Leben hat nicht nur zwei Seiten, Tora, es ist sehr vielseitig.«
Als ihre Tochter nicht antwortet, fährt sie fort: »Die Stelle in diesem Werk, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, entsprach doch genau deiner Ausbildung?«
»Ich wollte für das Wohlergehen der Betriebsangehörigen arbeiten. Aber der Besitzer meinte das Wohlergehen seines Betriebes!«
»Deckt sich das nicht? Wenn es dem Betrieb ›wohlergeht‹, wie du es nennst, geht es doch auch den Betriebsangehörigen gut. Und umgekehrt. Das ist in diesem Betrieb hier genauso, nur daß es auch noch den Gästen wohlergehen soll.«
Es lag nicht in Viktorias Absicht, über das Wohlergehen des Hotels zu reden. »Du stehst auf der falschen Seite!«
»Das hast du schon einmal gesagt.«
»Du begreifst es nur nicht! Du denkst immer noch in alten Schablonen!«
Hätte Maximiliane sagen sollen, daß ihre Tochter die alten Schablonen gegen neue ausgetauscht hatte?
Sie sagt es nicht, sondern wechselt das Thema.
»Was ist mit deinem Freund?«
»Manfred? Er ist nicht mehr mein Freund. In der ersten Firma hat er seinen eigenen Posten wegsaniert. Das passiert ihm nicht ein zweites Mal. Als er nichts fand, habe ich ihm die Hälfte meiner Stelle abgetreten. Er hat der Betriebsleitung bewiesen, daß er tüchtiger ist als ich. Er hat bereitwillig eingesehen, daß die Firma im Sinne der Arbeitsplatzerhaltung Rüstungsaufträge annehmen mußte. Ich habe das nicht eingesehen. Die Firma hat mir gekündigt, und Manfred hat mir auch gekündigt. Ich bin fünf Jahre älter als er. Solche Verhältnisse haben den Vorzug, daß man sich nicht scheiden lassen muß. Unsere Abmachungen waren jederzeit kündbar. Eine dokumentenfreie Partnerschaft, du kannst es auch eine unlizensierte Beziehungskiste nennen. Er wollte mir übrigens eine Analyse bezahlen. Er hält mich für verkorkst.«
»Hat er verkorkst gesagt?«
»Er hat noch ganz andere Ausdrücke benutzt. Bei einer Analyse wären alle Fehler, die du bei meiner Aufzucht gemacht hast, herausgekommen. Er hat sich bei einem Psychoanalytiker einen Kostenvoranschlag machen lassen, mit Altersangabe und Background des Patienten. Genau den Betrag habe ich bei mir.« Sie stößt mit dem Fuß gegen den Beutel.
»In bar?«
»Geld kann gar nicht bar genug sein, das hast du doch immer behauptet.«
Maximiliane versucht, sich zusammenzunehmen, umspannt mit der rechten Hand den linken Ellenbogen, mit der linken Hand den rechten, hält sich an sich selber fest, um nicht wieder in Versuchung zu geraten, ihr Kind in die Arme zu nehmen; sie würde sich sträuben, sie ließ sich nicht anfassen, schon gar nicht von ihrer Mutter.
»Der Satz stammte vom alten Quindt«, sagt sie und, auf den Beutel zeigend: »Ist das alles, was du besitzt?«
»Man muß Ballast abwerfen, das stammt von dir, das kann ja nicht vom alten Quindt stammen. Ein paar Klamotten, mehr braucht man doch nicht.«
Viktoria blickt hinunter auf den Parkplatz, sie taxiert die Wagen. »Ich wundere mich, daß du es hier aushältst.«
»Ich wundere mich auch, aber ich bin sechzig. Irgendwo muß ich doch bleiben.«
»Früher hast du gesagt: ›Wer kein Zuhause hat, kann überall hin.‹«
»Früher.«
»Das sind doch alles Mittelklasse-Wagen und drüber.«
»Von hier oben sehen sie alle klein aus, Tora. Es kommt auf den nötigen Abstand an.«
»Wodurch sind diese Individuen, die hier absteigen, denn reich geworden?«
»Vermutlich durch Arbeit.« Maximilianes Antwort klingt wenig überzeugend.
»Glaubst du etwa, daß sie glücklich sind?«
»Einige. Geld macht ja nicht unglücklich und Armut nicht glücklich. Erinnerst du dich, als wir im Winter 1945 hier gelandet sind? Strandgut, aus dem großen Strom der Flüchtlinge und der Vertriebenen. Damals glich der Eyckel einer mittelalterlichen Fliehburg. Wir haben zu sechst in einem Raum gehaust, dessen Wände feucht waren. Ihr wart ständig erkältet, Mirkas Windeln trockneten nicht. In allen bewohnbaren Räumen hausten Quindts, adlig und bürgerlich, mit und ohne ›d‹, aus Schlesien, aus Pommern, aus Ostpreußen, aus Mecklenburg. Alle waren arm, wenn auch nicht gleich arm.«
»Aber du hast damals auf dem Dachboden getanzt!«
»Ja, das habe ich. Mit Anna Hieronimi, die aus der Lausitz stammte. Und irgendein Quint hat Jazztrompete gespielt. ›Let me stay in your eyes –‹«
Maximiliane bricht ab. Viktoria sieht sie an: »Woran denkst du?«
»Ach, Kind.«
»Das war keine Antwort, das war ein Seufzer.«
»Habe ich geseufzt? Ich bin nicht gewohnt, über mich zu sprechen.«
»Dafür bist du doch hier, um mit den Gästen zu reden.«
»Sie reden, und ich höre zu. Morgens erkundige ich mich bei ihnen, ob sie geträumt haben. Oft bekomme ich die Träume schlafwarm erzählt. Und dann gieße ich noch eigenhändig eine Tasse Kaffee ein und gehe an den nächsten Tisch. Morgens haben alle ein gutes Wort nötig.«
»Das Wort zum Sonntag!«
»Zu jedem Tag, Tora. Die Woche hat sieben Tage, der Monat in der Regel dreißig und das Jahr 365 Tage. Für mein Dasein werde ich bezahlt. Die Gäste würden mich vermissen. Auf gewisse Weise bin ich hier unabkömmlich.«
»Legst du darauf Wert?«
»Es kommt doch nicht darauf an, ob ich Wert darauf lege. Mein Büro ist eine Beschwerdestelle. Bei mir beklagt man sich, wenn ein Fensterladen klappert, wenn der Blütensaft der Linden aufs Autodach tropft, wenn die Wespen den Genuß am Pflaumenkuchen beeinträchtigen.«
»Du nimmst das nicht ernst!«
»Doch! Ich sage, daß ich ein paar Worte mit dem Wind reden werde, und wenn eine Wespe wirklich einmal zusticht, hole ich eine Zwiebel aus der Küche und behandele den Einstich eigenhändig.«
Beide Frauen blicken in die Tiefe, wo, von schattenspendenden Linden fast verdeckt, die Wagen der Hotelgäste parken; es sind nicht viele.
»Gibt es Leute, die mit einem R4 hierher kommen?«
»Es ist meine Karre.«
»Sagst du noch immer ›Karre‹? Du bist ein Snob, weißt du das?«
»Ich versuche, mich zu unterscheiden. Ich muß mich unterscheiden, auch im Wagentyp. Frau Brandes gehört zu einer anderen Klasse, und der Ober gehört auch zu einer anderen Klasse. An ihrem Auto sollt ihr sie erkennen.«
»Fühlst du dich eigentlich wohl hier?« fragt Viktoria nach einer Pause.
»Ach, Kind!« antwortet Maximiliane.
»Laß uns jetzt nicht wieder das Mutter-Kind-Spiel spielen! Ich sage nicht mehr ›Mama‹ und auch nicht ›Mutter‹, ich werde Maximiliane sagen, oder einfach ›M‹, was du unter deine Briefe schreibst.«
»Du spielst ein neues Spiel in alter Besetzung. Du hast gefragt, ob ich mich wohl fühle.«
Ein Wagen biegt auf den Parkplatz, Maximiliane unterbricht sich. »Es kommen neue Gäste, ich muß zur Begrüßung auf der Treppe stehen. Willst du zu Abend essen?«
»Im Jagdzimmer etwa?«
»Die ehemalige Kapelle dient jetzt als Restaurant.«
Viktoria lacht auf. »Typisch! Mir wird übel, wenn ich nur zusehe, was die Leute alles in sich hineinschlingen.«
»Hast du wieder deine Gastritis? Willst du ein paar Tage hierbleiben und ausspannen? Zum Ausspannen ist der Eyckel besonders gut geeignet, steht im Prospekt. Ausspannen! Früher hat man die Pferde ausgespannt.«
»Ich bin Menschen so leid!«
»Ich auch, Tora. Aber ich frage mich nicht ab, ob ich mich wohl fühle, es gibt hier so viele, die viel Geld dafür ausgeben und viel Geld dafür bekommen, ich meine für ihr Wohlbefinden, und dafür bin ich zuständig. Aber ich habe es nicht studiert wie du.«
»Beklagst du dich?«
»Nein. Bei wem sollte ich mich denn beklagen?«
»Ich denke, du glaubst an Gott.«
»Der hat es gut mit mir gemeint, nur die Zeiten waren manchmal schlecht. Der alte Quindt hielt es mit den Bäumen, und seine Frau hielt es mit den Hunden. Alles vererbt sich.«
»Ich mache mir nichts aus Tieren.«
»Das habe ich vermutet. Du bist als Kind zu oft umgetopft worden.«
»Ich bin keine Blume.«
»Nein. Du blühst nicht. Wir reden später weiter, ich muß die Gäste begrüßen, es kann spät werden.«
»Spät, später, das hast du auch früher schon zu uns gesagt!«
Um die Wendeltreppe rascher hinunterlaufen zu können, zieht Maximiliane die Schuhe aus und nimmt sie in die Hand. Die Gäste blicken ihr bereits entgegen; sie entschuldigt sich lachend. »Ich hatte mir meine bequemsten Schuhe angezogen!« Sie schlüpft in die Schuhe und damit wieder in ihre Rolle. Sie erkundigt sich, ob die Herrschaften eine angenehme Fahrt hatten. Keine Staus auf der Autobahn? Unmittelbar aus Duisburg?
Sie wird verbessert. Aus Lippstadt! Sie hat Punkte verloren, muß in der Kartei blättern und nach dem Namen suchen, der ihr entfallen ist. Zur Strafe hat dann auch der Herr aus Lippstadt ihren Namen vergessen, aber seine Frau sagt: »Bemühen Sie sich nicht, Frau Baronin, wir kennen den Weg zum Zimmer.«
Frau Quint lächelt und verspricht, den gewohnten Platz im Speisesaal reservieren zu lassen. »Die Abende sind noch kühl, obwohl diese Junitage doch unvergleichlich …« Sie bricht ab und sagt: »Ich werde Feuer im Kamin machen. Eigenhändig.« Sie wirft einen Blick auf die Uhr.
Eine Stunde war vergangen, seit sie die Stimme von Frau Brandes gehört hatte, die mit Schärfe sagte: »Sie haben sich wohl in der Hotelkategorie geirrt!« Die Antwort hierauf hatte sie nicht verstanden, hatte es aber für ratsam gehalten, einzugreifen. Sie hatte die Schwingtür zur Eingangshalle mit dem Fuß aufgestoßen und für einen Augenblick ihre Tochter erkannt, die Tür angehalten und den Atem angehalten und hatte sich erst dann eingemischt und die Frauen, die im gleichen Alter waren, miteinander bekannt gemacht. »Frau Brandes, es handelt sich um meine Tochter, Dr. Viktoria Quint«, sagte sie, und zu dieser: »Frau Brandes ist hier die Chefin.« Sie hatte sich zur Treppe gewandt und zu Viktoria gesagt: »Komm mit, Tora!«, aber Frau Brandes hatte unmißverständlich auf die Uhr geblickt, was besagen sollte: »Es ist siebzehn Uhr, Frau Quint. Sie sind im Dienst. Sie können nicht einfach fortgehen.« Und Maximiliane hatte ihrerseits unmißverständlich gesagt: »Ich habe jetzt keine Zeit, ich werde sie mir nehmen müssen. Entschuldigen Sie mich, Frau Brandes!«
Während sie mit Viktoria den Hof durchquerte, sagte diese: »Du scheinst hier unentbehrlich zu sein.«
»Ich weiß nicht, ob ich unentbehrlich bin. Ich bin unerwünscht, aber die ›Baronin‹ und der Name Quint, die sind nicht zu entbehren. Das Recht der freien Meinungsäußerung steht im Grundgesetz. Dieses Gesetz muß auch hier gelten. Darauf bestehe ich. Aber es strengt mich an.«
Inzwischen hatten sie die Treppe erreicht, und Maximiliane fügte hinzu: »Mehr als die Treppen. Aber die Treppen strengen mich auch an. Ich wiege zehn Pfund zuviel. Ich muß hier manches schlucken. ›Besser den Hecht als den Ärger runterschlucken‹, hieß es auf Poenichen. Unter vier Augen sagt Frau Brandes ›Quint‹ zu mir, und wenn Gäste anwesend sind: ›Frau Baronin‹. In beiden Fällen antworte ich mit: ›Gern, Frau Brandes.‹ Du bist die Ausnahme, die ich mir selten leiste. Es kommt nicht oft vor, daß einer von euch hier auftaucht.«
»Sie könnte deine Tochter sein. Mit welchem Recht behandelt sie dich so?«
»Mit dem Recht der Witwe Brandes. Der alte Brandes hatte vorgehabt, mit neunzig Jahren zu sterben. Eine Vorausberechnung, die nicht aufgegangen ist. Seine zweite Frau sollte ihn verjüngen, statt dessen hat sie ihn rasch altern lassen und ihm den Spaß an seinem Burg-Hotel verdorben. Vermutlich hat sie ihm das Sterben leichter gemacht als das Leben. Jetzt regiert sie hier. Sie hat das Erbe mit dem Preis ihrer Jugend bezahlt. Sie findet den Preis zu hoch.«
»Nimmst du wirklich an, daß ich hierher gekommen bin, um über diese Frau Brandes zu reden?«
Maximiliane beantwortete die Frage nicht, sie brauchte den Atem für die letzten Stufen der Treppe.
Als sie die Treppe zum zweiten Mal hinaufstieg, noch langsamer als beim ersten Mal, waren zwei weitere Stunden vergangen. Sie hatte zusätzlich an dem Tablett, auf dem eine kleine Mahlzeit für ihre Tochter stand, zu tragen.
Viktoria hatte sich in eine Jacke gewickelt und sich auf der Mauer ausgestreckt. Sie blickte der Mutter entgegen. »Ich esse keinen Bissen!« sagte sie, als sie das Tablett sah.
»Ich habe frische Pellkartoffeln gekocht. Es gibt nichts Besseres als Kartoffeln bei einer Magenverstimmung. Und bei anderen Verstimmungen. ›Pommerns Trost‹, sagte der alte Quindt, und der hatte es von Bismarck. Lassen wir uns doch trösten. Salz habe ich mitgebracht und zwei Flaschen Brandes-Bier.«
»Ich habe keine Magenverstimmung. Ich habe eine Magersucht. Eine in der Kindheit erworbene Magersucht. Du hast mich immer gelobt, weil ich so leicht war.«
»Ich mußte dich auf den Karren heben und war schwanger.«
»Ja! Du warst schwanger! Das Urrecht der Schwangeren! ›Tora braucht am wenigsten Platz am Tisch!‹«
»Wir mußten zu sechst am Tisch Platz haben, und dann kam noch Maleen, Golos Freundin, dazu …«
Sie brach ab. Sobald sie an Golo erinnert wurde, drohte sie die Fassung zu verlieren.
»Ich hätte ein Glasgesicht, habt ihr gesagt. Man könnte durch mich hindurchgucken.«
»Das kann man nicht mehr. Das Glas ist trübe geworden.«
Maximiliane wechselte den Ton, pellte derweil die Kartoffeln.
»Was hast du noch aufzuzählen?«
»›Pflegeleicht ist diese Tochter nicht.‹«
»Habe ich das gesagt? Dann wird es gestimmt haben.«
»Warum habt ihr mich Tora genannt? ›Mein törichtes kleines Mädchen.‹«
»Du hast dir den Namen selbst gegeben, als du Viktoria noch nicht hast aussprechen können. Ich wollte deinem Vater eine Freude machen, deshalb solltest du heißen wie er. Es war Krieg. Das erste, was du gehört hast, war eine Siegesmeldung. Golo hatte im Büro das Radio auf volle Lautstärke gestellt. Das hat sonst immer Martha Riepe getan, wenn Sondermeldungen durchgegeben wurden. Deutsche U-Boote hatten 38 000 Bruttoregistertonnen versenkt. Ich erinnere mich genau an diese Zahl.«
»Bruttoregistertonnen wovon? Waffen? Munition, Lebensmittel, Menschen?«
»Ich habe nicht danach gefragt.«
»Das habt ihr offenbar nie getan.«
»Und dann wurde das Bruttoregistertonnenlied im Radio gespielt. So nannte es der alte Quindt. ›Denn wir fahren gegen Engelland –‹. Da schriest du bereits.«
»Was soll das alles? Warum redest du davon?«
»Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen –. Du bist in eine Welt hineingeboren, in der alles zerstört wurde. Ich habe alle meine Kinder in den Krieg hineingeboren.«
Während Maximiliane eine Kartoffel nach der anderen mit Salz bestreute und ihrer Tochter reichte und auch selber davon aß, suchten ihre Gedanken die Nachkriegszeit ab, und ein Erlebnis aus den Marburger Jahren fiel ihr ein.
»Als man Golo und dich auf dem Schwarzmarkt am Bahnhof erwischt hat und du sagen solltest, wie du heißt, hast du gesagt: ›Tora Flüchtling.‹«
»Weil du uns immer ermahnt hast: Seid leise, wir sind nur Flüchtlinge! Tora Flüchtling! Darüber haben immer alle gelacht, auf meine Kosten.«
»Man lacht immer auf Kosten anderer, man lebt auf Kosten anderer«, sagte Maximiliane.
Tora lachte auf. »Deine Maxime! Du wirst hier doch ausgebeutet«, sagte sie, »wie viele Stunden arbeitest du denn am Tag?«
»So leicht läßt sich ein Pommer nicht ausbeuten.«
»Pommern. In jedem zweiten Satz sprichst du von Pommern.«
»Nur heute abend.«
»Als ich das letzte Mal hier war, hast du zu mir gesagt: ›Sackgassen sind nach oben hin offen.‹«
»Stimmt das etwa nicht?«
»Für dich vielleicht.«
»Ich habe immer geglaubt …« Maximiliane brach ab.
»Das ist es! Das meine ich! Du hast immer geglaubt.«
Es war über dem Gespräch dunkel geworden. Beide Frauen schwiegen. Dann sagte Maximiliane: »Damals, nach dem Krieg, gab es einen Schlager: ›Und über uns der Himmel / läßt uns nicht untergehen.‹ Das habe ich gesungen wie ein Gebet. Spürst du davon nichts, wenn du hochblickst?«
»Ich habe seit Jahren keinen Sternenhimmel mehr über mir gehabt. Bei dir ist alles einfach: oben der Himmel, unten die Erde.«
»So muß es auch bleiben. Sonst schaffe ich es nicht.«
In diesem Augenblick leuchteten die Scheinwerfer auf, mit denen das Gebäude angestrahlt wurde, die schadhaften Stellen des Fachwerks wurden sichtbar. Maximiliane blickte auf die Uhr.
Viktoria erkundigte sich: »Langweile ich dich?«
»Die Scheinwerfer müssen eine Viertelstunde früher eingeschaltet werden.«
Mitternacht war vorüber, als Maximiliane ihre Tochter in eines der Erkerzimmer brachte. Sie sagte, was sie zu allen Gästen sagte, die sie dorthin begleitete: »Gleich unter den Vögeln!« Aber diesmal fügte sie hinzu: »Damals haben ›die weißen Tanten‹ hier gewohnt. Erinnerst du dich?«
»Nein.«
»Schade. Das einzige Vermögen, das ich mir erworben habe, ist das Erinnerungsvermögen, und das will keiner von euch erben.«
»Was war mit den weißen Tanten? Etwas Besonderes?«
»Eben nicht. Sie hatten keine Kinder. Sie sind völlig in Vergessenheit geraten. Vielleicht gibt es noch ein paar weiße Leinendecken, die sie gestickt haben. Mecklenburger Frivolitäten.«
»Du gehst hier durch die Gänge, als gehörte dir dieses Gemäuer seit Jahrhunderten.«
»Der Eyckel hat Jahrhunderte lang den Quindts gehört, das kann man nicht durch einen Kaufvertrag ändern. Die Erkerzimmer sind bei unseren Gästen beliebt. Sie sind romantisch. Bei Mondlicht kann man im Tal die Pegnitz sehen, manchmal hört man den Nachtkauz rufen.« Inzwischen hatte sie einen der Fensterflügel aufgestoßen und atmete tief. Blütenduft drang herein.
»Was ist das für ein Geruch?« fragte Viktoria.
»Die Sommerlinden blühen. Man schläft gut unterm Lindenduft.«
»Sagst du das zu allen Gästen?«
»Nur, wenn die Linden blühen. In den übrigen Jahreszeiten muß ich mir etwas anderes einfallen lassen. Im Herbst, wenn der Wind die Blätter am Fenster vorbeischickt, sage ich, daß es Laubvögel seien. Die Leute können nichts beim Namen nennen.«
Mutter und Tochter blickten sich an. Maximiliane legte nun doch den Arm um ihr Kind und erschrak über die knochigen Schultern.
»Ich brauche etwas«, sagte Viktoria, »etwas, das mir gehört, zu mir gehört! Du hast immer nur gesagt: Das brauchen wir nicht. Und nun stehe ich da, bin Mitte Dreißig und weiß nicht: Was braucht man?«
Und wieder schwieg Maximiliane; die Antwort mußte von allein gefunden werden. Statt dessen legte sie den Arm fester um Viktoria, die es zuließ, die Umarmung aber nicht erwiderte. Diese Tochter fragte nur danach, was sie selber brauchte, nicht aber, was der andere vielleicht brauchte. ›Das bringt mir nichts‹ als Maxime.
Die Mutter schlug die Bettdecke zurück, das tat sie auch bei anderen Gästen, eigenhändig, sagte: »Gute Nacht!« und ließ Viktoria allein. Sie hörte noch, wie die Fensterflügel heftig geschlossen wurden.
Als Maximiliane am Ende des langen Tages in ihr Zimmer kam, fand sie auf der Fensterbank eine Botschaft vor. Jemand hatte ein großes ›M.‹ aus Walderdbeeren auf das weißgestrichene Holz gelegt. Sie aß eine Beere nach der anderen, ließ nur den Punkt hinter dem ›M‹ übrig, öffnete dann beide Fensterflügel und atmete den Lindenblütenduft ein. An wie vielen Plätzen hatten ihr schon die Linden geblüht, als wären ihr die Lindenbäume gefolgt, von Poenichen über Hermannswerder, zum Eyckel, nach Marburg, nach Kassel, nach Paris. Die Stationen ihres Lebenswegs gerieten ihr durcheinander.
2
›Was jemand tut, ist wichtig! Was jemand sagt, ist wichtig! Aber genauso wichtig ist, was jemand nicht sagt und was er nicht tut. Das zählt auch.‹
Der alte Quindt
›Jeder Einarmige ist mein Vater. Jeder, der eine Uniform trägt, ist mein Vater. Jeder Deutsche ist mein Vater. Jeder Mann. Jedermann.‹
Die Aufzählung brach an dieser Stelle ab. Lange Zeit kam Mosche Quint nicht über die ersten wortarmen Sätze hinaus. Trotzdem hatte er mit seinem Verleger in München die Herausgabe des Buches bereits besprochen, sogar der Vertrag war schon gemacht und eine Vorauszahlung geleistet worden. Das Vater-Sohn-Thema wurde von den deutschsprachigen Autoren aus der Luft gegriffen, in der es in den siebziger Jahren lag. Wo warst du? fragten stellvertretend für jene, die diese Frage nicht öffentlich stellen konnten, die schreibenden Söhne ihre Väter, die das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg mitgemacht, nicht verhindert und zumeist auch überlebt hatten. Letzteres war bei Mosche Quints Vater nicht der Fall. Dieser Sohn stellte seine Frage einem toten, ihm weitgehend unbekannten Mann. Sein ›Vaterländisches Gedicht‹, das in einigen Schullesebüchern steht, wird im Deutschunterricht gern mit einem Gedicht ähnlichen Inhalts von Hans Magnus Enzensberger verglichen, das den Titel ›Landessprache‹ trägt. Die Zeilen ›Deutschland, mein Land, unheilig Herz der Völker‹ gleichen fast wörtlich einer Zeile aus Mosche Quints Gedicht, das von Schülern und Lehrern bevorzugt wird, weil es wesentlich kürzer als das Enzensbergersche ist. Die beiden Gedichte waren etwa zur gleichen Zeit entstanden, Quint war allerdings fast zehn Jahre jünger.
Woher rührte der Name »Mosche‹ für den erstgeborenen Quint auf Poenichen? Getauft wurde das Kind 1938 auf den Namen Joachim nach seinem Urgroßvater, dem legendären ›alten Quindt‹, Freiherr und Gutsherr auf Poenichen in Hinterpommern. Zunächst benutzte seine Mutter »Mosche‹ als Kosename, später diente er ihm als Künstlername. Er selbst wußte nichts von der rührenden Liebesgeschichte, die sich im letzten Sommer vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs am Großen Poenicher See abgespielt hatte. Er hatte nie etwas von seinem Lebensretter erfahren, jenem Leutnant, der zu Schießübungen auf den Truppenübungsplatz ›Poenicher Heide‹ kommandiert worden war und in den Mittagsstunden zum See ritt, um zu schwimmen, mit der gleichen Absicht wie Maximiliane, die mit dem Fahrrad kam, den kleinen Sohn in einem Korb auf dem Gepäckträger, dazu einige Windeln für ihn, für sich selbst Äpfel und Bücher. Der Leutnant, dessen Name nicht bekannt ist, hatte ein Wimmern gehört, war ihm nachgegangen und hatte einen Weidenkorb auf dem Wasser treibend entdeckt und darin das Kind. Moses im Körbchen – Mosche. Eine Augustwoche lang hatte er mittags sein Pferd an einen Baumstamm gebunden, Maximiliane hatte ihr Fahrrad ins Gras gelegt; sie hatten sich gemeinsam über Rilkes ›Cornet‹ gebeugt, aber auch über die ›Keuschheitslegende‹ von Binding. Sie hatten miteinander gebadet, und keiner hatte nach dem Namen des anderen gefragt. Mosche in seinem Weidenkörbchen war immer dabei, und sein Vater war in Berlin unabkömmlich.
Später wurde Mosche Quint gelegentlich gefragt: Woher der jüdische Vorname? Er hatte sich bei seiner Mutter erkundigt, und sie hatte seufzend gelacht oder lachend geseufzt und »Ach, Mosche!« gesagt. Diese Liebesgeschichte war nicht groß genug gewesen, als daß man sie mit einem anderen hätte teilen können. Maximiliane war verschwiegen, leidenschaftlich verschwiegen, wie es ihre Großmutter Sophie Charlotte gewesen war, die aus Königsberg stammte und ebenfalls als junge Frau eine Affäre gehabt hatte, ebenfalls mit einem Leutnant, allerdings einem polnischen. In den Dünen von Zoppot. Eine Affäre, die ihre Folgen hatte. Längst ist über diese Geschichte Gras gewachsen, niemand lebt mehr, der auch nur entfernt davon etwas ahnte, daß sich ins deutsche Blut der pommerschen Quindts polnisches Blut gemischt hatte. Alte Geschichten der alten deutsch-polnischen Geschichte! Für Mosche Quint ist der Poenicher See eine Sehnsucht, die er von der Mutter geerbt hat, keine Erinnerung. Er hat Gedichte mit der Muttermilch zu sich genommen, das weiß er, darüber hat er ein paar Verse gemacht, die so verständlich sind, daß sie aus Anlaß des Muttertags in den Zeitungen gelegentlich als Lückenfüller abgedruckt werden können. Die wenigen Kritiker, die sich bisher mit seiner Lyrik befaßt haben, vergleichen ihn mit Wilhelm Lehmann, sprechen von Naturlyrik und beachten die engagierten Töne, die es von Anfang an gegeben hat, zuwenig.
Joachim Quint, Mosche Quint, aber auch Jocke Quint. Eine junge Schwedin, Stina Bonde, hat ihn so genannt. »Jocke!« rief sie. »Kom hit, Jocke!« Ein Klang wie Unkenruf; und sie schwamm ihm davon. Er hat diese blonde Stina nicht halten können, vielleicht auch nicht halten wollen. Sie liebten dasselbe, sie liebten beide Dalarna. Einer der Irrtümer, zu denken, es genüge, wenn man das gleiche liebt. Ihretwegen hatte er Deutschland verlassen und war nach Schweden gegangen. In den kurzen biographischen Abrissen, die auf der Rückseite seiner Gedichtbände standen, las es sich anders, da stand, daß er seines Vaters wegen sein Vaterland verlassen habe, auch das stimmte. Der dritte Grund war, daß er damals gerade Larsgårda geerbt hatte, einen kleinen Besitz in Dalarna, der dem schwedischen Zweig der Quindts gehörte; niemandem sonst war an den halbzerfallenen Holzhäusern und –hütten gelegen und an den paar Hektar Wald. Es gehörte ein Stück Seeufer dazu, was allerdings in Schweden nicht zu den Besonderheiten zählt. Quint konnte als Ausländer zeitlich unbegrenzt und unbehelligt dort leben, alle fünf Jahre mußte er einen Fragebogen ausfüllen, woraufhin seine Aufenthaltsgenehmigung verlängert wurde; eine Arbeitserlaubnis benötigte er nicht, schreiben durfte jeder. Er nahm als Deutscher an den Gemeindewahlen teil, nicht aber an den Reichstagswahlen. Er war mit der schwedischen Außenpolitik einverstanden, Unabhängigkeit von den Machtblöcken. Neuerdings wählte er die ›Miljöpartiet‹, eine kleine Partei, die er im Gespräch mit seinem Nachbarn Anders Brolund als ›Unzufriedenheitspartei‹ bezeichnete, was dem Sachverhalt nahe kam.
Larsgårda ließ sich mit Poenichen nicht vergleichen. Oder doch? Ein Stück Land, ein Seeufer, Waldwege, Bäume. Nichts war eingezäunt, Quint konnte sich frei bewegen. Das Gefühl für Eigentum war ihm nicht angeboren und nicht anerzogen. Als Kind hatte er einmal zu seiner Mutter gesagt, daß er am liebsten ein Baum sein wolle, mitten im Wald; dieser Wunsch hatte sich nur insofern geändert, als er, des besseren Überblicks wegen, heute lieber am Waldrand stehen würde. Später, wenn das Interesse an seiner Biographie wächst, wird er solche Gedanken gelegentlich zum besten geben. Man erwartet dann von einem Mann wie Joachim Quint Originalität.
Besonderer eigener Erinnerungen wegen hatte seine Mutter das Märchen vom ›Fischer un syner Fru‹ geliebt. Anna Riepe, die Köchin, hatte es ihr am Küchenherd erzählt, und sie selbst hatte es zwei Jahrzehnte später ihren Kindern, die in einem Schloß, zumindest in einem pommerschen Herrenhaus, geboren waren, weitererzählt. Joachim, der schon als Kind immer lange nachdachte, bevor er etwas fragte, hatte seine Mutter eines Abends gefragt: »Was muß man sich wünschen, wenn man schon ein Schloß hat?« Seine Mutter hatte ihn angesehen, »Ach, Mosche!« gesagt und ihn in die Arme geschlossen; sie fand immer die richtige Antwort für dieses Kind. Vieles war auch in Pommern schon abzusehen, und wenn nicht von Maximiliane, so doch vom alten Quindt. Larsgårda glich der Fischerhütte aus dem Märchen, dem ›Pißputt‹. Joachim wünschte sich nichts anderes. »Hej du!« hatte Stina gesagt, bevor sie endgültig davonfuhr. Längst besaß sie eine Villa in den Schären von Stockholm und verbrachte die Wintermonate auf Lanzarote. Er war an eine Ilsebill geraten, die einen geschäftstüchtigen Verlagsleiter geheiratet hatte. Ein Band Gedichte, das immerhin, war übriggeblieben: ›Stina vergessen‹. Er hatte sich nicht entschließen können, einen anderen Namen für den Titel zu wählen. Wer kannte in Deutschland eine Stina? Wer las schon Gedichte? Wäre er ein Maler gewesen, hätte er Stina gemalt, immer wieder gemalt, noch besser: ihr ein Denkmal errichtet.
Der Junge denkt zuviel, hatte bereits der alte Preißing gesagt, Preißing aus Berlin-Pankow, der leibliche Großvater seiner Halbschwester Edda. Die Familienverhältnisse der Quints mit und ohne ›d‹ mußten Außenstehenden immer wieder erklärt werden, was aber keiner tat, man ließ es dabei: ›Opa Preißing aus Berlin-Pankow‹; allenfalls der Ausspruch der Mutter: ›Kinder können gar nicht genug Großväter haben!‹ wurde gelegentlich erwähnt. Mit dem Satz ›Die meisten Menschen denken zu wenig‹ hatte Maximiliane damals ihren Ältesten verteidigt. Beim Nachdenken war es lange Zeit geblieben, ein nachdenklicher Junge, ein nachdenklicher Student, ein nachdenklicher Schriftsteller, der mehr dachte als schrieb. Andere handeln unbedacht, verschieben das Nachdenken auf später, auch darin unterschied sich Joachim von seinen Altersgenossen. Er war ein Beobachter. Er hatte selten selbst geangelt, wußte aber über das Angeln mehr als ein Angler, ebenso über die Jagd, über die Forstwirtschaft. Die Umweltprobleme.
Es muß bei dieser Gelegenheit an die Taufrede erinnert werden, die ihm sein Urgroßvater gehalten hatte. Der alte Quindt sprach bereits 1938 von einer ›Vorkriegszeit‹. Es wurde, vor allem von Adolf Hitler, was nach seiner Ansicht immer ein schlechtes Zeichen war, zuviel vom Frieden geredet. Er sagte wörtlich: ›Die Quindts‹ – viele Generationen durch Anhängung eines Schluß-s zusammenfassend – ›konnten immer reden, trinken und schießen, aber sie konnten es auch lassen! Wir wollen darauf trinken, daß dieses Kind es im rechten Augenblick ebenfalls können wird. Auf das Tun und Lassen kommt es an!‹
Bisher, und dieses ›bisher‹ umfaßt Jahrzehnte, hat Joachim Quint das meiste gelassen. Er ist fast vierzig.
Er ist ein ängstliches Kind gewesen, das Vertröstungen brauchte. Ein Flüchtlingskind. Ein Traum kehrt ihm immer wieder: Er hört Pferde wiehern und hört Motorengeräusch, das sich entfernt, offenbar ein allgemeiner Aufbruch, aber er kann nicht wach werden, kann nicht aufspringen von seinem Bett. Als er dann vor dem Bett steht und Schuhe und Schreibzeug und Bücher zusammenrafft, ist es draußen längst still geworden, alle sind fortgezogen, und er ist allein. Aber das Alleinsein erschreckt ihn nicht mehr, auch im Traum nicht; er stellt sich ans Fenster, blickt über den See und beruhigt sich. Er hat die Angst überwunden, er wird damit fertig, sie gehört zum Leben. In Larsgårda gibt es niemanden mehr, der ihn verlassen könnte, nachdem Stina ihn verlassen hat. Er lebt allein, über lange Zeit allerdings mit seinem toten Vater, der ihm niemals im Traum erschienen ist.
Zunächst hatte er die geplante Abrechnung mit seinem Vater, der ein Nazi gewesen war, ›Umwege zu einem Vater‹ genannt, mit dem unbestimmten Artikel seine Einstellung bereits kennzeichnend. Im Laufe des weiteren Nachdenkens und Nachforschens änderte er seine Einstellung und hielt schließlich den Titel ›Annäherung an den Vater‹ für passender. Jetzt also mit dem bestimmten Artikel, wenn auch immer noch nicht mit dem besitzanzeigenden ›meinen‹. Daß der Vater seinerseits eine Beziehung zu ihm gehabt haben könnte, hielt er für unwahrscheinlich, obwohl er der Stammhalter, der Erstgeborene war, der Namensträger. Der Höhenunterschied war groß. Ein Kind blickt zu seinem Vater auf. Aber blickt ein Vater auf sein Kind herab, wenn er so Großes im Sinn hatte wie jener Viktor Quint: die Besiedelung des deutschen Ostens? Ein Vorsatz, dem alle seine Kinder ihr Dasein zu verdanken hatten. Nicht zu vergessen, daß er den Blick nur selten von seinem Führer Adolf Hitler abgewandt hatte.
Die Überlegung, daß sein Vater ebenfalls der Sohn eines Vaters gewesen war, wurde von Joachim Quint nicht angestellt. Die Herkunft des Vaters erschien ihm nicht wichtig, obwohl doch die Antwort auf die Frage, was an Viktor Quint das Schlesische gewesen sein mochte, wichtig hätte sein können. Der Vater war das älteste einer Reihe von vaterlosen Kindern gewesen, genau wie er selbst, vieles hatte sich wiederholt, auch wenn der Erste Weltkrieg mit dem Zweiten nur bedingt zu vergleichen war, allenfalls in der knappen Formel: Krieg ist Krieg. Die beiden Mütter: beide kinderreich, beide junge Kriegswitwen. Aber konnte man die karge, übelnehmerische, zu kurz gekommene Beamtenwitwe aus Breslau, diese Pensionsempfängerin, mit Maximiliane aus Poenichen vergleichen? Mit seiner Mutter? Wie viele Vergünstigungen hatte diese von Anfang an gehabt.
Kein Satz über Breslau, kein Satz über die Schulzeit des Vaters, nichts über seinen raschen Aufstieg beim Reichsarbeitsdienst zur Zeit der großen Arbeitslosigkeit. Joachim setzte dort an, wo seine eigenen Erinnerungen einsetzten, in Poenichen. In seinen Augen war Viktor Quint ein bürgerlicher, mittelloser Quint ohne ›d‹ im Namen, dessen Vorzug es war, das Goldene Parteiabzeichen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei zu tragen und – er verwandte eine Formulierung des alten Quindt, die er als Kind gehört hatte – sein Parteibuch schützend über Poenichen zu halten. Ein Buch, das man schützend über die Welt halten konnte! Damals bestand die Welt für ihn, Joachim, ebenso wie für seine Mutter aus Poenichen.
Mit jahrzehntelanger Verspätung dachte er nun über diesen Satz nach. Ein Parteibuch hatte er nie zu sehen bekommen, auch ein Goldenes Parteiabzeichen nicht, beides war verschollen wie der Vater, mit dem Vater. Er ging davon aus, daß sein Vater den Grund gekannt hatte, dem er die Ehe mit der Erbin von Poenichen verdankte. Bei seinen langen Überlegungen, warum seine Mutter sich als Siebzehnjährige ausgerechnet diesen Viktor Quint ausgesucht und bald darauf geheiratet hatte, war er zu dem Ergebnis gekommen, daß sie Poenichen nicht hatte verlassen wollen und daß Viktor Quint in Berlin am Reichssippenamt unabkömmlich war. Daß sie ihn und nicht seine Abwesenheit geliebt haben könnte, blieb ihm ebenso unvorstellbar wie allen anderen, die weniger lange darüber nachgedacht hatten. Würde er sich bei seiner Mutter nach dem Grund dieser Eheschließung erkundigen, würde sie vermutlich mit ›Ach, Mosche!‹ antworten; er unterließ die Frage nach den Gefühlen, sie schien ihm im übrigen nicht allzu wichtig zu sein. Damals pflegten die Menschen zu heiraten und sich fortzupflanzen, es war allgemein üblich; wer es nicht tat, galt als alte Jungfer oder als Hagestolz, beides komisch und bemitleidenswert. Er selbst brachte Liebe und Ehe nicht miteinander in Verbindung, er lebte als Single.
Sein Vater war ein eingeheirateter Quindt, von dieser Voraussetzung ging er aus. Um ein richtiger Quindt zu sein, fehlte ihm mehr als das ›d‹ im Namen und der Adelstitel. Er tauchte auf Poenichen auf und verschwand wieder, trug eine Uniform, trug Reitstiefel, häufig auch eine Reitgerte; ein Mann, bei dessen Anblick er gezittert und gestottert hatte. Steh still! Sieh mich an! Stottere nicht! Und er, dieses Kind, an Befehle nicht gewöhnt, hatte gezittert und hatte gestottert, sobald er vor seinen Vater kommandiert wurde. Er hatte den Anforderungen, die der Vater an seinen erstgeborenen Sohn stellte, nur in den rassischen Merkmalen entsprochen, er war großgewachsen, schlank, dazu blond und blauäugig, wie es den Idealen der Zeit entsprach: nordisch. Inzwischen hatte er das Blonde und Blauäugige weitgehend verloren, das Haar war nachgedunkelt, die Augen eher grau, aber mit diesem weiten Blick, den man bei Nordländern oft wahrnimmt. Im Gegensatz zu seiner Mutter war er laut schreiend zur Welt gekommen, dazu mit geballten Fäusten; in Augenblicken der Erregung ballt er auch jetzt noch die Hände zu Fäusten, zumindest darin seinem Vater ähnlich. Er war ein furchtsames Kind, auch dies im Gegensatz zu seiner Mutter, die im Urvertrauen zu Poenichen und zu dem alten Quindt aufgewachsen war. Von dem kindlichen Stottern ist eine kleine Sprachhemmung zurückgeblieben. Sie wird nur selten wahrgenommen, da sie sich allenfalls in einer zögernden Sprechweise äußert. Die Pausen zwischen Rede und Gegenrede fallen etwas länger aus, daher wirkt das, was er sagt, besonnen. Einer jener glücklichen Fälle, wo eine Fehlentwicklung der Kindheit sich später als Vorteil erweist. Auch diese Erkenntnis kommt ihm beim Nachdenken.
Als Kind hat er vor dem, was ihm fremd war, zunächst die Augen verschlossen. Eine Angewohnheit, die vom Vater beanstandet wurde. Mach die Augen auf! Woraufhin das Kind die Lider mit aller Kraft gehoben und den Vater mit aller Kraft so lange unverwandt angeblickt hatte, bis dieser als erster den Blick wegnahm. Auch davon ist etwas zurückgeblieben. Er sitzt oft mit gesenkten Lidern, um dann plötzlich den Blick mit verstärkter Aufmerksamkeit auf sein Gegenüber zu richten, womit er häufig Unsicherheit verursacht.
Auch nach der Ankunft seiner Geschwister blieb der Vater vornehmlich an dem Stammhalter interessiert. Das Wort ›Ankunft‹ muß hier benutzt werden, weil es sich nur in zwei Fällen um die natürliche Geburt von Geschwistern gehandelt hatte: zunächst Golo, sein ungestümer Bruder, der mit siebzehn Jahren tödlich verunglückte, dann, plötzlich und unerwartet, die bereits dreijährige Edda, die auf nie erklärte Weise ›Kuckuck‹ gerufen wurde; für diese Schwester hatte er sich nie interessiert, über ihre illegitime Herkunft wußte er nichts. Dann Viktoria, die Schwester, die ihm am nächsten stand, die mehrere Monate bei ihm in Larsgårda gelebt und ihre Dissertation über die Glückseligkeit geschrieben hatte. Die Kenntnis, daß seine jüngste Schwester Mirka einen Soldaten der sowjetischen Armee zum Vater hatte, verdankte er nicht etwa seiner Mutter, sondern der Bildunterschrift in einer illustrierten Zeitung, die Edda ihm voller Empörung – ›Hätte Mutter uns darüber nicht aufklären müssen?‹ – zugeschickt hatte.
In einem umfassenden Sinne waren alle fünf Kinder unter den Fittichen ihrer Mutter aufgewachsen, unterschiedslos; nur dann, wenn sie Bevorzugung für richtig hielt, hatte sie ihre ganze Liebe dem bedürftigsten Kind zugeteilt.
Mach die Augen auf! Sieh mich an! Dreißig Jahre nach seinem Tod haben die väterlichen Befehle noch Gewalt über den Sohn. An die eine Wand seines Zimmers hat er die Vergrößerung eines Fotos seines Vaters gehängt, an die gegenüberliegende Wand in gleicher Größe eine Fotografie Adolf Hitlers, beide in Uniform. Der Führer und der Verführte. Zwischen den beiden geht Joachim Quint hin und her, vier Schritte jeweils, der Raum ist klein. Einmal Auge in Auge mit dem Vater, das andere Mal Auge in Auge mit Hitler. Einen ganzen schwedischen Winter lang. Durch die starke Vergrößerung der Fotografien haben sich die Konturen aufgelöst, die Gesichter wirken verschwommen. Daran änderte sich auch dann nichts, als er nach Falun fuhr, zwei Atelierlampen kaufte und deren Scheinwerfer auf die beiden furchterregenden Gesichter richtete.
Diese erste Phase des Hineinsehens wurde abgelöst von einer langen Phase des Nachforschens, bis er sich dann endlich auf den Vater einschrieb, wie man sich auf ein Ziel einschießt.
Für seine Nachforschungen stand ihm zunächst nichts weiter zur Verfügung als das sogenannte ›Kästchen‹. Dieses Kästchen mit den Reliquien! In Poenichen hatte es auf dem Kaminsims gestanden und war ihm überantwortet worden, als sie auf die Flucht gingen. Ein Ausdruck, der allgemein üblich ist: auf die Flucht gehen, obwohl die Poenicher Gutsleute doch mit Treckern, Pferde- und Ochsengespannen aufgebrochen waren. In diesem Elfenbeinkästchen hatte man zunächst die Hinterlassenschaft von Achim von Quindt aufbewahrt, die seinen Eltern und der jungen Witwe Vera 1918 von der Front zugeschickt worden war. Orden und Ehrenzeichen, soweit ein Leutnant sie erwerben konnte, der bereits mit zwanzig Jahren den, wie es hieß, Heldentod gestorben war – Achim von Quindt, der Großvater. Von dem Vater, Träger des Deutschen Kreuzes in Gold, waren keine Orden und Ehrenzeichen erhalten, nichts war an die Witwe des Vermißten, der später für tot hatte erklärt werden müssen, geschickt worden. Wohin auch, an wen? Namenlos sollte er irgendwo in Berlin, nicht weit vom Führerbunker entfernt, verscharrt worden sein.
Ein Kinderbild seiner Mutter befand sich ebenfalls in dem Kästchen: die dreijährige Maximiliane vor einer der weißen Säulen der Poenicher Vorhalle, fotografiert von ihrer Mutter Vera, die später eine namhafte Fotoreporterin in Berlin geworden war. Dann die Vermählungsanzeige eben dieser Vera von Quindt, geborene von Jadow, mit Dr. Daniel Grün, alias Dr. Green, beide inzwischen verstorben, aber nicht vergessen: Seine Bücher über Verhaltensforschung haben hohe Auflagen als Taschenbücher erreicht, eine der stetig fließenden Einnahmequellen Maximilianes. Dr. Green hatte aus den Verhaltensweisen der Kinder, mit denen Maximiliane in Kalifornien zu Besuch gewesen war, am Abend vor der Abreise Zukunftsprognosen gestellt. Und Joachim hatte sich das ihn betreffende Gutachten aufschreiben lassen, schon als Kind hatte er immer alles schriftlich haben wollen. Auch dieser handschriftliche Zettel lag in dem Kästchen. ›Ein Sitzer. Er geht nur, um sich hinzusetzen, er wird früh seßhaft werden, zu Stuhle kommen. Er eckt nirgendwo an, er geht aus dem Wege. Er steht am Rande, ein Beobachter.‹ Einiges davon mochte zutreffen, im wesentlichen stimmte das Zukunftsbild nicht mit der Gegenwart überein. ›Zu Stuhle‹, dies zumindest stimmte, ein paar Holzstühle mit Strohgeflecht und hohen Lehnen, blaugestrichen, in Dalarna-Stil bemalt, zu einem Sessel hatte er es bisher nicht gebracht. Er war ein Geher, ein Waldgänger. Es gab einen Weg, den er täglich ging, eine Schneise im Wald, vierhundert Schritte hin, vierhundert zurück, sein Meditierweg.
In Poenichen hatte man alle Erinnerungsstücke, für die man keinen passenden Aufbewahrungsort fand, in dieses Elfenbeinkästchen gelegt. ›Leg es ins Kästchen!‹ Die Fotografie seines Vaters, nach der er die Vergrößerung hatte anfertigen lassen, stammte ebenfalls aus dem Kästchen. Den linken Arm zum Hitlergruß erhoben, der rechte Ärmel des Uniformrocks steckte leer in der Rocktasche. ›Er hat den Arm im Krieg verloren.‹ Wenn Joachim sich konzentrierte, konnte er diesen Satz der Mutter noch heute hören, und auch die Stimme der Urgroßmutter Sophie Charlotte, die fragte: ›Welchen Arm?‹ Erst sehr viel später hatte er seine Mutter gefragt, ob man den Arm nicht suchen könnte. Die Erinnerung an den Fünfjährigen, der solche Fragen gestellt hatte, rührte ihn und auch der Gedanke an seine Mutter, die seine Frage mit: ›Im Krieg verliert man alles‹ beantwortet, der unverständlichen Antwort nur noch ihr ›Ach, Mosche!‹ angefügt und ihn fest in die Arme geschlossen hatte. Als ob damit alles gesagt sei. Sie hatten beide geweint, ohne daß er gewußt hätte, warum. Die Mutter, die die Feldpostbriefe des Vaters vorlas: ›Ich liege jetzt –‹ Warum lag der Vater? War er krank? Wenn man krank war, lag man doch im Bett; aber die Mutter sagte: ›Euer Vater liegt jetzt an einem Fluß, der mit D anfängt.‹
Martha Riepe, der Gutssekretärin, war es zu danken, daß die Feldpostbriefe gerettet worden waren. Sie war es, die einen Schuhkarton mit blauem Samt beklebt, die Briefe darin aufbewahrt und mit auf die Flucht genommen hatte. Erst nach mehrfacher Aufforderung hatte sie sich davon getrennt; lebenslang hat sie Viktor Quint und Adolf Hitler die Treue bewahrt. Sie hätte gewußt, welcher Fluß gemeint war, der mit D anfängt; sie hatte die Wehrmachtsberichte verfolgt und hätte jederzeit angeben können, in welchem Frontabschnitt sich Leutnant Quint befand.
Graphologische Kenntnisse hatte Joachim Quint nicht, hielt von Hilfswissenschaften auch wenig; immerhin konnte er den Feldpostbriefen seines Vaters ansehen, unter welchen Umständen sie geschrieben worden waren. Eines der ersten Wörter, das ihm auffiel, war das Wort ›unabkömmlich‹; es tauchte mehrfach auf. Ein Vater, der unabkömmlich gewesen war. Ein Schlüsselwort. Zu keiner Zeit und für keinen Menschen war er, Joachim, je unabkömmlich gewesen. Er skandierte das Wort ›un-ab-kömm-lich‹ immer wieder; er hatte sich angewöhnt, laut zu sprechen. Wer entschied über die Abkömmlichkeit und die Unabkömmlichkeit eines Menschen?
Auf seinen langen Waldgängen dachte er darüber nach. Im Sommer war er mit Turnschuhen, im Winter mit Skiern unterwegs, ein paar wortkarge Nachbarn als Gesprächspartner, eine Box mit der Nummer 72, in der mit eintägiger Verspätung regelmäßig drei Zeitungen steckten, eine schwedische, eine englische und eine deutsche, in denen er die Kommentare, nicht die Meldungen las. Er war in weltpolitischen, auch in wirtschafts- und kulturpolitischen Fragen gut orientiert. Die Box Nr. 72, ein grauer Holzkasten, war mehr als einen Kilometer entfernt an einem Pfahl neben der Straße angebracht. Einen coop-Laden konnte er mit dem Fahrrad in zwanzig Minuten erreichen, das Auto stand weitgehend ungenutzt in einem der Holzhäuser, die zu Larsgårda gehörten.